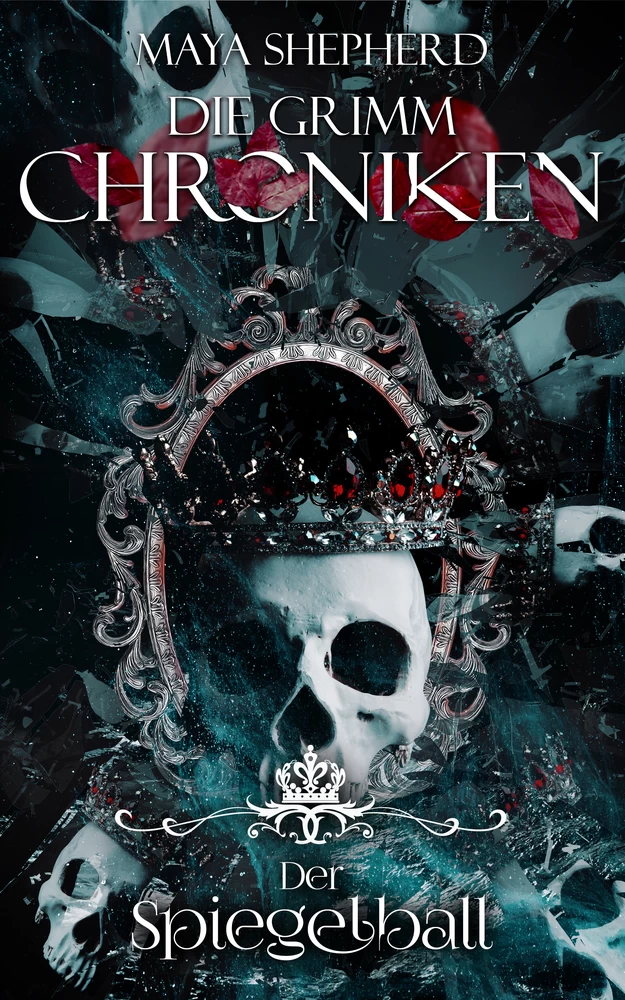Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Was zuvor geschah
Freitag, 26. Oktober 2012
13.00 Uhr
Margery, Jacob, Rosalie und Simonja befinden sich auf dem Rückweg von ihrem Gespräch mit Vlad Dracul in Schloss Drachenburg, als Margery plötzlich zusammenbricht. Sie spürt den Tod von Lavena und Arian, wodurch sie noch zwei weitere Splitter ihres Herzens verliert. Als sie den anderen gesteht, was geschehen ist, trifft dies Simonja besonders hart.
13.30 Uhr
Dorian und Maggy gelingt es, aus der Schlosskommende zu fliehen. Sie machen sich den Zauber des Medaillons von Will zunutze, um diesen und die anderen wiederzufinden.
14.00 Uhr
Will vertraut Joe an, dass Margery gespürt hat, dass Arian sich in der Gewalt der Königin befindet, aber nicht wollte, dass jemand anderes davon erfährt. Ihr Gespräch wird von dem Eintreffen von Maggy und Dorian in der Villa unterbrochen.
16.30 Uhr
Lavena und Arian begegnen in der Unterwelt dem Teufel, der sie davor warnt, dass Lavenas Licht den ewigen Schlaf der Toten stört, sodass diese zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang in die Welt der Lebenden zurückkehren können. Um sie aufzuhalten, muss Lavena sich auf dem Grund des Sees zur Ruhe legen.
17.00 Uhr
In der alten Villa am Rheinufer kommt es zu einem großen Wiedersehen, als Rosalie, Margery, Simonja und Jacob zurückkehren und dort auf Dorian, Joe, Will, Maggy und Ember treffen. Die Gruppe könnte nun stärker denn je sein, doch als Margery den anderen gesteht, dass Arian und Lavena gestorben sind, bricht Joe sein Versprechen an Will und verrät, dass Margery von Arians Gefangennahme wusste und darüber geschwiegen hat. Diese Enthüllung führt zu einem Bruch unter den Freunden, die sich nun fragen, ob sie Margery noch länger vertrauen können.
17.30 Uhr
Eva gelingt es, Rumpelstein zu überwältigen und aus dem Bunker zu fliehen, in dem sie ihren Entführer zurücklässt. Nun muss es ihr gelingen, in vollkommener Dunkelheit einen Weg aus dem unterirdischen Tunnelsystem zu finden.
18.30 Uhr
Maggy heilt mit ihrer Magie Joes Stichverletzung und gibt Will sein Medaillon zurück, da sie keine Macht über ihn haben will.
20.00 Uhr
Margery muss sich eingestehen, dass sie sich mit jedem Herzsplitter, den sie durch den Tod eines der Sieben verliert, immer mehr verändert. Es fällt ihr zunehmend schwerer, positive Gefühle wie Freude oder Mitleid zu empfinden, dafür treten alle negativen Empfindungen umso deutlicher hervor. Sie traut sich nicht, jemandem davon zu erzählen, da die anderen sich ohnehin schon von ihr verraten fühlen.
Sie hofft, dass ein Gespräch mit ihrer Mutter ihre Emotionen zu wecken vermag. Deshalb spricht sie diese in Begleitung von ihrem Vater und Jacob durch eine Spiegelung im Fluss an. Mary erscheint und kann zum ersten Mal wieder mit Dorian sprechen, nachdem sie von Elisabeth in den schwarzen Spiegel verbannt wurde. Es ist eine sehr bewegende und tränenreiche Begegnung, die Margery jedoch nicht in ihrem Inneren erreichen kann.
22.00 Uhr
Philipp muss der bösen Königin weiter aus den ›Grimm-Chroniken‹ vorlesen. Dabei kommt er an eine Stelle, in der die wahre Identität von Rumpelstein enthüllt wird. Er versucht, diesen zu schützen, da er die einzige Hoffnung auf Rettung für seine Eltern und sich selbst darstellt. Doch die Königin durchschaut sein Vorhaben und schöpft dadurch erst recht Verdacht.
Samstag, 27. Oktober 2012
1.00 Uhr
Lavena kehrt als Geist zu der alten Villa am Rheinufer zurück und warnt Margery und die anderen vor den Toten, die nun in der Zeit von Mitternacht bis zum Morgengrauen die Unterwelt verlassen können. Zudem bestätigt sie den anderen Arians Tod und stürzt damit Simonja in eine tiefe Verzweiflung.
2.30 Uhr
Maggy sucht das Gespräch mit Margery und bittet sie darum, den Zauber des geteilten Herzens rückgängig machen zu dürfen. Sie glaubt, dass es so für alle am besten wäre, da Margery sich immer mehr zum Negativen zu verändern scheint, je mehr Splitter ihres Herzens sie verliert. Margery weigert sich jedoch, den Vorschlag anzunehmen, da sie fürchtet, von den anderen im Stich gelassen zu werden.
Die beiden trennen sich im Streit, woraufhin Maggy beobachtet, wie Simonja sich allein aus der Villa schleicht und auf den Weg zum Finsterwald macht. Es gelingt ihr, sie einzuholen, und so erfährt sie, dass Simonja fest entschlossen ist, in der Schlosskommende nach Arians Körper zu suchen. Sie braucht einen Beweis, um glauben zu können, dass Arian wirklich tot ist. Maggy erklärt sich bereit, sie zu begleiten. Überraschend erhalten sie zudem Unterstützung von Will, Joe, Ember und Rosalie. Nur Margery, Dorian und Jacob bleiben unwissend in der Villa zurück.
3.00 Uhr
Es gelingt Eva, einen Weg aus dem unterirdischen Tunnelsystem zu finden, in dem Rumpelstein sie gefangen gehalten hat. Sie klingelt bei dem ersten Haus, an dem sie vorüberkommt, und informiert die Polizei. Kurze Zeit später trifft ein Beamter ein, der sie erst befragt und dann mit sich nimmt.
5.00 Uhr
Simonja, Maggy, Rosalie, Joe, Will und Ember erreichen die Schlosskommende und schaffen es, sich unbemerkt in das Gebäude zu schleichen. Unter Rosalies Führung finden sie den Raum der Wahrheit und entdecken dort Arians Körper. Zu ihrer aller Überraschung schlägt in seiner Brust ein Herz, was bedeutet, dass es noch Hoffnung für ihn gibt.
Sie beschließen, ihn mit sich zu nehmen, werden aber auf ihrer Flucht von der bösen Königin und ihren Wölfen entdeckt. Scheinbar stecken sie nun in der Falle, doch dann kommt ihnen der Geist von Arian zu Hilfe, dem es gelingt, Elisabeth zu überwältigen. Die Gelegenheit will die Gruppe nutzen, um die Königin zu entführen und Philipp aus ihrer Gewalt zu befreien.
Auf der Suche nach dem Prinzen stoßen sie im Verlies auf eine Gruppe von Jägern, die sich ihnen in den Weg stellt. Die böse Königin kommt wieder zu sich und verwendet ihre Blutmagie gegen die Eindringlinge. Sie sind gezwungen, erneut zu fliehen, und geraten dabei in eine scheinbar ausweglose Situation. Nur indem Rosalie sich opfert und allein in der Schlosskommende zurückbleibt, kann sie Joe und den anderen zur Flucht verhelfen.
Samstag,
27. Oktober 2012
Noch vier Tage

Die Ewigkeit
Samstag, 27. Oktober 2012
7.00 Uhr
Königswinter, Finsterwald, Friedhof des versunkenen Mondes
Der Wind fuhr durch die gefrorenen Blätter der Trauerweide und ließ sie winterlich knistern. Es war kalt geworden in dieser Nacht. Raureif bedeckte die Wiesen und Nebel war heraufgezogen, nachdem der Regen aufgehört hatte.
Ein einsamer Schwan zog seine Bahnen über den See, von dessen Ufer Lavena ihn betrachtete. Sein weißes Gefieder erstrahlte in ihrem Glanz und leuchtete wie ein Stern, der vom Himmel gefallen war.
Sie hatte die Arme um ihren Körper geschlungen, obwohl sie weder Kälte noch Wärme empfand. Es war mehr das Bedürfnis, sich selbst zusammenzuhalten, weil sie fürchtete, sonst wie Glas zu zerspringen – hin- und hergerissen zwischen dem, was sie wollte, und dem, was sie tun musste.
Seit Minuten, vielleicht waren es auch Stunden, blickte sie auf das trübe Wasser und versuchte sich dazu zu bringen, hineinzusteigen. Sie stellte sich vor, wie ihre Schultern bedeckt wurden und sie untertauchte, ohne ein letztes Mal Luft zu holen. Immer tiefer würde sie hinabsinken, bis sie den Grund des Sees erreichte. Dort unten gäbe es keine Geräusche mehr, weder das Wispern der Bäume noch den Ruf des Uhus. In vollkommener Stille wäre sie allein mit ihren Gedanken und könnte in einen tiefen Traum gleiten. Über ihr würden sich die Seerosenblätter schließen und sie vor der Welt verbergen. Das Schicksal würde seinen Lauf nehmen, ohne dass sie länger ein Teil davon wäre.
Der Frieden, welcher sie erwartete, war verlockend. Schon einmal hatte sie für eine sehr lange Zeit geschlafen und war frei von Sorgen gewesen. Damals hatte sie keine Wahl gehabt. Aber wenn sie nun ging, dann geschah es in dem Wissen, dass sie den Menschen, den sie am meisten auf der Welt liebte, in der Finsternis zurücklassen musste. Arian stand gegen die Sicherheit von unzähligen Menschen, deren Leben von den Toten bedroht wurde, solange Lavenas Licht die Unterwelt erhellte. Obwohl seine Seele verloren war, konnte sie den Gedanken nicht ertragen, ihn aufzugeben.
Es ging nicht einmal nur um die Menschen dieser Welt, sondern auch um die Bewohner Engellands, die sie als Mond am Himmel brauchten, um aus ihrem zweihundertjährigen Schlaf erwachen zu können. Lavena kannte jeden Einzelnen von ihnen. Sie hatte gesehen, wie Kinder ihren ersten Atemzug nahmen, wusste, welche Lieder ihre Mütter ihnen zum Einschlafen vorsangen, und konnte sich an die Ängste der Männer erinnern, von denen sonst niemand erfahren durfte. Sie waren ihr alle ans Herz gewachsen und sie fühlte sich verantwortlich für sie. Umso schwerer wog die Last in ihrer Brust.
Längst hätte sie dem Spuk ein Ende bereiten können, stattdessen harrte sie am Ufer aus und ließ die Zeit verstreichen, ohne etwas zu unternehmen. Sobald die Sonne ihre ersten goldenen Strahlen den Horizont emporschickte, wusste Lavena, dass es zu spät war.
Tiefe Schuld und großes Bedauern quälten sie, als sie sich von einem auf den anderen Augenblick in der Unterwelt wiederfand. Sie hatte versagt und nur ihretwegen waren die Toten nun munterer denn je. Während sie zuvor noch träge und ziellos durch die Weiten geirrt waren, hatte die Nacht ihre Lebensgeister geweckt.
Ihr Gang war nun aufrecht, geradezu strotzend vor Kraft. Die wenigen Stunden hatten ausgereicht, um ihnen zu demonstrieren, über welche Macht sie jetzt verfügten. Als umherwandelnde Tote konnte sie nichts und niemand mehr verletzen, dafür besaßen sie aber die Energie, um Einfluss auf die Lebenden zu nehmen. Sie waren ihnen in jeder Hinsicht überlegen und mit diesem Wissen würden sie Entsetzliches anrichten. Lavena war die Einzige, die sie aufhalten konnte.
Noch etwas hatte sich verändert: Die Toten scharten sich um das Licht des Mondmädchens wie Motten. Von allen Seiten drängten sie darauf zu. Jeder wollte in seiner Nähe sein, um nicht wieder in der Dunkelheit zu versinken. Manche streckten sogar die Hände nach ihm aus.
Lavena bekam es mit der Angst zu tun und suchte hilflos in der Menge der Gesichter nach einem einzigen.
Arian fiel es nicht schwer, sie zu finden. Er zwängte sich grob zwischen den vielen Leibern hindurch, die immer mehr zu werden schienen. Schließlich gelang es ihm, Lavena an sich zu ziehen und ihr Licht mit seinem Körper abzuschirmen, als er die Arme um sie schloss. Das löste Unwillen bei den anderen aus, die lautstark protestierten und ebenfalls versuchten, Lavena anzufassen. Sie glaubten, dass sie ein Anrecht auf das Wunder hätten, welches sie alle erweckt hatte.
Mit seinen Ellbogen, Fäusten und Tritten kämpfte Arian ihnen einen Weg aus der Masse. Dabei riss er einer Fremden den Umhang von den Schultern und warf ihn Lavena über, sodass ihr silberner Schein unter dem Stoff verborgen wurde. Sogleich fiel es den Toten schwerer, sie unter den vielen zu erkennen.
Arian und sie hielten sich an den Händen und flüchteten in die graue Wüste. Asche wirbelte unter ihren nackten Füßen auf und sie mussten aufpassen, dass sie nicht über die Risse im Boden stolperten, durch die das lodernde Feuer der Hölle zu erkennen war. Einige der anderen hasteten ihnen nach, aber schon bald verloren sie sich in der Trostlosigkeit, die ihnen von allen Seiten begegnete.
Es gab keinen Ort, an dem Lavena und Arian sich hätten verstecken können, deshalb liefen sie so lange, bis weit und breit kein anderer mehr zu sehen war. Erst dann wagten sie, anzuhalten, und fielen einander vor Erleichterung in die Arme. Arian schloss seine Hände um Lavenas Gesicht, welches seit jeher für ihn am hellsten strahlte, und legte seine Lippen auf ihre. Obwohl sie den Kuss erwiderte, fühlte er ihren Kummer. Es war ein bittersüßer Geschmack auf seiner Zunge, der ihre Liebe trübte.
Besorgt löste er sich von ihr, jedoch nur gerade weit genug, um in ihre silbernen Augen blicken zu können.
»Ich lasse nicht zu, dass die anderen dir noch einmal zu nahe kommen«, versprach er ihr, da er glaubte, dass dies der Grund für ihre Trauer war. Er ahnte nicht, welche Sorgen sie wirklich belasteten.
Lavena brachte es nicht über sich, ihm die Wahrheit zu sagen, weil sie gerade erst wieder vereint waren. Außerdem sprach er von den Toten, als würde er nicht zu ihnen gehören. Ihr tat das Herz weh, wenn sie daran dachte, dass er schon bald für immer zwischen ihnen ruhen musste.
»Es war eine lange Nacht ohne dich«, sagte sie stattdessen und schenkte ihm ein schwaches Lächeln. »Bist du in den Raum der Wahrheit zurückgekehrt?«
Alle Toten erwachten dort wieder zum Leben, wo sie gestorben waren. Bei Lavena war es die Insel Nonnenwerth gewesen. Dort hatte die Sonne sie verbrannt. Bevor sie zum Friedhof des versunkenen Mondes aufgebrochen war, hatte sie Margery und ihre Verbündeten in der Villa am Rheinufer aufgesucht, um sie vor den Geschehnissen in der Unterwelt zu warnen. Alle hatten sie herzlich empfangen, aber zugleich hatte Lavena auch den Riss in ihrer Mitte gespürt. Etwas begann sich zwischen ihnen zu verändern und sie gehörte nicht länger dazu. Vielleicht war sie nie wirklich ein Teil von ihnen gewesen, trotz des Splitters in ihrer Brust. Nun, wo sie diesen verloren hatte, fühlte sie sich nicht leichter, sondern als wäre ihr ein Stück ihres eigenen Herzens entrissen worden.
»Ja«, antwortete Arian bedrückt. Auch seine Nacht schien nicht so verlaufen zu sein, wie er es erhofft hatte. »Aber dieser Ort war nicht länger ein Gefängnis für mich. Es war ein schreckliches Gefühl, ihn nun ganz einfach durch eine Tür, die ich zuvor nicht sehen konnte, zu verlassen. Sogar mein toter Körper lag noch auf dem Marmor, wo meine Seele ihm entstiegen ist.«
Lavena umschloss seine Hände tröstend mit ihren Fingern. »Was ist danach geschehen?«
Arian senkte beschämt den Kopf. »Ich war fest entschlossen, die Königin zu töten. Sie sollte für alles büßen. Das war meine Chance, denn ich wusste, dass sie mir nichts mehr anhaben konnte. Ich war so kurz davor, dass ich ihren Hals bereits zwischen meinen Händen hielt. Wenn ich nur ein bisschen mehr zugedrückt hätte, wäre sie nun genauso tot wie wir.«
Obwohl der Plan der Vergessenen Sieben ein anderer gewesen war, nickte Lavena verständnisvoll. Arians Wunsch nach Rache war nachvollziehbar. »Was hat dich davon abgehalten?«
»Simonja«, brach es voller Erstaunen aus Arian hervor, als könne er es selbst kaum glauben. »Sie und die anderen haben sich in die Schlosskommende gewagt, um nach mir zu suchen.«
Lavena hatte bereits befürchtet, dass Simonja sich in Gefahr begeben würde. Umso deutlicher hatte sie ihr zu erklären versucht, dass es für Arian keine Rettung gab. Er war tot und niemand konnte etwas daran ändern. Aber Simonja hatte es nicht einsehen wollen, vermutlich hatte sie es nicht gekonnt. Auch sie liebte Arian.
»Haben sie dich gefunden?«
»Ja, sie hatten meinen Körper bei sich.« Sein Blick verschwamm und seine Gedanken glitten zurück in die vergangene Nacht. »In meiner Brust schlägt noch ein Herz.«
Diese Neuigkeit schockierte Lavena. »Aber wie ist das möglich? Wie kannst du leben und zugleich hier sein?«
»Ich habe den Wolf in mir getötet«, gestand er und fokussierte seine Sicht wieder auf ihr Gesicht. Es klang beinahe wie eine Entschuldigung.
»Bedeutet das, dass du als Mensch weiterleben könntest?«, hakte sie nach, um ganz sicher zu sein, dass sie ihn richtig verstand. Hoffnung schwang in ihrer Stimme mit.
Arian teilte ihre Euphorie jedoch nicht. »Selbst wenn, ein Leben ohne dich wäre für mich bedeutungslos«, sagte er in aller Härte und presste voller Verzweiflung seine Stirn gegen ihre. Er liebte sie gegen jede Vernunft. Genauso wenig wie sie ihn verlassen konnte, wollte er von ihr gehen. Lieber blieb er in der Unterwelt, als ohne sie zu sein. So aufrichtig und groß ihre Liebe auch war, so war sie dennoch ein Fluch, der sie nicht mehr freigab.
»Es gibt für uns keine Zukunft, Arian. Die hat es nie gegeben. Alles, was wir hatten, war gestohlene Zeit.«
Das Letzte, was Lavena wollte, war, Arian zu verletzen. Immer hatte sie nur das Beste für ihn gewollt und nun kam sie an den schmerzhaften Punkt, wo sie einsehen musste, dass sie nicht länger gut, sondern schädlich für ihn war. Nur seinetwegen hatte sie es nicht über sich gebracht, an den Grund des Sees zurückzukehren. Doch nun, wo sie wusste, dass er ein Leben haben würde und nicht in der Unterwelt bleiben musste, würde es ihr leichter fallen, zu gehen.
Sie wusste aber auch, dass Arian es nicht verstehen würde, wenn sie es ihm zu erklären versuchte. Jedes Argument und jede Logik würden ihn nicht erreichen. Er konnte den Gedanken nicht zulassen, ohne sie zu sein. Aber sie war überzeugt davon, dass er sich für das Leben entscheiden würde, wenn sie ihn vor vollendete Tatsachen stellte.
»Das ist nicht wahr«, widersprach er ihr stur. »Wir haben die Ewigkeit. Jetzt, wo wir durch den Tod vereint sind, kann uns nichts mehr trennen.«
Manchmal bedeutete die Ewigkeit nicht mehr als einen Tag – einen unendlich wertvollen Tag.
»Dann lass uns die Zeit, die uns bleibt, nutzen«, wisperte Lavena gegen seine Lippen, während sich ihr der Hals zuschnürte. »Halte mich in deinen Armen, als würdest du mich niemals loslassen, und küsse mich, als wäre es das letzte Mal.«
Mit der Verzweiflung eines Ertrinkenden presste Arian seinen Mund auf ihren. Er umschlang ihren Körper mit seinen starken Armen und ließ seine Finger über ihre Haut wandern, als wolle er sich jeden Zentimeter davon einprägen. Der Duft einer kalten Winternacht haftete ihrem Haar an und er sog diesen in sich auf, unfähig, die Sehnsucht abzuschütteln, die mit ihm einherging. Ihre Beziehung hatte immer nur aus Verlust bestanden. Es war ein Kommen und Gehen, ohne die Aussicht, je für immer zusammen sein zu können. Aber nun war das Ende erreicht. Der Punkt, an dem es kein Morgen oder kein nächstes Mal geben würde.
Obwohl Arian die Warnung des Teufels gehört hatte, weigerte er sich, diese zu akzeptieren, sondern beschuldigte ihn der Lüge. Er wusste, dass die Toten keine Ruhe finden konnten, solange Lavena in der Unterwelt blieb. Aber es war leichter, dem Teufel nicht zu glauben, als ihm zu vertrauen.
Tief in seinem Inneren kannte er sein Mondmädchen jedoch gut genug, um zu wissen, dass dieses nicht riskieren würde, andere Menschen seinetwegen leiden zu lassen. Sie würde ihn verlassen und er konnte es ihr nicht einmal vorwerfen, weil sie nicht diejenige gewesen wäre, die er unsterblich liebte, wenn sie geblieben wäre. Sein Herz würde ohne sie weiterschlagen, aber es wäre gebrochen und nichts in der Welt könnte es je wieder heilen.

Keine Alleingänge mehr
Samstag, 27. Oktober 2012
9.00 Uhr
Königswinter, Villa Rheinstolz
Joe hätte sofort seine eiternde Schnittverletzung im Bauch zurückgenommen, die Maggy erst am Vortag geheilt hatte, wenn Rosalie dafür wieder bei ihm gewesen wäre. Ebenso hätte er sich eine Hand abgehackt oder sich selbst an die böse Königin ausgeliefert. Alles wäre besser gewesen als der unerträgliche Schmerz in seiner Brust.
Nie zuvor hatte er sich so gefühlt. Nicht einmal, als Maggy dem Fluch des Schlafenden Todes erlegen gewesen war. Irgendwie hatte er immer gewusst, dass sie es schaffen würde. Aber bei Rosalie konnte er sich nicht sicher sein, denn es hing nicht von ihren eigenen Fähigkeiten ab, ob sie überleben würde, sondern vor allem von Elisabeth. Er hatte nicht nur gelesen, sondern auch erlebt, zu welcher Grausamkeit diese neigte. Rosalie hatte sie verraten und das konnte eigentlich nur eines für sie bedeuten – den Tod.
Das Einzige, worauf er hoffen konnte, war, dass Elisabeth sich damit Zeit lassen würde. Sie genoss das Leid ihrer Opfer viel zu sehr, um ihnen eine schnelle Hinrichtung zu gewähren.
Der Gedanke, dass Rosalie vielleicht genau in diesem Augenblick an eine Wand gekettet oder gar genagelt worden war und mit spitzen Klingen gefoltert wurde, machte ihn wahnsinnig. Sein Innerstes krümmte sich zusammen, sodass selbst das Atmen wehtat, und er hätte am liebsten nur noch geschrien – aus voller Kehle, bis kein Ton mehr aus ihm herauskäme. Er wollte seine Fäuste gegen Stein schlagen und mit seinen Füßen immer weiter auf irgendetwas eintreten. Es war ihm gleich, ob er sich dabei verletzte, denn er würde es ohnehin nicht spüren.
Sein ganzer Körper pulsierte vor Adrenalin und sträubte sich dagegen, mit Maggy und den anderen zur Villa am Rheinufer zurückzukehren. Jeder Schritt, den er sich von Rosalie entfernte, war einer zu weit. Wenn seine Schwester und Will nicht gewesen wären, hätte er den unterirdischen Tunnel durchquert, nur um auf direktem Weg zur Schlosskommende zurückzueilen, völlig unbedacht und gegen jede Vernunft.
Immer wieder musste er daran denken, wie Rosalie das Seil mit ihrem Schwert durchschlagen hatte, welches das eiserne Tor hielt, das das Verlies von dem Tunnel trennte. Nicht einmal eine Sekunde hatte sie gezögert. Sie hatte sich geopfert, damit er und die anderen fliehen konnten.
Obwohl er schon länger wusste, dass sie nicht so böse war, wie sie ihn zu Beginn hatte glauben lassen, schockierte ihn diese enorme Selbstlosigkeit dennoch. Er wünschte, sie hätte es nicht getan. Selbst wenn das bedeutete, dass sie nun vielleicht alle Gefangene der bösen Königin wären. Zumindest wären sie dann zusammen.
Die Bäume des Finsterwaldes lichteten sich und gaben den Blick auf die verfallene Villa frei, deren Umrisse sich gegen den grauen Himmel abhoben. Joe wollte nicht dorthin zurück. Es graute ihm vor den sinnlosen Diskussionen, die ihn dort erwarteten.
In den Gesichtern der anderen konnte er sehen, wie erschöpft sie waren. Maggy hatte sich in der Schlosskommende mit ihrer Magie verausgabt und brauchte dringend etwas Erholung. Zuvor würde sie allerdings Simonjas Schussverletzung heilen und sichergehen, dass Ember außer einer Beule von den herabstürzenden Steinen keinen größeren Schaden davongetragen hatte. Will litt vermutlich unter Muskelkater, weil er als Einziger von ihnen den bewusstlosen Arian die ganze Zeit getragen hatte. Allein hätte er sein Gewicht nicht gestemmt bekommen, deshalb hatten Maggy, Ember und Joe sich damit abgewechselt, ihm zu helfen.
Joe war sich bewusst, dass auch sein Körper Ruhe brauchte, weil er sonst irgendwann zusammenbrechen würde. Aber die Vorstellung, sich hinzulegen und gar einzuschlafen, erschien ihm unmöglich. Solange er in Bewegung war, konnte er sich von den Sorgen um Rosalie zumindest etwas ablenken, aber sobald er gezwungen war, an einem Ort zu verweilen, würden sie wie Blitzschläge auf ihn niederfahren. Diesem Schmerz konnte er nicht standhalten, ohne in Tränen auszubrechen. Aber er durfte nicht weinen! Nicht, solange es noch Hoffnung für Rosalie gab. Sie brauchte ihn und er musste stark sein.
Sobald sie in den düsteren Eingangsbereich des Anwesens traten, erhob sich eine Gestalt von der Treppe, die ihnen verriet, dass ihre Rückkehr bereits bemerkt worden war. Jacob musterte jeden von ihnen, der durch die Tür trat, mit seinen intelligenten, scheinbar allwissenden Augen. Er hob erstaunt die buschigen Augenbrauen beim Anblick von Arian, als hätte er zwar geahnt, was Joe und die anderen vorhatten, aber nicht damit gerechnet, dass es ihnen tatsächlich gelingen würde. Ihm entging weder Simonjas Verletzung noch die Tatsache, dass sie mit einer Person weniger zurückkehrten, als sie aufgebrochen waren. Zu all dem sagte er nichts, sondern blieb still.
Als alle eingetreten waren und die Tür sich hinter ihnen schloss, traten zwei weitere Personen aus dem Schatten neben der Treppe: Margery und Dorian. Genau wie Jacob mussten sie darauf gewartet haben, dass die anderen wiederkamen – ungewiss, ob dies überhaupt der Fall sein würde.
Es war die Prinzessin, welche das Schweigen brach. »Wo ist Rosalie?«
Joe rechnete ihr an, dass sie das Fehlen ihrer Schwester bemerkte, dennoch betrachtete er sie voller Argwohn und suchte nach einem verräterischen Anzeichen von Erleichterung in ihrem Gesicht. Er brachte es nicht einmal über sich, die Wahrheit auszusprechen.
»Wir mussten sie in der Schlosskommende zurücklassen«, antwortete Will an seiner Stelle.
»Ohne sie hätte es keiner von uns zurück geschafft«, ergänzte Maggy, da sie es wichtig zu finden schien, Rosalies Opfer zu betonen. »Sie hat uns gerettet.«
Die anderen nickten einvernehmlich, während Margerys Miene unbewegt blieb. Zu gern hätte Joe gewusst, was ihr durch den Kopf ging. Sorgte sie sich oder gab sie sich Mühe, ihre Freude zu verheimlichen? Wenn man der Prophezeiung glauben konnte, würde eine der Schwestern die andere töten. Es käme Margery doch sicher gelegen, wenn Elisabeth das an ihrer Stelle übernehmen würde und Rosalie somit keine Gefahr mehr für sie wäre.
»Ist sie am Leben?«, fragte Dorian bestürzt. Auch wenn er Rosalie als Kind im Stich gelassen hatte, schien er sich zumindest jetzt für sie verantwortlich zu fühlen. Joe wollte ihm glauben, dass ihm auch an seiner zweiten Tochter etwas lag.
»Das war sie, als wir sie zuletzt gesehen haben«, erwiderte Will bedrückt. Er brauchte niemandem zu erklären, dass in der Gewalt der bösen Königin ein Leben am seidenen Faden hing. Dorian wusste selbst am besten, was es bedeutete, deren Gefangener zu sein.
»Wir werden nach ihr suchen, wenn wir uns mit Vlad Dracul und seinen Vampiren Zutritt zur Kommende verschaffen«, sagte Jacob den anderen zu, ehe er sie mit einem strengen Blick bedachte. »Vorausgesetzt, unser Plan lässt sich überhaupt noch in die Tat umsetzen, nachdem ihr Elisabeth vorgewarnt habt. Ist euch klar, dass ihr mit dieser unüberlegten Aktion vielleicht alles ruiniert habt?«
»Wir haben Arian gefunden und er hat eine Chance, zu überleben. Ist das nichts wert?«, blaffte Simonja ungehalten zurück. Obwohl sie Rosalie verloren hatten, bereute sie die Nacht nicht im Geringsten. Ganz im Gegenteil – sie hätte es immer wieder getan, um Arian zu retten.
Joe hingegen hätte die Zeit zurückgedreht, wenn es ihm möglich gewesen wäre. Es war nicht seine Entscheidung gewesen, zur Kommende aufzubrechen. Überhaupt war er nur mitgekommen, weil er seine Freunde nicht im Stich hatte lassen wollen. Bis jetzt konnte er sich nicht erklären, warum Rosalie so fest entschlossen gewesen war, ausgerechnet Simonja zu helfen, die ihr immer nur mit Misstrauen begegnet war. Lag es daran, dass sie die rote Macht war? Hatte Rosalie sich deshalb mit ihr gut stellen wollen? Bedeutete ihr die Prophezeiung doch mehr, als sie zugeben wollte?
»Natürlich bedeutet Arians Leben etwas«, entgegnete Jacob beschwichtigend. »Wenn es uns aber nicht gelingt, Elisabeth aufzuhalten, wird seine Rettung ihm und uns allen nur wenige Tage verschaffen, bevor alles vorbei ist. Der Spiegelball ist wahrscheinlich unsere einzige Chance, an Elisabeth heranzukommen.«
»Es kann alles so bleiben, wie wir es geplant haben«, sagte Maggy versöhnlich. »Der Ball ist erst heute Abend, bis dahin ist noch genug Zeit.«
Jacob zögerte mit einer Antwort, als ahnte er bereits, dass diese den anderen nicht gefallen würde. »Was, wenn Elisabeth bis dahin eingeweiht ist und wir in eine Falle laufen?«
Während Maggy ahnungslos die Stirn runzelte und dazu ansetzte, zu fragen, wie Jacob das meinte, verstand Joe sofort, worauf er hinauswollte.
»Rosalie würde uns nicht verraten«, brauste er zornig auf. Wie konnte Jacob es nur wagen, ihr so etwas zu unterstellen, nachdem er gerade erfahren hatte, dass sie sich für die anderen geopfert hatte? Verdiente sie nicht spätestens jetzt ihrer aller Vertrauen?
»Die Königin wird sie foltern«, gab Ember leise zu bedenken und pflichtete damit indirekt Jacob bei.
»Sie ist stark«, beharrte Joe voller Überzeugung.
Rosalie war unter Vlad Dracul aufgewachsen. Auch wenn er keine Details kannte, war er sicher, dass niemand eine schlimmere Kindheit als sie erlebt haben konnte. Das machte ihm Angst, denn umso mehr würde sie erleiden müssen, bis Elisabeth einsah, dass sie Rosalie nicht brechen konnte.
»Auch wenn ich Rosalie erst vor wenigen Stunden kennenlernen durfte, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich von Elisabeth zu irgendetwas zwingen lassen würde«, stimmte Dorian zu. Es schmerzte ihn sichtlich, dass ihm nicht mehr Zeit mit seiner Tochter vergönnt gewesen war. Erneut hatte er darin versagt, sie zu beschützen.
»Und was, wenn alles nur ein Trick war?«, platzte es aus Simonja hervor. »Was, wenn sie von Anfang an vorhatte, sich in der Kommende von uns zu trennen, und sie uns nur deshalb dorthin geführt hat?«
Ihre Anschuldigung jagte wie ein Stromschlag durch Joes Körper. »Das ergibt doch gar keinen Sinn«, schrie er mit geballten Fäusten, ohne auch nur darüber nachzudenken. »Sie hat uns gerettet!«
»Vielleicht nur, um sich unser Vertrauen zu sichern«, widersprach Simonja ihm unnachgiebig. »Erinnere dich doch mal daran, wie sie uns davon abhalten wollte, Elisabeth gefangen zu nehmen. Kam dir das nicht verdächtig vor?«
Auch wenn Joe Rosalie in diesem Punkt nicht hatte verstehen können, hatte er deshalb nicht an ihren Absichten gezweifelt. »Letztendlich hat sie recht behalten, oder nicht? Wir konnten die böse Königin nicht kontrollieren! Wenn wir direkt auf Rosalie gehört und einfach die Flucht ergriffen hätten, wäre sie jetzt noch bei uns. Sie hat sich für unseren Fehler geopfert!«
»Joe«, sprach Ember ihn eindringlich an. »Ich weiß, dass es so aussieht und du unbedingt daran glauben möchtest, dass sie einen guten Kern hat, aber wenn du ehrlich zu dir selber bist, musst du zugeben, dass diese Selbstlosigkeit nicht unbedingt zu ihr passt. Abgesehen von dir, hat sie zu keinem von uns eine engere Bindung. Warum sollte sie dann ihr Leben für unseres riskieren?«
Ihre Worte stachen in sein Innerstes und trafen einen wunden Punkt, denn sosehr er sie auch liebte, war ein letzter Zweifel geblieben. Er hatte ihr zwar verziehen, dass sie ihn schon einmal hintergangen hatte, aber es nicht vergessen. Konnte all das, was seitdem zwischen ihnen gewesen war, zu ihrem Spiel gehören? Hatte sie ihn wirklich nur benutzt, um an Margery und die anderen heranzukommen?
Wenn man es logisch betrachtete, lag es im Bereich des Möglichen, aber Joe dachte nicht logisch, sondern mit dem Herzen. Er hatte gespürt, dass etwas zwischen ihnen war. Auf dieses Gefühl musste er sich nun verlassen.
Vehement schüttelte er den Kopf. »Wir haben alle gesehen, wie sie Jäger und Wölfe getötet hat, um uns zu beschützen. Seite an Seite haben wir mit ihr gekämpft.«
Verzweifelt blickte er von einem zum anderen, um unter ihnen jemanden zu finden, der genauso für Rosalie einstand, wie er es tat. Doch Ember und Simonja waren voller Misstrauen und Will und Maggy hatten die Blicke gesenkt, als wagten sie es nicht, ihm in die Augen zu schauen. Seine Aufmerksamkeit richtete sich auf Margery, die nur dastand und schwieg, so als ginge sie das alles gar nichts an. Als wäre es nicht ihre Schwester, die sich in der Gewalt der Königin befand.
»Hast du dazu keine Meinung?«, fuhr Joe sie vorwurfsvoll an. »Ist sie dir so gleichgültig oder bist du vielleicht sogar froh darüber, dass sie nun weg ist?«
Margery zuckte zusammen und bemerkte, wie sich plötzlich alle Augen auf sie richteten. Auch den anderen kam es nun komisch vor, dass sie so wenig gesagt hatte, wo sich doch eigentlich alles um sie drehte. Sie hatte weder ihre Sorge um Rosalie noch ihre Freude darüber, dass Arian noch am Leben war, zum Ausdruck gebracht.
»Warum sollte ich irgendetwas sagen, wenn ihr mich ohnehin schon längst verurteilt habt?«, erwiderte Margery ruhig. Es war ungewohnt, sie so gefasst, beinahe emotionslos, zu erleben. Nur eine Spur Enttäuschung schwang in ihrer Stimme mit. »Ich könnte in Tränen ausbrechen, aber ihr würdet sie mir nicht mehr glauben. Wenn ich nichts sage, werft ihr mir Gleichgültigkeit vor. Ganz gleich, was ich tue oder nicht tue, ihr vertraut mir nicht mehr.«
»Das ist nicht wahr«, rief Ember verletzt und eilte Margery entgegen. Sie umschloss deren Finger mit ihren Händen und schaute ihr in die Augen, um sie sehen zu lassen, wie viel sie ihr immer noch bedeutete. »Ich vertraue dir!«
Embers Nähe rief bei Margery nicht die erwartete Reaktion hervor, denn diese blieb distanziert. Vielleicht, weil sie wusste, dass dies nicht für alle galt.
»Vertrauen ist etwas, das man gewinnen oder verlieren kann«, entgegnete Simonja hart. »Du hast meins verspielt, als du wegen Arian geschwiegen hast.«
Maggy äußerte sich nicht, denn Margery kannte den Grund für ihr Misstrauen und sie hätte es nicht fair gefunden, diesen vor allen wie eine Anschuldigung vorzubringen.
Auch Will stellte sich nun an Margerys Seite, allerdings waren in seiner Miene ebenfalls Zweifel zu erkennen. »Es tut mir leid, wenn ich dir dieses Gefühl vermittelt habe. Aber Vertrauen beruht auf Gegenseitigkeit und es kommt mir vor, als würdest du dich immer mehr vor uns verschließen. Ein enormer Druck lastet auf dir und sicher hast du Angst, aber ich würde mir wünschen, dass du mit uns darüber sprichst.«
Es war offensichtlich, dass er immer noch an das Gute in ihr glaubte. Zwar mochte sein Bild in den letzten Tagen getrübt worden sein, aber ein Teil von ihm würde immer das Mädchen in ihr sehen, in das er sich hoffnungslos verliebt hatte.
Tränen traten in Margerys Augen, die tief aus ihrem Inneren zu kommen schienen, als wären sie lange dort zurückgehalten worden. »Ihr seid in dieser Nacht ohne mich gegangen. Keiner von euch hat mir genug vertraut, um mich einzuweihen. Ihr habt mich ausgeschlossen.«
»Wundert dich das?«, entgegnete Simonja argwöhnisch. »Du hast klar zum Ausdruck gebracht, dass du nicht bereit warst, irgendetwas für Arian zu riskieren. Er war dir nicht mehr wichtig genug, weil der Teil deines Herzens in ihm bereits tot war. Deshalb hatte er keinen Wert mehr für dich.«
Früher hätte dieser Vorwurf Margery verletzt, doch nun schien sie irgendeinen Weg gefunden zu haben, sich dagegen abzuschotten. Aufrecht stand sie da und blickte Simonja ohne Scheu entgegen. »In Engelland habt ihr daran geglaubt, dass ich die weiße Macht bin. Deshalb habt ihr euch mir angeschlossen. Aber keiner von euch hat je darüber nachgedacht, was es für mich bedeutet, wenn jeder immer nur das Beste von mir erwartet. Ihr scheint nicht zu verstehen, dass das, was für den einen das Beste ist, für den anderen einen Nachteil bedeuten kann.«
Zum ersten Mal gewährte sie den anderen einen Einblick darauf, welche Last sie jeden Tag allein zu tragen hatte. Erwartungen und Verantwortung wogen schwerer als ein Sack Steine.
»Wenn ich nur Margery wäre, hätte nichts mich davon abhalten können, meinen Freunden in der Not beizustehen. Aber was würde dann aus Engelland? Wer würde sich für das Schicksal unserer Heimat einsetzen, wenn ich nur noch an mich denken würde? Ich war nie nur die Tochter, die Schwester oder die Freundin von irgendjemandem, sondern wurde als weiße Macht geboren. Es ist meine Aufgabe, mich der Dunkelheit entgegenzustellen, welche die Welt bedroht. Der Krieg der Farben hat noch nicht begonnen, sondern steht uns erst noch bevor.«
Dorian legte Margery tröstend eine Hand auf die Schulter. Es tat ihm leid, dass er sie einem solch schweren Schicksal ausgeliefert hatte, aber er war auch stolz auf ihre Stärke. Endlich schien sie die Rolle, welche ihr in dieser Geschichte zugeschrieben worden war, zu akzeptieren. Sie versteckte sich nicht mehr hinter anderen, sondern war bereit, eigene Entscheidungen zu treffen, auch wenn diese ihr nicht die Zustimmung aller einbrachten.
Selbst Joe musste anerkennen, dass ihre Rede ihn beeindruckt hatte. Rosalie war eine Kriegerin, aber Margery eine Königin. Doch die Vergangenheit hatte gezeigt, dass so mancher Herrscher an der Macht, die durch seine Hände floss, zerbrochen war. Gute Absichten führten nicht immer zu guten Taten. Der größte Fehler, den ein Herrscher machen konnte, war, zu glauben, dass er unfehlbar sei. Dann wurde aus einem guten Menschen schnell ein Diktator, der nicht mehr sehen konnte, welches Leid er anderen zufügte.
War es das, was auch aus Margery werden würde, wenn sie niemanden mehr an ihrer Seite hätte, der den Weg mit ihr ging?

Eine dunkle Vereinbarung
Samstag, 27. Oktober 2012
9.00 Uhr
Bonn, Schlosskommende Ramersdorf
Seit Stunden lief Rosalie in dem Salon mit dem prasselnden Kaminfeuer auf und ab. Mehrfach schon hatte sie die einzelnen Latten der hölzernen Wandvertäfelung gezählt, während ihre Schritte von dem Marmorboden widerhallten. Voller Ungeduld hatte sie immer wieder zu der großen Flügeltür gestarrt und darauf gewartet, dass sie sich öffnete. Ihre Nerven waren zum Zerreißen gespannt und sie lauschte auf jedes noch so kleine Geräusch.
Durch die Fenster konnte sie beobachten, wie die Nacht vom Tag abgelöst wurde. Sie blickte auf den Apfelgarten hinaus, dessen goldene Früchte wie Sterne in dem Nebel funkelten. Die Gäste des Spiegelballs wären davon beeindruckt und würden es für eine prachtvolle Dekoration halten. Sie ahnten nicht, dass nur ein Biss für sie tödlich enden würde.
Hin und wieder ließ Rosalie sich in einen der hohen Lehnstühle sinken, die um einen länglichen Tisch platziert waren. Dann vergrub sie ihr Gesicht in ihren Händen und ließ ihre Gedanken wandern. Diese glitten jedoch immer wieder zu demselben unglücklichen Moment zurück, den sie am liebsten vergessen hätte. Sie ertrug es nicht, sich der Erinnerung zu stellen, und stand deshalb jedes Mal wieder auf, nur um erneut ruhelos durch den Raum zu tigern. Ihr war bewusst, dass sie vor dem, was sie getan hatte, nicht davonlaufen konnte, aber sie wollte zumindest nicht mehr daran denken.
Ich liebe dich, hatte Joe zu ihr gesagt, bevor er sie geküsst hatte. War ihm bewusst gewesen, wie viel diese drei Worte einem Mädchen bedeuteten, das sich von aller Welt ungeliebt fühlte?
Bevor sie ihm begegnet war, hatte sie geglaubt, dass niemals jemand sie lieben könnte, und sich damit abgefunden. Es war sogar einfacher, wenn man allein war. Aber dann war er gekommen und hatte alles durcheinandergewirbelt und auf den Kopf gestellt. Wenn sie mit ihm zusammen war, wusste sie manchmal nicht mehr, wer sie selbst war.
Wie konnte ihr die Meinung eines einzelnen und zudem unbedeutenden Menschen derart wichtig sein? Sie waren so verschieden, dass sie von zwei unterschiedlichen Planeten hätten stammen können, aber dennoch gab es Momente, in denen Rosalie sich ihm im Herzen verbunden fühlte. In seinen Augen spiegelte sich manchmal der Schmerz, ohne dass er darüber sprach. Nur jemand, der das Gleiche empfunden hatte, konnte es erkennen.
Plötzlich war es ihr nicht mehr wichtig gewesen, was in der Vergangenheit gewesen war oder was sie in der Zukunft erwartete, sondern es war ihr nur noch um ihn gegangen. Eine ungeheure Macht hatte in ihrem Lächeln gelegen, mit dem sie ihn anstecken konnte. Ihre Hände waren magisch gewesen, weil er sich so sehr nach ihrer Berührung sehnte. Sie hätte gern behauptet, dass es ihre Lippen gewesen waren, die ihn verzaubert hatten, aber es war genau andersherum gewesen. Joe hatte sie für sich eingenommen und die Mauern, die sie um ihre Seele errichtet hatte, zum Einsturz gebracht.
Sie liebte ihn. Sie liebte ihn so sehr, dass es wehtat. So sehr, dass sie es nicht ertragen hätte, sich im Spiegel zu betrachten. Wenn sie es ihm doch nur gesagt hätte. Nur ein einziges Mal.
Aber würde es wirklich etwas ändern? Oder würde es alles nur noch schlimmer machen? Hätte er ihr überhaupt glauben können?
Nachdem Rosalie so lange darauf gewartet hatte, dass sich endlich die Tür öffnete, fühlte sie sich unvorbereitet, als dies tatsächlich geschah.
Elisabeth trat allein ein und schloss die Tür hinter sich. Das, was sie sich zu sagen hatten, war nicht für fremde Ohren bestimmt und ging niemanden sonst etwas an. Die Flammen des Feuers ließen ihr Haar golden glänzen und ihr Gesicht erstrahlen. Die Strapazen der letzten Nacht waren ihr in keiner Weise anzusehen. Sie wirkte so entspannt, als wäre sie gerade erst aus einem langen Urlaub zurückgekehrt. Sicher trug die Vorfreude auf das, was schon bald kommen würde, dazu bei. Aber Rosalie vermutete eher, dass ein ausgiebiges Bad in einer roten Flüssigkeit dafür verantwortlich war. Die Vorstellung widerte sie an und sie konnte ihren Ärger kaum verbergen.
»Warum hast du mich so lange warten lassen?«, fuhr sie die böse Königin an.
Die seelenlosen Jäger hatten sie direkt in den Salon gebracht, nachdem sie Rosalie im Tunnel vor dem heruntergelassenen Tor gefunden hatten. Sie hatte eigentlich angenommen, dass Elisabeth sie dort bereits erwarten würde, doch stattdessen ließ diese sie die ganze Nacht schmoren.
Missbilligend schnaubte die Königin und eine kleine Zornesfalte zeigte sich auf ihrer Stirn, als sie sich auf einem der Stühle niederließ und ihre schlanken Beine übereinanderschlug. »Ich hatte einiges zu tun, nach dem Chaos, das du mit deinen Freunden hinterlassen hast.« Sie sprach das Wort aus, als handelte es sich dabei um eine ansteckende Krankheit. »Beinahe den gesamten ersten Stock hat die Aschemagd verbrannt. Kannst du dir vorstellen, wie viel Blut ich lassen musste, um das wieder in Ordnung zu bringen?«
»Ich bin sicher, du hast sogleich für ausreichend Nachschub gesorgt«, entgegnete Rosalie mitleidslos.
»Drei Mädchen waren nötig, um meinen Bluthaushalt wieder aufzufüllen«, fauchte Elisabeth vorwurfsvoll. »Die hatte ich mir eigentlich erst vor dem Ball gönnen wollen. Jetzt musste ich den Polizisten noch einmal losschicken, um mir Ersatz zu besorgen. Du glaubst gar nicht, wie schwer das in dieser erbärmlichen Welt ist. In Engelland war alles so viel einfacher.«
Rosalie musste sich ein Grinsen verkneifen, denn Elisabeth hörte sich mehr denn je wie die alte Frau an, die sie im Grunde war. Sie dachte dabei nicht an die unschuldigen Mädchen, die in dieser Nacht ihr Leben hatten lassen müssen. Sie waren nicht die ersten gewesen und würden auch nicht die letzten sein. In den Zeiten eines Krieges waren es immer die Unschuldigen, die am meisten leiden mussten.
»Zum Glück brauchst du dich nicht mehr lange damit herumzuplagen.«
Diese Aussicht sollte die Königin versöhnlich stimmen, doch das Gegenteil war der Fall. Sie grub ihre langen Fingernägel, welche spitz wie Nadeln waren, in das Holz der Tischplatte und hinterließ tiefe Kerben, während sie Rosalie wütend anfunkelte. »Ich hoffe, du hast eine verdammt gute Erklärung parat, warum du die Sieben hast entkommen lassen. Wenn nicht, sollte ich mir vielleicht überlegen, dich zu meinem nächsten Opfer zu erwählen.«
Nichts als leere Drohungen, dachte Rosalie spöttisch. Die Königin brauchte sie, das wussten sie beide.
»Was nutzen dir die Sieben ohne Margery?«
»Allein für das Feuer hätte es mir großes Vergnügen bereitet, dieser dämlichen Magd das Herz aus der Brust zu reißen«, grollte Elisabeth. »Und diese minderwertige Hexe verdient schon lange eine Strafe dafür, dass sie es gewagt hat, ihre Magie in Engelland gegen mich zu richten.«
Bevor sie sich noch weiter in Rage reden konnte, fiel Rosalie ihr ins Wort: »Du wirst deine Rache noch früh genug bekommen. Was macht schon ein Tag aus, wenn du dafür noch heute Nacht das Herz von Margery in deinen Händen halten wirst?«
Ganz ließ sich die Königin davon nicht besänftigen. »Wäre sie nicht erst recht vor meiner Türschwelle aufgetaucht, wenn ich ihre kostbaren Sieben in meine Gewalt gebracht hätte?«
»Du täuschst dich«, warnte Rosalie. »Margery ist nicht mehr ganz so weinerlich, naiv und hilflos, wie du sie in Erinnerung hast. Stell dir vor, sie hat ihren Sieben nicht einmal davon erzählt, wie du den bösen Wolf gequält hast. Diese waren natürlich empört, als sie davon erfuhren.« Ein boshaftes Grinsen legte sich auf Rosalies Züge, welches dem von Elisabeth nicht unähnlich war. Theatralisch sprach sie mit verstellter Stimme weiter: »Wie konnte sie uns das nur verheimlichen? Ist Margery überhaupt so gut, wie wir dachten? Was, wenn sie die Böse ist?« Rosalie brach kopfschüttelnd in Gelächter aus, ehe sie wieder ernst wurde. »Auch wenn Margery jetzt angreifbarer denn je ist, sollten wir nicht den Fehler machen, sie so kurz vor unserem Ziel zu unterschätzen.«
Elisabeth schmunzelte über den Bericht ihrer Enkelin. Alles schien sich zu ihren Gunsten zu entwickeln. »Du hast einige meiner Jäger und Wölfe auf dem Gewissen. Mit welchen Informationen gedenkst du, mich für ihren Verlust zu entschädigen?«, hakte sie neugierig nach.
»Ich versichere dir, dass sie nicht umsonst gestorben sind«, behauptete Rosalie zuversichtlich. »Du wirst von mir nicht nur erfahren, wer zu den Sieben gehört, sondern ich kann dir auch alles über ihren wichtigen Plan für heute Abend erzählen, mit dem sie dich zu stürzen gedenken.«
»Nur los«, forderte die Königin sie gebannt auf, doch so leicht wollte Rosalie es ihr nicht machen.
»Wir haben zwar einen gemeinsamen Feind, aber du gabst mir darüber hinaus auch ein Versprechen«, erinnerte sie Elisabeth nachdrücklich. »Gilt unsere Vereinbarung noch?«
Elisabeth rollte genervt mit den Augen, als ginge es um eine unwichtige Kleinigkeit. »Wenn dir so viel daran liegt, sollst du bekommen, was du verlangt hast.«
Rosalie nickte zustimmend. Für Elisabeth mochte ihre Forderung unbedeutend erscheinen, aber für Rosalie war sie essenziell. Ohne die Zusage der Königin hätte sie sich niemals auf eine Zusammenarbeit mit ihr eingelassen. Solange sie beide dasselbe wollten, war es nicht einmal nötig, ihr zu vertrauen.
Die nächste Stunde verbrachte Rosalie damit, jedes Geheimnis, das sie über Margery oder ihre Verbündeten erfahren hatte, zu verraten. Sie ließ keines aus und ignorierte dabei die Gewissensbisse, welche sich wie Dornen um ihr Herz legten. Immer wieder tauchte dabei das Gesicht von Joe vor ihrem inneren Auge auf. Das nächste Mal, wenn er sie sah, würde er nicht Ich liebe dich zu ihr sagen, sondern er würde lernen, wie schnell Liebe zu Hass werden konnte.

Schwarze Träume
Samstag, 27. Oktober 2012
11.00 Uhr
Bonn, Schlosskommende Ramersdorf
Das trübe Licht eines grauen Tages fiel durch das Fenster auf das Bett, in dem Eva geschlafen hatte. Sie war erst vor wenigen Sekunden erwacht und fühlte sich orientierungslos. Die Erinnerungen an die letzte Nacht und die vorangegangenen Tage in dem unterirdischen Bunker sickerten zäh wie Honig in ihr Bewusstsein. Beinahe erschien ihr alles wie ein Traum – ein böser Traum. Aber noch war dieser nicht ganz vorbei, denn sonst wäre sie bereits zurück in ihrem Internatszimmer, welches dem Begriff eines Zuhauses am nächsten kam. Sie konnte nicht verstehen, warum der Polizist sie nicht in die Obhut der Nonnen hatte übergeben können, sondern stattdessen an diesen seltsamen Ort gebracht hatte.
Es war stockdunkel gewesen, als sie vor dem herrschaftlichen Anwesen, das beinahe wie ein Schloss aussah, aus dem Auto gestiegen waren. Er hatte sie in eine Decke gehüllt, zum Schutz vor der Presse, wie er gesagt hatte. Eva fragte sich, wie diese so schnell von ihrer Entführung Wind bekommen haben sollte, wenn ihre Lehrer sie nicht einmal vermisst gemeldet hatten, aber sie wagte es nicht, das Vorgehen infrage zu stellen. Schließlich war sie nur eine Schülerin und hatte keine Ahnung von polizeilichen Ermittlungen.
Herr Klausen hatte sie schnell in das Gebäude eskortiert, welches mit seinen vielen Zimmern an ein Hotel erinnerte. In einem davon hatte er sie untergebracht und ihr kurze Zeit später einen Tee zur Nervenberuhigung serviert.
»Hier bist du sicher«, hatte er ihr versichert. »Komm jetzt erst einmal zur Ruhe und leg dich etwas schlafen. Alles Weitere besprechen wir dann morgen.«
Sie war so verängstigt und nervös gewesen, dass sie fürchtete, ihren Entführer vor sich zu sehen, sobald sie die Augen schloss. Aber die Erschöpfung musste stärker gewesen sein als ihre Furcht, denn sie konnte sich nicht daran erinnern, lange wach gelegen zu haben. Der Schlaf war ganz plötzlich über sie gekommen und wie der Himmel vor dem Fenster vermuten ließ, war sie erst Stunden später wieder aufgewacht.
Erst im Tageslicht konnte sie sehen, wie schmutzig ihre Kleidung war. Ihre Jeans war mehr braun als blau und ihr Pullover stank so entsetzlich nach Schweiß, dass sie sich ekelte. Wenn sie doch nur zu Hause gewesen wäre, eine warme und sehr lange Dusche hätte nehmen und sich danach in eine Leggins und einen weiten Pullover hätte kuscheln können. Sie sehnte sich nach dem vertrauten Geruch des alten Klostergemäuers, in dem das Internat untergebracht war, nach ihrem Zimmer mit den Dielen, die immer an denselben Stellen knarrten, und nach den beiden Regalen, die mit Büchern vollgestopft waren. Es hätte ihr geholfen, sich in die Welt eines ihrer Lieblingsbücher zurückziehen zu können, um den Gefahren ihres eigenen Lebens für eine kurze Zeit zu entkommen.
Das Heimweh war schlimmer denn je. In dem Bunker hatte sie Todesangst gehabt und es war nur noch darum gegangen, zu überleben. Aber jetzt, wo eigentlich alles wieder gut sein sollte, war es für sie sowohl unverständlich als auch unerträglich, dass sie nicht nach Hause durfte. Nur mit Mühe konnte sie das Zittern ihres Körpers unter Kontrolle halten und die Tränen wegblinzeln.
Verunsichert nahm sie den Raum, in dem sie die Nacht verbracht hatte, zum ersten Mal in Augenschein. Er hatte hohe, mit Seidentapete veredelte Wände und eine stuckverzierte Decke. Weicher Teppich bedeckte den Boden. Die Möbel sahen antik aus und glänzten in einem rötlichen Holzton. Vielleicht Mahagoni?
Zwei Türen befanden sich in dem Zimmer. Eine führte auf den Flur, durch den Herr Klausen sie in aller Eile geführt hatte. Aber was verbarg sich hinter der anderen?
Allein schon, um sich von ihrer Angst abzulenken, erhob Eva sich von dem weichen Himmelbett und schritt auf die zweite Tür zu. Die goldene Klinke ließ sich problemlos herunterdrücken und ein Licht flackerte automatisch dahinter auf.
Zum Vorschein kam ein elegantes Badezimmer mit Marmorboden und Fliesen mit einem goldenen Muster. Eine große Badewanne zog Evas Blick wie magisch an. Sie ließ sich auf dem Rand nieder und drehte den Hahn auf, aus dem sofort klares Wasser plätscherte. Es tat bereits gut, die Hände einfach nur unter den Wasserstrahl zu halten. Das Verlangen, sich die Kleidung abzustreifen und den Körper in dem warmen Nass versinken zu lassen, war überwältigend. Auch weiße Frotteehandtücher waren bereitgelegt worden, ebenso wie ein weicher Bademantel.
Kurz entschlossen stand Eva auf, um sich den Pullover auszuziehen. Doch sie erstarrte in der Bewegung, als sie sich selbst in dem großen Spiegel entdeckte, der sich hinter den beiden Waschbecken über die gesamte Wand erstreckte. Das Mädchen, welches ihr daraus entgegenblickte, sah entsetzlich aus. Nicht, dass sie sich zuvor für eine Schönheit gehalten hätte, aber nun erkannte sie sich selbst kaum wieder. Das Haar war verfilzt, stand ihr wirr vom Kopf ab und hatte jeglichen Glanz verloren. Ihr Gesicht wirkte schmaler, beinahe hohlwangig, wodurch ihre Augen wie zwei große schwarze Löcher erschienen. Die Lippen waren nicht nur rissig, sondern auch blutig. In ihrer Gefangenschaft hatte sie vor Nervosität immer wieder feine Hautfetzen abgerissen – eine schlechte Angewohnheit, die aber noch nie so schlimme Auswirkungen hinterlassen hatte.
Sie konnte nichts dagegen tun, dass nun doch Tränen über ihre schmutzigen Wangen liefen. Bebend schlang sie sich die Arme um den Körper, weil niemand sonst da war, um sie zu trösten. Das Rauschen des Wassers übertönte ihr Schluchzen und sie ließ sich niedersinken, weil sie nicht länger die Kraft fand, zu stehen.
Alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatte, brach wie ein Gewitter über sie herein. Weinend rollte sie sich auf dem kühlen Boden zusammen und wartete darauf, dass es wieder vorüberging. Die Angst hatte sie immer noch fest im Griff, solange sie nicht erfuhr, was nun mit ihr geschehen würde.
Wie lange musste sie an diesem Ort bleiben? Warum durfte sie nicht nach Hause? Wann würde ihr Leben wieder zur Normalität zurückkehren? Würde es überhaupt jemals wieder werden wie zuvor? Könnte sie sich je davon erholen oder wäre sie nun für immer kaputt?
Ein Klopfen ließ Eva zusammenfahren und sie drehte sich bestürzt zur Tür herum, auf deren Schwelle eine blonde Frau stand, die sie mit einem mitleidigen Blick bedachte.
»Ich wollte dich nicht erschrecken«, entschuldigte die Fremde sich. Dabei musste sie wegen des Wassers, das weiterhin in die Badewanne strömte, ziemlich laut sprechen. Entschlossen durchquerte sie das Zimmer und drehte den Hahn zu.
Die plötzliche Stille, die darauf folgte, war für Eva nicht weniger unangenehm als das unerwartete Auftauchen der Frau. Diese hatte sie in ihrem verletzlichsten Moment gesehen, wofür Eva sich nun schämte. Verlegen wischte sie sich mit den Händen über das Gesicht, um die Spuren ihrer Tränen zu beseitigen. Schniefend zog sie die Nase hoch, woraufhin die Frau an ihr vorbeitrat und ihr eine Rolle mit Toilettenpapier reichte.
»Bleib ruhig noch einen Moment und spritz dir etwas Wasser ins Gesicht«, sagte sie mit sanfter Stimme. »Ich warte im Zimmer auf dich.«
Danach ließ sie Eva allein und schloss die Tür hinter sich, um ihr wenigstens etwas Privatsphäre zu gönnen.
Wer ist sie?, fragte Eva sich, als sie sich vom Boden aufrappelte und dem Rat der Fremden folgte. Ist sie von der Polizei? Oder vielleicht vom Jugendamt?
Eva war immer noch schmutzig und stank, aber sie traute sich nicht, die Frau darum zu bitten, erst baden zu dürfen, bevor sie mit ihr sprach. Vielleicht hatte diese nur wenig Zeit und außerdem wollte sie selbst unbedingt erfahren, wie es nun weitergehen würde. Ein Bad könnte sie danach sicher immer noch nehmen.
Verlegen verließ sie das Badezimmer und entdeckte die Fremde in dem Polsterstuhl, der zuvor an einem Tisch gestanden hatte, nun aber in Richtung des Bettes gedreht war.
»Setz dich zu mir«, forderte die Frau sie auf und deutete auf das Bett.
Unsicher eilte Eva an ihr vorbei und ließ sich ihr gegenüber nieder. Erst krallte sie ihre Hände in den Rand der Matratze, doch als sie sich der schwarzen Ränder unter ihren Nägeln bewusst wurde, schloss sie ihre Finger schnell zur Faust. Dabei spürte sie deutlich den prüfenden Blick der Fremden auf sich. Was mochte diese über sie denken?
»Bevor ich dir erkläre, warum ich hier bin, sollst du wissen, dass du vor nichts Angst zu haben brauchst oder dich für irgendetwas schämen musst«, sagte die Fremde einfühlsam. Sie hatte auffallend blaue Augen, die wie Aquamarine strahlten. Ihr blondes Haar fiel ihr in sanften Wellen über die Schultern. Sie trug einen eng anliegenden schwarzen Rollkragenpullover und eine dazu passende Jeans, die ihre schlanke Figur betonte.
Angesichts ihrer Schönheit fühlte Eva sich nur noch unwohler, auch wenn die Frau sich nicht anmerken ließ, dass sie sich vor ihrem Gestank ekelte. Scheu nickte Eva, als Zeichen dafür, dass sie das Gesagte verstanden hatte.
»Als Nächstes würde ich mich dir gern vorstellen. Ich heiße Elisabeth und wurde von der Polizei beauftragt, mich mit dir zu unterhalten.« Sie schenkte Eva ein aufmunterndes Lächeln. »Mir ist wichtig, zu betonen, dass dies kein Verhör ist. Alles, was du mir erzählst, ist vertraulich. Ich gebe nur die Dinge weiter, von denen du möchtest, dass die Polizei sie erfährt.«
Wieder nickte Eva stumm. Ihre Zunge war wie verknotet und ihr Hals wie zugeschnürt.
»Gibt es irgendetwas, das du brauchst, Eva?«
Sie wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Es gab so vieles, das sie brauchte – ihr Zuhause, das Gefühl von Sicherheit, einen Ausschaltknopf für ihre Gedanken … Aber nichts davon konnte Elisabeth ihr geben. Mit ihrer Frage hatte sie wohl auch eher banalere Dinge wie Essen gemeint.
»Ich würde gern ein Bad nehmen«, antwortete Eva heiser. Ihre Stimme war noch ganz schwer von den Tränen. »Kann ich etwas anderes zum Anziehen bekommen?«
Elisabeths Augen leuchteten erfreut auf, weil Eva sich nun doch dazu durchgerungen hatte, mit ihr zu sprechen. »Natürlich. Sobald wir hier fertig sind, kannst du baden und ich besorge dir Kleidung zum Wechseln. Sicher hast du auch Hunger. Es tut mir leid, dass du noch nichts zu essen bekommen hast.«
Tatsächlich verspürte Eva erst ein Knurren im Magen, als Elisabeth das Thema ansprach. Zuvor war sie mit allem anderen viel zu beschäftigt gewesen, um auch nur an Nahrung zu denken.
»Wie lange muss ich denn noch hierbleiben?«
Wo auch immer hier sein mochte.
»Das hängt davon ab, wie gut die Polizei in den Ermittlungen zu deinem Fall vorankommt. Du kannst ihnen dabei helfen, indem du mir möglichst viel erzählst, was ihnen weiterhelfen könnte. Aber ich hoffe, dass es dir bis dahin an nichts bei uns mangelt und du dich wohlfühlst.«
Bei uns. Das klang nach einer Einrichtung. War das gesamte Anwesen vielleicht ein Ort für Entführungsopfer oder Opfer anderer Gewalttaten?
»Ich habe Herrn Klausen, dem Polizisten, der mich hierhergebracht hat, gestern bereits alles gesagt, was ich weiß. Soll ich Ihnen das auch erzählen?« Die Unsicherheit war nicht nur ihrer Stimme anzuhören, sondern sprach auch aus jeder Faser ihres Körpers – ihre gekrümmte Haltung, das Zittern ihrer Hände und der verschüchterte Blick.
Elisabeth schaute sie verständnisvoll an. »Mir liegt der Bericht von Herrn Klausen selbstverständlich vor, aber manchmal hilft einem etwas zeitlicher Abstand dabei, die Dinge klarer zu sehen. Wie hast du heute Nacht geschlafen, Eva?«
»Gut«, antwortete sie irritiert.
»Hattest du irgendwelche Träume?«
Diese Frage erschien ihr noch seltsamer. »Nein. Nicht, dass ich wüsste.«
»Wie war es vor der Entführung? Hast du da viel geträumt?«
Eva verstand nicht, was ihre Träume mit der Entführung zu tun haben sollten. Aber Elisabeth blieb dabei völlig ernst. Vermutlich ging es um ihr Unterbewusstsein.
»Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mehr als andere Menschen geträumt habe. Manchmal konnte ich mich an einen Traum erinnern, oft aber auch nicht.«
»Ist dir ein Traum besonders in Erinnerung geblieben?«
»Nein«, erwiderte Eva, ohne zu zögern. Ihr entging nicht, wie Elisabeth die Mundwinkel verzog, als wäre sie mit der Antwort unzufrieden.
»Was waren es für Träume? Eher Albträume?«
»Nein«, meinte Eva völlig verwirrt. Warum waren ihre Träume so wichtig? »Zwar hatte ich schon Albträume, aber nicht häufiger als andere Träume. Ich erinnere mich auch kaum noch an einen.«
»Nicht einmal an einen einzigen?«, hakte Elisabeth skeptisch nach, so als würde Eva versuchen, irgendetwas vor ihr geheim zu halten.
Sie wollte nicht, dass Elisabeth glaubte, sie wäre nicht bereit, mitzuarbeiten. Deshalb dachte sie angestrengt nach, bis sie einen Traum fand, von dem sie erzählen konnte, auch wenn sie nicht wusste, was dieser mit ihrer Entführung zu tun haben sollte.
»Ein paar Mal hatte ich schon den gleichen oder einen ähnlichen Traum. Dabei befand ich mich in einem sehr hohen Gebäude und bin aus dem Fenster gestürzt. Während des Fallens bin ich immer aufgewacht.«
Neugierig musterte Elisabeth sie. »Ein hohes Gebäude wie ein Turm?«
»Ja, oder ein Hochhaus.«
»Was hast du dort gemacht?«
»Ich weiß es nicht. Ich war einfach dort«, erwiderte Eva aufrichtig.
»Bist du freiwillig aus dem Fenster gesprungen oder wurdest du geschubst?«
Eva versuchte, sich zu erinnern, da es Elisabeth wichtig zu sein schien. »Es tut mir leid, ich weiß es nicht mehr. Es hat für mich aber auch keine Rolle gespielt.«
»Schon gut«, besänftigte Elisabeth sie, die zu merken schien, dass ihre Fragen Eva verunsicherten. »Lass uns über deine Entführung sprechen. Du hast Herrn Klausen bereits den Mann beschrieben, der dich überwältigt hat. Könntest du das bitte für mich noch einmal tun?«
Sofort tauchte vor Evas innerem Auge wieder das furchteinflößende Bild des Mannes auf, der ihr die schlimmsten Tage ihres Lebens beschert hatte. Niemals würde sie sein Gesicht vergessen.
»Er war ziemlich klein, nicht größer als einen Meter dreißig. Dazu ging er aber auch gebückt und hatte eine Art Buckel. Dennoch war er sehr stark.« Sie fühlte sich genötigt, das hinzuzufügen, um zu erklären, warum sie ihm nicht früher hatte entkommen können. »Er hat ein ungepflegtes Äußeres mit langen, fettigen Haaren. Sie waren braun, aber mit grauen Strähnen. Ich würde ihn auf irgendetwas zwischen vierzig und sechzig Jahren schätzen. Neben seinem Schweißgestank hatte er auch Mundgeruch, der von seinen verfaulten Zähnen kam.« Verlegen senkte sie den Blick, da sie sich aktuell kaum in einem besseren Zustand befand. »Seine Kleidung erinnerte mich an die eines Obdachlosen. Sie war verschlissen und schmutzig. Er trug einen dunklen Mantel, mehr konnte ich nicht erkennen.«
»Hat er dir seinen Namen genannt?«, erkundigte Elisabeth sich. Sie hatte Evas Beschreibungen aufmerksam gelauscht und dabei teilweise sogar genickt, fast so, als habe die Polizei bereits einen Verdächtigen im Visier.
»Nein, aber er kannte meinen Namen«, antwortete Eva schaudernd. Die Vorstellung, dass der Mann sie über längere Zeit unbemerkt beobachtet haben musste, war schlimm gewesen. Sie wusste nicht, wie das möglich sein sollte, da er mit seinem Äußeren nicht gerade unauffällig war.
»Hat er dir einen Grund genannt, warum er dich entführt hat?«
Beschämt sah Eva weg. »Er hält sich für meinen Vater.«
Obwohl sie nichts für die Wahnvorstellungen dieses Verrückten konnte, fühlte sie sich dennoch schuldig. Vielleicht lag es an der Art, wie er mit ihr gesprochen hatte – so verzweifelt. Er konnte nicht verstehen, dass sie sich nicht an ihn erinnerte. Für ihn war alles, was nur in seinem Kopf existierte, vollkommen real gewesen.
Elisabeth musterte sie neugierig. »Besteht die Möglichkeit, dass er die Wahrheit sagt? Bist du vielleicht als Kind adoptiert worden?«
Eva schüttelte verstört den Kopf. Sie wusste nichts über eine Adoption. »Warum fragen Sie nicht meine Eltern danach?«
Waren diese überhaupt informiert worden? Müssten sie nicht sogar bei jeder polizeilichen Befragung anwesend sein, weil Eva minderjährig war? Ihr Verhältnis war zwar nie besonders eng gewesen, trotzdem hätte Eva sich sicherer gefühlt, wenn ihre Eltern bei ihr gewesen wären.
»Wir konnten sie bisher nicht erreichen«, erwiderte Elisabeth ausweichend. »Worüber hat dein Entführer noch mit dir gesprochen?«
»Er erzählte immer wieder von einem Ort, den er Engelland nannte. Ich dachte erst, dass er England meinen würde, aber er wurde wütend, als ich ihn darauf hinwies. Nichts von dem, was er gesagt hat, ergab einen Sinn. Ich glaube, dass er in einer Fantasiewelt lebt und gar nicht mehr weiß, was real ist.«
Obwohl Eva es nicht wollte, regte sich nun doch Mitleid für den Mann in ihr. Er war nicht nur einfach böswillig oder kriminell, sondern krank. Es wäre nicht nur für alle anderen Menschen das Beste, wenn er in eine psychiatrische Einrichtung käme, sondern auch für ihn.
Elisabeth schien das jedoch anders zu sehen. »Was hat er dir von Engelland erzählt?«, wollte sie neugierig wissen.
Warum interessierte sie sich für einen Ort, der nur in den Wahnvorstellungen eines kranken Mannes existierte?
»Er hat behauptet, dass eine böse Königin hinter mir her wäre und mir mein Herz stehlen wolle.« Evas Unglaube war nicht zu überhören. Es war lächerlich.
»Also hat er dich entführt, um dich vor der Königin zu beschützen?«, hakte Elisabeth nach, die das alles sehr ernst zu nehmen schien.
»Ja, aber das ist doch völlig verrückt«, entgegnete Eva, die es verunsicherte, dass eine erwachsene Frau wie Elisabeth sich für die Märchengeschichten eines Gestörten interessierte.
»Natürlich ist es das«, stimmte diese ihr zu, wobei sie allerdings etwas verärgert klang. Hatte Eva irgendetwas Falsches gesagt? »Bevor du dich waschen und etwas essen kannst, muss ich dich noch untersuchen.«
Elisabeth erhob sich ruckartig und schritt auf die Tür zu, als habe sie es auf einmal eilig.
Eva ging das zu schnell. »Aber der Mann hat mich nicht angerührt«, sagte sie entschieden, ohne von dem Bett aufzustehen. Vermutlich bestand der Verdacht, dass ihre Entführung einen sexuellen Hintergrund haben könnte. Auch sie hatte sich in dem Bunker davor gefürchtet, aber tatsächlich hatte der Mann sich ihr nie unsittlich genähert. Es passte auch nicht zu seinem Bild von ihr, da er sich für ihren Vater hielt.
»Das glaube ich dir«, beteuerte Elisabeth. »Dennoch muss ich dich bitten, einer Untersuchung zuzustimmen. Es handelt sich dabei um reine Routine und gehört zum gängigen Verfahren. Ich versichere dir, dass es ganz schnell gehen wird und nicht wehtut.«
Obwohl Eva Elisabeth erst seit wenigen Minuten kannte, hatte sie bereits Vertrauen zu ihr gefasst und zweifelte nicht an ihren Worten. Sie wollte alles tun, um der Polizei dabei zu helfen, den Täter gefangen zu nehmen. Wenn eine Untersuchung dazugehörte, würde sie diese über sich ergehen lassen.
»In Ordnung«, willigte sie ein und folgte Elisabeth aus dem Zimmer in den Flur, den sie letzte Nacht nur im Dunkeln gesehen hatte. Doch auch bei Tageslicht verstärkte sich der Eindruck eines Hotels. Eva kam an vielen geschlossenen Türen vorbei, während der Teppichboden ihre Schritte dämpfte.
Sie erreichten eine alte Wendeltreppe aus dunklem Holz, die sie ein Stockwerk tiefer führte. Dort kamen sie an mehreren Personen vorbei, die alle etwas Wichtiges zu tun zu haben schienen. Einige von ihnen waren Männer in dunklen Anzügen, die Eva an Mitarbeiter einer Security-Firma erinnerten. Es waren aber auch Frauen in Dienstmädchenuniformen anwesend, die von einem Raum in den anderen flitzten. Manche von ihnen trugen Blumenarrangements, Kerzen oder andere Dekoartikel mit sich. In der Luft lag der Geruch von gekochtem Essen. Es wirkte ganz, als ob ein großes Fest vorbereitet würde.
Aber am ungewöhnlichsten war, dass sich alle vor Elisabeth verneigten, sobald sie diese erblickten. Diese Geste kam Eva nicht zeitgemäß und völlig übertrieben vor. Sie wagte aber auch nicht, Elisabeth danach zu fragen.
Von einer prunkvollen Eingangshalle mit Kronleuchter und einem bunten Bodenmosaik, das einen roten Apfel zeigte, ging eine Steintreppe in das Untergeschoss hinab. Flackerndes Licht erhellte die düsteren Gänge. Die Temperatur sank augenblicklich um einige Grad und ein muffiger Gestank breitete sich aus.
Wohin führt sie mich?, fragte Eva sich stumm, während ihr ganz unheimlich zumute wurde. Befindet sich hier unten etwa das Untersuchungszimmer?
Nicht nur die Wände, sondern auch der Boden war kahl und schmutzig. An manchen Stellen waren dunkle Flecken, beinahe wie von Blut, zu erkennen. Spinnweben zogen sich über die Decke. Hier war schon lange nicht mehr sauber gemacht worden.
Ein leises Stöhnen, das aus einer der geschlossenen Türen drang, ließ Eva erschaudern. »Was war das?«, entfuhr es ihr ängstlich.
Elisabeth machte eine wegwerfende Handbewegung. »Das ist ein altes Gebäude. Da sind seltsame Geräusche keine Seltenheit, aber sie haben immer einen ganz logischen Ursprung. Wahrscheinlich wurden oben nur ein paar Stühle verschoben.«
So harmlos hatte sich das Geräusch für Eva nicht angehört. Sie war sogar sicher, dass es von einem Menschen gestammt haben musste, doch nun hörte sie nichts mehr davon.
Erst als sie vor einer der vielen Türen stehen blieben, bemerkte Eva, dass sie nicht länger mit Elisabeth allein war, sondern zwei der Sicherheitsmänner ihnen gefolgt waren. Sie hielten ebenfalls an und versperrten mit ihren Körpern den Gang, den sie gerade entlanggekommen waren, sodass es kein Zurück mehr gab.
Ängstlich versuchte Eva, Augenkontakt zu Elisabeth herzustellen, doch diese wirkte plötzlich nicht mehr so nett und einfühlsam, sondern vor allem ungeduldig. Sie deutete mit ausgestrecktem Arm auf den Raum, der sich hinter der Tür befand, und signalisierte Eva, dass sie eintreten sollte.
Evas Herzschlag beschleunigte sich und sie bekam ganz feuchte Finger, als sie an Elisabeth vorbeitrat. Das, was sie im Inneren erwartete, war nichts, womit sie gerechnet hätte. Sie hatte sich das Untersuchungszimmer wie einen Raum in einem Krankenhaus vorgestellt – steril, mit weißen Wänden, ein paar Schränken für Arbeitsmittel und einer Liege. Vielleicht auch ein Computer, in dem der Arzt die Untersuchungsergebnisse direkt festhalten konnte.
Aber nichts davon befand sich in diesem Zimmer, abgesehen von der Liege. Allerdings waren die Eisenschellen für Hände, Füße und den Hals, die davon herabbaumelten, sehr furchteinflößend. An den Wänden befanden sich weitere Vorrichtungen, die keinen anderen Zweck zu erfüllen schienen, als Menschen dort zu fesseln. Unter einer davon war der Boden so rostrot, dass Eva sich nicht vorstellen konnte, dass es sich dabei um etwas anderes als getrocknetes Blut handeln konnte.
Auf einem Tisch lagen neben Skalpellen auch große Messer und Sägen. Manche davon wiesen die gleiche dunkle Verfärbung wie der Boden auf. In einem Regal sammelten sich verschiedene Flaschen und Behälter mit undefinierbarem Inhalt. Dazwischen ragten Gerätschaften auf, denen Eva keinen Zweck zuordnen konnte. Eines davon erinnerte entfernt an einen Helm, allerdings war er von innen mit spitzen Nägeln versehen.
Der ganze Anblick war so entsetzlich, dass sie am liebsten schreiend davongerannt wäre. Dieser Raum glich einer Folterkammer und hätte jederzeit als Drehort für einen Horrorfilm verwendet werden können.
Völlig verunsichert drehte sie sich mit fragendem Blick zu Elisabeth herum, die ihre Finger über die Werkzeuge auf dem Tisch wandern ließ. Ihre Augen strahlten dabei vor Faszination. In der geöffneten Tür hatten sich die beiden Männer in den dunklen Anzügen positioniert.
»Findet hier die Untersuchung statt?«, wollte Eva mit piepsiger Stimme wissen. Sie kam sich dumm dabei vor, aber wusste nicht, was sie sonst sagen oder fragen sollte.
»Ja, bitte leg dich hin«, erwiderte Elisabeth ungerührt und deutete auf die Liege in der Mitte des Raumes.
Eva hielt es für einen schlechten Scherz. Ganz sicher würde sie sich nicht auf etwas legen, an dem man sie fesseln konnte. »Mir gefällt es hier nicht«, widersprach sie ängstlich.
Erstaunt hob Elisabeth die Augenbrauen und bewegte sich langsam auf sie zu. »Nicht? Was stört dich denn?«
Sie klang süffisant, wenn nicht gar gehässig. Wo war die Sanftheit in ihrer Stimme geblieben?
Eva sah sich demonstrativ um, ehe ihr entfuhr: »Alles.« Sie wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Irgendetwas stimmte hier ganz gewaltig nicht. »Das ist doch kein Untersuchungsraum, sondern ein Gruselkabinett. Ich möchte zurück in mein Zimmer und mit der Polizei sprechen.«
Elisabeth verzog missbilligend den Mund. »Ich weiß, der Ort kann etwas einschüchternd wirken, aber solange du tust, was ich von dir verlange, wird dir nichts Schlimmes geschehen.« Sie lächelte ihr ermutigend zu, aber es lag keinerlei Wärme in ihrer Miene. Eva hatte das Gefühl, auf einmal einer ganz anderen Person gegenüberzustehen.
Und wenn nicht?, dachte sie verzweifelt. Was geht hier vor sich?
»Sind Sie wirklich von der Polizei?«, hakte sie ungläubig nach. Zwar hatte Herr Klausen sie selbst an diesen Ort gebracht, aber solch eine Folterkammer konnte doch nicht im Interesse der Polizei sein.
»Zweifelst du etwa an meinen Worten?«, konterte Elisabeth unbeeindruckt und näherte sich Eva bedrohlich, die nun vor ihr zurückwich.
»Was wollen Sie von mir? Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß«, rief sie hilflos aus und floh auf die andere Seite des Zimmers, um so viel Abstand wie möglich zwischen sich und Elisabeth zu bringen.
Diese schnalzte tadelnd mit der Zunge. »Das hast du auch sehr gut gemacht, aber es geht mir doch nicht darum, was du weißt. Ganz besonders, weil es so ernüchternd wenig ist. Ich will das, was in deiner Brust schlägt.«
Sie schnipste mit den Fingern und die beiden Wachmänner traten aus dem Flur ein. Zielgerichtet steuerten sie auf Eva zu.
Panisch schaute diese sich zu allen Seiten um, in der Hoffnung, einen Fluchtweg zu entdecken, der ihr bisher verborgen geblieben war, während die Männer und Elisabeth immer näher rückten. Bebend drückte sie sich gegen die Wand und stieß ein hilfloses Wimmern aus, als die Wachen sie an den Armen packten und zu der Liege zerrten. Sie versuchte, sich loszureißen, und trat schreiend mit den Beinen um sich, aber jede Gegenwehr war zwecklos.
Mit einem Ruck wurde sie auf die Matratze geschleudert und ehe sie sich versah, schlossen sich die Schnallen um ihre Handgelenke und Knöchel. Zuletzt folgte das eiserne Band um ihren Hals. Sie würgte und hatte das Gefühl, nicht mehr atmen zu können. Ihr Puls raste und alles um sie herum begann sich zu drehen. Ihre Schreie wurden zu einem qualvollen Keuchen, da sie ahnte, dass ihr an diesem dunklen Ort niemand zu Hilfe kommen würde.
Elisabeth beugte sich über sie, wobei ihr blondes Haar über Evas Gesicht streifte. »Ganz ruhig, Träumerin«, gurrte sie. »Je mehr du dich dagegen wehrst, umso schwerer wird es für mich, präzise zu arbeiten. Wir wollen doch beide nicht, dass du verletzt wirst.«
Träumerin?, schoss es Eva verständnislos durch den Kopf. Und hat Elisabeth nicht gerade gesagt, dass sie etwas will, das in meiner Brust schlägt? Mein Herz? Bedeutet das etwa, dass sie die böse Königin ist, vor der mein Entführer mich gewarnt hat?
Aber das war unmöglich! Dieser Verrückte konnte nie und nimmer die Wahrheit gesagt haben. Ausgeschlossen! Es sei denn, die beiden teilten dieselben Wahnvorstellungen. Aber warum hatte der Polizist sie dann ausgerechnet hierhergebracht? Gehörte er dazu?
Würde sie jetzt sterben?
Diese Angst bestätigte sich, als sie in Elisabeths Hand ein Skalpell aufblitzen sah.
»Nein«, wimmerte Eva verzweifelt. »Bitte tun Sie das nicht! Bitte! Bitte lassen Sie mich gehen.«
»Aber wir haben doch noch so viel miteinander vor«, entgegnete Elisabeth in gespielter Bestürzung, als sie die Klinge ansetzte und den Stoff von Evas Pullover zerschnitt.
Eva bebte am ganzen Körper und heiße Tränen rannen über ihre Wangen. Sie fürchtete sich zu sehr vor der Klinge, um sich zu rühren oder zu schreien. Zudem erschien es ihr ohnehin sinnlos. Wer sollte sie hören? Wer sollte ihr helfen?
Warum geschah ihr das? Erst die Entführung und jetzt das? Sie hatte geglaubt, dass sie das Schlimmste bereits überstanden hätte, und war ahnungslos in ein noch viel größeres Unglück gestolpert. Aber nicht einmal jetzt konnte sie sich nach dem Bunker zurücksehnen. Lieber wäre sie gestorben, als länger dort gefangen sein zu müssen.
Was hatte sie getan, dass diese Verrückten es auf sie abgesehen hatten?
»Bitte«, schluchzte Eva, auch wenn sie in ihrem Inneren bereits wusste, dass die blonde Frau kein Erbarmen haben würde. »Bitte nicht!«
»Du solltest mir lieber dankbar sein, dass ich dich von diesem elendigen Parasiten erlöse«, zischte Elisabeth gnadenlos und drückte das Skalpell in Evas Haut.
Der Schmerz war überwältigend und vertrieb jeden anderen Gedanken aus ihrem Kopf. Sie schrie wie am Spieß und warf sich instinktiv gegen ihre Fesseln. Blut rann über ihre nackte Haut. Nur wie durch einen Schleier nahm sie wahr, dass nun auch noch die beiden Männer hinzugetreten waren und sie an der Hüfte und dem Oberkörper auf die Liege drückten. Obwohl sie nur ein zierliches Mädchen war, brauchten diese ihre ganze Kraft, um sie zu bändigen.
Sekunden fühlten sich wie eine Ewigkeit an, in der Eva nur noch sterben wollte. Sie konnte dem nicht länger standhalten und alles wäre ihr lieber gewesen, als länger leiden zu müssen. Ganz gleich, worum diese Frau sie in diesem Augenblick gebeten hätte – sie hätte es getan. Absolut alles, nur um diesem Schmerz zu entkommen.
Aber das Einzige, was Elisabeth von ihr wollte, befand sich in ihrer Brust. Die scharfe Klinge teilte Evas Fleisch wie Butter und arbeitete sich immer tiefer vor, bis Elisabeth endlich das fand, wonach sie gesucht hatte. Ein letzter Schnitt und sie zog ihre blutüberströmte Hand wieder aus Evas Brustkorb.
Mit einer triumphierenden Fratze blickte sie auf ihr sich windendes und qualvoll kreischendes Opfer hinab. Ihr eigenes Blut tropfte Eva ins Gesicht, als Elisabeth ihre Finger öffnete und ihr ein pechschwarzes Fleischstück präsentierte. Es war kaum größer als ein Daumennagel, aber es pulsierte wie ein eigenes Organ – selbst außerhalb des Körpers.
»Schau nur, wovon ich dich befreit habe«, raunte Elisabeth ihr zu. »Jetzt wird alles wieder gut.«
Eva konnte nicht glauben, dass sich dieser schwarze Fleck wirklich auf ihrem Herzen befunden haben sollte. Sie konnte nichts von dem glauben, was gerade vor sich ging. Ihre Gedanken wirbelten unkontrolliert durcheinander und sie verlor jegliche Kontrolle über ihren Körper. Schreien und Weinen war das Einzige, wozu sie noch in der Lage war.
Einer der Männer reichte Elisabeth ein Einmachglas mit einer trüben Flüssigkeit, in die sie das Herzstück gleiten ließ. Danach stellte sie das Glas zufrieden neben ein weiteres in ein Regal, das sich gerade noch in Evas Sichtfeld befand.
Wem hatte sie das andere Herzstück aus der Brust geschnitten? Was wollte diese Geisteskranke damit?
Elisabeth kehrte an Evas Seite zurück und streichelte ihr behutsam über die schweißfeuchte Stirn. Ihre Berührung fühlte sich wie ein elektrischer Schlag an, unter dem Eva zusammenzuckte.
»Schlaf schön, Träumerin«, säuselte Elisabeth und wie durch Magie fielen Eva die Augen zu. Sie konnte sich nicht dagegen wehren und spürte, wie sie in tiefer Dunkelheit versank. Der Schmerz und ihr Bewusstsein verblassten, alles war auf einmal bedeutungslos – es war eine Erlösung.

Der große Abend
Samstag, 27. Oktober 2012
13.00 Uhr
Bonn, Schlosskommende Ramersdorf, Verlies
An Wände genagelte Vögel, durchtrennte Kehlen, nackte Frauenleichen, die von der Decke baumelten, und vor Blut überlaufende Badewannen hatten Philipps Träume bestimmt, als er mit rasendem Herzschlag aus dem Schlaf aufschreckte. Für einen Augenblick war er orientierungslos und blickte sich panisch in der Zelle um, in der er mit seinen Eltern gefangen gehalten wurde. Seit Tagen waren sie auf Stühle gefesselt und hatten jedes Zeitgefühl verloren. Nur die ›Grimm-Chroniken‹, deren Seiten immer weniger wurden, gaben ihnen einen Hinweis darauf, wie lange ihr Martyrium noch anhalten würde.
Aber was kam danach? Bedeutete das Ende des Buches auch das Ende ihrer Leben?
»Philipp«, sprach seine Mutter ihn sanft an. »Wir sind immer noch hier.«
Sie wusste nicht, was er geträumt hatte, aber konnte den Schrecken in seinem bleichen Gesicht sehen. Was immer es gewesen war, es schien noch schlimmer als die Wirklichkeit zu sein. Ihr mütterlicher Instinkt verlangte von ihr, ihn zu trösten, aber sie wusste nicht, wie. Sie konnte ihm nicht sagen, dass alles gut werden würde, denn weder sie noch sein Vater verstanden, warum sie sich überhaupt in dieser furchtbaren Lage befanden. Ihnen fehlte jegliche Erinnerung an Engelland. Für sie waren die ›Grimm-Chroniken‹ nichts als eine erfundene Geschichte – die Wahnvorstellung einer geisteskranken Frau, die sich selbst als Königin bezeichnete.
Das letzte Kapitel, welches er Elisabeth hatte vorlesen müssen, war besonders schlimm gewesen. Bisher hatte er immer geglaubt, dass Menschen nicht böse geboren wurden, sondern erst ihre Erfahrungen sie dazu machten. Aber sie hatte ihn eines Besseren belehrt, als er gezwungen gewesen war, in ihre Vergangenheit abzutauchen. Selbst als Kind hatte sie die Grausamkeit schon in sich getragen. Es hatte ihn gegruselt und angewidert, von ihren Gräueltaten berichten zu müssen, die sie allerdings mit großer Zufriedenheit erfüllten. Er hatte sie nie glücklicher erlebt. Jedes schaurige Detail genoss sie in vollen Zügen und sie weidete sich an ihrer eigenen Boshaftigkeit.
Das einzige Interessante war gewesen, als er von ihrer Heirat mit dem Teufel und ihrer Verbindung zu Vlad Dracul erfahren hatte. Es hatte sie allerdings sichtlich verärgert, zu hören, dass dieser ihr nie so treu ergeben gewesen war, wie sie bis dahin geglaubt zu haben schien.
»Verräter«, hatte sie wütend gezischt, als er ihr vorlas, dass Vlad seit jeher geplant hatte, sich ihrer zu entledigen, sobald sie ihm zu mächtig werden sollte. Danach hatte sie auch vorerst kein Verlangen mehr verspürt, noch mehr erzählt zu bekommen.
Tiefe Schatten lagen unter den Augen seines Vaters, als dieser hilflos an seinen Fesseln rüttelte, die blutige Striemen auf seinen Handgelenken hinterlassen hatten. »Ich verstehe nicht, warum die Polizei uns nicht findet«, seufzte Friedrich zum wiederholten Mal. Seine ganze Hoffnung ruhte auf den Gesetzeshütern.
»Elisabeth kontrolliert sie mit Spiegelscherben in ihren Augen«, erwiderte Philipp kleinlaut. Ihre Gespräche wiederholten sich. Er hatte schon öfter versucht, seinen Eltern alles zu erklären, aber Dinge, die sie mit Logik nicht begreifen konnten, ergaben für sie keinen Sinn. Es war frustrierend für beide Seiten und dadurch entstand eine kaum zu überwindende Distanz zwischen ihnen.
»So ein Unfug«, schimpfte Friedrich nun, der fürchtete, dass sein Sohn den Verstand verlieren könnte. »Selbst wenn sie einzelne Beamte bestochen haben sollte, gilt das doch längst nicht für alle. Außerdem bist du nicht irgendwer, sondern eine wichtige Persönlichkeit. Mittlerweile müsste international nach uns gefahndet werden. Vielleicht ist sogar schon das FBI an dem Fall dran.«
Philipp musste sich zwingen, nicht die Augen zu verdrehen. Ganz gleich, ob in dieser Welt oder in Engelland, sein Vater litt an chronischer Selbstüberschätzung. Nur weil sein Sohn ein paar erfolgreiche Songs produziert hatte, hielt er sich für privilegiert. Diese Ansicht ließ er auch nach außen durchscheinen, weshalb Philipp sich häufig für seine Äußerungen, die nur so vor Selbstverherrlichung trieften, schämte.
»Na dann kann es ja nur noch eine Frage von Minuten sein, bis das Gebäude gestürmt wird und wir befreit werden«, erwiderte er sarkastisch. »Vielleicht sollten wir uns schon einmal überlegen, wo wir heute Abend essen gehen wollen. Oder lassen wir uns lieber irgendeinen Sternekoch einfliegen?«
Friedrich lief puterrot an. Mit Ironie und Sarkasmus hatte er noch nie umzugehen gewusst. »Schön, dass dir immer noch zum Scherzen zumute ist«, warf er ihm wütend vor. Sie hatten alle viel zu wenig geschlafen und ihre Nerven lagen blank.
»Beruhigt euch bitte«, flehte Philipps Mutter Claudia. Sie war seit jeher der Ruhepol der Familie. Auf Stress reagierte sie nicht mit Gebrüll, sondern mit Tränen. Auch jetzt glänzten ihre rot geäderten Augen verräterisch feucht. »Wir dürfen uns nicht streiten, das will diese Verrückte doch nur.«
Weder Philipp noch sein Vater konnte es ertragen, Claudia weinen zu sehen, und sie verstummten deshalb. Genau in dem Augenblick öffnete sich die Tür und Elisabeth trat ein. Sie trug ein höhnisches Grinsen zur Schau und blickte lauernd von einem zum anderen. Vielleicht hatte sie auf dem Gang Fetzen ihrer Diskussion aufgeschnappt und gierte nun nach mehr. Es bereitete ihr die größte Freude, zu sehen, wie andere ihretwegen litten.
Doch dieses Mal könnte auch etwas anderes der Grund für ihre Erheiterung sein, denn ihre Hände waren beinahe bis zu den Ellbogen mit Blut verschmiert. Es glänzte sogar noch feucht.
Demonstrativ stellte sie sich so dicht vor Philipp, dass ihm der metallische Geruch in die Nase stieg, und schleckte sich genüsslich einen Finger nach dem anderen ab.
»Durstig?«, fragte sie ihn süffisant und mit vor Erregung funkelnden Augen.
Über irgendetwas freute sie sich ungemein, was bei ihm die Befürchtung hervorrief, dass es sich um das Blut einer ihm bekannten Person handeln könnte. Ember? Könnte es sein, dass es der Königin doch noch gelungen war, sie auch in ihre Gewalt zu bringen? Aber würde sie diesen Triumph nicht viel mehr auskosten, als ihm nur ihre blutverschmierten Arme zu präsentieren?
Er konnte ihr ansehen, dass sie nur darauf wartete, dass er sie fragte, wessen Blut das war, aber diesen Erfolg wollte er ihr nicht gönnen. Wer immer das arme Opfer war, er konnte ohnehin nichts für es tun.
Seine mangelnde Reaktion verdarb ihr den Spaß und sie ließ sich auf seinen Schoß sinken. Mit ihren feuchten Fingern fuhr sie durch sein Haar und tätschelte ihm die Wange. »Weißt du, was heute für ein Tag ist?«, säuselte sie geheimnistuerisch.
Nur mit Mühe konnte Philipp seine Galle zurückhalten, so sehr ekelte er sich vor ihr. »Nein.«
»Ich verrate es dir«, erwiderte sie amüsiert. »Heute ist der Tag, der als der Spiegelball in die Geschichte eingehen wird. Ein großes Ereignis steht uns bevor und du hast das große Glück, dabei sein zu dürfen.« Sie musterte sein Gesicht und zog ihre Lippen zu einem Schmollmund. »Allerdings siehst du gerade gar nicht gut aus. So kann ich dich unmöglich unseren Gästen präsentieren. Hast du etwa nicht genug gegessen und geschlafen?« Herablassend schnalzte sie tadelnd mit der Zunge.
Der Spiegelball – das war der Tag, für den die Königin ihm zugesagt hatte, dass sie seine Eltern freilassen würde, wenn er ihr bis dahin gehorsam aus den ›Grimm-Chroniken‹ vorlesen würde. Er hatte alles getan, was sie von ihm verlangte, dennoch konnte er nicht glauben, dass sie ihr Versprechen halten würde. Zumal die Geschichte längst noch nicht vorbei war. Mit jedem Tag kamen neue Seiten hinzu, da sich das Buch von selbst schrieb. Jeden seiner Gedanken könnte er später schwarz auf weiß darin nachlesen.
»Aber was ist mit den ›Grimm-Chroniken‹?«, fragte er sie verdutzt. Wollte sie denn gar nicht wissen, wie es weiterging?
Desinteressiert zuckte sie mit den Schultern. »Ich wüsste nicht, was dieses alberne Buch mir noch verraten könnte, das ich nicht längst durchschaut habe.«
Bisher war sie ganz gierig darauf gewesen, immer mehr zu erfahren. Es hatte ihr gar nicht schnell genug gehen können. Warum interessierte das alles sie auf einmal nicht mehr?
Ihr Sinneswandel bereitete Philipp Sorgen, da er fürchtete, seinen letzten Triumph gegen sie verloren zu haben. »Was ist mit den Vergessenen Sieben?«, hakte er verzweifelt nach.
Das entlockte Elisabeth ein diabolisches Grinsen und sie beugte sich noch dichter zu ihm vor, sodass ihr Atem seine Lippen streifte. »Der Prinz«, hauchte sie verführerisch. »Der Phönix, die Hexe, der Wolf, der Mond, der Tod und die Träumerin. Ich weiß längst, wer die Sieben sind. Es gibt kein Geheimnis, das ich deinem schönen Mund noch entlocken könnte. Nach der heutigen Nacht habe ich keine Verwendung mehr für dich, mein Dornenprinz.«
Er erstarrte unter ihren Worten. Wie hatte sie herausfinden können, wer die anderen waren? Wer hatte es ihr verraten?
Sie lachte über seinen schockierten Gesichtsausdruck und erhob sich von seinen Beinen. »Ach Prinzlein, nun schau doch nicht so betrübt. Wir hatten eine herrliche Zeit zusammen, aber alles ist irgendwann einmal vorbei. Dachtest du etwa, ich würde bis in alle Ewigkeit deiner Stimme lauschen?«
Fassungslos schüttelte er den Kopf. Er wusste nicht, was er erwartet oder gehofft hatte, aber es ging ihm zu schnell, obwohl die letzten Tage eine einzige Qual gewesen waren. »Was ist mit meinen Eltern?«, stieß er verzweifelt aus. »Ihr habt mir zugesagt, dass Ihr sie gehen lassen würdet, wenn ich Euch bis zum Spiegelball vorlese.«
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752104233
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (September)
- Schlagworte
- Brüder Grimm Rotkäppchen Dornröschen Hexe Märchenadaption Schneewittchen Vampire böse Königin Dracula Fantasy düster dark Romance Urban Fantasy Episch High Fantasy