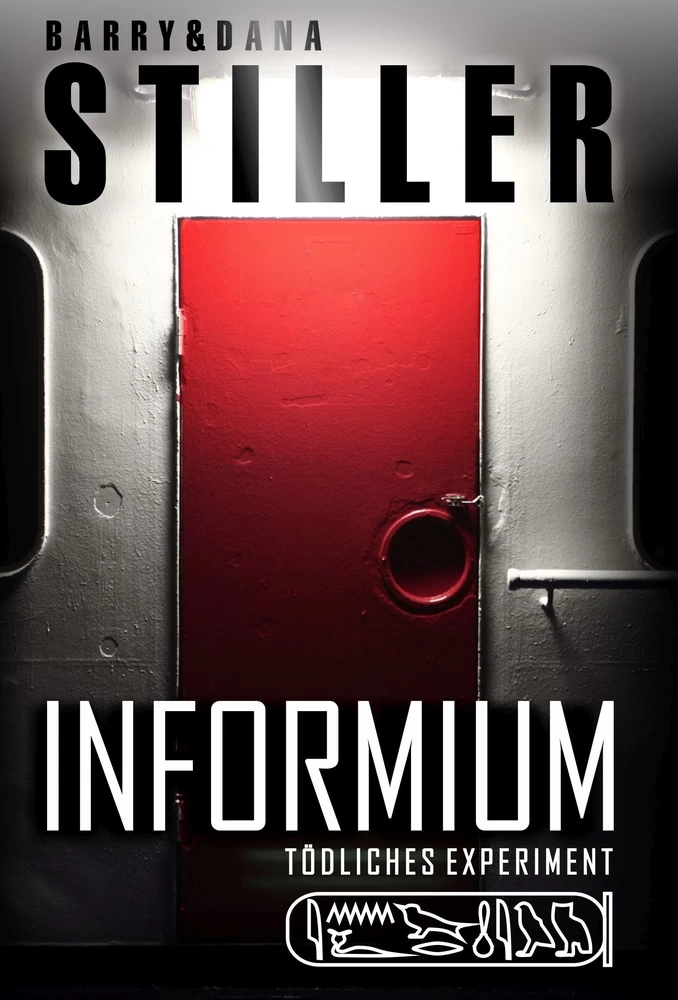Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Ägyptische Wüste, Oase Faiyum
Wie jeden Morgen folgte er dem großen Hauptgraben, um zu seinem Heim zu gelangen. Durch den Staub und Dreck von Jahrhunderten war der Boden dort weicher als auf den harten Steinplatten außerhalb des Hohlweges. Er hatte keine Ahnung, wer dieses architektonische Meisterwerk von scheinbar endlosen Wegen mit seinen unglaublich vielen Verzweigungen gebaut hatte. Soweit seine Erinnerung zurückreichte, gab es diese gleichmäßig breiten Gräben. Letztlich brauchte es ihn auch nicht zu kümmern, Hauptsache, er kam schnell zum Ziel und verlief sich nicht – obwohl diese Gefahr bei näherer Betrachtung kaum bestand. In seiner Umgebung kannte er jedes Sandkorn. Und falls er den Weg in seine Behausung nach den nächtlichen Streifzügen einmal doch nicht mehr fand, konnte er sich jederzeit eine neue Bleibe suchen. Genaugenommen war eh eine Bude in dieser Gegend wie die andere. Gedanken an Schlaf und Gemütlichkeit nachhängend setzte er seinen Weg nach Hause fort.
Auf die letzte große Kurve seines Heimatgrabens freute er sich immer besonders, auch wenn er noch so müde Beine hatte. Mit Schwung und Geschwindigkeit hinein, durch das subtile Zusammenspiel von Schwer- und Fliehkraft auf Kurs gehalten. Das war sein morgendlicher Spaß, bevor er schlafen ging. Ob die Baumeister der Vergangenheit diese Steilkurven extra für solche Typen wie ihn angelegt hatten? Wahrscheinlich nicht, der Aufwand schien ein wenig übertrieben für das bisschen Nervenkitzel. Trotzdem musste man sich nach dem Sinn so mancher Grabenanlage fragen. Zum Beispiel endeten Wege plötzlich, so als seien die Erbauer nicht fertig geworden. Doch das war unwahrscheinlich, denn diese Sackgassen waren teilweise sehr lang, und am Ende fehlte oft nur ein kurzes Stück bis zum nächsten Hohlweg. Außerdem waren diese Endstücke oft perfekt gerundet und genauso glatt poliert wie die Seitenwände der Gräben. Warum sollte man so bauen?
Noch absonderlicher erschienen die in sich geschlossenen Anlagen. Einige führten in konzentrischen Halbkreisen über das Felsplateau oder bildeten schlichte parallele Geraden. Andere liefen in komplizierten Windungen durch den Fels oder wiesen ein wechselndes Muster von Zickzack-Linien auf. Zudem waren diese abgeschlossenen Grabensysteme in der Regel etwas schmäler als die großen Hauptgräben für die langen Distanzen. Doch allen war gemeinsam, dass sie nicht an andere Gräben anschlossen. Man kam nur in sie hinein, indem man aus den Hauptverkehrsgräben an der richtigen Stelle herauskletterte und ein Stück Plateau überquerte. War man einmal in diese Gräben hineingeklettert, konnte man nur zwischen Anfang und Ende hin- und herlaufen. Natürlich ließen auch hier weder die Form des Grabenweges noch die Enden den Zweck der Anlage erahnen. Bei den geschlossenen Hohlwegen konnte man wenigstens endlos im Kreis rennen, zugegebenermaßen nicht der übelste Zeitvertreib. Fitness brachte es allemal.
Darüber hinaus boten die v-förmigen Vertiefungen im Gestein einen gewissen Sichtschutz, der bei ihm zu einem diffusen Geborgenheitsgefühl führte. Rational betrachtet billigte er den Gräben allerdings kaum echte Sicherheitswirkung zu. Im Gegenteil, einem möglichen Angreifer konnte man vielleicht schlechter ausweichen, wenn man die Verkehrsgräben benutzte; aber wer wusste sowas schon genau. Einer seiner Brüder meinte einmal, man solle sich über Dinge, die nicht zu ändern sind, auch keine allzu aufwendigen Gedanken machen. Vermutlich kam man mit einer Portion Fatalismus ganz gut durchs Leben – doch er war eben ein Grübler.
So vieles hatte sich in letzter Zeit geändert. Es war laut, hektisch, heiß und viel zu hell geworden, und etliche seiner Bekannten waren auf mysteriöse Weise zu Tode gekommen. Manche verschwanden einfach, andere fand man zerquetscht auf dem Felsplateau. Die, die mit abgetrennten Gliedmaßen oder herausquellenden Därmen eine kurze Weile überlebten, erzählten immer die gleiche Geschichte, bevor sie starben: Ohne Vorwarnung hatte sie ein monströser Gegner aus dem Nichts attackiert. Nachdem er ihnen die tödlichen Verletzungen beigebracht hatte, entschwand der Mörder schnell und spurlos. Eine Chance hatte man niemals. Erstaunlicherweise kam es nur am Tag zu solchen Überfällen; er hatte von keinem Opfer gehört, das in der Nacht ermordet worden war.
Aber es gab zwischen Morgendämmerung und Sonnenuntergang noch andere Bedrohungen als den großen Killer. Weniger tödlich, doch dafür umso häufiger anzutreffen. Ihm selbst war dieser Angreifer in den letzten zwei Wochen sechsmal über den Weg gelaufen. Auch dieser Feind tauchte plötzlich auf, und nach einem heftigen Schlag musste man sich, meist nach einer kurzen Bewusstlosigkeit, aus dem Dreck kämpfen und seinen Weg erneut antreten. Völlig schwindelig, verwirrt und mit unsäglichen Kopfschmerzen irrte er dann umher, bis er schließlich sauer und übermüdet nach Hause fand.
Am besten lief man bei Tageslicht gar nicht mehr draußen herum. Aber woher sollte man so genau wissen, wann es hell wurde? Die morgendliche Dämmerung war schon immer das Signal, den Heimweg anzutreten. Dass man also in der Morgensonne sein Zuhause erreichte, ließ sich nicht so leicht ändern – und eigentlich wollte er das auch nicht.
Warum war das Leben nur so verrückt geworden? Jeden Tag grübelte er, zu einer Erkenntnis kam er nie. Und doch wurde er das Gefühl nicht los, dass seine geliebten Verkehrsgräben irgendwie Mitschuld an dieser Misere trugen. Hoffentlich blieb er wenigstens heute verschont.
Eins
Donnerstag, 27. Oktober 1988
Mit einem routinierten Schwung pinselte Lisa den Staub aus einer sorgfältig gemeißelten Namenskartusche und fegte dabei einen kleinen, schwarzen Mistkäfer weg. Er fiel in den Sand zu ihren Füßen und kam strampelnd auf dem Rücken zu liegen. Einen Moment überlegte sie, ob sie dem Käfer auf die Beine helfen sollte. Oder zertrat sie ihn besser, bevor er in ihren Sandalen auftauchte und einen Anfall von Ekel verursachte? Sie unternahm nichts; der Skarabäus tat ihr fast leid. Was wusste das arme Tier schon von der Schufterei grabender Archäologie und dem quälenden Hunger nach Erkenntnis, für die sie die Hitze, das schlechte Essen und das miserable Grabungsleben auf sich nahm?
Für dieses Insekt war sie mit Sicherheit nur ein Störenfried und die eingravierten Hieroglyphen höchstens ein Hindernis auf dem Weg zur nächsten Mahlzeit. Sei froh, dass du dir keine Fragen nach Sinn oder Unsinn stellen kannst, dachte sie. Dann fuhr sie fort, den mit altägyptischen Zeichen übersäten Steinblock für eine genaue Dokumentation sauber zu pinseln.
Lisa blinzelte gegen die Sonne, sah auf den rundum beschrifteten Sandstein und seufzte. Das Licht schien so grell, dass bunte Ringe hinter ihren Augenlidern tanzten. Die Hitze kochte sie in ihrer langärmeligen Bluse und der weiten, khakifarbenen Arbeitshose, aber ohne lange Kleidung war es noch weniger erträglich. Nicht nur wegen des schnell eintretenden Sonnenbrandes, sondern auch wegen der Blicke und Tuscheleien der arabischen Grabungshelfer.
Schicksalsergeben stapfte die junge Frau um ihr Studienobjekt herum, bis die Morgensonne in ihrem Rücken stand und ihr langer Schatten quer über die Schriftzeichen fiel. Besser. Mit einem frischen Papier auf dem Zeichenbrett und gespitztem Bleistift machte sie es sich so bequem, wie es der kieselige Sandboden zuließ, und begann zu kopieren.
Die Hieroglyphen gingen ihr leicht von der Hand, denn sie kannte die meisten auswendig. Solche, die ihr bisher selten untergekommen waren, schlug sie sorgfältig in ihrer Gardiner-Zeichenliste nach. Lisa hatte sich fest vorgenommen, auf ihrer ersten Grabung keine Fehler zu machen. Wenn sie so gut arbeitete, dass der berüchtigt pedantische Bergen nichts an ihrer Arbeit auszusetzen fand, konnte sie ziemlich sicher sein, endlich einen Fuß in die Tür der Ägyptologie gesetzt zu haben. Sie dürfte kaum Schwierigkeiten haben, bei weiteren Ausgrabungen angestellt zu werden und später eine Stelle in Forschung oder Lehre zu finden. So malte sie es sich wenigstens aus. Sie war höchst erstaunt gewesen, als der Grabungsleiter des Professors sie vor zwei Monaten ansprach. Ihre Stärke lag ganz klar im philologischen Bereich. Sie besaß ein Talent für alte Sprachen und Schriftsysteme, und normalerweise waren das nicht die Leute, die man zu einer jungen Grabung wie dieser mitnahm. Schließlich wusste niemand, wie viele beschriftete Objekte überhaupt zu bearbeiten sein würden.
Lisa gab dem großen Steinquader grinsend einen kameradschaftlichen Klaps. Nun hatte sie ihre ersten Schriftzeichen schon nach weniger als einer Woche gefunden...
Den Vormittag hindurch und nach der üblichen fünfstündigen Mittagspause kam sie gut voran. Im Verlauf des späten Nachmittags erlahmte ihr Eifer, aber sie war mit dem Ergebnis ihrer Arbeit zufrieden. Sie hatte drei Seiten des Quaders vollständig kopiert und mit Thomas’ Hilfe fotografisch dokumentiert. Die Einmessung mit dem Theodoliten hatten sie und Paul am Vortag erledigt, nachdem Lisa bei der ersten Begehung des Grabungsabschnittes auf die Oberkante des Steinquaders gestoßen war. Eben als sie erwog, sich an die vierte Seitenfläche zu begeben, tönte ein Ruf über die Grabungsfläche. Irgendetwas unverständlich Arabisches, das das Ende des Arbeitstages verkündete. Mit spitzem Mund zog Lisa eine letzte, gerade Kartuschenkante, klappte die Schutzfolie auf die Zeichnung und warf ihre Arbeitsgerätschaften in den Koffer. Die Sonne stand tief und verfärbte sich bereits rot. Wie das Morgenlicht zog auch die Dunkelheit hier schnell herauf. Vor der Abfahrt zur Unterkunft musste die Grabungsmannschaft noch die profanen Aufgaben erledigen, die jede Ausgrabung begleiteten: Reinigen und sorgfältiges Wegschließen der Werkzeuge. Die technische Ausrüstung, den Stromgenerator sowie den tragbaren Toshiba T1100 verluden sie auf die Jeeps, um sie ins sichere Grabungshaus mitzunehmen. Die Gerätschaften hatten mehr gekostet als der Arbeiterlohn für die ganze Saison, und Ersatz konnten sie in Ägypten kaum beschaffen. Außerdem enthielten sie am Ende des Tages die gesammelten Messdaten, und wenn die verlorengingen...
Lisa musste ihren Gerätekoffer heute selbst zum Jeep schleppen. Ihre Mappe mit den Zeichnungen trug sie unter den Arm geklemmt. Mit der freien Hand nahm sie im Vorübergehen noch ein paar Maßbänder und zwei Grabungskellen mit. Je eher sie hier fertig wurden, desto früher durften sie alle sich in die Schlange vor der Dusche einreihen. Möglichst bevor das Wasser in der aufgeschnittenen Tonne auf dem Dach der Mannschaftsunterkunft kalt oder aufgebraucht war.
Neben dem Jeep stand Peter Conrad, der sich lauthals mit einem der älteren Arbeiter unterhielt. Der Grabungsleiter sah in seiner weiten Armeehose und dem staubigen Hemd nicht anders aus als die Studenten, dachte Lisa. Sie wusste über ihn nur, dass er Anfang dreißig war und an seiner Doktorarbeit in der Anthropologie schrieb. Außerdem war er als wortkarg bekannt. Bei ihr hinterließ das den Eindruck, als hätte er eigentlich Besseres zu tun, als sich mit Studenten abzugeben. Von einigen Kommilitoninnen hatte sie gehört, dass er ganz in Ordnung war, aber die zählten nach Lisas Meinung zu den Suppenhühnern. Die studierten bloß, um innerhalb der nächsten Semester einen Mann in guter Position mit solidem Einkommen abzugreifen. Ihr Typ war dieser Conrad jedenfalls nicht. Er war nur unwesentlich größer als sie und insgesamt etwas schmal. Athletisch hatte Suppenhuhn Inga gemeint, die vor zwei Jahren an einer von Bergens Grabungen hatte teilnehmen dürfen. Lisa schnaufte, als sie an das Gespräch zurückdachte.
Sie war jetzt nah genug, um den aufgebrachten Tonfall des Vorarbeiters zu hören. Bestimmt ging es um die donnerstägliche Auszahlung der heimischen Grabungshelfer. Sie machte einen scharfen Bogen in der Hoffnung, nicht gesehen zu werden.
»Lisa!« Peter unterbrach seinen arabischen Redeschwall. Dem Unausweichlichen folgend wandte sie sich ihrem Chef zu. Man konnte eigentlich nicht übersehen, dass sie schwitzte, bepackt war wie ein Lastesel und am liebsten nicht stehengeblieben wäre. Aber dieser Conrad übersah es mit Leichtigkeit.
Peter sah die Studentin mit einem entnervten Gesichtsausdruck über das Geröll stolpern. Mit schlechtem Gewissen fiel ihm ein, dass er sie und den vermutlichen Türsturz völlig vergessen und den ganzen Tag nicht nachgesehen hatte, wie sie zurechtkam. Dabei wusste er, dass es seine Aufgabe als Grabungsleiter war, gerade auch den Anfängern unter die Arme zu greifen.
»Na, Lisa, wie sieht’s aus? Bist du mit dem Bauschutt durch?«, fragte er darum bemüht, interessiert zu klingen. Es gelang ihm wohl nicht, jedenfalls sah diese Lisa aus, als hätte sie gern Unflätiges geantwortet. Mahmad brummte auf Arabisch etwas über aufsässige Westlerinnen; und nicht zum ersten Mal teilte Peter die Meinung seines Vorarbeiters. Er behielt seine Ansichten allerdings für sich, weil sich viele der Männer sowieso feixend das Maul zerrissen.
»Nicht ganz. Ich hab’ die Kopien soweit fertig. Morgen muss ich die Unterseite kontrollieren.«
»Eingemessen ist aber alles?«
Wieder dieser beleidigte Blick. Lisa ging ihres Weges.
Peter ärgerte sich – über den Auftakt, den diese Saison nahm, und sich selbst.
Als er eine halbe Stunde später in seinem Zimmer saß, war es vor seinem Fenster bereits stockdunkel, eine ägyptische Nacht wie die meisten. Wirkliche Ruhe herrschte jedoch selten. Vom Summen der Mücken, die um den undichten Wassertank hinter dem Grabungshaus schwärmten, bis zum steten Gemurmel der Grabungsmannschaft gab es viele Geräuschquellen. Peter bezweifelte nicht, dass sich das wenigstens im Bezug auf seine Mitarbeiter geben würde. In drei Monaten würden sie so wenige Worte wechseln, dass man ihre Truppe für den Ausflug einer Taubstummenschule halten könnte. Vielleicht passierte das in diesem Jahr schneller als sonst, denn es war ein gemischter Haufen, in dem es unablässig brodelte. Besonders dieser Thomas Meller schien ein Talent zu haben, für Unruhe zu sorgen. Seit dem ersten Tag stritt er mit der einzigen ägyptischen Studentin von der Kairoer Universität. Worum es dabei ging, wusste Peter nicht und wollte es auch nicht unbedingt wissen. Er hatte genug Grabungen erlebt, wo die Chemie einfach nicht stimmte. Entweder schlugen sie sich die Köpfe ein, oder nach zwei Wochen sprach niemand mehr miteinander. Schön, sollte ihm recht sein.
Peter starrte noch immer aus seinem kleinen Fenster, das er mit Mückennetz ausgeklebt hatte. Geistesabwesend beobachtete er, wie sich eine dicke Spinne durch eine lose Ecke in sein Zimmer drückte. Es klopfte an seiner Tür. Hastig zog er den Stapel Dokumentationen vor sich, den er eigentlich durcharbeiten musste, und rückte seine Brille zurecht.
»Herr Conrad?«
Wer denn sonst? Sein geheimer Zwillingsbruder? Er wünschte, er hätte wenigstens abends seine Ruhe, aber das Grabungsleben war zwangsweise geselliger, als es ihm lieb war.
»Ach, Hilla.«
»Ja, ähm. Ich wollte nur nochmal nachfragen, wie Sie das hier mit dem Tagebuch handhaben. Ich meine, das ist ja überall anders...«
Peter unterdrückte ein Seufzen und erklärte der Studentin ein weiteres Mal, wie sie die Formulare auszufüllen und jeder Schnittleiter Beschreibungen anzufertigen hatte. Er wusste nicht, welchen Beschluss er mehr bereute. Die vorlaute Lisa oder die langsame Hilla mitgenommen zu haben. Wobei er bei genauer Betrachtung nicht wirklich eine Entscheidung getroffen hatte. Sein Doktorvater hatte ihm beide Studentinnen empfohlen und keinen Zweifel daran gelassen, dass seine Empfehlung etwas Obligatorisches enthielt.
Nun saß er hier drei volle Monate fest. Er war sich schon jetzt im Klaren, dass er mit seiner Dissertation nicht wesentlich weiterkommen würde, denn es gab einiges zu tun. Das Grabungsareal umfasste eine pharaonenzeitliche Stadt, die sich einst über mehrere Hektar erstreckt hatte. Vor zwei Jahren waren sie bei einer Magnetprospektion auf die zahlreichen Mauerzüge gestoßen. Seither war bis auf ein paar Sondierungsgruben noch nicht viel freigelegt worden, doch mit seinem untrüglichen Instinkt witterte Peters Doktorvater, Professor Bergen, sofort ein neues Tätigkeitsfeld für sein Institut. Peter konnte die Begeisterung seines Professors für diesen Fundplatz nicht gänzlich nachvollziehen, obwohl er seit der ersten Begehung mit dem Projekt vertraut war. Er hatte nichts gegen Siedlungsarchäologie, nein. Er fand nur eben Bestattungen, gleich ob in Mastabas, Pyramiden oder Schachtgräbern, tausendmal faszinierender. Aber die meisten vielversprechenden Fundorte waren längst fest in der Hand der Amerikaner. Es war ein Leid, dass es in Ägypten einfach zu viele Ausgräber gab. Jedes Land dieser Erde, das es sich leisten konnte, führte Grabungen hier durch – man musste die unfreundliche Haltung der Einheimischen beinahe verstehen.
Vor Sonnenaufgang waren die Archäologen auf den Beinen, tappten halbschlafend über die staubigen Flure hin zum spärlichen Frühstück oder gleich zu den wartenden Jeeps. Ihre Fahrer begrüßten sie mit einem mürrischen Salam Aleikum, was insofern seltsam war, als sie zu den wenigen Kopten gehörten. Am heiligen Freitag der Muslime mussten die als Einzige arbeiten. Auf die restlichen zwei Dutzend Grabungshelfer würden die Forscher heute verzichten und eigenhändig weitergraben. Die meisten Archäologen nutzten diesen Tag, um kleinere Befunde sorgfältig freizulegen und zu fotografieren, Zeichnungen zu beenden oder Bodenprofile zu putzen.
Kurz bevor die sengende Mittagshitze das Ende des Arbeitstages einläutete, hörte Peter plötzlich aufgeregtes Schwatzen aus Richtung der Grabungsfläche. Er saß unter einem Sonnensegel und verschaffte sich gerade einen Überblick über die zahllosen Scherbenfunde der letzten Tage. Keramik, nichts als endlose Keramik. Natürlich stellten Gefäße eine wichtige Informationsquelle für Archäologen dar. Sie halfen bei der Datierung und gaben Hinweise auf Handelsverbindungen sowie Lebensumstände der damaligen Benutzer. Manche Ur- und Frühgeschichtler machten ganze Kulturen an einzelnen Stilelementen von Töpferwaren fest, wenn schriftliche Überlieferungen fehlten. Peter ging das eindeutig zu weit. Was er sich jedoch nicht vorstellen konnte, war, dass sich irgendjemand ernsthaft für dröge Keramik begeisterte. Ausgräber wollten Waffen, Schmuck, Werkzeuge oder Kleidung finden, nicht das Geschirr der Vorfahren – auch, wenn das niemand offen zugab.
Erst überhörte er das laute Geschnatter. Als es sich aber nicht legte, stand er schließlich auf und stapfte über die großflächige Ausgrabungsstätte in Richtung des Aufruhrs. Als er sich der Gruppe näherte, die mitten in einem der abgesteckten Grabungsschnitte beisammen stand, würdigte ihn kein einziger auch nur eines Blickes. Alle redeten durcheinander, sodass er sich mit den Ellbogen durch die Studenten zwängen musste. Die tadelnden Worte blieben ihm im Halse stecken. Zu seinen Füßen ragte etwas aus dem graugelben Sand, das zunächst wie achtlos verstreuter Müll wirkte, weil es im Wind flatterte wie eine Plastiktüte. Erstaunt folgte sein Blick dem länglichen Objekt, dessen Ende sich in ein paar dünnere, spröde Stecken teilte, die mit ausgetrocknetem Leder umwickelt zu sein schienen.
»So, jetzt treten alle zurück. Hilla, nein, du kannst da bleiben und weiterputzen, man sieht ja noch fast gar nichts.« Peter kommandierte, ohne nachzudenken. Die Entdeckung eines Leichnams sollte einen Archäologen in Freude versetzen, aber aus irgendeinem Grund fühlte er nichts als Anspannung. Ehe er sich neben Hilla in die Hocke sinken ließ, hörte er jemanden seinen Namen rufen.
»Jetzt nicht, Lisa!«, antwortete er abwesend und senkte sein Gesicht bis auf wenige Zentimeter an das Objekt heran. Kein Zweifel, er blickte auf einen menschlichen Unterarm. Die Knochen waren noch beinahe vollständig mit Haut umhüllt, die wie rissiges Pergament wirkte. Und zum Humerus, dem Oberarmknochen, hin flappten leinene Fetzen. Er fragte sich, was unter dem Sand folgen mochte, eine Schulter? Ein Torso?
»Herr Conrad!« Drängender als zuvor.
Genervt stand Peter auf, warf einen vernichtenden Blick in die Runde der murmelnden Studenten.
»Herr Meller, hätten Sie vielleicht die Freundlichkeit, Lisa zu sagen, dass sie und ihr Türsturz momentan nicht Mittelpunkt dieser Grabung sind? Entweder gibt sie jetzt Ruhe, oder sie wäscht den Rest der Woche Scherben!«
Thomas trottete mit einem schadenfreudigen Grinsen in Lisas Richtung davon. Als er nach ein paar Minuten zurückkam, war sein Grinsen wie weggewischt.
»Herr Conrad, Sie sollten doch zu Lisa hinübergehen. Sie hat etwas sehr Seltsames gefunden.«
Ihr Fund war in der Tat äußerst merkwürdig. Nachdem sie den Türstein mit viel Mühe und einer provisorischen Hebelkonstruktion aus Schalungsbrettern umgekippt hatte, blickte sie auf eine glatte, halbrunde Schale. Eine Schädelkalotte, an der noch blonde Haarsträhnen klebten.
Zwei
Freitag, 28. Oktober 1988
»Hören Sie mich, Peter?« Bergens Stimme wurde halb vom Rauschen der Satellitenleitung verschluckt. Ägypten war nicht das Ende der Welt, aber die Technik hatte eine Tendenz, sich zu verweigern, als wüsste sie, dass sie hier nichts verloren hatte. Wider besseres Wissen überprüfte Peter die Verbindung der Parabolantenne mit dem Satellitentelefon, das sie Bergens guten Beziehungen zur Inmarsat verdankten. Trotz seines konservativen Grabungsstils war Bergen schon immer ein Freund neuer Technologien gewesen, die ihm die Arbeit erleichterten. So hatte er seine Bekanntheit genutzt und der UN-Organisation, die sich mit der Verbesserung der Sicherheit in der Seeschifffahrt beschäftigte, vorgeschlagen, auf seinen Grabungskampagnen eines der ersten an Land einsetzbaren Geräte zu testen.
»Hallo, Professor.« Wie beiläufig erzählte Peter, dass er ein paar Daten der Grabungsergebnisse per Satellit schicken würde, zu denen er gern Bergens Meinung hätte. Sein Professor merkte sofort, dass er mit etwas hinterm Berg hielt.
»Was hast du denn da? Ich höre doch, dass etwas passiert ist.« Peter grinste in sich hinein, schwieg und drückte in seinem Transferprogramm auf ENTER. Bergen erkundigte sich nach den Fortschritten, nach der Laune der Arbeiter, dem Verhältnis zur ägyptischen Antikenbehörde und dem Umgangston der örtlichen Polizei. Wonach er nicht fragte, waren seine Studenten.
»Soweit alles normal. Aber unsere Mädels liegen sich ständig in den Haaren«, bemerkte Peter ungefragt.
Bergen schnaubte in einer Mischung aus Herablassung und Resignation. »Das Essen ist schlecht, die Betten zu hart, und Heimweh haben sie«, äffte er weinerlich. »Entschuldige, Peter. Ich weiß, dass du dich mit diesen Dingen herumärgern musst. Ich begreife nur nach all den Jahren noch immer nicht, was sich diese jungen Leute...« Bergen verstummte.
»Nachricht angekommen?«, fragte Peter leutselig. Er konnte die Überraschung seines Professors förmlich durch die Leitung spüren.
»Ich kann am Sonntag in Kairo sein, spätestens am Montag bei euch.«
»Das ist nicht nötig–«
»Wirklich unglaublich, völlig unglaublich! Wir sehen uns am Montag, und bis dahin kein Wort zu den ägyptischen Behörden. Du weißt, wie es ist. Wenn einer im Kulturamt etwas wittert, dann haben wir schneller den verehrten Kollegen Al-Wass und unsere internationale Kollegenschaft auf dem Hals, als wir gucken können.« Mit einem Schnappen war die Verbindung unterbrochen. Peter starrte verblüfft auf den Hörer.
Er hatte noch nie eine solche Reaktion beim eher behäbigen Bergen erlebt, geschweige denn, dass sein Professor je in einer Blitzaktion auf eine Grabung geeilt wäre. Andererseits war eine gut erhaltene Mumie im ägyptischen Wüstensand inzwischen eine kostbare Seltenheit. Zu viele Generationen von Grabräubern, Schatzsuchern, Hobbyarchäologen und Rucksackabenteurern hatten das Land geradezu umgepflügt. Der Traum jedes Ausgräbers vom ungestörten Befund blieb in Ägypten heutzutage allzu oft einer. Insgeheim beneidete Peter die Altamerikanisten, die nicht selten im mittelamerikanischen Dschungel auf beinahe unversehrte Mayabauten stießen oder ganze Gräberfelder in Peru fanden.
Neben seinem Hauptfach Anthropologie hatte er selbst einige Semester lang die Archäologie Amerikas im Nebenfach studiert. Die Kalendersysteme der Maya, die bizarren religiösen Bräuche, die Schöpfungsmythen der Azteken und das Staatswesen der Inka faszinierten ihn auch jetzt noch. Es erfüllte ihn mit Bitterkeit, dass er nicht an den Anforderungen des Fachs, sondern an den Ethnologen gescheitert war, die diesen Fachbereich okkupiert hatten. Diese Leute wollten nicht die objektiven Erkenntnisse gewinnen, die ihm so wichtig waren. Meist interessierten sich nicht einmal die Professoren für eine möglichst wahrheitsgetreue Rekonstruktion der Vergangenheit. Viele Völkerkundler wollten bloß Geschichten von friedliebenden indigenen Völkern erzählen. Selbst wenn sie dazu Daten verbiegen, Funde ignorieren und Datierungen uminterpretieren mussten, die sie wegen fehlender Grundkenntnisse ohnehin niemals nachvollziehen konnten.
Peter war zutiefst überzeugt, dass auch Archäologen zwingend über fundierte mathematische und naturwissenschaftliche Kenntnisse verfügen müssten. Die Ethnologen, die er im Laufe des Studiums kennengelernt hatte, waren für ihn schlicht Dummköpfe, wenn nicht gar Fälscher. Im besten Falle waren diese verklemmten Völkerkundler naive Geschichtenerfinder mit einem schlechten Gewissen und einem utopischen Bild vom präkolumbischen Gutmenschen. Tausende abgeschlagene Köpfe nebst Knochen der Opfer, die die Stufen heruntergeworfen worden waren und sich – passend zu den spanischen Überlieferungen – am Fuße der großen Pyramide fanden, verwandelten sich bei ihnen in Unfallopfer oder ähnliche Lächerlichkeiten. Dass die Azteken wahre Kannibalismusexzesse mit religiöser Rechtfertigung abhielten, um den dramatischen Mangel an tierischem Eiweiß irgendwie abzumildern, leugneten viele Ethnologen schlicht. Quellen, die den Brauch belegten, hochwertige Fleischstücke wie Oberschenkel für die Priesterkaste zu reservieren, ignorierten sie kurzerhand. Oder sie taten sie bequem als Erfindung der Spanier ab.
Ein Student, der einem allzu harmonischen Indianerbild entgegen hielt, dass auch die Maya als extrem kriegerische Stadtstaaten organisiert gewesen seien und – aus heutiger Sicht – menschenverachtende Kriegsbräuche pflegten, konnte schnell mit einem unterschwelligen Rassismusvorwurf mundtot gemacht werden. Als Nächtes wurde dann regelmäßig der Umgang der spanischen Eroberer mit den indigenen Völkern Amerikas ins Spiel gebracht. Damit war endgültig jede aufkeimende Diskussion beendet.
Für Peter Conrad waren diese befremdlichen und teilweise schockierenden Bräuche der frühen Mesoamerikaner ein Umstand, der seinen Forschergeist herausforderte. Er wollte nachvollziehen, welches Weltbild und welches Bild vom Menschen diese Kulturen entwickelt hatten. Ihn interessierte, wie man zu der Einstellung gelangen konnte, dass Menschenopfer richtig und notwendig für die Gesellschaft waren. Doch nach all seinen Erfahrungen mit den Völkerkundlern fand er es folgerichtig, sich aus der Altamerikanistik zu verabschieden. Damals fokussierte er sein Interesse auf eine andere Kultur, die – nach dem Wertekodex der westlichen Welt – ebenfalls ein seltsames Bild vom Universum und der menschlichen Existenz besessen hatte. Peter war von der Altamerikaforschung in die Ägyptologie gewechselt. Und als Anthropologe mit fundierten Kenntnissen zur altägyptischen Geschichte konnte er auch weiterhin auf archäologische Grabungen hoffen. Erstaunlicherweise gab es unter den Ägyptologen kaum solche Sozialträumer wie in der Ethnologie, die Märchen liebten und ihr höchstes Glück als Experte in einer leichtverdaulichen Geschichtsdokumentation fanden.
Peter schob die aufwühlenden Gedanken an seine Studienzeit beiseite und betrachtete die Polaroid-Aufnahmen, die er heute von den beiden mumifizierten Menschen gemacht hatte. Morgen musste alles genauestens eingemessen und gezeichnet werden, ehe sie die Überreste mit größter Vorsicht ins Grabungshaus transportieren konnten. Dann endlich würde Peters Stunde als Anthropologe schlagen. Es würde ihm sicherlich gelingen, Alter und Geschlecht der Toten zu bestimmen, vielleicht würde er sogar Hinweise auf die Todesursache finden.
Da sich seine Dissertation mit einer breit angelegten Vergleichsstudie ägyptischer Mumien befasste, hatte er inzwischen ein gutes Auge für diese besonderen Leichen. Schon auf der Grabungsfläche war ihm daher der große Unterschied zu den Mumien aufgefallen, mit denen er sich normalerweise beschäftigte. Es gab keinerlei Indizien für Einbalsamierung oder Grabbeigaben, und das hieß wohl, dass sie es mit natürlich mumifizierten Leichnamen zu tun hatten. Peter musterte eingehend das Polaroid und schüttelte den Kopf. Das waren eindeutig keine Bestattungen.
Als er zum Abendessen ging, fand er seine Mannschaft in altbekannter Zwietracht vor. Lisa und Hilla schienen sich zu streiten. Layla, die ägyptische Studentin, und die zwei jungen Männer warfen hitzige Kommentare in die Diskussion ein.
»Denkst du, da fällt ein massiver Türsturz auf jemanden, und niemand merkt das?«
»Was glaubst du denn, wie sein Schädel unter den Steinblock gekommen ist?«, erwiderte Lisa.
»Oder ihrer«, brummte Paul dazwischen.
»Ihr was?«
»Ihr Kopf, Hilla. Auch Frauen können sich Steinquader auf den Kopf fallenlassen«, erklärte Thomas süffisant.
»Ich bezweifle, dass hier irgendjemandem irgendetwas auf den Kopf gefallen ist, mit Ausnahme von dir vielleicht!«
Peter musste lachen.
Drei
Montag, 2. Februar 1942
Mit einem nachdenklichen Kopfschütteln klappte Gruber die Akte mit der Bezeichnung VRILBORN auf und fragte sich zum hundertsten Mal, wie man dieses unselige Vorhaben ordentlich zu Ende bringen könnte. Schließlich durfte man das Leben tausender deutscher Volksgenossen nicht einfach so beenden, nur um der Geheimhaltung willen. Sein Gewissen jedenfalls rebellierte – und das kam in letzter Zeit zu häufig vor.
Er war jetzt seit über drei Jahren Leiter aller als geheim eingestufter Vorgänge des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung in der Wilhelmstraße 68. Ihm hätten deshalb wesentlich größere Räumlichkeiten sowie mehr Personal als seine Sekretärin und ein Assistent zugestanden. Aber er glaubte an die Bewegung und die Tugenden, die sie als typisch deutsche propagierte; und Anton Gruber war darauf bedacht, sich nicht von Macht korrumpieren zu lassen. Ihm waren die Prunksucht, die Ausschweifungen, die oft aus Bequemlichkeit geborene Skrupellosigkeit und die protzigen Kanzleibauten vieler seiner Parteigenossen zuwider. Wozu brauchte ein Göring zum Beispiel solche Prachtgemächer – sicherlich nicht, um seine Arbeit zu tun. Und weshalb duldete der Führer diese Auswüchse von Dekadenz eigentlich? Trotz seiner Repräsentationspflichten und den gewaltigen Aufgaben, vor denen er stand, war der Führer immer recht bescheiden geblieben und hatte sich mit seiner gesamten Kraft der Bewegung und dem Dienst am deutschen Volk verschrieben.
»Kommen Sie herein«, antwortete Gruber auf den einfachen, kräftigen Klopfer an die schwere Eichentür seines nüchternen Dienstraums.
Es war Standartenführer Rosengart-Bölkow, der Gruber in seinen Gedanken unterbrach, der Ressortleiter der Rabiex, wie die Abteilung für rassische und biologische Experimente intern hieß. Die Rabiex war eine Einrichtung, die formal dem Reichserziehungsministerium unterstellt war, aber weitgehend autonom arbeitete. In den offiziellen Strukturdiagrammen der Behörde tauchte sie überhaupt nicht auf. Gruber hatte keine Ahnung, ob Reichsminister Rust über den Zweck dieser Organisation im Bilde war und ob er bezüglich ihrer Tätigkeiten unterrichtet wurde. Thematisch hatte ihre Arbeit jedenfalls wenig mit dem Aufgabenbereich des Erziehungsministeriums gemein, und niemand wusste mit Sicherheit, von wem die Rabiex ihre Befehle erhielt. Schon des Öfteren hatte Gruber sich gefragt, ob er froh sein sollte, dass er strikte Weisung hatte, bei einigen Projekten Rosengart-Bölkows Organisation in Anspruch zu nehmen. Manches Mal wollte er gar nicht so genau wissen, wie bestimmte Befehle von den Leuten der Rabiex ausgeführt wurden...
»Heil Hitler, Gruppenführer.«
»Nehmen Sie Platz, Bölkow. Wollen Sie etwas trinken? Ich habe noch einen ganz hervorragenden Cognac, von unserem Westausflug ‘40.« Eigentlich zog Gruber es vor, Dienstgespräche in einer betont sachlichen Stimmung zu führen; aber bei so heiklen Unterhaltungen wie heute bevorzugte er eine entspanntere Atmosphäre. Schließlich ging es hier nicht um eine dieser lächerlichen Schulbuchdiskussionen, bei denen die Frage anstand, ob man die Nase zukünftig nicht besser als Gesichtserker bezeichnen sollte, da ‚Nase‘ ja aus dem Lateinischen käme. Ob ‚Gesicht‘ und ‚Erker‘ nun rein germanische Ursprünge hatten, konnten die beteiligten Korinthenkacker natürlich auch nicht so genau sagen...
Rosengart-Bölkow nahm das Angebot dankend an, und nachdem sie beide den ersten Schluck genossen hatten, kam Gruber zur Sache.
»Die Akte Vrilborn macht mir große Sorgen, mein Freund.« Er klappte die dünne Mappe zu und tippte mit seinem Füllfederhalter auf den mit VERSCHLUßSACHE – STRENG GEHEIM beschrifteten Deckel. »Wie verfahren wir in dieser Angelegenheit weiter, was schlagen Sie vor?«
Rosengart-Bölkow sprach, als lese er eine Rede vom Blatt ab. »Die Neuigkeiten aus Ägypten sind nicht gut, wir werden wohl kaum über den Halfaya-Pass hinauskommen. Alexandria können wir komplett vergessen. Und auf Unterstützung durch die Italiener konnten wir ja noch nie bauen. Unsere Expedition weiter im Süden ist jetzt schon in Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn die Engländer unsere Leute hochnehmen – und das scheint mir nur eine Frage der Zeit – wäre es besser, wenn von unseren Untersuchungen vor Ort keine Spur mehr zu entdecken ist. Andernfalls steht das gesamte Unternehmen auf dem Spiel. Wir stecken noch in den Kinderschuhen, und wir werden noch viel Zeit brauchen, bis erste Resultate kommen. Der Rest der Welt wird über uns herfallen, wenn unser Vorhaben bekannt wird.« Der Leiter der Rabiex machte eine kurze Pause. »Aber wir müssen erfolgreich sein. Und wir werden erfolgreich sein, Gruppenführer. Und dann werden alle die, die heute gegen uns hetzen, für ewig vor uns im Staub liegen.« Als Gruber ihn nur verwundert ansah, fuhr Rosengart-Bölkow fort: »Also habe ich Obersturmbannführer Löffler befohlen, das Lager sofort abzubrechen, die Spuren zu beseitigen und schnellstmöglich nach Berlin zurückzukehren. Ich habe den Rücktransport durch die Einheit Rhön bereits in die Wege geleitet. Löffler und seine Truppe sollten übermorgen zurück sein.«
»Sie haben völlig eigenmächtig die Aktion abgebrochen?«
»Es gab aus meiner Sicht keine Alternative, um Schaden von unserem Volk abzuwenden«, erwiderte Rosengart-Bölkow unterkühlt.
Gruber machte eine beschwichtigende Handbewegung. »Jaja. Schon gut, Bölkow, Sie haben vollkommen richtig gehandelt. Wie Sie wissen, genießen Sie mein vollstes Vertrauen, und ich finde Ihre selbständige Arbeitsweise nach wie vor gut. Aber in Zukunft wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich bei so wichtigen Schritten wenigstens unterrichten.«
»Selbstverständlich, Herr Gruppenführer. Ich werde Sie natürlich ausführlich informieren, sobald unsere Leute aus Ägypten zurück sind.« Rosengart-Bölkow atmete hörbar aus; ob aus Erleichterung oder unterdrückter Empörung, konnte Gruber nicht feststellen. Er neigte zur zweiten Alternative. Er hielt den schnell aufgestiegenen Standartenführer für linientreu, extrem ehrgeizig und skrupellos. Er hütete sich, ihn zu maßregeln, obwohl er rein formal sein Vorgesetzter war.
Für einen Moment war es absolut still im Dienstraum des SS-Gruppenführers. Gruber griff wortlos zu seinem Cognac, schwenkte das Glas einige Male und leerte es. Nach einer Minute des Nachdenkens, tippte er erneut mit seinem Füllhalter auf den Aktendeckel.
»Dann besprechen wir die weitere Vorgehensweise, wenn wir einen Bericht von Löffler haben und die Lage besser einschätzen können. Nehmen Sie das hier bitte wieder an sich.« Er reichte Rosengart-Bölkow die Akte. »Wir treffen uns am kommenden Freitag, ich würde sagen um zehn hier in meinem Dienstzimmer.«
Rosengart-Bölkow nickte kurz und vollführte einen Hitlergruß, der einiges an Forschheit vermissen ließ. Noch ehe der Standartenführer sich umdrehte, blickte Gruber ihn ernst an.
»Informium darf so nicht scheitern.«
Vier
Montag, 31. Oktober 1988
Als Professor Bergen drei Tage später in Ägypten ankam, hatte sich die Grabung für Peter in einen wahren Alptraum verwandelt. Wenn auch einen aufregenden, wissenschaftlich wohl einzigartigen Alptraum. Was sollten sie bloß mit so vielen Mumien anfangen? Sie konnten sie kaum sachgerecht verwahren. Mittlerweile war er froh darüber, dass sein Doktorvater darauf bestanden hatte herzukommen, denn was sie seit ihrem Telefonat entdeckt hatten, überstieg Peters archäologische Fähigkeiten bei Weitem.
Bergen erreichte das Dorf Qarun am Rand der fruchtbaren Oase von Faiyum spät am Abend mit dem ausgedienten Militärjeep, den Peter schon am Vortag nach Kairo zum Flughafen geschickt hatte. Sein Professor sah älter aus als seine achtundsechzig Jahre, und auch sein gewöhnlich volles Gesicht wirkte beinahe abgehärmt. Als läge ihm etwas auf der Leber, was nichts mit ihren Funden zu tun hatte. Aber auf eine entsprechende Nachfrage hin zog der Forscher nur die buschigen Augenbrauen in die Höhe und versicherte, dass alles in bester Ordnung sei.
»Ich will nur hoffen, dass für meine Grabung hier dasselbe gilt«, stichelte er.
Als Peter mit ihm am nächsten Morgen zur Grabungsfläche aufbrach, sah man Carl Bergen nur noch das Hochgefühl an, das er immer ausstrahlte, sobald er einen Fuß auf diesen geschichtsträchtigen Boden setzte. Vielleicht hatte er sich ja alles auch bloß eingebildet, und Bergen vertrug die Hitze nicht mehr, dachte Peter.
Das Areal, das für die archäologischen Forschungen abgesperrt worden war, lag gut drei Kilometer vom Grabungshaus entfernt auf einer höher gelegenen Geländestufe, die den Faiyumsee nach Norden hin einrahmte. Bergen lenkte den Jeep eigenhändig die zunehmend steile Schotterpiste hinauf und schenkte dem malerischen Sonnenaufgang jenseits des Birket Qarun keine Beachtung.
Sie erreichten die Grabungsfläche eine gute halbe Stunde, bevor die Arbeiter und das Grabungsteam dort erscheinen würden. Bergen liebte es, allein über seine Grabungen zu stolzieren wie ein Feldherr über das Schlachtfeld nach einem Sieg. Er parkte schwungvoll neben dem ersten Suchschnitt, stieg aus dem Wagen und ließ seinen Blick schweifen. Ein paar verstreut liegende Testschnitte waren mit Flatterband markiert, damit keiner der Dorfbewohner, die unerlaubt aber beständig auf dem Gelände herumwanderten, verunglückte oder Funde zertrampelte. Vier zehn mal zehn Meter messende Zonen im südlichen Teil der Siedlung waren mit Pflöcken und Draht umzäunt – die eigentlichen Grabungsflächen, an denen die Studenten momentan arbeiteten.
Die Morgensonne stand noch so niedrig, dass die eingetieften Grabungsabschnitte im Schatten lagen, als Peter seinen Professor nun herumführte. Die Aufregung ließ ihn hastig zwischen den Planquadraten wechseln.
»Langsam, Peter, langsam.« Bergen wischte sich über die hohe Stirn. Der Schweiß klebte ihm seine kurzen, hellgrauen Haare an den Kopf.
»Entschuldigen Sie, Professor. Es gibt so vieles, was ich Ihnen zeigen muss.«
»Aber wir haben Zeit, und alles, was ich jetzt nicht richtig sehen kann, muss ich mir später noch einmal angucken.« Bergen blinzelte ihn in seiner höchst eigenen Weise an, und Peter wusste, dass der Mann einen Scherz hatte machen wollen. Für Professor Carl Bergen war es schier unvorstellbar, dass es Menschen gab, die sich Dinge mehr als ein Mal ansehen mussten, um sie im Gedächtnis zu behalten.
In sämtlichen Grabungsflächen ließen sich mittlerweile die Straßenzüge anhand der angrenzenden Hausgrundrisse sehr gut ausmachen. Die tiefer liegenden Ziegellagen, die sie nun freilegten, hatten nicht so stark unter dem jahrtausendelangen Getrampel der Nachfahren ihrer Erbauer gelitten. Und so konnte man vielerorts die Hauseingänge auf der Straßenseite, die großzügigen Einraumwohnungen und die Ausgänge in die Hinterhöfe erkennen. An einigen Stellen reihten sich in schmalen Räumen kreisrunde Verfärbungen aneinander, die von eingetieften Vorratsgefäßen stammen mussten. Peter wusste, dass ihnen nur wenige Zentimeter fehlten, ehe sie das ehemalige Bodenniveau erreicht haben würden und damit die Oberkanten der großen Gefäße. Sie ähnelten verblüffend ihren berühmten, griechischen Verwandten, nur dass die Ägypter die Idee zweitausend Jahre früher gehabt hatten.
Durch die beschränkte Ausdehnung der quadratischen Grabungsflächen wurden viele Gebäude nur angeschnitten, die Straßen endeten im Sand. Es war noch zu früh, um sich völlig sicher zu sein, aber nach den Abschnitten der Gassen und Häuser, die sich bislang abzeichneten, glaubte Peter, dass es sich um eine planmäßig angelegte Siedlung handelte. Auch auf den Karten der Magnetmessungen sah es aus, als verliefen alle Wege parallel oder rechtwinklig zueinander, ganz so, wie es die ordnungswütigen Römer später gemacht hatten. Bedauerlicherweise hatten sie bisher nur eine ungefähre Vorstellung von der Ausdehnung des gesamten Siedlungsareals. Begehung und Prospektion deuteten eine Größe von wenigstens acht Hektar an. Sie hatten seit ihrer Ankunft rund um das eigentliche Grabungsareal Testschnitte angelegt, quadratische Gruben, deren Inhalt Aufschluss darüber geben sollte, bis wohin sich die besiedelte Fläche genau erstreckte. Zu Peters Erstaunen hatte ein solcher Schnitt südlich, in gut hundert Metern Entfernung zur angenommenen Siedlungsgrenze, überhaupt keine Funde zutage gefördert. Nicht einmal die außerhalb einer Siedlung typischen Müllgruben mit Knochen oder Keramikresten waren vorhanden. Wie konnte es sein, dass die Bewohner so nah bei ihrem Dorf keinerlei Spuren hinterlassen hatten?
»Meine Güte, meine Güte«, murmelte Bergen. Dann sagte er eine lange Weile nichts mehr, während er wie ein Schlafwandler über die mit roten Fundmarkern übersäten Fundflächen tappte. Sie waren in den vergangenen Tagen dazu übergegangen, auf der Grabungsfläche diese farbigen Kunststofffähnchen an die Position bereits geborgener Mumienfunde zu setzen. Es kam nicht infrage, die empfindlichen Überreste tagelang der prallen Sonne und dem sandhaltigen Wind auszusetzen. Aber so hatten sie immerhin die Möglichkeit, sich vor Ort an die ursprüngliche Lage zu erinnern, ohne Pläne konsultieren zu müssen.
Peter wusste, dass es keine gute Idee war, Bergen bei seiner ersten Inaugenscheinnahme zu stören. Und er wusste auch, dass Bergen in weniger als einer halben Stunde zu einer Hypothese gekommen sein würde, auf die er vermutlich niemals käme. Also ersparte er sich die Peinlichkeit, seine eigenen Theorien zu offenbaren, und setzte sich abwartend auf einen größeren Steinblock am Rand von Schnitt eins.
»Das können unmöglich alles Mumien gewesen sein. Mumienteile – vielleicht. Aber vollständige Mumien? Peter...«, lächelte Bergen mit erhobenen Augenbrauen und Zeigefinger. »Du erlaubst dir doch einen Scherz?«
»Bislang konnten wir zwölf natürlich mumifizierte Leichname identifizieren, und keiner von ihnen ist unvollständig bis auf die kleineren Finger- und Fußknochen.«
»Unglaublich. Das ist absolut einmalig. Das...«, Bergen stockte einen Moment, als dämmere ihm die wahre Bedeutung des Gesehenen, »...ist ein Alptraum! Wenn die Presse Wind davon bekommt, dann stehen morgen diese aufdringlichen Kamerateams von National Geographic, BBC und Co. und – noch viel schlimmer – die Herren aus Kairo vor der Tür!« Bergen wischte sich mit seinem großen Stofftaschentuch erneut die Stirn und schnaufte aufgebracht. Peter wunderte sich wieder einmal, weshalb der ältere Mann niemals Grabungskleidung trug. Er tauchte immer in Jeans und Pullover auf, gleich ob er eine Tagung oder einen Tagebau besuchte.
»Dieser Al-Wass wird uns den Firman entziehen, sobald er weiß, dass es hier wirklich etwas zu finden gibt. Ich könnte den Kerl...« Zwischen Bergen und dem Verwalter der ägyptischen Altertümer war eine Art Privatkrieg entbrannt, für den niemand so recht die Ursache kannte. Peter teilte Bergens Urteil über den Mann – übereifrig, parteiisch, geltungssüchtig und noch nicht einmal besonders bewandert (was kein Wunder war, falls die Gerüchte stimmten, dass Al-Wass selbst einmal Grabräuber gewesen war). Nur half es nichts, denn an der Behörde vorbei ging in Ägypten eben nichts, wenn man Archäologie betreiben wollte.
Eine Stunde später saßen Bergen und Peter in dem Arbeitsraum des momentan verlassenen Grabungshauses. Zwei Tassen ägyptischen Kaffees standen beinahe ungetrunken auf dem langen Arbeitstisch. Bergen studierte die farbigen Pläne und ließ sich von Peter die exakte Lage der eingezeichneten Objekte beschreiben. Dabei unterließ er es nicht, seinen Ärger über das ungenügende Gedächtnis seines Doktoranden mit spitzen Bemerkungen kundzutun, wenn dieser eine Information nicht sofort präsent hatte.
»Ich verstehe nicht, wie du das nicht mehr so genau wissen kannst! Du bist gerade halb so alt wie ich! Versuch endlich, dich zu erinnern.«
»Die Fotos liegen auf meinem Schreibtisch, ich könnte ja–«
Bergen machte eine unwirsche Handbewegung. »Wo sind die Funde?«
»Teils hier, teils im Waschzelt. Sie müssen sie sehen. Diese Inschriften!«
»Hat sich Fräulein Franks schon mit ihnen befasst?« Bergen sah Peter prüfend über den Rand seiner Halbmondgläser hinweg an. »Sie muss momentan auf der Grabung helfen, damit wir die zusätzlichen Arbeiter beaufsichtigen können.«
»Höre ich da eine gewisse Antipathie? Sie ist gut, Peter. Benimm dich nicht wie ein Kind.«
»Professor Bergen, ich–«
»Es war nur ein Rat. Ich weiß, dass Fräulein Franks dir mehr Widerworte geben dürfte, als du das gewohnt bist, aber das ist vollkommen egal, denn wir werden sie hier brauchen.«
»Herr Professor, es hat Sie noch nie interessiert, was ich von Ihren Grabungsstudenten halte. Trotzdem vielen Dank für die Erklärung.« Peter griff nach der Kaffeetasse und verbarg seinen Ärger hinter ihr.
Mittwoch und Donnerstag vergingen in hektischer Aktivität. Bergen übernahm keineswegs die Leitung der Grabung, sondern lediglich Lisas Arbeitermannschaft samt ihrem Grabungsschnitt. Peter durfte sich weiterhin allein mit den unangenehmen Organisationsaufgaben sowie der Bändigung der Arbeiter und der Bearbeitung der explosionsartig anwachsenden Dokumentation herumschlagen. Bergen veranlasste, dass Lisa in das ehemalige Abstellkämmerchen hinter Hillas provisorischem Restaurierungslabor zog. Dort befasste sie sich nun von früh bis spät mit den Hieroglyphentexten, die teils auf Papier gepaust, teils in Form von beschrifteten Gegenständen zu ihr gebracht wurden. Sie schob Fragmente hin und her, und allmählich glaubte sie zu wissen, weshalb sie bei der Entzifferung keinen Schritt weiterkam. Zuerst war ihr nur die extrem kleinteilige Zerstörung der Inschriften aufgefallen. Der fast vollständige Türsturz, den sie noch selbst auf der Grabungsfläche hatte freilegen dürfen, trug den einzigen größeren Textabschnitt. Und der war denkbar unspektakulär, ein gängiger Paragraph aus dem sogenannten Totenbuch.
Aber das, was sie seither gefunden hatten, waren kaum mehr als drei, vier Zeichen auf einem Fragment oder Teilstück unzerstörter Wand gewesen. Und Lisa wunderte sich. Sie entdeckten ja nicht wenig Textmaterial. Im Gegenteil. Wo so zahlreiche Reste von Inschriften auftauchten, da mussten einst zigtausende Schriftzeichen existiert haben, sonst wäre bei der gründlichen Zerstörung noch erheblich weniger erhalten geblieben. Nur gab es dermaßen viele Wiederholungen, dass sich schwer zusammenhängende Passagen rekonstruieren ließen. Zudem war alles, was sie bisher entdeckt hatten, thematisch ähnlich, was die Arbeit zusätzlich verkomplizierte. Lisa nahm den Bonnet zur Hand, ein Standardwerk zur ägyptischen Religionsgeschichte, in dem die verschiedenen heiligen Texte vorgestellt wurden, vom Amduat, über das sogenannte Totenbuch bis hin zu den Sargtexten. Sie begann nach Übereinstimmungen, nach seltenen Ausdrücken und chronologischen Hinweisen zu suchen. Aber sie kam einfach nicht weiter. Mit dem, was ihr bislang zur Verfügung stand, war es aussichtslos, den Quelltext identifizieren zu wollen.
Am frühen Abend, nachdem er gutgelaunt von der Ausgrabungsfläche zurückgekehrt war, sich geduscht und ein Stündchen geschlafen hatte, berief Carl Bergen sein »Mitarbeiterbriefing« ein. Wie alle wussten, liebte es der alte Ausgräber, sich dabei durch die Verwendung von Begriffen aus Marketing, Juristerei und Betriebswirtschaft über die »verweichlichten Schnösel« lustig zu machen. Genauso entsprach es seiner Liebe zur Provokation, den »ängstlichen Pinseläffchen« auf seiner Expedition erst einmal mit dem Klappspaten zu zeigen, wie man die »Deckschichten« beseitigt. Natürlich hätte er jeden Einfältigen auf der Grabung, der sich daran ein Beispiel nahm und dabei einen Befund zerstörte, am Besanmast aufgehängt.
Bergens Credo war einfach: Sei besser als gut und mach keine Fehler, dann kannst du auch nach Herzenslust das arrogante Arschloch spielen. Ihm imponierten Studenten, die eine große Klappe riskierten, weil sie wussten, dass sie im Recht waren und man ihnen selten am Zeug flicken konnte. So war es eigentlich kein Wunder, dass er die vorlaute, aber nach seiner Meinung in Sachen ägyptische Hieroglyphen brillante Lisa Franks protegierte, obwohl sie über keinerlei Grabungserfahrung verfügte.
Eine oft erzählte Anekdote berichtete, dass er auf die Anmerkung eines früheren Grabungsleiters, er sei nicht so richtig teamfähig und man könne nur schlecht mit ihm zusammenarbeiten, mit der Bemerkung geantwortet hatte, man solle ja auch nicht mit ihm, sondern für ihn arbeiten.
Fünf
Freitag, 28. Oktober 1988
Den Zettel mit der gekritzelten Nachricht in der Faust stand der Mann in der ägyptischen Dunkelheit. Der Mond löste sich eben aus den Kronen der Palmen, die den Rand der kultivierten Zone markierten.
Ein kalter Wind fuhr in seine Jacke, und verärgert wandte er ihm den Rücken entgegen. Wenn die Wichtigkeit der Angelegenheit es erforderlich machte, dass er mitten in der Nacht hier herauskam, dann hätte er angenommen, dass man ihn wenigstens nicht warten ließ. Er wusste ja nicht einmal, wer ihn hierher bestellt hatte. Aber letztlich war er nur ein kleines Licht in der Hierarchie von Forschern und Gelehrten, die dem großen Ziel zuarbeiteten, und dessen war er sich stets bewusst.
Die Flamme mit den Händen schützend entzündete der Archäologe eine Zigarette und drehte sich einige Male auf der Stelle. Er sah jedoch noch immer nichts außer den Schatten der Schuttberge, die sie in den letzten Wochen aufgehäuft hatten, und den finsteren Silhouetten der Grabungszelte. Er bemerkte weder das kurze Aufblitzen des Mündungsfeuers noch den Mann, der ihn erschoss.
Sechs
Montag, 7. November 1988
In den vergangenen vier Tagen hatten sie auf der Grabung sieben weitere Leichname geborgen, und Bergen musste zugeben, dass sie nicht mehr lange weiterarbeiten konnten, ohne die Behörden zu benachrichtigen. Wenn rein zufällig ein Beamter der ägyptischen Altertümerverwaltung auf einen Besuch erschien, würden ihre Karrieren ein frühes Ende finden – jedenfalls, was Grabungskampagnen in Ägypten anging. Nicht so sehr, weil ihr Vorgehen eigentlich kriminell war, sondern weil Al-Wass nur auf einen falschen Schritt von Bergen oder seinem Team lauerte. Und dass Bergen jetzt persönlich hierher auf die Ausgrabung geeilt war, musste in Kairo längst bekannt sein. Die Gemeinde der archäologisch tätigen Ägyptologen war einfach zu klein für Geheimniskrämerei. Peter fand Bergens Verhalten äußerst seltsam. Ihr Institut hatte erst in diesem Jahr wieder eine unbefristete Grabungserlaubnis bekommen, und schon setzte Bergen alles aufs Spiel. Er nahm eine ähnliche Verwunderung auch bei Hilla und Paul wahr, die sich des Risikos ebenfalls bewusst waren. Die Einzige, die von der allgemeinen Besorgnis unberührt schien, war Lisa Franks, und Peter fragte sich, ob die Studentin kaltschnäuziger oder bloß naiver war als die anderen.
Viel Zeit, um sich den Kopf zu zerbrechen, hatte Peter in den vergangenen Tagen jedoch nicht gehabt. Er war täglich etliche Stunden mit der Erstbeschau der mumifizierten Leichname beschäftigt gewesen. Und obwohl es eine unter diesen Umständen anstrengende, wissenschaftlich nicht besonders befriedigende Arbeit war, war sie notwendig. Er wusste genau, dass Bergen darauf bestand, diese vorläufigen Untersuchungen vorzunehmen, weil sie wahrscheinlich nicht noch einmal die Gelegenheit dazu bekommen würden. Die menschlichen Überreste wurden auf der Grabungsfläche vorsichtig auf Bretter gebettet, mit Holzwolle gestützt und mit einem festen Rahmen umbaut, ehe man sie ins Grabungshaus fuhr. Peter hatte drei Tische für seinen provisorischen Untersuchungsraum kapern können. Layla, die ihm bei der Erstbeschau assistierte, befreite die nächsten beiden Körper behutsam von dem schützenden Bretterrahmen, während Peter sich seine Instrumente bereitlegte.
Die pergamentene, rissige Haut der ersten Mumie glitt unter dem Latex seines Handschuhs durch wie ein hartgetrocknetes Fensterleder. Es war allein dem ariden Klima zu verdanken, dass die menschlichen Überreste der Verwesung entgangen waren. Peter konnte tatsächlich nirgendwo Hinweise auf eine absichtliche Mumifizierung oder sonst eine Behandlung nach dem Tod finden. Muskulatur und Sehnen zeichneten sich stellenweise wie gespannte Seile ab. Fleisch und Fett waren in der extremen Trockenheit längst zu den wasserlosen Zellbestandteilen zusammengeschrumpft. Deshalb sahen sich Mumien auch so ähnlich, dachte Peter, während er Layla die Maße diktierte. Im Tod hatten sie alle dieselbe, skelettöse Figur, eine gekrümmte Haltung, die tiefdunkel verfärbte Haut und dieses zähneentblößende »Lächeln«. Im Leben hatten die zwei Toten hier auf seinen Tischen mit Sicherheit so verschieden ausgesehen wie er und Lisa.
»Mumie AK 3-11 ist die eines Mannes, Körperlänge etwa 1,75 m. Die Erhaltung entspricht den taphonomischen Bedingungen, das heißt einer natürlichen Mumifikation in ungestörtem Befund.«
Layla trat näher an den Untersuchungstisch heran und notierte den Kopfumfang und die Längen der Gliedmaßen, die Peter diktierte.
»Bis auf vier fehlende Fingerknochen ist der Leichnam vollständig. Einzige Auffälligkeit im Bereich der Halswirbelsäule.« Peter richtete die Gelenkneonlampe auf diese Körperzone und tastete vorsichtig mit den Fingern nach der Stelle, die wie ein zerfleddertes Hundespielzeug aussah.
»Dem Schaden an der Haut nach zu urteilen handelt es sich um einen ante mortem zugefügten Schnitt, der als Todesursache in Betracht kommt.« Er nahm sich die Lupe und eine lange Pinzette. »Der Schnitt scheint durch die Kehle bis auf die Halswirbelsäule gedrungen zu sein. Eine mikroskopische Untersuchung der Schnittspuren ist empfehlenswert, in sechsfacher Vergrößerung lassen sie sich jedoch schon gut erkennen.«
Laylas beinahe schwarze Augen folgten jeder seiner bedächtigen Bewegungen. »Der wurde auch umgebracht«, stellte sie fest.
Peter nickte nur. Bei den meisten Mumien hatten sie zweifelsfrei einen gewaltsamen Tod diagnostizieren können.
»Störe ich?« Lisa lugte vorsichtig um die halbgeöffnete Tür in das Untersuchungszimmer.
Peter meinte fast, sie ein wenig blass um die Nasenspitze werden zu sehen, und schüttelte schadenfreudig den Kopf. »Nein, komm ruhig rein. Der Professor wird sowieso gleich hier sein.« Es war beinahe wieder Zeit für die tägliche Lagebesprechung.
Lisa warf Layla ein kurzes Lächeln zu, das diese aber nicht erwiderte. Die ägyptische Studentin war ausgesprochen ernst und umgab sich mit einer Aura der Unnahbarkeit. Nicht einmal mit Peter hatte sie mehr als ein Dutzend Sätze gewechselt. Thomas und Paul drückten sich mit einem gemurmelten Gruß hinter Lisa durch die Tür.
»Herbe Fritte«, verkündete Thomas mit einem Blick auf Peters Untersuchungsobjekt. Der verzog den Mund, ließ die Arme sinken und räumte seufzend seine Werkzeuge zurück auf das Tablett. Bevor er Thomas eine passende Antwort geben konnte, wurde die Tür aufgestoßen.
»Ah, alle schon versammelt! Ich gratuliere dir zu der Disziplin auf dieser Grabung, Peter.« Bergen stand frisch geduscht in der Tür und rieb sich die Hände.
»Nun, Hilla fehlt«, bemerkte Lisa.
»Nein, nein, Fräulein Roth ist anderweitig beschäftigt. Peter, bitte unterrichte uns jetzt von deinen bisherigen Ergebnissen.«
»Sie wurden alle ermordet?« Lisa sah Peter an, als hätte sie noch nie etwas so Dämliches gehört. »Das ist doch völlig unmöglich.«
»Na, Sie werden Peters Expertise fürs Erste Glauben schenken müssen, Fräulein Franks. Er ist das Nächste an einem Anthropologen, was wir in der näheren Zukunft bekommen werden.«
»Vielen Dank, Professor.«
»Na, Peter. Fräulein Franks’ Skepsis spricht ja durchaus von Sachverstand. Und wüsste ich nicht, dass du so eine haarsträubende Behauptung nicht ohne guten Grund aufstellen würdest, würde ich selbst Fräulein Franks wohl beipflichten.«
Peter verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich in dem ungemütlichen Flechtstuhl zurück. Er hatte keine Lust auf Bergens Spielchen.
»Ich habe an den Mumien überhaupt nichts gesehen, was wie Verletzungen aussah«, fuhr Lisa fort und sonnte sich in Bergens scheinbarer Zustimmung. Peter wusste aus eigener Erfahrung nur zu genau, wie dünn das Eis war, auf das sie sich gerade begab. Im Grunde war sie ihm nicht einmal unsympathisch, doch einen kleinen Rüffel von Professor Bergen konnte ihr vorlautes Mundwerk durchaus vertragen.
»Peter, hörst du mir eigentlich zu?«, hakte Lisa nach.
»Also... ja. Der überwiegende Teil der Mumien weist tiefe Schnitt- beziehungsweise Stichwunden in verschiedenen Körperregionen auf, vor allem im Hals- und Brustbereich. Ich kann natürlich noch keine abschließende Analyse bieten, aber bei den meisten Individuen konnte ich Schnittmarken auf den darunter liegenden Knochen nachweisen.«
»Es hat also jemand alle Menschen in diesem Ort erstochen?«, fragte der sonst so stille Paul.
»Nein. Eher die Kehle durchgeschnitten.« Peter fuhr mit dem Finger über seinen Hals.
»Du sprachst vom überwiegenden Teil der Mumien«, unterbrach Bergen Peters dramatische Darbietung.
»Nun ja, ich bin mir sicher, dass wir bei den übrigen zum gleichen Schluss kämen, wenn wir wenigstens röntgen könnten.«
»Das sind reine Spekulationen, Peter«, sagte Lisa kopfschüttelnd.
Bergen blickte amüsiert zwischen Lisa und Peter hin und her. Er machte keinerlei Anstalten, Partei zu ergreifen.
»Denk mal nach, Lisa. Alles andere ergibt doch überhaupt keinen Sinn, betrachtet man die Mumien im Zusammenhang mit den Befunden. Wir haben sämtliche Leichen dort gefunden, wo offensichtlich einst Flure oder Straßenzüge waren. Außerdem gehören alle Mumien stratigraphisch in dieselbe Phase. Wie willst du das erklären, wenn nicht durch einen Massenmord?«
Lisa runzelte die Stirn. »Aber–«
»Angenommen«, fuhr Peter rasch fort, »sie wären nicht alle mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt getötet worden, glaubst du vielleicht, die Dorfbewohner hätten Tote überall in ihren Straßen und Häusern herumliegen lassen? Es gibt nur dieses eine Szenario, das Sinn ergibt. Irgendjemand hat die gesamte Dorfbevölkerung an einem einzigen Tag ausgelöscht.« Es war eine gespenstische Szenerie, die unwillkürlich vor Peters innerem Auge entstanden war, während er die Mumien untersucht hatte.
Lisa war noch immer nicht überzeugt. »Weshalb sollte jemand so etwas tun? Und wer?«
»Das ist jetzt aber ein bisschen viel von Peter verlangt, finden Sie nicht, Fräulein Franks?« Bergen sah beinahe vergnügt aus.
»Nein, ich meine–«
»Ich denke«, schnitt Bergen ihr das Wort ab, »wir können zumindest eines mit ziemlicher Sicherheit sagen: Es hat keine kriegerische Auseinandersetzung stattgefunden. Wir haben weder Waffen noch Panzerungen oder anderes militärisches Gerät gefunden. Irgendwelche Anzeichen von Kampfverletzungen, Peter?«
Der verneinte, und Bergen nickte gewichtig. »Wir haben nicht einmal ein Messer gefunden, mit dem man jemanden hätte ermorden können. Da hilft nur eines. Wir gehen tiefer. Ab morgen werden alle Suchschnitte vollständig auf das mustawa al-mumiya abgetieft, also das Mumienniveau wie unsere Arbeiter es so treffend getauft haben. Und wisst ihr, was das heißt?«
»Dass wir niemals fertig werden?«, schlug Lisa vor.
Bergen funkelte sie mit seinen eisblauen Augen an, verkniff sich aber eine Entgegnung.
Sieben
Freitag, 4. November 1988
Als Oberleutnant Peter Kosminsky den Zündschlüssel abnahm, löste das Prasseln des Regens ansatzlos das Geknatter des Zweitaktmotors ab.
»So ein Mistwetter, aber was erwartet man im November in unseren Breiten. Na los, dann lassen Sie uns mal reingehen.« Hauptmann Keller schlug den Kragen seines Regenmantels hoch und zog die altmodische Schiebermütze tiefer ins Gesicht. Oft hatten sich die Kollegen im Revier über seine Opamütze mokiert, auch Kosminsky. Jetzt konnte er sich bei dem Gedanken, dass das Trommeln auf dem Autodach gleich auf der Hinterhauptsglatze seines Assistenten weiterging, ein Grinsen hinüber zum Fahrersitz nicht verkneifen. Er öffnete die Tür des Streifenwagens und trat in eine knöcheltiefe Pfütze, die sich im Rinnstein gebildet hatte, seit der Regen am frühen Morgen begonnen hatte. »So ein verdammter Mist!«, entfuhr es ihm, als das eiskalte Wasser in seine Halbschuhe strömte.
»Trösten Sie sich, Chef, bei mir wird langsam die Frisur feucht.«
»Jaja«, murmelte Hauptmann Keller und betrachtete seine nassen Füße als eine kleine Strafe für die Vorfreude auf Kosminskys Durchnässung.
Die Gegend um die Robert-Siewert-Straße, in die sie heute Abend gerufen worden waren, lag direkt am Tierpark. Sie war vor allem bei älteren Leuten beliebt, nicht zuletzt wegen ihrer zentralen Lage. Das hier war zwar nicht Berlin-Mitte, aber trotzdem kein Viertel, in dem man eine marode Kanalisation vermuten würde. Mit den raumgreifenden Schlaglöchern, die mittlerweile zum normalen Straßenbild gehörten und immer öfter zu Reifen- und Aufhängungsschäden an den Einsatzfahrzeugen der Volkspolizei führten, hatte er sich abgefunden. Mit den Schlägen, die sein Rückgrat malträtierten, konnte Keller sich nicht anfreunden. Etwas anderes als die miserable Federung des alten Wartburg 353 sollte er sich doch im Laufe von fast vierzig Dienstjahren verdient haben. »Ich hätte gedacht, dass die wenigstens zur Vierzigjahrfeier die Straßen in Ordnung bringen...«, machte er seinem Ärger Luft. Sein Partner Kosminsky reagierte, wie üblich, nicht auf Kellers Kritik an den Zuständen in ihrer Republik.
»Hier ist es, Chef, ganz hinten durch, dritte Etage.« Oberleutnant Kosminsky stand bereits im Hauseingang eines Altbaus, der erstaunlicherweise die alliierten Bombardements und zuletzt die Häuserkämpfe mit der Roten Armee ohne massiven Schaden überstanden hatte. Fast schien es, als hätten die folgenden vier Jahrzehnte Vernachlässigung in der Deutschen Demokratischen Republik dem Gebäude mehr geschadet. Überall waren die Zeichen schleichenden Verfalls zu sehen. Der von Abgasen verdreckte Fassadenputz war an vielen Stellen abgeplatzt und überließ das blanke Mauerwerk Regen, Hitze und Frost. Der Hinterhof passte in das trostlose Bild; abgesacktes Kopfsteinpflaster, tiefe Pfützen und ein scheinbar uralter Haufen Bauschutt.
Der Tatort lag im Hinterhaus. Als Keller die letzten Stufen der durchgetretenen Holztreppe erstieg, konnte er schon das kräftige Organ von Leutnant Sarno hören. Der liebte es, mit lauten und meist völlig überflüssigen Anweisungen die Tatortuntersuchung zu erschweren und den Kollegen mit seinen abstrusen Theorien über den Ablauf einer Tat auf die Nerven zu gehen. Trotzdem war er nicht unbeliebt auf dem Revier; denn was er an kriminalistischem Handwerkszeug und Kombinationsgabe vermissen ließ, glich er durch Beflissenheit und Beharrlichkeit aus. Wenn man Sarno eine langweilige Beschattung oder einen Wochenenddienst nur genügend schmackhaft machte, durfte man sich in der Regel sicher sein, diese Bürde loszuwerden.
Mit einem tiefen Seufzen betrat Keller die Wohnung. »Guten Tag, Genosse Sarno, dann berichten Sie mal.«
»Guten Tag, Genosse Hauptmann. Also angerufen hat uns der Nachbar von oben drüber, der heißt Walter Meier, weil er einen Schuss gehört hat. Hier auf der Etage wohnt sonst niemand mehr. Also, der Zeuge Meier hat dann im Treppenhaus nachgeschaut, konnte aber nicht feststellen, woher der Schuss gekommen war. Dann ist er erstmal zum Fernsprecher und hat uns angerufen. Das war so gegen 18 Uhr 25. Dann hat er noch einmal im Treppenhaus nachgeschaut und gesehen, dass die Tür zur Wohnung des Opfers einen Spaltbreit offenstand. Reingegangen ist er aber nicht. Als er wieder in seiner Wohnung war, hat er nur noch gehört, wie unten die Haustür zugefallen ist. Der Zeuge Meier ist sich aber ganz sicher, dass er sie zuvor geschlossen hatte.«
»Sonst nichts, keine richtigen Zeugen, hat denn niemand etwas gesehen?«
»Nein, hier wohnt sonst nur noch eine alte Frau im Erdgeschoss. Aber die hat sich gar nicht rausgewagt. Na ja, und für die Frau vom Meier gilt dasselbe, die hat sich auch nicht aus der Wohnung getraut. Den Schuss hat sie allerdings ebenfalls gehört.«
»So ein Mist – was ist denn überhaupt passiert?«, forderte Keller unwirsch.
Ohne zu antworten, ging Sarno durch die Diele voraus und blieb im Türrahmen zur Küche stehen. Keller und Kosminsky bot sich ein ungewohnter Anblick. Morde, besonders so brutale wie dieser hier, waren in der Hauptstadt der DDR durchaus nicht an der Tagesordnung. Jedenfalls nicht so alltäglich wie in West-Berlin und der BRD, wenn man der Aktuellen Kamera und den Nachrichtensendungen im Westfernsehen Glauben schenken durfte.
Der Mann saß am Küchentisch, den Kopf auf die Arme gelegt, als sei er eingeschlafen. Die riesige Blutlache rings um seinen Kopf allerdings berichtigte diesen Eindruck. In seinem kurzgeschorenen Nacken war ein blutiges, kleines Loch zu sehen, dafür fehlten große Teile des Gesichtes, weil sie auf der Tischplatte und dem gegenüberliegenden Spülstein lagen.
»Der Tote heißt Helge Dietrich, geboren 1921 in Rendsburg, in der heutigen BRD.«
»Ich weiß, wo Rendsburg ist«, unterbrach Keller den Leutnant. »Wär’ er bloß im Westen geblieben, dann hätte er sich das hier erspart – und uns auch. Machen Sie weiter, Genosse Sarno.«
»Ja also, da gibt’s nicht viel. Aufgesetzter Schuss im Nacken. Der massiven Verletzung des Gesichtes nach zu schließen vermutlich ein Hohlmantelgeschoss. Nichts, was man so bekommen kann oder beispielsweise ein Jäger zur Verfügung hätte – wir von der K übrigens auch nicht. Ich würde denken, solche Munition wird eher im militärischen oder vielleicht im terroristischen Umfeld benutzt. Das wäre ja dann eher was für das Kommissariat 9, nicht für uns. Hm... ja, aber wir haben das Geschoss noch nicht gefunden; die Spurensicherung ist noch dran.«
Keller hörte Sarnos langatmigen Ausführungen kaum noch zu. Ihn beschäftigte die Frage, was ein anscheinend harmloser, alleinstehender Rentner, der in recht ärmlichen Verhältnissen lebte, anstellen musste, damit er zur Zielscheibe einer Terrorgruppe oder eines Geheimdienstes oder was auch immer wurde. Denn eines war klar: Das hier war keine Streiterei unter Betrunkenen, bei der sich ein Schuss gelöst hatte, oder ein missglückter Wohnungseinbruch. Das hier war eine Hinrichtung mit professionellem Werkzeug und wenigen Spuren durch jemanden, der genau wusste, was er tat – und das sicherlich nicht zum ersten Mal.
»Nun gut, Genosse Sarno. Sie sind mir vor Ort für die ordnungsgemäße Sicherung der Spuren verantwortlich. Und finden Sie um Himmels willen das Projektil, das sollte uns eine ganze Menge über den Täter – oder meinetwegen die Täter – verraten.« Ehe Leutnant Sarno zu einer Antwort ansetzen konnte, fuhr Keller fort: »Ich möchte so schnell wie möglich den Obduktionsbericht auf dem Tisch haben. Finden Sie heraus, wer dieser Dietrich war und warum er bei uns in der Republik gelebt hat – und seit wann. Vielleicht bringt uns sein Lebenslauf auf die richtige Fährte. Auf irgendwelche Zeugen können wir ja wohl nicht hoffen... Ach ja, und suchen Sie mir alle Verwandten von diesem Dietrich, zur Not auch in der BRD. Das werden Sie ja schon irgendwie hinkriegen. Ich verlasse mich auf Sie.«
»Wird erledigt, Genosse Hauptmann. Montagmorgen haben Sie einen ersten Bericht von mir auf dem Tisch. Wenn Doktor Dochnaal von der Gerichtsmedizin durch ist, bekommen Sie den Obduktionsbericht umgehend.«
»Danke.« Bevor Keller sich zum Gehen wandte, warf er noch einen Blick in die Küche. Der Mann hatte wirklich keine Reichtümer. Nicht einmal ein Backofen gehörte zur Einrichtung. Außer dem uralten Spülbecken, dem Küchentisch und zwei Holzstühlen, gab es nur einen kleinen Unterschrank, auf dem zwei elektrische Herdplatten standen.
Als sie wieder in ihrem Dienstwagen saßen, wandte sich Keller an seinen Partner. »Kollege Kosminsky, ich habe ein verdammt übles Gefühl bei diesem Fall.«
Acht
Dienstag, 8. November 1988
Einen Tag nach Peters Bericht über die Mumien saß Lisa wieder in ihrer alten Besenkammer hinter der Restaurierungswerkstatt. Es fiel ihr heute schwer, sich zu konzentrieren, und noch immer hatte sie keinen Erfolg mit ihren widerspenstigen Textfragmenten. Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und streckte sich ausgiebig. Durch die geöffnete Tür konnte sie Hilla bei der Arbeit an einem Fundstück sehen. Klar, als Schriftexperte brauchte man nicht so viel Platz, nur ein paar Bücher und einen Schreibtisch. Trotzdem hätte sie gern wenigstens ein Fenster gehabt.
»Wie kommst du voran, Hilla?«, erkundigte sich Lisa mehr aus Überdruss an ihrer eigenen Arbeit als aus echtem Interesse. Sie neidete Hilla ein wenig ihre vergleichsweise simple Aufgabe. Die vorläufige Sicherung der Kleinfunde und erste Zusammensetzungsversuche der Keramik waren dankbar, wenn auch vielleicht etwas langwierig. Aber es gab eigentlich nichts, was Hilla dabei im Weg stehen konnte.
»Och, na ja... bisher sind die Funde ziemlich gut erhalten, wenig zu tun bis auf Scherben puzzeln. Ich glaube, der Spaß kommt erst noch, wenn wir tiefergehen.«
»Ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch tiefergehen können«, entgegnete Lisa.
»Doch doch, Bergen hat schon einige Stellen ausgesucht, die jetzt testweise abgetieft werden. Mal sehen, was dabei herauskommt«, klärte Hilla sie auf.
»Das habe ich gar nicht gewusst!«
Hilla pustete sich die Haare aus der Stirn und lächelte sie ein wenig schief an. Lisa wandte sich irritiert wieder ihren Schriftzeichen zu.
An diesem Nachmittag erklärte Bergen Peter und Lisa, was sich auf der Grabung ereignet hatte, während sie Innendienst schoben. Weit davon entfernt, schon alles auf das »Mumienniveau« abgetieft zu haben, war er auf die Idee gekommen, an einigen ausgewählten Baustrukturen ein Stück tiefer zu graben, um Hinweise auf die Besiedlungsdauer der Anlage zu gewinnen.
Peter fühlte sein Gesicht glühen. War er nun Grabungsleiter, oder nicht? Dann sollte Bergen ihm wenigstens offen sagen, dass er von nun an allein entschied. Aber diese Diskussion wollte er nicht vor den übrigen Grabungsteilnehmern führen.
»Und diese unorthodoxe Grabungsmethode hat nichts damit zu tun, dass Sie genau wissen, dass wir nächstes Jahr gar nicht wieder an Al-Wass’ Tür zu klopfen brauchen, wenn wir nicht bald eine Meldung machen?«, fragte er um Höflichkeit bemüht.
»Geh mir nicht auf die Nerven, Peter.«
Anders als sonst sah Lisa nicht aus, als gönne sie Peter den Rüffel, und sie sprang ihm sogar bei: »Machen wir es denn wegen Al-Wass, Professor?«
»Nein, der Affe aus Kairo hat nichts damit zu tun. Ich habe da bloß so ein Gefühl. Kann sein, dass Sie nicht wissen, wovon ich spreche, aber als Archäologe muss man Instinkt haben. Und mein Instinkt sagt mir, dass hier etwas seltsam ist. Und dem sollten wir schnell nachgehen.«
Peter verdrehte die Augen. Lisa schürzte die Lippen und sagte doch tatsächlich: »Na ja, Professor, das ist ja das, was Herr Conrad und ich seit zwei Wochen sagen. Ich frage mich bloß, wie uns da die Information über eine Mehrphasigkeit der Siedlung weiterhelfen könnte.«
»Und sehen Sie, Fräulein Franks, das ist eben der Unterschied zwischen uns beiden. Ich weiß einfach, dass sie uns helfen wird.«
Eingebildeter Pinsel, dachte Peter. Und gleichzeitig hatte er das dumme Gefühl, dass sich Bergens Vermutungen wieder einmal als richtig erweisen würden.
Vier Tage lang durften Peter und Lisa auf die Grabungsfläche zurück. Lisa hätte nicht gedacht, dass sie einmal so froh sein würde, im staubigen Sand zu sitzen und Profile zu kratzen. Einziger Wermutstropfen war, dass sie sich die Schnittleitung teilen mussten. Bergen wies Peter und Lisa einen Arbeitertrupp zu, mit dem sie nun schrittweise einen Teil der Fläche abtiefen sollten. Nach Konsultation der elektromagnetischen Karten und der Übersichtskarte, die sie aus den Grabungsplänen der ersten zwei Wochen zusammenmontiert hatten, hatte Bergen sich für eine fünf auf fünf Meter große Fläche im Bereich einer größeren Straßenkreuzung entschieden.
Während die arabischen Jungen und jungen Männer Spitzhacken und Schaufeln in den festgebackenen Sand trieben, gab es für die Archäologen zunächst nicht viel zu tun. Sie umrundeten den Schnitt und hielten die Augen nach Funden offen. Normalerweise gingen sie bei Grabungen in solchen relativ gut erhaltenen Gebäuderesten nicht so zimperlich vor, und es wurden üblicherweise zwanzig, dreißig Zentimeter auf einmal abgetragen, wenn die Mauerverläufe bekannt waren. Aber heute waren die Männer auf Bergens Weisung hin vorsichtig und entfernten die Schicht in mehreren Schritten. Einige Male mussten sie die Arbeit unterbrechen, weil Lisa etwas ins Auge fiel. Diesmal gleich neben der Außenmauer eines größeren Gebäudes. Das Glänzen, das sie gesehen hatte, entpuppte sich als eine kleine Fayence-Statuette. Peter holte den Spiegel, den sie brauchten, um die Fundstücke mit dem elektronischen Theodoliten zentimetergenau einzumessen.
Bergen stand selbst an dem neuen Gerät, und Lisa sah, dass Paul Herman danebenstand und nervös von einem Fuß auf den anderen trat. Er hatte den Part des Grabungstechnikers übernommen, weil er von ihnen allen noch am geschicktesten war, was Technik anging. Allerdings hatte niemand vorhergesehen, welche Menge an Einmessungen sie hier erwartete. Paul hatte das Handbuch der nagelneuen Wild-Heerbrugg Einmessstation nun schon zweimal durchgearbeitet, und Lisa war sich sicher, dass er sie im Traum beherrschte. Trotzdem war er unsicher und fürchtete jeden Tag wieder, dass er irgendeinen Fehler bei der morgendlichen Einrichtung und Kalibrierung gemacht haben könnte. Auch er kannte Bergens Einstellung zu Fehlern nur zu gut. Lisa konnte die Nervosität des jungen Mannes zwar halbwegs verstehen, aber bei dem Druck, unter dem sie ohnehin arbeiteten, trug sie nur noch mehr zur angespannten Stimmung bei, und das war kein Gewinn. Sie hörte Bergen etwas murren, und Pauls Gezappel hörte schlagartig auf.
»C-23. 243,45 m. 235,66 m. 1,54 m«, rief Bergen über die Köpfe der anderen Arbeitstrupps hinweg. Lisa notierte die Koordinaten auf dem vorgedruckten Fundzettel, während Peter die Schutzkappe wieder auf den Spiegel setzte.
Sie holten Dutzende von Artefakten aus dem Schnitt, an diesem und den folgenden beiden Tagen. Und auch sonst erfüllte Bergens Plan seine Erwartungen.
Hilla beaufsichtigte einen etwas abseits gelegenen Grabungsschnitt, den Bergen am Vortag scheinbar aus dem Blauen heraus festgelegt hatte, und kam schon nach wenigen Stunden freudestrahlend zu Peter gelaufen. Wenigstens einer schien sich noch zu erinnern, wer offiziell verantwortlich war. Sie hatte eine massive Ansammlung von Lehmziegeln entdeckt, die mit großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich die von Bergen postulierte Umfassungsmauer war. Mehr würden sie am nächsten oder übernächsten Tag wissen.
Währenddessen tauchten in den übrigen Grabungsschnitten, unter den Fundamenten der jüngsten Bauphase, also der Zeit, als die Bewohner des Ortes umgekommen waren, deutliche Zeichen einer vorherigen Besiedlung auf. Die Mauern, auf die sie stießen, waren aus demselben Material erbaut, aber in einer etwas anderen Weise gemauert und leicht versetzt. Die Straßen in jener Zeit waren auch ein wenig schmaler gewesen.
Als sie eine dritte, noch ältere Phase eindeutig identifizieren konnten, gab es keine Möglichkeit mehr weiterzuarbeiten, ohne die darüberliegenden Baustrukturen abzubauen. Und das kam bei dem derzeitigen Stand auf der restlichen Grabungsfläche nicht infrage. Also wurde Peters und Lisas Zeit im Außendienst einmal mehr für beendet erklärt, und es hieß für Peter zurück an die Mumien, die sich in den Lagerräumen aneinanderreihten wie alte Frauen in den Arztpraxen; und für Lisa zurück an die leidigen Textfragmente.
Am folgenden Sonntagmorgen hatte Lisa, wahrscheinlich weil sie sich vier Tage lang mit etwas ganz anderem beschäftigt hatte, eine Erleuchtung. Es lag gar nicht allein an den winzigen Bruchstücken, in die so gut wie alle Texte zerfallen waren, dass sie bei der Zuordnung und Übersetzung nicht weiterkam.
Lisa sprang auf und begab sich fast im Laufschritt zu ihrem Zimmer. Es lag in dem Flügel des Grabungshauses, der zu dieser Uhrzeit völlig verlassen war. Sie warf die Tür zu dem Zimmer auf, das sie sich mit Hilla teilte, fiel auf die Knie und fischte mit den Armen nach der großen Büchertasche, die sie unter dem Bett verstaut hatte. Mit den Wörterbüchern und Zeitschriften, die sie seit Beginn der Grabung nicht hervorgeholt hatte, kehrte sie in ihr Arbeitszimmer zurück und begann zu blättern. Wie bei einem Fundort aus der frühen Spätzeit zu erwarten gewesen war, hatten sie hieroglyphische Inschriften (wie auf ihrem Türsturz), hieratische und auch ein paar wenige demotische Textfragmente gefunden. Aber nicht alle Hieroglyphen, die sie vor sich sah, passten in diese Zeitstellung, wie ihr nun klar wurde.
Lisa stütze den Kopf auf und nahm eine Tabelle zur Hand, die die zeitliche Veränderung besonders prägnanter Hieroglyphen nachzeichnete. Im Alten und Mittleren Reich hatten Hieroglyphen und die hieratische Variante mehr oder weniger gleichberechtigt nebeneinander existiert. Die einen wurden vorwiegend auf Gebäuden, also für monumentale Inschriften verwendet, die anderen meist auf Papyrus, auch für nicht-religiöse Texte. Erst etwa im siebten Jahrhundert vor der Zeitenwende war eine grundlegende Neuentwicklung eingetreten, die Einführung der demotischen Schrift. Von da an hatte man diese sehr viel abstraktere Schriftvariante für profane Texte benutzt und das Hieratische war eine religiöse Schrift geworden. Das Komplizierte an der ganzen Sache lag darin, dass die Ägypter zwar jahrtausendelang die gleichen Zeichen nahezu unverändert verwendet hatten, sich die Sprache aber verändert hatte, nicht anders als im Deutschen oder Englischen. Wer konnte heute schon noch das Mittelhochdeutsche des Mittelalters verstehen? Ähnlich verschieden waren auch die Sprachstufen des sehr frühen Altägyptisch, des lange Zeit dominierenden Mittelägyptisch und schließlich des Neuägyptischen.
Als Lisa erneut auf die schwer zu entziffernden Textpassagen und Bruchstücke blickte, wurde ihr endlich klar, weshalb sie solche Schwierigkeiten bei der Übersetzung der vielen verschiedenen Textschnipsel hatte. Die verschiedenen Zeichen sahen nicht bloß so verschieden aus, weil sie von verschiedenen Schreibern stammten oder die einen mit Tusche auf Papyrus geschrieben, die anderen in Stein gemeißelt worden waren. Sie sahen so eigenartig unterschiedlich aus, weil sie unterschiedlich waren. Die Sprachstufen, in denen die einzelnen Texte verfasst waren, entstammten völlig verschiedenen Epochen, vom Alten Reich bis zum Niedergang des Neuen Reiches; die Textfunde dieser Grabungsfläche deckten eine Zeitspanne von über zweitausend Jahren ab! Und das erklärte auch, weshalb immer wieder frühe Versionen der Sargtexte neben Abschnitten aus den neuägyptischen Unterweltsbüchern aufzutauchen schienen.
Lisa arbeitete sich an diesem und dem nächsten Tag so weit durch die Transkriptionen, die sie angefertigt hatte, dass sie sich sicher war, dass sie sich nicht alles bloß eingebildet hatte. Das fehlte ihr noch, sich beim Briefing mit Bergen bei einem groben Schnitzer erwischen zu lassen.
»Es ergibt keinen Sinn, und ich habe keine plausible Erklärung dafür, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich nicht irre!«
»Sehr schön, Fräulein Franks. Wenn Sie jetzt noch gesagt hätten, wovon sie überhaupt sprechen, würden Sie mich ganz Ohr vor Ihnen sitzen sehen«, kommentierte Bergen, aber diesmal prallte seine Ironie von Lisa ab.
»Ich spreche davon, dass wir es zum einen – wenigstens bisher – ausschließlich mit religiösen Texten zu tun haben und dass die Texte zum anderen aus verschiedenen Jahrtausenden stammen.« Lisa hatte ein Glimmen in den Augen, das Peter verriet, wie sehr sie sich auf diesen Auftritt gefreut hatte. »Nachdem ich auch die frühesten Sargtexte und Pyramidentexte in den Abgleich mit einbezogen habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass sich letztlich alle Inschriften unserer Grabung einem der heiligen Texte zuordnen lassen. Mit ein paar weiteren, nicht-kanonischen Zaubersprüchen vielleicht...«
»Religiöse Texte in einem Dorf wie diesem?« Bergens Blick wechselte irritiert zwischen Peter und Lisa hin und her. Es war klar, dass auch er keine Erklärung parat hatte, also fragte er: »Und was sagen Sie nun als Philologin zu so einem Befund?«
»Als Philologin sage ich, dass es ein überaus ungewöhnlicher und wissenschaftlich hochinteressanter Umstand ist, der es erlauben könnte, die Entwicklung der ägyptischen Religion in einem ganz neuen Licht erscheinen zu lassen. Aber wenn Sie mich nach vergleichbaren Fundumständen fragen, dann glaube ich nicht, dass in ganz Ägypten bislang eine solche Menge heiliger Texte außerhalb von Grabanlagen oder Tempelruinen aufgefunden wurde.«
»Das war auch mein Eindruck. Können Sie mir etwas Genaueres zu den Textpassagen sagen, um die es sich handelt?«, hakte Bergen nach.
»Geben Sie mir noch eine Woche, Professor. Jetzt, wo ich weiß, wonach ich suchen muss, werde ich es schon herausbekommen.”
Keiner der Konferenten war wohl besonders zufrieden mit dieser Erkenntnis, aber immerhin bedeutete es, dass sie Hilla, die sich mit den Scherben beschäftigte, aus ihrer Misere halfen. Die grabungserfahrene Studentin hatte sich einige Tage bemüht, ihre Verunsicherung zu verbergen und auch auf Lisas Fragen nach der Datierung der Keramiken nur ausweichende Antworten gegeben. Nun endlich traute sie sich aus ihrer Deckung.
»Na ja, das passt jedenfalls ziemlich gut zu dem, was ich festgestellt habe«, bestätigte Hilla aufgeregt. »Die Artefakte und vor allem die Keramikformen, die die Arbeiter aus Peters und Lisas Schnitt geholt haben, sind nämlich auch zu alt. Oder zu jung. Je nachdem, wie wir nun datieren.«
Neun
Dienstag, 15. November 1988
Dass etwas nicht stimmte, merkte am frühen Morgen zunächst niemand. Halbschlafend machten sich Bergen, Hilla, Layla und Thomas auf den Weg zur Grabungsfläche. Keinem fiel auf, dass Paul mit seiner Messstation fehlte, bis sie die Absperrungen der Grabungsschnitte vor sich sahen und im rötlichen Sonnenaufgang aus den Toyota-Jeeps kletterten.
»Neigt Herr Herman zu solchen Unpünktlichkeiten?«, erkundigte sich Bergen unwirsch bei Hilla und Layla, die aber beide den Kopf schüttelten.
»Im Gegenteil, unser Paul ist äußerst gewissenhaft. Sie haben ihn doch erlebt!«
Bergen brummte etwas und erlaubte Hilla, mit den Wagen ins Grabungshaus zurückzufahren und Paul zu holen – natürlich mit seinen besten Grüßen. Aber Paul hatte nicht verschlafen, lag nicht krank in seinem Bett und war nirgendwo in dem weitläufigen Gebäude zu finden. Schließlich schreckte Hilla auch Peter und Lisa aus ihren Büros auf, damit sie ihr bei der Suche halfen.
»Ich verstehe das nicht. Gestern Abend war er doch noch hier, und er war wie immer. Selbst wenn er die Nase von Bergens Meckerei voll gehabt hätte, traue ich ihm nicht zu, dass er sich einfach absetzt.« Peter sah die beiden Frauen fragend an, und Lisa machte mit ausgebreiteten Händen eine ratlose Geste. Hilla hingegen wich seinem Blick aus, behauptete aber eisern, nichts weiter zu wissen.
»Ich wette, dass Paul wieder auftaucht. Wo soll er schließlich mitten in der Nacht hingegangen sein? Wir sind nicht gerade in Kairo. Ich wüsste nicht einmal, wie er dieses Kaff hätte verlassen sollen«, meinte Peter schließlich. »Fehlt denn etwas von seinen Sachen?«
»Es sieht nicht so aus«, erklärte Hilla nach kurzem Nachdenken. Dann wurde ihr Gesicht mit einem Male blass, und Peter schickte sie in Lisas Begleitung zurück auf ihr Zimmer. Er würde selbst mit Bergen sprechen.
Wie Peter erwartet hatte, reagierte Bergen in erster Linie mit Unmut auf die Nachricht von Pauls rätselhaftem Verschwinden. Dann war er beleidigt, weil Paul den Fortgang seiner Grabung behinderte. Erst nach zwei Umkreisungen des Grabungsgeländes fragte Bergen nach Peters Meinung.
»Denkst du, dass mehr dahinter steckt? Ich meine, könnte ihm irgendetwas zugestoßen sein?«
»Ich weiß es wirklich nicht, Professor. Aber... er hat nichts mitgenommen. Und alle Gerätschaften sind da. Möchten Sie, dass ich ins Dorf fahre und bei der Polizei eine Meldung mache?«
Bergen strich sich durch den kurzen Bart und wedelte sein Tuch einige Male über die Stirn. »Ich sage dir, was wir machen. Wir geben Paul drei Tage. Wenn wir dann nichts von ihm gehört haben... Dann überlasse ich dir die Entscheidung.«
»Herr Professor! Paul ist verschwunden, ohne eine Spur. Finden Sie nicht, dass wir es ihm schuldig sind nachzuforschen? Es wäre immerhin möglich, dass er...«
»Was denn, Peter? Verschleppt wurde? Ohne, dass es einer von uns bemerkt hat? Und selbst wenn es so wäre, dann müssten wir auf Nachricht von seinen Entführern warten. Ich sage dir: Er hat das Grabungshaus höchstwahrscheinlich freiwillig verlassen, also geben wir ihm Gelegenheit, in gleicher Weise zurückzukommen.«
Peter nickte und behielt seine Zweifel für sich. Er verstand Bergens Wunsch, die Grabung wenigstens noch einige Tage zu schützen. Und Peter hatte eigene gute Gründe, noch ein paar Tage unbehelligt von Polizei und Antiquitätenverwaltung weiterarbeiten zu wollen. Ihm war inzwischen klar geworden, dass die Mumien, die sie gefunden hatten, noch weitere Besonderheiten außer ihrer Ermordung aufwiesen. Zuerst hatte er sich die auffälligen Proportionsverschiebungen oder verwachsenen Gelenke als natürliche Vorkommnisse in einer solchen Population erklärt. Immerhin waren sie hier auf etwas Einmaliges, absolut nie Dagewesenes gestoßen: eine mehr oder weniger vollständige Dorfbevölkerung. Da musste man als Anthropologe schon damit rechnen, dass Befunde auftauchten, die alles andere als alltäglich waren. Trotzdem musste er sich eingestehen, dass ihm die Häufigkeit der Skelettdeformationen etwas unheimlich vorkam.
Und noch etwas anderes bereitete Peter zunehmend Kopfzerbrechen. Er fand zwar schwach deformierte Schädel (ein Fall von leichter Hydrokephalie) verwachsene Hüftgelenke (vielleicht ein Unfall in der Kindheit) und gleich drei Fälle von Hasenscharten (sicherlich Blutsverwandte), aber was er überhaupt nicht fand, das waren die Dinge, die hätten da sein sollen. Nicht eine einzige der adulten, vollständig ausgewachsenen Mumien zeigte die typischen Abnutzungserscheinungen an Wirbelsäule und den am meisten belasteten Gelenken.
Seit sich die Anthropologie einen Platz in der ägyptologischen Forschung erobert hatte, wurden immer mehr ägyptische Mumien auf ihren allgemeinen Gesundheitszustand hin untersucht. Erst vor Kurzem hatte eine britische Kollegin mit ihren Untersuchungen des katastrophalen Zahnzustandes der alten Ägypter Aufsehen erregt. Und sie hatte erstaunliche, aber plausible Schlussfolgerungen über Ernährungsgewohnheiten und Nahrungszubereitung gezogen.
Und hier saß Peter mit seinen verdammten Mumien, die sich allerbester Gesundheit erfreut hatten – von einigen, meist erblich bedingten Schädigungen einmal abgesehen. Aber keine Arthrose, keine Karies oder sonstige Krankheiten, die im Altertum zur Normalität gehörten. Dann war jemand gekommen, um ihnen allen die Kehle zu durchtrennen oder ein Messer in die Brust zu stoßen.
Als hätte er seine Gedanken mitgehört, klopfte Bergen ihm auf die Schulter und zwinkerte ihm verschwörerisch zu.
»Du willst dir doch von Herrn Hermans Verschwinden nicht die Aussicht auf die wissenschaftliche Entdeckung deines Lebens nehmen lassen.«
Peter schluckte seine Bedenken herunter und schüttelte den Kopf. Nur drei Tage, sagte er sich. Aber er wollte sich nicht ausmalen, was passieren würde, wenn Paul bis dahin nicht wieder aufgetaucht war.
Pauls Verschwinden hatte für Peter und die Studenten auch etwas Gutes, denn Bergen sah sich angesichts der Kälte, mit der ihm besonders Hilla, Lisa und auch Layla begegneten, genötigt, seine Studenten stärker ins Vertrauen zu ziehen und in seine Gedanken einzuweihen, als er das für gewöhnlich auf seinen Grabungen zu tun pflegte. Mit unkooperativen Mitarbeitern hatte auch ein Professor Carl Bergen schlechte Chancen. So lud er seine Studenten am nächsten Vormittag zu einem Briefing. Und in der Art, wie er seine Studenten immer mit Geschichten und Anekdoten überzeugte, die genau auf den Punkt trafen, so gelang es ihm auch diesmal, die Bedeutung ihrer Funde zu einem erstaunlichen Bild zu verweben.
»Ich habe Sie hierher gebeten, um Ihnen einen Eindruck davon zu verschaffen, was ich sehe, wenn ich auf der Grabung stehe und mir das anschaue, was Sie mir in den vergangenen Tagen geliefert haben. Die Mumien, die Texte, die Funde.« Bergen nickte ihnen einem nach dem anderen zu, und Peter bewunderte seinen Doktorvater einmal mehr für seine Führungsqualitäten, die ihm selbst so abgingen. Hilla und Layla blickten gebannt zu Professor Bergen auf.
»Wir sind hier auf etwas Einmaliges gestoßen, einen Jahrhundertfund, der jedem von Ihnen einen Platz in der Geschichte der Archäologie bringen wird – wenn wir klug und schnell vorgehen. Aber es ist nicht nur einfach etwas Neues. Es ist ein echtes Rätsel. Ich bin mir sicher: Wenn wir nicht in der Lage sind herauszufinden, was passiert ist, dann kann das keiner. Deshalb sind wir alle hier – so sehe ich das. Das ist so etwas wie Vorsehung.« Nicht einmal in der Situation, in der sie momentan steckten, konnte Bergen es lassen, kleine Provokationen einzustreuen. Und die Reaktionen auf Anspielungen und Zitate aus der deutschen Vergangenheit, speziell aus dem Dritten Reich, bereiteten ihm besondere Freude.
»Nichts von dem, was wir gefunden haben, ergibt irgendeinen Sinn!«, fuhr Bergen fröhlich fort. »Wir haben hier eine Siedlung gefunden, die sich über wenigstes zehn Hektar erstreckt, soweit wir das bisher überblicken können. Wir befinden uns etwa 90 Kilometer südöstlich von Gizeh und damit außerhalb des fruchtbaren Nildeltas, in der Wüste. Soweit wir das nachvollziehen können, lag das Dorf, welches wir hier ergraben, auch zu altägyptischen Zeiten im Wüstensand, recht weit außerhalb der Oase Faiyum. Der Weg zur nächsten Wasserquelle war mindestens drei Kilometer weit. Eine sehr seltsame Standortwahl für eine Siedlergemeinschaft, nicht wahr?«
Ohne eine Antwort auf diese rhetorische Nachfrage abzuwarten, fuhr Bergen fort: »Aber damit nicht genug. Unsere Siedlung scheint auch noch mit einer starken Befestigung umgeben zu sein; gerade so, als hätten die Bewohner Angriffe befürchtet. Genauso rätselhaft erscheint mir, dass wir außerhalb der Stadtmauern praktisch fundleeres Niemandsland vorfinden. Keine Abfallgruben, keine Bestattungen – nichts, was man an einem normalen Siedlungsplatz vermuten würde. Auch nicht bei einer festungsähnlichen Anlage. Nicht einmal einen Verkehrsweg zu unserem Dorf hier haben wir bisher gefunden.
Wenn nicht so viel dagegen spräche, würde ich behaupten, wir hätten ein antikes Alcatraz vor der Nase. Aber, wie gesagt, dagegen spricht der außerordentlich gute Gesundheitszustand der ‚Insassen’. Der ist zweifellos auf eine hervorragende Versorgungslage und eine besondere Ernährung zurückzuführen; sie bestand jedenfalls nicht aus den im damaligen Ägypten üblichen sandverseuchten Getreideprodukten. Sonst hätten die Bewohner unserer Nekropole die kariösen Zähne ihrer Pharaonen und Landsleute vorzuweisen. Zudem dürften die ehemaligen Inhaber der gefundenen Skelette nur wenig körperliche Arbeit verrichtet haben, denn bei den eigentlich zu erwartenden Abnutzungserscheinungen – Fehlanzeige. Und auch die Sehnenansätze, an den Knochen deuten eher auf eine schwache Muskulatur hin. Vielleicht war es ja ein Prominentengefängnis mit Spezialdiät.« Bergen erlaubte sich einen kurzen Lacher, bevor er seinen Vortrag fortsetzte.
»Aber auch dagegen sprechen, vor allem anderen, drei erstaunliche Fakten. Fast alle Bewohner hatten, trotz ihres guten Allgemeinzustandes, mit mehr oder minder starken Einschränkungen durch Erbkrankheiten zu kämpfen. Das typische Spektrum reicht von Schädel- und Kieferdeformationen, bis zu Gelenkverwachsungen und Deformationen der Langknochen. Wie es mit der Erbsubstanz und genetischen Defekten aussieht, werden wir wohl hoffentlich bei späteren Untersuchungen im Institut oder in unserem Uniklinikum in Steglitz erfahren. Es sieht so aus, als wären viele unserer Mumien miteinander näher verwandt. So weit die Erkenntnisse, die wir unserem hervorragenden Grabungsanthropologen und Ausgrabungsleiter Peter Conrad zu verdanken haben.«
Er ließ die Spitze eine Sekunde im Raum stehen und als niemand reagierte, wechselte er das Thema.
»Zweite Unstimmigkeit: Das gesamte Grabungsareal ist mit religiösen Texten übersät, die man eher einer Nekropole oder kultisch ausgerichteten Stätte zuordnen würde, keinesfalls jedoch einem Gefangenenlager. Kommen wir jetzt zum dritten und nach meiner Meinung seltsamsten Punkt unseres Befundes. Der betrifft in erster Linie die Erkenntnisse von Fräulein Franks.
Die Textfragmente, die wir gefunden haben, scheinen aus einer Zeitspanne von rund zweitausend Jahren zu stammen. Die ältesten Funde könnte man etwa auf Djosers Zeit, also auf den Beginn des Alten Reiches, datieren, die jüngsten dagegen in die Zeit des Untergangs der Ramessiden, also ans Ende des Neuen Reiches. Dies wird auch von den Keramik- und Kleinfunden gestützt, mit denen sich Hilla Roth beschäftigt hat. Auch dieses Fundinventar erstreckt sich über etwa zweitausend Jahre ägyptischer Kultur.
Dass ausgerechnet ein VIP-Gefängnis für Erbkranke über eine so lange Zeit in einer so unwirtlichen Umgebung von den verschiedensten Herrscherdynastien ohne zwischenzeitliche Auflassung betrieben wurde, halte ich für eine gewagte These.«
An dieser Stelle konnten sich die Zuhörer ein Grinsen nicht verkneifen.
»Und nachdem der letzte Pharao beschlossen hat, diese zweitausendjährige Institution aufzulösen, werden die Insassen kurzerhand gemeuchelt und die reichlich vorhandenen Inschriften zerstört.« Mit einem Blick in die ratlos dreinblickende Runde kam Professor Bergen zum Ende seiner Grabungsbesprechung. »Wenn ihr mich fragt, Kinder, sind wir hier sowas von auf dem Holzweg.«
Zehn
Donnerstag, 17. November 1988
»Ich begreife nicht, warum Bergen so tut, als wäre nichts passiert. Was ist denn, wenn Paul etwas zugestoßen ist?« Lisa stellte eine dampfende Tasse vor Peter auf den Schreibtisch und ließ sich auf einen Hocker fallen, wobei sie sich mit Kaffee bekleckerte.
»Ja, ich weiß. Direkt nach seinem Monolog habe ich nochmal versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er die Polizei verständigen muss.«
»Na ja, so sehr haben Sie sich da wohl nicht bemüht«, stellte Lisa fest, aber sie wirkte nicht wirklich, als nähme sie es ihm übel.
»Du kannst mich ruhig duzen«, entgegnete Peter, der sich neben den zehn Jahre jüngeren Grabungsstudenten sowieso schon alt fühlte.
»Okay.«
»Und ich habe tatsächlich mit Bergen gesprochen. Aber Paul ist immerhin schon... wie alt?«
»Zweiundzwanzig«, antwortete sie.
Eine Weile tranken sie schweigend den starken ägyptischen Sud, der hier als Kaffee galt. Peter beobachtete, wie Lisa die Mumien betrachtete. Ihre mittelblonden Haare waren lang, steckten aber unter einer Mütze, und obwohl sie momentan nur noch im Grabungshaus arbeiteten, trug sie ihre ausgebeulten Hosen und weiten Männerhemden. Peter wusste nicht, ob er froh sein sollte, dass sich Lisa nicht als Nachfolgerin von Inga entpuppte, einer völlig grabungsungeeigneten Nagellackfetischistin, die er zwei Jahre zuvor auf Bergens Geheiß hatte mitnehmen müssen – aus was für Gründen auch immer; oder ob er Lisas völliges Desinteresse an Kosmetik und modischer Kleidung eher verstörend finden sollte.
»Hallo, Peter? Ich rede mit dir.« Lisa verdrehte die Augen. »Meinst du, unser Paul könnte etwas in sein Grabungstagebuch geschrieben haben, was uns weiterhilft?«
»Ich... ich habe keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass Paul eins geführt hat, wo er doch immer nur an der Einmessstation gestanden hat. Lass uns nachschauen.«
Lisa hatte sich ein Bild von Paul gemacht, das vor allem aufgrund seiner ständigen Nervosität nicht das günstigste war. Immerzu hatte Paul an irgendetwas herumgenestelt oder seine Brille verschoben oder an seinen Ärmeln gezogen. Als sie nun sein Grabungsjournal durchblätterte, war sie erstaunt, dass es ordentlich und lesbar war.
»Ich fasse es nicht, dass er die ganze Zeit alle Messwerte mitgeschrieben hat!« Peter wirkte tatsächlich, als könnte er seinen Augen kaum glauben. »Wozu die moderne Technik, wenn nicht mal die Leute, die sie bedienen, ihr vertrauen?«
»Paul hatte eben Angst, dass irgendetwas verlorengehen könnte. Disketten sind ja schnell mal defekt.«
»Dann hätten wir uns die Investition in die Einmessstation und die beinahe zehntausend für den Toshiba auch gleich sparen können.«
Lisa zuckte mit den Schultern und blätterte zu der letzten beschriebenen Seite. Außer einigen Fragezeichen in roter Tinte und ein paar handschriftlichen Berechnungen war sie leer, bis auf den sorgfältig daruntergesetzten Satz Niveauunterschied ergibt überhaupt keinen Sinn, Fundensemble 455 prüfen!
Und das war es, was Lisa und Peter taten, ohne zu ahnen, was sie damit in Gang setzten.
»Das ist ja meine Mumie«, stellte Lisa erstaunt fest, als sie das Ensemble mit der Nummer 02-NM-455 in der improvisierten ‚Leichenhalle’, wie sie den Lagerraum seit dem Auffinden so vieler Mumien nannten, gefunden hatten.
Peter seufzte. »Ach ja, nachdem all die anderen Mumien kamen, bin ich einfach nicht dazu gekommen, sie zu untersuchen. Und da ihr Schädel so zertrümmert ist, wollte ich damit sowieso lieber bis Kairo warten.«
Falls Lisa ahnte, dass er die Mumie in der hintersten Ecke unter einem vollgestapelten Tisch einfach völlig vergessen hatte, dann sagte sie nichts. Kein Zweifel, Lisa mochte Mumien nicht sonderlich. Sie versuchte, Abstand zu halten, half aber, die provisorische Bahre hinüber ins Untersuchungszimmer zu tragen.
»Du kannst auch rausgehen«, bot Peter ihr an, aber Lisa guckte ihn böse an und beugte sich trotzig über das zertrümmerte Gesicht.
»Was meint Paul mit Niveauunterschied? Und was soll mit dem Fundensemble sein?«
Peter deutete wortlos auf eine kleine Pappschachtel, in die Layla bei der ersten Routineuntersuchung alle losen Kleinteile gelegt hatte. Bis auf ein paar textile Fetzen war sie noch leer. Während Lisa sich das spärliche Inventar ansah, nahm Peter einen Erfassungsbogen aus der Schublade. Wenn er schon dabei war, konnte er die vergessene Mumie auch sachgerecht aufnehmen. Mit Handschuhen tastete er die Leiche der Länge nach nach weiteren Fundstücken ab, aber wie bei allen anderen auch gab es keine Amulette oder andere Kleinfunde am Körper. Solche Funde hätten für eine Bestattung gesprochen, aber die lag bei diesem Leichnam ebenso wenig vor wie in den übrigen Fällen.
»Wonach suchst du?«
»Nach irgendetwas Besonderem. Immerhin ist das hier die einzige Mumie, die nicht nur unter Sand lag.«
»Sondern teilweise auch noch unter einem zentnerschweren Türsturz. Der Schädel sieht ja wirklich fürchterlich aus.« Lisa schien ihre Abneigung nun besser im Griff zu haben und musterte besagten Körperteil mit gerunzelter Stirn.
Peter lenkte seine Aufmerksamkeit auf die verdorrten Gliedmaße zurück. Die Haut der Mumie war erstaunlich gut konserviert, besser noch als bei den anderen Exemplaren, und es war sogar ein Großteil der Kopfbehaarung erhalten geblieben. Peter notierte auf dem Datenblatt zunächst die offensichtlichen Merkmale männlich und adult. Dann griff er nach dem Maßband, das an einem krummen Nagel an der Wand hing, und nahm die Gesamtlänge des Toten.
»Guck mal, das hier sieht wie ein Loch aus«, sagte Lisa plötzlich, während Peter noch die Körpermaße notierte. »Wurden viele durch einen Stich in den Kopf getötet?«
»Bitte was?«
Aber Lisa hatte recht. Der einzige nicht zersplitterte Teil der Schädelkalotte, das Os Frontale, wies tatsächlich ein rundes Loch auf, das Peter stutzig machte. Mit einem Mal hatte er ein ganz, ganz mieses Gefühl bei der Sache. Und es kam noch schlimmer, als er einer Eingebung folgend den Kiefer der Mumie aufzwang.
»Was ist das?« Lisa bemerkte seinen Gesichtsausdruck und beugte sich gegenüber von Peter über die Mumie. Mit einer kleinen Taschenlampe leuchtete Peter in die Mundhöhle, und da sah sie es auch. »Das ist doch nicht das, wofür ich es halte?«
Elf
Dienstag, 1. November 1988
Eiligen Schrittes verließ Helmut Stankowski das Café Atlas in Berlin-Mitte. Er trug die fast uniforme Kleidung ostdeutscher Rentner, die sich aus dem eingeschränkten Angebot an grau-grell gemusterten Kunstfaserstrickpullovern ergab – und daraus, dass er keine Verwandten im Westen hatte. Sonst wirkte er beinahe ungewöhnlich gepflegt, glattrasiert, die Haare sehr kurz getrimmt. Dies gehörte zu den Teilen seiner frühen Erziehung, die er nie hatte ablegen können. Ebenso wie sein zackiger Gang und die auffällig gerade Haltung. Stankowski achtete weder auf die Fußgänger, von denen ihm einige unfreundliche Blicke zuwarfen, noch auf den eiskalten Wind, der Sturmwolken über den Himmel trieb. Seine fadenscheinige Polyesterjacke hielt ihn kaum warm, aber seine Gedanken waren so weit weg, dass er es nicht bemerkte. Im ersten Moment hatte er geglaubt, sich verlesen zu haben, aber dann dieser Name... Da hatte er gewusst, dass die Vergangenheit nicht so vergangen war, wie er es sich vierzig Jahre lang eingeredet hatte.
Stankowski hatte, wie jeden Dienstag und Freitag, an seinem Stammplatz im Café am Alexanderplatz gesessen, als sein Blick auf die zusammengefaltete Zeitung des Mannes neben ihm gefallen war. Es war keine der üblichen Journalien, die Aufmachung sah gleich nach Westzeitung aus. Der ganze Mann sah nach Westen aus. Der Gast am Nachbartisch hatte sein Starren bemerkt und ihm mit einer gönnerhaften Geste den Teil der Zeitung zugeschoben, den er beiseitegelegt hatte.
»Gönnen Sie sich ein bisschen freie Presse, Kumpel«, hatte der Mann ihm augenzwinkernd zugeraunt. Es war keineswegs Stankowskis Gewohnheit, sich von einem halb so alten, blasierten Westler herablassend behandeln zu lassen, aber er nickte bloß, zog mit einem gemurmelten Dankeschön die Berliner Abendzeitung zu sich heran und las. Der Bericht war denkbar kurz, aber er fühlte sich wie in der Zeit zurückgeworfen von den Erinnerungen, die mit einem Mal auf ihn einstürzten. Wie lange hatte er nicht mehr an die ganze Angelegenheit damals gedacht. Und doch waren ein paar Sätze und ein Name alles, was es brauchte, um ihn völlig außer Fassung geraten zu lassen. Geistesabwesend hatte er den Artikel herausgetrennt, wobei ihn sein Tischnachbar verdutzt beobachtet hatte.
»Sie können auch die ganze Zeitung mitnehmen«, bot er an, aber Stankowski schüttelte bloß den Kopf. Er brauchte diesen Artikel, damit er auch morgen früh noch glauben konnte, was er gelesen hatte.
Was war das? Stankowski blieb stehen. Er war ganz automatisch in Richtung seiner winzigen Wohnung gegangen und stand nun in einer menschenverlassenen Seitenstraße. Die Fenster waren dunkel und eine Straßenbeleuchtung gab es hier nicht. Stankowski starrte mit klopfendem Herzen in das Halbdunkel. Er hatte doch gerade Schritte gehört. Mit einem Mal erschien ihm der Heimweg zu lang – es mochten noch gut drei Kilometer sein, und er war schließlich kein junger Mann mehr. Stankowski schob den Ärmel über seiner Armbanduhr hoch und sah, dass es noch nicht einmal sechs Uhr war. Wenn er zur Haltestelle Prenzlauer Allee ging, dann konnte er den allergrößten Teil des Heimweges mit der Straßenbahn zurücklegen. Die zwanzig Pfennig würde er verschmerzen können, sagte er sich. Mit einem Kribbeln im Nacken wandte er sich zurück in Richtung Hauptstraße. Ihm war, als würde ihn jemand beobachten. Er zwang sich, nicht schneller zu werden und so leise zu gehen wie möglich. Ein paar Male wandte er sich im Gehen unauffällig um. War da jemand? Oder spielten ihm seine Nerven einen Streich? Mit einem erleichterten Seufzen sah Stankowski die Lichter der Prenzlauer Allee am Ende der Straße auftauchen. Er war nur noch ein Dutzend Schritte von der Einmündung entfernt, an der sich die Haltestelle der Straßenbahn befand, als er schon das entfernte Quietschen von Eisenrädern in den Schienen hörte. Entschlossen, die Bahn nicht zu verpassen, beschleunigte Stankowski seinen Schritt, bis er beinahe lief. Als er die Prenzlauer Allee erreichte, war er sich sicher, dass er tatsächlich verfolgt wurde. Womit er nicht rechnete, war der harte Stoß in seinen Rücken, der ihn nach vorne warf, genau vor die Fahrerkabine der Straßenbahn 71.
Zwölf
Donnerstag, 17. November 1988
Peter schaltete die Taschenlampe aus und sah zu Lisa auf. »Doch, ich fürchte es ist das, wofür du es hältst. Das hier ist ohne jeden Zweifel eine Amalgamfüllung.«
Lisa sank auf ihren Hocker, ohne es zunächst zu bemerken, so verblüfft war sie und so überwältigt von den Implikationen ihres Fundes. »Soll das... heißt das...?«
Aber Peter hörte ihr, wieder einmal, nicht zu. Er hatte den Mund der Mumie wieder geschlossen und suchte nun den Schädel millimeterweise mit einem Vergrößerungsglas ab.
»Du hattest recht, das Loch ist von der Tatwaffe verursacht worden. Nur«, Peter schob vorsichtig eine Pinzette in einen Riss oberhalb der Stirn und leuchtete mit der Taschenlampe hinein, »war es kein Messer, sondern eine Pistole.«
Mit diesen Worten holte er ein stumpfes, leicht längliches, metallenes Objekt aus der Wunde. Oder der »Beschädigungsstelle« von Mumie 455. Obwohl sie wusste, dass es albern war, machte Lisas Magen einen deutlichen Unterschied zwischen antiken und subrezenten Überresten. Sie schluckte.
»Das ist eine Patrone, oder?«
»Ein Projektil.« Peter ließ seinen Fund auf ihre Handfläche fallen, und sie zwang sich, nicht daran zu denken, wo er noch kurz zuvor gewesen war. »Ich kenne mich mit Waffen nicht besonders gut aus. Zumindest nicht mit modernen... Aber das kann wohl nichts anderes als eine Kugel sein. Der Größe nach würde ich auf eine Pistole oder einen Revolver tippen.«
Peter suchte die Mumie noch einmal von Kopf bis Fuß ab, fand aber keinen Hinweis auf die Identität des Toten. Nicht, dass sie erwarteten, einen Ausweis zu finden, aber zumindest etwas, was den Zeitpunkt seines Todes ein wenig eingrenzte, doch nichts...
»Das ist wirklich merkwürdig. Viel länger als vielleicht hundert, hundertfünfzig Jahre kann er hier ja noch nicht liegen.«
»Vielleicht hat man ihn ausgezogen?«, schlug Lisa vor.
Peter nickte und zog die Latexhandschuhe mit lautem Schnappen von seinen Fingern. Sie deckten den Leichnam vorsichtig wieder mit Leinentuch ab und trugen die Bahre zurück ins Magazin.
»Hier seid ihr also!«, klang es plötzlich hinter ihnen.
Lisa fuhr erschrocken zu Hilla herum, die im Türrahmen stand und misstrauisch zwischen ihr und Peter hin- und herblickte. Unauffällig ließ Lisa das Projektil aus ihrer Hand in die Hosentasche gleiten.
»Musst du dich so anschleichen, du hast mich fast zu Tode erschreckt!«, fuhr Peter Hilla an.
»Ich habe nur gedacht, ihr wärt jetzt auch noch verschwunden und ich wäre bald die Einzige hier mit Bergen«, erwiderte Hilla empört.
»Wieso, deine Freunde Thomas und Layla sind ja schließlich auch noch da«, gab Lisa unschuldig zurück, und beide mussten plötzlich lachen.
Nach dem Abendessen, dem eigentlichen Grund für Hillas Suche nach Lisa und Peter, nahm Peter Professor Bergen beiseite und sie verschwanden in seinem Büro. Lisa wusste, dass er dem Professor von ihrem überaus merkwürdigen Fund berichten wollte. Sie hatten entschieden, das Ganze zunächst vor den Studenten und den anderen Grabungsteilnehmern zu verheimlichen, denn eine neuzeitliche Leiche – selbst wenn sie mumifiziert war – konnte unangenehm werden. Peter hatte ihr erklärt, dass die Arbeiter trotz des Fortschritts noch immer abergläubisch waren und die Macht der Toten fürchteten. Vielleicht blieb das in einem Land wie Ägypten nicht aus, in dem die Toten seit Urzeiten Macht und Ansehen genossen hatten. Lisa hatte eingeworfen, dass die Ägypter immerhin das größte Volk von Grabräubern in der Geschichte waren; aber vielleicht war genau das der Grund für ihre besondere Furcht vor Rache aus dem Jenseits. Aber auch von potentiellen Schwierigkeiten mit den Arbeitern abgesehen, gab es gute Gründe, die Sache vorerst für sich zu behalten. Schließlich war die Stimmung im Grabungsteam seit Pauls Verschwinden ohnehin nicht die beste.
Nach wenigen Minuten kam Peter schon wieder aus dem Zimmer des Professors und verschwand sichtlich aufgebracht in die einsetzende Dämmerung vor dem Grabungshaus.
»Was hat er jetzt schon wieder gesagt?«, hörte Lisa jemanden fragen, als sie aus der Tür ins blendende Abendlicht trat. Hilla und Peter saßen auf der zusammengeschusterten Bank aus zwei Stahlkanistern und rohen Brettern, die von den Transportkisten für die Messgeräte und die Werkzeuge stammten. Es war den einheimischen Arbeitern einfach nicht beizubringen, dass es nicht sinnvoll war, Transportkisten, die man schließlich für die Rückreise wieder brauchte, für improvisierte Tische, Bänke und Möbel auseinanderzunehmen. Aber diese, aus deutscher Sicht planlose, Herangehensweise kannten sie schon von Ausgrabungen in den Anden; wobei man dort tatsächlich oft kein Baumaterial besorgen konnte. Doch hier war Faiyum, wo man so ziemlich alles Nötige bekam, nicht weit.
»Ach, manchmal frage ich mich wirklich, warum ich mir das hier antue. Bergen interessiert es einen–« Als Peter Lisa sah, verstummte er. Mit einer kleinen Entschuldigung an Hilla zog er Lisa hinter sich her und nuschelte als Erklärung, dass er einen Spaziergang bräuchte, um sich zu beruhigen.
Lisa hatte Peter noch nie so aufgebracht gesehen, trotzdem ärgerte sie sich über sein Verhalten. »Noch auffälliger hättest du dich Hilla gegenüber ja kaum benehmen können. Sie hat bestimmt längst gerochen, dass wir etwas verheimlichen!«
»Ach, was soll’s! Soll Bergen sich doch den Kopf zerbrechen, was er mit einer neuzeitlichen Leiche auf seiner Grabung anfängt.« Eine Weile stapften sie schweigend durch das Geröll und den Sand auf dem Weg, der das Grabungshaus mit dem Grabungsareal verband. Es lag knapp drei Kilometer außerhalb von Qarun, dem nordwestlichsten Zipfel der Oase Faiyum. Das Tageslicht würde noch vielleicht eine Stunde ausreichen, danach brach rasch die Finsternis herein, die abseits der stärker befahrenen Routen nur gelegentlich von Straßenlampen erhellt wurde. Hier, mitten im Nirgendwo, außerhalb jeglicher Siedlung gab es keine öffentliche Beleuchtung.
Die atemberaubende Landschaft rund um die Oase beruhigte Peters Nerven etwas. Hinter ihnen lag das grüne Ackerland der Bauern, vor ihnen begann die Wüste mit beeindruckenden, schroffen Klippen. Und rechts von ihnen glänzte der große Birket Qarun im Abendlicht. Obwohl er längst vom Süßwasser- zum Salzwassersee geworden war, bildete er eine der Lebensadern dieser immer noch fruchtbaren Gegend.
Nach etwas mehr als dreißig Minuten hatten sie den steilen Wegabschnitt erreicht, der sie hinauf auf die Klippe bringen würde. Als Peter sich hinter Lisa den Geröllpfad hinaufquälte, konnte er sich die Landschaft vor mehr als dreitausend Jahren mit einem Mal vorstellen. Der See war viel größer gewesen und sein altes Ufer hatte eben diese Klippe gebildet, die heute als steile Sandsteinwand unvermittelt in der Wüste aufragte. Damals hatte ihre Fundstätte also nicht ganz so weit vom nördlichen Rand des Sees entfernt gelegen. Trotzdem war die Lage für eine Siedlung äußerst seltsam, denn durch das nach Norden ansteigende Gelände war der Boden hier niemals fruchtbar gewesen. Nur südlich und östlich des Sees, entlang des speisenden Nilarmes, hatte man Ackerbau betreiben können. Und nur diese fruchtbaren Zonen waren schon über tausend Jahre vor Anbeginn der ägyptischen Zivilisation bewohnt gewesen; der Ackerbau, der genau hier in der Faiyum vor mehr als siebentausend Jahren in Ägypten eingeführt worden war, hatte das Alte Reich erst ermöglicht.
Aber warum sollten sich hier, in Blickweite der Kornkammer Ägyptens Menschen niederlassen, die niemals für ihr eigenes Auskommen sorgen konnten? Ihr Ausgrabungsobjekt erinnerte nicht so sehr an ein Gefängnis, dachte Peter, sondern an abgelegene Klöster.
Die Sonne hatte sich im Westen beträchtlich dem Wüstenhorizont genähert, als er und Lisa schließlich das Areal der Grabung erreichten. Ein paar einsame Ziegen zupften am spärlichen Dünengras, ansonsten war keine Bewegung zu sehen.
»Bist du bereit für ein paar Überstunden?«
»Also gibt es doch einen Grund, weshalb wir bis hier gelaufen sind und uns auf dem Rückweg wahrscheinlich den Hals brechen?«, fragte Lisa.
Peter hielt ihr grinsend eine große Stabtaschenlampe entgegen. »Außerdem haben wir beinahe Vollmond.«
»Und ich hab mich schon gefragt, warum du deinen halben Hausstand mitschleppst«, kommentierte Lisa mit Blick auf seine prallgefüllte Umhängetasche. »Also, was suchen wir?«
Peter legte den nicht mehr ganz aktuellen A3-Übersichtsplan, der im Gegensatz zum detaillierten Grabungsplan nur die Lage der Suchschnitte, der Grabungsschnitte und einiger Orientierungspunkte enthielt, auf ein flaches Mauerstück am Rand der ausgegrabenen Anlage und orientierte ihn so wie die vor ihnen liegenden archäologischen Überreste.
Lisa blickte zwischen Plan und Realität hin und her, und die Merkwürdigkeit des Ganzen wurde ihr erneut deutlich. An einigen Testschnitten, die Bergen in den letzten Tagen rund um das Siedlungsareal angelegt hatte, waren die beeindruckenden Reste einer gewaltigen Mauer zutage getreten; meterbreite Ziegellagen zeichneten sich deutlich im sandigen Boden ab, und an einer Stelle, die nur wenige Meter von Lisas und Peters Standort entfernt war, hatte Bergen den Eckpunkt der Umfassungsmauer lokalisiert. Ein ungefähr fünf mal fünf Meter messender pylonartiger Befestigungsbau hatte diese strategisch wichtige Stelle markiert. Sonst ähnelte der Mauerzug dem, den Lisa von der Grab- und Tempelanlage der berühmten Stufenpyramide Pharao Djosers in Sakkara kannte: eine von zahllosen Nischen gegliederte, perfekt rechteckige Mauer, die in Sakkara über zehn Meter hoch gewesen war. Bergen hatte diese Ähnlichkeit auch erkannt und nach Toren gesucht, bislang jedoch nur Scheintore gefunden, diese merkwürdigen Elemente ägyptischer Architektur, die echten Toren bis aufs Haar glichen, nur dass sie solide vermauert waren, wo sie eigentlich hätten Einlass gewähren sollen.
Doch anders als bei der Tempelanlage von Sakkara waren im Inneren dieser trutzigen Mauer keine Gebetshallen oder Kapellen, sondern nur Straßen und scheinbar normale Wohnhäuser zu finden. Ungewöhnlich an den Gebäuden selbst war, dass sie in planvoller Präzision ausgerichtet und ihre Grundmauern bis heute erhalten waren, denn nur vergleichsweise wenige Überreste von Wohnhäusern hatten in Ägypten die Zeiten überdauert. Am verwirrendsten aber war die Tatsache, dass die bescheidene Größe und die winzigen freien Flächen – wahrscheinlich Gärten – für eine eher untere bis mittlere Bevölkerungsschicht sprachen, die überaus sorgfältige und stabile Bauweise aber auf öffentliche oder religiöse Bauten deutete.
Damals wie heute noch in vielen Gegenden des Landes hatten die Fellahin, die Bauern, in schlichten, kaum als Häuser zu bezeichnenden Unterkünften gelebt, die oft nicht einmal die erste Nilschwemme überstanden. Doch das war kein Problem, weil nach dem Zurückweichen der Flut Schlamm für Ziegel reichlich zur Verfügung stand und der Neubau eines Hauses kaum eine Woche dauerte. Die Häuser der Reichen dagegen waren auf Haltbarkeit und Prunk angelegt und entsprechend großzügig mit Gärten, Höfen und mehreren Stockwerken versehen.
Lisa erinnerte sich noch sehr genau an Bergens Worte in seiner Vorlesung zur ägyptischen Baukunst: Alle ägyptischen Häuser ähnelten Bauernhöfen. So groß war die Bedeutung der Landwirtschaft immer gewesen, dass selbst die Häuser reicher Beamter und die Paläste des Pharao, Wirtschaftsräume und Magazine besaßen und so wie große Gutshöfe anmuteten. Die Häuser in ihrer Siedlung aber schienen Bergens Worten genau zu widersprechen.
»Ein bisschen erinnert das an die staatlichen Soldatenhäuser oder eine Variante von Deir el-Medina«, meinte Peter. »Aber ein Fort ist das hier sicher nicht gewesen, und eine Arbeitersiedlung ohne Grabanlagen im weiten Umkreis macht auch keinen Sinn. Es passt einfach wirklich nichts zusammen, da hatte Bergen schon recht.«
Lisa war ein wenig erstaunt über Peters Tonfall, der anzeigte, dass er dem Professor noch immer grollte. Sie hatte ihn immer für einen ziemlich unkritischen und anbiedernden Liebling des Professors gehalten, aber vielleicht hatte sie sich getäuscht.
»Lass uns sehen, ob wir auf irgendeine Idee kommen, was Paul mit seinem Tagebucheintrag gemeint haben könnte.« Peter faltete den Plan zusammen und verstaute ihn sorgfältig zwischen der übrigen Grabungsdokumentation wieder in der Tasche, ehe er hinunter in den abgetieften Grabungsschnitt sprang.
»Du hast sogar das Grabungstagebuch, die Planumszeichnungen und die Fundlisten dabei?«, fragte Lisa verwundert.
»Jo, nur den großen Plan konnte ich eben nicht mitnehmen«, Peter zuckte nur mit den Achseln und ging den Grabungsschnitt entlang. Ohne weitere Nachfrage folgte Lisa ihm.
Sie befanden sich auf einer schnurgeraden Straße, die Bergen auf etwa dreißig Meter Länge hatte freilegen lassen. Peter dachte an seinen Besuch in Pompeji vor zwei Jahren. Er hatte sich von Anna aus Interesse an den Opfern des legendären Vulkanausbruchs zu dieser Exkursion überreden lassen. Das Ende vom Lied war gewesen, dass der eingebildete Kunstgeschichtsfatzke, der die Fahrt leitete, die bemerkenswerten Leichenabdrücke in der vulkanischen Auswurfsschicht nicht einmal erwähnt hatte und ihnen im Museum zu wenig Zeit geblieben war, um mehr als einen flüchtigen Blick auf ein paar Wandfresken zu werfen.
Jedenfalls ähnelten die durchgängig bis auf Knie- oder Hüfthöhe erhaltenen Hauswände mit ihren Türdurchbrüchen und einem hier und dort erhaltener Treppenabsatz stark der untergegangenen römischen Stadt. Beim Durchstreifen der Ruinen bekam man einen guten Eindruck vom antiken Urzustand. Peter ging es oft so, dass er in Gedanken die Mauern nach oben verlängerte, hölzerne Türen und Fensterläden ergänzte und schließlich Menschen auf den toten Straßen wandeln sah. Vielleicht hatte er zu viele von diesen modernen Fernsehdokumentationen gesehen, vielleicht hatte er aber auch ein besonders gutes Vorstellungsvermögen für solche Dinge.
Peter führte Lisa bis an das grabungsbedingte Ende der Straße, wo sie wieder hinauf auf die heutige Geländeoberfläche stiegen. Drei eingetiefte Löcher im Boden verrieten noch, wo Paul den elektronischen Theodoliten aufgestellt hatte, um die Funde im Grabungsgrundriss einzumessen und die Höhe, in der die Funde lagen, zu ermitteln.
»Also, wie würdest du den Geländeverlauf hier beschreiben?«, fragte er Lisa nachdenklich, nachdem er sich selbst einige Momente orientiert hatte.
»Ich würde sagen, das Areal hier auf der Geländestufe war zur Zeit seiner Besiedlung beinahe horizontal. Das war sowas wie ein Felsplateau. Die Straße scheint jedenfalls keine Steigung zu haben.«
»Was wohl heißt, dass die Mumien alle mehr oder weniger auf gleichem Niveau gelegen haben dürften.«
Lisa fixierte einen Punkt in der Dämmerung und wandte sich dann plötzlich mit krauser Stirn zu ihm um. »Ich glaube, ich weiß, was Paul gemeint hat!« Sie hüpfte hinunter in den Grabungsabschnitt und marschierte los. »Lass uns noch einmal zu meinem Türsturz gehen, ich hab da so eine Idee.«
Peter holte Lisa ein, und bald waren sie am nördlichsten Ende der Ausgrabung angekommen. Der Türsturz lag noch immer dort, wo Lisa ihn drei Wochen zuvor auf die Seite gestürzt hatte.
»Also? Was ist deine Theorie?«
»An dem Freitag, als Hilla und ich die ersten beiden Mumien gefunden haben, da waren wir noch nicht mehr als sechzig Zentimeter unter dem rezenten Niveau, richtig?« Lisa peilte wieder über die Grabung. »Ich hatte gedacht, na klar, wir sind auf einer Tiefe, also liegen beide Mumien in einer Fundschicht. Aber guck mal von hier rüber zur Straße.«
»Ja Lisa, ich weiß, dass das Gelände nicht eben ist, es fällt leicht nach Südosten hin ab–« Peter war kurz davor, sich tatsächlich mit der flachen Hand vor die Stirn zu schlagen. Warum war er nicht selbst darauf gekommen, nachdem sie Pauls Notiz gefunden hatten? »Deine Mumie lag zu hoch... viel zu hoch.«
»Es sieht doch wirklich so aus, oder nicht?«
Ein merkwürdiger Laut unterbrach sie in diesem Moment. Es klang ein wenig wie ein leises Krächzen und Scharren.
»Was war das?«
Peter machte eine Geste, die Lisa zum Schweigen brachte. Einige Dutzend Meter nördlich von ihnen endete das ebene Gelände, wo eine weitere Klippe emporragte. Im tiefen Schwarz der Schatten an den Felsen und Vorsprüngen war nichts auszumachen, aber das seltsame Geräusch setzte sich fort. Wer oder was auch immer dort war, ließ sich nicht von ihnen stören. Erneut ein Schaben und dann eine Art Grollen.
»Vielleicht nur ein Hund«, flüsterte Peter Lisa zu, die näher an seine Seite getreten war. Er griff nach der schweren Stabtaschenlampe und leuchtete in die dunklen Flecken.
Beim dritten Schwenk sahen sie dann eine Bewegung hinter einem der größeren Felsbrocken. Es musste tatsächlich ein Hund sein, oder vielleicht auch ein wilder Schakal, von dem sie allerdings nur die Hinterläufe und den Schwanz sehen konnten. Mit einigen großen Steinen bewaffnet näherten sie sich der Stelle, darauf bedacht, dem Tier einen Fluchtweg zu lassen. Tollwut oder eine andere Infektion durch einen Hundebiss hätte ihnen gerade noch gefehlt. Sie hatten schon genug Probleme auf der diesjährigen Grabungskampagne, da mussten nicht auch noch Krankenhausaufenthalte hinzukommen.
Peter zielte einen Stein neben die Hinterläufe, traf aber offensichtlich besser, als er gewollt hatte; der Hund nahm heulend Reißaus und lief humpelnd bis an den Rand der Grabung. Dort legte er sich auf die Seite und begann an seinem Hinterlauf zu lecken.
Als Peter sich endlich sicher war, dass der Köter keinen Angriff im Sinn hatte, ließ er die restlichen Steine fallen; Lisa hatte anscheinend weniger Furcht vor streunenden Hunden, jedenfalls hatte sie den Felsbrocken bereits umrundet. Sekunden später war sie schon wieder neben ihm und klammerte sich an seinem Ärmel fest. Sie starrte Peter mit weit aufgerissenen Augen an und brachte kein Wort hervor.
»Was ist los?«, fragte er eher verwundert als beunruhigt.
Lisa zerrte ihn stumm um die Ecke des Felsens, und der Strahl seiner Maglight traf auf das, was das Interesse des Streuners erregt hatte.
Sie hatten Paul gefunden.
Dreizehn
Montag, 7. November 1988
Noch einmal nahm Hauptmann Keller die Akte zur Hand, als hoffte er, dieses Mal einen konkreten Hinweis auf den Täter zu finden, der den Rentner Helge Dietrich ermordet hatte. Außer dem Projektil, das die Spurensicherung aus der maroden Wand unter dem Spültisch in Dietrichs Küche gepult hatte, gab es kaum Erkenntnisse. Tatsächlich handelte es sich nicht um Standardmunition. Weiter brachte das Keller und Kosminsky nicht, weil die Herkunft nicht zu ermitteln war. Und der einzige Zeuge in diesem Fall war auch keine Hilfe. Seine erste Befürchtung, es hier mit Profis zu tun zu haben, erhärtete sich vor allem durch die Umstände der Tat. Nur die Tatsachen, dass es keine Einbruchsspuren gab und der Nachbar Meier sich erinnerte, dass die Tür unmittelbar nach dem Schuss geschlossen gewesen war, schienen bemerkenswert. Ganz offenbar hatte Helge Dietrich seinen Mörder selbst hereingelassen.
Die ärmliche Wohnung gab auch kaum etwas her. Dietrich besaß nur wenig Privates; in Wohn- und Schlafraum stand ein gerahmtes Foto von seiner Frau, das allerdings aus ihrer Jugend zu sein schien, und im einzigen Schrank fanden sich ein paar Aufnahmen, die offensichtlich aus seiner Zeit als Soldat stammten. Sie zeigten Dietrich und einige andere Soldaten vor einem Zeltlager in der Wüste. Im Hintergrund war eine Ansammlung größerer Holzkisten zu sehen, und auf einer der Fotografien stand Dietrich auf der Tragfläche eines zweimotorigen Militärflugzeugs. Auf die Rückseite hatte jemand mit Kugelschreiber »Faiyum 1943« geschrieben.
»Was hat denn die Gerichtsmedizin zu sagen?«
»Nichts, was uns weiterbringt, Chef«, begann Kosminsky seine Zusammenfassung. »Den Schmauchspuren nach zu urteilen ein aufgesetzter Schuss im Nacken. Die Kugel hat eine fürchterliche Verwüstung angerichtet und ist dann aus dem Vorderkopf ausgetreten. Im Putz unter dem Spülstein ist sie dann zum Stillstand gekommen. Was das bedeutet, haben wir ja gesehen.«
Keller nickte langsam und blickte ins Leere, erwiderte aber nichts.
»Leider hilft uns die Kugel auch nicht viel weiter«, fuhr der Oberleutnant fort. »Wir haben es hier, laut Spurensicherung, mit einem Teilmantelgeschoss zu tun. Als ich nach dem Hohlmantelgeschoss gefragt habe, das Genosse Sarno erwähnt hatte, haben die sich beinahe totgelacht und mir irgendwas von Hohlspitz- und Zerlegegeschossen erzählt. Na ja, egal, SpuSi-Humor. Bei diesem Teilmantelgeschoss jedenfalls liegt, kurz gesagt, die Bleispitze frei, was zu einer erheblichen Deformation beim Aufprall führt. So kann ein normales 9mm-Kaliber wie dieses hier«, er deutete auf ein Plastiktütchen, welches einen Inventarzettel und das Projektil enthielt, »leicht sein Kaliber verdreifachen oder vervierfachen. Das führt dann zu extremen Verletzungen. Solche Projektile haben eine hohe Mannstoppwirkung, wie mir der Kollege Schleicher von der SpuSi abschließend verraten hat.« Kosminsky verzog das Gesicht. »Die Krux dabei ist, dass neben Armee und der Staatssicherheit sogar einige Gruppen der Volkspolizei bei bestimmten Einsätzen diese Art von Munition einsetzen. So viel zu Leutnant Sarnos Einschätzungen...« Er ließ diese Erkenntnis wirken, aber Keller sagte immer noch nichts und zog stattdessen die Augenbrauen hoch.
»Kurz gesagt: Jeder, der eine 9mm-Allerweltspistole sein Eigen nennt, könnte unser Täter sein. Noch nicht einmal beim Modell ist sich die Ballistik sicher, weil wir die Hülse nicht haben.«
Keller wechselte das Thema. »Was wissen wir denn über das Opfer; hat der Genosse Sarno schon was recherchiert?«
Kosminsky blätterte in der Akte. »Da gibt’s nicht viel. Dietrich, Helge, geboren 1921 in Rendsburg, verheiratet, keine Kinder. Die Frau ist schon 1974 gestorben. Verwandte hat er auch nicht mehr, seine einzige Schwester ist letztes Jahr in Neumünster, in der BRD, gestorben.« Kosminsky stand auf und machte sich auf den Weg zur Kaffeemaschine. »Er ist sehr früh Soldat geworden ab 1940 Flieger im NSFK gewesen, das war das sogenannte Nationalsozialistische Fliegerkorps. Dort hat er anscheinend hauptsächlich Transportflüge gemacht, was ein bisschen seltsam ist, weil die eigentlich nicht in militärische Aufgaben eingebunden waren; und normalerweise nicht in Uniform Dienst getan haben. Das war nach den offiziellen Quellen mehr so eine Art Flugschule.«
»Auf den alten Fotos, die wir in seiner Kommode gefunden haben, ist er aber nur in Uniform zu sehen – offensichtlich während des Afrikafeldzuges«, ergänzte Keller. »Moment mal!« Er stand auf und warf dabei fast seinen Stuhl um. »Dieser Kerl, der letzte Woche Unter den Linden überfahren wurde...«
»Stankowski«, half Kosminsky.
»Ja, dieser Stankowski, der war auch in diesem Nationalsozialistischen Fliegerkorps; das gleiche Alter wie unser Mordopfer. Außerdem war er im Krieg wohl auch in Afrika – jedenfalls hat das seine Tochter erzählt. Und der Stankowski hatte nur diesen komischen Zeitungsausschnitt über eine Ausgrabung dabei, die die West-Berliner Uni in Ägypten macht. Und die Zeugen sagen, dass er mit hoher Sicherheit vor die Straßenbahn gestoßen wurde.« Er setzte sich wieder und rutschte beinahe von der Stuhlkante ab. »Ich habe das trotzdem eher für einen Unfall gehalten – aber jetzt? Wir brauchen diesen Zeitungsausschnitt, irgendwas war da mit den Fotos bei Dietrich.«
»Moment, Chef.« Oberleutnant Kosminsky ging hinüber zum Aktenschrank und zog zielsicher die Akte Helmut Stankowski hervor, auf der mit rotem Buntstift geschrieben die Anmerkung »Straßenbahnunfall« stand. Auf dem Rückweg füllte er gewohnheitsgemäß seine Kaffeetasse auf.
Keller blätterte die Akte durch und nahm den knitterigen Zeitungsartikel heraus, der mit einer Büroklammer an das Ende des dünnen Berichts geheftet war.
in der ägyptischen Wüste
Der Rest des Artikels, der offensichtlich aus dem West-Berliner Abendkurier stammte, fehlte.
»Das ist es. Das ist es, verdammt. Das ist Stankowskis Verbindung mit Helge Dietrich!« rief Keller und klopfte mit dem Zeigefinger energisch auf den Zeitungsausschnitt. »Die Oase Faiyum, mein Lieber. Faiyum. Das hat unser Mordopfer auf eines seiner Fotos aus dem Afrikafeldzug geschrieben.«
Vierzehn
Donnerstag, 17. November 1988
Sie liefen Hals über Kopf den Weg zurück von der Grabungsfläche zum Grabungshaus. Keiner von ihnen sprach ein Wort. Peter konnte einfach nicht fassen, was er gerade gesehen hatte.
Sie schlitterten gefährlich die Schotterpiste an der ersten Klippe hinunter. Der Lichtkegel der Taschenlampe hüpfte im Rhythmus seiner Schritte, und die meiste Zeit folgten sie der Richtung der tiefen Spurrillen der schweren Geländewagen, die sich dunkel gegen den Sand abzeichneten.
In weniger als der Hälfte der Zeit, die sie hinauf zur Grabung gebraucht hatten, schafften sie den Rückweg. Sie sahen bereits die ersten Palmen und Feldränder vor sich. Nur noch ein kleines Stück weiter und das Grabungshaus würde in Sicht kommen. Lisa blieb japsend an einen Strommast gelehnt stehen. Peter hielt neben ihr an und versuchte selbst, wieder zu Atem zu kommen. Er hatte keine Ahnung, wie er die fürchterliche Nachricht überbringen sollte, aber sie mussten zumindest Bergen sofort erzählen, was sie gesehen hatten. Und die Polizei musste man ja auch rufen. Peter kämpfte gegen die Übelkeit an, als er an das dachte, was von Pauls Gesicht übriggeblieben war.
Als Lisa wieder Luft bekam, gingen sie schweigend die letzten Meter Richtung Grabungshaus. Sie bogen eben um die Umfassungsmauer des Grundstücks, als ein Schuss die Luft zerriss.
Peter zerrte Lisa hinter einen der Toyota Land Cruiser der Grabungsmannschaft.
»Was war das? Was verdammt nochmal–«, raunte sie leise, aber Peter schob ihr die Hand vor den Mund und schüttelte entschieden den Kopf. Schließlich nickte sie und blieb stumm.
Peter fühlte sein Herz an der Kehle pochen, als er vorsichtig um den Vorderreifen des Geländewagens herumspähte. Der sandige Hof zwischen Garagen und Grabungshaus war leer, aber er sah frische Reifenspuren, die ein wahres Gewirr zeichneten und von mehreren Fahrzeugen stammen mussten. Nach Spur- und Reifenbreite zu schließen wahrscheinlich von Lastwagen.
Etwa eine Minute lang beobachtete er den Eingang zum Grabungshaus und die Fenster auf der ihnen zugewandten Seite, aber die Fensterläden waren geschlossen und an der Tür bewegte sich nichts. Was sollten sie nun machen? Was hatte der Schuss zu bedeuten?
Mit mehr Kaltblütigkeit, als er sich selbst zugetraut hätte, entschied Peter, dass sie näher ans Gebäude mussten, um herauszufinden, was im Haus geschah. Lisa kauerte neben ihm im Schatten und erwiderte sein Handzeichen mit einem Nicken. Geduckt schlichen sie zum Heck des Land Cruisers, hinter dem sie Deckung gesucht hatten. Von dort rannten sie in die Schatten der Garagen und dann weiter zur hinteren Umfassungsmauer des Hofes, vor der ein paar dürre Palmengewächse ihr Dasein fristeten. Sie huschten zwischen den Pflanzen an der Mauer entlang, die nach wenigen Metern an die Hauswand stieß. Tief geduckt erreichten sie das erste Fenster des Unterkunftsbereiches.
Ein lauter Schrei ließ sie beide zusammenzucken. Ein Mann stieß einen arabischen Fluch aus, den Peter zwar nur zur Hälfte verstand, der ihn aber sicher sein ließ, dass er diese Stimme noch niemals gehört hatte. Lisa schnitt eine aufgebrachte Grimasse in seine Richtung. Sie war längst beim zweiten Fenster, das zum Aufenthaltsraum gehörte, den sie ironisch »Salon« getauft hatten. Kurz schielte sie durch eine herausgesplitterte Ecke des Fensterladens, dann winkte sie Peter heran und zeigte mit ihren Fingern eine Sechs an.
Peter fühlte sich, als wären sie in einen schlechten Horrorfilm versetzt worden. Gleich würde seine Grabungsmannschaft – während sie einen Ausflug zur Fläche gemacht hatten durch einen außerirdischen Virus infiziert – als blutrünstige Zombies aus dem Grabungshaus stürmen und nach frischem Menschenfleisch lechzen. Als er sich vorstellte, wie Hilla als Untote aussähe, musste er unwillkürlich grinsen.
»Was ist so lustig?« raunte Lisa und tippte sich an die Stirn. Ohne eine Antwort rückte er näher an sie heran, um ebenfalls einen Blick durch die Lücke im Fensterladen zu werfen.
Das Grabungshaus, das die Philosophische Fakultät der Freien Universität Berlin in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Archäologischen Institut, einer der ältesten und renommiertesten altertumswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen der Welt, eingerichtet hatte, war von schwarzgekleideten, zum Teil vermummten Männern mit Gewehren und furchteinflößendem Auftreten gestürmt und okkupiert worden.
Peters Gedanken rotierten. Die ägyptischen Behörden und die Altertümerverwaltung hatten diese Grabung genehmigt; die Polizei in Faiyum und auch im Dörfchen Qarun kannte sie, hatte ihren Aufenthalt legitimiert und war ihnen eigentlich immer freundlich und interessiert begegnet. Wer zum Teufel sind diese Kerle?
Da begann der eine Mann wieder zu sprechen. Obwohl sein Arabisch nicht schlecht war, konnte Peter kaum etwas verstehen, denn der Mann sprach leise. Peter rückte wieder näher an die kaum handgroße Lücke im hölzernen Fensterladen, um wenigstens zu sehen, was geschah. Schläfe an Schläfe mit Lisa beobachtete er, wie Layla kopfschüttelnd auf die Fragen des verhörenden Soldaten – oder wer genau die Männer auch immer waren – antwortete. Der reagierte mit einer Ohrfeige.
Wegen des ungünstigen Blickwinkels sah Peter erst jetzt, dass auch Thomas in dem Raum war. Festgebunden an einen Stuhl saß er Layla gegenüber in einer Ecke des Salons. Auch bei ihm stand einer der Männer, die das Grabungsteam überfallen hatten. Im Gegensatz zu den anderen hatte er bisher noch kein Wort gesprochen und schien Laylas Verhör zu folgen. Außerdem war er älter als die anderen, offensichtlich arabischen, Angreifer; und sein Aussehen wirkte europäischer, obwohl er alles andere als hellhäutig war.
Thomas spürte, wie die Kabelbinder, mit denen seine Handgelenke an die Lehne des Holzstuhls gefesselt waren, in die Haut schnitten, sobald er versuchte, eine etwas bequemere Handhaltung zu finden.
Er war noch völlig verwirrt, weil alles so schnell gegangen war. Plötzlich standen diese schwarz vermummten Typen im Aufenthaltsraum, drehten ihnen in Sekunden die Arme auf den Rücken und fixierten Layla und ihn mit einer Menge Kabelbinder auf den alten Stühlen. So saßen sie jetzt seit zehn Minuten an Händen und Füßen gefesselt, und er fragte sich, was Bergen dazu sagen würde. Hatten sie den Professor auch erwischt? Und wo waren eigentlich Lisa und Peter? Was wollten diese Typen?
Der einzige nicht vermummte Eindringling hatte sich vor ihm aufgebaut und starrte ihn die ganze Zeit an, ohne ein Wort zu sagen, während der andere fortwährend auf Arabisch auf Layla einredete. Zwei weitere Männer standen mit Uzis neben den Stühlen, um sie in Schach zu halten, was eigentlich unnötig war, weil sogar ihre Füße an die Stuhlbeine gefesselt waren, und noch einmal zwei hatten sich neben der Tür postiert. Aus seiner Wehrdienstzeit, die er noch vor seinem Archäologiestudium abgeleistet hatte, kannte Thomas diese primitive israelische Maschinenpistole und wusste, wie gefährlich sie war. Da sie keinen herkömmlichen Verschluss hatte, sondern nur eine Art Federmechanismus, versagte sie äußerst selten und konnte sogar ins Wasser oder in den Dreck fallen, ohne eine Ladehemmung zu haben. Für den Einsatz in Wüstengegenden waren solche Eigenschaften natürlich sehr nützlich. Andererseits gingen diese Dinger manchmal schon los, wenn sie auf den Boden fielen oder irgendwo anstießen. Auf jeden Fall fuchtelte keiner mit einer geladenen Uzi herum – es sei denn, ihm war egal, wen er erschoss... oder er war schwachsinnig. Dass die offensichtlich arabischen Angreifer auf israelische Waffen zurückgriffen, weil sie nichts Gleichwertiges zur Verfügung hatten, schien ihm beinahe komisch.
Der Ältere mit den europäischen Gesichtszügen schien so etwas wie der Anführer zu sein. Er trug kein Tuch vor dem Gesicht, und es war ihm anscheinend auch völlig egal, ob seine Geiseln ihn wiedererkennen würden. Unvermittelt richtete er seinen Blick auf Layla.
»Koff, koff, Mahmud. Mach Pause, die Schlampe will uns offensichtlich nicht helfen. Mit der beschäftigen wir uns später.« Mit einem breiten Grinsen wandte er sich wieder Thomas zu. »Vielleicht ist dieses elend lange Milchgesicht ja kooperativer.«
Verwundert bemerkte Thomas, dass der Mann Deutsch sprach. Sofort hatte er einen schmerzenden Kloß im Hals, weil er seine Haut mit der Ausrede mangelnder Sprachkenntnisse wohl nicht würde retten können.
»Also, mein Freund«, der Mann ließ die Anrede ein paar Sekunden wirken, »wo sind die Pläne?«
Thomas starrte den Anführer der Truppe an, brachte aber kein Wort heraus. Der Mann wartete eine kurze Weile und versetzte ihm dann eine heftige Ohrfeige.
»Taub bist du ja wohl nicht. Wo sind die Pläne?«
»Ich... keine Ahnung... was für Pläne?« Wieder ein Schlag auf die gleiche Gesichtshälfte. Seine linke Wange brannte fürchterlich, und nach dem zweiten Schlag hatte er jetzt auch noch ein lautes Pfeifen im Ohr.
»Die Pläne dieser Ausgrabung, du Trottel. Was für Pläne?«, äffte er den verängstigten Studenten nach. »Also, wo sind die?«
»Ich... weiß es nicht. Wirklich.« Thomas erwartete die nächste Ohrfeige, die jedoch zu seiner Erleichterung nicht kam. Stattdessen sah ihn sein Peiniger nur einige Momente mit einem beinahe mitleidigen Blick an, ging an den großen Tisch in der Mitte des Aufenthaltsraums und nahm einen der Holzstühle. Er stellte ihn mit der Lehne zuerst vor ihm hin und setzte sich rücklings darauf, die Arme auf der Lehne verschränkt. Wie in einem schlechten Agentenfilm, dachte Thomas.
»Wie heißt du, mein Freund?«
»Thomas«, erwiderte er, völlig verdutzt über den veränderten Tonfall des Verhörers. Unter anderen Umständen kann dieses Arschloch bestimmt den netten älteren Herrn geben – genau wie Bergen, ging es ihm durch den Kopf.
»Du kannst mich Max nennen, wenn das unser Vertrauensverhältnis verbessert.« Er bedeutete seinen Leuten, die Maschinenpistolen zu senken.
»Also noch einmal, Thomas. Wo sind die Pläne und die Aufzeichnungen zu dieser Ausgrabung?« Während er auf die gewünschte Antwort wartete, griff er in die Seitentasche seiner Armeehose, holte betont langsam eine Luger hervor und lud sie durch.
Was für ein altertümliches Ding, wie aus dem letzten Krieg, dachte Thomas, ohne sich der Bedrohlichkeit von Max’ Geste bewusst zu sein.
»Die Grabungsdoku, ich meine Aufzeichnungen zur Grabung, die werden bei Bergen sein... oder Peter hat sie.«
»Peter? Peter wer?«
»Peter Conrad.«
»Und wo ist Peter Conrad jetzt?« Man merkte, wie Max sich bemühen musste, den freundlichen Tonfall beizubehalten.
»Keine Ahnung, wirklich. Beim Abendessen habe ich ihn noch gesehen. Mit Lisa.«
»Lisa?«
»Ja, Lisa Franks, eine von den Studentinnen, die hier mitgraben.«
»Und wo Lisa ist, weißt du natürlich auch nicht...«
»Nein... Ich denke, die ist mit Peter unterwegs.«
»Wohin?«
»Ehrlich, ich weiß es nicht, echt... Ich glaube, die wollten einfach nur nochmal raus... zum Reden. Auch weil Paul verschwunden ist seit–«
»Wo hat Peter Conrad sein Zimmer?« fiel ihm Max ins Wort.
»Hier in diesem Flügel, in der Mitte des Ganges. Hinter der Küche links.«
»Und diese Lisa?«
»Sie... sie ist mit Hilla auf dem Zimmer. Im anderen Flur. Die letzte Tür auf der rechten Seite.«
Max rief etwas zu dem Mann hinüber, den er Mahmud genannt hatte. Es folgte eine recht aufgebrachte Unterhaltung auf Arabisch, die von Mahmud mit einem schnappenden Laut abrupt beendet wurde.
Vielleicht können die sich nur so unterhalten, dachte Thomas.
Max wandte sich ihm wieder zu. »Unsere Leute haben alle Zimmer in diesem Trakt gründlich auf den Kopf gestellt. Hier sind die Aufzeichnungen nicht. Thomas, wo sind die Aufzeichnungen zur Ausgrabung?« Er nahm die alte Armeepistole, die er auf die Sitzfläche zwischen seine Beine gelegt hatte, wieder in die Hand.
»Ich weiß es doch nicht... Vielleicht hat Peter sie ja bei sich... das macht er manchmal... Ich weiß nicht, wo er ist.« Thomas war den Tränen nahe, halb aus Furcht, halb vor Wut über seine Hilflosigkeit in dieser Situation.
»Thomas, Thomas, du bist ein Idiot.«
Thomas hörte den Schuss und blickte ungläubig in das grinsende Gesicht des Anführers, als seine Kniescheibe und der Schienbeinkopf seines linken Beines zersplitterten. In der nächsten Sekunde spürte er einen unbeschreiblichen Schmerz, der nicht einmal Schreien zuließ. Warum?, dachte er, während ihm schwarz vor Augen wurde und er das Bewusstsein verlor.
Fünfzehn
Donnerstag, 17. November 1988
»Oh Mann, Scheiße«, zischte Lisa.
Peter bedeutete ihr, leise zu sein. Er zog sie vom Fenster weg, sodass sie nun an die Hauswand gelehnt hockten. »Wir müssen schleunigst hier weg. Behalt jetzt die Nerven und folge mir«, flüsterte er Lisa zu. Sie nickte und machte ihm ein Zeichen, dass er vorangehen sollte.
Vorsichtig darauf bedacht, auch ja kein Geräusch zu machen, schlichen sie geduckt an der Außenwand des Grabungshauses bis zur Gebäudevorderseite. Der Hof war immer noch leer und alles war ruhig. Den Gedanken, mit einem der Geländewagen wegzufahren, hatte Peter schnell verworfen. Immerhin hätte das einiges Aufsehen verursacht, mal ganz abgesehen davon, dass er das Risiko, den Fahrzeugschlüssel aus dem Haus zu holen, nicht eingehen wollte. Schließlich wussten sie nicht, mit wie vielen Angreifern sie es zu tun hatten; auf jeden Fall waren sie mit mehr als einem Auto angerückt. Sie hatten die Fahrzeuge selbst zwar nicht gesehen, aber vielleicht standen die sogar mit Fahrern in Bereitschaft auf der Gebäuderückseite. Nein, sie mussten zu Fuß flüchten, möglichst abseits der Straße.
Peter schaute Lisa an; und als sie ihn auch ansah, rannte er geduckt weg vom Haus in Richtung ihrer Ausgrabungsfläche, Lisa folgte ihm mit einigem Abstand. Als sie etwa zweihundert Meter in die Dunkelheit gelaufen waren, hielt Peter an und hockte sich hinter einen der seltenen Dornbüsche in den flachen Graben neben der Piste. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass alles ruhig war und man sie nicht bemerkt hatte, wandte er sich an Lisa.
»Alles klar?« Ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr er fort. »Wir laufen jetzt abseits der Piste bis hinauf zur Grabung. Aber wir gehen nicht rauf, verstehst du? Da werden die uns am ehesten suchen–«
»Ich bin ja nicht blöd«, flüsterte sie.
Peter ignorierte sie. »Wir gehen links... also westlich dran vorbei und nehmen den Trampelpfad hoch auf das zweite Plateau, oberhalb der Fläche. Von da aus haben wir eine gute Übersicht. Falls irgendjemand sich der Grabung über die Straße nähert, bekommen wir das mit.«
»Okay.«
»Da oben sehen wir dann weiter. Also los.«
Die Fahrbahn für die Grabungsfahrzeuge konnte man mit Fug und Recht eine unebene Schotterpiste nennen, auf der man sich schnell einmal den Fuß umknicken konnte – besonders in der Dunkelheit. Aber während Peter und Lisa etwa fünfzig Meter abseits der Piste durch die mit scharfkantigen Brocken übersäte Steinwüste stolperten, kam ihnen die erste Wanderung heute Abend auf der Piste fast wie ein Strandspaziergang vor. Aus Angst vor Entdeckung weigerte Peter sich auch, seine große Maglight-Taschenlampe anzuschalten. Und so stapften sie unter Lisas ständigem und Peters gelegentlichem Fluchen, aber ohne ein Wort zu wechseln, in Richtung Grabungsfläche. Nach einer halben Stunde zeichnete sich das Plateau, auf dem sich ihre Ausgrabung befand, als dunklere Erhebung schwach gegen die vom Mond angeleuchteten Klippen nördlich der Grabung ab. Sie waren noch mindestens einen halben Kilometer von ihrem Ziel entfernt, als Lisa anhielt und Peter aufforderte, ebenfalls stehenzubleiben.
»Hörst du das auch?«
»Ja, ich fürchte das sind Motorengräusche. Wahrscheinlich sehen wir gleich die Scheinwerfer.«
Sie lauschten angespannt und versuchten, auf der vielleicht hundert Meter entfernten Schotterpiste etwas zu erkennen. Tatsächlich sahen sie nach einiger Zeit einen Lichtschein aus der Richtung ihrer Unterkunft, der aber anscheinend nur sehr langsam näherkam.
»Was ist das? Zu Fuß laufen die ja wohl nicht. Oder glaubst du, die durchkämmen das Gebiet mit Suchhunden?«
Falls Lisa einen bösen Witz machen wollte, verfehlte er seine Wirkung nicht. Der Gedanke an Suchhunde trieb Peter trotz der Kühle, mit der eine typische Wüstennacht einherging, sofort Schweiß auf die Stirn. Wenn die Angreifer Hunde einsetzten, hatten ihr Verzicht auf Beleuchtung und der beschwerliche Weg abseits der Schotterpiste keinen Sinn, dann konnten sie gleich aufgeben. Offenbar realisierte auch Lisa das, jedenfalls sparte sie sich jede weitere Bemerkung in dieser Richtung.
Deckung gab es hier, abgesehen von den vielen Steinbrocken nicht; aber auch die waren selten höher als ein halber Meter. Sie gingen in die Hocke und warteten angespannt. Es vergingen ein paar Minuten, bis die Verfolger in Sichtweite kamen. Erleichtert stellte Peter fest, dass offenbar keine Hunde oder Fußtruppen im Spiel waren und die Wagen einfach nur sehr langsam fuhren.
Tatsächlich war das Überfallkommando mit großen MAN-Lkws unterwegs. Peter kannte diese unverwüstlichen Fahrzeuge noch aus seiner Zeit bei der Bundeswehr, schließlich hatte er auf den alten Lastern seinen Lkw-Führerschein gemacht. Keine Heizung, keine Servolenkung, kein synchronisiertes Getriebe und eine MG-Halterung, an der man sich jedes Mal den Ellenbogen aufschlug, wenn man versuchte, einen der sechs Gänge unter mächtig Zwischengas hineinzuprügeln. Aber dafür waren die Biester geländegängig wie ein Unimog und mit Hammer und Schraubenzieher zu reparieren.
Peter konnte mindestens zwei Fahrzeuge ausmachen. Da man auf der überplanten Ladefläche bequem sechzehn Soldaten samt Ausrüstung transportieren konnte, schätzte er, dass sie es wohl wenigstens mit fünfzehn oder zwanzig Angreifern zu tun hatten. Die sechs, die sie im Aufenthaltsraum beobachtet hatten, waren wohl nur die Spitze des Eisbergs.
Plötzlich sah Peter einen Lichtkegel auf sich zurasen. Er warf sich flach auf den Boden und riss Lisa durch einen groben Griff in ihren Nacken mit sich. Lisa quittierte das mit einem ihrer üblichen Flüche, was Peter, wie üblich, ignorierte.
»Verdammt, die Schweine benutzen Suchscheinwerfer, mit denen man eine Flak bestücken könnte.« Der Suchscheinwerfer bestrich jetzt für einen Moment die andere Seite der Piste.
»Deshalb fahren die auch so langsam. Die scannen einfach die gesamte Gegend bis zur Grabung ab. Natürlich haben die vermutet, dass wir in diese Richtung abhauen – aber vielleicht sind auch noch andere in Richtung Faiyum unterwegs.«
»Glaub’ ich nicht. Wenn die Truppe so groß wäre, dann hätten die auch das Grabungshaus umstellt und hätten uns schon längst gekascht.«
Wie ein Finger tastete der Lichtkegel des riesigen Suchscheinwerfers die Wüste ab. Jedes Mal, wenn er knapp über ihre Köpfe hinwegstrich, hielten sie vor Anspannung die Luft an und verstummten. Nach wenigen Minuten, die ihnen unendlich lang erschienen, entfernten sich die beiden MANs weiter in Richtung der Grabungsfläche und ließen sie im Schatten zurück. Ihre Verfolger fuhren tatsächlich auf das Plateau der Ausgrabung und ließen den Suchscheinwerfer über das Gelände streifen.
»Ich schlage vor, wir bleiben hier liegen, bis die wieder abziehen, sonst laufen wir denen doch noch in die Lampe«, raunte er Lisa zu, die das mit einem Nicken zu Kenntnis nahm. »Wenn die auf die Idee kommen, durchs Gelände zu laufen, robben wir weiter in Richtung Wüste. Du kannst doch robben, oder?«
»Blödmann, spar dir deine Witzchen«, zischte sie.
»Wer hat denn die Suchhunde ins Spiel gebracht? ich jedenfalls nicht!« Peter fand, dass der Galgenhumor die Situation durchaus auflockerte, beschloss aber, es nicht weiterzutreiben.
Viel konnten Peter und Lisa von ihrem Versteck aus nicht beobachten. Auf der Grabungsfläche wurde lautstark diskutiert, und jemand brüllte Befehle. Weil auch weiterhin mit dem Scheinwerfer die Umgebung nach ihnen abgesucht wurde, mussten sie in Deckung bleiben.
Nach etwa zwanzig Minuten verließ der Suchtrupp die Grabungsfläche wieder und bestieg die Lastwagen. Erst jetzt bemerkte Peter, dass auch noch ein offener Willis Jeep dazugehörte; sicherlich das Fahrzeug des »Kommandanten«. Der Trupp trat den Rückzug in Richtung Faiyum an; diesmal schneller und ohne Einsatz des Suchscheinwerfers. Als der Konvoi sie passiert hatte, warteten sie noch einige Zeit schweigend und setzten dann ihren Weg fort.
»Glaubst du, die haben Wachen auf der Grabung zurückgelassen?«, nahm Lisa das Gespräch wieder auf.
»Quatsch, warum sollten sie? Denen ist schon klar, dass wir sie gesehen haben und dass wir vermuten, dass sie uns am ehesten in der Nähe der Grabung finden.«
»Da hast du recht, die Grabungsfläche ist zu gefährlich... obwohl ich ja schon gerne gewusst hätte, was Paul passiert ist.«
»Hast du mir nicht zugehört? Natürlich gehen wir nachsehen – jetzt erst recht«, entgegnete er mit einem breiten Grinsen.
»Aber ich dachte–« Dann winkte sie ab und folgte ihm zur Ausgrabungsfläche.
Der Platz vor dem Grabungsareal, auf dem normalerweise die Geländewagen der Grabungsmannschaft parkten, war aufgewühlt von den groben Reifen der schweren Armeefahrzeuge. Ein Gewirr von Fußspuren, heruntergetretene Ränder an den Grabungsschnitten und zerrissene Absperrbänder komplettierten den Eindruck von Vandalismus.
Sie gingen schweigend und langsam, immer darauf gefasst, das Knirschen eines fremden Stiefels oder das Durchladen einer Maschinenpistole zu hören. Aber es war offensichtlich keine Wache zurückgeblieben. Als sie das Ende der Grabungsfläche erreicht hatten, schaltete Peter seine Taschenlampe ein und seufzte laut.
»Da hinten... ja genau, hinter diesem dicken Brocken muss er liegen«, kommentierte Lisa, als der Lichtkegel von Peters Maglight über einen der riesigen Felsblöcke strich, die vor langer Zeit von der Klippe im Norden des Ausgrabungsareals abgebrochen sein mussten.
Der Suchtrupp schien auch dem Streuner den Appetit verdorben zu haben, denn diesmal war kein Hund oder ein anderer Aasfresser zu sehen. Als sie die Rückseite des Felsens erreichten, blieb Lisa abrupt stehen und hielt sich die Hand vor den Mund, dann vor die Augen und drehte sich um. Peter zwang sich, den Anblick zu ertragen, und schluckte schwer. Die einzigen unbedeckten Körperteile waren Arme und Gesicht – und von dem war nicht viel übrig; identifizieren konnte man Paul darüber jedenfalls nicht mehr. Die lange Blue Jeans, die Paul seltsamerweise auch in der brutalsten Mittagshitze niemals gegen eine kurze Hose getauscht hatte, war unversehrt, wie auch das sandfarbene Hemd.
Peter kniete sich neben den Leichnam des Studenten und betrachtete ihn eine Weile, ohne die Ursache für seinen Tod erkennen zu können. Er zögerte kurz, dann drehte er Paul auf den Bauch. Die Rückseite des Hemdes war vollgesaugt mit Blut.
»Auf jeden Fall wurde er von hinten angegriffen«, bemerkte Peter und zog sein Taschenmesser aus der linken Seitentasche seiner Bundeswehrhose, die er schwarz gefärbt hatte, damit sie nicht so militärisch aussah. Er schnitt das Hemd am Rücken auf und winkte Lisa zu sich.
»Komm rüber, ich habe ihn umgedreht. Kannst du mir bitte hierhin leuchten?«
Lisa nahm die Taschenlampe und sah in dem etwas zittrigen Lichtkegel, dass Paul wohl erstochen worden war. Links neben der Wirbelsäule war deutlich eine längliche Wunde zu sehen.
»Hier ist er aber offensichtlich nicht getötet worden, sonst wäre ja wohl wesentlich mehr Blut auf dem festgebackenen Sandboden zu sehen. Es ist aber fast gar nichts da.«
»...und nach hinten fällt man eher auch nicht, wenn man von hinten erstochen wird, oder?« warf Lisa ein.
»Ich würde sagen, er wurde von da oben heruntergeworfen. Lass uns gehen.«
»Sollten wir nicht... Ich meine, Paul hier so liegenzulassen... Du hast ja gesehen, was die Hunde mit ihm angestellt haben. Sollten wir ihn denn nicht irgendwie... begraben?«
Peter hatte nicht eine Sekunde daran gedacht, Paul ein würdiges Begräbnis zukommen zu lassen. Nicht, weil er das für überflüssig hielt, sondern weil es ihm schlicht nicht in den Sinn kam. Er hatte sofort ein schlechtes Gewissen; aber statt Lisa zuzustimmen, wich er aus und legte sich eine Rechtfertigung zurecht.
»Wie sollen wir das machen? Ohne Spitzhacke gräbst du hier keinen Zentimeter tief, und Zeit haben wir auch keine. Das Einzige, was wir für Paul tun können, ist die Polizei zu benachrichtigen... Außerdem werden die anderen ihn wohl auch bald finden.« Die Möglichkeit, ihn wenigstens mit Steinen zu bedecken, erwähnte er erst gar nicht, weil er fürchtete, sie würden zu viel Zeit verlieren.
»Wenn die anderen überhaupt noch da sind...«, bemerkte Lisa.
Peter überlegte kurz. Sie sollten Paul tatsächlich nicht so liegenlassen. »Okay, komm, bringen wir ihn in den nächsten Schnitt und treten den Rand los, damit er halbwegs vor den Tieren sicher ist.«
Es kostete Lisa einige Überwindung, ihren toten Kommilitonen an den Beinen anzufassen, aber wenigstens übernahm es Peter, den Oberkörper zu tragen. Zu ihrer Überraschung war er trotz seiner Größe nicht sehr schwer. Sie schleppten ihn etwa hundert Meter in den nächstgelegenen Grabungsschnitt und ließen Pauls Leichnam dann vorsichtig an der Schnittkante hinunterrutschen. Dann kletterten sie wieder aus der Grube heraus und traten so viel Erde vom Rand los, bis Paul halbwegs bedeckt war. Peter sprang noch einmal in den Grabungsschnitt hinunter.
»Lisa, wirf mir bitte Flatterband hier runter, so viel du in der Nähe findest. Und gib mir zwei, drei von den Eisenstecken, damit ich das hier wenigstens ein bisschen absperren kann.«
Als sie fertig waren, kletterte Peter aus dem Grabungsschnitt. »Jeder, der diese Grabung kennt, wird sofort merken, dass wir etwas verändert haben... und alle anderen werden sich wahrscheinlich so über die Absperrung wundern, dass sie sich das näher ansehen. Die finden Paul auf jeden Fall, hoffe ich.«
»Ich hoffe auch. Na ja, los, gehen wir...« Lisa fragte sich, woran es lag, dass sie sich mit dem Studenten, mit dem sie in den vergangenen Wochen zusammengearbeitet hatte, nur ein einziges Mal beim Abendessen kurz unterhalten hatte – und dann auch noch über die Arbeit. Sie fand keinen wirklichen Grund. »Leb wohl, Paul«, murmelte sie. Als Lisa an all die schrecklichen Ereignisse des heutigen Abends dachte und ihr bewusst wurde, dass einer aus ihrer Grabungsmannschaft tot war und dass sie, Peter und Hilla nie wieder Witze über Pauls übertrieben akribische Vermessungen machen würden, kamen ihr die Tränen.
Sechzehn
Donnerstag, 10. November 1988
Wie schon so oft in den vergangenen Tagen saßen Keller und Kosminsky in ihrem Dienstzimmer und grübelten über die beiden Todesfälle und ihre seltsame Verbindung. Keller nahm das Gespräch wieder auf. »Wir haben wenige, aber dafür doch sehr ungewöhnliche Anhaltspunkte, das müsste uns einigermaßen schnell auf eine gute Spur bringen.«
»Ja, Chef.« Kosminskys Aufmerksamkeit schien noch nicht wieder geweckt.
»Wir haben einen Rentner, der von der Straßenbahn überfahren wird und außer einem Zeitungsausschnitt nichts Außergewöhnliches bei sich hat. Und wir haben einen weiteren alten Mann, der in seiner Wohnung erschossen wird; und zwar auf professionelle oder, sagen wir es doch, eher geheimdienstliche Weise. Es gibt nur eine einzige Sache, die beide verbindet, aber genau das scheint mir zu speziell, um Zufall zu sein. Beide haben irgendetwas mit einer Oase in Ägypten zu tun. Aber warum verläuft alles im Sande, wenn wir versuchen, mehr herauszufinden? Was übersehen wir, Kosminsky?«
Der Oberleutnant strich sich über seine Halbglatze und nahm dann seine Kaffeetasse in die Hand, als könne er sie beim Zusammenfassen seiner Recherche gebrauchen. »Ich habe mich ein wenig über den Afrikafeldzug schlaugemacht. Und raten Sie mal, da ist schon wieder einiges nicht ganz glatt. Die Wehrmacht war nämlich niemals im Gebiet der Oase Faiyum. Die liegt nahe diesem Örtchen Qarun, und das liegt keine hundert Kilometer westlich von Kairo. So weit waren die gar nicht gekommen, als sie 1943 von den Briten aus Nordafrika verscheucht wurden.«
»Also alles Quatsch mit diesem Foto aus Dietrichs Wohnung?«
»Nein, nein, das glaube ich nicht, Chef.« Kosminsky genehmigte sich einen Schluck des echten Bohnenkaffees, den sein Vorgesetzter Keller regelmäßig von seiner Schwester aus dem Westen erhielt und der ihr Dienstzimmer zu einer beliebten Tauschbörse für Informationen aller Art machte. Er schlug die dünne Akte auf, in der sie die Fälle Stankowski und Dietrich gemeinsam untergebracht hatten, seit Keller den Zusammenhang hergestellt hatte. Der vermutliche zweifache Mord wurde jetzt unter der Aktenbezeichnung »OASE - MK/AZ 23 aus 88« geführt.
»Weil mir das auch komisch vorkam, habe ich den kurzen Dienstweg gewählt und versucht, über die Universität in West-Berlin etwas über dieses Faiyum herauszufinden. Die Genehmigung zu erhalten, dienstlich in den Westen anzurufen und mit den Behörden zu sprechen, war kein großes Problem. Aber Sie glauben gar nicht, wie langwierig es ist, überhaupt eine freie Leitung in die BRD zu bekommen...«
»Alles zum Schutz der werktätigen Bevölkerung vor dem zersetzenden Einfluss imperialistischer Kräfte, geschätzter Genosse«, warf Keller ein.
Kosminsky verdrehte die Augen. »Nun, jedenfalls bin ich letztendlich bei einem Doktor Schwaadt vom Deutschen Archäologischen Institut gelandet, weil die wohl während des Krieges für alle Auslandsgrabungen verantwortlich waren. Dieser Schwaadt hat heute Morgen zurückgerufen und erzählt, dass es eine Eintragung im Jahrbuch gibt, die eine Kampagne 1941/42 bei der Oase Faiyum in Nordägypten erwähnt, mehr hat er aber nicht herausgefunden – oder er wollte uns nicht mehr sagen.«
Siebzehn
Donnerstag, 17. November 1988
Sie erreichten das nächste Felsplateau, das noch einmal gut zwanzig Meter höher als das Grabungsareal lag. Peter ging zu einem der großen Steinbrocken, die auch hier oben herumlagen, und ließ sich an ihm nieder. Lisa setzte sich zu ihm.
»Ins Grabungshaus zurück können wir nicht...«, eröffnete Peter das Gespräch.
»Nein, können wir nicht«, bestätigte Lisa. »Aber du hast doch schon einen Plan?«
Ohne eine Antwort zu geben, nahm Peter die Karte der Grabung aus seiner Umhängetasche und breitete sie vor ihnen aus. »Wir sind jetzt hier.« Er beleuchtete den kleineren Übersichtsplan, der am oberen Rand des Ausgrabungsplanes angeheftet war. »Etwa fünfzehn Kilometer nördlich von uns verläuft die E10 Richtung Kairo.« Er tippte mit dem Finger auf eine Stelle im Sand oberhalb des Planes. »Bis zum Morgen sollten wir sie erreicht haben; irgendjemand wird uns dann schon mitnehmen. Wenn wir in Kairo sind, sehen wir weiter.«
Lisa überlegte eine Weile. »Einen Kompass oder sowas haben wir nicht dabei, oder?«
»Ich glaube, den brauchen wir nicht. Wir orientieren uns an der Lage unserer Grabung und marschieren los. Den ganzen Quatsch mit im-Kreis-laufen glaube ich nicht. Außerdem stoßen wir auch dann auf die E10, wenn wir vom Kurs abkommen; dauert halt nur länger. Und spätestens, wenn es dämmert, wissen wir, wo Osten ist.«
»...nur Richtung Westen sollten wir nicht abdriften, da wird es ziemlich einsam«, verbesserte Lisa ihn.
»Das wird schon nicht passieren. Hast du unsere Gegend mal auf einer Landkarte gesehen? Von den Klippen ist das Gelände nach Norden leicht abschüssig, und zwar genau in Richtung der Straße nach Kairo. Eigentlich müssen wir nur einem dieser Wadis – oder wie immer diese flachen Erosionstäler hier in der Wüste heißen – folgen. Die laufen beinahe rechtwinklig auf die E10 zu und werden uns wahrscheinlich sogar den schnellsten Weg weisen.« Er faltete den Plan des Grabungsareals wieder zusammen und verstaute ihn sorgfältig im vorderen Fach seiner Tasche.
»Na ja, auf jeden Fall wird es nicht daran scheitern, dass wir nicht irgendwie nach Kairo kommen.« Mit einem Griff unter sein T-Shirt zog er seinen Brustbeutel heraus. »Und als erfahrene Archäologin hast du natürlich deinen Pass und das ganze Visa-Zeug dabei.« Mit einem triumphierenden Grinsen wedelte er mit seinem Pass vor Lisas Nase herum.
Die zog ihren rechten Schuh aus und fingerte unter der Einlegesohle nach einem Plastikbeutel, der einige große Geldscheine enthielt. Als sie ihn aus dem für das ägyptische Klima recht warmen Wanderschuh hervorzog, lächelte sie schief und genoss die Retourkutsche. »Und du hast als erfahrener Anthropologe natürlich auch genügend Bargeld am Mann.«
Peter wurde blass und für einen Moment sprachlos. Mist, die Kohle sollte man immer dabei haben! »Da haben Sie vollkommen recht, Dr. Jones«, erwiderte er als verspätete Parade.
Schweigend saßen sie an den großen Felsbrocken gelehnt und blickten in die Richtung, in der sie die Straße nach Kairo vermuteten.
Nach einigen Minuten nahm Lisa das Heft in die Hand und blies zum Aufbruch. »Vamos, Kollege!«
Peter sollte recht behalten. Es stellte sich tatsächlich als recht einfach heraus, den eingeschlagenen Kurs beizubehalten. Auch erwies sich das flache Tal, das sie sich als Pfad ausgesucht hatten, als nicht so steinig wie befürchtet. Der eingewehte Sand machte das Geröll weniger uneben und ließ sie verhältnismäßig schnell vorankommen. Trotzdem war ihnen klar, dass sie noch einige Stunden anstrengenden Fußmarsches vor sich hatten; und so sprachen sie auf den ersten Kilometern überhaupt nicht miteinander, den Gedanken an die heutigen Ereignisse und an den vor ihnen liegenden Weg nachhängend.
Es war Lisa, die das Schweigen brach.
»Was glaubst du, was diese Kerle mit den anderen machen? Wer sind die?« Schon jetzt begannen die Ereignisse, die sie mit eigenen Augen gesehen hatte, ihr unwirklich vorzukommen. Ihr fiel einfach keine Erklärung für das ein, was passiert war. Dass Peter das Ganze einfach hinzunehmen schien, irritierte sie.
»Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber offensichtlich haben sie irgendein spezielles Interesse an unserer Grabung.«
»Und an unseren Plänen. Sie werden doch nicht... Ich meine, denkst du, sie erschießen am Ende wirklich jemanden?«
»Wir können nur Hilfe holen. Und die hätten wir in Qarun selbst dann nicht gefunden, wenn uns die Typen nicht erwischt hätten. Für mich sahen die einfach nicht nach ein paar Rebellen aus. Das war ein organisierter Trupp, kein grölender Haufen archäologiefeindlicher Kameltreiber–«
»Du meinst, die Polizei wusste Bescheid?«, fiel Lisa ihm ins Wort. Es ergab alles immer weniger Sinn, aber sie verstand jetzt Peters Entscheidung, sich sofort auf den Weg nach Kairo zu machen.
»Glaubst du vielleicht, da fahren Lastwagen durch das Örtchen und jemand startet nachts eine Suchaktion mit solchen Scheinwerfern, ohne dass das sofort jeder weiß?«, gab Peter zu bedenken.
»Nein, wahrscheinlich nicht, du hast recht. Aber was machen wir, wenn wir in Kairo sind? Gehen wir zum Antikenamt oder zur Botschaft oder was?« Allmählich kehrte Lisas Realitätssinn zurück, aber mit ihm ein vages Gefühl von Paranoia. Wer war für diesen unglaublichen Überfall auf ihre Grabung verantwortlich? Wer sollte überhaupt ein Interesse daran haben, was sie da taten? Konnte es sein, dass Al-Wass dahintersteckte? Aber das anzunehmen war völlig verrückt, immerhin war Al-Wass ein hoher Staatsbeamter mit beträchtlicher internationaler Reputation, und sie befanden sich im modernen Ägypten, nicht irgendeinem Mafiadorf... Vielleicht waren die Unterschiede da aber nicht so groß, wie sie sich einredete. Lisa musste mit einem Mal an ihre Mutter denken, die völlig außer sich vor Sorge gewesen war, als ihre Tochter ihr von der Grabung in der ägyptischen Wüste erzählt hatte.
»Was schnaubst du?«, fragte Peter mit einem Seitenblick zu ihr.
»Haben dich auch immer Leute damit aufgezogen, dass du bloß Archäologe werden willst, damit du wie Indiana Jones durch die Gegend abenteuern kannst?« erklärte Lisa ihre geistige Abwesenheit.
Peter lachte leise und nickte. »Natürlich.«
»Jetzt weiß ich jedenfalls, dass ich es ganz bestimmt nicht deshalb gemacht habe.«
Der beinahe volle Mond kroch bleich über den Himmel, während sie ihren Weg fortsetzten. Ein Blick auf das beleuchtbare Display seiner Casio-Digitaluhr zeigte Peter, dass es nach Mitternacht war. Obwohl der Marsch sie wärmte, wurde es allmählich empfindlich kühl. Er wünschte sich, er hätte wie Lisa sein Hemd mit den langen Ärmeln getragen.
Peter fragte sich zum zigsten Mal, ob er richtig entschieden hatte. Hätten sie bleiben und versuchen müssen, Thomas, Layla und den anderen zu helfen? Er war davon überzeugt, was er zu Lisa gesagt hatte und dass aus Qarun keinerlei Hilfe zu erwarten war, aber das machte es nicht einfacher, Bergen und die Grabungsstudenten zurückzulassen. Er fragte sich, ob es vielleicht Hilla oder dem Professor gelungen sein könnte zu entkommen. Aber sicher hätten sie dann nach ihm und Lisa gesucht und sich irgendwo bei der Grabung versteckt.
Peter hatte keine Ahnung, wie weit sie schon gekommen waren, aber gegen zwei Uhr morgens waren sie beide reif für eine Pause. Sie suchten sich einen ebenen Platz feinsten Saharasandes und ließen sich wie auf einem zu weichen französischen Hotelbett zurücksinken. Als Peter merkte, dass er kurz davor war einzuschlafen, setzte er sich wieder auf und ließ den Blick über die Landschaft schweifen. Der Geländeeinschnitt war mittlerweile weniger tief, und der Mond erhellte von Süden den Weg. Nachdem sie sich daran gewöhnt hatten, war das Mondlicht erstaunlich hell.
Er wandte sich zu Lisa um, die tief und fest schlief. Na ja, auf ein paar Minuten kommt es ja auch nicht an, dachte er und ließ den Mond ein Stückchen weiterziehen, ehe er Lisa zum Aufbruch weckte.
»Ich habe nachgedacht«, verkündete Lisa ein paar Minuten später, nachdem sie sich auf die hoffentlich letzte Etappe ihres Weges bis zur Staatsstraße E10 gemacht hatten.
»Geschlafen hast du.«
»Aber vorher habe ich nachgedacht. Denkst du, dass die ganze Sache etwas mit unserer Mumie zu tun haben könnte?«
Peter zog eine Augenbraue in die Höhe. »Puh, das ist aber ganz schön weithergeholt. Wie kommst du darauf, dass dieser Trupp diesen Aufwand wegen eines einzelnen, bereits mumifizierten Toten veranstaltet?«
»Ich finde es ja bloß etwas merkwürdig, dass wir einen neuzeitlichen Toten finden, und noch am gleichen Abend...«, Lisa geriet etwas ins Stottern, als sie an Pauls Leiche dachte, »da finden wir auch Paul tot auf der Grabung und irgendwelche Milizen stürmen das Grabungshaus. Ist das nicht etwas viel des Zufalls?«
»Du vergisst nur, dass Paul ja nicht erst seit heute verschwunden war. Dass wir ihn ausgerechnet jetzt gefunden haben, war definitiv reiner Zufall. Außerdem, wer hätte etwas von dieser Mumie wissen können?«
»Der Mörder vielleicht?«, gab Lisa sofort zurück.
»Der so schlau war, sein Opfer ausgerechnet in einem Ausgrabungsareal zu verscharren?«
»War ja nicht erst gestern. Woher sollte der Mörder denn wissen, dass an dieser Stelle einmal eine Grabung sein würde?«
»Immerhin hat er einen Türsturz über sein Opfer expediert, er wird wohl kaum geglaubt haben, dass der einzeln so herumliegt.«
»Vielleicht war der Mörder ja archäologisch nicht so bewandert wie du«, erwiderte Lisa giftig, ohne selbst besonders überzeugt zu sein.
Als der Mond langsam linkerhand hinter dem Rand des Wadis zu verschwinden begann, legten sie die letzten zwei Kilometer beim Licht der schwächer werdenden Maglight zurück. Dann endlich sahen sie die zweispurige Teerstraße. Von regem Verkehr allerdings keine Spur. Tatsächlich war das erste Verkehrsmittel, das sie sahen, ein überladener Eselskarren, der die frühe Stunde nutzte, um unbeschadet die Fernstraße zu kreuzen. Lisa sah dem wackeligen Gefährt nach, als schätze sie ab, wie lange wohl eine Fahrt nach Kairo damit dauern würde.
»Es wird schon bald ein Auto kommen«, erklärte Peter im Brustton der Überzeugung. Rechts und links der verhältnismäßig gut ausgebauten Straße zogen sich flache Gräben voller Müll hin. Stellenweise stank es beunruhigend nach Verwesung, ein Geruch, den er im Augenblick überhaupt nicht ertrug.
Schließlich fanden sie einen Betonblock, der von irgendeiner dubiosen Baumaßnahme zurückgeblieben war und sich als Sitzgelegenheit für müde Wanderer bestens eignete. Sie hatten es sich kaum bequem gemacht, als in Lisa Zweifel aufkamen. War es klug, sich hier wie auf einem Präsentierteller hinzusetzen und auf den Suchtrupp zu warten? Sollten sie nicht lieber neben der Straße in Deckung bleiben und auf einen harmlosen Eselskarren warten, der sie langsam, aber sicher nach Kairo schaukeln würde? Aber der würde sicherlich auch durchsucht werden... Ich will einfach nur hier weg.
Nach wenigen Minuten meinte Peter, so etwas wie Motorengeräusch zu hören. Lisa atmete heftig aus, nahm ihren ganzen Mut zusammen, sprang auf die Füße und positionierte sich am Straßenrand.
»Ich sehe die Lichter. Meinst du, er nimmt uns mit nach Kairo?«
»Lass deinen Charme spielen«, riet Peter müde. Er hoffte wirklich, dass sie jetzt nicht stundenlang warten mussten und noch in der Mittagshitze hier standen.
Wider Erwarten trat der Fahrer des Lastwagens auf die Bremse, sobald er sie am Straßenrand sah. Erschrocken erkannte Lisa, dass es sich um einen ausgemusterten Militär-Lkw handelte.
Achtzehn
Dienstag, 3. Februar 1942
Alle drei BMW 132T-2 Neunzylinder-Sternmotoren liefen mit tieferem Brummen und ohne jegliche Anzeichen von Aussetzern weiter, als NSFK-Sturmführer Hermann Schlösser die Gashebel wieder zurück in die Standgasstellung zog. Zufrieden und erleichtert verfolgte er, wie die Zeiger der drei Drehzahlmesser zügig und gleichmäßig absanken und sich die Anzeige auf etwa 500 Umdrehungen pro Minute einpendelte.
Obwohl er stets darauf achtete, dass die Bremsklötze am Hauptfahrwerk ordentlich ausgelegt und fixiert waren, der rote Knebel für die Parkbremse angezogen und, was bei seinen Kameraden durchaus nicht üblich war, sogar das Heckspornrad am Boden fixiert wurde, war ihm bei jedem Testlauf mulmig zumute.
Wie leicht konnte jemand aus Unachtsamkeit in den Propellerkreis geraten oder von aufgewirbelten Teilen verletzt werden. Man konnte die Leute zehnmal warnen, sich nicht in die Gefahrenzone zu begeben, wenn die Motoren liefen – doch sobald sie eine andere Aufgabe ablenkte, waren die rasenden Propellerblätter nicht nur optisch unsichtbar.
Andererseits konnte man gerade in abgeschiedenen Einsatzgebieten gar nicht oft genug die nötigen Wartungsarbeiten ausführen und die Funktionsfähigkeit der Maschine testen. Auf Ersatzteile konnte man mitten in der Wüste lange warten. Außerdem war es nicht seine gewohnte Tante Ju, die zu Hause in Berlin jetzt wahrscheinlich von seinem Kameraden Gerhard von Bossel geflogen wurde und deren Wartungszustand und kleine Macken er in- und auswendig kannte. Dies hier war eine Junkers Ju 52/3m g7e, die vom 11./KGzbV1, das von der griechischen Insel Milos aus operierte, zur Verfügung gestellt worden war.
Das war schon sinnvoll. Zum einen deshalb, weil man sich so beinahe dreitausend Kilometer Flugstrecke, zwei Zwischenlandungen zum Tanken und gut fünfzehn Flugstunden sparte; zum anderen, weil das Kampfgeschwader zur besonderen Verwendung 1 an den Kämpfen um Kreta beteiligt war und die Ju 52 deshalb wenigstens mit Maschinengewehren zur Verteidigung gegen alliierte Jagdflugzeuge ausgestattet worden war.
Das 7,92mm-MG 15 im A-Stand der Pilotenkanzel konnten er oder sein Co-Pilot zur Not selbst bedienen. Allerdings fragte sich Schlösser, wer von diesen Archäologieheinis das Maschinengewehr im nach hinten offenen B-Stand am Heck bedienen sollte; ganz zu schweigen davon, dass ein 13mm-MG 131 das Leitwerk in Sekunden abrasieren konnte. Mit einem kaputten Seitenleitwerk konnte man ja noch notlanden, vielleicht sogar bis zum nächsten Tankstopp weiterfliegen, aber wenn einer dieser Zivilisten es schaffte, den Lauf nach unten auf das Höhenleitwerk zu richten, dann gute Nacht.
Schlösser wischte den Gedanken an eine mögliche Auseinandersetzung mit feindlichen Fliegern beiseite und fuhr mit den Flugvorbereitungen fort. Querruder und Höhenruder des Wellblechflugzeugs ließen sich leichtgängig und ohne Hakelei bedienen, und auch die großen Landeklappen, die sie auf der kurzen Piste von Milos sicherlich ausgiebig nutzen mussten, arbeiteten einwandfrei. Die Gängigkeit der Fußpedale für das Seitenruder überprüfte er nicht, weil das Spornrad fixiert war; außerdem war Schlösser sowieso der Meinung, dass man ohne Seitenruder fliegen konnte und dass man es meistens eh nur zum Lenken am Boden brauchte – vielleicht noch beim Starten und Landen, wenn der Wind ein wenig ungünstig von der Seite blies.
Ein abschließender Blick auf die Temperaturanzeigen informierte ihn darüber, dass die Wasserkühlung seiner BMWs und der sensible Kreislauf der Betriebsmittelkühlung auch in der ägyptischen Mittagshitze ihren Dienst versahen. Beruhigt setzte er die Motoren außer Betrieb und versicherte sich durch leichtes Klopfen an das Instrumentenglas, dass keine der Nadeln der Kraftstoffanzeigen einfach nur in der Maximalposition festhing, anstatt wahrheitsgemäß volle Tanks zu melden. Dann überprüfte er noch einmal, dass alle Flugkarten und der Flugbefehl für den abendlichen Flug an Bord waren, und bemerkte, dass auch die Jungs des griechischen Geschwaders die Klammer eines Klemmbrettes an das Steuerhorn geschraubt hatten. Das war zwar offiziell nicht erlaubt, aber ungemein praktisch auf langen Flügen. Zufrieden klemmte er die Flugkarten für die erste Etappe, die zurück auf die Kykladeninsel Milos kurz vor der türkischen Küste führte, an den Halter.
Vor ihnen lag die erste Etappe mit über 1200 Kilometern und etwa sechs Stunden höchster Konzentration und Anspannung. Wenn sie nicht wegen Kraftstoffmangels notwassern wollten, mussten sie heute Nacht besonders wach sein. Jede kleine Kursabweichung oder Extraschleife konnte sie an die etwa 1300 Kilometer Reichweite der Ju 52 bringen, denn etwaige Zusatztanks hatten die Leute vom KGzbV natürlich nicht eingebaut. Deshalb beschloss Schlösser, es seinem Co-Piloten gleich zu tun und noch ein paar Stunden in dem sandfarbenen Zelt zu schlafen, das man ihm und seinem Kameraden Stankowski gestern bei der Ankunft zur Verfügung gestellt hatte.
Dass das Wachpersonal und die beiden Piloten direkt an der Ausgrabungsstätte bei ihrer Maschine untergebracht waren, war ihm nur recht, schließlich sparte es ihnen die Schaukelei in einem der VW-Kübelwagen, die zwischen Ausgrabungsareal und den gut drei Kilometer entfernten Unterkunftsbaracken pendelten. Und dass die komfortabler und ruhiger waren, konnte er sich beim besten Willen nicht vorstellen. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, warum man ihn und Stankowski für einen profanen Rücktransport von Material und Zivilisten aus der ägyptischen Wüste abgestellt hatte. Was war daran so wichtig, dass man eine Einheit des NSFK einsetzte, die es offiziell überhaupt nicht gab? Warum nicht die Luftwaffe oder einfach Transporter der Wehrmacht? Die waren doch sowieso vor Ort – egal, er sollte jetzt dringend schlafen gehen.
Eine Stunde vor dem Abflug um 22:00 Uhr ägyptischer Zeit würde er dann ein paar Tassen Kaffee trinken, um wach zu werden, eine Packung mitgebrachter Butterkekse vertilgen und zwei Thermoskannen mit starkem Kaffee für den Flug füllen. Sein Co-Pilot Helmut Stankowski würde, wie üblich, aus Angst vor Harndrang und fehlender Bordtoilette mit einer Tasse schwarzen Kaffees vorliebnehmen. Schlösser war das egal. Er konnte normalerweise alles Nötige vorher erledigen – und wenn nicht, dann nicht. Es fand sich immer eine Lösung. Müde und hungrig zu fliegen war jedenfalls nicht seine Lieblingsbeschäftigung, schon gar nicht, wenn sie in der Nacht auf Sicht mit einer mit Zivilisten vollgepackten Transportmaschine dicht über die ägyptische Wüste und die Wellen des Mittelmeeres fliegen mussten.
Gegen Viertel nach acht wurden die beiden NSFK-Piloten von lautem Geschrei und dem unverkennbaren tiefen Brummen von Flugzeugmotoren geweckt. Mit einem ausgedehnten Fluch setzte sich Sturmführer Hermann Schlösser auf und massierte seine Schläfen. Helmut Stankowski saß bereits auf der Kante seines niedrigen Feldbettes und gähnte.
»Klaut jetzt einer unsere Ju, oder was ist hier los, Kamerad?« fragte Schlösser, als er sich nach einer halben Minute immer noch keinen Reim auf die Vorkommnisse machen konnte.
»Keine Ahnung,« erwiderte Stankowski, während er ausgiebig weiter gähnte und umständlich im Sitzen seine Stiefel anzog, während die Feldhose noch auf seinen Knien hing.
Als Schlösser in Unterhemd, Kampfhose und Stiefeln vor das Zelt trat, überflog die Ursache für den Lärm, der sie aus dem Schlaf geholt hatte, ein letztes Mal die provisorische Piste, als wolle sie überprüfen, ob sich eine Landung inmitten der Einöde wirklich lohne. Er verfolgte den Anflug der Me-110 und war gespannt, wie der Pilot die Landung meisterte, war doch dieses Flugzeug, im Gegensatz zu seiner Junkers, nicht gerade für kurze Landepisten konstruiert. Schlösser mochte diese verhältnismäßig schnelle und elegante Maschine, die von der Luftwaffe ursprünglich als Zerstörer in Auftrag gegeben worden war. Keiner wusste so recht, was mit dieser Flugzeugklasse eigentlich beabsichtigt war; es gab Bomber, Jäger und Transporter wie seine Ju, aber was bitte war ein »Zerstörer«? Schulterzuckend fokussierte er seinen Blick wieder auf die zweimotorige Maschine, als sie kurz vor dem Aufsetzen noch einmal leicht die Nase hob, um den Sinkflug zu beenden. Das seltsame Drahtgestell an der Spitze des Rumpfes wirkte irgendwie fehl am Platz, störte es doch massiv den schnittigen Eindruck, den Schlösser mit diesem Flugzeugtyp verband. Das »Hirschgeweih«, wie die Antennen am Bug dieser Me-110 von den Fliegern genannt wurde, gehörte zu einer brandneuen Entwicklung, die er nur vom Hörensagen kannte. Das Radargerät von Telefunken mit dem Tarnnamen Lichtenstein konnte angeblich Flugzeuge in bis zu fünf Kilometern orten, egal ob es nebelte oder stockdunkel war. Für Schlösser war das beinahe unglaublich gewesen, bevor er diese Messerschmitt mit eigenen Augen sah, kannte er doch nur die großen und schwer zu transportierenden Freya-Geräte, die erst vor kurzer Zeit an der Nordseeküste installiert worden waren, um englische Bomberstaffeln frühzeitig zu erkennen.
Nach einer butterweichen, punktgenauen Landung, wie Schlösser mit Respekt feststellen musste, rollte die Messerschmitt fast bis auf zehn Meter an den Kistenstapel heran, der die Gerätschaften der Grabungsmannschaft enthielt. Nachdem der Pilot die Maschine und die Propeller gestoppt hatte, konnte Schlösser seine Neugier nicht mehr unterdrücken und ging hinüber. Ihm war nicht bekannt, dass außer ihrem noch ein Transport stattfinden sollte, schon gar nicht mit einer Maschine, die als Transporter überhaupt nicht geeignet war, sondern hauptsächlich hochgeheime Gerätschaften an Bord hatte.
Die Kabinenhaube öffnete sich und ein kompakter, junger Mann mit raspelkurzem Haar und den vertrauten Schulterklappen eines Sturmführers des NSFK erhob sich vom Pilotensitz. Schlösser mochte den verbindlichen Helge Dietrich eigentlich, auch wenn der durch, wie er fand, übertriebene Dienstbeflissenheit zwei Jahre früher als er und Stankowski zum Sturmführer befördert worden war. Dabei war der Dienstgrad »Sturmführer« für die Einheit, in der er, Stankowski und auch Dietrich ihren Dienst versahen, schon übertrieben; sie waren nicht einmal genug Leute, um die rund hundert Mann für einen einzigen Sturm vollzukriegen. Soweit Schlösser wusste, gab es in ihrer »Transporteinheit für besondere Aufgaben« überhaupt keine Mannschaftsdienstgrade.
Als der Flugzeugführer bereits dabei war, von der Tragfläche hinab in den Wüstensand zu springen, stand der Soldat auf, der hinter ihm gesessen hatte. Er trug die schwarze Uniform der SS und hatte schon seine Dienstmütze aufgesetzt, als wäre diese Ausgrabung in der ägyptischen Wüste der Empfangssaal der deutschen Botschaft, in der man gerade den Präsidenten der Vereinigten Staaten erwartete. Was für ein Affe, dachte Schlösser. Zu spät bemerkte er, dass dieser schnöselige Typ immerhin Obersturmbannführer der SS war und der Vorgesetzte von vielleicht tausend Soldaten sein konnte. Jedenfalls wurde ihm mit Schaudern bewusst, dass ein Mann, der offensichtlich die Dreißig noch nicht erreicht hatte, gewöhnlich nicht durch Toleranz und Umgänglichkeit die Befehlsgewalt über ein ganzes Regiment erlangte.
Schlösser realisierte, dass er mit seinem Co-Piloten Stankowski ein herrliches Empfangskomitee in Unterhemden, herabhängenden Hosenträgern, mit offenen Hosenställen und Kampfstiefeln abgab – Schlunz und Schlumpi begrüßen den englischen König!
»Was ist denn das hier für ein Sauhaufen. Ich kann mich nicht erinnern, dass NSFK die Abkürzung für Nationalsozialistisches Festkomitee ist!«, brüllte der Schnösel in ihre Richtung, noch bevor er von der Tragfläche der Messerschmitt heruntergesprungen war. Gruß-Meldung-Gruß, schoss es Schlösser durch den Kopf.
Er salutierte, was in seiner Aufmachung sicherlich einiges an Komik für den Betrachter bot. »Wir haben Sie nicht erwartet, Herr Obersturmbannführer. Sturmführer Stankowski und ich hatten uns hingelegt, um für den Rücktransport der Grabungsmannschaft heute Abend ausgeruht zu sein.« Er salutierte erneut und richtete seinen Blick konzentriert auf das ernste Gesicht des SS-Offiziers, um nicht durch den Anblick seines zerzausten Kameraden in einen Lachanfall zu geraten.
»Rühren. Wir sind hier nicht bei den Hottentotten. Sie gehen jetzt in Ihr Zelt und hosen sich ordentlich an. Dann melden Sie sich wieder bei mir, alle beide. Ich werde Sie über den Ablauf des Rücktransportes informieren. Wegtreten!«
Stankowski und Schlösser schlugen die Hacken zusammen, salutierten mit weit in die Höhe gerecktem rechtem Arm und verabschiedeten sich mit einem lauten »Heil Hitler!«.
»Hoffentlich ist die Transportmaschine des NSFK nicht in dem gleichen Zustand wie ihre beiden Piloten«, rief ihnen der SS-Obersturmbannführer hinterher, offensichtlich wenig begeistert von dem formal nicht ganz korrekten Abgang der beiden Flieger.
Neunzehn
Freitag, 18. November 1988
Als Lisa schließlich nach über zwei Stunden Fahrt mit steifen Beinen aus dem Lkw kletterte, war ihr erster Gedanke, dass sie endlich dem beißenden Plastikgeruch entging, den das Armaturenbrett verströmte. Ihr war beinahe schlecht geworden in dem schaukelnden Gefährt, auf die Rückbank hinter Peter und den Fahrer geklemmt, aber sie hätte niemals um eine Pause gebeten, denn sie wollte nichts mehr, als in Kairo ankommen.
Der Mann entblößte zum Abschied ein weißes Grinsen, und Peter verabschiedete sich mit einigen arabischen Worten und schlug die zerbeulte Tür zu. In einer blauen Abgaswolke stehend blickten sie dem Lastwagen hinterher, der sich hupend in den Verkehr einfädelte. Der Fahrer hatte sie in einer Nebenstraße des Gizah Square abgesetzt, weil sie von hier am einfachsten überall hinkamen, hatte Peter behauptet. Sie hatten dem Mann auch nicht mehr als unbedingt notwendig über ihre Absichten verraten wollen.
Apartmentblocks aus Beton, Zeichen des sogenannten Fortschritts, türmten sich überall um sie herum und wechselten sich mit halb zerfallenen Einfamilienhäusern ab.
Was für ein widerlicher Moloch, dachte Lisa. Schon früh am Morgen war es in den Straßenschluchten Kairos stickig von einem Gemisch aus Benzindunst, Kamelgeruch und Fäkalien in den Abwasserkanälen. Die große, unbebaute Fläche vor ihnen war belebt, eilige Fußgänger marschierten zwischen den Autos über die Fahrbahn, und das Hupen der rostigen Karossen hallte von den Fassaden der »Prachtstraße« wider.
Die E10 hatte sie mitten in Kairos Innenstadt gebracht, wo sie als Al-Ahram-Straße bis zum Gizah Square führte. Von hier aus, so meinte Peter sich zu erinnern, war es nicht weit bis zur Nilbrücke, und als sie nun den Blick nach Osten richtete, wohin der Lkw verschwunden war, sah Lisa einen hellen Streifen inmitten des Häusermeeres. Dort befand sich wohl der Nil. Die Frage war, wohin sie nun überhaupt wollten. Die Müdigkeit nach der vergangenen Nacht machte sich bemerkbar, obwohl sie viel zu aufgeregt waren, um auch nur einen Gedanken an Schlaf zu verschwenden. Das klare Denken fiel ihnen allmählich schwer.
»Und jetzt? Was machen wir?«
Peter hatte die Frage natürlich erwartet und ihr einige Überlegung schon während der Fahrt in dem heruntergekommenen Armee-Truck gewidmet. Langsam schob er den Gurt seiner Tasche auf seiner Schulter hoch, wischte seine verstaubten Brillengläser am Hemdsaum sauber und blickte sich um.
»Wir haben ja im Grunde nur die Wahl zwischen Polizei und Botschaft«, sagte er schließlich. Er konnte sich nicht erinnern, diesen Platz schon einmal gesehen zu haben.
»Meinst du, dass die Polizei hier in die Sache irgendwie... verwickelt sein könnte?« Lisa machte ein konspiratorisches Gesicht, worüber Peter fast lachen musste. Es war wohl die Müdigkeit, denn eigentlich war nicht sehr viel Amüsantes an ihrer Situation. Aber immerhin hatten sie es nach Kairo geschafft, was auch immer das wert sein würde.
»Ich kann es mir nicht vorstellen.«
»Also die nächste Polizeistelle?« Lisa kaute auf ihrer Unterlippe, als wäre ihr nicht wohl bei der Vorstellung. »Können wir nicht vielleicht jemanden beim DAI auftreiben?«
Aber Peter hatte im selben Augenblick einen Entschluss gefasst. »Nein, lass uns zur Botschaft gehen. Wir müssen denen erst einmal erzählen, was mit Bergen und den anderen passiert ist. Im Zweifelsfall können nur die sie wieder raushauen.«
»Du meinst, falls es um Lösegeld geht?«
»Zum Beispiel.«
Die nächste halbe Stunde versuchten sie herauszufinden, wo genau die deutsche Botschaft untergebracht war, und wie sie dorthin gelangen konnten. Sie standen einigermaßen hilflos auf dem belebten Platz, und Peter sprach die männlichen Passanten an, was gar nicht so einfach war inmitten des ohrenbetäubenden Großstadtlärms. In Wirklichkeit befanden sie sich eher auf einer riesigen Kreuzung mit beinahe einem Dutzend Fahrspuren und kleinen Grünflächen dazwischen. Nur wenige Fußgänger waren geneigt, stehenzubleiben und ihnen überhaupt zuzuhören. Schließlich hatte Peter aber Glück und erhielt eine passable Wegbeschreibung von einem arabischen Geschäftsmann.
Obwohl sie nicht darüber sprachen, schien Lisa so unwillig wie Peter selbst, ihr ohnehin knappes Geld für ein Busticket oder einen Kaffee zu verschwenden, bevor sie nicht in einem gepolsterten Sessel in der Botschaft saßen und wussten, wie es weiterging. Also machten sie sich in dem immer lebhafter werdenden Verkehr von Autos, Fahrrädern und Eselskarren zu Fuß auf den Weg. Bis zum Ufer des Nils war es nicht einmal ein halber Kilometer. Dann folgten sie dem westlichen Ufer des Flusses nach Norden, entlang der dicht befahrenen Niluferstraße, die in die Gamal Abd Al-Nassar überging. Die Temperaturen stiegen langsam; selbst im November konnte man sich in Ägypten noch leicht einen Sonnenbrand einfangen. Still marschierte Peter neben Lisa die Promenade entlang. Auf der anderen Flussseite reihten sich Wolkenkratzer aneinander und schufen ein unvergleichlich scheußliches Panorama. Dort lag Kairos ursprüngliche Altstadt, die Medina, aber die Stadt hatte sich schon lange ausgebreitet, immer weiter und weiter. Heute trennten sie nur noch wenige Kilometer von den großen Pyramiden, erinnerte sich Peter mit Schaudern. Auf ihrer Seite des Flusses drängten sich Ausflugsboote, geschmacklose Restaurants und Hotels an das Ufer. Nach zwei Kilometern teilte der Nil sich in zwei schmalere Arme auf, die eine der Nilinseln umschlossen, auf denen sich ein Gutteil des politischen und geldadeligen Lebens der Stadt abspielte.
»Das muss die Zamalek sein«, erklärte Peter und deutete auf die schmal zulaufende Nilinsel. »Wir sind bald da.«
Aber Lisa schien ihn nicht gehört zu haben. Sie nestelte an einer ihrer Hosentaschen herum und förderte schließlich ein kleines Kosmetikspiegelchen zutage.
Dass sie so etwas überhaupt besitzt, hätte ich nie gedacht, fuhr es Peter durch den Kopf.
Als hätte sie seine Gedanken gehört, murmelte Lisa: »Praktisch, wenn man auf einer Grabung um Ecken gucken muss, oder unter Türstürze.« Sie tat so, als inspiziere sie ihr Gesicht in dem kleinen klappbaren Spiegel, aber Peter sah, dass ihre Augen etwas anderes fixierten, und sie drehte und kippte den Spiegel ständig.
»Was soll das?«, fragte er schließlich ratlos.
»Ich dachte, wir werden verfolgt«, murmelte Lisa würdevoll. Peter lachte auf und sah Lisas Gesicht finster werden.
»Was ist daran so komisch?«
»Gar nichts. Ich frage mich bloß, wie du hier zwischen den tausenden Leuten jemanden entdeckt haben willst, der es auf uns abgesehen hat.«
Nach einigen Sekunden steckte Lisa schließlich ihr improvisiertes Spionagegerät weg. »Wie weit ist es denn nun noch bis zur Botschaft, ich dachte, du wüsstest so genau, wo es langgeht?«, stichelte sie, ein wenig rot auf den Wangen.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752107371
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (August)
- Schlagworte
- DDR Drittes Reich Ägypten Verschwörung Geheimgesellschaft Spannung Archäologie Volkspolizei Mordserie Wissenschaft Historisch Abenteuer Reise Krimi Ermittler Dystopie Utopie Science Fiction