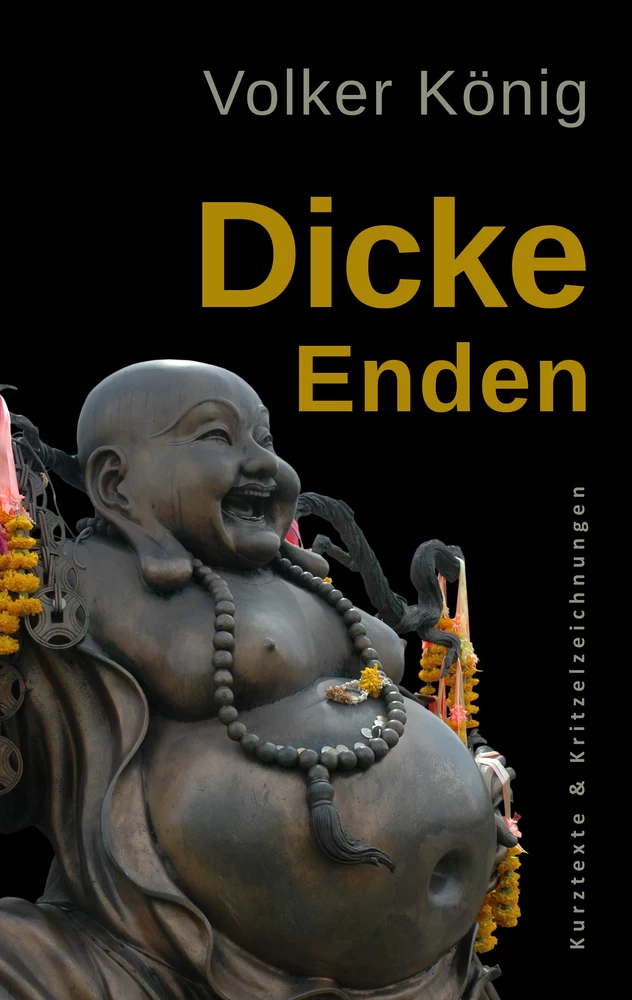Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Impressum
© Neuauflage Januar 2020
© 2004 Volker König
Kämmereihude 14, 45326 Essen
www.vkoenighome.de
Bildquelle: pixabay
ISBN der Printversion: 9 783750 437166
Zitat
Er wunderte sich,
dass den Katzen gerade an den Stellen
zwei Löcher in den Pelz geschnitten wären,
wo sie die Augen hätten.
Georg Christoph Lichtenberg
358 Türchen
Gleichmütig lächelnd stand Herr Piefke mit Zwiebelnetz und Senfglas in der Kassenschlange seines Supermarktes und ließ seinen Blick über emsige Kassiererinnen, nervöse Kunden und quengelnde Kinder schweifen, bis der an einem Haufen Adventskalendern haften blieb. Bald war Weihnachten! Die einst mit dem Öffnen der Türchen verbundene Aufregung durchflutete ihn mit einem Mal, und als sie etwas verebbte, erkannte er, dass er wohl nicht der Einzige zu sein schien, der mit diesem einfachen Gegenstand eine vorfreudige Stimmung verband. Gerade eben hatte wieder jemand einen Kalender mit kindlichem Lächeln an sich genommen. Wenn diese Vorfreude doch länger andauern würde, dachte Herr Piefke, als plötzlich in seinem Kopf eine geradezu ungeheuerliche Vorstellung entstand. Entschlossen griff er in den Haufen. Er brauchte ein Muster, denn er würde den ersten ganzjährigen Weihnachtskalender herstellen!
Zu Hause machte sich Herr Piefke sofort ans Werk. Der mitgebrachte Kalender inspirierte ihn zu zwei Varianten seiner Vision. Variante A sollte aus zwölf Steckmodulen über je einen Monat bestehen, die zusammen eine etwa 0,75 Quadratmeter große Weihnachtskalenderfläche ergaben. Hinter jeder der 358 Türchen, also vom 1. Januar bis zum 24. Dezember, sollte eine Schokoladenfigur warten, die saisonbedingt beispielsweise im Frühling ein Krokus oder im Sommer ein Sonnenschirm war. Die Variante B hingegen sollte vor allen Dingen Käufern mit kleinen Räumlichkeiten die Möglichkeit einer Installation dieses außergewöhnlichen Kalenders bieten. Dazu erdachte sich Piefke einen fünfzehn Zentimeter langen Wandhaken, an den die zwölf Steckmodule hintereinander gehängt werden konnten. Nach abgeschlossener Planung kratzte Piefke mit der Überzeugung, der Menschheit einen eigentlich unbezahlbaren Dienst zu erweisen, sein gesamtes Vermögen zusammen, leierte bei seiner Bank einen seine Erwartungen übertreffenden Kredit heraus und kaufte eine kleine Fabrik irgendwo in der Holsteinischen Schweiz.
Piefke hatte sich bereits im Vorfeld der Produktion zwar etwas von seiner Idee erhofft, aber als der Kalender nach einer angemessenen Werbestaffel schließlich an einem 1. Januar für gerade 9,95 Euro in den Läden erhältlich war, da sprengte die Resonanz seine kühnsten Erwartungen.
Menschen rotteten sich vor Supermärkten zusammen, manche übernachteten sogar vor den Türen, um als Erste einen Kalender zu erstehen. Kaum dass neue Ka-lender geliefert wurden, waren sie auch schon ausverkauft. Der Schwarzhandel blühte in diesen Zeiten des Engpasses. Eine Frau hatte die die astronomische Summe von 135 Euro gezahlt und war darauf sogar noch stolz. Selbst die schlimmsten Säufer kauften für einige Tage etwas weniger Schnaps, um das Geld für den Kalender zu sparen. Besonders Überzeugte waren der Meinung, dass auch die Toten dieser segensreichen Erfindung teilhaftig werden sollten, und so fand man die Variante B vereinzelt an Grabsteinen fest geschraubt.
Piefke selbst wurde in Talkshows herumgereicht, und auch die zynischsten Showmaster ließen es sich nicht nehmen, ihre Sympathie für Piefkes Projekt zu bekunden. Sicher gab es einige, die den Kalender mit Skepsis betrachteten, aber die hielten den Mund, denn zum einen wollten sie nicht ins Schussfeld der allgemeinen Meinung geraten, zum anderen mussten sie sich eingestehen, nur neidisch auf Piefkes Erfolg zu sein.
Bereits im März war die Fabrik der Nachfrage nicht mehr gewachsen, so dass vergrößert werden musste. Der kleine Ort in der Holsteinischen Schweiz entwickelte sich langsam zu einem Wallfahrtsort, worauf dort niemand vorbereitet gewesen war. Doch den findigen Bewohnern gelang es, den nahezu heiligen Glanz des Gegenstandes auf ganz gewöhnliche Dinge umzuleiten. Selbst die Steine des Zufahrtsweges zur Fabrik wurden fortgetragen, denn immerhin hatten die Lkws, bepackt mit Weihnachtskalendern, sie berührt. Eine Gruppe extremer Priester schlug Piefke schließlich als Anwärter für eine Heiligsprechung vor, aber so weit wollte man im Vatikan noch nicht gehen. Immerhin wäre das Unternehmen vordergründig rein kapitalistisch, wenn auch ein gewisser Bezug zu Glaubenssachen nicht abzustreiten sei. Aber ärgerlicherweise sei Piefke Protestant.
Man hätte meinen können, dass Piefke in seinem Büro im zwölften Stock seines neuen Verwaltungsgebäudes für immer ausgesorgt haben müsste. Aber eines Tages im Hochsommer, als er sich wieder vor der Panzerglasvitrine mit dem ersten gekauften Weihnachtskalender in seinem Ruhm aalte, sah er, wie sich die Pappe um den 15. Dezember herum erst ausbeulte und dann verfärbte. Ungläubig rieb er sich die Augen. Eine braune Masse quoll durch die Perforation der Papptürchen und wälzte sich langsam über die Weihnachtsmänner und rehgezogenen Schlitten. Dann breitete sie sich auf dem Samtkissen, auf dem der Kalender ruhte, aus. Piefke wurden die Knie weich. Die im Kalender enthaltene Schokolade hielt den Sommertemperaturen nicht stand.
Es hagelte zunächst nur Beschwerden, dann aber vor allem Rechnungen über verschmierte Wohnzimmerwände. War der Stein des Anstoßes erst nur die sich verflüssigende Schokolade gewesen, so wurden nun Kritiker mutig, die sich im Zuge der Euphorie nicht getraut hatten, ihre Meinung zu sagen. Reporter zogen durch das Land, um die Menschen nach ihrer Meinung zu befragen. Sehr viele wussten nun, warum der Piefke-Kalender nur 9,95 Euro gekostet hatte, denn sie sahen sich darin bestätigt, dass das, was nichts kostet, auch nichts taugt. Eine Gruppierung zur Rettung des Osterfestes wurde laut, denn der Piefke-Kalender hätte durch seine Konzeption das Weihnachtsfest so stark in den Vordergrund gerückt, dass andere Feste – speziell Ostern – völlig vernachlässigt worden seien. Wieder andere empfanden es plötzlich als langweilig, ein ganzes Jahr auf Weihnachten zu warten. Ganz spitzfindige meinten dagegen, dass von Ganzjährigkeit überhaupt nicht die Rede sein konnte, denn schließlich würden dafür exakt 7 – in Worten sieben – Tage fehlen, auch wenn es im Volksmund die Tage zwischen den Jahren gebe. Manche hatten sich auch über die Schokoladenfiguren hinter den Türen geärgert, und speziell eine alte Jungfer hatte die Darstellung eines Frosches mit der eines spärlich bekleideten Mannes verwechselt und geisterte seitdem verwirrt durch U-Bahn Schächte.
Die wahrscheinlich größte Katastrophe hatte der Kalender aber in Geheimdienstkreisen heraufbeschworen. Spezialisten hatten aus der vorgegebenen Anordnung der Schokoladenfiguren einen super geheimen Code entwickelt, der dort, wo der Kalender hing, zum Informationsaustausch der Agenten diente. Die sich auflösenden Figuren führten somit zu einem Informationsloch, das behelfsmäßig, und darum fehlerhaft, gestopft wurde und zu drastischen Missverständnissen führte. So war die Ermordung des Präsidenten einer Bananenrepublik schließlich nur auf ein derartiges Missverständnis zurückzuführen. Kommunistische Staaten empörten sich, kapitalistische Staaten versuch-ten zu vertuschen, bis die Zusammenhänge von einem renommierten Nachrichtenmagazin veröffentlicht wurden und die Situation entschärft werden konnte. Schließlich wäre ein Krieg durch einen schlecht gemachten Weihnachtskalender nicht zu rechtfertigen gewesen. Am Ende zogen die extremen Priester ihren Vorschlag zurück und wandelten ihn in einen Antrag auf Exkommunizierung Piefkes um, der aber aus denselben Gründen abgelehnt wurde wie der zuvor gestellte.
So kam es, dass Piefke sein gesamtes Vermögen für Wiedergutmachungen ausgeben musste. Zudem wurde sein Kalender verboten, und auch eine verbesserte Neuauflage wurde ihm nicht gestattet, weil man soziale, moralische und wirtschaftliche Unruhen befürchten musste. Piefke stand schließlich wieder genau dort, wo er angefangen hatte: in der Schlange vor der Kasse, mit einem Zwiebelnetz und einem Senfglas in der Hand, und stellte verbittert fest, dass die Grenze zwischen Heldentum und Schande wahrhaftig fließend sein kann.
Kontakt
„Sind Sie ein furchtsamer Mensch?“
Ich starre direkt in ein spitznasiges, schlecht rasiertes, tief zerfurchtes und groß grinsendes Gesicht unter einem seltsamen Hut, das mich mit seiner Frage aus meiner Lektüre herausgerissen hat.
„Nicht, dass ich wüsste“, stammele ich irritiert und zugleich in die Enge getrieben und blicke mich daher suchend um. Aber ich bin allein mit meinem Gegenüber an dieser verlassenen Bahnstation.
„Hervorragend“, sagt der Andere und tritt einen Schritt zurück. Er steckt in einem zusammengewürfelten, abgetragenen Anzug, überdeckt von einem langen, dunklen, mit einer derben Kordel am Hals zusammengehaltenen Umhang. Blitzsaubere Schuhe lugen unter dem Saum hervor.
„Dann werde ich Sie jetzt mit einer Sache vertraut machen. Dabei müssen Sie aufmerksam sein. Schauen Sie hin. Hören Sie zu. Auf keinen Fall dürfen Sie jedoch weiterlesen!“
„Wenn Sie das für richtig halten“, sage ich, sehr darauf bedacht, den anderen nicht zu reizen, weiß man doch, wohin leichtfertige Worte führen können.
Ich lasse die Lektüre also sinken, ja ich halte es sogar für angemessen, die Hände frei zu haben, und lege die Lektüre darum neben mich auf die Bank. Ich hoffe inständig, es lediglich mit einem jener harmlosen Verwirrten zu tun zu haben, wie sie mir in dieser Gegend des Öfteren begegnen.
„Ich bin sozusagen ein Entdeckungsreisender. Sie kennen doch Entdeckungsreisende, oder?“
Ich nicke vorsichtshalber. Zu meiner Erleichterung tritt der Mann noch einen Schritt zurück.
„Dann werde ich Sie jetzt mit meiner Vorübung vertraut machen. Sie werden sehen.“
Er breitet die Arme aus, so dass der Umhang den Bahnsteig dahinter vollständig verdeckt.
„Es ist eine Vorübung, die absolut nötig ist ... zum Aufwärmen sozusagen. Vor allem muss sie rechtzeitig ausgeführt werden. Sonst funktioniert es nicht.“
„Sonst funktioniert was nicht?“, frage ich.
„Es hat mit dem Reisen an sich zu tun. Dem Prozess als solchem. Ich muss mich sehr konzentrieren, und selbst dann gelingt es nicht immer. Jetzt, wo Sie mich schon einmal gesehen haben, spielen Sie auch eine gewisse Rolle dabei.“
„Wieso ich?“, frage ich verblüfft.
„Nun, jetzt lässt es sich nicht mehr rückgängig machen. Und darum müssen Sie genügend vorbereitet sein.“
„Ich? Wofür?“
„Es nennt sich Nebensprung und befähigt mich, eine kurze Distanz zu überbrücken, ohne dass mich irgend-etwas daran hindern könnte.“
Jetzt bin ich vollständig davon überzeugt, es mit einem dieser Verwirrten zu tun zu haben.
Er beginnt langsam mit den Armen auf und ab zu wedeln, als wolle er sich einem großen Schmetterling gleich in die Luft erheben. Seine Bewegungen werden schneller und schneller, bis ich den Eindruck gewinne, seine Arme mit dem darüber hängenden Umhang hätten sich in so etwas wie riesige, rauschende Flügel verwandelt, denn der hinter ihm liegende Bahnsteig wird für mich wieder sichtbar. So schnell sind seine Bewegungen. Sein restlicher Körper mit dem Kopf darauf bleibt dagegen in absoluter Ruhe.
„Sehen Sie?“, lächelt er mir zu. „Ich habe das lange geübt.“
„Wie weit können Sie sich denn auf diese Weise bewegen?“, frage ich inzwischen belustigt, denn obwohl die Geschwindigkeit der Arme beeindruckt, so bewegt sich der Kerl um kein Maß in irgendeine Richtung.
„Nur ein paar Schritte. Sie werden sehen. Übrigens, fährt hier nicht der Schnellzug durch?“
Ich stutze.
„Ja, das tut er. In wenigen Minuten wird er kommen. Aber er wird nicht halten. Er ist kein Bummelzug.“
„Das ist gut“, sagt der Mann. „Würden Sie mir Bescheid geben, wenn er sich nähert?“
Ich blicke in die Richtung, aus welcher der Zug kommen wird, und auch, um mich zu vergewissern, ob vielleicht inzwischen irgendjemand den Bahnsteig betreten hat und ebenfalls Zeuge seiner Darbietung wird. Aber weder das eine noch das andere ist der Fall. Ich wende mich wieder dem seltsamen Mann zu.
„Gut, das wird reichen“, sagt er und stellt seine Armbewegungen so schlagartig ein, dass es mich ein wenig schwindelt.
„Aber Sie sind nach wie vor an derselben Stelle“, sage ich.
„Wie ich bereits erwähnte, handelt es sich dabei lediglich um eine Vorübung. Sie werden sehen.“
In diesem Moment beginnen die Gleise zu singen.
„Ich denke, der Zug kommt“, vermute ich. „Ja, da hinten zeigt er sich schon. Gleich wird er da sein.“
„Vielen Dank“, lächelt der Mann sehr breit. Zumindest wirkt es so, als lächele er jetzt breiter. Tatsächlich aber hat es einen kurzen Ruck durch seinen Körper gegeben, und er hat sich in zwei identische aufgeteilt, die um etwa eine Fingerbreite gegeneinander verschoben sind und sich dabei vollständig durchdringen. Diese beiden Männer werden transparent, springen zurück ineinander, springen wieder auseinander, schneller und schneller und sind schließlich so etwas wie ein oszillierendes, ein flimmerndes System. Als wäre ich noch nicht genug verblüfft, hebt dieses Gebilde, denn von einem Mann mag ich in dem Moment nicht mehr reden, eine Hand oder vielmehr zwei rechte Hände zum Gruß. Mit einem sanften Blitz etwa in der Art, wie er beim Ausschalten eines Fernsehgerätes beobachtet werden kann, verschwindet die Erscheinung in dem Augenblick, als der Zug am Bahnsteig entlang rast.
Ich erhasche den Anblick des Mannes, wie er hinter einem der vorübersausenden Fenster weiterhin zu mir herübergrüßen. Mir stellt sich die Frage, was jene Passagiere in dem Abteil wohl über sein plötzliches Erscheinen, seinen Nebensprung, denken möchten. Ich bin immerhin in geeigneter Weise vorbereitet worden, um mich nicht zu fürchten.
Messiaen
Warum habe ich mich um Himmels Willen nur darauf eingelassen?
Weil sie mir geschmeichelt haben? Weil ich zu gutmütig bin? Weil es eine Herausforderung ist? Sie haben kein Basssaxophon auftreiben können, das sie eigentlich gebraucht hätten. Aber ich hätte doch zu Hause eine Tuba. Die würde ich doch wie meine Posaune vorzüglich beherrschen, haben sie gesagt. Die Tuba sei jedoch in Es gestimmt, habe ich gesagt. Eher etwas für ein Ensemble, nicht für ein Blasorchester. Sie hätten keinen anderen, haben sie gesagt. Keinen anderen Dummen, füge ich jetzt für mich hinzu. Dabei liegt das Stück selbst eigentlich in einer günstigen Lage, bis auf diesen einen Ton. Den ersten Ton. Den allerersten Ton. In Forte Fortissimo!
Nein, nein, eine Tuba bläst man nicht wie eine Blockflöte. Der Ton wird mit den Lippen erzeugt. Er muss auch ohne Mundstück und Instrument klingen. Ich habe während der ersten Probe mit Sub-Kontra-Es angegeben. Naturton auf diesem Instrument! Kaum 20 Hertz! Über eine Oktave tiefer als für das Stück nötig und als es mit einem Basssaxophon überhaupt möglich wäre. Sub-Kontra-Es ist leicht, das spiele ich im Schlaf, das will das Instrument fast von allein spielen. In dieser Tiefe klinge meine kleine Tuba beinahe so schnarrend wie ein Basssaxophon, meinte der Maestro. Er will darum unbedingt Sub-Kontra-E haben. Das ist auch im Keller, auch ganz unten, aber eine Idee über der Leichtigkeit. Gerade eben kein Naturton. Eine Qual. Da muss man alle vier Ventile drücken, da muss man Luft geliehen bekommen, vor allem bei mehrfacher Taktlänge und Forte Fortissimo. Das nenne ich Ewigkeit! Die Lippen sind flaumweich und flattern vor den Zähnen im Kessel des Mundstücks herum. Sub-Kontra-E! Die Zunge verkriecht sich in den vibrierenden Hals, aber auch der Kopf vibriert, der Brustkorb, ja der ganze Körper bis in die kleine Zehe. Der Raum drumherum geht manchmal in Resonanz über. Selbst das Haus kann mitschwingen.
Speziell bei meinem Instrument muss man den Ansatz für diesen Ton ein wenig absacken lassen – vor dem Anblasen, nicht während! Er darf keinesfalls geschlenzt sein wie bei manchen Schlagersängern. Dieser Ton muss genau auf den Einsatz des Maestros hin sauber im Raum stehen. Man muss ihn eine halbe Sekunde früher anblasen, damit die Luftsäule genug Zeit hat, um sich einzuschwingen für Sub-Kontra-E und Forte Fortissimo. Es dauert bei diesem Stück Messiaens besagte Ewigkeit, bis das Orchester einsetzt und mich erlöst. Meine Lunge ist ausgequetscht und fühlt sich nur noch walnussgroß an. Mir ist dann schwindelig. Als Posaunist bin ich so was nicht gewohnt.
Gestern hat es wieder nicht geklappt, und gleich ist Premiere. Ich bin ein Nervenbündel. Am liebsten würde ich den Ton jetzt und hier, mitten auf der Bühne noch einmal proben, so wie in den letzten Wochen.
Da bin ich morgens aufgestanden, habe mir die Tuba gegriffen und den Ton gespielt. Aus dem Stegreif und genau so, wie wenn der Maestro mir den Einsatz gibt. Ich kam von der Toilette und habe den Ton gespielt. Ich trank einen Kaffee und spielte danach den Ton. Ich ging einkaufen und spielte den Ton nach meiner Rückkehr. Ich hängte die Wäsche im Keller auf und spielte, wenn ich zurück in der Wohnung war, den Ton. Ich wischte die Treppe und dachte nur an den Ton. Ich saß im Kino, in der Straßenbahn, im Auto, im Hotel und dachte nur an den Ton. Ich erwischte mich dabei, wie ich durch die Straßen lief, in der Hosentasche meine Finger zum Alle-Ventile-drücken-Griff formiert. Dazu flatterten meine Lippen.
Meine Nachbarn haben erst nur verhaltener gegrüßt, dann haben sie es ganz unterlassen, und als ich vorhin die Wohnung verließ, sah ich einen mit übermüdeten, hasserfüllten Augen. Sie wissen um meinen Beruf, aber sie wissen auch um meine Kraft. An mich heranwagen würden sie sich daher nicht. Für ein fettiges Bittschreiben mit allen Unterschriften, unter meiner Tür durchgeschoben, reichte ihr Mut gerade eben. Ich konnte nicht darauf Rücksicht nehmen, kann es ihnen aber auch nicht verübeln, dass sie mich schneiden, denn auch, wenn ich nachts aufwachte, nahm ich sofort das Instrument und spielte den Ton. Meine Freundin ist verbittert. Guter Sex war einmal. Kein Kuscheln danach, nur der Ton. Forte Fortissimo! Sie ist erst einmal ausgezogen.
Ich bin sowieso nur noch zu einer Sache zu gebrauchen. Niemand kann die Qualen erahnen, die ich erleiden musste und muss, wenn sich das Universum nur noch um diese knapp 20 Hertz am Anfang, allein und in Forte Fortissimo dreht. Ich hoffe, ich bete ...
Der Maestro betritt die Bühne und besteigt das Pult. Bei rauschendem Beifall zwinkert er allen zu. Mir zwinkert er gleichfalls zu, aber da ist in seinen Augen auch etwas von der Angst, die ich ausschwitze. Ich halte etwas Wasser im Mundraum gefangen, das ich kurz zuvor herunterschlucken werde. Der Mund darf nicht trocken werden!
Der Beifall verebbt. Der Maestro hebt den Stock und fasst mich scharf ins Auge. Ich sehe den Stock seinem höchsten Punkt entgegenschwingen, ich schlucke, ich drücke die Ventile, ich hole tief, sehr tief Luft. Die Lippen erschlaffen kontrolliert. Der Stock zielt auf mich wie ein Degen, da habe ich bereits angeblasen. Und dann ist er da! Groß und mächtig steht der Ton im Raum wie ein Monument. Mit Messiaen rufe ich aus den Tiefen der Tiefe und erwarte meine Auferstehung von den Toten.
Das 1964 in Paris uraufgeführte und für Holz- und Blechbläser gleichermaßen atemlose Stück von Olivier Messien heisst Et expecto resurrectionem mortuorem (Und ich erwarte die Auferstehung von den Toten).
Das Wort
Wenn einer nicht mehr hungrig ist,
dann ist er satt, soviel steht fest.
Bei durstig wird es schwierig, weil
für durstig fehlt das Gegenteil.
Zwar fand ein Mensch bei Stuttgart,
sitt sei geschickt und sehr smart.
Doch Doktor Mathematikus
saß in der Kammer mit Verdruss.
Es ärgerte ihn krumm und schief
dies kleine Wort, dies Adjektiv!
Dem Doktor war es zu bescheiden,
ein besseres galt herzuleiten.
Den Buchstaben von A bis Z
man eine Zahl zuordnen tät
von eins bis sechsundzwanzig –
des Doktors Stirn entspannte sich.
Nun ließ sich schön die Summe bilden,
von jedem Wort, aus allen Silben.
Mit hungrig, durstig und auch satt
den Dreisatz er geformet hat.
Er musste hier bedenken fix,
dass hungrig zu satt wie durstig zu x.
Der Doktor wurde jetzt ganz hitzig,
denn x sollt sein gar runde siebzig!
Buchstaben zählt er, die vielen –
hungrig hat wie durstig sieben.
Zu satt war jetzt ganz logisch hier,
das neue Wort sollt haben vier.
Konsonant und auch Vokal
bereiteten ihm etwas Qual.
Hungrig hat genau zwei G,
entsprechend satt genau zwei T.
Weil durstig lebt mit einem G
erhält das neue Wort ein T.
Den U´s und I´s äquivalent
ist A. Das ist doch evident!
Der Doktor jubelte: „Vortrefflich.
Die Wissenschaft ist unbestechlich.
Die gute, alte Algebra
erzwang ein T sowie ein A.“
Die Summe dieser beiden
ließ sich von siebzig scheiden.
Was blieb war ein gesunder Rest.
Neunundvierzig. Welch ein Fest!
Neunundvierzig für zwei Staben!
Das war zu lösen ohne Fragen.
Und als am Morgen kam die Katz,
da stand auf seinem Zettel: watz!
Das nun sollte das Wörtchen sein.
Es war ganz schmuck und obendrein
ermittelt und verknüpft,
ertüftelt und geprüft.
Der Doktor schrieb dann an verehrte
Gremien und Schriftgelehrte.
Das Wort, es passe ins Gefüge.
Auf das man´s lehre und es übe!
Die Fachwelt war ganz fasziniert,
der Doktor aber tief gerührt.
Im ganzen Land durft´ er verbreiten
das Wort und seine Nützlichkeiten.
Das alles war zwar gut erdacht,
allein das Wort wurde verlacht.
Obwohl der Doktor drauf bestand
es nicht in Volkes Sprache fand.
Statt watz sprach jeder hurtig:
„Ich bin jetzt nicht mehr durstig.“
Und als er wollte jemand zwingen,
bekam er Prügel nebst andern Dingen.
Schwer zerbeult kehrte er heim
und gestand den Fehler ein.
Ein Wort, das bisher nicht von Nöten,
das muss man nicht zusammenlöten.
Selbst wissenschaftlich hergeleitet,
ist es doch künstlich zubereitet.
Gut erfunden mag erheben,
den Lohn vergibt derweil das Leben.
Vielleicht ...
Werner Pohl saß vor seinem Feierabendbier und beobachtete, wie die Schaumkrone langsam zerfiel. Was gäbe er darum, jetzt jemanden bei sich zu haben, der mit ihm anstoßen würde. Aber seine wenigen Freunde waren wie so oft beschäftigt, und dem Schauspieler im Fernsehen zuzuprosten, hielt er für krankhaft.
Ob der Luftdruck dafür sorgte, dass die Schaumkrone zerfiel? Aber so weit wusste er über physikalische Zusammenhänge Bescheid, um diese Erklärung sofort zu verwerfen. Andererseits wurden tagtäglich neue, erstaunliche Entdeckungen in den Naturwissenschaften gemacht, und manchmal sogar althergebrachte Vorstellungen von Wirklichkeit über den Haufen geworfen.
Er nahm einen tiefen Schluck aus der Flasche und wechselte den Kanal. Im Fernsehen berichteten sie vom Start einer Rakete ins All.
Das All!
Gerade hier schienen zahlreiche Überraschungen auf die Menschen zu warten. Konnte man doch heute schon Milliarden Lichtjahre in das Universum hineinhorchen. Für Werner Pohl war es unfassbar, dass man bis heute nicht auf andere Lebewesen gestoßen war.
„Vielleicht haben wir immer noch nicht die Möglichkeiten“, murmelte er, schlürfte das Glas leer und wälzte sich aus dem Sessel. Auf dem Weg zum Kühlschrank kam ihm eine Idee. Was wäre, wenn es zwar Lebewesen im Kosmos gäbe, die Menschen sie aber nicht sehen könnten. Vielleicht, weil sie unsichtbar waren. Oder ... und nun stutzte er. Vielleicht wollten diese Wesen gar nicht von uns gesehen werden?
Er hatte seinen Sessel wieder erreicht und starrte mit glasigen Augen die Wand über dem bedeutungslos gewordenen Fernseher an. Seine Gedanken begannen zu galoppieren. Vielleicht wollten die da draußen nichts mit uns Menschen zu tun haben und verbargen sich deshalb nach Kräften. Werner Pohl konnte das nur zu gut verstehen, denn er selbst hatte auch oft das Bedürfnis, nichts mit denen vor seiner Wohnungstür zu tun zu haben. Nur jetzt hätte er gerne einen zum Anstoßen gehabt. Doch er schweifte ab.
Wie, wenn diese Lebewesen alle Anstrengungen, sie zu finden, abwehrten? Vielleicht hatten sie die Raumsonden von der Erde auf ihren Nachtkästchen deponiert und machten sich über ihre Absender lustig. Vielleicht war es ihnen mit einem guten Kniff gelungen, uns auf der Erde weiszumachen, der Raum sei gekrümmt, oder sie hatten vielleicht eigens eine Industrie dafür entwickelt, uns vorzugaukeln, dass es da draußen Galaxien über Galaxien gäbe.
Werner Pohl wurde sehr aufgeregt. Das Bier hatte er schon wieder ausgetrunken, und darum lief er schnell zum Kühlschrank. Er nahm gleich den Rest der Sechserpackung mit.
Aber warum wollten diese Wesen unerkannt bleiben, grübelte er, als er wieder im Sessel saß. Taten sie etwas ganz Geheimes? Oder gar Gefährliches? Oder hatten sie Angst? Er suchte nach einer Antwort, indem er von seinem Sessel aus durchs Fenster in die Nacht starrte.
„Vielleicht sind wir euch etwas zu verrückt oder zu böse oder zu langweilig oder alles auf einmal. Verflucht ... ich könnte das gut verstehen."
Ein weiterer Schluck stieß die Tür zu einer neuen Vorstellung auf. Wenn das hier auf der Erde nur die kleine Party wäre, dann wären wir alle von der großen, der eigentlichen, ausgeschlossen! Der Abschaum des Universums! Zu mies, als dass man sich mit uns beschäftigen müsste.
„Vielleicht sitzt ihr jetzt irgendwo da oben und trinkt Bier wie ich“, murmelte Werner Pohl angetrunken.
„Prost ihr da oben“, brüllte er in die Sterne. Er erhielt keine Antwort.
„Na gut“, seufzte er. „Vielleicht wollt ihr bei eurer Party unter euch sein ...“
Daraufhin schlief er in seinem Sessel ein.
Wäre er nicht eingeschlafen, dann hätte er leise, aber ganz deutlich, ein einziges Wort hören können:
„Genau!“
Humpert
Wahrscheinlich weiß nur noch ich, was es mit dem alten Humpert auf sich gehabt hatte. Natürlich wusste es auch Oma Tigges, denn die hat mir die Geschichte erzählt. Vielleicht ahnten es auch noch ein paar andere aus dem Dorf. Aber diese anderen sind, wie er selbst, bereits tot, und so ist es an mir, davon zu berichten.
Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als ich den alten Humpert zum ersten Mal sah. Es war ein Sonntagvormittag, und ich saß bei Oma Tigges in der Küche. Es roch nach Kaninchenbraten und warmer Milch, und die Katzen strichen um meine Beine. Oma Tigges saß vor einem Berg Kartoffeln. Liebevoll schälte sie die hellbraune Schale in einem Stück mit einem kurzen Messer herunter, halbierte die Kartoffel und gab mir beide Hälften, damit ich sie in den mit Salzwasser gefüllten Topf plumpsen lassen konnte. Die Sonne schien warm zum geöffneten Fenster herein, und von Zeit zu Zeit verirrte sich ein dicker Brummer auf eine der Geranien. Ich kann mich nicht entsinnen, jemals später wieder eine friedlichere Zeit erlebt zu haben. Noch heute, wenn ich in einem Kaufhaus einen dunkelblauen Stoff mit karminroten kleinen Quadraten darauf sehe, fällt mir der Küchenkittel von Oma Tigges ein, und ich verweile eine Zeit davor, um mir diesen Frieden wieder bewusst zu machen.
„Was willst du tun, wenn du groß bist?“, fragte Oma Tigges.
„Ich werde Bauer!“, sagte ich mit der Überzeugung, die nur Neunjährige haben können.
„Das ist eine gute Wahl. Meinst du, wir werden dann immer noch Kartoffeln zusammen schälen, wenn du ein Bauer geworden bist?“
„Selbstverständlich!“
Oma Tigges lächelte.
„Aber vielleicht hast du bis dahin eine junge Frau gefunden“, meinte sie.
„Nein, so wie du wird niemand Kartoffeln schälen.“
Oma Tigges lachte. Dann schaute sie aus dem Fenster. Ich blickte in ihr Gesicht und entdeckte mit einem Mal ein viel jüngeres darin. Dessen Augen glänzten hell und wach, während ein verträumtes Lächeln ihren Mund umspielte.
„Da ist Humpert“, sagte sie leise.
Ein sehr alter Mann schleppte sich über den kleinen Platz vor der Kirche. Er trug einen Sack auf dem Rücken. Sein Stock stieß auf dem Pflaster auf, als wolle er sich jedes einzelnen Steines vergewissern. Er blieb stehen, schob den Hut nach hinten und blickte zur Uhr des Kirchturms. Dann zog er ein weißes Tuch aus der Hosentasche und wischte sich damit den Nacken. Nachdem er das Tuch wieder eingesteckt hatte, drückte er den Hut zurück in die Stirn.
„Guten Tag, Humpert!“, rief Oma Tigges und lehnte sich etwas aus dem Fenster.
„Guten Tag, Luise!“, rief der alte Humpert zurück und lüftete seinen Hut. Seine Stimme klang kraftvoll und knorrig. Dann kam er auf uns zu. Sein großer Kopf erschien zwischen den Geranien.
„Wie geht es dir, Luise?“, fragte Humpert.
„Gut“, sagte Oma Tigges.
„Kenne ich den jungen Mann schon, der dir beim Kartoffelschälen hilft?“, fragte Humpert mit einem Blick auf mich.
„Das ist Robert. Er ist zu Besuch aus der Stadt gekommen.“
„Aha“, sagte Humpert und blickte mich fest an. Ich schwöre, ich habe bestimmt genauso zurückblicken wollen. Doch unter seinen buschigen, grauen Augenbrauen leuchtete mir ein Glanz entgegen, der mich in eine Welt mit hohen Bergen am Rande einer weiten Ebene entführte. Die Sonne tauchte alles in ein rot-goldenes Licht, und der Wind drückte Mulden in ein mannstiefes Grasmeer.
„Kann ich dir etwas anbieten?“, fragte Oma Tigges.
„Oh nein. Ich werde noch einen kleinen Spaziergang machen“, erwiderte Humpert.
„Dann will ich dich nicht aufhalten“, sagte Oma Tigges.
Ich blickte ihm über das Grasmeer hinweg nach, wie er hinter der Kirchhofsmauer verschwand.
„Ein seltsamer Mensch“, sagte ich leise.
„Oh ja. Das ist er“, meinte Oma Tigges. „Wenn du versprichst, es für dich zu behalten, dann werde ich dir eine Geschichte über den alten Humpert erzählen. Eine unglaubliche Geschichte, aber sie ist wahr.“
Ich nickte. Sie strich sich ihren dunkelblauen Kittel mit den karminroten Quadraten über den Knien glatt. Dann nahm sie eine neue Kartoffel und während sie die Schale in einem Stück abschälte, begann sie zu erzählen.
„Humpert wohnte damals wie heute in einem kleinen Häuschen am Rande des Dorfes. Zumindest damals war es der Rand des Dorfes. Heute grenzt dort die Neubausiedlung. Aber damals waren da Wiesen, sanfte Hügel und der Bach.“
„Was hat er dort gemacht?“, fragte ich.
„Nun, er hat Schlösser repariert. Du kannst dir sicher vorstellen, dass es im Dorf eine Menge Schlösser gibt. Manchmal klemmen sie, manchmal lassen die Leute Türen zufallen, und manchmal gibt es keine Schlüssel, weil sie verloren gegangen sind. Humpert kannte sich mit all dem aus. Ja, er war ein Meister seines Faches.“
Sie reichte mir die Kartoffelhälften, und ich ließ sie ins Wasser fallen.
„Bei schönem Wetter hat er auf der Bank an der Rückseite seines Hauses gesessen und Schlösser repariert. Von Zeit zu Zeit blickte er über den Bach, die Wiesen und die sanften Hügel, lächelte, und dann hat er weitergearbeitet. Wenn es regnete oder zu kalt war, dann saß Humpert in seiner Hütte am Fenster. Auch von dort konnte er den Bach, die Wiesen und die sanften Hügel sehen.“
Sie hielt eine Weile mit dem Kartoffelschälen inne und blickte nach draußen. Dann wendete sie sich mir wieder zu.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752103564
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (Juli)
- Schlagworte
- Kurztexte Kurzgeschichten Kirchgang skurrile Texte