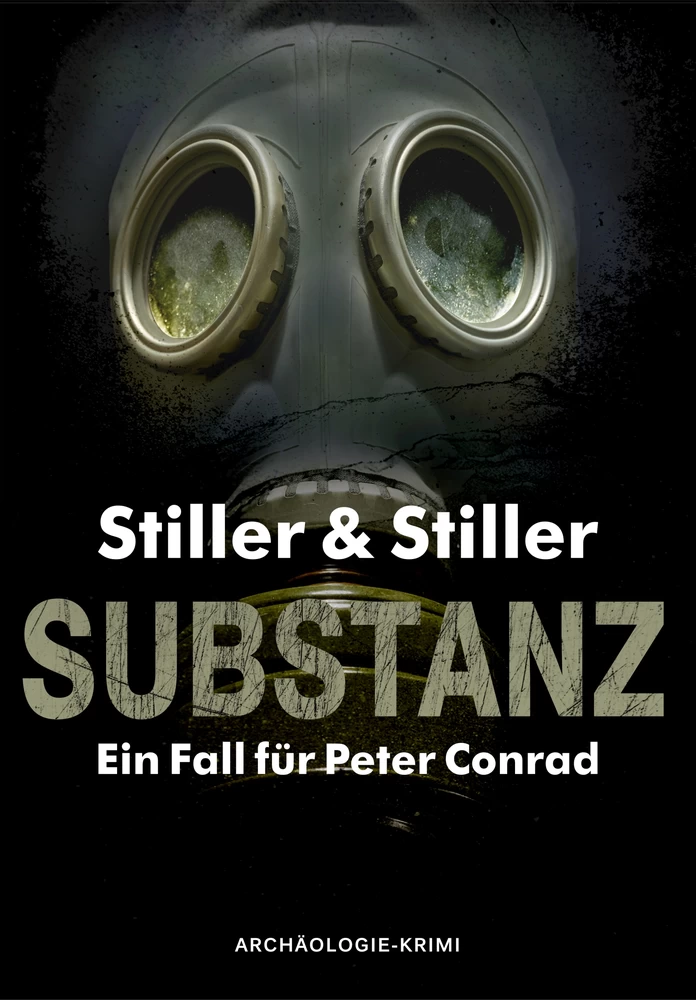Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Die bisher erschienen Romane von Stiller & Stiller
GREEN MAMBA — Schatten des Todes
INFORMIUM — Tödliches Experiment
Ein Fall für Peter Conrad:
DIE ERSTEN — Peter Conrads erster Fall
BLUT — Peter Conrads zweiter Fall
MASCHINE — Peter Conrads dritter Fall
SUBSTANZ — Peter Conrads vierter Fall
Peter Conrad Sammelband:
IN SITU — Peter Conrad Sammelband Fall 1 & 2
01
Er hatte die halbe Welt bereist. Das offene Meer, die Berge Asiens und die weiten Steppen Afrikas gesehen. Er hatte genommen, was immer er begehrenswert fand. Alles war ihm wunderbar und neu erschienen, er liebte das Abenteuer und, ja, auch die Gefahren, die ein solches Leben immer wieder bedeuten konnte. Nie wusste man, was hinter dem Horizont, im nächsten Hafen wartete. Doch genau das war es, was den Reiz eines Lebens in ständiger Bewegung ausmachte. Dass er deswegen möglicherweise nie ein alter Mann werden würde, der auf einer sonnenbeschienenen Bank die Tage verträumte und Kindern die Geschichten aus aufregenderen Tagen erzählen würde, hatte er von Anfang an in Kauf genommen. Das war nie das Ziel seines Daseins gewesen. Er hatte auch nie ernsthaft die Frage nach dem Sinn seines Lebens gestellt; das war ihm erst hier an diesem Ort bewusst geworden. Aber dass die letzten Tage seines irdischen Daseins so aussehen würden, hätte er niemals geglaubt.
Etwa eine Woche vor seiner Ankunft in Venedig, hatte ihn ein vages Unwohlsein gequält, das er nicht benennen konnte und mit dem er auch den Schiffsarzt nicht aufgesucht hatte. Doch dann war das Fieber gekommen. Nicht enden wollende Gluthitze. Und man hatte ihn nach der Ankunft sofort weggesperrt.
Seine Augen suchten haltlos die Schatten in den Ecken und Winkeln des halbdunklen Raums ab. War es schon wieder Nacht? Oder versagten seine Augen, so wie der Rest seines Körpers in den letzten Stunden abgebaut hatte? Er wand sich auf der dünnen Unterlage, kaum mehr als ein Sack mit Stroh. Der Raum verschwamm zu einem dunklen Brei. Das Fieber stahl ihm jede Kraft. Inzwischen konnte er nicht mehr auf den eigenen Füßen stehen, nicht mehr richtig essen, kaum noch Wasser und die dünne Brühe bei sich behalten.
Auch wenn ein Teil von ihm wusste, dass es jeden treffen konnte, dass er nur einer von vielen war, dass diese Möglichkeit immer bestanden hatte, fragte er sich immer wieder, ob es nicht doch einen Grund dafür gab, dass es ausgerechnet ihn getroffen hatte. Wie viele Begleiter auf seinen Reisen, Männer und sogar Frauen—die ein noch viel riskanteres Leben führten als er—waren dort draußen, und niemand hatte sie mit solchem Elend geschlagen?
Manchmal, ganz kurz, wenn das Licht in Blitzen durch das schmale Fenster fiel, glaubte er, ganz deutlich ein Kreuz auf der unverputzten Ziegelwand zu erkennen, aber immer, wenn er ein zweites Mal hinsah, war es verschwunden. War das ein Zeichen Gottes, dass er für seine Sünden gerichtet wurde und der Allmächtige selbst ihn in seinen Qualen sah und sie für wohlgetan hielt? Oder war im Gegenteil das Zeichen der Beweis dafür, dass sein Martyrium unverschuldet und eine Prüfung seines Glaubens war?
Auch wenn es mehrere Jahrzehnte her war, konnte er sich an die Worte des alten Priesters in der winzigen Kapelle am Rand seines Dorfes erinnern, als der von Hiobs Leiden berichtete. Mit der Leidenschaft, zu der nur ein Mann dieses Standes fähig war. Er hatte sich immer gefragt, ob Padre Colombo sich vor einer solchen Gottesprüfung sicher gefühlt hatte, weil er nicht von geeigneter Tugend war, um Gott und Teufel zu einer solchen Wette zu veranlassen.
Jetzt beschäftigte ihn die Geschichte Hiobs, die Vorstellung, dass die verschiedensten Leiden und Schläge des Schicksals einen einzigen Menschen treffen konnten, doch vor allem verfolgte ihn sein ketzerischer Hohn gegenüber jenem Priester. Hatte er mit seinen abfälligen, spöttischen Gedanken den Zorn des Herrn herausgefordert? Auch wenn er nie jemandem mit Absicht geschadet hatte, prüfte Gott nicht das Herz jedes Menschen? Und waren solche Gedanken nicht Sünde genug, besonders, wenn es um das Leiden des gerechtesten aller Menschen ging?
Was hatte er selbst schon je getan, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Ihn hatte nie etwas anderes interessiert als sein eigenes Vergnügen und nicht selten der Profit, den er durch seine Reisen machen konnte. Und jetzt trug er etwas in sich, das ihn bis in den letzten Winkel, in die letzte Faser seines Seins anfüllte.
Schüttelfrost packte ihn hart im Nacken, und er biss die Zähne so fest aufeinander, dass sie knirschten. Dann kam der Husten, der ihn inzwischen immer öfter quälte und jetzt auch noch die wenigen Momente der Ruhe stahl, die ihm der Schlaf noch gewährt hatte. Die bellende Qual ebbte erst nach Minuten wieder ab und ließ ihn vollkommen erschöpft auf seiner ärmlichen Bettstatt in einen Dämmerzustand sinken, nur um ihn nach kurzer Frist erneut zu überfallen.
Ihm blieb bloß noch zu hoffen, dass sie wussten, was sie taten. Dass er hier in diesem Loch bleiben konnte, bis alles sein unausweichliches Ende nehmen würde. Dann würde er seinem Schöpfer gegenübertreten und endlich erfahren, ob er gestraft wurde oder geprüft—oder ob er für etwas ausersehen war, das er nicht erkennen konnte.
02
»Gino Soccio.«
»Buona giornata... äh... Mi chiamo Franks... Lisa Franks. Io... äh...« Innerhalb von zwei Sekunden war ihr Gesicht puterrot angelaufen.
»Signorina Lisa!«
»Io...« Sie warf Conrad einen wütenden Blick zu, der ihn mit Unschuldsmiene und zwei erhobenen Daumen erwiderte. »Ich... io...«, stotterte Franks, während sie sich, ihren Begleiter fixierend, in einer eindeutigen Geste über Kehle fuhr. »Io... äh chiamo...«
»Sie können Deutsch mit mir sprechen, wenn Ihnen das lieber ist, Signorina Lisa«, erwiderte die sonore Stimme, die Conrad deutlich verstand, obwohl Lisa den Hörer mit weiß hervortretenden Knöcheln fest an ihr rechtes Ohr presste. »Wenn man die Seuchen des Mittelalters als Steckenpferd hat, dann ist es von Zeit zu Zeit ganz hilfreich, die Sprache der Kollegen zu beherrschen.«
Sie überhörte seine Spitze. Ihre Augen verengten sich zu Schlitzen und sie wiederholte ihre Drohgeste gegenüber Peter Conrad. »Äh, schön... am Telefon ist es wirklich nicht so einfach. Ich... mein Kommilitone, Herr Peter Conrad von der Universität Berlin hat mich gebeten–«
»Ah, ich weiß Bescheid, Fräulein Franks«, unterbrach sie der Italiener. »Herr Conrad hat mir von Ihrem Wunsch berichtet.«
»Meinem...?«, stammelte sie. »Ich... Wir... Also wir–« Dieses Mal unterbrach sie sich selbst. »Ich reiche Sie gerade rüber zu Herrn Conrad. Der kann Ihnen das selbst sagen.« Mit weniger rotem Kopf, aber weiterhin böser Miene übergab sie ihm den klebrigen Hörer.
»Guten Tag, Gino.« Er ließ eine Sekunde verstreichen, um sich an Lisas verblüfftem Gesichtsausdruck zu weiden. »Wir sind vor Ort. Wie geht es Ihnen?«
»Fantastisch, vielen Dank«, dröhnte Soccios Bass. »Ich hoffe, Sie und Ihre zauberhafte Begleiterin hatten eine angenehme Reise in unser wunderschönes Venedig.«
»Zauberhaft...«, murmelte Conrad leise, während man den Archäologen herzhaft lachen hörte.
»Ich dreh' dir den Hals um«, zischte Franks, während Conrad nach den richtigen Worten suchte.
»Ich habe Ihnen ein hübsches Zimmer in einer gemütlichen Pension reserviert. Nicht das Hotel Ritz, aber mit familiärer Atmosphäre, guter Küche und, das Wichtigste, in der Altstadt gelegen.«
Franks war jetzt ganz nah an Conrads Ohr. »Wenn der Kerl ein Doppelzimmer gebucht hat, überlebst du die Nacht nicht, Peter Conrad.«
Conrad machte eine unwirsche Bewegung, verzog missmutig das Gesicht und schüttelte den Kopf. »Das... äh... das ist wunderbar. Vielen Dank!«
»Ein Doppelzimmer ist doch in Ordnung für Sie beide, nehme ich an?« Wieder hörte man Soccio lachen. »Anderenfalls wird es etwas kompliziert. Zurzeit ist hier kaum noch ein Zimmer zu bekommen. Hochsaison, Sie verstehen?«
»Ist schon in Ordnung«, antwortete Conrad, während er Franks' giftigem Blick zu entkommen versuchte. »Wir sind ja schließlich... befreundet.«
»Da bin ich erleichtert«, brummte der Italiener. »Aber wir sind ja alle Archäologen. Wie sollten wir den Grabungsalltag bewältigen, wenn wir uns an solchen Kleinigkeiten stören würden?« Wieder dieses polternde Lachen.
»Wenn der noch einmal geiert, erwürge ich den gleich mit«, zischte Lisa ihm ins Ohr.
»Äh, ja... Wo treffen wir uns?«, versuchte der Anthropologe auf den Punkt zu kommen. »Wir sitzen gerade vor der–«
»Ah, ich weiß, wo der Bahnhof ist«, unterbrach ihn Soccio. »Geben Sie mir noch ein wenig Zeit. In einer halben Stunde bin ich vor dem Eingang. Ich erkenne Sie sicher, wenn ich Sie sehe.« Noch bevor Conrad sich verabschieden konnte, hatte der Archäologe von der Universität Padua aufgelegt.
***
Es war warm, selbst hier im Schatten des kleinen Cafés am Kanal, in das sie mit Professor Soccio eingekehrt waren. Conrad trank von seinem eben servierten Cappuccino und wünschte sich, er hätte eine Limonade bestellt.
Soccio nippte einige Male genüsslich an seinem Espresso, ehe er zur Sache kam. »Lazzaretto Vecchio, das ist unser Grabungsareal für diesen Sommer und vermutlich die nächsten Jahre.« Er zog eine handliche Übersichtskarte der Lagune von Venedig aus der Innentasche seines Sakkos, breitete sie zwischen ihren Tassen und Wassergläsern aus und umfuhr die kleine Insel mit dem Zeigefinger. »Hier.«
»Eine Insel...«, murmelte Franks.
»Ich dachte, du hast den Bericht gelesen«, schaltete sich Conrad ein. »Die Insel der Verdammten.«
Sie winkte ab. »Sieht ziemlich klein aus. Ich habe mich nur gefragt, wie das mit dem Friedhof funktioniert.«
»Sie meinen das Wasser«, half der Italiener. »Man hat damals verhältnismäßig viel Material aufgeschüttet, sodass das Bodenniveau des alten Lazaretts rund zwei, teilweise drei Meter über der Wasserlinie liegt. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es im Mittelmeer kaum Gezeiten. Deshalb ist die Höhe des Wasserspiegels recht konstant. In der Adria ist diese Schwankung noch einmal geringer. Zum einen, weil sie recht weit vom Atlantik und seinen Einflüssen entfernt ist, zum anderen, weil die Form beziehungsweise Länge dieses Meeresgebietes das Ganze noch träger macht.« Er umkreiste langsam die Lagune und tippte auf eine der Verbindungen in die Adria. »Wie Sie sehen, gibt es nicht sonderlich viele Durchfahrten in unsere Lagune. Dieses beinahe abgeschlossene System ist somit noch stärker gedämpft. So konnte man relativ sicher sein, dass die Toten nicht im Wasser liegen.« Er räusperte sich. »Wobei das eher religiöse Gründe hatte. Um eine Trinkwasserverseuchung hat man sich damals weniger Sorgen gemacht, auch weil vor dem Bau der Versorgungsleitungen in der Neuzeit das Regenwasser in Zisternen gesammelt wurde... und in dieser Region regnet es ausreichend.«
»An die Gezeiten hatte ich gar nicht gedacht–«
»Ich habe das ein wenig vereinfacht, Signorina Lisa«, unterbrach Soccio ihren Gedankengang. Er nahm einen weiteren, winzigen Schluck von seinem Espresso. »Genau genommen ist die Lagune von Venedig in einen nördlichen und einen südlichen Bereich zu unterteilen. Die Altstadt, also das, was die meisten Menschen als Venedig bezeichnen, bildet durch ihre schiere Größe gewissermaßen eine Barriere. Nördlich davon gibt es praktisch keinen Tidenhub, dafür fast reines Süßwasser. Wir nennen das den 'toten' Teil der Lagune. Der lebendige Teil im Süden ist Brackwasser oder Salzwasser, hat also wesentlich mehr Austausch mit dem Mittelmeer und ist dem Einfluss des Mondes stärker unterworfen. Das Lazzaretto befindet sich in einem Übergangsgebiet. Jedenfalls ausreichend, dass die bisher gefundenen Überreste die meiste Zeit trocken gelagert waren.«
»Nun gut, verstanden«, ergriff Conrad das Wort. Obwohl er wusste, dass das mit dem Mond Unsinn war, verzichtete er darauf, den Leiter der Ausgrabung zu verbessern. »Aber Fräulein Franks meinte sicherlich das berühmte Hochwasser, das in Venedig nach meinem Wissen alles andere als eine Seltenheit darstellt.«
»Ah, sì. Acqua alta. Ich verstehe, worauf Sie hinauswollen.« Der Archäologe lehnte sich zurück, blickte hinüber zum Bahnhof Santa Lucia, der im gleißenden Sommerlicht regelrecht zu leuchten schien. »Im Winterhalbjahr ist etwa ein Meter keine Seltenheit. Das ist nicht viel, und für unsere Insel spielt es kaum eine Rolle, wenn man die Toten nicht allzu tief vergräbt. Und das würde man als Venezianer sicherlich nicht tun. Im Übrigen hat man das wohl auch nicht, soweit wir bisher durch den Befund wissen. Wie dem auch sei... Dieser eine Meter Wasseranstieg bedeutet für den Markusplatz tatsächlich schon 'Land unter', wie es bei Ihnen heißt. Rund zwanzig Zentimeter immerhin. Mit normalen Gummistiefeln wird es da schon knapp, wenn man nicht wirklich langsam schlurft oder über die Stege läuft. Für den Rest der Altstadt hat so ein kleines Hochwasser jedoch kaum Auswirkungen. Sie können eigentlich überall trockenen Fußes hingelangen, außer am tiefst gelegenen Punkt, dem Markusplatz eben.«
»Dann ist das alles nicht so dramatisch, wie es im Fernsehen aussieht? Ich meine, man bekommt ja wirklich immer nur den Markusplatz gezeigt...«
Soccio hob mahnend die Hand. »Langsam, Signorina. Nur dreißig Zentimeter mehr überfluten bereits die halbe Stadt. Dann stehen Sie auf dem Markusplatz auch nur knietief im Wasser.« Er nahm einen großen Schluck Wasser und räusperte sich leise. »Ungefähr bei eineinhalb Metern ist im Grunde genommen die gesamte Insel betroffen. Venedig steht dann komplett unter Wasser. Aber das kommt nur sehr selten vor, und selbst dann wären unsere Toten wahrscheinlich nicht zur Gänze betroffen.«
Conrad und Franks nickten beinahe synchron.
»Allerdings gab es vor gut zwanzig Jahren einen Rekordstand von fast zwei Metern. Das bedeutet dann auch für die Lazarettinsel die fast völlige Überschwemmung. Doch wie schon gesagt: Das war das höchste gemessene Hochwasser. Meist bewegen wir uns zwischen einem und eineinhalb Metern.«
»Gut, die Toten auf der Pestinsel dürften demnach aus anthropologischer Sicht noch einiges hergeben«, resümierte der Doktorand und winkte nach dem Kellner. »Da bin ich mächtig gespannt.«
03
»So etwas nenne ich ein Loch«, bemerkte Conrad, nachdem er die papierdünne Zimmertür geöffnet hatte.
Der Raum war düster, obwohl es gerade sechzehn Uhr war und die Sonne von einem wolkenlosen Himmel schien (jedenfalls war das so, als sie das 'Hotel' Del Bajazzo betreten hatten), und wirkte deshalb erheblich kleiner, als er tatsächlich war. Das einzige Tageslicht kam von einem schmalen Fenster an der gegenüberliegenden Raumseite, das sich ein gutes Stück oberhalb ihrer Köpfe befand. Die linke Wand wurde von einem monströsen Kleiderschrank im Spanplatte-PVC-Holz-Look eingenommen, der mit seinen abgestoßenen Kantenumleimern dermaßen ramponiert aussah, als hätte man ihn vom Sperrmüll zurückgeholt. Die rechte Hälfte des Zimmers bestand aus einem ebenso heruntergekommenen Doppelbett, das auf einem grau-grün gemusterten Teppich stand, der wahrscheinlich nicht nur wie ein Ungezieferhort aussah. »Das ist ja wirklich ein schäbiges Etablissement«, murmelte er resignierend. »Das Erste, was ich morgen früh mache, ist diesem Soccio–«
»Ekelhaft! So etwas Widerliches habe ich–« Schnaufend flüchtete Franks aus dem winzigen Bad und stapfte eine Sekunde später auf dem Flur Richtung Ausgang. »So ein Saustall!«, hörte Conrad sie schreien. »Ich werde diesem blasiertem Affen an der Rezeption sowas von die Meinung geigen.«
Er beeilte sich, sie einzuholen, und bekam sie auf halber Strecke an der Schulter zu fassen. »Hey, hey, langsam. Lass mich das machen.«
»Wenn du glaubst, dass ich auch nur eine Minute–«
»Komm runter. Ich habe selber nicht die geringste Lust, mich in dieser heruntergekommenen Kaschemme auch nur zu setzen.«
Franks sog lautstark die Luft ein. »Außerdem steht da ein Doppelbett.«
Conrad ging auf diesen Versuch, die Situation aufzulockern, nicht ein. »Du produzierst bitte keinen Eklat, versprich mir das. Wir gehen jetzt nach vorne und bringen unseren Unmut in aller Unaufgeregtheit zum Ausdruck.«
Sie kniff die Augen zusammen und entwand sich seinem Griff.
»Wir sind bestimmt nicht die Ersten, die sich beschweren. Wir wollen dem Typen doch nicht die Genugtuung geben, da vorne einen Affentanz aufzuführen, bei dem er uns seelenruhig abtropfen lassen kann.«
Franks atmete aus und nickte widerwillig, doch sie stand noch immer kurz vor einer Explosion.
Der kleine Mann mit den streng nach hinten gegelten Haaren schien Conrad für einen endlosen Moment überhaupt nicht zur Kenntnis zu nehmen, als der sich vor ihm aufbaute und die Arme auf der niedrigen Theke verschränkte.
»Sie wünsche«, fragte der Italiener schließlich kaum hörbar und ohne den Blick zu heben.
Jetzt spürte auch Conrad, dass es schwer werden würde, die Fassung zu bewahren. »Es gibt da ein kleines Problem mit dem... Zimmer.«
Provozierend langsam sah der Rezeptionist auf und wartete mit desinteressiertem Gesichtsausdruck auf weitere Ausführungen seines Gastes.
Conrad verzichtete auf die offensichtlich überflüssigen Floskeln der Freundlichkeit. »Das Zimmer ist düster, weil es nur ein Kellerfenster gibt. Außerdem ist es völlig abgewrackt und macht einen extrem schmuddeligen Eindruck. Wir hätten deshalb gerne ein anderes Zimmer.«
Franks blickte ihn verständnislos an. »Das Möchtegern-Bad ist ein ekelhaftes Dreckloch«, schleuderte sie dem Italiener entgegen.
»Scusa signora... Ich verstehe nicht–«
»Ich geb' dir gleich–«, legte Franks los, wurde aber durch Conrads erneuten Schultergriff gestoppt.
»Wir haben hier ein schwerwiegendes Problem«, versuchte er es erneut.
»Äh... Problem... Ich verstehe nicht, signore...«, entgegnete der schmierfrisierte Mittfünfziger mit Unschuldsmiene.
Mittlerweile atmete auch Conrad schwer. »Hören Sie...«
»Ich trete dem schmierigen Schlumpf gleich in die Eier«, zischte Lisa. »Das kapiert er garantiert.«
Der Angesprochene wandte sich ihr zu, und sein Blick verriet Franks, dass er jedes Wort verstanden hatte.
Sie drehte sich abrupt um und zog Conrad hinter sich her. »Keine Minute, kein Wort mehr, wir holen unsere Klamotten und gehen«, raunte sie ihm zu.
Anstatt die Klinke zu benutzen, trat sie mit ihrem Bundeswehrstiefel gegen die angelehnte Papptür des Zimmers, was sie zwar öffnete, aber auch—ob beabsichtigt oder nicht, erschloss sich Conrad nicht—in der unteren Hälfte aus der Angel brach.
Er schüttelte den Kopf, konnte sich breites Grinsen aber nicht verkneifen. Als er seinen nagelneuen Rucksack vom Bett genommen hatte und Lisa ihren schulterte, kam der kleine Italiener in bisher ungekannter Gefühlsaufwallung auf sie zugelaufen.
»Sie könne doch nicht, ich bitte Sie...«, rief er wild gestikulierend.
»Beweg dich, und du bist tot«, knurrte Franks dem einen Kopf kleineren Mann zu, während der sich an die Wand des schmalen Flurs drückte, um sie vorbeizulassen.
Conrad begnügte sich damit, dem Rezeptionisten ein Schulterzucken und ein Lächeln zu schenken. »Ah, diese Weiber... Aber das kennen signore bestimmt besser als ich«, setzte er kopfschüttelnd hinzu, ohne sich noch einmal umzudrehen.
***
»Nicht schlecht«, stellte Franks kauend fest.
»Und gar nicht so teuer wie befürchtet«, ergänzte Conrad. »Liegt sicherlich daran, dass die Konkurrenz abends groß ist, wenn die Horden von Tagestouristen schon zurück auf dem Festland sind.«
»Hier gibt es ja anscheinend auch keine vernünftige Übernachtungsmöglichkeit«, murmelte sie in die Stoffserviette, während sie nach ihrem Bier griff.
Er überging das Thema. »Der Soccio hat uns noch überhaupt nichts zur eigentlichen Grabungskampagne erzählt. Keine Ahnung, was die bis dato eigentlich für einen Befund vor Ort haben. Das ist mir nachher erst aufgefallen.«
»Dafür wissen wir jetzt alles über das berühmte Hochwasser und eigentlich auch über die verzwickte Verwaltungsstruktur der Kommune Venedig... nur habe ich da nicht mehr zugehört.« Sie spießte das letzte Stück ihrer Champignonpizza auf die Gabel. »Aber seien wir ehrlich: Wir würden das Ganze auch lieber vor Ort auf der Fläche erklären, als mit Karten und Grabungstagebuch herumzudozieren.«
»Ja, vermutlich hast du recht«, bemerkte Conrad geistesabwesend. »Trotzdem finde ich es irgendwie merkwürdig. Ich habe eben nochmal an den Artikel in der GEO gedacht... Genau genommen wissen wir jetzt nicht mehr als das, was da auch drin stand. Er hat uns überhaupt nichts Interessantes gesagt. Ich meine, der Kerl ist doch schließlich Archäologe...«
Sie lehnte sich zurück und schob den leeren Teller ein wenig von sich. »Möglich, aber ich verstehe immer noch nicht, worauf du hinaus willst.«
Conrad schüttelte den Kopf. »Egal, vielleicht geht mir bloß der Tag ein bisschen auf die Nerven.« Er nahm die Speisekarte zur Hand. »Ich hatte eben erwartet, dass der Professor darauf brennen würde, uns von seiner Grabung vorzuschwärmen. Stattdessen ist er ungewöhnlich... sparsam mit Informationen.«
Sie winkte ab. »Quatsch, du bastelst dir da eine Verschwörung zusammen.«
»Klar, ist ja auch genau meine Domäne«, murmelte Conrad kaum hörbar. »Ich brauche jetzt noch ein Eis zum Nachtisch«, verkündete er, klappte die Karte zu und sah sich nach einer Bedienung um.
»Für mich ein Banana Split«, stimmte sie ein. »Wie gut, dass meine Mutter so schnell etwas angewiesen hat.«
Er verzog verlegen den Mund. »Ja, schauen wir mal, was der Tag morgen bringt. Wahrscheinlich will der gute Mann tatsächlich nicht alles zweimal erklären und wartet, bis wir die Fläche gesehen haben.«
»Apropos morgen«, hakte sie ein, während er nach dem Kellner winkte. »Wir können ja kaum in unsere Unterkunft zurück, selbst wenn wir wöllten... Was ich aber auf gar keinen Fall will.«
Ein Schreck durchfuhr ihn, und er glaubte, dass Lisa das bemerkte.
»Wir können wohl ebenso wenig unter einer Brücke pennen«, legte sie nach, »auch wenn Hochsommer ist und wir uns kürzlich mit Schlafsäcken und ziemlich teurem Campingequipment ausgerüstet haben.«
»Das Mount-Everest-taugliche Tonnenzelt nicht zu vergessen«, ergänzte er mit säuerlicher Miene. »Was schlägst du vor?«
Sie verdrehte die Augen und wandte sich dann in zuckersüßem Tonfall dem Kellner zu, dessen Namen sie bereits bei der zweiten Getränkebestellung recherchiert hatte: »Ah, Giovanni... abbiamo bisogno... di una stanza... prego.«
Der junge Mann beugte sich leicht zu ihr und setzte ein Lächeln auf, das Conrad zu Hause in Berlin wohl als Anzüglichkeit eingeordnet hätte. Derweil Giovanni wortreich und gestikulierend (soweit die Teller auf seinem linken Arm es zuließen) auf Lisas Anliegen zu antworten wusste, nahm ihr Gesicht zum ersten Mal an diesem Tag wirklich entspannte Züge an. Sie bedankte sich lächelnd, und er deutete eine Verbeugung an, bevor er sich dem Gast am übernächsten Tisch zuwandte, der bereits etwas fordernder nach dem Kellner verlangte.
»Und?«, fragte Conrad genervt, als Franks keine Anstalten machte, eine Erfolgsmeldung abzusetzen.
»Geht klar. Der älteste Bruder betreibt eine kleine Pension. Er kündigt uns an, damit wir reinkommen«, verkündete sie lapidar.
»Dazu braucht der fünf Minuten? Und dieses Etablissement heißt vielleicht 'Bella donna' oder ist es das 'In Cannelloni'? Jedenfalls ist das das einzige, was ich verstanden habe.« Er klang bissiger, als er wollte.
»Incantevole«, entgegnete Lisa milde lächelnd. »Ach, du hast wirklich keine Ahnung, wie man mit... Italienern sprechen muss.«
Angesichts ihres Auftrittes am Nachmittag war er tatsächlich einen Moment lang sprachlos. »Ah, Giovanni, una birra per favore, pronto!«, rief er Lisas neuem Freund quer durch das Restaurant zu.
04
»Commissario!«
Bruno Mancini machte eine Handbewegung, als wolle er einen Schwarm Mücken verscheuchen, und setzte seinen langsamen Gang den Steg entlang mit nach unten gerichtetem Blick fort. »Warte einfach ab, Toto. Der Commissario macht das immer so. Das ist seine Art, sich einen unbeeinflussten Ersteindruck zu verschaffen, und er hat mit dieser Methode eine Aufklärungsquote...«, vernahm er Salvatore Ingrossatos unnötiges Geplapper im Hintergrund. Gut, dann musste er den Neuen wenigstens nicht mehr selbst einnorden. Salvo gab dem jungen Polizisten weitere Hinweise zum Umgang mit ihm, während Mancini sich bemühte, seine Konzentration wieder dem Wesentlichen zuzuwenden.
Eines war ihm nach den wenigen Minuten seiner auch heute noch den meisten Kollegen merkwürdig erscheinenden Herangehensweise (er nannte das Tatortbegehung, auch wenn—wie es hier der Fall war—das Tatgeschehen an einem ganz anderen, bisher unbekannten Ort stattgefunden hatte), schon klar geworden: Das hier war keines der Delikte, mit denen sie sich sonst abgeben mussten. Kein aus dem Ruder gelaufenes Drogending, wie es in den letzten Jahren vor allem im Sommer immer häufiger vorkam, und auch kein Raubüberfall, jedenfalls kein offensichtlicher. Aber der Tote sah eindeutig nach Tourist aus, kein Einheimischer; ziemlich sicher noch nicht einmal Italiener. Auch einen Auftragsmord schloss Mancini nach wenigen Blicken auf den Leichnam aus. Es gab überhaupt keine äußeren Verletzungen, nichts, was auf einen gewaltsamen Tod des Mannes hindeutete. Trotzdem war dieser Grünschnabel von der örtlichen Polizei geistesgegenwärtig genug gewesen, die Polizia di Stato—und damit ihn—zu benachrichtigen. Und der schlaksige junge Mann hatte damit goldrichtig gelegen.
Mancini konnte es bisher nicht greifen, es war nichts weiter als ein Gefühl, eine Ahnung. Doch hier handelte es sich um einen Mord, das stand für ihn fest. Der Kerl war nicht einfach betrunken oder vollgedröhnt von einer Brücke in den Kanal gefallen. Was ist es, das nicht zusammenpasst? Er hob den Blick und schaute für eine Sekunde hinüber zur neuen Pescaria, drehte sich um und schlenderte zu Ingrossato zurück. »Salvo, wer hat ihn aus dem Wasser gezogen?«
»Der Kollege selbst. Agente Righera.« Ingrossato deutete auf den jungen Polizisten, der sie informiert hatte, und überließ ihm den Bericht.
»Um einundzwanzig Uhr fünfundzwanzig ging bei uns auf dem Revier der Anruf des Zeugen Zarelli ein. Ein offensichtlich toter Mann treibe zwischen den Pfählen am Palazzo Michiel. Als wir zehn Minuten später eintrafen, bin ich mit Dottoressa Galvini hinüber gerudert. Aber wir konnten für den leblosen Mann nichts mehr–«
»Sie haben ihn hier so abgelegt?«, unterbrach ihn Mancini.
»Ja, ich... wir haben ihn auf den Steg gelegt, und die Dottoressa hat versucht, ihn wiederzubeleben, konnte aber nur seinen Tod feststellen.«
»Hm, in Ordnung.« Der Commissario lockerte den scheuernden Kragen. Der verdammte Mückenstich im Nacken würde ihn noch wahnsinnig machen. »Äh, ja. Wo ist die Notärztin jetzt?«
»Dottoressa, der Commissario möchte kurz mit Ihnen reden«, rief Ingrossato einer auffallend kleinen Blondine zu, die mit dem Packen ihres klobigen Lederkoffers beschäftigt war.
»Agente... Toto, richtig? Sie können zurück aufs Revier. Lassen Sie Salvo bitte Ihre Privatnummer da. Vielleicht fällt mir nachher noch etwas auf, und ich muss Sie möglicherweise heute Nacht noch belästigen.«
Der Angesprochene protestierte nicht, sondern nickte mit einem Lächeln und entfernte sich wortlos.
»Ah, Dottoressa...«
»Galvini, Claudia Galvini. Agente Righera hat mich benachrichtigt, weil er wusste, dass ich heute Abend Bereitschaft habe. Falls Sie sich fragen–«
»Schon gut.« Natürlich dachte er sich seinen Teil, doch jetzt war nicht der Zeitpunkt, die junge Frau in Verlegenheit zu bringen. »Was können Sie mir zur Todesursache sagen? Völlig aus dem Bauch heraus, ich brauche im Augenblick keine fachlich abgesicherte Meinung«, fügte er hinzu, als er das Unbehagen in ihrem Blick bemerkte. »Einfach nur den ersten Eindruck. Was ging Ihnen spontan durch den Kopf?«
»Dass er nicht so aussieht, als sei er ins Wasser gefallen und ertrunken.«
»Danke, Dottoressa. Ich denke, alles Weitere wird die gerichtsmedizinische Untersuchung zeigen.«
»Das ist nicht... Ich habe jedenfalls keine–«
»Alles in Ordnung«, unterbrach Mancini, um ihr den Rechtfertigungsversuch zu ersparen. »Ich wollte tatsächlich nur wissen, was ihr professionelles Bauchgefühl im ersten Moment meinte.« Er kratzte seinen juckenden Hals. »Machen Sie sich nichts daraus. Fast alle Kollegen halten mich für einen schrägen Kauz, zumindest was meine Arbeit angeht. Ich denke, ich kann Sie notfalls über Agente Righera erreichen, falls mir noch etwas fehlt.« Er konnte sich diese kleine Unverschämtheit nicht verkneifen. Einen Moment verspürte er so etwas wie Neid auf den jungen Polizisten, obwohl er Righera nicht unsympathisch fand.
»Gut, wenn das alles ist, Commissario... Agente Righera weiß natürlich, wo er mich heute Nacht findet«, parierte sie seine Anzüglichkeit und lächelte.
»Ein... auffälliges Pärchen«, bemerkte Ingrossato leise, nachdem die Ärztin auf dem Ramo Dragan, der geradlinig vom Anlegesteg wegführte, außer Sichtweite war.
»Ja, er ist bestimmt drei Köpfe größer«, murmelte Mancini und verkniff sich weitere Anspielungen. »Nun, wir werden sehen, ob ich Recht habe. Ich glaube, hier hat jemand einen Toten entsorgt. Auf merkwürdige Weise...«
05
»Das da vorne hat er wohl gemeint.« Franks beschleunigte ihren Schritt bei der Aussicht auf einen ordentlichen Morgenkaffee.
Conrad folgte ihr gähnend. Die Pension von Kellner Giovannis Bruder war eine regelrechte Offenbarung gegen die dunkle Wanzenbude, in der Soccio sie hatte unterbringen wollen. Darüber würde er mit dem Grabungsleiter noch reden müssen. Wenn sie beide hier bleiben sollten, und daran hatte er keinen Zweifel, dann würde der Professor die umgerechnet zwanzig Mark mehr pro Übernachtung schlucken müssen. Eigentlich sollte das kein Thema sein, schließlich fand man einen guten Anthropologen nicht an jeder Ecke. Lisa hatte zwar vorgeschlagen, dass ihre Mutter den Mehraufwand zahlen könnte (so glücklich war sie über ihre neue Unterkunft), aber Conrad sah das nicht ein und hatte vehement widersprochen. Er hatte schon jetzt ein schlechtes Gewissen. Dabei war ihm vollkommen klar, dass er das Angebot doch annehmen würde, wenn Soccio sich verweigern sollte, denn zurück nach Deutschland wollten sie momentan unter keinen Umständen. Aber so weit waren sie noch nicht.
Er fragte sich, wieso er dazu neigte, sich ständig Dinge auszumalen, die noch gar nicht zur Debatte standen. Er war doch beileibe kein Pessimist und Schwarzseher... Sie hatten gut geschlafen (und Lisa hatte erstaunlich wenig über den Umstand gemeckert, dass auch in diesem Zimmer nur ein Doppelbett stand), am Morgen festgestellt, dass es eine fast durchgängige Fensterfront mit einem winzigen Balkon gab, und sie hatten ein sauberes Bad mit heißem Duschwasser vorgefunden. Sogar große Badetücher, die diesen Namen verdienten, hatten bereit gelegen.
»Alles gut«, murmelte er, als er nach der Tür griff, die Lisa für ihn aufhielt. Immer noch gähnend blickte er sich kurz in dem Bistro um und steuerte dann auf eine gemütliche Bank am Fenster zu. Augenblicklich wurde er am Ärmel seiner Windjacke unsanft zurückgezogen.
»An die Bar«, belehrte Franks ihn. »Immer an die Bar und im Stehen konsumieren. Sobald du dich hinsetzt, ist es mit Bedienung, Gedeck und Lametta und kostet mindestens das Doppelte. An der Bar bestellen und dann irgendwo hinsetzen geht auch nicht, falls dir das eingefallen wäre.«
Conrad zuckte mit den Schultern und kam zu den Schluss, dass er nicht gewillt war, die abendliche Pizza (darauf würde es bei ihnen fast immer hinauslaufen) im Stehen einzunehmen. Morgenkaffe und etwas Gebäck, das würde schon gehen.
Franks wünschte dem Barmann einen guten Morgen, orderte zwei Milchkaffee und jeweils ein süßes Brötchen und ein Croissant. Der Schmierlappen hinter dem Tresen grinste breit—es gab keinen Zweifel, dass auch er jedes Wort von Lisas Belehrung davor verstanden hatte—und erkundigte sich bei Lisa nach ihrem Schlaf und der Unterbringung... Jedenfalls schloss Conrad das aus den wenigen Fetzen, die er aufschnappte.
Er verspeiste seine beiden Gebäckstücke und war dankbar, dass seine Begleiterin ihm kein Gespräch aufzwang, bevor er einen zweiten Kaffee zu sich genommen hatte. Er schüttelte heftig den Kopf, was der Barmann mit einem weiteren Grinsen quittierte, während Lisa ihn überhaupt nicht beachtete. Nein, komm runter. Es besteht nicht der geringste Grund für schlechte Laune, schalt er sich. Soccio war einfach nur ein Geheimniskrämer und kauzig, das sollte ihn nicht wundern. Wahrscheinlich würde er selbst sein Pulver auch nicht verschießen, bevor er den Grabungsbefund in realita präsentieren konnte. Fakt war: Sie hatten eine interessante Grabung in spannender Umgebung aufgetan, das Wetter war schön, ohne heiß zu sein... und sie hatten, dank Lisa, keine Geldsorgen. Sobald er wieder Zugang zu seinem kläglichen Doktorandensalär hatte, würde er ihre Mehrausgaben zurückzahlen, also auch kein Grund für ein schlechtes Gewissen.
»Wir sollten langsam los«, unterbrach sie seine Grübelei. »Als Erstes müssen wir uns Vaporettotickets besorgen, am besten Wochenkarten oder gleich für den ganzen Monat. Das ist erheblich billiger.«
Er nickte und kramte nach seinem Portemonnaie.
Sie schob seine Hand zurück. »Ist schon bezahlt.«
»Gut, danke«, murmelte Conrad. Er hatte das überhaupt nicht mitbekommen. Eigentlich sollte er wacher sein. Auf der Grabung würde er seine Sinne zusammennehmen müssen, denn er wollte auf gar keinen Fall, dass Soccio den Eindruck bekam, für ihn alles dreimal erklären zu müssen.
»Ciao, Luca«, rief Lisa, als sie auf die kleine Piazza hinaustraten.
Den kannte sie also auch schon. Noch etwas, das er in seinem Dämmerzustand nicht mitbekommen hatte...
***
Schon wenige Minuten, nachdem sie den Anlegesteg nahe der Rialtobrücke betreten hatten, kam ein Boot, das ihr Umsteigeziel am Markusplatz ansteuerte. Erst als Conrad realisierte, dass neben den offensichtlichen Urlaubern der größte Teil der Mitfahrer aus Italienern in Alltagskleidung und ohne jegliches Gepäck bestand, wurde ihm bewusst, dass das Vaporetto für die Venezianer nichts anderes war als ein Omnibus. Dass man leicht schwankend auf dem Wasser unterwegs war, musste man sich wegdenken. Das hier war für die Einheimischen wahrscheinlich selbstverständlicher als der Linienbus aufs Festland, für Conrad hingegen hatte es noch einen winzigen Teil Abenteuer, und er genoss den Wind und sogar den Geruch des Großen Kanals, der hier draußen auf dem Wasser überraschenderweise weniger intensiv erschien als am Uferweg.
Wie tief mochte der Canal Grande sein? Er wusste, dass Schiffe und Boote mit möglichst wenig Tiefgang gebaut wurden. Die Kähne der Müllabfuhr, die (wie er von Lisa erfahren hatte) jeden Morgen auch durch die schmäleren Kanäle fuhren, lagen sogar voll beladen deutlich weniger als einen Meter tief im Wasser, so schätzte er. Er fand die Vorstellung faszinierend, dass man die stellenweise über fünfzig Meter breite Wasserstraße womöglich zu Fuß durchqueren konnte und dabei den Kopf über der Wasserfläche behielt. Man würde nicht ertrinken, dafür würde einem eines der hundert Boote, denen man auf diesem Weg begegnete, den Kopf abfahren. Aber wahrscheinlich war das Unsinn; er würde Soccio fragen. So hatte er wenigstens ein Gesprächsthema, wenn der Archäologe schon keine Lust hatte, über seine Fundstelle zu reden...
»Alles in Ordnung?«, erkundigte sich Franks, ohne tatsächlich eine Antwort zu erwarten. »Schau, da drüben ist das Guggenheim.«
»Aha«, war das Einzige, was ihm einfiel. Manche Gebäude sahen ganz interessant aus, aber die meisten waren in der ständigen Wiederholung mit ihren immer gleichen Farben und Formen irgendwie... langweilig. Wahrscheinlich würde Lisa ihn für diese Gedanken zusammenstauchen, doch schon auf dieser einen Fahrt sah er zu viele Paläste und Prachtvillen, als dass er noch überrascht sein konnte. Venedig war in der Tat eine andere Welt, eine Art grandios vergammeltes Disneyland mit echten Hotels, Betrieben, Bewohnern und Schicksalen. Was komplett fehlte waren die Dinge, mit denen man 'draußen' in anderen Städten ganz selbstverständlich konfrontiert war: Hochhäuser, Straßenbahnen, Kaufhäuser und Autos. Das war vermutlich das Beeindruckendste: Wochenlang (Monate würden sie wohl nicht hier verbringen) ohne LKWs, Busse, Autos und Fahrräder zu leben—und ohne Ampeln. Er schmunzelte.
»Da hinten auf der linken Seite sieht man schon den Dogenpalast«, erklärte seine Kommilitonin. »Dort müssen wir umsteigen.«
Während sie sich durch die beachtlich dichte Menschenansammlung zum Ausstieg vorarbeiteten, versuchte Conrad vergeblich, einen Blick auf den Markusplatz zu bekommen, erkannte aber zumindest den fast hundert Meter hohen Markusturm.
»Das ist der Campanile«, bemerkte Franks. »Sollte ursprünglich wohl als Leuchtturm dienen. Gucken wir uns alles in den nächsten Tagen an.«
»Ja, natürlich.« Es hatte sowieso keinen Zweck zu widersprechen. Zumal schon wieder sein schlechtes Gewissen rumorte, weil Lisa ihn komplett aushielt.
***
An der Station San Marco-San Zaccaria hatten sie die Anlegestelle gewechselt, weil die Linie Richtung Lido vom anderen Ponton abfuhr. Seit einigen Minuten ging die Fahrt nun über das offene Wasser der Lagune. Hier begegneten ihnen auch schon größere Schiffe, und der Wellengang war merklich. Conrad gefiel das, während Lisa eine eher verkniffene Miene zeigte und auffallend schweigsam war. Dass die Station der ersten Insel, an der das Vaporetto haltmachte, San Sèrvolo hieß, bekam er dieses Mal nicht vorgetragen.
Wenige hundert Meter weiter legte ihr Boot an San Lazzaro an und nahm dann—immer noch recht gut besetzt—Kurs auf den Kanal, der zur Endstation auf der Strandinsel führte. Als sie die Mündung passierten, waren sie vermutlich kaum zweihundert Meter von der Insel der Verdammten entfernt. Für Conrad wirkte sie wie eine mächtige rote Ziegelwand, die jemand mitten in die Lagune von Venedig gebaut hatte. Wo soll man denn da graben?, ging es ihm durch den Kopf. Ein paar Minuten später machte das Vaporetto fest, und alle Passagiere gingen an Land.
Von der Anlegestelle aus folgten sie, wie Soccio ihnen aufgetragen hatte, dem schmalen Kanal, bis sie das direkt am Strand liegende Excelsior erblickten. Gegenüber von dem Luxushotel befand sich eine Art Mini-Marina für vielleicht ein Dutzend Boote. Wahrscheinlich gehört das zum Service für die Yachtbesitzer, dachte Conrad.
»Da drüben winkt einer. Ich vermute mal, dass das unser Grabungsleiter ist«, verkündete Franks und eilte auf den Mann zu.
»Vermutlich, die Figur passt ja«, brummte der Anthropologe in Gedanken an die bevorstehende Kommunikation und versuchte vergeblich, seine abhandengekommenen Brille zurechtzurücken. Kopfschüttelnd beeilte er sich, mit seiner Kommilitonin Schritt zu halten.
»Ich bin überaus glücklich, dass Sie es pünktlich einrichten konnten! Guten Morgen.«
Wir sind Deutsche. Conrad stoppte erfolgreich die Weiterleitung dieses Gedankens an seine Stimmbänder. »Guten Morgen. Ja, der Berufsverkehr mit dem Vaporetto funktioniert reibungsloser, als ich gedacht hätte.«
»Auf dem Wasser gibt es selten Stau. Das macht es erheblich einfacher«, dröhnte Soccios tiefe Stimme. »Für gewöhnlich haben meine Landsleute dennoch ein leicht anderes Verhältnis zur Pünktlichkeit, auch wenn diese Einstellung hier im Norden nicht so ausgeprägt ist... Mich jedenfalls nennt die Familie meiner Frau 'il tedesco'», fügte er mit einem donnernden Lachen hinzu.
Der massige Italiener erinnerte Conrad mit einem Mal an Bud Spencer, obwohl er den Schauspieler für noch etwas korpulenter hielt; aber das war schwer zu sagen, wenn man nur Kinofilme als Maßstab hatte... Könnte doch sein, dachte er feixend. Immerhin hatte auch der Schauspieler einen Doktortitel und sprach gut Deutsch, soweit er wusste. Ich werde mit Bud Spencer graben.
»Was ist so lustig? Lass mich mitlachen«, forderte Franks, während Soccio die Leine am Bug eines unauffälligen, kleinen Motorboots von der Klampe löste.
Conrad entschied sich im letzten Moment für eine unverfängliche Antwort, um sich einen neuen Spitznamen zu ersparen. »Ach, ich fand seine Analyse der italienischen Pünktlichkeit nur amüsant...«
Ihr Blick verriet, dass sie kein Wort glaubte.
Wenige Minuten später hatten sie den schmalen Kanals von der Hotel-Marina zurück in die Lagune hinter sich gelassen und sahen gut hundert Meter vom Strand des Lido entfernt eine seltsame rote Baustruktur über der Wasserlinie aufragen. »Sieht aus wie eine halb versunkene Burg«, bemerkte Franks.
»Architektonisch liegen Sie nicht so verkehrt, Lisa. Die Mauer diente aber dazu, die armen Seelen drinnen zu halten... Dabei dürften die meisten Insassen kaum zu einem Fluchtversuch in der Lage gewesen sein.«
Sie hatten sich dem Eiland auf vielleicht zwanzig Meter genähert und passierten jetzt die südöstliche Ecke des riesigen Ziegelbaus. Soccio steuerte nicht auf die Anlegestelle im Osten zu, die augenscheinlich nicht mehr als ein Loch in der Wand war; stattdessen nahm er Kurs auf einen hölzernen Steg, der sich an einem kleinen, durch einen schmalen Kanal von der eigentlichen Lazarettinsel getrennten, Stück Land am südwestlichen Ende befand.
»Das ist der ehemalige Hauptzugang«, erklärte der Archäologe. »Den näher am Lido liegenden Zugang auf der Ostseite hat man aus logistischen Gründen angelegt. Es ist einfacher, Waren und Ausrüstung dort direkt in die Gebäude zu bringen, als sie von hier aus über die teils unwegsame Insel zu schleppen. Und jetzt, wo wir den Boden an mehreren Stellen abtragen, wird es noch mühsamer.« Soccio stellte den winzigen Außenborder ab, brachte das Boot routiniert längsseits und bereitete sich aufs Festmachen vor. »Deshalb halten wir den Lieferanteneingang auch für Transporte frei.« Er angelte nach einer Leine, die vom Steg hing, und legte sie über eine Klampe am Heck. Dann wiederholte er den Handgriff am Bug und zog ihre Fähre nah genug heran, dass der Landgang möglich wurde. »Außerdem bekommen Sie auf diesem Weg einen authentischeren Eindruck und sehen gleichzeitig mehr von der 'isole del dolore', wie die meisten Venezianer das alte Lazzaretto nennen.«
06
Noch war nichts entschieden. Der Tropfen wuchs zu erstaunlicher Größe und schien sich förmlich an dem dünnen Glasröhrchen festzuklammern. Vorsichtig drückte er etwas fester auf den kleinen Gummibalg und hielt unwillkürlich die Luft an. Was würde passieren, wenn die beiden zusammenkamen? War er dem Durchbruch so nahe, wie er hoffte? Oder würde die Vereinigung alles zunichtemachen—wie es schon hunderte, nein tausende Male vorher passiert war? Schließlich reichte die Oberflächenspannung nicht mehr aus, und die klare Flüssigkeit löste sich von der Pipette. Er hatte immer noch keinen Atemzug getan. Der Fall aus kaum zehn Zentimetern Höhe schien eine Ewigkeit zu dauern, ganz so, als habe dieses Experiment die Schwerkraft außer Funktion gesetzt. Wie in Zeitlupe traf der Tropfen auf die gelbliche Substanz in der von der Kühlschrankkälte immer noch beschlagenen Petrischale. Er beobachtete, wie kleinste Spritzer beim Aufprall der Testflüssigkeit hochsprangen und in einem Umkreis von vielleicht einem Zentimeter in die Glasschale zurückfielen. Die Oberfläche beruhigte sich rasch. Es passierte nichts—exakt so, wie er es sich gewünscht hatte. Erleichtert atmete er aus und genoss die Stille. Hatte er das Ziel erreicht? Blieb die Substanz nach unzähligen Versuchen und Enttäuschungen nun endlich stabil? Euphorie wollte sich in ihm ausbreiten, doch er zwang sich, diese Regung zu unterdrücken. Noch ein paar Sekunden—zur Sicherheit. Zu oft war er im letzten Moment enttäuscht worden, seine Nerven lagen sowieso schon blank.
Ein leises Zischen, zunächst kaum hörbar, störte die göttliche Stille. Wieder atmete er tief ein und hielt die Luft an. Dieses Mal jedoch, um die aufkommende Wut im Zaum zu halten. Unter das Zischen mischte sich eine Art Brodeln, ein gedämpftes Blubbern. Er wusste, was das bedeutete: Er war wieder gescheitert.
Während das Zischeln langsam nachließ, veränderte sich die Farbe der zähen Flüssigkeit von einem transparenten Gelbton in eine dünne milchige Plörre. Allmählich wurde es wieder vollkommen still, und auch das leichte Blubbern ebbte vollkommen ab.
Er krallte seine Hände um die Tischkante, um nicht die Kontrolle zu verlieren, denn wenn er jetzt etwas Unüberlegtes täte, wäre es unweigerlich sein Ende—ein unglaublich qualvolles Ende. Das durfte nicht sein, er hatte noch viel zu tun. Mit einem Geräusch, das wesentlich lauter war als das, das seinen erneuten Misserfolg verkündet hatte, entließ er die verbrauchte Luft aus seinen Lungen und löste seinen Griff. Doch es war zu früh. Um die Spannung abzubauen, ließ ihn sein aufgewühltes Unterbewusstsein nach dem Erlenmeyerkolben direkt neben dem Versuchsaufbau greifen und das Gefäß gegen die Wand hinter ihm schleudern. Das laute Klirren brachte in die Realität zurück. Er hatte in seiner Rage das Chlorform erwischt. Lautlos fluchte er über seine Unbeherrschtheit. Verdammter Mist! Bei Raumtemperatur und ohne Sonnenlicht bestand keine große Gefahr, dass sich die klare Flüssigkeit in Gas verwandelte. Viel schlimmer war, dass es einiger Anstrengung bedurft hatte, um das Zeug in die Hände zu bekommen—und zwar ohne, dass er sich ausweisen oder irgendwelche Quittungen abzeichnen musste.
Verflucht! Noch nie hatte er derart die Beherrschung verloren. Und noch nie war er so nah am ersehnten Erfolg vorbeigeschliddert. Doch er musste sich mäßigen. Das Zeitfenster war knapp bemessen. Wer konnte schon vorhersagen, wann wieder ein solcher Fund, ein Jahrhundertschatz geborgen werden würde? In den nächsten ein oder zwei Tagen musste er eine Lösung finden, die Substanz zu stabilisieren, sonst würde er womöglich Jahre auf eine neue Möglichkeit warten müssen. Das war schon einmal passiert. Doch daran wollte er jetzt nicht denken. Er hatte dazugelernt, es musste einfach funktionieren...
07
Soccio hatte versprochen, ihnen in Kürze eine Einweisung auf die Insel und seine Grabung zu geben, sich dann jedoch entschuldigt: »Ich muss erst noch etwas erledigen. Macht euch doch schon mit den anderen bekannt. Einfach geradeaus, da hinten, wo die Tür offensteht.«
Franks zuckte mit den Schultern und marschierte über den grasbewachsenen Innenhof. Conrad, der solchen Situationen mit weit weniger Gleichmut begegnete, folgte mit einigen Sekunden Abstand. Seine Bedenken zerstreuten sich glücklicherweise, sobald sie das improvisierte Grabungshaus betraten.
»Hallo, ich bin Andrea«, begrüßte sie ein sportlich aussehender Mann um die vierzig auf Englisch und bot ihnen einen Platz an einem großen, offensichtlich von der Grabungsmannschaft gezimmerten Holztisch an. »Ich bin einer der beiden Hobbyarchäologen. Ein Seniorenstudent, der noch einmal ein Abenteuer erleben möchte, bevor die morsch werdenden Knochen versagen.«
»Hört nicht auf den«, schaltete sich eine zierliche junge Frau mit raspelkurzen dunklen Haaren ein, bevor Conrad und Franks Andrea di Botellis Begrüßung überhaupt erwidern konnten. »Andrea hat in den letzten Jahren mehr mittelalterliche Kampagnen mitgemacht als wir anderen zusammen.«
Botelli kommentierte das mit einem Lächeln, das in Conrads Augen einen Hauch Überheblichkeit enthielt.
Gott sei Dank läuft hier alles auf Englisch, registrierte der Anthropologe erleichtert. »Ganz im Gegensatz zu uns. Wir haben noch keine einzige Mittelaltergrabung mitgemacht... wenn ich mich nicht irre.«
»Wenn man die Geschichte in London nicht dazu zählt«, ergänzte Franks leise auf Deutsch.
»Äh, ja«, überging er ihre Bemerkung. »Auf jeden Fall freuen wir uns, endlich hier zu sein. Was steht denn auf dem Programm?«
»Wir frühstücken gerade.« Die Studentin in militärischem Grünzeug—das sicherlich Lisas Gefallen fand—machte eine einladende Geste. »Ich bin Alexandra Panetta, alle hier nennen mich Lexi. Ich studiere Mediävistik in Padua bei Professore Soccio; den habt ihr ja schon kennengelernt.«
Der älteste Student am Tisch gab sich wesentlich fokussierter: »Wir hoffen, noch vor der Mittagspause die ersten Knochen auf der Fläche einmessen zu können.«
Conrad hörte nur mit einem Ohr zu und nickte bedächtig. Beim Anblick der beiden großen Thermoskannen und der prall gefüllten Brottüten wurde ihm klar, dass das kleine Weckchen und das Croissant schon seit einer Weile nicht mehr vorhielten. »Klasse, das ist jetzt genau das Richtige«, bedankte er sich und griff nach einem der auf der Öffnung stehenden Keramikbecher, füllte ihn mit dampfendem Kaffee und rührte ein Päckchen Milchweißer ein.
»Wir haben genug für alle.« Lexi schob ihnen zwei der Papiertüten zu. »Wir frühstücken hier morgens zusammen. Dabei kann man die Tagesplanung wunderbar erledigen. Jeden Morgen ist jemand anders mit der Besorgung dran, das spielt sich schnell ein«, ergänzte die Studentin, als sie Franks' fragenden Blick bemerkte.
Während Conrad zufrieden in die Tüte mit den süßen Brötchen griff und mit den beiden älteren Studenten einen Small Talk begann, zog Franks eine auf grünlichem Papier gedruckte Tageszeitung zu sich hinüber. »Ich darf doch«, murmelte sie leise, ohne den Blick zu heben. »Mal schauen, wie viel Italienisch hängen geblieben ist.«
***
Nach der Lektüre eines Leitartikels, der sich über einen offenbar ertrunkenen Touristen ausließ, konstatierte Franks, dass es mit ihrem Sprachverständnis besser bestellt war, als sie angenommen hatte. Sie blätterte zum Sportteil und stellte mit Verwunderung fest, dass sie hier vornehmlich die Bundesligaergebnisse vom letzten Wochenende fand. Bevor Lisa jedoch etwas Lesenswerteres gefunden hatte, gesellte sich der Professor zur Frühstücksgruppe, der zuvor auch der von Botelli erwähnte zweite Seniorenstudent beigetreten war. Der Mann machte—obwohl leicht übergewichtig—durchaus einen sportlichen Eindruck und wies die dunkle, wettergegerbte Haut eines Seemannes auf. Im Kontrast zu Andrea di Botelli schien er tatsächlich im Rentenalter zu sein. Er studierte, wie alle Anwesenden außer Conrad und Franks, Geschichte an der Universität in Padua und hieß Lorenzo Portobello; Lisa ließ die Vorstellung schmunzeln, dass vielleicht er (oder seine Familie) hinter den in Deutschland vor einigen Jahren schwer angesagten und nebenbei überteuerten Spießerstrickjäckchen steckte. Die Runde der sieben wurde durch eine Freundin von Lexi vervollständigt, die sich mit Gina Sandrelli eingeführt hatte und ebenfalls Mediävistik an Italiens drittältester Universität studierte. In gewisser Weise war sie der Gegenentwurf zu Panetta; die Haare waren blond und lang, ihre Figur eher unsportlich. Auch schien sie sich weitaus mehr für Kosmetik zu interessieren als ihre Freundin (wobei Lisa keineswegs entgangen war, dass auch Lexi einen Kajalstift sehr wohl benutzen konnte). Kurz und gut, die beiden kamen sich wahrscheinlich nie ins Gehege—die wichtigste Voraussetzung für eine beständige Freundschaft.
»Das Lazzaretto Vecchio bot sich zur Isolation von Kranken an«, holte Soccio sie aus ihren Gedanken. »Bereits im vierzehnten Jahrhundert entschloss man sich für diese, wie ich meine, sehr moderne Vorgehensweise. Natürlich hatte man in dieser Zeit keine Ahnung von Bakterien, schon gar nicht von Viren. Möglichkeiten zur Heilung waren so gut wie nicht vorhanden. Trotzdem war den Venezianern selbstverständlich klar, dass man die Kranken von den Gesunden fernhalten musste. Zudem zeigte die Beobachtung, dass die Seuche sich umso schneller ausbreitete, je enger die Menschen aufeinander hockten. Dass eine hohe Bevölkerungsdichte nicht die einzige Ursache für eine rasante Ausbreitung ist, ist uns heute bekannt, doch vor über fünfhundert Jahren zeigte diese Beobachtung den augenfälligsten Zusammenhang.« Der Archäologe füllte seinen Kaffee nach und rührte eine Unmenge Zucker hinein, während er fortfuhr: »Nun ist ja einleuchtend, dass man an den begrenzten Platzverhältnissen und der Einwohnerzahl auf die Schnelle nichts ändern konnte. Und ein Ausweichen auf das Umland war genauso wenig eine Option wie Abschottung. Die naheliegende Lösung war also auf den zahlreichen kleinen Inseln der Lagune zu suchen.« Soccio nippte an seinem Becher und verzog ein wenig das Gesicht. »Bah, ich bekomme noch mal Diabetes... Gut, jedenfalls spielte sich schnell ein System ein, welches darauf basierte, dass man auf einer nördlicheren, nahe an der Hauptinsel und Murano liegenden Insel—eigentlich eher eine trockene Erhöhung in einer von Brackwasserkanälen beherrschten Marschlandschaft—eine Quarantäneeinrichtung etablierte. Hier wurden die Verdachtsfälle, meist See- beziehungsweise Kaufleute besonders aus Arabien oder Asien, zwangsweise in kleinen Unterkünften untergebracht, während die Ladung ihrer Handelsschiffe in einem großen Lagerhaus gestapelt wurde. Die Waren wurden in dieser Zeit mit allen erdenklichen Methoden behandelt, von denen man glaubte, dass sie desinfizierend wirkten. Das ging vom einfachen Waschen bis zum Ausräuchern und der Behandlung mit diversen Substanzen, beispielsweise Essig. Dieses fast quadratische Eiland ist als Lazzaretto Nuovo bekannt. Erkrankte ein Insasse in der Quarantäneunterkunft, wurde er sofort hierher auf die alte Lazarettinsel gebracht. Sein Schicksal war damit in der Regel besiegelt, kaum jemand verließ das Lazzaretto Vecchio lebend. Schnell war die Insel als 'isole del dolore', Insel des Schmerzes, oder als Insel der Verdammten bekannt. Heutzutage wird sie meist schlicht als Pestinsel bezeichnet.«
08
Mancini nippte an dem hauchdünnen Plastikbecher. Die Brühe kochte beinahe noch, und er befürchtete, der weicher werdende Rand könnte jeden Moment einknicken und ihm die Lippe verbrennen, noch bevor seine Eingeweide an der Reihe waren. »Wenigstens merkt man bei der Hitze nicht, woraus das Zeug zusammengebraut ist«, murmelte er und zeigte auf den entkleideten Leichnam. »Guten Abend, oder vielmehr einen guten Morgen, Professoressa Bellucci. Können Sie mir schon irgendetwas berichten, womit ich etwas anfangen kann?« Er gähnte und ließ sich auf dem unbequemen Drehhocker neben der Schiebetür nieder.
»Guten Morgen, Commissario.« Die Gerichtsmedizinerin sah zu ihm hinüber und deckte den Toten mit einem weißen Tuch zu. »Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen meine äußerst vorläufigen Erkenntnisse bei einem ordentlichen Espresso darlege?«
Er blickte kurz auf sein Automatenheißgetränk und stellte es dann samt Inhalt vorsichtig in dem Mülleimer vor der Schiebetür ab.
Bellucci schüttelte den Kopf und machte sich an einem beeindruckenden Kaffeevollautomaten zu schaffen. »Ohne das Ding wäre es mir wahrscheinlich unmöglich, nachts zu arbeiten–« Sie streichelte mit der Linken über den verchromten Deckel des Bohnenbehälters und setzte die Maschine in Gang.
»Sie sind meine Rettung. Ich hätte die Plörre in meiner Verzweiflung beinahe getrunken.« Mancini ging hinüber zu einem der Spülbecken aus Edelstahl, nahm ein Becherglas aus dem Metallregal und ließ kaltes Wasser einlaufen. »Er ist nicht ertrunken, oder?«, rief er Bellucci über die Schulter zu.
»Das kann ich noch nicht definitiv sagen. Wir werden sehen, ob er Wasser in der Lunge hat. Bei der äußeren Beschau konnte ich keine Verletzungen feststellen, schon gar keine, die irgendwie geeignet wären, ein Ableben herbeizuführen.« Die Ärztin stellte seine Tasse auf einen leeren Obduktionstisch und holte dann ihr eigenes Getränk. »Er hat ein paar blaue Flecke, wie sie wahrscheinlich jeder von uns ab und zu aufweist, Blutreste in der Mundhöhle, postmortale Schrammen von der Bergung oder Hindernissen im Kanal, aber keinerlei Abwehrverletzungen oder sonst irgendetwas, das auf Gewalt hindeuten könnte.«
»Sie wollen mir nicht sagen, dass er kein Fall für mich–«
»Immer langsam, Commissario«, unterbrach sie gedehnt. »Natürlich wäre es möglich, dass der Mann eines natürlichen Todes gestorben ist. Trotzdem glaube ich nicht, dass Sie ihn vom Haken lassen müssen. Man wirft einen Verstorbenen ja nicht ohne Grund in den Kanal... Warten wir die Untersuchungsergebnisse ab.«
»Wie lange?«
»Kurz. Durchaus möglich, dass er nur ein paar Stunden im Wasser lag.«
Er nahm mit hochgezogener Braue einen großen Schluck Wasser und ermunterte sie mit aufwendiger Geste fortzufahren.
Die Gerichtsmedizinerin zog das weiße Laken bis zur Hüfte des Toten hinunter. »Wie schon erwähnt, ich kann noch nicht sagen, woran der Mann gestorben ist.«
»Gut. Das bedeutet für mich?«
»Ich werde mich nicht zu etwas versteigen, nur um Ihnen vorschnell einen Ermittlungsansatz zu liefern. Sehen Sie sich den Mann an. Und Sie haben seine Kleidung gesehen. Er hat gepflegte Hände, einen Haarschnitt und ist glatt rasiert. Keine Einstiche; und nach Drogen sieht das keinesfalls aus. Den Standard 'Betrunken in den Kanal gefallen' können wir wohl ebenso hintanstellen. Natürlich könnte er auf der Rialto einen Herzinfarkt erlitten haben und dann ins Wasser gekippt sein—völlig ohne Publikum... Aber wie realistisch ist das? Commissario, diese Überlegungen kann jeder Polizeischüler anstellen.«
Der Commissario brummte; das passierte immer, wenn er unzufrieden war und den Grund dafür nicht zu fassen bekam.
Sie seufzte. »Weil ich Sie so gut kenne, dass ich weiß, wie Sie damit umgehen werden, begebe ich mich jetzt auf die Ebene emotional gegründeter Spekulation.« Bellucci zog einen Hocker zu sich, nahm Platz und rollte dicht an Mancini heran. »Eine Infektion, sagt mein Gefühl. Aber ich bin mir sicher, wenn Sie erst einmal seine Identität kennen, werden Sie feststellen, dass er keine entsprechende Krankheitsgeschichte hat.« Sie nahm den letzten Schluck Espresso und zog eine Packung grüner Dunhill aus der Kitteltasche. »Auch eine?«
Mancini wunderte sich, denn er hatte die Medizinerin noch nie in den Untersuchungsräumen mit einer Zigarette gesehen. Er zuckte mit den Schultern und nahm an. Eigentlich rauchte er schon seit eineinhalb Jahren nicht mehr, doch eine Menthol zwischen den Seziertischen erschien ihm um diese Uhrzeit irgendwie passend.
»Wenn Sie mich fragen, dann ist mein erster Tipp der Doktor«, rückte Bellucci mit ihrer Befürchtung heraus. »Es ist etwas Schnelles, ein Tag, ein paar Tage maximal, vermute ich. Es würde mich nicht wundern, wenn unser Mann einen Arzt aufgesucht hat, weil er sich schlecht fühlte. Offenbar hat man dabei aber nichts Lebensbedrohliches festgestellt, sonst wäre er ja wohl in einem Krankenhaus gestorben. Vielleicht geben uns Medikamente in seinem Körper einen Hinweis.«
Der Polizist stand auf. »Das ist doch schon was.«
»Nageln Sie mich nicht fest«, kam ihm Professor Bellucci zuvor. »Ich habe noch keine Zeit für eine mikroskopische oder toxikologische Untersuchung gehabt. Auch Abstriche und Kulturen brauchen ihre Zeit. Nur würde es mich nicht wundern, wenn er ins Muster passt.«
»In der Tat fürchte ich schon, dass es so ist, seit ich ihn auf dem Steg habe liegen sehen«, grübelte Mancini. »Seine Sachen sind in der Kriminaltechnik. Alles sieht nach einem wohlhabenden Urlauber aus.« Er stellte seine leere Tasse auf die Spüle und drehte sich im Gehen noch einmal um. »Vielen Dank. Sie können mich jederzeit erreichen, wenn Sie Ergebnisse haben. Ich glaube nicht, dass ich so schnell nach Hause komme...«
»Erst einmal muss ich ihn aufschneiden«, rief die Pathologin Mancini durch die bereits zugezogene Schiebetür nach.
09
»Das habt ihr alles zu fünft freigelegt?«, erkundigte sich Conrad beeindruckt. Er schaute auf die rechteckige Zone von etwa fünfundzwanzig Metern Länge und zehn Metern Breite hinab. Das derzeitige Grabungsplanum lag ungefähr sechzig Zentimeter unter dem rezenten Bodenniveau.
»Zu viert«, berichtigte Soccio mit einem breiten Grinsen. »Der Ausgrabungsleiter schaufelt nicht mit, wie Sie sich sicher denken können.« Er ließ diese Behauptung für einige Sekunden wirken und ergötzte sich offensichtlich an seiner und Lisas Sprachlosigkeit. »Das ist natürlich Quatsch«, erlöste er sie. »Die Deckschichten haben wir mit Erstsemestern und willigen Amateuren abgetragen. Als wir auf die ersten relevanten Befunde gestoßen sind, haben wir die Grabungshelfer nach Hause geschickt. Das ist nicht so gemein, wie es sich anhört«, kam er Lisas Einwand zuvor. »Alle Teilnehmer wussten, worauf sie sich einlassen. Wir hatten wesentlich mehr Interessenten, als wir letztendlich beschäftigen konnten. Und es war ja auch ein ordentlich bezahlter Ferienjob an der frischen Luft... Die fachlichen Erklärungen sowie historisches Hintergrundwissen haben sie von uns natürlich sowieso bekommen.«
Soccios Rechtfertigung war Conrad gleichgültig. »Auf jeden Fall eine beeindruckende Erdbewegung. Seit wann liegt das Planum mit den Skeletten frei?«
»Schon seit letztem Herbst«, berichtete Soccio den verdutzten deutschen Archäologen. »Ich habe vergangenes Jahr zwei Grabungen in Mailand und Turin geleitet. Daher konnten wir hier erst spät im Sommer mit den Arbeiten anfangen. Natürlich haben wir den Befund mit zwei Schichten Folie und einem guten Teil des Aushubes wieder abgedeckt, als wir die Kampagne letztes Jahr beendet haben.«
»Den Drecksjob haben natürlich wieder die Statisten gemacht«, nuschelte Franks.
Falls er sie mitbekommen hatte, dann überging Soccio ihre Provokation. »Vor sechs Wochen haben wir die Grabung wieder aufgemacht und mit der Freilegung der Skelette begonnen. Ja, und spätestens nächste Woche hätte ich mich im Anthropologischen Institut nach einem fähigen Mitarbeiter erkundigen müssen.«
»Dafür sind wir ja da«, bemerkte Conrad mit stolzer Stimme.
»Exakt, Sie kommen wie gerufen. Aber Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, Peter, dass ich ungeachtet Ihrer Qualifikation ein paar Nachforschungen bei befreundeten Wissenschaftlern angestellt habe, bevor ich mich tatsächlich dafür entschieden habe, Sie für diese–«
»Schon okay«, kürzte der Anthropologe ab. »Gibt es hier so etwas wie einen Fundlagerraum, in dem ich ein provisorisches Labor für die gröbsten Untersuchungen der Knochen einrichten kann?«
»Ich denke, wir werden in den großzügigen Gebäuden noch etwas Adäquates für Sie beide finden.« Er blickte kurz zu Franks. »Die notwendige Ausrüstung, ein Mikroskop, diverse Feinwerkzeuge und anderes Laborzeug sollte morgen anlanden. Eine große Menge Regale und einige Tische haben wir bereits aufbauen lassen.«
»Apropos 'etwas Adäquates'», flüsterte sie Conrad ins Ohr, während er noch über Soccios selbstverständlich benutzte Passivkonstruktion nachdachte. Soccio schienen hier für alles Helfer zu haben...
Er brachte Lisa mit einer herrischen Bewegung zum Schweigen. »Das mache ich schon noch«, zischte er seiner Kommilitonin zu. »Heute Abend.«
»Alles in Ordnung?«, fragte der italienische Archäologe.
Conrad winkte ab. »Nichts Wichtiges. Ging um unsere Unterbringung. Da würde ich gerne nochmal mit Ihnen sprechen, später.«
Soccio nickte mit verständiger Miene, ging aber nicht darauf ein. »Wo war ich stehengeblieben? Ach ja. Also, wir sind nun an dem Punkt, an dem wir die ersten Knochen einmessen und bergen könnten.«
***
Die Sonne stand schon ziemlich tief am Himmel, als sie zum zweiten Mal an diesem Tag mit dem Vaporetto unweit des Markusplatzes anlegten. Obwohl die menschlichen Überreste zur Bergung vorbereitet waren, hatte Soccio seinen Anthropologen und Franks kaum etwas tun lassen, sie jedoch mit ausführlichen Geschichten um das Lazzaretto und ein paar Anekdoten über ihre Grabungskollegen unterhalten. Kaffee war außerdem reichlich geflossen. Conrad machte sich keine Hoffnung, dass diese entspannte Stimmung besonders lange andauern würde. Spätestens, wenn das erste Skelett draußen war, würde auch ein vordergründig gemütlicher Brummbär wie dieser Soccio Resultate sehen wollen.
Hatte er schon am Morgen das Vaporetto für gut gefüllt gehalten, stellte Conrad jetzt fest, dass der Verkehr abends noch dichter war—und das hieß hier: dichtes Gedränge von Menschen. Keine Autokarawanen oder voll besetzten Busse, hier in Venedig walzten Touristen und die wenigen Einheimischen in einem steten Menschenstrom durch die wichtigsten Wege und über all die Brücken, zwängten sich noch durch die schmalsten Gassen der Stadt. Und im Sommer hatten sie natürlich absolute Hochsaison in der Lagune.
Conrad atmete flach, während er neben Lisa hinter einer Gruppe aufdringlich parfümierter Amerikanerinnen den Anleger hinaufstieg, um sich in den laufenden Verkehr an der Riva degli Schavioni einzufädeln. Dass Widerstand gegen Lisas Plan, ihre Ankunft in Venedig doch noch angemessen zu begehen, völlig zwecklos wäre, wusste er. Außerdem war er froh, dass sie das heikle Thema Unterkunft in einem günstigen Augenblick mit Soccio geklärt hatte—dafür hatte sie sich das Vergnügen verdient, ein oder zwei Stündchen im Urlaubsflair zu schwelgen und ihn mit ihrem Wissen über die historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt zu beeindrucken.
Er war froh, als sie endlich die breite, hell gepflasterte Uferpromenade erreicht hatten und sich ein wenig aus dem Gedränge lösen konnten.
»In einer Stunde fängt hier der Abendbetrieb in den Restaurants an«, bemerkte Lisa und wies auf die Etablissements, die sich wie Perlen auf einer Schnur aneinanderreihten. »Aber das hier ist sowieso außerhalb unserer Preisklasse, und wir wollen ja etwas für unsere humanistische Bildung tun.«
Conrad mochte gutes Essen und wusste auch das eine oder andere Glas zu schätzen, aber die auf nobel getrimmten Schuppen, die er hier sah, waren tatsächlich nicht seine Sache. Er blinzelte gegen das Licht und nickte. »Unser Futterplatz für diese Kampagne steht doch sowieso schon fest, oder täusche ich mich da?«
Franks grinste breit und zog ihn weiter, vorbei an noch mehr Restaurants und Ständen mit Touristenwaren wie Sonnenbrillen und Strandtaschen, Badehosen, Hüten und kitschigen Souvenirs. Kurz darauf erreichten sie die markante Ponte della Paglia mit ihren flachen Stufen und dem an manchen Stellen arg tauben- und möwenbekackten weißen Geländer. Lisa blieb stehen. Sie lehnten sich auf der Lagunenseite auf die Brüstung, und Conrad musste zugeben, dass eine Stadt am—oder vielmehr im—Wasser eine gewisse Faszination besaß. Alles war flach, das Meer bildete einen lebendigen Teppich zwischen den hier und dort knapp oberhalb der Wasserlinie liegenden Inseln und den vergleichsweise wenigen, dafür umso auffälliger aufragenden Wahrzeichen der Stadt. Von hier konnte er die glockig-gemächliche Santa Maria della Salute und den keck gereckten Campanile von San Giorgio Maggiore sehen, wie Lisa ihm gestikulierend und wortreich erläuterte. Er wollte sie gerade damit aufziehen, dass die Stadt schon merklich auf sie abfärbte, als ein Mann ihm im Vorübergehen seinen Spazierstock in die Wade rammte. Conrad fuhr mit einem Schmerzenslaut herum. »Verfluchter...«
»Ja, Stehenbleiben ist hier nicht die beste Idee. Lass uns weitergehen. Wenigstens den Markusplatz will ich jetzt noch sehen. Museen schaffen wir heute sowieso keine mehr.« Franks drehte ihr Gesicht in den leichten Wind, der über die Lagune strich. Nicht, dass es eine frische oder gar wohlriechende Brise war, aber sie wirkte zufrieden und entspannt.
Gleich hinter der Brücke erhob sich auf ihrer rechten Seite der Palazzo Ducale, der Dogenpalast. Auch Conrad wusste, dass sich hier eines der ältesten archäologischen Museen Europas befand. Es war auch keineswegs so, dass er noch nie in Italien gewesen war, wenn auch nicht in Venedig. Aber die Studienreise nach Rom und Pompeji hatte ihm nachdrücklich bewiesen, dass klassische Archäologie ihm weitgehend fremd war und immer bleiben würde. Anna hatte in den zahllosen Statuen und anderen Kunstwerken geschwelgt; er hatte ihre Gesellschaft genossen und die Langeweile der Fahrt darüber vergessen. Die Erinnerung daran kehrte schlagartig zurück, als er befürchtete, dass Lisa ihn vielleicht zu ähnlichen endlosen Gängen durch Skulpturensammlungen und zur Besichtigung alter venezianischer Architektur animieren wollte. Aber sie steuerte nicht auf den Eingang zu, der zu seiner Erleichterung auch schon geschlossen war, sondern auf die freie Fläche neben dem Palast des Statthalters.
»Das hier ist die Piazzetta San Marco, nicht der eigentliche Markusplatz, auch wenn das meist verwechselt wird«, dozierte Lisa, während er mit halbem Ohr zuhörte. »Die beiden Säulen da kennst du sicherlich, sie stehen vor allem für ankommende Staatsgäste Spalier und zeigen die beiden Stadtheiligen.«
Conrad nickte und bedachte die Monumente mit einem pflichtschuldigen Blick, ehe sie der Lagune den Rücken zuwandten und den Platz in Richtung des weltberühmten Campanile überquerten, der völlig frei am Übergang zur Piazza San Marco aufragte. Mit dem Markusdom an seiner einen Schmalseite erstreckte sich der trapezförmige Platz nach Südwesten, auf den anderen drei Seiten von nahezu perfekt einheitlichen Gebäuden mit Rundbogenfenstern und einem Portikus mit Ladenstraße eingefasst.
»Und jetzt, mein Lieber, ist es Zeit für das beste Eis der Welt«, verkündete Lisa strahlend und führte ihn zu einer Gelateria in den Kolonnaden.
Der Preis für drei Kugeln für jeden von ihnen brachte Conrads Puls zwar heftig in Wallung, aber da er nicht zahlen konnte, fühlte er sich nicht in der Position zu protestieren.
»Danke, das...«
»Ist eine wichtige Tradition. Und außerdem deine Entschädigung dafür, dass ich dich bestimmt noch viele Stunden langweilen werde, während wir hier sind.« Lisa drückte ihm beide Eisbecher in die Hände, um sich die Haare mit einem Gummi zusammenzubinden. »Lass uns ein Plätzchen zum Sitzen suchen.«
Das allerdings erwies sich auf dem kahlen Platz als nicht so einfach. Die Steinstufen am Campanile selbst waren bereits gut besetzt, doch der kleine Anbau hatte einen Sims, auf dem sie sich schließlich niederließen. Sie stießen feierlich mit ihren Eisbechern an und aßen genüsslich in der Abendsonne Gelato. Unweigerlich richteten sich ihre Blicke dabei auf ein seltsames Objekt aus Metall, das wenige Meter vor ihnen aufgestellt war. Dass Venedig berühmt für seine zweijährliche Kunstausstellung war, wusste Conrad. Sonst wäre er vielleicht nicht auf die Idee gekommen, dass das Objekt wirklich... Kunst darstellte.
»So einen Mist können die hier aufstellen, aber keine Bänke«, maulte Lisa, musste dabei aber grinsen. »Kommt mir irgendwie bekannt vor.«
»Ach, das erinnert dich bloß an das Faraday-Logo auf deiner Lieblingsmütze«, gab er stichelnd zurück.
Franks schnaufte aufgebracht, dann gab sie ein nachdenkliches Geräusch von sich, während sie ihr Eis ungewohnt langsam verzehrte. »Eigentlich hast du recht. Das sieht aus wie die lebensunfähige Kreuzung aus einem Strommast und einem Kirchturm.«
Er lachte und ging auf das Spiel ein. Als Kunstkenner würde er bei Lisa sowieso nie durchgehen, obwohl er sich selbst zumindest als Kunstfreund betrachtete. »Kirche? Das sieht ja wohl eher nach Posthörnern oder Alarmsirenen aus. Bestimmt ist das eine Kritik an der Moderne, und diese Tröten sollen die Menschen wachrufen.«
Lisa legte das Kinn in die Hand und strich sich einen imaginären Bart. »Conrad, Sie haben wohl die Handräder übersehen und das leere Herz dieser Skulptur.« Sie deutete auf die Mitte, an der irgendetwas zu fehlen schien. »Das hier ist eine Allegorie auf die Sinnleere, die selbst mit unserer aller Hände Arbeit nicht mehr zu neuem Leben zu erwecken ist.«
Conrad konzentrierte sich kopfschüttelnd auf sein Eis, das wirklich köstlich schmeckte. »Ich weiß nicht, wie du auf so einen Quatsch kommst.«
»Das Studium von Geisteswissenschaften hinterlässt selbst bei mir seine Spuren. Ich glaube, ich kann dir mittlerweile so ungefähr alles irgendwie kultisch interpretieren.« Sie warf ihm einen misstrauischen Blick zu. »Aber fass das nicht als Herausforderung auf.«
»Würde mir im Traum nicht einfallen. Ich schätze, wir können deine Talente auch gewinnbringender einsetzen.«
Lisa zog ein Gesicht. »Erinnerst du dich an Inga, die mal mit auf Bergens Grabung war? Die hat auf Kunstgeschichte umgesattelt–«
»Na, Gott sei Dank«, schnaubte er zufrieden.
»Wieso Gott sei Dank? Die macht da jetzt bestimmt schon das Doppelte von deinem mickrigen Salär.«
Conrad vertiefte sich in seinen Eisgenuss. Das Letzte, wonach ihm der Sinn stand, war eine Diskussion über Geld und Devisen. Er würde Lisa sowieso noch um ein Darlehen für eine Brille angehen müssen, und das stank ihm jetzt schon beträchtlich.
***
»Danke, dass du das heute mit Soccio geregelt hast. Schließlich ist dein Italienisch viel besser als meines«, eröffnete Conrad das Gespräch, nachdem sie Essen und Getränke bestellt hatten. »Außerdem weißt du ja—im Gegensatz zu mir—wie man mit den Einheimischen reden muss.«
»Außerdem geht es ja um mein Geld... beziehungsweise das meiner Mutter«, grinste sie provokant.
»Du weißt genau, dass ich das auf Heller und Pfennig zurückzahle«, protestierte er. »Und schließlich habe ich uns überhaupt diese Grabung an Land–«
»Hey, alles gut.« Sie legte ihre Hand auf seinen Unterarm und lächelte. »Ein kleiner Scherz unter Freunden muss noch drin sein.«
»Entschuldigung, aber du weißt genau...«, murmelte er betreten und lehnte sich zurück. »Ich frage mich die ganze Zeit, wie die so sicher sein können, dass es sich bei den Skeletten um Pestopfer handelt.«
»Was meinst du?«, entgegnete Franks, von dem Themenwechsel überhaupt nicht überrascht, und lehnte sich ebenfalls gegen das bequeme Korbgeflecht.
»Nun, wenn du dich erinnerst, dann stand in diesem GEO-Special über die Seuchen des Mittelalters gar nichts Konkretes. Wir reden immer von einem Pestfriedhof, aber das war ein Bericht über London. Dass die Universität Padua in Venedig gräbt, war eine neue Information. Wir beziehungsweise ich habe ganz selbstverständlich daraus geschlossen, dass es hier auch um die Pest geht...«
»Du meinst, wir sind gar nicht wegen–«, sie stockte. »Ist doch auch egal. Hauptsache, es ist eine Mittelaltergrabung mit Knochen, und die benötigen einen Anthropologen.«
Conrad hob abwehrend die Hände. »Nein, nein, das habe ich nicht gemeint. Freund Soccio redet die ganze Zeit von der Pest, alle seine Erklärungen zu Venedig und den Handelsbeziehungen laufen darauf hinaus. Und die Geschichte der alten Lazarettinsel ist historisch gut verankert, sie ist über Jahrhunderte als Insel für die Isolation von Kranken bekannt, aber...«
»Aber was? Dann ist doch alles plausibel.« Ihr Gesichtsausdruck zeigte deutlich, dass sie keine Ahnung hatte, was ihn so misstrauisch klingen ließ.
»Na, das sind Archäologen, Wissenschaftler, wie wir auch. Würdest du so kategorisch Fakten verbreiten, die du noch überhaupt nicht geprüft hast? Ich meine, was, wenn es schiefgeht, und die Toten sind im neunzehnten Jahrhundert der Cholera zum Opfer gefallen oder an Lungentuberkulose gestorben? Das ist genauso denkbar, schließlich wurde diese Toteninsel bis dahin genutzt, wenn ich mich nicht irre.«
Sie nickte, lehnte sich nach vorne und stützte die Ellenbogen auf die unebene Rattanplatte. »Ich verstehe, was du meinst. Vielleicht ist Soccio einfach ein bisschen voreilig. Immerhin ist auch der Italiener.« Sie blickte auf und winkte. »Da kommen endlich unsere Getränke.«
»Ja... vielleicht.« Conrad folgte der Richtung, für die ihr Lächeln bestimmt war, und sah Giovanni mit zwei Flaschen Bier und zu großen Gläsern im Anmarsch. »Trotzdem ist er sich seiner Sache extrem sicher.« Jetzt rückte auch er wieder näher an den Tisch. »Also ich würde so etwas nur herausposaunen, wenn ich nicht nach hinten überkippen könnte. Die notwendigen Untersuchungen sind ja nicht mal eben gemacht. Egal, ob italienische Toleranz oder nicht, der ist garantiert genauso an seiner Reputation und Karriere interessiert wie unsere Professoren auch.«
Sie zuckte mit den Schultern und schien nur Augen für das Honigkuchenpferd zu haben, das gerade, nach Conrads Dafürhalten unnötig aufwendig, die Getränke servierte.
»So, kann es weitergehen?«, fragte er genervt und wartete, bis der Kellner seiner Pflicht an einem anderen Tisch nachkam. »Nochmal: Wenn mich nach Soccios Erklärungen heute jemand gefragt hätte, dann hätte ich keine Zweifel gehabt, dass die die Skelette längst untersucht haben...«
Franks ließ sich mit einer Antwort Zeit und leerte zuerst das zur Hälfte eingeschüttete Glas. »Und wenn?« Sie wischte den Schaum von der Lippe. »Unmöglich ist das doch nicht. Was macht es schon? Umso besser für uns, dann wissen wir wenigstens, dass es spannende Befunde geben wird.«
Er war von ihrem ungewohnten Phlegma langsam genervt. »Soccio hat ausdrücklich erwähnt, dass sie die Knochen noch nicht einmal eingemessen haben. Und dass es Zeit wird, einen fähigen Anthropologen einzubinden. Das sagt man nicht, wenn man schon alles weiß–«
»Ach, jetzt werd nicht zum Erbsenzähler. Die wollten den großen Peter Conrad, sonst hätte der Professor dich niemals kommen lassen.«
Er wollte protestieren, doch sie ließ es nicht zu.
»Sei nicht so empfindlich. Wenn die uns nicht brauchen würden, wären wir nicht an der Kampagne beteiligt. So einfach ist das.« Sie goss das verbliebene Bier in ihr Glas. »Und hier zu sein, ist das Beste, was uns in einer ganzen Weile passiert ist, würde ich behaupten. Entspann dich, die sind hier einfach ein wenig–«
»Ein wenig was?«, unterbrach er sie. »Jetzt komme mir nicht mit 'italienischer Lässigkeit' oder so einem Quatsch. Da gehe ich nicht mit. Und ich weiß auch nicht, was an dieser nervtötenden Mentalität... charmant sein soll.«
Sie hob die Brauen, enthielt sich aber einer Entgegnung.
»So, wie Professor Soccio die ganze Sache dargestellt hat...«, er überlegte kurz und griff dann ebenfalls nach seinem Pils. »Entweder lügt der Kerl uns an, oder er ist schlicht ein unprofessioneller Trottel.«
»Es könnte auch sein, dass er ein Schlitzohr ist und Gründe sucht, die Grabung möglichst lange zu bespielen, schließlich geht es immer auch um Geld... Aber lass uns hoffen, dass die charmante Blauäugigkeit siegt.« Sie hob ihr Glas und prostete ihm zu. »Auf viele interessante Knochen in den nächsten Wochen.«
10
»Waren Sie schon einmal in Venedig?«
Berndorff hasste diese Frage. Er wischte sich zum hundertsten Mal den Schweiß von der kalten Stirn und versuchte, ein säuerliches Aufstoßen zu unterdrücken. Sie waren in der zweiten—und Gott sei Dank letzten—Woche ihrer Reise, und mittlerweile hatte ihm wirklich jeder eine Unterhaltung mit diesen Eröffnungsworten aufgezwungen. Was regelmäßig folgte, waren absurde Lobpreisungen dieser miefigen, heruntergekommenen Touristenfassade. Nein, er war noch nie in Venedig gewesen, und nein, er würde nicht wiederkommen. Ganz im Gegenteil. Er war froh, wenn diese unglaublich enttäuschenden vierzehn Tage vorüber waren und er im Flugzeug zurück nach Frankfurt saß. Nichts war so, wie er sich das vorgestellt hatte: Venedig war ein Freizeitpark mit einigen wenigen Einheimischen als Statisten für die Besucher. Eine romantisch verklärte Stadtkulisse für die anspruchsloseren Europäer; in den Vereinigten Staaten hätte man den Park wegen fehlender Attraktionen und Ereignislosigkeit schnell geschlossen. Es gab hier nicht viel zu sehen. Am ersten Tag hatte er die verfallenen Häuserinseln im stinkenden Brackwasser interessant gefunden, doch schon am zweiten Tag wurde ihm klar, dass es keine neuen, überraschenden optischen Eindrücke geben würde—von einigen 'Sehenswürdigkeiten', die jede andere italienische Stadt so oder ähnlich auch zu bieten hatte, einmal abgesehen. Dass die sensorischen Belästigungen bis zum Ende seines Urlaubes anhalten würden, damit hatte er sich ja sowieso schon kurz nach ihrer Ankunft abgefunden. Venedig war definitiv stinklangweilig. Was für ein treffendes Bild. Er lachte krächzend auf, und sofort meldete sich der lästige Husten.
»Waren Sie schon einmal in Venedig?«, wiederholte die aufgedunsene Mittsechzigerin in ihrem fränkischen (oder hessischen) Dialekt, der ihn noch mehr abstieß als die noch folgenden drei Tage in der tristen Lagunenstadt.
»Nein.« Sie vielleicht?, hätte er wahrscheinlich antworten sollen, aber er wollte keine Konversation in Gang bringen. Wenn er sich besser gefühlt hätte... wäre vielleicht eine provokative Äußerung der Auftakt zu einer Abwechslung in dieser öden Zeit gewesen, doch mit diesem Befinden? Nein, er sollte sich hinlegen.
»Ich bin schon das neunte Mal zu Besuch. Seit mein Mann gestorben ist, komme ich mit meiner Freundin jedes Jahr hierher. Finden Sie nicht auch, dass Venedig die romantischste Stadt ist, die man sich vorstellen kann?« Sie drehte sich ein wenig weiter zu ihm. »Ach, ich liebe dieses aus der Zeit gefallene Fleckchen Erde. Wo findet man sonst diese Mischung aus Melancholie und Intimität?«
»Auf dem Friedhof, meine Liebe«, entgegnete er spontan und erwartete wegen dieser Unbeherrschtheit nun den empörten Protest der beiden Frittenbudenbetreiberinnen (jedenfalls war das das Urteil, zu dem er nach Abwägung der Schmink- und Parfümierungsgewohnheiten in den vergangenen zehn Tagen gekommen war).
Die schlampig blondierte Matrone lachte erwartet gewöhnlich. »Ja, etwas Morbides hat Venedig, aber das ist ein Teil des Charmes, meinen Sie nicht auch, Herr Berndorff?«
Ach, halt das Froschmaul und lass mich endlich in Frieden, lag ihm auf der Zunge, doch er konnte es in diesem Fall zurückhalten. »Na, jedenfalls ist es nicht mein Geschmack.« Wieder ein Schweißausbruch und dieser Schwindel, der ihn schon seit beinahe zwei Tagen in immer kürzer werdenden Abständen heimsuchte. »Vielleicht ist es auch der widerliche Geruch–« Er bekam einen heftigen Hustenanfall. Erst nach einer halben Minute kam er zur Ruhe und wischte sich Stirn und Lippen mit der ausgebleichten Stoffserviette ab. »Der Stadt, meine ich.«
»Ist Ihnen nicht gut? Vielleicht sollten Sie einen Tee trinken. Hier sind in der Hauptsaison so viele Menschen unterwegs, dass man sich leicht eine Sommergrippe holen kann«, schaltete sich der quietschrot gefärbte Klon der Pommesbudenfrau ein. »Ist mir auch schon passiert, da waren Carmen und ich zum Weihnachtsshopping hier. Das war ein Schlamassel, kann ich Ihnen sagen. Versuchen Sie mal, hier einen Arzt zu finden, der ordentliches Deutsch spricht... Und in einem italienischen Krankenhaus, das versichere ich Ihnen, wollen Sie auch keinesfalls liegen. Diese Italiener haben eine ganz andere Einstellung zu Sauberkeit und Hygiene, das weiß man ja.«
Berndorff verkniff sich einen bissigen Kommentar, dieweil er gegen die nächste Hustenattacke kämpfte. Verdammt, er fühlte sich, als hätte er vergangene Nacht durchgezecht und wäre zum Abschluss in eine Schlägerei geraten. Die beiden Imbissdamen redeten auf ihn ein, doch er nahm ihre Stimmen nur durch einen dichter werdenden Nebel wahr. Zu allem Überfluss wurde das Schwindelgefühl allmählich durch eine Schüttelfrostepisode bereichert. Das war neu. Mensch, ich habe mich schon lange nicht mehr so elend gefühlt... eigentlich noch nie, ging es ihm durch den Kopf. Kurz darauf kam schon ein weiterer Hustenanfall. Er griff nach der Serviette—dieses Mal sah der Auswurf dunkel aus. Er verscheuchte den Gedanken an die Umschreibung 'blutig'.
»Sollen wir Sie nicht doch zum Hospital begleiten? Das hört sich wirklich schlimm an«, bot Carmens Freundin (hieß die Blondierte nicht Tosca?) an. »So weit ist das nicht von hier.«
Er konnte kaum sprechen. »Lassen Sie nur«, krächzte Berndorff. »Ich weiß, das ist nett gemeint. Wahrscheinlich habe ich mir eine Salmonellenvergiftung zugezogen.« Wieder schüttelte ihn Husten, und dieses Mal war der dünnflüssige Schleim auf dem Stoff eindeutig rotbraun.
»Das kann man sich gut vorstellen«, kommentierte die vermutliche Tosca. »Als mein Mann noch lebte, habe ich einmal in Neapel...«
Er registrierte kaum etwas von der folgenden Geschichte. Der Nebel wurde dichter, Zeit und Raum schienen sich aufzulösen. Das Atmen fiel schwer und das Schwindelgefühl verschwand überhaupt nicht mehr. Was hatte er nur zu sich genommen? Hatte er irgendetwas gegessen, was die anderen nicht auch bestellt hatten? Berndorff aß niemals Fisch oder Meeresfrüchte auswärts, schon gar nicht in südlichen Ländern. Und er bestellte nur Speisen, die von mindestens einem anderen aus der Gruppe auch geordert wurden. So konnte man eine Vergiftung eindeutig nachvollziehen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen.
»...ganze Woche habe ich flachgelegen. Ich versichere Ihnen, das war kein Vergnügen...«
Seine Wahrnehmung klärte sich etwas, doch in dem Maß, wie das Schwindelgefühl abnahm, flammte unerträglicher Kopfschmerz auf. Kälte fuhr in seine Knochen und die Hustenquälerei fand ihre Fortsetzung. Mit dem blutigen Sputum kehrte auch das üble Drehen in seinem Kopf schlagartig zurück.
»Vorne raus, hinten raus, Sie machen sich keine Vorstellung, Herr Berndorff. Nie wieder werde ich...«
Er musste hier weg. Frische Luft würde ihm guttun—ganz bestimmt. »Ich werde... eine Runde um den Block drehen«, unterbrach er Toscas Monolog. »Wenn Sie für mich bezahlen würden.« Mit schmerzenden Gliedern kramte er nach seiner Geldbörse und zog schließlich ein Bündel Lire-Scheine heraus. »Das sollte reichen, wir sehen uns sicher morgen in aller–«
»In aller Frische«, vervollständigte Carmen lächelnd seine von heiserem Bellen erstickte Erklärung.
»Sollen wir wirklich nicht...?«, versuchte es Tosca noch einmal.
Er winkte unwirsch ab. »Nicht nötig.« So muss sich ein Hundertjähriger fühlen, dachte Berndorff, als er sich unter Stöhnen auf die Beine hievte und dabei fast den Tisch umkippte. »Sie entschuldigen mich...«
Tosca setzte zu einem neuen Versuch an, doch Carmen legte die Hand auf ihren Arm und schüttelte mit gesenktem Blick das Haupt. »Lass gut sein, wir verärgern Herrn Berndorff nur«, flüsterte sie ihrer Freundin zu.
Nach endlos erscheinenden zwei Minuten hatte er die zehn Meter bis zur Tür geschafft und sie aufgedrückt, trat ins Freie und sog die Luft tief in seine Lungen, was ihm eine weitere Hustenattacke bescherte. Doch er fühlte sich augenblicklich besser. Zwar blieben das Frösteln und der Kopfschmerz, das Schwindelgefühl jedoch ließ stetig nach. Er wartete noch einige Zeit, bis er sich sicher genug für den Heimweg fühlte. Welcher war der kürzeste Weg zurück in das Hotel mit der durchgelegenen Matratze? Nach kurzem Zögern entschied er sich für links. Mit keuchender Atmung setzte er sich in Bewegung. Anstrengender als befürchtet. Schon nach wenigen Schritten verschlechterte sich sein Gleichgewichtssinn wieder, und er tastete sich an der welligen Hauswand entlang. »Mein Gott, das wird ein schöner Heimweg«, murmelte er und spie den Auswurf der unmittelbar folgenden Hustentirade auf das unsauber verlegte Kopfsteinpflaster.
11
Als Soccio aus dem Kanal in die Lagune steuerte, blickte Conrad gedankenverloren hinüber zum alten Lazarett. War das der Blick, den die Todgeweihten gehabt hatten, wenn man sie auf die Insel des Schmerzes deportierte? Ein wohliges Frösteln durchfuhr ihn; er grinste. Dafür studierte man Archäologie und nahm all die Unannehmlichkeiten auf sich, die mit dieser Tätigkeit zwangsläufig verbunden waren... Und er musste ja noch nicht einmal im Dreck sitzen, scharren und unzählige Säcke voll Erde von einer Stelle auf die andere tragen. Er war Anthropologe—die interessantesten Funde wurden ihm von den Ausgräbern gewissermaßen auf dem Silbertablett überreicht. Ja, er freute sich einfach auf eine große Anzahl menschlicher Schädel, Zähne und Langknochen. Es konnte gut sein, dass er nie wieder eine so reichhaltige Grabung in seiner Laufbahn mitmachen würde.
»Ich bin mal gespannt, wie der Befund sich nun darstellt«, holte Lisa ihn aus der Tagträumerei. »Bisher haben wir ja nur einmal kurz in die Fläche geguckt.«
»Ja, drei oder vier Dutzend Bestattungen werden es wohl sein. Da habt ihr ordentlich was zu tun, wenn ihr das alles putzen müsst.«
Franks grinste breit. »Ich bin sehr sicher, dass du mitpinseln wirst, zumindest am Anfang. Warte es ab.«
Sein Protest war verhalten. »Aber ich muss ja noch das Labor improvisieren, die Geräte aufbauen... jedenfalls ab Nachmittag.«
»Alles bereit für den Landgang machen«, rief Soccio theatralisch, während die beiden italienischen Ausgräberinnen ihrer Unterhaltung zu folgen versuchten. Sie verstanden wohl annähernd nichts, wie Conrad aus ihren Blicken und dem Stirnrunzeln schloss. Er schenkte Lexi und Gina ein verlegenes Lächeln.
Als Erster sprang der sportliche Botelli aus dem Kahn auf den schmalen Anleger, der genau genommen lediglich aus drei Baudielen bestand, wie man sie vom Gerüstbau kannte. Der Mittvierziger wirkte geübt, als er ihre Fähre festmachte. Sobald er das Heck herangezogen hatte, verließen die beiden Studentinnen das Boot. Soccio überließ Portobello den Vortritt, zum Schluss gingen Franks und Conrad von Bord und folgten den anderen Archäologen zu dem quadratischen Bau, den man am ehesten als Torhaus bezeichnen konnte. Dieses Backsteingebäude überbrückte den schmalen Kanal und verband so die kleine Anlandeinsel mit dem eigentlichen Lazarett.
»Laut den Quellen wurde dieses unbebaute Stück Land im Mittelalter übrigens ebenfalls als Friedhof genutzt«, erklärte Soccio. »Auch hier wurde bereits prospektiert—vor dem Krieg. Zwar hat man keine großangelegte Grabungskampagne gestartet, aber die damaligen Untersuchungen lassen vermuten, dass kaum aufschlussreiche Befunde zu erwarten wären.«
»Warum nicht, wenn das hier ebenfalls als Bestattungsareal genutzt wurde?«, erkundigte sich Franks.
»Wegen des Wasserspiegels vermutlich«, antwortete Conrad für Soccio.
»Ja, dieses vorgelagerte Inselchen liegt kaum über der Wasserlinie«, bestätigte der Ausgrabungsleiter. »Alle Suchschnitte haben letztlich nur Knochenfragmente und eine Menge organischer Reste hervorgebracht, deren genaue Herkunft nicht mehr zu ermitteln war. Mit den damaligen Mitteln jedenfalls hätte sich eine Ausgrabung an dieser Stelle nicht gelohnt—und würde es wahrscheinlich auch heute nicht.«
Der Anthropologe nickte. »Außerdem haben wir auf der Hauptinsel ja einen reichhaltigen Friedhof, der aller Voraussicht nach nicht im Grundwasser steht.«
»Exakt«, antwortete Soccio knapp.
Hinter dem Torhaus öffnete sich vor ihnen ein kleiner Platz, umrahmt von den allgegenwärtigen Bauten aus rotem Backstein, mit einem Durchgang auf die große Freifläche, auf der sich in etwa siebzig Metern Entfernung ihre Grabungsfläche befand.
Soccio nickte nach links, wo eine Treppe zu einem auf Stelzen stehenden Geschoss hinaufführte. »Dort oben ist unser Fundlager. Erhöhter, befestigter Boden, regendichtes Dach—bei Weitem keine Selbstverständlichkeit hier—und keine Wandöffnung, die wir nicht verschließen können.« Er lächelte. »Das ist leider nicht unwichtig. Seit es ein paar Berichte über unsere Arbeit im Lazzaretto gibt, finden auch Neugierige und übereifrige Hobbyarchäologen den Weg hierher. Das bedeutet allerdings nicht, dass hier nicht eindringen könnte, wer über ein wenig kriminelle Energie verfügt. Nun ja, bisher gab es noch keinen größeren Ärger. Zur Sicherheit nehme ich die wichtigsten Funde nach der Voruntersuchung hier vor Ort mit ins Institut. Das hat sich bewährt.«
»Aha«, murmelte Conrad ungeduldig.
»In diesem komfortablen Gebäude werden Sie auch Ihr Feldlabor einrichten, Peter.«
»Und was ist da drüben drin?«, meldete sich Franks zu Wort und deutete auf den ebenso massiven Klinkerbau rechts von ihnen.
»Das haben wir nicht belegt. Es ist der westlichste Flügel des großen Lazarettkomplexes, der die gesamte Osthälfte der Insel einnimmt. Wir befinden uns im südwestlichen Teil. Durch dieses Gebäude«, er nickte in die Richtung, in die Lisa gezeigt hatte, »können Sie bis an die nordöstliche Spitze des Lazzaretto gelangen, ohne ins Freie zu treten.«
Conrad pfiff beeindruckt durch die Zähne und Franks nickte verständig. Währenddessen waren die vier italienischen Grabungsteilnehmer bereits in dem Gebäude vor ihnen verschwunden, das sie vom Vortag schon als improvisierte Kantine kannten.
»Lassen Sie uns bei einem frischen Kaffee die Lage besprechen«, forderte der Professor die beiden auf, ihm ins Innere zu folgen. »Oh, wir haben natürlich ein Dieselaggregat aufgebaut«, beantwortete er Conrads fragenden Blick. »Wie Sie sich vorstellen können, gibt es keinerlei Infrastruktur auf der Insel—und spätestens, wenn Sie Ihre Untersuchungen beginnen, werden Sie feststellen, dass ohne künstliche Beleuchtung nicht viel zu wollen ist.«
»Ja, die Gebäude wirken ziemlich düster«, murmelte Franks, als sie das Grabungshaus betraten, wo die anderen Ausgräber schon mit den Frühstücksvorbereitungen beschäftigt waren.
***
»Diese Fläche, Grube Nummer eins, ist unser aktuelles Grabungsareal. Wie Sie sich vermutlich denken können, erwarten wir weitere solche Befunde im gesamten westlichen Teil des Lazzaretto, vor allem im Norden, wo der reguläre Friedhof lag. Dort sehen Sie jetzt nur noch Mauerreste der einstigen Kirche Santa Maria di Nazareth. Dass wir südlich dieser Fundamente ähnliche Befunde haben, halte ich für ausgeschlossen, weil dieser Bereich stets als Garten oder Gemeinschaftsfläche zwischen den Verwaltungsbauten der Kirche und dem Lazarettkomplex angesehen wurde.«
»Das ist ja überschaubar«, resümierte Franks.
»Nicht ganz«, widersprach der Professor. »Westlich gibt es noch ein größeres Gebiet, das wir den 'Park' nennen. Wenn man sich die große Anzahl an zu beerdigenden Toten vergegenwärtigt, dann kann der zur Kirche gehörende Friedhof bei Weitem nicht ausgereicht haben—schon gar nicht während der akuten Phase einer Epidemie.« Er hielt kurz inne. »Um der Wahrheit die Ehre zu geben: Das nur so eine Idee von mir. Die Forschung sagt Nein; und man hat mir auch von anderer Stelle versichert, dass dort... nun, nicht die Befunde zu erwarten sind, die ich mir insgeheim wünsche.«
Mit einer ausladenenden Geste lenkte er ihren Blick nach Osten zu dem riesigen Lazarett, welches aus einem endlos langen Gebäude zu bestehen schien, das sich wie eine Krake über die halbe Insel ausgebreitet hatte; jedenfalls hatte es auf der Karte, die Soccio ihnen gestern präsentiert hatte, so ausgesehen. »Ob in den vier Innenhöfen dort Tote beigesetzt wurden, wissen wir nicht. Ich halte es aber für recht wahrscheinlich, denn zum einen ist auch der in Frage kommende Bereich des Parks nicht unendlich groß, zum anderen—und das ist erheblich wichtiger—liegt sein südlicher Teil zu nah an den Verwaltungsgebäuden. Der dürfte tabu gewesen sein.«
»Das leuchtet ein«, stimmte Conrad zu. »Die wollten sicherlich nicht hochinfektiöse Leichen direkt vor ihrem Arbeitsplatz begraben. Zwischen den Bettenhäusern werden die Betreiber des Lazaretts da weniger Manschetten gehabt haben.«
Soccio nickte zufrieden und stieg auf einen der schmalen Stege, die durch die Grube mit den Skeletten führten und eine Arbeit im Liegen erlaubten, ohne das Grabungsplanum mit dem empfindlichen Befund zu betreten. »Wir haben mit dem Einmessen, Fotografieren und Zeichnen schon begonnen. Ich nehme an, dass wir am Nachmittag selektiv erste Schädel und ein paar zugehörige Langknochen bergen können, um sie zu untersuchen.« Er sah zu dem Anthropologen. »Ob wir die finanziellen Mittel bekommen werden, alle menschlichen Überreste zu bergen, weiß ich derzeit noch nicht.«
»Statistisch wäre das aber schon interessant«, gab Conrad zu bedenken.
»Sicher«, seufzte Soccio und machte eine Geste der Hilflosigkeit. »Nur arbeitet niemand umsonst, selbst wenn die Grabungsgenehmigung kein Problem sein wird.«
Also... ich arbeite hier umsonst, dachte Conrad.
»Ist es normalerweise üblich, dass es mehr als Kost und Logis für die Ausgräber gibt?«, fragte Franks nach. »Oder habe ich da etwas falsch verstanden?«
Soccio überging diesen etwas pampig klingenden Nachsatz. »Nein, üblicherweise arbeiten auf den Grabungen Studenten, die mit Unterkunft und Verpflegung zufrieden sind—schließlich gehört diese Arbeit zu ihrer Ausbildung und macht sich gut im Lebenslauf.«
Conrad befürchtete schon, dass Lisa im Begriff war, eine Diskussion über die üppigen Bezüge von Universitätsprofessoren vom Zaun zu brechen, doch sie besann sich eines Besseren und lenkte das Gespräch in eine andere Richtung. »Dann werde ich mich mit Peter erst einmal nützlich machen und ein wenig freipräparieren. So gut ist mein Italienisch nicht, dass ich am Theodoliten stehen oder die Doku übernehmen könnte.«
Soccio nickte zustimmend, während Conrad sich ein wenig übergangen fühlte.
Lisa hockte sich auf die dicke Holzbohle und befühlte vorsichtig die Kalotte eines Schädels. »Am Nachmittag würde ich dann Peter beim Einrichten des Fundlabors und ersten Untersuchungen assistieren.«
Zu seiner Verwunderung schluckte der Professor aus Padua diese Eigenmächtigkeit ohne das geringste Zeichen von Unmut. »Ich denke, das funktioniert, Signorina Lisa. Sie sind sicher gut eingespielt.«
***
Bis zur Mittagspause arbeiteten alle außer Soccio und Portobello, der mit der Dokumentation im Grabungshaus beschäftigt war, auf der Fläche. Der Professor streifte währenddessen über das Friedhofsareal der verschwundenen Kirche und scharrte von Zeit zu Zeit mit dem Fuß auf dem staubigen Boden, als hoffe er, so neue Entdeckungen zu machen.
Conrad beobachtete, wie Lisa scheinbar völlig in ihre Aufgabe versunken abwechselnd Wasser aus einer Sprühflasche auf einem intakt aussehenden Schädeldach verteilte und dann vorsichtig abwischte, bis aller Dreck entfernt war, ohne die Knochensubstanz mechanisch zu belasten.
Streng genommen waren sie beide keine Archäologen im herkömmlichen Sinne. Er hatte im Hauptfach Anthropologie studiert und im Laufe der Jahre immer größeren Gefallen an der Feldforschung gefunden. Seine Kommilitonin, die als Ägyptologin typischerweise mit Büchern arbeiten sollte, hatte damals in Ägypten die Grabungskelle selbst in die Hand genommen und Blut geleckt. Seitdem waren die beiden Freunde oft zusammen unterwegs gewesen, um den Kitzel der Erstentdeckung interessanter Befunde immer wieder zu erleben. Dieser Kick blieb den meisten Schreibtischarbeitern verwehrt (und vor allem Ägyptologen waren in der Regel genau das, weil nur die wenigsten eine Grabungserlaubnis von der ägyptischen Altertümerverwaltung erhielten und Plätze auf Ausgrabungen rar und begehrt waren). Dabei vermissten viele dieser Kollegen nicht einmal etwas, wenn sie ihr akademisches Leben ausschließlich in Universitäten und auf Kongressen verbrachten. Diese Einstellung würde Conrad immer verschlossen bleiben...
»Hübsch, oder?«, meldete sich Franks. »Sieht der Kerl nach Pesttod aus?«
»Das ist eine Frau, Lisa.«
»Wie...?«
Für einige Sekunden genoss er ihren ungläubigen Gesichtsausdruck. »Das war ein Witz, Mann. Wie soll ich denn an einer polierten Schädelkalotte, die noch zur Hälfte in der Erde steckt, beurteilen, ob ich einen Menschen vor mir habe, der an der Pest gestorben ist?« Tatsächlich hatte er keine Vorstellung, wie das funktionieren sollte. Soweit er wusste, hatte man vor ein paar Jahren erstmals das Erbgut eines Bakteriums isoliert und untersucht—ob das für mittelalterliche Erreger und deren DNS auch möglich war? Wahrscheinlich nicht. Erbgut war empfindlich und bewahrte seine Informationen sicherlich nicht über so viele Jahrhunderte, dass man das Lebewesen bestimmen konnte, von dem es stammte. Und bevor man gefundene DNS irgendeinem Organismus zuordnen konnte, musste man ja die Muster kennen, die für ein bestimmtes Lebewesen charakteristisch waren. Conrad bezweifelte stark, dass das Erbgut von Yersinia pestis, dem Bakterium, das für die Pest verantwortlich war, überhaupt schon analysiert worden war...
Ganz abgesehen davon lag der Zugriff auf solch extrem teure Untersuchungsmethoden in weiter Ferne, besonders für so unwichtige Wissenschaften wie die Archäologie oder Anthropologie. Die Medizin und, wie es aussah, die Kriminalistik würden alle Ressourcen auf absehbare Zeit für sich beanspruchen. Vielleicht würde das einmal anders werden, doch sicher nicht während dieser Venedig-Kampagne mit der Universität Padua. Auch war sich Conrad sicher, dass die Pest keinerlei Veränderungen an der Knochensubstanz verursachen würde, die man mit den üblichen Werkzeugen seiner Wissenschaft nachweisen konnte. Dazu ging es von der Infektion bis zum Tod viel zu schnell. Bei der Lepra war das etwas grundlegend anderes. Da absorbierte der Körper im Lauf der Jahre (oft auch Jahrzehnte) des körperlichen Verfalls das zerstörte Gewebe. Finger und Fußknochen wurden kürzer und verkümmerten. Häufig unterlag sogar der Schädel starken Veränderungen. Auch die Syphilis ließ sich zumindest im Spätstadium sehr häufig anhand von Knochenbefunden nachweisen.
Aber die Pest? Nein, ob Opfer des Schwarzen Todes oder nicht—das würden die historischen Aufzeichnungen der Stadtschreiber und andere Quellen bestimmen.
Dafür konnte er mit seiner Arbeit wichtige Erkenntnisse über die Lebensumstände der Menschen in jeder Periode der Geschichte erarbeiten. Anthropologie hatte ausgesprochen viel mit Statistik zu tun, auch wenn so mancher Fachkollege gerne aus einem einzelnen unvollständigen Schädel eine neue Hominidenart zauberte... So etwas mochte für sensationslastige Zeitungsartikel oder Bücher ein Geschenk sein, das sich wunderbar vermarkten ließ; mit Wissenschaft hatte das jedoch nicht das Geringste zu tun. Trotzdem waren solche Märchen wie der Peking-Mensch nicht totzukriegen. Conrad seufzte lautlos.
Lisa hatte nicht weiter nachgehakt und widmete sich intensiv dem Vorbereiten der Funde, damit sie möglichst schonend geborgen werden konnten. Vielleicht dachte sie selbst darüber nach, wie der Nachweis einer Pestinfektion gelingen konnte. Er hielt das nicht (mehr) für unwahrscheinlich. Sie hatte von Anfang an wenige Berührungsängste mit menschlichen Überresten gezeigt. Auch wenn ihr bei Mumien immer noch unwohl war—für eine angehende Ägyptologin zumindest unpraktisch—bei Skeletten und Knochen war sie ihm schon des Öfteren bei Untersuchungen zur Hand gegangen. Und dabei hatte die Studentin eine Menge gelernt, was traditionell nicht als Gegenstand ihres Faches galt. Allerdings wurde es immer wichtiger, mehr zu können, als Hieroglyphen zu entziffern. Die wissenschaftliche Untersuchung auch von menschlichen Überresten hatte in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen.
»Hey, Lexi, von mir aus könnt ihr den Schädel jetzt einmessen und rausholen«, rief sie den beiden Studentinnen auf Englisch zu. »Ich begebe mich dann an seine–«, sie sah zu Conrad hinüber, der die Vorgänge neugierig beobachtete, ohne selbst zu arbeiten, und grinste, »ihre Langknochen.«
»Verstehst du, was der Soccio da drüben treibt?«
Sie sah auf und schüttelte den Kopf. »Nein, der schleicht schon den ganzen Vormittag rum, als suche er einen geheimen Zugang unter die Erde.«
»Wer weiß, vielleicht eine spirituelle Art der Prospektion«, murmelte Conrad und zuckte mit den Schultern.
»Der Professor vermutet, dass es dort noch weitere Massengräber geben könnte«, schaltete Lexi Panetta sich auf Englisch ein. »Irgendwie habe ich aber den Eindruck, ihm wäre es lieber, nichts zu finden.«
»Oh, ich wusste gar nicht, dass du so viel Deutsch verstehst«, bemerkte Conrad verwundert und dachte an die ratlose Miene, die Panetta im Boot gezeigt hatte. »Aber ja, du hast Recht. Besonders motiviert sieht er nicht aus... Was soll's. Ich freue mich jedenfalls darauf, an die Arbeit zu gehen.« Er wandte sich wieder Franks zu. »Lisa, hilfst du mir nachher bei der Inbetriebnahme des Labors? Ich möchte vor Feierabend wenigstens ein paar Knochen durchschauen.« Bevor Soccio sie mitnimmt, ergänzte er bei sich. Das war auch eine Methode, den Anthropologen einer Grabung auf Trab zu halten, dachte er.
»Natürlich, Chef. Sobald ich hier unten mit der Arbeit fertig bin«, antwortete ihm Franks mit gespielter Gereiztheit.
Conrad warf ihr ein Lächeln zu und schlenderte davon.
12
Wie spät mochte es sein? Mit unglaublicher Anstrengung hob er seinen Bleiarm und bemerkte erst jetzt, dass er mit dem Rücken gegen eine Mauer lehnte. Wie lange stehe ich wohl schon an dieser Wand?, fragte er sich. Er sich bemühte sich, den Blick so weit zu klären, dass er die Zeiger erkennen konnte. An den Lichtverhältnissen lag es nicht, denn er stand offenbar unter einer Laterne oder der Leuchtreklame eines der hunderttausend Touristenlokale. Drei... oder vier, eher vier; so genau war das nicht zu erkennen. Er fühlte sich hundeelend. Kein Wunder, wenn man in seinem Zustand die halbe Nacht lang durch die Gegend wankte. Er sah sich um. Wo war er? Soweit er erkennen konnte, sah es hier genauso aus wie vor dem Fischrestaurant, in dem er den ersten Teil dieses unerquicklichen Abends verbracht hatte. Berndorff atmete schwer und kämpfte gegen den unablässigen Schwindel und die stechenden Kopfschmerzen. Ich bin doch nicht im Kreis gelaufen, verflucht. Warum begegneten ihm keine anderen Menschen? Oder hatte er das in seinem Dämmerzustand nur nicht bemerkt? Sechs Stunden?, durchfuhr es ihn. Berndorff war sich sicher, dass es viertel nach neun gewesen war, als er in dieser Kaschemme das letzte Mal auf seine Automatik geschaut hatte. Das konnte nicht sein... Er war doch gerade erst losgegangen. Mein Gott, mindestens sechs Stunden. Das darf nicht wahr sein. Der quälende Hustenreiz gewährte ihm mittlerweile kaum noch Minuten zwischen den Anfällen. Erschöpft ließ er sich an der Mauer herunterrutschen und fiel in einen traumlosen Dämmerzustand.
Eine warme Berührung auf seiner linken Wange weckte ihn und brachte die mörderischen Kopfschmerzen zurück in sein Bewusstsein. Und immer noch drehte sich alles um ihn herum. Auch der Brechreiz war wieder da. Er öffnete die schweren Lider. Ein grelles Stechen traf seine Netzhaut; er kniff die Augen zusammen, trotzdem wurde es nur unmerklich dunkler. Er stöhnte. Sonnenaufgang? Unmöglich. Doch es musste so sein. Er hatte wohl die ganze Nacht auf dem Pflaster gesessen. Obwohl er nicht auf Zuhörer hoffen konnte, versuchte er, etwas zu sagen, doch sein Gehirn weigerte sich, irgendeinen Satz zu formulieren. Stattdessen schüttelte ihn ein Hustenkrampf. Er kippte zur Seite und ließ die blutige Flüssigkeit einfach aus dem Mundwinkel laufen; die Kraft zum Ausspucken hatte er längst nicht mehr. Als hätte es nichts mit ihm selbst zu tun, beobachtete er, wie sich der rote Schleimfaden langsam von der Erhöhung des Basaltpflasters in eine dunkle Fuge schlängelte und in der Tiefe verschwand. »Was um alles in der Welt habe ich nur getan...?«, stöhnte Berndorff, ehe sein Geist in endgültige Schwärze glitt.
13
Conrad umrundete die Grabungsfläche ohne jede Eile und streifte ein kleines Stück in die buschige Vegetation hinein, die sich nördlich an die Grabungsfläche anschloss. Wenn der Chef Zeit hatte, Löcher in den Boden zu starren, dann konnte er selbst auch noch entspannt bleiben. Diese Insel hatte etwas Besonderes. Es war völlig anders als seine bisherigen Ausgrabungen, denn obwohl sie wirklich nicht weit von lebhafter Zivilisation entfernt waren, herrschte hier angenehme Ruhe, und er beobachtete etliche Vögel, die sich offensichtlich hier niedergelassen hatten. Mediterrane Wärme, eine ruhige Arbeitsatmosphäre und trotzdem eine Stadt mit allen Annehmlichkeiten in Reichweite. So sollten eigentlich alle Ausgrabungen sein, fand Conrad. Nicht nur, weil er für Komfort zu haben war, sondern weil er es schon oft genug erlebt hatte, dass in abgelegenen Teilen der Welt irgendetwas fehlte oder den Geist aufgab, das sich dann weder beschaffen noch reparieren ließ. Und wenn er zwischen arktischer Kälte und der Hitze der Sahara wählen musste... würde er genau die Mitte wählen, und da war Venedig verdammt nah dran.
Lisa hatte völlig recht. Wieso konnte er eine Grabung, an der es—er musste es einsehen—einfach nichts auszusetzen gab, nicht als günstigen Wink des Schicksals nehmen? Er hatte doch in den letzten Kampagnen mehr als genug Ärger erlebt. Wahrscheinlich lag genau darin sein Misstrauen begründet...
Conrad hatte wieder die Ecke südwestlich der Grabungsfläche erreicht, wo sich der Innenhof mit ihrem 'Frühstücksraum' anschloss. Er entschied, einen ersten Blick in den Bereich zu werfen, den Soccio für ihn vorgesehen hatte. Das Gebäude, auf das der Professor gezeigt hatte, war auf Stelzen gebaut, erhob sich aber keine ganze Etage vom Boden. Wer immer es gebaut hatte, wollte offenbar dafür sorgen, dass es darin immer trocken blieb, was Conrad nur begrüßen konnte. Seine Laune verbesserte sich weiter, als er das dicke, schwarze Kabel entdeckte, das sich aus dem Nachbargebäude durch ein Fenster schlängelte. Soccio hatte sogar schon die versprochene Elektrifizierung vorbereitet. Conrad wollte eben die alte Steintreppe mit dem gemauerten Geländer hinaufsteigen, als er einen Bootsmotor hörte, der immer lauter wurde.
Er wandte sich von der Stiege ab und trat stattdessen in das Torhaus. Im Sonnenlicht auf der kleinen Insel sah er die Anlegestelle, wo in diesem Moment ein kleines Boot neben dem des Grabungsteams festmachte. Ein einziger Blick sagte ihm, was er hier vor sich hatte, und Conrad machte instinktiv einen Schritt zurück in den Schatten. Genau das hat uns gefehlt. Es war ja auch zu ruhig, um wahr zu sein.
»Ah, signor!« Eine rundliche, gedrungene Gestalt hatte mit der routinierten Eleganz des Laguneneinheimischen den festen Boden betreten und irgendwie sofort den Beobachter im dunklen Tor erspäht. Der Mann winkte Conrad eifrig zu und wieselte im nächsten Augenblick auch schon zu ihm. Währenddessen kämpfte der zweite Mann im Boot sichtlich damit, eine Kameraausrüstung unbeschadet auszuladen. »Signor...«
»Es tut mir leid«, log Conrad, als der Mann vor ihm zum Stehen kam, »ich spreche leider kein Italienisch.«
»Oh, aber das macht doch nichts«, kam es wie aus der sprichwörtlichen Pistole geschossen und in einem zwar stark akzentgefärbten, aber glänzend verständlichen Deutsch.
Conrads Gesichtszüge entglitten. Er nickte mechanisch, während der andere ihm hektisch die Hand schüttelte und einen Wortschwall auf ihn niedergehen ließ. Cristiano Pedulla, Reporter der Rai 3, arbeitete gerade für die TGR, die Regionalnachrichten. Und von der Ausgrabung der Universität Padua musste doch berichtet werden, schließlich sei das genau nach dem Geschmack der Einheimischen: Abenteuer, Geheimnisse, Krankheit, Drama und Tod.
»Ich nehme an, Sie sprechen von den Befunden hier auf der Insel und nicht von unserer Kampagne«, knirschte Conrad, dem die 'Dramatik' des Reporters jetzt schon aufstieß.
Pedulla lachte und wischte sich über die hohe, breite Stirn. Seine tiefliegenden Augen aber erschienen Conrad mit einem Mal gar nicht amüsiert.
»Ah, morbide Geschichten funktionieren zu allen Zeiten. Speziell hier in der Lagune, und gerade jetzt sind die Leute ja sowieso beunruhigt wegen dieser sonderbaren Todesfälle. Sie haben davon gehört.« Da der Reporter keine Frage daraus gemacht hatte, ließ Conrad das unkommentiert stehen. Er versuchte, sich zu erinnern, ob Lisa ihm irgendetwas in der Art erzählt hatte. »Wir haben gut zu tun. Ich sage Ihnen, dieses Land hat uns Journalisten jetzt nötiger als je zuvor.« Pedulla plusterte sich zur Untermalung seiner eigenen Wichtigkeit noch einmal sichtlich auf. »Deutschland hat gute Journalisten, aber wir hier auch. Und unter uns, wir sind uns sicher, dass da etwas vertuscht–«
»Signor Pedulla. Ich bringe Sie besser zu unserem Grabungsleiter, Professor–«
»Professore Soccio!« Der Reporter wandte sich mit einem breiten Lächeln zum Leiter der Ausgrabung zu, der just in diesem Moment das Torhaus betrat.
»Cristiano.« Soccio lächelte und reichte dem Reporter die Hand. Wohl aus Rücksicht auf Conrad fuhr er auf Deutsch fort: »Ich habe schon einen hübschen Platz für uns ausgesucht. Mit ein bisschen Geschick kriegst du während des Interviews sogar die Skelette auf der Grabung schön mit ins Bild.«
»Gino, es ist mir immer ein Vergnügen mit Leuten zu arbeiten, die mitdenken«, lobte Pedulla. Dann wandte er sich um und brüllte etwas auf Italienisch zu dem jungen Mann am Boot, der mit wilden dunklen Locken auf die Lagune hinausblickte, jetzt aber zusammenfuhr.
»Scusi, Signore Pedulla, io...«
Und da hörte es mit Conrads Italienischkenntnissen dann auch schon auf. Falls Soccio geglaubt hatte, ihn mit dem Filmbericht über ihre Grabung beeindrucken zu können, hatte er sich geschnitten. Und schon gar nicht beeindruckend fand Conrad, dass Soccio sich den ganzen Vormittag offenbar mehr Gedanken über die perfekte 'Location' für die Fernsehaufnahmen gemacht hatte als über seine Ausgrabung... Oder spann er sich da jetzt aus Widerwillen gegen den Reporter bloß etwas zusammen? Es wäre jedenfalls seltsam, wenn der Grabungsleiter sich in dem öden Strauchwerk interviewen lassen wollte, in dem er verschwunden war, oder? Konzentrier dich doch einfach auf die Arbeit und lass dem Soccio seine fünf Minuten Ruhm, mahnte er sich, wobei die Stimme ziemlich nach Lisa Franks klang. Die würde sich wahrscheinlich vor allem darüber aufregen, dass Soccio sich als großen Forscher präsentieren würde, während das Team, das die meiste Arbeit leistete—wenn überhaupt—in einem zweisekündigen Schwenk über die Grabungsfläche im Bericht erschien.
Das erwartete Spektakel dauerte etwas weniger als eine Stunde. Soccio, so viel war klar, war wirklich ein Medienprofi. Eigenartigerweise hatte Conrad aber den Eindruck, dass ihm Pedullas Gegenwart nicht gänzlich willkommen war. Eine gewisse Anspannung schien den Professor erfasst zu haben, die Conrad vorher überhaupt nicht wahrgenommen hatte.
Lisa verfolgte die Vorgänge mit eifrigem Augenrollen, beobachtete aber ganz offenkundig lieber den Kameramann als die beiden Herren im gesetzteren Alter, die sich ausladend gestikulierend vor der Kamera unterhielten. Wahrscheinlich würde das Ganze auf einen Fünfminüter zusammengeschnitten und bloß irgendwo im Vorabend des hiesigen Regionalprogramms laufen, dachte Conrad. Aber Soccio legte sich ins Zeug, als hätte er ein Filmteam aus den Vereinigten Staaten zu Gast. Fehlendes Engagement für seine Kampagne konnte man dem Professor in dieser Hinsicht wahrlich nicht vorwerfen.
»Ich hoffe, die sind bald fertig, ich wollte dir doch was zum Arbeiten aus der Fläche pulen.«
»Was erzählt Soccio da eigentlich so lange? Um unsere Ergebnisse kann es ja wohl nicht gehen, wenn er länger als zehn Minuten sprechen kann.«
Lisa stieß ihm den Ellenbogen in die Seite. Pedulla hatte das ganze Team nachdrücklich um Ruhe gebeten, weshalb die meisten für einen Snack in die provisorische Kantine verschwunden waren.
»Soweit ich folgen kann, ist es dieselbe allgemeine Story, die er uns auch erzählt hat, gewürzt mit ein paar Unappetitlichkeiten zur Pest und zum grausigen Schicksal der Patienten hier im alten Lazarett.«
»Und die Show ist vorbei, Applaus«, murmelte Conrad ihr zu, als Pedulla sich mit gewichtigem Gesichtsausdruck der Kamera langsam näherte und dabei eine Abmoderation lieferte, wie unabhängig von der verwendeten Sprache klar erkennbar war. »Ich glaube, ich verziehe mich mal in das künftige Labor, bevor ich den Vogel noch herzlich verabschieden soll.«
***
Gegen halb fünf bemerkte Conrad, dass draußen eine gewisse Unruhe herrschte, und verließ das Gebäude. Er war mit den Vorbereitungen für die Voruntersuchungen sowieso fast durch. Soccio stand mit Botelli, Panetta, ihrer Freundin Gina Sandrelli, Lisa Franks und sogar Portobello (den Conrad den ganzen Tag über noch nicht außerhalb des Grabungshauses gesehen hatte) am Rand des Gebietes, das er als ehemaligen Friedhof bezeichnet hatte, und diskutierte mit den Studenten.
»Was ist denn das für ein Auflauf?«, erkundigte sich Conrad bei Lisa.
»Kurz nachdem du im Fundhaus verschwunden bist und der Reporter abgerauscht war, hat Soccio mit Andrea, Gina und wohl auch Lexi an mehreren Stellen entlang der Einfassungsmauer gegraben.« Sie wandte sich wieder der Unterhaltung zwischen Botelli und dem Professor zu.
Conrad zupfte ungeduldig an ihrem T-Shirt. »Ja, und?«, zischte er ihr ins Ohr.
»Gleich. Sei nicht so ungeduldig. Ich versuche mitzubekommen, was da los ist.«
Er kam sich wie das fünfte Rad am Wagen vor, weil er kein Wort der Diskussion verstand. Eines schien aber klar: Es ging um die frisch ausgehobenen Suchlöcher, und anscheinend waren Soccio und die Studenten über irgendetwas uneins. Botelli schien ihm der Wortführer auf Seiten der Ausgräber. Verlegen trat Conrad einen Schritt zurück und sah sich um, konnte aber nichts entdecken, was diesen Aufruhr rechtfertigen würde. Niemand nahm Notiz davon, als er sich auf Erkundungstour in die angedeutete Richtung machte. Um das eigentliche Friedhofsareal, an das ihre rund zwanzig Quadratmeter große Ausgrabungsfläche grenzte, schien es nicht zu gehen. Er hatte am Vormittag mitbekommen, wie der Professor dieses Areal oberflächlich prospektiert hatte. Das Gebiet war bis zur nördlichen Umgrenzung eben, weitgehend vegetationsfrei und ließ selbst bei genauerer Betrachtung keinerlei Spuren von Grabungsaktivitäten erkennen. Offensichtlich lag der Stein des Anstoßes an anderer Stelle.
Conrad schlenderte in Richtung der Bäume im Westen der Insel, den Soccio als Park tituliert hatte. Auch hier standen Grundmauern, oder vielmehr Mauerreste, in Verlängerung des Gebäudes, das sie als Grabungshaus nutzten. Dahinter befand sich eine verbuschte Brachfläche von schätzungsweise hundert auf dreißig Metern, die umso karger wurde, je mehr man sich dem Wasser der Lagune näherte, das sich hinter der durchgehenden Steinumfassung erstreckte. Um diesen kahlen Streifen ging es wohl.
Als er die bröckelige Ziegelmauer, die die Lazarettinsel im Westen umgab, schließlich erreicht hatte, wandte er sich nach rechts und stand nach wenigen Metern am Rand eines grobschlächtig ausgehobenen Loches. Er beschloss, es auf dem Rückweg zu untersuchen. Zunächst jedoch schritt er die Einfassungsmauer in südlicher Richtung ab.
Hab ich's mir doch gedacht. Soccio und seine Leute hatten auch hier eine Grube von der Größe einer herkömmlichen Duschtasse ausgehoben. Angestrengt blickte Conrad in das südliche Loch, konnte jedoch auf die Schnelle nichts entdecken, was auf menschliche Anwesenheit schließen ließ. Er sah auf; dieser Suchschnitt lag kaum zwanzig Meter von seinem Fundhaus entfernt.
Ein wenig enttäuscht drehte er wieder um und kehrte zu dem Loch zurück, das die Studenten etwa auf halber Länge der Ziegelmauer ausgehoben hatten. Auf den ersten Blick gab es auch hier nichts Interessantes. Doch als er kurzentschlossen hineinstieg und ein wenig Erde beiseite gewischt hatte, erkannte er einen Langknochen sowie etwas faseriges Gewebe, vielleicht Kleidungsreste; und dann noch kleinere Knochenstückchen, die er spontan der Mittelhand beziehungsweise einem Fuß zugeordnet hätte. Unwillentlich pfiff er leise durch die Zähne und hievte sich umsichtig aus der Grube. Ohne eine nähere Untersuchung war das nicht zu beurteilen, doch der Aufregung nach zu schließen, die der Befund verursacht hatte, dürfte es sich wohl um menschliche Überreste handeln.
Gerade als er sich auf den Weg in die nordwestliche Ecke der Lazarettinsel machen wollte, wo er eine dritte Ausschachtung vermutete, hörte Conrad einen aufgebrachten Soccio hinter sich.
»Niemand fummelt an diesen Sondierungslöchern, bevor ich es sage!«, rief er Conrad hinterher. »Auch Sie nicht, Peter!«
Der Anthropologe blieb stehen und überlegte einen Moment, ob er sich über die Anweisung des Grabungsleiters hinwegsetzen sollte. Er entschied sich dagegen, obwohl er angesichts einer ähnlichen Situation schon einmal die Brocken hingeworfen hatte und nach Hause gefahren war... Aber sie waren nicht ohne Grund nach Venedig gefahren, und Lisa würde ihm den Kopf abreißen, wenn diese Kampagne in einem Eklat endete. Mit einem resignierten Schulterzucken drehte er sich um und folgte dem mürrisch dreinblickenden Soccio zurück zu den anderen, die immer noch aufgeregt debattierten.
»Also?«, raunte er Lisa zu, nachdem die nach einer gefühlten Ewigkeit noch immer keine Notiz von seiner Rückkehr genommen hatte.
Sie stöhnte genervt auf und zog ihn ein paar Meter beiseite. »Also, nachdem der Pressemensch weg war, ist der Professor wohl auf der Fläche hinter dem Park prospektieren gegangen. Vor schätzungsweise zwei Stunden hat er dann Andrea, Lexi und Gina zu sich gerufen und den alten Portobello zu mir geschickt, damit wir die Einmessung und Doku alleine weitermachen. Er hat die drei offenbar irgendwelche Sondierungslöcher ausschachten lassen und–«
»Jaja, die habe ich gesehen. Zwei, beziehungsweise drei an der westlichen Umfassungsmauer«, setzte er sie ins Bild. »Wenn du mich fragst, dann sind da... durchaus interessante Befunde zu erwarten. Aber ich kann mich auch täuschen. Der Soccio hat mich von dem Loch verscheucht, bevor ich Genaueres herausfinden konnte.«
Sie zog erstaunt die Brauen hoch. »Dass da schon was aufgetaucht ist, davon war bisher keine Rede... Nun, jedenfalls kamen die vor einer halben Stunde zurück und begannen hier drüben eine Unterhaltung, die sich innerhalb von Minuten zu der lautstarken Diskussion entwickelt hat, die dich aus dem Fundhaus gelockt hat.«
»Und? Jetzt lass dir nicht jedes Wort aus der Nase ziehen, verdammt«, raunte Conrad.
»Der Professor hat seine Helfer angewiesen, die Löcher gleich morgen früh wieder zuzuschütten und festzustampfen, nichts weiter.«
»Ach«, murmelte Conrad und sah hinüber zum Park. »Verstehe.«
»Verstehe was?« Jetzt war es Franks, die einen genervten Tonfall anschlug. »Du verstehst... was?«
»Na, warum die anderen so aufgeregt mit ihm diskutieren«, sagte er nachdenklich und wandte sich dann noch leiser an sie: »In der einen Grube, in die ich schauen konnte, der mittleren, befinden sich Knochen. Vermutlich menschliche Knochen.«
***
»Reichst du mir jetzt noch den Mikroskopkoffer?«
Franks zog die schwarze Holzkiste zu sich heran und wuchtete sie auf den Tisch. Auf der anderen Seite der großzügigen Arbeitsfläche, die Conrad am Nachmittag aus Holzböcken und alten Türen zusammengestellt hatte, nahm der Anthropologe den Deckel ab und positionierte das Gerät so, dass sein Rücken das durch die Ritzen der Fensterläden dringende Tageslicht abschirmen würde, wenn er vor dem Lichtmikroskop saß.
Als Nächstes brachten sie die verbliebenen sechs Schreibtischlampen an den Türtischkanten an, und Conrad freute sich, dass Soccio heute ausnahmsweise ihm das Abschalten des Stromgenerators überlassen hatte. Das kräftige Dieselaggregat befand sich im Anbau des Grabungshauses, weil dort die Belüftung wesentlich besser war als im größeren Fundhaus, in dem er sein provisorisches Knochenlabor einrichtete. Instinktiv griff er in die linke Gesäßtasche und stellte erleichtert fest, dass der Schlüssel für den Schuppen, in dem das Aggregat arbeitete, noch da war.
Lisa zog einen Stapel Pappen aus einem der hohen Wandregale, in denen sie vor allem die Funde zwischenlagern würden.
»Was hältst du davon, wenn du uns noch ein Abendkäffchen brühst, bevor wir mit den Fundkartons loslegen? Ich denke, wir sollten die Gelegenheit nutzen, heute Abend länger Strom zu haben.«
Sie ließ die gestanzten Pappen auf den Tisch fallen und machte auf dem Absatz kehrt, ohne etwas zu erwidern.
»Ich stelle währenddessen schon mal das Mikroskop richtig ein, damit wir keine Zeit verlieren«, rief er ihr entschuldigend hinterher, obwohl er wusste, dass das keinen Zweck hatte. Er setzte sich und stellte fest, dass der hölzerne Drehhocker sich nicht hoch genug schrauben ließ. Dabei war dieses Teil schon die höchste Sitzgelegenheit. Leise fluchend machte er sich auf die Suche nach einer Unterlage. An der westlichen Giebelwand wurde er fündig: Eine große quadratische Pflasterplatte aus Beton, wie sie gewöhnlich für Gehwege Verwendung fand, war genau das Richtige. Ächzend schleppte er das Ding zu seinem Labortisch und unterstützte es an allen vier Ecken zusätzlich mit Backsteinen aus dem Torhaus, die sie am Nachmittag herübergetragen hatten und die auf der Lazarettinsel ausnahmsweise keine Mangelware waren. Gerade als er im Begriff war, die Okulare des Stereomikroskops auf seine Dioptrinzahl einzustellen, kam Lisa mit einem Karton zurück, in dem sich Tassen, Thermoskanne und eine Rolle Kekse befanden.
»Vielen lieben Dank. So werden wir die Knastarbeit des Kartonfaltens gut überstehen«, versuchte er, schönes Wetter zu machen, und holte vier weitere Zehnerpacks mit Wellpappen aus einem der blechernen Schwerlastregale, wie sie Baumärkte seit einigen Jahren überall auf der Welt anboten—und in die man natürlich niemals wirklich schwere Lasten legen durfte, wollte man eine Katastrophe vermeiden.
Franks versorgte sich mit einem Heißgetränk und begann mit dem Zusammenstecken der Kartons. Nach wenigen Minuten schien ihr Unmut verraucht, denn sie ging nicht auf seine Unverschämtheit von vorhin ein; vielmehr beschäftigte sie noch immer der nachmittägliche Tumult. »Wie es aussieht, hat unser Professor gefunden, was er vermutet hat.«
»Ja, das würde ich auch sagen«, entgegnete Conrad erleichtert. »Nur hat er nicht so reagiert, wie ich es erwartet hätte. Auf mich hat er einen ziemlich unzufriedenen Eindruck gemacht... Ich meine, was würdest du denn machen, wenn deine Spürnase sagt, dass es abseits des bisherigen Fundgebietes weitere ergiebige Grabungsmöglichkeiten gibt?« Bevor sie etwas dazu sagen konnte, legte er nach. »Klar. Du machst eine Prospektion und legst an aussichtsreichen Punkten ein paar Suchschnitte an. Und dann–«
»Und dann findest du tatsächlich exakt das, was du gesucht hast«, unterbrach sie ihn.
Er nickte heftig. »Ja, genau. Wenn das für einen grabenden Archäologen kein Grund zur Freude ist, was dann? Aber was macht Professor Soccio? Der zieht ein langes Gesicht und lässt alles wieder zuschütten.« Er goss sich Kaffee nach und rührte Milchweißer ein. »Vielleicht deute ich sein Verhalten auch völlig falsch und er ist schlicht aufgeregt oder ein bisschen überfordert. Es ist nicht unnormal, dass eine Sondierungsgrabung abgedeckt wird, um Befunde zu sichern und sich die Ausgrabung für eine spätere Kampagne aufzubewahren. Und ich verstehe auch, dass in so einer Situation jeder Jeck anders reagiert... Aber der Kerl will sie wieder zuschütten und festtrampeln lassen?« Conrad tippte sich gegen die Stirn. »Die sicherste Methode, um filigrane Befunde für immer zu zerstören und die Stelle im Zweifelsfall nächstes Jahr nicht wiederzufinden.« Er trank einen Schluck und schüttelte den Kopf. »Ich kann ohne Weiteres nachvollziehen, dass die Studenten mit diesem Vorgehen alles andere als einverstanden waren. Ich hätte auch mitdiskutiert, wenn ich etwas verstanden hätte.«
Franks schüttelte ebenfalls das Haupt. »Mein Eindruck ist, dass Soccio sehr bestimmt reagiert hat. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann war er nicht überfordert...«
»Sondern?«
»Ernsthaft beunruhigt, besorgt. Wenn es nicht so theatralisch klänge, würde ich seine Reaktion als alarmiert bezeichnen.« Sie dachte kurz nach. »Irgendwie habe ich den Eindruck, er hatte gehofft, letztlich nichts zu finden.«
»Oder etwas völlig anderes.« Conrad zuckte mit den Schultern, sah auf seine G-Shock und brachte das Gespräch zurück auf ihre eigentliche Aufgabe. »Wir haben noch gut drei Stunden, bevor der Professor uns netterweise von der Insel holt. Ich möchte ihn nicht warten lassen.«
»Der holt nicht uns ab, sondern seine Funde«, murrte Franks leise.
14
»'Rätselhafter Toter Nummer drei'. Wie sind die verdammt nochmal an Zarelli gekommen?« Commissario Mancini warf die Zeitung auf Ingrossatos Schreibunterlage. »Wo kommen wir hin, wenn sich jeder über polizeiliche Anordnungen hinwegsetzt?«
Mancinis Ermittler zog die Schultern hoch. »Ich habe dem Zeugen, so deutlich es ging, eingeschärft, dass er Stillschweigen zu bewahren hat und mit niemandem über seine Beobachtungen sprechen soll, schon überhaupt nicht mit der Presse.« Er faltete das hellgrüne Blatt und schob es in ein unteres Fach seiner Ablage, um seinen Vorgesetzten nicht noch unleidlicher werden zu lassen. »Sogar Strafen für den Fall, dass er zuwiderhandelt, habe ich... erfunden.«
»Und wieso quatscht das verdammte Arschloch dann?« Mancini stellte sich an das Fenster und blickte in den trostlosen Innenhof hinunter. Es war immer dasselbe... »Am liebsten würde ich den Kerl in Gewahrsam nehmen lassen.«
Ingrossato wiegelte ab: »Es muss doch gar nicht Zarelli gewesen sein. Vielleicht hat der Kellner gequatscht oder ein Gast, oder der Wirt ist die undichte Stelle. Da gibt es–«
»Unsinn!«, fuhr der Commissario dazwischen. »Die Gazzettino hat mit Stefano Zarelli gesprochen. Wenn der sich nicht selbst bei der Presse gemeldet hat, dann bleibt ja nur noch die Möglichkeit, dass wir einen Maulwurf in unseren Reihen haben.«
Ingrossato stöhnte und schwieg.
Es stimmte, das Thema hatten sie schon bei diesen Fällen in Turin und Mailand durchgekaut und waren zu keinem Ergebnis gekommen. In der Bevölkerung hatte sich Beunruhigung und zunehmend Groll auf die ermittelnden Behörden ausgebreitet. Und angesichts der nicht stattfindenden Öffentlichkeitsarbeit war das nur zu verständlich. Doch hätte man den Menschen den wahren Grund für die Geheimniskrämerei der Staatsanwaltschaften mitgeteilt, wäre die Situation womöglich eskaliert. So hatte man sich für die Öffentlichkeit auf eine gewisse Unfähigkeit geeinigt: Die italienische Polizei war mal wieder nicht in der Lage, ihre Bürger im Ernstfall zu beschützen.
»Soll ich Zarelli einbestellen?«
Mancini winkte ab. »Unsinn, ich bin nur frustriert. Was mich wirklich beunruhigt, ist die Tatsache, dass die Presse so schnell Zusammenhänge herstellt und sich darauf versteift.«
»Das ließ sich wohl kaum vermeiden, wenn nun in der dritten Stadt ungeklärte Todesfälle in Reihe auftauchen.« Ingrossato ging hinüber zum Waschbecken und ließ Wasser in ein Glas laufen. »Journalisten sind nicht unbedingt blöde, nur weil wir die meisten nicht ausstehen können. Komm schon, Bruno.«
»Das weiß ich doch. Aber warum basteln die eine Verbrechensserie daraus? Es war nicht einmal ein Dutzend Opfer—in Mailand und Turin zusammen.« Mancini schüttelte unwillig den Kopf und ging dann an seinen Platz zurück. »Keinen einzigen Toten haben die Staatsanwaltschaften bisher offiziell mit einer Straftat in Verbindung gebracht.«
»Die Antwort ist Sensationsgier. Verbrechen verkauft sich eben besser.«
»Du weißt, was ich meine, Salvo. Wie kommen die darauf? Im Sommer sterben die Leute in den Städten wie die Fliegen, wenn es ordentlich heiß wird...« Er ließ seine Überlegung unvollendet, weil sie auch ihn nicht zu überzeugen vermochte. »Verdammt, wir müssen das in den Griff kriegen.«
»Oder hoffen, dass es aufhört und schnell in eine andere Stadt wechselt«, bemerkte Ingrossato lakonisch. »Lass uns das Thema wechseln«, schob er schnell hinterher, um die Laune seines Vorgesetzten nicht noch weiter zu verschlechtern. »Es gibt ein paar Neuigkeiten von Professoressa Bellucci.«
»Wissen wir denn mittlerweile wenigstens, wie er heißt?«
»Äh, ja, Moment.« Ingrossato blätterte in der dünnen Akte zurück. »Der Mann hieß Henry Williams. Er ist siebenundvierzig Jahre alt geworden, stammte aus den Vereinigten Staaten, aus Madison im Bundesstaat Wisconsin. Witwer, beide Kinder aus dem Haus. Er reiste alleine. Das Konsulat war erstaunlich hilfreich... Ist man ja sonst von den Amerikanern nicht gewöhnt.«

»Es geht um einen ihrer Staatsbürger.« Mancini schob die Mitteilung der Botschaft in die Ermittlungsakte zurück und betrachtete nachdenklich die Lageskizze, die Agente Righera noch am gleichen Abend angefertigt hatte. »Warte mal ab, wie ungemütlich die werden, wenn wir denen nicht schnell eine überzeugende Aufklärung bieten können.«
»Das musst du mir nicht sagen«, murmelte der Polizist. »Aber zur Sache: Wie wir schon vermutet haben, ist der Mann nicht im Kanal ertrunken, und er weist auch keine äußeren Verletzungen auf. Es gab keinen Kampf oder ähnliches. Keine Hämatome. Die Professoressa lässt sich so weit ein, dass alle äußerlichen Auffälligkeiten post mortem entstanden sind, wahrscheinlich durch das Treiben im Wasser und–«
»Jetzt erzähl mir nicht, der Mann sei eines natürlichen Todes gestorben. Komm auf den Punkt, Salvo.«
»Nein, das wäre zu schön... Williams ist an einer Grippeinfektion gestorben. Die Bellucci ist sich sicher. Aber auf Spezifischeres wollte sie sich noch nicht festlegen lassen. Als ich allerdings zum wiederholten Mal nachgebohrt habe, wieso er denn nicht einfach Opfer einer ganz normalen Sommergrippe geworden sein könnte... Nun, jedenfalls spricht sein körperlicher Allgemeinzustand dagegen, und er gehörte keiner Risikogruppe an. Jedenfalls muss es rasend schnell mit ihm zu Ende gegangen sein...«
»Also vielleicht auch etwas, das man mit einer Grippe verwechseln kann«, mutmaßte Mancini.
»Nein, nein«, entgegnete sein Assistent. »Wie schon gesagt, bei der Grippevermutung ist sich die Professoressa 'todsicher'. Sie wollte noch die mikrobiologischen Untersuchungen abwarten, aber... sie vermutet, dass es sich um die Spanische Grippe handelt.«
»Katastrophe«, war das Erste, was Mancini dazu einfiel.
15
»Wir beide messen weiter ein und holen das Zeug aus der Erde?«, fragte Lexi Panetta und prostete Franks mit der Kaffeetasse zu. »Hat doch gestern ganz ordentlich funktioniert.«
»Wenn das für den Professor okay ist, liebend gerne«, antwortete sie. »Was machen die anderen?«
»Gina nimmt Lorenzo an die Hand. Die pinseln hauptsächlich«, erklärte die Studentin. »Wir sitzen also zu viert auf der Fläche.«
»Ich sorge auch für die Doku, wenn ihr später bei uns einmesst«, ergänzte Portobello lächelnd.
Conrad zog das letzte Croissant aus der Frühstückstüte. »Und was ist mit Botelli?«
Lexi grinste. »Wie man sich hätte denken können, hat sich unser Fitnessfanatiker dazu bereit erklärt, die drei Sondierungsgruben wieder zuzuschaufeln. Ich glaube, er ist schon fleißig. Ich habe ihn vorhin Richtung Park gehen sehen.«
»Ach, das ist doch alles Kacke«, protestierte der Anthropologe zum wiederholten Male. »Was soll denn das? Die machen doch mehr kaputt, als wenn man das einfach notdürftig mit Folie abdeckt.«
Die Ausgräberin mit dem raspelkurzen Haar zog die Schultern hoch. »Das musst du mir nicht sagen, aber Gino ist der Boss. Wir haben das schon diskutiert.«
»Trotzdem stimmt da was nicht«, meinte Franks leise und zog nachdenklich die Maserung des groben Holztisches mit einem Filzstift nach.
»Wo ist Meister Soccio eigentlich? Der hätte uns wenigstens erklären können, was er vorhat«, murrte Conrad. »Jaja, ich weiß, ich sollte mich nicht aufregen. Die nächste Zeit wird die Grabungsfläche reichen, da kommt genug Material für mich raus...«
»Muss ich also davon ausgehen, dass du mir einmal mehr nicht beim Freilegen deiner Knochen hilfst?«, lamentierte seine Kommilitonin. »Lexi muss schließlich die meiste Zeit am Theodoliten stehen...«
Conrad verdrehte die Augen. »Ich setze mich zu dir.« Er schenkte sich Kaffee nach und erhob sich. »Ich organisiere meinen Kram noch schnell so, dass wir das heute Nachmittag nicht machen müssen, und bringe Messer und Kelle mit. Dann komme ich rüber auf die Fläche.«
»Aye, aye«, salutierte Franks zufrieden.
Er brach sich keinen aus der Krone, wenn er mitputzte. Eigentlich machte ihm diese Tätigkeit sogar Spaß, aber auf den üblichen Ausgrabungen des Berliner Institutes musste man immer aufpassen, sich nicht zu sehr mit den Studenten zu fraternisieren, sonst war man ganz schnell im Einzugsgebiet des Grabungsleiters oder—wenn man selbst die Aufsicht hatte—keine Respektsperson mehr. Und eine zu selbstbewusste Grabungsmannschaft konnte wirklich niemand gebrauchen, wenn es vorangehen sollte.
Als er an Soccios improvisiertem Büro vorbeikam, das dieser in einem schmäleren Anhängsel am Eingang des Grabungshauses eingerichtet hatte, vernahm er die Stimme des Professors. Hier steckt der Kerl also. Wahrscheinlich hatte er keine Lust gehabt, auf der alltäglichen Frühstückstagung Rechtfertigungen für seine gestrige Entscheidung liefern zu müssen... die vermutlich sowieso recht wenig genützt hätten. Diskussionen hätte es auf jeden Fall gegeben. Kein Archäologe ließ freiwillig eine vielversprechende Gelegenheit auf interessante Befunde aus.
Aber... mit wem sprach der Grabungsleiter eigentlich? Botelli war ja angeblich mit dem Zuschütten der westlichen Suchlöcher beschäftigt. Soccio telefonierte, ging es Conrad auf. Ihm war gar nicht klar gewesen, dass sie hier ein Telefon hatten. Auf den meisten Kampagnen gab es keines; was in diesem Fall auch kein echtes Problem gewesen wäre, weil das Lazzaretto Vecchio kaum hundert Meter vom Festland entfernt lag. Vorsichtig linste er durch die halboffene Tür, um zu verstehen, worum es ging. Soccio telefonierte mit einem dieser sündhaft teuren Mobiltelefone, die ohne Koffer und Tasche auskamen und genau genommen nur aus einem (zugegebenermaßen riesigen) Hörer mit gummierter Stummelantenne bestanden. Die meiste Zeit schwieg der Archäologe, und aus seinen Reaktionen schloss Conrad, dass er nicht der Boss des Gespräches war. Jedenfalls hatte er den Eindruck, dass Soccio Bericht erstatte und womöglich Anweisungen erhielt. Er lauschte einige Minuten angestrengt, konnte sich jedoch vom Inhalt nichts erschließen. Mist, wenn Lisa jetzt da wäre, wüssten wir mehr. Eigentlich war seine neugierige Freundin bei solchen Gelegenheiten immer zur Stelle; sie schien geradezu einen Riecher dafür zu haben... aber ausgerechnet jetzt, wo es wichtig gewesen wäre, war sie nicht da.
Resigniert setzte er schließlich seinen Weg in das Fundhaus fort. Soccio hatte ihn garantiert nicht bemerkt; vielleicht würde sich noch so eine Gelegenheit ergeben, bei der Lisas Italienischkenntnisse sie weiterbrachten. Kein Grund für Verschwörungsgedanken, Conrad, verscheuchte er das aufkommende Misstrauen gegenüber dem Professor aus Padua.
***
Conrad brannten die ausgetrockneten Augen. Er lehnte sich zurück und fingerte nach dem Schalter der Schreibtischlampe. »Ich brauche eine Pause. Ich wünschte, wir hätten ein Mikroskop mit Kamera. Stundenlang durch die Okulare zu glotzen und sich darauf zu konzentrieren, keine Wimpern im Bild zu haben, ist nicht das Gelbe.«
Sie überging souverän sein Jammern auf hohem Niveau. »Zu welchem Schluss ist der Chef-Anthropologe denn nun bei unseren Patienten gekommen?«
»Wie erwartet gibt es nicht viel Spezifisches.« Er langte in die mittlerweile fast leere Keksdose und aß die letzte Hagelzuckerbrezel, bevor er mit einer Erklärung begann. »Wie schon gesagt hinterlässt die Pest keine verwertbaren Spuren an den Knochen, du kannst–«
»Und was wollen die dann mit dir auf so einer Kampagne anfangen?«, unterbrach ihn Lisa.
So viel Unverschämtheit hatte er nicht erwartet. Für einen Moment wusste er nichts zu erwidern, dann erwachte seine Schlagfertigkeit wieder. »Das wollte ich dir gerade erläutern, meine Liebe. Doch die eigentliche Frage ist: Was wollen die mit Lisa Franks? Du bist einfach eine kostspielige Ägyptologiestudentin für die man zwei Heimschläfer beschäftigen könnte... und dass es hier keine Hieroglyphen gibt, war wohl von Anfang an klar. Und wenn du es genau wissen willst, dann lass dir gesagt sein, dass ich Soccio gesagt habe, dass ich ohne persönliche Assistentin nicht anreise.«
»Wow, wow, wow!« Sie machte eine beschwichtigende Geste. »Das sollte kein Angriff sein. Ich war einfach nur neugierig.«
Seine Unbeherrschtheit war ihm augenblicklich peinlich. »Entschuldige, ich... Aus irgendeinem Grund bin ich derzeit in Nullkommanichts auf hundertachtzig. Liegt vielleicht auch an dem sonderbaren Verhalten unseres Chefs.«
Sie konnte seine Äußerung nicht auf sich beruhen lassen. »Du hast nicht wirklich die Karte mit der 'persönlichen Assistentin' gezogen, oder?«
Und ob er das hatte... »Natürlich nicht«, log er. »Du kennst mich. Ich habe ihm erzählt, dass ich eine unglaublich hübsche Kommilitonin mitbringen würde.«
Sie holte aus, doch er hatte damit gerechnet, und seine Wange entging ihrer Handfläche um Zentimeter. »Das war knapp«, murmelte Conrad erleichtert.
Zu seiner Verwunderung grinste sie. »Gut, also noch mal von vorne.«
Er winkte sie zu sich. »Schau durch und sag mir, was du siehst.«
Sie beugte sich über das beeindruckende Stereomikroskop und blinzelte. »Gezackte Linien auf einer Schädelkalotte? Knochennähte, nicht wahr?«
»Exakt. Genauer gesagt einen Teil der Scheitelnaht, andere sagen Kranznaht. Die läuft quer über den Kopf.« Er führte den Zeigefinger von Schläfe zu Schläfe. »In der Schädelmitte so ziemlich auf dem höchsten Punkt führt dann die Pfeilnaht, die Sutura sagittalis, zum Hinterhaupt, wo wieder eine Knochennaht quer verläuft. Insgesamt gibt es so an die dreißig größere und kleinere Nähte... Müsste ich eigentlich exakt wissen... aber für uns ist das gerade egal.« Er kratzte sich an der Stirn. Gott sei Dank sprach er nur vor Lisa. Wenn sie wieder zu Hause waren, schien ein Blick in die Bücher dringend geraten. Andernfalls würde ihn sein Doktorvater Professor Bergen mit Wonne in der Luft zerreißen.
»Okay, habe ich schon mal gesehen.«
»Ja, die Schädelnähte«, nahm er den Faden wieder auf und wechselte das Schädelstückchen gegen ein etwas größeres aus. »Jetzt schau dir dieses an und sag mir, was an dem Teil hier anders ist.«
Franks ließ sich etwas mehr Zeit als beim ersten Mal. »Nicht so deutlich. Glatter, würde ich sagen. Irgendwie stabiler, als wären die Knochenteile besser verwachsen...«
»Das Individuum, von dem die zweite Probe stammt, ist das ältere«, half Conrad. »Viel mehr kann man nicht rausholen, das ist die Krux.«
»Verstehe, du willst mir sagen, dass es hauptsächlich um eine Altersbestimmung der Toten gehen wird.«
Conrad nickte. »Es gibt noch andere Anhaltspunkte, wie zum Beispiel die Fußknochen oder die Verknöcherung der Mittelhandknochen. Aber richtig genau ist das alles nicht, und je älter die Individuen geworden sind, desto schwieriger wird es in der Regel.«
Sie war nicht zufrieden. »Mir leuchtet noch immer nicht ein, was die Untersuchung hier für einen Nutzen hat, wenn man die Pestinfektion nicht an den Knochen festmachen kann.«
»Mal abgesehen davon, dass noch anderes menschliches Gewebe erhalten sein könnte, kann man Abnutzungsspuren an den Gelenken und den Zähnen bewerten. Allerdings gebe ich zu, dass ich auf dieser Insel knapp über dem Grundwasser nicht an verwertbare Gewebereste glaube... Summa summarum können wir uns mit der Untersuchung möglichst vieler Überreste ein Bild von der Gruppe machen, die hier begraben liegt.«
Franks nickte langsam, aber Conrad war klar, dass der Groschen bei ihr noch nicht gefallen war.
»Es geht um den Unterschied zwischen einem Friedhof, auf dem man eine 'normale Population', also sehr viele Alte und sehr Junge vorfindet, Säuglinge und Kleinkinder, und einer Begräbnisstätte, die im Gegensatz dazu eine unnatürliche Altersstruktur aufweist.«
»Und das scheint hier der Fall zu sein?«
»Genau. So viel lässt sich aus den mittlerweile fast drei Dutzend Individuen schon herausdeuten. Hier liegt einfach alles, was man in einer Hafenstadt, wie Venedig erwarten würde. Das wird mit der Zeit sicher noch wesentlich prägnanter werden, denn wir haben bisher nur einen kleinen Teil geborgen.«
Jetzt wirkte Franks' Rekapitulation wesentlich überzeugter: »Wir sehen gewissermaßen einen Schnappschuss der damaligen Population.«
»Hätte ich nicht schöner sagen können.«
16
Franks stocherte schon seit einigen Minuten nachdenklich in ihrem Spaghettigericht herum. Schließlich hielt sie es nicht mehr aus. »Nehmen wir einmal an, die Skelette aus unserer Grabungsfläche stammen tatsächlich von Menschen, die an der Pest gestorben sind...«
»Worauf willst du hinaus?«, fragte Conrad, nachdem sie keine Anstalten machte, ihren Gedanken vernehmbar fortzuführen.
Sie sah auf und legte die Gabel beiseite. »Na ja, wenn das wirklich Pestopfer sind, dann frage ich mich, wie gefährlich das für uns ist. Ich meine, wir arbeiten ohne irgendwelchen Schutz. Könnte nicht zum Beispiel im Knochenmark–«
»Ach, Unsinn, Lisa. Bakterien überleben nicht die Jahrhunderte«, würgte er sie ab. Doch im nächsten Moment wurde ihm bewusst, dass solche Pauschalaussagen alles andere als wissenschaftlich waren. Bei Botulismus, Milzbrand und Wundstarrkrampf wusste man, dass die Sporen sehr lange in der Erde überleben konnten, auch unter widrigen Bedingungen. Ähnliches galt für Sporen von Schimmelpilzen... Zum Glück war Yersinia pestis kein sporenbildendes Bakterium. Zum Überleben benötigte es einen Wirt. In einem toten Körper konnte der Erreger nicht lange bestehen—schon gar nicht über fünf oder sechs Jahrhunderte, und um solche Zeitspannen ging es schließlich bei ihrer Kampagne.
Lisa schien noch nicht ganz beruhigt. »Dann müsste ja die Pest aussterben, wenn die infizierten Leute irgendwann alle tot sind oder ihr Immunsystem die Bakterien erfolgreich eliminiert hat.«
Conrad stöhnte, er hatte befürchtet, dass Lisa darauf kommen würde. »Ja, ganz so einfach ist es nicht. Du weißt ja wohl, dass die Pest von einem infizierten Floh eingeschleppt wird, der auf Ratten wohnt.«
Sie nickte und wirkte erleichtert, dass er sich nun zu einer überzeugenderen Antwort genötigt sah.
»Allerdings sterben auch Ratten an der Pest. Das bedeutet, dass das Bakterium seinen Wirt verliert und mit dem Ungeziefer selbst dezimiert wird. Da ist es praktisch, dass der infizierte Floh, wenn Menschen mit den Ratten in Berührung kommen, auch auf den Menschen übersiedeln und dort überleben kann.« Er trank sein Bier aus und winkte nach Giovanni. »Der Floh selbst stirbt nicht an der Pest, aber er braucht Blut als Nahrung, also einen Wirt.«
Man sah förmlich, wie es in Lisa Franks arbeitete. »Dann geht es ja den Ratten letztlich nicht besser als uns.« Sie schüttelte den Kopf. »Was ich sagen will: Wenn die Ratten an der Pest eingehen... Irgendwie funktioniert das doch nicht auf Dauer.«
»Hm. Stimmt auch. Yersinia pestis braucht das, was die Epidemiologen als Reservoir bezeichnen. Soweit mir bekannt ist, weiß man noch nicht sicher, in welchen Tieren die Pest überdauert. Da wird seit einiger Zeit dran geforscht. Die Vermutungen gehen in Richtung anderer Nagetiere, die wohl nicht so schnell sterben oder einfach nur übertragen, beispielsweise Eichhörnchen und Murmeltiere. Aber nagel mich nicht fest, ich habe wirklich kein fundiertes Wissen dazu.« Er schlürfte den Schaum von seinem frischen Pils. »Ich kann das bei Gelegenheit ja mal nachlesen. Ich bin mir aber sicher, dass von unseren Leichen keine Gefahr ausgeht.« Zumindest nicht, was die Pest angeht, schob er in Gedanken nach, aber er hütete sich davor, Lisa auf dumme Ideen zu bringen.
»Von Hörnchen und anderen Kleinnagern sollte man sich sowieso nicht beißen lassen. Das weiß man ja«, resümierte sie nickend. »Und... Würde der Professor uns ungeschützt arbeiten lassen, wenn wir uns an den Knochen irgendwas holen könnten?«
In gewisser Weise fand er es bemerkenswert, dass Lisa Franks nach ihren Erfahrungen in London noch an solche Skrupel in akademischen Kreisen glaubte. Und auch ihr Berliner Professor Bergen taugte wahrlich nicht als moralisches Vorbild. Wer wusste schon, wie ihr derzeitiger Grabungsleiter tickte, wenn er zwischen persönlichem Ruhm und einem gewissen Risiko für seine Studenten wählen musste? Er selbst empfand Soccios Reaktionen teils als merkwürdig, und auch das Telefongespräch ging ihm nicht aus dem Kopf. Er hatte nichts verstanden, und dennoch war er überzeugt, dass da etwas nicht koscher war. Unsinn, Conrad, schalt er sich. Lisa war gerade ein wenig von ihrem Verschwörungsspleen runter; da musste er jetzt nicht ihre Nachfolge antreten. »Ganz genau, lass dich einfach nicht von einem Eichhörnchen beißen«, murmelte er und nahm die Dessertkarte zur Hand.
***
Conrad schob den restlos geleerten Amarenabecher von sich und wischte den Mund mit einer dieser glatten Papierservietten ab, die mehr verschmierten als aufsaugten (und die weltweit von derselben Butterbrotpapiermafia geliefert wurden, die garantiert auch für das kratzige Klopapier in Hotels verantwortlich war). Während er diesem grimmigen Gedanken nachhing, erschien Lisa wieder in dem schmalen Gang, der zu den Toiletten führte. Als ihr Lieblingskellner an ihr vorrüberging, begann sie ein Gespräch, welches Giovanni aber nach nicht einmal zwei Minuten mit einem breiten Lächeln und einem Deuten auf den Garderobenständer beendete. Sie blieb mit verdutztem Gesicht zurück und nahm dann einen Zeitungshalter vom Haken, in den grünliche Papierbögen eingespannt waren. Nach kurzem Blättern und Lesen kam sie an ihren Tisch zurück.
»Was ist los?« Er klang leicht genervt. »Steht womöglich etwas über deinen neuen Kavalier in der Zeitung?«
Ihre Miene drückte Unverständnis aus. »Eifersüchtig?« Sie schüttelte den Kopf. »Das ist ja mal was Neues«, setzte sie kaum hörbar hinzu.
»Bah!«, winkte er energisch ab.
Doch sie ging überhaupt nicht weiter darauf ein und machte ein Gesicht, das er als eine Mischung aus Neugier und Unbehagen interpretierte. »Wusstest du, dass in Venedig angeblich gerade ein Serienmörder sein Unwesen treibt, der vorher schon Mailand und Turin unsicher gemacht haben soll? Ist in ganz Norditalien das vorherrschende Gesprächsthema zurzeit.«
»Wie? Wo sind wir denn jetzt gelandet?«, entgegnete er völlig verdutzt.
»Ach, lies einfach selber.« Sie legte die Gazzettino vor ihm auf den Tisch und bemerkte im selben Moment seine Miene. »Oh, Entschuldigung«, murmelte sie, schob den Zeitungshalter an die Tischkante und übersetzte abschnittsweise den Inhalt des Artikels für ihn.
IL GAZZETTINO
Rätselhafter Toter Nummer drei ist Amerikaner
Wie IL GAZZETTINO kurz vor Redaktionsschluss erfahren hat, ist der Mann, den die Carabinieri vorgestern am späten Abend in Höhe des Fischmarktes aus dem Kanal gezogen haben, amerikanischer Staatsbürger. Der Mann war 47 Jahre alt, hieß Henry Williams und war nach Angaben der Staatsanwaltschaft alleinreisender Tourist. Über die genaue Todesursache ist noch nichts bekannt, allerdings gehen die Behörden von einem Verbrechen aus, so der Polizeisprecher.
Gehört der Tote in die Serie mysteriöser Todesfälle, die Venedig seit Wochen in Atem hält? Was halten Polizei und Staatsanwaltschaft zurück? Geht es vielleicht um eine Mordserie, wie Mailand und Turin sie im letzten Sommer erleben mussten?
Vorgestern gegen zweiundzwanzig Uhr wurde die Polizei zum Kanal gerufen. Ein Zeuge hatte auf Höhe des Palazzo Michiele eine leblose Person zwischen Pfählen im Wasser treiben sehen. Offensichtlich konnte der Mann, bei dem es sich—wie heute bekannt wurde—um einen amerikanischen Touristen handelte, nur noch tot geborgen werden. Der Tote befindet sich jetzt zur weiteren Untersuchung im rechtsmedizinischen Institut der Universität Padua. Zu weiteren Erkenntnissen hält die Polizei sich bislang bedeckt.
Es gelang IL GAZZETTINO jedoch, mit dem Zeugen Stefano Z. zu sprechen, der den Toten im Canal Grande entdeckt und daraufhin die Polizei informiert hat. Seinen Angaben zufolge konnte der Leichnam noch nicht lange im Wasser gelegen haben, als er gegen halb zehn seine Entdeckung meldete. Z. saß mit seiner Familie als einer der letzten Gäste im Außenbereich eines Restaurants am Fischmarkt; gegenüber liegen der Palazzo Smith und der Michiele mit der zugehörigen Anlegemöglichkeit.
Bei einem Blick auf den Kanal bemerkte der Zeuge eine zu dieser Uhrzeit ungewöhnliche Aktivität am Bootssteg vor dem Palazzo. Daraufhin ging er an den Kanal und versuchte, mehr zu erkennen. Letztlich sah er aber nur ein mit einer Person besetztes Boot, das ablegte und mit hoher Geschwindigkeit Richtung Rialto verschwand. Als sein Blick die Festmachpfähle streifte, sah er etwas im Wasser treiben, das ihn an einen Menschen erinnerte. Nachdem auch der herbeigeholte Wirt des Restaurants und ein Kellner seine Beobachtung bestätigten, rief Stefano Z. den Notruf der Polizei. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Mestre will den Hergang, wie ihn der Zeuge schildert, weder bestätigen, noch dementiert sie seine Angaben.
Eines steht jedoch fest: Der tote Amerikaner ist bereits der dritte Todesfall seit Anfang Juni, bei dem sich die Umstände äußerst suspekt darstellen und bei dem die Behörden jede Auskunft zu Todesursache, vermutlichem Tathergang und Tatverdächtigen verweigert. Nur Geschlecht, Alter und Namen der Toten sowie Auffindeorte wurden jeweils bekannt gegeben.
Was bisher geschah: Am frühen Morgen des 6. Juni wurde der 38-jährige Maurizio Bruno in der Calle del Bastion zwischen Guggenheim Museum und der Basilica di Santa Maria della Salute von einer Anwohnerin tot aufgefunden (IL GAZZETTINO berichtete). Am 27. Juni kurz vor Mitternacht fand eine Gruppe französischer Touristen die leblose Magdalena Pedrocchi (53) in den Arkaden, die den Durchgang von der Calle Larga Ascensione zum Markusplatz bilden. Die verwitwete Hausfrau verstarb auf dem Weg nach Mestre ins Krankenhaus (wir berichteten).
Nachdem nun ein dritter Toter, bei dem sich die Staatsanwaltschaft so merkwürdig zugeknöpft verhält, innerhalb kurzer Zeit im Stadtgebiet von Venedig gefunden wurde, stellt sich die Frage, ob dies weiterhin als Zufall erklärt werden kann. Wir gehen davon aus, dass die Staatsanwaltschaft noch am heutigen Vormittag eine Pressekonferenz abhalten wird, um über den Stand der Ermittlungen zu informieren. Lesen Sie die Zusammenfassung der Erkenntnisse in einer IL GAZZETTINO-Sonderausgabe, die am heutigen Abend erscheinen wird!
(cp)
Conrad bemerkte Lisas Aufregung, nachdem sie ihren Vortrag beendet hatte, wollte sich aber nicht auf Spekulationen und schon gar keine Diskussion einlassen. »Interessant ist das ja. Aber zum Glück haben wir mit der Sache nichts am Hut.«
Lisa grunzte unzufrieden und blickte noch immer gebannt auf den Artikel.
Er schüttelte lächelnd den Kopf. »Es fällt dir schwer, mysteriöse Vorkommnisse und Verschwörungsnummern links liegen zu lassen, oder?«
»Es beschäftigt die Leute hier eben.« Ihre Miene konnte man nur als beleidigt bezeichnen, und Conrad glaubte, eine intensivere Durchblutung ihrer Wangen zu erkennen. »Du redest ja nicht mit den Einheimischen«, fügte sie schnippisch hinzu. »Außerdem musst ausgerechnet du mir nicht mit 'Verschwörung' kommen.«
Er winkte ab. »Ich wundere mich doch nur, dass du mit deinem Freund kein anderes Gesprächsthema findest.« Noch im selben Moment bereute er seine Provokation. Jetzt war ihre rote Gesichtsfarbe nicht mehr zu übersehen. »War nicht so gemeint, tut mir leid«, schob er nach, bevor sie explodieren konnte. »Ich möchte nur nicht, dass wir uns damit beschäftigen und am Ende schon wieder in eine Sache hineinrutschen, die mehr Ärger als Spaß macht—und zu allem Überfluss womöglich auch noch gefährlich ist.«
Sie atmete lautstark aus, schien sich aber zu beruhigen.
»Wir sollten noch einen Schlummertrunk bei Giovanni bestellen«, versuchte Conrad die Wogen zu glätten. »Meiner Einschätzung nach wird morgen ein arbeitsreicher Tag. Wir kriegen bestimmt wieder genügend alte Knochen auf dem Tisch.«
Lisa nickte zaghaft. »Zwei Portweinchen. Die gehen auf dich, schreibe ich auf deinen Deckel.«
»Geht klar.« Er grinste erleichtert und winkte nach dem Kellner. »Außerdem noch eine Schüssel Amarettini, mir ist danach.«
»Stimmt, du hattest ja heute noch keine Süßigkeiten«, bemerkte sie, während sie die Augen verdrehte.
17
Vor ihnen lag ein Mann. Auf den ersten Blick konnte man ihn für einen Obdachlosen halten, der im Alkohol- oder Drogenrausch sein Ende gefunden hatte. Das glatt rasierte Gesicht, gepflegte Hände und seine neu wirkende Bekleidung bezeugten etwas anderes. Mancini strich sich grübelnd über den Schädel; der spärliche Bewuchs konnte eine Schur mit der Maschine vertragen. Die Spurensicherung hatte bereits ein recht klar umrissenes Bild vom Ablauf der Ereignisse geliefert: Das blutige Sputum des Toten ließ sich bis zum Anfang der schmalen Gasse zurückverfolgen. Aus welcher Richtung der Mann hierhergekommen war und vor allem, wo er sich am Abend aufgehalten hatte, würde sich sicherlich herausfinden lassen, wenn die Kriminaltechnik die weitere Umgebung nach Spuren absuchte. Eigentlich gab es keine Alternative zu diesem Vorgehen. Man hätte die Gegend großräumig absperren müssen—und zwar schnellstmöglich. Dutzende Carabinieri, Menschen in Schutzanzügen, Hundestaffeln und eine Menge technisches Großgerät müssten eingesetzt werden und das Viertel in ein kinoreifes Katastrophenszenario verwandeln. Das vertrug sich jedoch nicht mit der Anweisung der Staatsanwaltschaft, ohne großes Aufsehen zu ermitteln. Die Politik wollte jede Beunruhigung von Touristen und der Bevölkerung vermeiden. Das funktionierte am besten, wenn man die Presse außen vor halten und den Mann als einen weiteren Bedauernswerten darstellen konnte, den seine Sucht letztlich das Leben gekostet hatte. Commissario Mancini hegte keine allzu große Hoffnung auf eine ordentliche Spurensicherung und versuchte, sich mit der begrenzten Maßnahme, die man ihm zugebilligt hatte, abzufinden. Trotzdem...
Mancini sah hinüber zu Ingrossato, der neben dem Opfer kniete und irgendetwas an seinen Einweghandschuhen fummelte. Als der seinen Blick bemerkte, hob er mit ratlosem Gesichtsausdruck die Schultern und richtete sich auf.
Den textilen Spuren nach hatte der Mann sich an die Mauer gelehnt, war an ihr heruntergerutscht und dann zur Seite gekippt. In dieser gekrümmten Stellung war das Opfer dann höchstwahrscheinlich verstorben. Eine postmortale Umlagerung hatte nicht stattgefunden, jedenfalls ergab das Rinnsal aus schleimigem Blut, das aus seinem Mundwinkel gekommen war, ein eindeutiges Bild.
Aber sein Assistent wollte Maria Bellucci nicht vorgreifen. »Die Gerichtsmedizin wird uns endgültige Sicherheit liefern. Laut der Professoressa gibt es wieder keine äußeren Verletzungen. Nur kleinere Abschürfungen an den Handinnenflächen und am Hinterhaupt. Rühren wohl am ehesten von der rauen Maueroberfläche her. Entsprechende Blutreste werden sicherlich auch zu finden sein.«
»Wissen wir, wer der Mann ist?«
Ingrossato zog einen transparenten Plastikbeutel aus der Innentasche seiner olivgrünen Fliegerjacke und entnahm ihm einen deutschen Personalausweis. »Er hieß Wolfram Berndorff, siebenundfünfzig Jahre alt, in München gemeldet.«
»Noch ein Tourist«, murmelte Mancini.
»Ja, wieder ein Tourist«, bestätigte Ingrossato. »Meinst du, dass das von Belang ist?«
»Ich weiß es nicht, Salvo.«
»Rein statistisch sind die Besucher den Einheimischen an Zahl weit überlegen«, überlegte sein Assistent. »Aber das ist nicht...«
Mancini schüttelte langsam den Kopf. Verflucht, jetzt schon der vierte Tote, bei dem Geheimniskrämerei angesagt ist. Er betrachtete Berndorffs eingefallenes Gesicht und ging in die Hocke. »Touristen sind die ganze Zeit auf Achse, wenn sie nicht zum Schlafen in ihrem Hotelzimmer sind. Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Vaporettofahrten, dicht gedrängt mit anderen Urlaubern.«
»Im Gegensatz zu den Einheimischen«, führte Ingrossato seinen Gedanken fort. »An die kommt man viel schwieriger heran. Das ist durchaus eine Erklärung.«
»Und Touristen fahren wieder zurück in ihre Heimat und nehmen mit, was immer sie in Venedig abbekommen haben.« Ihn fröstelte bei dem Gedanken. Er schüttelte den Kopf, als könne er ihn dadurch verscheuchen, und wandte sich wieder dem Leichnam zu. Gerade, als er die metallisch glänzende Folie zurückschlagen wollte, die man mittlerweile über dem Toten ausgebreitet hatte, vernahm er Belluccis warnende Stimme.
»Commissario, lassen Sie das besser.« Sie hielt ihm ein Paar Latexhandschuhe entgegen. »Ziehen Sie zumindest die hier an, bevor Sie ihn berühren.«
***
»Ich fürchte, Ihre Sorge ist berechtigt, Commissario.«
Mancini nahm den Kaffee mit dankbarer Miene entgegen. »Kein guter Start in den Tag, verdammt.« Er nippte an dem übervollen Keramikbecher. »Es ist also wirklich die Spanische Grippe...«
Bellucci nickte mit ernster Miene. »Nach meiner Ansicht: Höchstwahrscheinlich.«
»Berndorff ist Toter Nummer vier.« Der Polizist kratzte sich im Nacken. »Verflucht, mein Laienverstand sagt mir, dass das hier eine Epidemie werden kann. Williams und Berndorff hatten nicht viel Zeit, aber wer weiß, wen unsere ersten beiden Opfer schon alles angesteckt haben.«
»Was das angeht, würde ich nach derzeitigem Erkenntnisstand und meiner persönlichen Gefahrenabschätzung nicht ganz so schwarz sehen, denn–«
»Grippe ist hochansteckend. Ist es nicht so?«, unterbrach er. »Und was ich über die Spanische Grippe gelesen habe, klingt alles andere als beruhigend, Professoressa.«
Sie atmete lautstark aus und klopfte eine Menthol-Dunhill aus der Packung. »Sehen Sie, Commissario, ich bin mir der Gefahr bewusst und ich betone noch einmal: Es ist meine ganz subjektive, wenn auch fachlich begründete Einschätzung.« Nachdem sie die Zigarette angezündet und zwei tiefe Züge genommen hatte, fuhr sie in ruhigem Ton fort: »Erst einmal kann ich bestätigen, dass die ersten drei Opfer an der Spanischen Grippe gestorben sind. Die Berichte aus dem Labor der Universitätsklinik sind da, und sie sind eindeutig. Bei unserem Toten Nummer vier...«
»Wolfram Berndorff«, half Mancini.
»Für Berndorff liegt mir der Laborbericht noch nicht vor, aber wir dürfen davon ausgehen, dass mein Verdacht auf ein Grippevirus sich bestätigen wird.«
»Und was ist daran beruhigend?«, warf er ein.
»Langsam, Commissario.« Sie nahm einen weiteren Zug von der Mentholzigarette. »Beruhigend ist vielleicht das falsche Wort... Lassen Sie mich erklären.« Bellucci nahm ihren eigenen Kaffee aus der Maschine und lehnte sich an Berndorffs metallene Liege. »Fangen wir mit Maurizio Bruno an, dem ersten Opfer. Wie Sie dem Bericht entnehmen konnten, war bei ihm der Auffindeort nicht der Ort, an dem er gestorben ist. Der Mann wurde dort nach seinem Tod abgelegt, offensichtlich von seinem Mörder—oder wie auch immer man den Verursacher seiner Krankheit nennen sollte.«
»Das weiß ich selber«, murrte Mancini und bedeutete Bellucci, sich nicht durch seine Bemerkungen unterbrechen zu lassen.
»Die Tatsache, dass der Mann wahrscheinlich bis zu seinem Tod gefangen gehalten wurde, ist unser Glück. Damals wussten wir überhaupt nicht, woran wir waren. Hätte der Mann die Möglichkeit gehabt, andere Menschen auf herkömmliche Weise anzustecken, also über eine Tröpfcheninfektion, dann hätten wir schon seit Längerem mehr Infizierte. Im schlimmsten Fall würden wir mitten in einer Epidemie stecken.«
Der Polizist nickte. »Tun wir aber nicht.«
»Exakt, Commissario. Wir können also froh sein, dass unser Täter die Opfer erst ans Tageslicht gebracht hat, nachdem sie bereits tot waren. Leichen werden in der Regel nicht von vielen Menschen berührt. Außerdem war die Polizei schnell vor Ort. Das Ansteckungsrisiko war dementsprechend gering... aber davon hatten wir ja zu dem Zeitpunkt keine Ahnung.«
»Ist Maurizio Bruno damals nicht rechtsmedizinisch untersucht worden?«, kramte Mancini in seinem Gedächtnis.
Bellucci drückte ihre Dunhill in den Ausguss des stählernen Handwaschbeckens. »Doch, aber wir hatten anfangs keinen Grund zu der Annahme, dass es um eine ansteckende Seuche gehen könnte. Erst nach dem zweiten Opfer, dieser älteren Frau, wurde klar, dass so etwas wie eine aggressive Influenza im Spiel sein könnte.« Sie füllte ihre Tasse nach und gesellte sich wieder zu Berndorff. »Auch sie wurde während ihrer Krankheit eingesperrt, wahrscheinlich sogar unter Quarantänebedingungen, und nach ihrem Tod am Auffindeort abgelegt.«
»Er hat die Opfer beobachtet«, flüsterte Mancini düster.
»Natürlich. Vermutlich war das der Sinn der Sache; genau zu beobachten, wie sich die Krankheit entwickelt. Wahrscheinlich hat er sogar Buch geführt.«
Der Polizist winkte ab. »Das meinte ich nicht, Professoressa. Niemand hat die beiden Opfer vermisst gemeldet in der Zeit vom Verschwinden bis zur Auffindung. Das waren sicherlich einige Tage... Wochen?«
»Wenige Tage«, half sie.
»Jedenfalls hat der Kerl seine potentiellen Opfer ausgekundschaftet. Wenn er sicher war, dass er jemanden gefunden hatte, bei dem die Verwandtschaft nicht Himmel und Hölle in Bewegung setzten würde, kam er als Proband in Frage.« Mancini stellte seinen Becher ab und begann, zwischen den Metalltischen umherzugehen. »Maurizio Bruno war ein alleinstehender Saisonarbeiter, ein Tagelöhner aus dem Süden, den niemand so schnell vermissen würde. Die einzigen Verwandten leben in Neapel. Opfer Nummer zwei, Magdalena Pedrocchi, war Witwe und lebte allein; sie hatte kaum Sozialkontakte, und berufstätig war sie auch nicht, weil sie von der Rente ihres Mannes leben konnte.«
»Mit dem hier könnte er aber schon einen Feldversuch begonnen haben.« Die Pathologin deutete auf das Kühlfach, in dem Henry Williams untergebracht war, der Mann, den man aus dem Kanal gefischt hatte.
Der Commissario atmete lautstark ein. »Gott bewahre! Wir haben keine Ahnung, wo der Amerikaner sich herumgetrieben hat. Lassen Sie uns hoffen, dass auch er ein Laborexperiment war, das niemand vermisst hat.«
»Die Untersuchungsergebnisse sind diesbezüglich nicht eindeutig«, gab die Rechtsmedizinerin zu bedenken.
»Dennoch. Aufgrund der Tatsache, dass niemand den Mann vermisste—auch keine Reisegruppe—glaube ich, dass er genauso behandelt wurde wie Maurizio Bruno und die Pedrocchi.«
Bellucci nickte nachdenklich. »Ja, hoffentlich. Aber mit dem vierten Opfer hat er seine Vorgehensweise jetzt definitiv geändert.« Sie klopfte auf das glänzende Stahlblech, auf dem der Leichnam von Wolfram Berndorff ruhte. »Der Mann ist mit der Krankheit herumgelaufen.«
»Was möglich war, haben wir sofort in die Wege geleitet... Jedenfalls alles, was keine unerwünschte Aufmerksamkeit erregt. Berndorffs gesamte Reisegruppe befindet sich in Quarantäne.« Mancini lächelte fein. »Und die Presse hat davon noch nichts mitbekommen; ich hoffe das bleibt die nächste Zeit auch so.«
»Irgendwann wird zumindest den Verwandten und Freunden in Deutschland auffallen, dass die Gruppe überfällig ist, Commissario.«
Er schüttelte verärgert den Kopf. »Da wird uns schon etwas einfallen. Wahrscheinlich hat Berndorff kaum Gelegenheit gehabt, viele Keime zu verbreiten. Nach Angaben der Teilnehmer und der Reiseleitung hat er die Reisegruppe kaum verlassen. Außerdem pflegte er selbst innerhalb der Gruppe kaum Kontakte.«
»Dann lassen Sie uns hoffen, dass er auch keine Kontakte zur Bevölkerung hatte und dass es mit ihm so schnell zu Ende ging, wie es nach bisherigem Untersuchungsstand aussieht«, fasste Maria Bellucci zusammen.
Erneut kratzte Mancini seinen Hinterkopf. »Ja, lassen Sie uns hoffen. Wovor mir wirklich graut, ist, dass es noch einen solchen Fall geben könnte... Es wird nicht immer weiter gut gehen. Irgendwann infiziert ein Opfer des Doktors die halbe Stadt.« Er starrte für einige Sekunden auf den zugedeckten Leichnam. »Die Hoffnung, dass die Spanische Grippe nur diese drei beziehungsweise vier aus heiterem Himmel, sozusagen... auf natürliche Weise heimgesucht haben könnte, ist vermutlich vergeblich. Habe ich Recht?«
»Vollkommen vergeblich, Commissario, glauben Sie mir. Das Auftauchen, die Verbreitung und der zeitliche Ablauf haben überhaupt nichts Natürliches.«
18
Das während des allmorgendlichen Frühstücks im Grabungshaus vorherrschende Gesprächsthema der italienischen Studenten waren Zeitungsartikel über die Serie merkwürdiger Todesfälle. Wie erwartet hielten die Ereignisse mittlerweile ganz Venedig samt Festland (auf dem bisher scheinbar noch nichts passiert war) in Atem. Doch zu Conrads Erstaunen klinkte Lisa sich nicht in die Diskussion ein.
»Sollten wir die nicht mal auf das komische Verhalten des Professors ansprechen?«, raunte er Lisa zwischen zwei Bissen von seinem Croissant zu.
Sie schüttelte kaum merklich den Kopf. »Ich würde sagen, wir lassen das vorerst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das nicht mitgekriegt haben. Vielleicht ist der Kerl einfach so. Die kennen den Soccio ja schon länger, zumindest die meisten.«
Conrad ging zwar nicht überein mit dieser Einschätzung, hielt aber den Mund.
»Jedenfalls sehe ich keinen Grund, uns in die Nesseln zu setzen«, fügte sie leise hinzu.
»Wahrscheinlich hast du Recht.«
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752113273
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (Oktober)
- Schlagworte
- Morde Venedig Epidemie Pest Geheimnis Abenteuer Krimi Geschichte Archäologie Ermittlungen Ermittler Historisch Dystopie Utopie Science Fiction