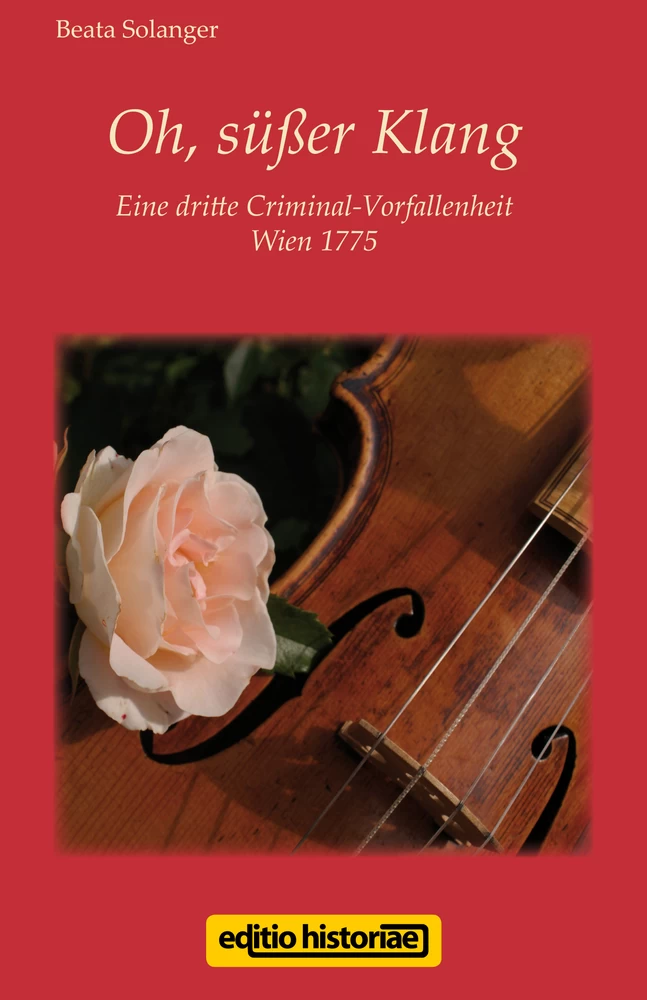Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Oh, süßer Klang
Beata Solanger
Vorwort
B
is zum Anfang des 20. Jahrhunderts war die Welt der Musik ein von Männern dominiertes Feld. Ausgehend von Entscheidungen seitens der katholischen Führung war Frauen das öffentliche Musizieren und Singen untersagt. Vor allem der Gesang in den Gotteshäusern war nur Knaben- und Männerchören gestattet. Zur Erhaltung von besonders schön klingenden Stimmen wurden viele Knaben vor dem Einsetzen des Stimmbruchs einer Kastration unterzogen. Viele überlebten den riskanten Eingriff nicht oder litten lebenslänglich unter den körperlichen Veränderungen, die durch das Fehlen des Testosterons hervorgerufen wurden. Manche Kastraten wurden übermäßig groß oder neigten zu ungesunder Leibesfülle.
In den Anfängen wurden Kinder aus Waisenhäusern für die Ausbildung herangezogen, später kam es zu regelrechten Rekrutierungen durch sogenannte Eunuchenhändler, die armen Familien ihre Söhne für wenig Geld abkauften. Diesen Knaben war nur mehr wenig Einfluss auf ihr Leben beschert. Gerade eine Handvoll von Tausenden schaffte tatsächlich den Sprung zum gefeierten Sänger. Die namenlose Masse versuchte, als schlecht bezahlte Chormitglieder, als Darsteller bei Gauklertruppen oder auch mit Prostitution ein Auskommen zu finden. Neben diesen kaum aussichtsreichen Möglichkeiten waren Kastraten auch vom normalen Leben ausgeschlossen. Aufgrund eines päpstlichen Impotenzdekrets aus dem 16. Jahrhundert war ihnen die Verehelichung untersagt. Erst 1903 erließ Papst Pius X. die Bestimmung, dass nur mehr Knaben für die Besetzung der hohen Stimmen herangezogen werden durften. Das bedeutete das Ende der Kastraten und des grausamen Geschäfts mit ihnen.
1
Im Zimmer der Baronin von Tiefenthal
Jänner 1775
M
it betont gelangweilter Miene steckte Frieda eine Haarlocke in ihrer Frisur fest. „Und hat er wieder das Porträt angestarrt?“ Sie sah in den Spiegel und würdigte den Kammerdiener ihres Schwiegervaters keines Blickes.
Emil Pohanka nickte eifrig. „Ja, fast den ganzen Vormittag, Baronin. Wie es scheint, hat der gnädige Herr die Hoffnung nicht aufgegeben.“
Frieda presste verärgert die Lippen zusammen. Doch sie ließ sich nur kurz gehen. Schon einen Wimpernschlag später glätteten sich ihre Züge wieder. Um jeden Preis wollte sie ihren beginnenden Fältchen Einhalt gebieten. Mit einer geübten Bewegung klappte sie ihre Reispuderdose auf. „Du weißt, was das bedeutet, wenn mein Mann dem Baron nicht als sein Erbe nachfolgt?“
Der lang gediente Kammerdiener schlug die Augen nieder. „Ja, Frau Baronin. Ich denke schon.“
Wütend drehte sich Frieda zu Pohanka um. „Nein, du weißt gar nichts. Du weißt nicht, wie es ist, von einem unbedeutenden Einkommen leben zu müssen, das dich in die Verbannung auf irgendeinen Landsitz in der Provinz zwingt. Ohne Einkaufsmöglichkeiten, ohne gesellschaftliche Kontakte und ohne jegliche Aussicht auf Zerstreuungen. Das Mittagessen mit dem Dorfpfarrer gilt dort schon als Sensation!“ Frieda drehte sich wieder zu ihrer Psyche, aber sie änderte ihren Blickwinkel auf den Spiegel und fixierte den Dienstboten. „Für deine Sorte sieht es nicht viel besser aus.“
Diesmal gelang es Frieda nicht rechtzeitig, den bitteren Zug um ihren Mund zu verbannen. Sie sah Pohanka mit eisigem Blick an. „Rede ihm diesen Glauben an eine“, Frieda würgte das nächste Wort fast hervor, „Genesung von Thaddäus doch endlich aus!“ Sie knallte den Deckel ihrer Puderdose aufgebracht zu. „Es ist doch nun schon über zwei Jahre her, dass der Baron seinen Sohn auf das Landgut in Keszthely[1] geschickt hat.“ Frieda verdrehte die Augen. „Als ob der Plattensee etwas gegen diese schwere Form der Melancholie ausrichten könnte.“ Sie sprang heftig von ihrem Schemel auf und ging aufgebracht in ihrem Boudoir hin und her. „Gabriel wird meinem Schwiegervater nachfolgen. Er hat Karl nicht so wie Thaddäus enttäuscht. Und er versteht das Geschäft so gut wie jeder andere.“
Friedas höchstes Ziel war es, dass die Belieferung der gesamten k. k. Armee mit Unterbekleidung für die Soldaten in die richtigen Hände ging. Wenn man in naher Zukunft vom „Wäschebaron“ sprach, sollte Gabriel von Tiefenthal damit gemeint sein und nicht mehr Karl oder — Gott bewahre sie vor diesem Schicksalsschlag — Thaddäus.
Der Kammerdiener hob verzweifelt die Schultern. In seinem Kopf rasten die Gedanken. Was sollte er sagen, ohne den zweifelhaften Charakter des Ehemanns der Baronin ins Spiel zu bringen? Der gnädige Herr jammerte täglich mehrmals über die Eskapaden und den verschwenderischen Lebensstil seines jüngeren Sohnes Gabriel und dessen Frau.
Baron Karl Ernst von Tiefenthal bereute den Bruch mit seinem Erben bitterlich und hatte sich die Rückkehr von Thaddäus zu seiner letzten Lebensaufgabe gemacht.
Emil Pohanka steckte in der Klemme. Auf der einen Seite fühlte er sich durch viele Jahre des Dienens an seinen Arbeitgeber gebunden und auf der anderen Seite war dieser Stern im Sinken. Auf wen sollte er setzen? Pohanka genoss die Vorzüge seiner Spitzelei. Die zusätzlichen Münzen, die ihm die Baronin für seine Informationen gab, polsterten sein Einkommen in angenehmer Weise auf. Doch was geschah, wenn Thaddäus tatsächlich wieder auftauchte?
Moritz von Leutgeben, der pingelige Sekretär von Karl von Tiefenthal, hatte schon klargestellt, dass er auf eine Rückkehr des älteren Sohnes hoffte.
Emil verband mit diesem Schreiberling eine jahrelange Hassfreundschaft. In ihrer Sorge um den Gesundheitszustand des gnädigen Herrn zogen sie mehr oder weniger an einem Strang, doch bei vielen anderen Punkten lagen ihre Absichten die Reichweite eines Kontinents auseinander. Von Leutgeben verabscheute Frieda von Tiefenthal, denn seiner Meinung nach war sie nur eine emporgekommene Landpomeranze, die nach einem Titel und vor allem Geld gestrebt hatte. Trotzdem würde Moritz seine Stelle vermutlich behalten können, denn er administrierte das Wäscheimperium praktisch allein.
Aber Gabriel hatte seinen eigenen Kammerdiener und Thaddäus wahrscheinlich auch. So war Emils Zukunft nach dem Tod seines Herrn mehr als ungewiss. Pohanka musste sich um jeden Preis für die Baronin unverzichtbar machen. Er seufzte innerlich.
Der Kammerdiener verneigte sich förmlich und antwortete endlich: „Gewiss, Frau Baronin. Die fortschreitende Krankheit wird den gnädigen Herrn von allzu vielen Taten abhalten.“
Frieda hob zur Antwort nur leicht die Augenbraue. Nach ihrem Geschmack ging der körperliche Verfall ihres Schwiegervaters viel zu langsam vor sich. Dabei hegte sie schon seit Monaten berechtigte Hoffnungen. Der Umstand, dass Tiefenthals Leibarzt den vielen Zucker im Körper seines Patienten diagnostiziert hatte, war ihr sehr gelegen gekommen. Vielleicht musste sie dem naschsüchtigen Karl noch mehr süßes Gebäck heimlich zustecken?
Sie nickte knapp und deutete Pohanka zu gehen. „Versuche trotzdem, auf ihn einzuwirken, und zögere nicht, ihn zu verwöhnen.“ Sie lächelte süßlich. „Viel ist dem alten Mann ja nicht mehr geblieben.“
Der Kammerdiener verneigte sich und eilte erleichtert aus dem Zimmer. Auf dem Gang holte er tief Luft und drückte die Schultern bewusst wieder nach unten. In seinem Magen stach es jedes Mal unangenehm, wenn er bei der Baronin vorsprechen musste. Er hasste diese Frau, aber er brauchte sie.
Nach mehreren Atemzügen schlug er den Weg zur Küche ein. Es war Zeit für den Nachmittagskaffee des Barons. Er zog seine feinen Handschuhe aus der Rocktasche, um sie überzustreifen. Sein Blick fiel auf die weißlichen Ringe, die sich seit einiger Zeit auf seinen Fingernägeln zeigten. Da er sich sonst gut fühlte, gab er nichts weiter drauf.
„Hast du frische Kekse gebacken, Ildikó?“ Pohanka arrangierte die Kaffeekanne auf einem silbernen Tablett. Irritiert entdeckte er einen bräunlichen Fleck. Er verschob das Spitzendeckchen ein wenig. Die Rüge für das Hausmädchen, das das Silber putzte, musste warten. Die aus Ungarn stammende Köchin klapperte mit einem Topfdeckel und zeigte dann auf die Vorratskammer. „Im Regal links, Emil. Aber nur eines, wie der Doktor gesagt hat.“
Pohanka zuckte mit den Schultern und nahm einen zierlichen Porzellanteller, der vom Muster her zum restlichen Geschirr passte. In der Kammer steckte er zuerst selbst ein Gebäck in den Mund und ließ sich Zeit, drei weitere herauszunehmen.
Dann stolzierte er grußlos aus der Küche und steuerte die große Marmortreppe an. Die Hausknechte und Stubenmädchen sollten die hintere Dienstbotentreppe nehmen. Emil stand weit über ihnen.
Von Leutgeben sah auf, als Pohanka in die Bibliothek kam. Er entdeckte die Kekse und hob mit verärgerter Miene einen Finger. Emils Gesicht blieb ausdruckslos, doch er stellte das Tablett beim Sekretär ab. Moritz griff nach den überzähligen Süßigkeiten und ließ sie wie jeden Nachmittag, an denen er Emil erwischte, in einer Dose verschwinden. Und wie jeden Nachmittag schüttelte er dabei tadelnd den Kopf.
„Sie sind doch extra mit diesen Spezialzutaten und wenig Zucker gebacken“, raunte Pohanka beleidigt.
Der Sekretär verdrehte genervt die Augen. „Das ist ja der Grund, warum dem gnädigen Herrn dieses eine Gebäck gestattet ist. Sonst gäbe es gar nichts.“
Emil begrüßte den Baron, der eingewickelt in eine Decke auf seinem Lieblingssessel vor dem Kamin saß.
„Oh, Emil, mein Kaffee. Wie wunderbar.“ Von Tiefenthal schnaufte verächtlich. „Er schmeckt ohne Zucker zwar entsetzlich bitter, aber immerhin.“
„Ich habe mir erlaubt, Ihnen ein wenig Freude zu bereiten“, sagte der Kammerdiener so leise, dass Moritz es nicht hören konnte.
„Mein guter, treuer Emil. Bitte gieße gleich etwas für mich in die Untertasse.“
„Habt Ihr Post bekommen, gnädiger Herr?“
„Oh, ja. Es regnet viel am Plattensee.“
Emil nickte höflich und trat einen Schritt zurück. Er schielte zum Schreibtisch, doch von Leutgeben kratzte mit der Feder in einem der Abrechnungsbücher. Wo war der Brief von Thaddäus?
„Gibt es ...“, Pohanka räusperte sich, „irgendwelche Neuigkeiten, von Leutgeben?“
Moritz sah auf und kniff kurz die Augen zusammen. „Nächste Woche kommt der Hafner und schaut sich den Kamin im blauen Gästezimmer an. Der Hausknecht hatte gemeldet, dass er raucht.“
Im blauen Gästezimmer? Das war doch Thaddäus‘ Zimmer gewesen. War das etwa ein möglicher Hinweis auf eine baldige Rückkehr des älteren Sohnes?
Emil nickte ungeduldig. „Sonst noch etwas?“, hakte er nach. Der Sekretär tauchte die Feder ins Tintenfass und lehnte sich zurück. Er antwortete mit einer unglaublichen Arroganz: „Nichts, was in deine Agenden fällt, Pohanka.“ Der Kammerdiener fühlte sich genauso abgekanzelt, wie von Leutgeben es beabsichtigt hatte. Emil schluckte seinen Stolz herunter und versuchte es mit einem kumpelhaften Gehabe.
„Meine Agenden, was? Da gehört der Kamin ja wohl auch nicht dazu. Hab dich nicht so. Lass mich wissen, was sich tut“, flüsterte er eindringlich. Er warf einen kurzen Seitenblick auf den gnädigen Herrn, um zu sehen, ob das Gespräch ihn stören könnte. Doch von Tiefenthal knabberte selig an seinem Keks und kümmerte sich nicht um seine Umgebung.
Moritz seufzte übertrieben geduldig. „Es tut sich nichts, um deine Ausdrucksweise zu gebrauchen. Für morgen hat der gnädige Herr den werten Baron Lafarche zu einem Besuch gebeten.“ Er sah auf die große Standuhr und deutete mit dem Kinn ungefähr in die Richtung. „So um diese Zeit.“
Pohanka kicherte. „Der reiche Wäschebaron trifft den noch reicheren Kaffeebaron. Wollen sie gemeinsam ihr Geld zählen?“
Moritz zischte verärgert: „Sch! Wirst du das wohl endlich lassen! Es interessiert niemanden, was du auf der Gosse aufgeschnappt hast.“
Nun schwoll Emil doch der Kamm. „Komm mir ja nicht mit deinem vornehmen Getue, von Leutgeben.“ Er spie den niederen Adelstitel beinahe aus. „Du weißt selbst, dass sich die Schreiberlinge vom Wienerischen Diarium[2] diese Bezeichnungen ausgedacht haben.“
Der Sekretär legte die Fingerspitzen aufeinander und sah sein Gegenüber übertrieben milde an. „Ein langjähriger Freund unseres Herrn erweist ihm die Ehre eines Besuchs anlässlich des neuen Jahres.“
Emil presste verärgert die Lippen aufeinander. Er spürte, dass er keine Informationen bekommen konnte und wandte sich wieder dem Baron zu. Von Tiefenthal ließ sich Kaffee nachschenken und berichtete seinem Kammerdiener vom erwarteten Besuch. „Kannst du mir bitte einen besonders schönen Rock rauslegen? Ich kenne Egmont zwar schon mein halbes Leben lang, aber ein wenig Eitelkeit gönne ich mir doch.“ Der Baron lachte angestrengt und entließ seinen Diener.
Emil nickte von Leutgeben nur ruppig zu und eilte zu seiner nächsten Aufgabe. An der zufallenden Flügeltür hielt er kurz inne.
„Brauchen Sie mich heute Abend, gnädiger Herr?“, vernahm Pohanka von Moritz.
„Nein, nein ...“ Die Tür fiel mit einem Klicken ins Schloss. „Wunderbar“, dachte Emil, „der Herr von und zu übernachtet nicht in seiner Kammer.“
Dann stand es ihm frei, später in aller Ruhe den Schreibtisch in der Bibliothek zu durchsuchen. Er musste den Brief unbedingt finden, damit er der Baronin die gewünschten Neuigkeiten überbringen konnte.
2
Im Palais Tiefenthal
Z
wei Wochen später war Frieda ihren Zielen noch kein Stück nähergekommen. Die Informationen von Pohanka waren nur spärlich gewesen. Je mehr sich die Hinweise verdichtet hatten, dass Karl fest entschlossen war, Thaddäus zurückzuholen und damit Gabriels und ihre Zukunftsaussichten zu vernichten, desto verschlossener hatte sich von Leutgeben gezeigt.
Frieda ärgerte sich über ihren schon lange zurückliegenden Wutausbruch vor dem Sekretär. Damit hatte sie die letzte womöglich vorhandene Sympathie des Angestellten ihres Schwiegervaters verspielt. Von Leutgeben grüßte sie zwar noch, wechselte aber sonst kein Wort mehr mit ihr. Sie war bei dieser Quelle vollkommen von dem Trottel Pohanka abhängig.
Gabriel schwelgte in seiner üblichen Ahnungslosigkeit und begnügte sich mit knappen Berichten über den Fortgang des Wäscheimperiums. Solange er genug Geld für seine Umtriebigkeiten am Spittel Berg hatte, fand er keinen Grund für Besorgnis.
Seine Frau hingegen zerbrach sich sehr wohl den Kopf darüber, wie sie das Vermögen endlich in ihre Hände bekommen konnte. Denn sie wollte sich nicht länger mit den bescheidenen Zuwendungen ihres Schwiegervaters zufriedengeben. Wie sollte sie auch mit nur 4.000 Gulden[3] im Jahr ihr Auslangen haben? Die Schneider, Hutmacher und Kurzwarenhändler waren allesamt geldgierige Hyänen. Wenn sie nicht jedes Mal zumindest einen kleinen Teil der Schulden, die sie vielerorts angehäuft hatte, abtrug, bekam sie keine neuen Sachen mehr. Nein, so konnte es nicht weitergehen. Sie wollte alles.
Ein schüchternes Klopfen ließ Frieda aufblicken. „Herein!“, herrschte sie ungehalten. Eine blutjunge Magd öffnete zögerlich und stand unentschlossen mit einem Kübel Wasser in der Tür. Die Baronin zeigte auf ihre Badewanne. „Da hin, du ungeschickter Trampel!“ Das Mädchen nickte und tat wie ihm geheißen. Frieda kniff die Augen zusammen und sah das unscheinbare Ding an. „Du bist neu hier?“
„Ja, ich Eszter. Nichte von Köchin. Komme Ungarn.“
„Ah, ja“, Frieda winkte gelangweilt ab. „Ich habe davon schon gehört. Ildikó wollte dich als zusätzliche Küchenhilfe hier haben.“
Sie trat hinter den Paravent und murmelte. „Wann kommt Edith endlich?“ Frieda hasste die Trödelei ihrer Zofe. Sie hörte das Wasser in die Wanne plätschern.
Plötzlich fiel ihr etwas ein. Sie kam wieder hinter dem Wandschirm vor. „Warte. Warst du bisher nicht am Landgut in Keszthely?“
Eszter nickte. „Igen ... äh ... ja. Waschen Geschirr.“
Frieda zuckte mit den Achseln. „Kann ja nicht viel gewesen sein. Es ist ja nur der junge Herr Baron dort.“
Das Mädchen sah sie mit großen Augen an. Langsam schüttelte Eszter den Kopf. „Nicht verstehen.“
Frieda verdrehte genervt die Augen. „Ich sagte, dass ja nur der junge Baron, Thaddäus von Tiefenthal, dort lebt. Und da gibt es nicht viel zu tun, du dummes Ding. Ich hoffe, ich muss mich nicht allzu oft mit dir abgeben.“
Eszter war von ihrer Tante auf den lausigen Charakter der Herrin vorbereitet worden. Sie biss sich auf die Lippen, bevor sie antwortete: „Nein, niemand da. Immer nur Dienstleute.“
Aufbrausend wie eine Furie fuhr die Baronin zu ihr herum und riss beide Arme hoch. „Was soll das heißen? Es war niemand da?“
Die junge Magd ließ den Eimer scheppernd fallen und schlug erschrocken die Hände vor ihr Gesicht, weil sie fürchtete, die Herrin würde zuschlagen.
Eszter floh entsetzt aus dem Raum. Frieda trat wütend gegen den Kübel und kreischte wie eine Verrückte: „Pohanka!!“
Sie kochte vor Wut. Diesen elenden Wurm würde es teuer zu stehen kommen, dass er seine Aufträge nicht ordentlich ausgeführt hatte. Frieda riss eine ihrer Truhen auf und griff nach ihrer Reitgerte.
„Ihr habt gerufen, Frau Baronin?“ Der Kammerdiener verneigte sich tief, um im nächsten Augenblick unter dem Hieb der Pferdepeitsche aufzujaulen. Pohanka riss schreiend die Arme hoch und versuchte den Schlägen zu entkommen.
„Du widerwärtiger Verräter! Du intrigantes Schwein!“ Die Baronin keuchte vor Anstrengung.
„Was habe ich getan? Was habe ich getan?“, wimmerte Pohanka.
„Was du getan hast? Du hast mich belogen und betrogen! Laut dieser neuen Spülmagd ist Thaddäus gar nicht mehr in Ungarn. Wo ist er dann?“ Frieda hatte die Gerte weggeworfen, doch sie war noch nicht fertig. Sie holte aus und verpasste dem Kammerdiener eine schallende Ohrfeige. „Du weißt etwas und du hast mich absichtlich im falschen Glauben gelassen.“ Sie drohte ihm mit dem Zeigefinger. „Sprich oder du bist noch heute deine Stellung los!“
Emils Augen weiteten sich vor blanker Angst. „Nein“, sagte er weinerlich. „Nein, ich weiß doch nichts.“ Er hob seine Handflächen nach oben. „Ich habe Euch doch von jedem Brief, den der Herr Baron geschrieben oder erhalten hat, sofort berichtet. Auch von dem letzten, in dem der Herr Baron noch einmal angedeutet hat, dass der junge Herr Thaddäus wieder in Wien willkommen ist.“
Frieda hatte sich etwas beruhigt und sah Pohanka finster an. „Und alle diese Briefe sind nach Ungarn gesendet worden?“
Der Diener nickte. „Ja, ausnahmslos alle. Leutgeben hat jeden Brief mit der Adresse des Landguts beschriftet.“
Die Baronin kniff die Augen zusammen. „Und Leutgeben war dann auch derjenige, der die Post an den Kurier gesandt hat?“
Pohanka hob leicht die Schultern. „Das zählt zu seinen Aufgaben, ja.“ Die Stellen, wo die Baronin ihn mit der Peitsche getroffen hatte und seine Wange brannten, aber er wagte es nicht hinzugreifen, um sie nicht noch mehr gegen sich aufzubringen. Er musste die Züchtigung, ob verdient oder nicht, widerstandslos schlucken.
„Dieser Leutgeben könnte mehr wissen. Wir müssen zuerst herausfinden, wie lange Thaddäus überhaupt in Keszthely gewesen ist. Weder mein Schwiegervater noch sonst jemand von uns ist seitdem wieder dort hingefahren.“ Frieda begann in ihrem Zimmer hin- und herzuwandern. „Wann hat Thaddäus das Landgut verlassen? Aber die wichtigste Frage ist: Wo ist er jetzt?“ Die Baronin schwang herum. „Ich bin mir sicher, dass dieser dahergelaufene Sekretär etwas mit der Sache zu tun hat. Er könnte die Briefe weiß Gott wohin geschickt haben.“
„Äh, wohin denn, Frau Baronin?“ Pohanka ließ seine Hand schnell sinken, denn er hatte sich nun doch über die schmerzende Wange gerieben.
„Dorthin, wo sich Thaddäus gerade aufhält, du Schwachkopf!“ Frieda tippte ungeduldig mit dem Fuß auf den Boden. „Hast du jemanden, dem du vertraust und der etwas für dich erledigen kann?
Emil dachte kurz nach und dann nickte er. Die Baronin kam wieder mit erhobenem Zeigefinger auf ihn zu. „Wage es ja nicht, mich reinzulegen.“
„Nein, nein. Einer meiner Neffen ist noch zu jung für eine Stelle. Er kann etwas für mich erledigen. Was soll es denn sein?“
„Von Leutgeben. Ich muss ab jetzt über jeden seiner Schritte Bescheid wissen. Er geht doch ständig ein und aus. Und etliche Male in der Woche ist er auch über Nacht weg.“
„Ja, bei seiner Mutter“, murmelte Pohanka.
„Und wo ist das?“, fragte Frieda scharf.
Der Kammerdiener hob zur Antwort wieder nur die Schultern. Er war erneut nicht vorbereitet und die nächste Ohrfeige landete klatschend auf seiner bereits malträtierten Wange. Pohanka schnaufte gepeinigt auf. Woher nahm diese Furie nur so viel Kraft? Ihre schrille Stimme ließ seine Ohren klingen: „Dann finde es raus, du Nichtsnutz!“
Der Kammerdiener floh auf den Gang und lehnte sich schwer atmend an die Wand. Der Gedanke an eine neue Stelle nach dem Tod des Barons drängte sich wieder in den Vordergrund.
Pohanka schüttelte den Kopf. Selbst wenn sich diesen Schritt überlegte, war er immer noch der mercé[4] der Baronin ausgeliefert. Denn wer würde ihm sonst ein gutes Zeugnis ausstellen?
3
Im Palais Lafarche
Februar 1775
T
obi lehnte mit dem Kopf an Josephs Schulter. Sie saßen in der riesigen Bibliothek der Familie Lafarche auf einem Sofa und blätterten in einem Atlas, den der Achtjährige zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte. Der ältere Bruder von Tobias saß neben Josephs Vater, Baron Egmont Lafarche. Mithilfe eines Heftchens für Schulanfänger übten sie das Alphabet. Joseph ließ kurz den Blick auf Anton ruhen und wandte sich dann wieder Tobi zu. Es war kaum drei Monate her, dass Joseph die beiden Straßenkinder in Pflege genommen hatte, aber er empfand sie bereits als fixen Teil seiner Familie.
„Meine Familie“, dachte er und seine Augen wanderten augenblicklich zu Marie, die in ein Gespräch mit seiner Mutter Madeleine vertieft war. Bald gab es nicht nur mehr seine Eltern und seine beiden Schwestern, sondern tatsächlich seine eigene Familie. Joseph, der von allen meistens „Seffi“ gerufen wurde, schwelgte in dem Moment, als Marie seinen Heiratsantrag angenommen hatte.
Er hatte die Schwester seines Schwagers Alexander Eisenhardt schon jahrelang angebetet, während sie als Gesellschafterin seiner Mutter und seiner Großtante Helene bei ihnen im Palais gewohnt hatte.
Im letzten Jahr hatte sie ihn endlich erhört. Marie hatte nicht nur eingewilligt seine Frau zu werden, sondern sie hatte auch vorgeschlagen, dass Anton und Tobias bei ihnen bleiben sollten. Ihrer Meinung nach hatten die Schutzengel der Waisenkinder das Schicksal beeinflusst, weil Seffi zuerst den kleinen Tobi auf dem Hohen Marckt aufgelesen hatte und dann die Polizey mit seiner Hilfe auch den damals verschwundenen Toni hatte wiederfinden können.
Alexander und Seffis ältere Schwester Constanze waren mehr als bereit gewesen, die beiden Jungen nach Egersfeld in ihre Findelanstalt mitzunehmen. Marie wusste, dass es ihnen dort auch gut gegangen wäre, aber sie hatte die Kinder fest ins Herz geschlossen und wollte sie bei sich haben. Joseph hatte nicht über Maries Idee nachdenken müssen, denn er hatte denselben Wunsch gehegt.
„Von wo genau kommt Opa Egmonts Kaffee?“, fragte Tobi. Er hatte sofort Seffis ganze Aufmerksamkeit.
„Blättere ein paar Seiten weiter bis nach Afrika.“ Seffi wartete und zeigte dann auf Abessinien. Tobi spreizte seine Hand über der Karte und sein kleiner Finger reichte nur bis zum Mittelmeer.
„So weit weg?“, fragte er erstaunt. Abessinien, der Nil, das Rote Meer, Ägypten. Tobis Augen flogen hin und her.
„Ja, die Bohnen sind lange unterwegs, bis sie in meinem Morgenkaffee landen.“ Seffi nickte.
„Oder in der Silbernen Schlange für seeehr viel Geld verkauft werden“, krähte Tobi vergnügt.
Egmonts Lachen dröhnte zu ihnen rüber. „Gut gesprochen.“ Er zwinkerte dem Kind zu und zeigte auf seinen Erben. „Wenn du doch das Interesse an unserem Kaffeehandel verlierst, habe ich vielleicht mit diesem jungen Mann bessere Chancen.“
Bevor er antwortete, zog Joseph eine Grimasse, als hätte er in eine besonders saure Zitrone gebissen.
„Nachdem du mich schon fast ein dreiviertel Jahr durch deine sogenannte Lehre schleifst, gebe ich nicht mehr so schnell auf.“ Er sah Tobi an und grummelte: „Du wirst hübsch warten, mein Sohn.“
Egmont schlug mit seiner großen Hand zufrieden auf seinen Schenkel. „Wunderbar. Dann kann ich mich ja bald zurückziehen und mich meinen acht Enkelkindern widmen.“
Anton hob den Kopf und strahlte den alten Mann an. Constanze war seit einigen Jahren mit Alexander Eisenhardt verheiratet und sie hatten sechs Kinder. Annemarie, die jüngere Tochter, hatte nach dem Tod ihres Verlobten Walther die Ehe- und Kinderlosigkeit gewählt. Damit war klar, dass Egmont Lafarche die beiden Jungen als gleichwertig betrachtete. Zufrieden kuschelte sich Toni näher an seinen Ziehgroßvater und steckte seine Nase wieder in sein Lehrbuch, dessen Titel ihm wohl erst nach dem Erlernen des Alphabets etwas sagen würde:
„Neu erfundener Lust-Weg zu allerley schönen Künsten und Wissenschaften : welcher besteht in einer besondern Erfindung : wie die zarte Jugend durch Beyhilffe gewisser darzu bequemen Bildern ganz spielende den ersten Haubtgrund dess ABC und Buchstabierens erlernen: und selbige dadurch fast ohne Lehrmeister in gar kurzer Zeit zum volligen teutsch- und lateinischen Lesen und Schreiben perfectionirt werden konnen : wegen verhoffenden sonderbaren Nutzens der Jugend vorgestellt.“
Was hatte sich der Autor namens Johann Christoph Weigel bei der Wahl des Titels wohl gedacht? Denn das Büchlein selbst war überhaupt nicht kompliziert. Anhand von hübschen Illustrationen wie beispielsweise dem Bild von einem Bader wurde der Buchstabe B vorgestellt. Toni konzentrierte sich darauf und ihm entging dadurch Seffis Miene.
Der einzige Erbe und mögliche Nachfolger von Baron Lafarche sah beunruhigt aus. Sollte die ganze Last der Verantwortung wirklich schon so bald auf seinen Schultern ruhen? Sie waren durch sein regelmäßiges Training wohl breit genug, aber fühlte er sich denn schon bereit dafür? Seffis Blick fiel auf seinen Hund Büdi, der auf dem Teppich vor dem Kamin lag und friedlich döste. In weniger als einem Jahr hatte sein Leben eine völlige Kehrtwendung gemacht. Als Ewigstudent hatte sich Joseph August Lafarche herzlich wenig den Kopf über das tägliche Leben zerbrochen. Nach einigen sehr ernst gemeinten Ermahnungen seines Vaters hatte Seffi sein Studium der Juridica abgeschlossen, aber der eigentliche Wendepunkt war der gewaltsame Tod seines besten Freundes Franz Hörlezeder gewesen. Danach war nichts mehr wie früher geblieben. Seffi hatte die Lust am Trinken verloren, was kein Schaden für ihn gewesen war, und der Straßenköter Büdi war in sein Leben gepurzelt, was definitiv ein Schaden war, wenn man dessen Angewohnheit betrachtete, seinen Auslauf im Morgengrauen einzufordern. Noch dazu am Glacis vor den Stadttoren Wiens! Einen erheblich langen Fußmarsch vom Palais entfernt.
Doch Josephs Blick ruhte liebevoll auf dem eher hässlichen Tier, denn Bűdös war der beste Gefährte, den man sich wünschen konnte. „Büdi“, dachte sein Besitzer amüsiert. Seinem Kosenamen, der sich aus einer ungarischen Bezeichnung für etwas Stinkendes ergeben hatte, wurde der Hund eigentlich nur mehr gerecht, wenn ihn die Familienköchin Resi mit Kutteln gefüttert hatte.
Tobi zeichnete mit gerunzelter Stirn den Verlauf des Nils nach und gab Joseph die Gelegenheit, weiter seinen Gedanken nachzuhängen. Er sah wieder zu Marie. Sie bückte sich gerade nach einer Ledermappe, in der sie ihre Unterlagen für die Hochzeitsplanung aufbewahrte und sie holte einen Karton hervor, an dem verschiedene Stoffstreifen hingen. Joseph wollte sich aus dem Thema schon wieder ausklinken, als er den Kommentar seiner Mutter aufschnappte: „Oh, dieses Material fällt besonders schön, meine Liebe. Aber der Stoff ist recht dünn und eignet sich eher für ein Sommerbrautkleid.“
Joseph sah, dass seine Verlobte eifrig nickte und eine Antwort parat hatte, die ihm keineswegs behagte.
„Wir könnten den Hochzeitstermin per Ende Juni festlegen.“ Da musste Seffi dringend eingreifen.
Er drückte Tobi liebevoll. „Schaust du kurz allein weiter? Ich muss etwas mit Marie besprechen.“ Der Kleine nickte abgelenkt und zog den Atlas zu sich. Seffi erhob sich und schlenderte zu den Damen des Hauses. Ohne Vorwarnung ergriff er die Hand seiner Verlobten. „Verzeih, meine Liebe, hast du einen Augenblick Zeit für mich?“ Marie sah verwirrt auf. „Aber ...“ Doch weiter kam sie nicht, denn Seffi hatte ihr Handgelenk arretiert und zog sie sanft, aber bestimmt hoch. Er nickte seiner Mutter höflich zu. „Entschuldigen Sie uns bitte, werte Mama.“
Der junge Baron schob seine Braut aus der Bibliothek auf den kalten Gang hinaus. Kaum war die Tür ins Schloss gefallen, schwang er Marie zu sich herum. Sie prallte gegen seine harte Brust und er schloss sie in die Arme. Im schwachen Tageslicht konnte sie ein gefährliches Funkeln in Seffis blauen Augen erkennen.
„Was ...“, doch ihr Protest wurde von seinem Angriff erstickt. Seffi drückte der Frau seines Herzens einen sehr bestimmten Kuss auf ihre weichen und sehr einladenden Lippen. Ihren zweiten Versuch zu protestieren, nützte Seffi schamlos aus, um seine Liebkosung zu vertiefen. Er erforschte jeden Winkel ihres süßen Mundes. Maries Gegenwehr war schon nach einem Wimpernschlag zusammengebrochen. Sie krallte sich wie eine Ertrinkende an seine Wolljacke.
Nach einer Weile beendete Seffi mit einem Seufzer den Kuss. Er sah Marie tief in die Augen.
„So, meine Liebe. Das war nur ein winziger Vorgeschmack auf das, was dich in unserer Hochzeitsnacht erwartet. Ich werde jede Stelle deines entzückenden Körpers entdecken und auf alle nur erdenklich mögliche Arten liebkosen. Wenn ich damit fertig bin, wirst du mich anflehen, mich endlich mit dir zu vereinen.“ Seffi sah in Maries weit aufgerissene Augen und seine Lippen verzogen sich zu einem trägen Lächeln.
„Du wirst dann endgültig die Meine sein und ich werde dich zu Wonnen führen, von denen du noch nicht einmal zu träumen gewagt hast.“ Er nickte entschlossen. „Und in unserer Ehe werden wir einander wieder und wieder Freude bereiten — am Abend, in der Nacht, vielleicht auch am Morgen.“ Bei den nächsten Worten knurrte Seffi fast: „Wenn es der Mistköter zulässt.“ Er küsste Marie auf die Nasenspitze. „Bestimmt wirst du bald unser erstes Kind in deinem Schoß tragen und ich werde deinen wundervollen Leib noch mehr verwöhnen.“ Joseph presste sich dicht an Marie und ließ keinen Zweifel daran, wie ernst er seine Worte meinte. Er lächelte sie kurz an, doch dann brummte er ungehalten: „Mitte April. Das ist der äußerste Termin, den ich dir zugestehe. Bis dahin hast du Zeit für deine Planungen.“ Seffi entließ die völlig verdutzte Marie aus seiner Umarmung. Er strich ihr eine goldene Locke, die sich aus ihrer Frisur gelöst hatte, hinters Ohr. „Du gehst jetzt wieder da rein und suchst dir einen hübschen Frühjahrsstoff für dein Brautkleid aus.“
Er griff zur Türschnalle, doch bevor er die schwere Tür zur Bibliothek öffnete, drückte er ihr noch einen Kuss auf. Seffi stieß einen Pfiff aus. „Komm, Büdi, du brauchst dringend frische Luft.“ Der Hund kam sofort herausgeschossen und seine Krallen klickten gleich darauf auf der Marmortreppe.
Während die Tür zufiel, konnte Seffi noch die Stimme seiner Mutter hören: „Oh, meine Teure, ist alles in Ordnung? Du siehst ein wenig erhitzt aus.“
Mit einem diabolischen Grinsen wandte sich der Erbe des Lafarche-Vermögens zur Treppe und folgte seinem Hund.
Rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit war Seffi wieder zurück im Palais. Die Zeit an der frischen Luft hatte nicht nur Büdi gutgetan. Joseph fühlte sich erfrischt und nach diesem angenehmen Sonntag konnte die nächste Arbeitswoche losgehen. Büdi wuselte sofort in die Küche und sein Herr stieg die Marmortreppe hinauf. „Wie in meinem Leben“, dachte Seffi amüsiert. Sein Vater hatte ihn monatelang mit einem mehr als unhandlichen Kasten sämtliche Abnehmer für Kaffee abklappern lassen. Seit letztem Herbst arbeitete er im Lagerhaus unter der Aufsicht des langjährigen Lagerleiters Herrn Schefzig. Egmont hatte darauf bestanden, dass sein Nachfolger den Kaffeehandel von der untersten Stufe weg kennenlernte und das, bei Gott, wurde Joseph auch zuteil.
Die Tage der Mithilfe bei der Einlagerung der frisch angelieferten Bohnen und der Herstellung der Röstproben hatte Seffi bereits hinter sich gelassen. Er hatte diese Zeit eher verflucht als geschätzt, aber eines musste er seinem Vater lassen: Er kannte nun jedes Detail des Geschäfts.
Zudem hatte er den Respekt der Mitarbeiter errungen. Er hatte mit dem kroatischen Lagerarbeiter Zvone genauso Seite an Seite gearbeitet wie mit Xaver Heufelder, dem Verantwortlichen für die Einwaage.
Seit Weihnachten ging Joseph Herrn Schefzig direkt in der Administration zur Hand. Aufgrund von Seffis Ausbildung zum Juristen landeten sämtliche Verträge automatisch auf seinem Pult. In manchen Momenten war nicht mehr klar zu erkennen, wer eigentlich wen anleitete. Seffi hätte sich aber eher auf die Zunge gebissen, bevor er dem Lagerleiter in irgendeiner Form in dessen Agenden dreingeredet hätte. Der rechte Arm seines Vaters sollte doch unbedingt eines Tages für ihn da sein.
Egmont und Madeleine hatten sich für die Nachmittagsruhe zurückgezogen. Marie war mit den Jungen in den kleinen Wohnsalon gegangen, der leichter beheizt werden konnte und am Abend mehr Wärme bot als die Bibliothek. Anton und Tobias lagen auf einem dicken Teppich am Boden und waren in ein Brettspiel vertieft. Marie saß auf einem Polstersessel und las in einem Ratgeber für junge Brautleute.
Seffi verzog das Gesicht und überlegte, wie er seine Verlobte von ihren intensiven Vorbereitungen ablenken konnte. Unter der Woche war er bis zum Abend außer Haus und so blieb Marie nur der Sonntag, um seine Teilnahme zu gewinnen.
Doch die Auswahl der Speisenfolge war ihm ebenso gleichgültig wie die Farbe der Schleifen für die Blumenkinder. Das sollte sich Marie doch wirklich mit seiner Schwester Constanze ausmachen.
Anfangs hatte Seffi ein mildes Interesse an den Eheratgebern gezeigt, die sich Marie eifrig besorgt hatte. Er hatte ihr zu verstehen gegeben, dass er ihre Bemühungen zu schätzen wisse, doch der Inhalt der Lektüre war ihm gewaltig gegen den Strich gegangen. Er war auf absolut unnötige Weisheiten gestoßen: distanziert-höflicher Umgang miteinander, die Vermeidung von häuslichen Streitigkeiten und, Gott bewahre, Enthaltsamkeit im Ehebett. Er selbst war gegenteiliger Meinung. Für ihn waren seine ständigen Neckereien und Vertraulichkeiten erst die Würze des Alltags. Dicke Luft wurde am besten mit einem heftigen Wortgefecht gereinigt und er wollte seine Frau mit Sicherheit um den Verstand v*****.
So viel zu den Ratgebern!
Seffi beschloss, dass es Zeit war, zu handeln. Er hörte Büdi am Gang Laut geben und ließ ihn ein. Dann drehte sich mit Schwung zu seinen Ziehsöhnen um und fragte: „Was meint ihr? Sollen wir am nächsten Sonntag wieder einmal einen ausgedehnten Waldspaziergang machen?“
Toni und Tobi waren sofort auf den Beinen und jubelten. Die Holzmännchen des Brettspiels kullerten über den Boden. Büdi wusste nicht, worum es ging, aber er fiel mit lautem Gekläffe mit ein. Joseph hob beide Hände hoch. „Also abgemacht. Beruhigt euch wieder.“ Er warf seinem Hund einen strengen Blick zu. „Du auch, Ruhe und sitz!“ Büdi gehorchte augenblicklich und ließ sich direkt neben Marie nieder, weil er gestreichelt werden wollte. Sie lächelte den Grund für die Unterbrechung ihrer Lektüre an und graulte das gute Tier hinter den Ohren.
Tobi sah zu Seffi auf: „Können wir es wie beim letzten Mal machen?“ Sein Ziehvater stöhnte kurz bei dem Gedanken an den hässlichen alten Gaul, den er vor dem Schlachthof bewahrt hatte. „Nein. Herbert kann gerne wieder mitkommen, aber Theodor muss im Stall bleiben.“ Die beiden Jungen machten enttäuschte Gesichter, aber Seffi blieb hart. „Kein Theodor. Es gibt zwar heuer noch keinen Schnee, aber es ist zu kalt für so ein altes Pferd.“
Mit diesem Argument drang er durch. Die Brüder nickten verständig. Dann stürmten sie hinaus, um dem Stallburschen Herbert die gute Neuigkeit zu überbringen. Der Lehrling des Stallmeisters Hannes war ein wenig älter als die beiden, doch das hatte sie nicht davon abgehalten, eine enge Freundschaft zu schließen.
„Aber du!“ Seffi näherte sich seiner Verlobten mit raubtierhaften Schritten. Marie schreckte zusammen. „Aber du wirst mitkommen. Die frische Luft wird deinen Teint erstrahlen lassen.“
„Ich soll in den Wald mitgehen?“ Marie starrte Seffi an, als hätte er den Verstand verloren.
„Ja.“ Seffi nahm ihr den Lesestoff aus der Hand. „Du musst dich unbedingt von diesem Unfug lösen.“
Er hatte seine Worte absichtlich gewählt und weidete sich am Zorn, der seiner Lieblingsfrau gerade in zarter Röte auf die Wangen kroch. Wie erwartet kniff sie die Augen zu engen Schlitzen zusammen. Gleich würde sie mit dem erstbesten Gegenstand, dessen sie habhaft werden konnte, nach ihm werfen. Seffi trat blitzschnell auf sie zu, beugte sich vor und küsste sie. Marie quiekte empört auf, doch an der Entspannung ihrer Lippen merkte Seffi, dass er ihr erfolgreich den Wind aus den Segeln genommen hatte.
„Ich habe nichts zum Anziehen für solche Lausbubenabenteuer“, protestierte Marie. Sie sah Seffi entrüstet an. „Das letzte Mal habt ihr ein leeres Vogelnest, irgendein Gestrüpp und einen toten Frosch angeschleppt!“
„Es waren ein paar Zweige Hartriegel und die Amphibie war erst halbtot“, erklärte Joseph gelassen. Er richtete sich auf und grinste sie breit an. „Das war alles für die Bildung. Der Hauslehrer der beiden war ganz begeistert und sie haben den Frosch gemeinsam aufgeschnitten.“
Marie verzog angeekelt das Gesicht. Joseph tippte ihr auf die Nase. „Nicht doch. Das gibt nur vorzeitig Fältchen.“
Zur Antwort hob sie nur leicht ihre linke Augenbraue und ließ dabei keinen Zweifel, dass sie durch und durch eine geborene Comtesse von Eisenhardt war. Sie legte noch mehr Herablassung in ihren Blick.
„Wie gesagt: Ich habe für solche Arten von Unternehmungen nichts zum Anziehen. Warum soll ausgerechnet ich mitkommen? Du hast doch deinen Männerverein!“ Sie wedelte abfällig mit der Hand.
Joseph schenkte ihr sein verführerischstes Lächeln. „Wir sehen gleich in der Kammer mit der Ausstattung für das Gesinde nach. Dort finden wir bestimmt etwas für dich. Und du kommst mit, weil das irregeleitete Mannsvolk dringend deine sanfte weibliche Hand braucht.“
Bevor Marie etwas erwidern konnte, drückte Seffi ihr das Heftchen mit den Eheratschlägen wieder in die Hand. „Steht doch alles da drinnen, nicht wahr mein Schatz?“
4
In Maries Zimmer
A
m nächsten Sonntag stand Marie vor dem Spiegel und sah entsetzt an sich herab. Ihre Zofe Annerl hatte ihr geholfen, das Kleid vom Kirchgang abzulegen und die anderen Sachen anzuziehen. Marie konnte sich nicht erklären, welcher Teufel sie geritten hatte, als sie doch ihre Einwilligung zu der Unternehmung gegeben hatte.
„Oh, wohl. Ein Teufel namens Seffi“, murmelte Marie ungehalten, während sie die braunen Hosen betrachtete, die in Stallarbeiterstiefeln verschwanden. Herbert war erst vor Kurzem daraus herausgewachsen und Seffi hatte das Paar zu Maries Wald-und Wiesen-Stiefeln auserkoren.
Annerl stand mit skeptischer Miene neben ihrer Herrin und hielt einen unansehnlichen Wollmantel so weit wie möglich von sich. Sie hatte das Haar der Comtesse zu einem dicken Zopf geflochten, der nun unter dem Mantel und einem dicken Schal verschwand. Den Abschluss machte ein sehr alter Dreispitz.
Marie seufzte. „Zum Glück bin ich schon verlobt“, grummelte sie. „Mit diesem Auftritt hätte ich jeden möglichen Verehrer bis in alle Ewigkeit verscheucht.“
Die junge Zofe kicherte. „Der gnädige Herr ist so oder so ganz angetan von Ihnen.“
Marie lächelte milde. „Habe ich ein Glück.“
Sie hörte, dass Seffi nach den Jungen rief, die sofort unter lautem Gejohle die Treppe hinunterstürzten. Büdi tat selbstverständlich auch seine Anwesenheit kund. Marie verdrehte kurz die Augen und warf einen letzten Blick auf ihr Spiegelbild. „Besser nicht zu lange hinschauen“, jammerte sie. Sie grüßte Annerl und ging dann im ungewohnten Schuhwerk ebenfalls die Treppe hinunter.
Joseph hatte Herbert gebeten, den Leiterwagen zu richten. Der Lehrling spannte ein robustes junges Pferd namens Leander davor. Der Erbe des Hauses war sich nicht zu schade, ein paar Heuballen auf die Ladefläche zu hieven, damit es die jungen Herren bequem hatten. Anton und Tobias halfen eifrig mit und streckten sich zufrieden aus.
Büdi thronte auf dem Kutschbock, doch das passte Seffi nicht. Er wollte seine Verlobte an der Seite haben und nicht den ehemaligen Straßenköter. Er klopfte auf einen der Heuballen. „Schau, mein Guter, wie bequem du es hier hast. Komm, mach Platz!“ Büdi hüpfte begeistert nach hinten. „So ist es fein, braver Hund.“
Das Tier hechelte zufrieden und hatte keine Ahnung, dass es gerade elegant ausgebootet worden war.
Marie erschien im Torbogen. Joseph grinste bei ihrem Anblick von einem Ohr zum anderen. „Perfekt!“ Er zeigte mit einer galanten Verbeugung auf das Gefährt. „Mitfahrgelegenheit gewünscht?“
Seine Verlobte hob die Augenbrauen und zupfte ihren Schal so zurecht, dass niemand, der vielleicht zufällig vorbeikam erahnen konnte, wer sie war.
„Nur gegen Bezahlung“, gab sie hochmütig zurück.
Joseph lachte. „Du möchtest einen Obolus als Gegenleistung für deine Gesellschaft?“ Er trat ganz nahe an sie heran. „Ich würde dich sehr gerne gleich an Ort und Stelle bis zur Besinnungslosigkeit küssen, aber ...“ Er ließ seinen Blick über ihre Gestalt wandern. „Wenn man uns so zusammen sieht, ist mein Ruf endgültig ruiniert.“ Seffi zwinkerte ihr zu.
Marie hob die Augenbrauen noch etwas höher. „Ich dachte eher an ein hübsches Kleinod.“
Er verstand sie absichtlich falsch. „Was? Du willst ein Kind von mir? Das wird sich bald einrichten lassen.“ Er lachte leise. „Ja, und den Schmuck bekommst du auch.“ Dann packte er sie bei der Taille und hob sie auf den Kutschbock. Wie zu erwarten, quietschte sie überrascht auf. Während er Marie auf den Leiterwagen half, stellte er zufrieden fest, dass ihr Hinterteil in den Hosen sehr attraktiv war.
Marie entschloss sich zu stoischer Gelassenheit, um Joseph nicht noch mehr Gelegenheit für seine Neckereien zu geben. Sie wandte sich zu den beiden Jungen um. „Also, ihr zwei Waldschrate, wie wird das Abenteuer aussehen?“
Der ältere Toni schenkte ihr ein Grinsen, seit Neuestem mit Zahnlücke. „Wir fahren hoch bis nach Neuwaldegg. Dort stellen wir Leander in der Poststation unter. Das letzte Mal haben wir Theodor mitgenommen, aber Seffi möchte den Weg heute ganz ohne Pferd machen.“ Tobi nickte eifrig und schnatterte aufgeregt weiter: „Zuerst wandern wir durch die Weinberge und dann gehen wir in den Hochenaist[5] nach Schätzen suchen.“
Joseph war noch einmal ins Palais gegangen und kehrte mit Decken und einem Korb zurück. „Es gibt dort einen kleinen Weiher, wo es allerlei zu erforschen gibt.“ Er hob den Deckel. „Für das leibliche Wohl vorher und nachher ist gesorgt.“
Marie sah die Essensvorräte mit großen Augen an. „Sind wir denn mehrere Tage unterwegs?“
Joseph lächelte schief. „Ach nein, aber du bist mit einem hungrigen Männertrupp unterwegs.“ Er zwinkerte Herbert zu. „Unsere Resi weiß Bescheid.“
Seffi stellte den Korb auf die Ladeflache und sah seine Ziehsöhne mit gespielter Strenge an.
„Das müsst ihr unter dem Einsatz eures Lebens bewachen.“
„Jaaaa“, krähte Toni begeistert. „Wir werden es jedem Räuber zeigen.“ Er streckte seine kleinen Fäuste hoch. Seffi lachte. „Ja, denen auch. Ich habe aber Büdi gemeint.“ Mit zwei Schritten war er vorn beim Kutschbock und schwang sich behänd hinauf. Er griff nach den Zügeln und ließ Herbert Zeit zum Aufsteigen. „Ab mit uns!“
Während der Fahrt waren die drei Jungen in ein Gespräch über die Vorzüge verschiedener Pferderassen vertieft. Marie genoss ihre neue Freiheit in vollen Zügen. Ein Tag ohne Korsett und Unterröcke war eine unerwartete Wohltat. Sie hätte es vor Seffi aber nie zugegeben. Am Ende erwartete er vielleicht noch Dankbarkeit für seine verrückte Idee.
Sie verließen Wien über das Burgtor und Seffi dirigierte Leander über das Glacis Richtung Hernals[6]. Marie staunte immer wieder von Neuem über die Weitläufigkeit der Grasfläche vor den Stadtmauern. „Und du kommst wirklich jeden Morgen mit Büdi hierher?“, fragte sie mit einem Hauch von Skepsis.
Seffi nickte zuerst mit zusammengepressten Lippen. „Ja, und ich darf ihm dann im gestreckten Lauf hinterherjagen.“
Marie kicherte. „Kein Wunder, dass du nun ein Ausbund an körperlicher Tüchtigkeit bist.“ Joseph zog eine Grimasse, aber im Grunde genommen war er sehr zufrieden, dass er die Tage der Atemlosigkeit, die ihn schon nach ein paar Stufen heimgesucht hatte, weit hinter sich gelassen hatte. Mit einem Anflug von Wehmut dachte er an einen seiner Studienkollegen, Samuel von Pufendorf. Der Lebensstil, den Seffi zusammen mit ihm und einigen anderen Studienkollegen gepflegt hatte, hatte seinen Freund Pufi vor ein paar Monaten vorzeitig ins Grab gebracht.
„Glaub mir, Marie“, sagte er leise. „Büdi ist das Beste, was mir passieren konnte.“
Seine Verlobte sah ihn nachdenklich von der Seite her an. Sie nickte zustimmend. „Ja, ich weiß. Du vergisst, dass ich dich nun schon mehrere Jahre kenne.“
Seffi lächelte schief. „Es ist erstaunlich. Du hast mich in meinen tiefsten Abgründen gesehen und willst mich dennoch zum Mann nehmen.“
Ihr glockenhelles Lachen war Balsam für seine Gewissensbisse, die ihn wegen seiner Vergangenheit gelegentlich noch einholten. Sie stupste ihn aufmunternd an. „Es kommt doch darauf an, was man nach dem Hinfallen aus sich macht. Und du hast wohl nur Gutes aus dir herausgeholt.“ Sie schenkte ihm ein strahlendes Lächeln und ließ ihren Blick anerkennend über ihn gleiten.
Seffi wandte den Blick schnell wieder ab, sonst hätte er Leander noch in eine falsche Richtung gelenkt.
Er räusperte sich. „Da vorn ist das k. k. Mehlmagazin. Wir biegen vorher in Richtung Hernalser Linie ab.“ Er griff in seine Rocktasche und schaute dann auf die Münzen, die er gefunden hatte. „Hm, das sollte für die Wegmaut und die Poststation reichen.“
Marie sah nachdenklich über die bräunliche Grasfläche. „Ich weiß, dass du bei diesem Thema abblockst, aber ich will nicht mit dir über die Hochzeit sprechen, sondern über die Zeit danach.“ Sie sah Joseph prüfend an.
Nachdem er nicht gleich leidend aufstöhnte, fuhr sie fort: „Ich meine beispielsweise, aus welchem Zimmer wir unser gemeinsames Gemach machen können und wo Büdi schlafen wird.“
Seffi nickte knapp. „Einverstanden. Also Räume haben wir im Palais mehr als genug. Unsere jetzigen Zimmer liegen recht nahe beieinander. Ich habe mit Papa die Möglichkeit besprochen, dass wir zu den Räumen, die einmal Annemaries Zimmer waren, die Wände durchbrechen. Dann hätten wir eine Zimmerflucht ganz für uns. Die Jungen sind gegenüber und ich konnte Büdi schon davon überzeugen, dass er unbedingt auf die beiden aufpassen muss.“ Joseph zuckte kurz mit den Schultern. „Er kommt mich jetzt jeden Morgen abholen.“
Er sah Marie kurz an und lächelte verschmitzt. Sie hatte die Augen zu Schlitzen zusammengekniffen und sah ihn unheilverkündend an.
„Ha, du hast dir doch etwas durch den Kopf gehen lassen. Wann wolltest du mir das mitteilen?“
Seffi hob kurz beide Augenbrauen. „Was unser Eheleben angeht, da fällt mir schon einiges dazu ein ...“
„Aber das, was vorher dazu notwendig ist, behagt dir nicht“, unterbrach ihn Marie.
Ihr Verlobter schnaufte. „Also dazu notwendig wäre eigentlich nur das Sätzchen ‚Ja, ich will‘ vor einem Mann Gottes.“ Er korrigierte kurz Leanders Richtung. „Aber das reicht euch Frauenspersonen ja nicht.“ Er lächelte entschuldigend. „Damit meine ich auch meine teure Frau Mama, Tante Helene und Constanze.“
Marie lehnte sich zurück und überlegte, wie wütend sie auf ihren zukünftigen Göttergatten sein wollte. Nach ein paar Atemzügen kam sie drauf, dass sie überhaupt nicht böse auf ihn war. Was konnte ihr denn Besseres passieren? Er hatte nur bei der Festlegung des Termins seinen Standpunkt klargemacht, sonst sagte Seffi zu all ihren Wünschen und Vorstellungen Ja und Amen. Er wollte nur endlich verheiratet sein. Die Gestaltung des Weges dorthin überließ er gerne den Frauenspersonen, wie er es ausgedrückt hatte, denn dieser Aspekt interessierte ihn überhaupt nicht.
Marie schloss die Augen und hob das Gesicht in das milde Wintersonnenlicht. Sie konnte die zarte Wärme genießen, ohne fürchten zu müssen, dass ihre Haut davon braun wurde. Fast hätte sie die einfachen Leute um ihre Arbeit im Freien beneidet.
Ihre Gedanken flossen träge dahin. Nach einer Weile merkte sie auf. „Wann hast du denn mit deinem Vater gesprochen? Vor oder nach seiner Krankheit?“
Auf Seffis Gesicht legten sich augenblicklich Kummerfalten. Er seufzte: „Ein paar Tage vorher. Aber er ist jetzt natürlich auch noch einverstanden.“ Er schüttelte den Kopf. „Ich möchte dem Arzt gerne Glauben schenken, dass Papa wirklich nur etwas Schlechtes gegessen hatte. Er sagt selbst, dass es ihm gut geht, und er hat auch seinen gesunden Appetit wiedergefunden. Aber trotzdem möchte ich, dass Alexander ihn gründlich untersucht, wenn er nächste Woche nach Wien kommt.“
Marie nickte verständnisvoll. „Ja, es war wirklich schrecklich.“ Sie merkte, dass sich Seffi verkrampfte. Sie legte ihm ihre Hand auf den Arm. „Wir waren alle ganz bekümmert vor Sorge. Eine Zeit lang haben wir das Allerschlimmste befürchtet.“
Ihr Verlobter nickte knapp. „Lass uns das Thema wechseln. Also wir können vier Räume für uns bekommen. Unser Schlafzimmer, ein Ankleidezimmer und einen Wohnsalon ...“
Seffi hatte sich für die Gestaltung ihres neuen Lebensbereichs erwärmt und Marie hörte ihm gerne bei seinen Ideen zu. Endlich interessierte er sich für etwas, was sie beide betraf.
Sie passierten den kleinen Vorort Hernals und bald hatten sie die Poststation in Neuwaldegg erreicht.
Während Seffi zusammen mit Herbert die Einstellung von Leander organisierte, richtete Marie einen Teil von Resis Gaben her. „Das wollt ihr wirklich alles jetzt essen?“ Sie saß neben Tobi und hatte den aufgeklappten Deckel des Korbs als behelfsmäßigen Tisch benutzt. Das war nur möglich gewesen, weil Büdi mit seinem Besitzer mitgegangen war. Der Kleine nickte eifrig. „Die Pasteten, die Würste, das Brot und das Hühnchen sind für jetzt.“ Er linste in das Füllhorn hinein. „Der Kuchen und die Kekse sind dann für später, obwohl ...“, er grinste Marie breit an, „mir ein Keks durchaus auch jetzt genehm sein könnte.“
Marie hob die Augenbrauen. „Ach so, es könnte dir genehm sein?“, näselte sie gekünstelt. „Du, Lausejunge. Du bist doch gar noch nicht alt genug dafür, dass dir etwas genehm sein könnte.“ Sie sah ihn mit gespielter Strenge an. „Du musst tun, was man dir sagt, und essen, was man dir gibt.“
Tobi runzelte die Stirn und überlegte kurz. „Also bei der Mirli-Oma war das schon so, aber ihr seid immer nett zu uns.“ Er lächelte seine Ziehmutter an. „Die Lakaien reden halt immer so – ob Opa Egmont was genehm ist oder nicht.“
„War sie denn so streng, die Mirli-Oma?“, fragte Marie mitfühlend. Tobi zuckte mit den Schultern. „Na ja. Immerhin hat sie sich um uns gekümmert, nachdem die Mama von der Polizey geholt worden war.“ Der kleine Junge ließ den Kopf traurig hängen und scharrte mit den Füßen über den Boden des Leiterwagens. Seine Mutter war vor wenigen Monaten an der Schwindsucht gestorben, doch sie hatte auch schon vorher nicht mehr für ihre Söhne da sein können. Eine Verurteilung für ein lächerliches Vergehen – sie hatte einen Beamten des Kriegsministeriums der Langsamkeit bezichtigt – hatte ihr einige Monate im Arbeitshaus eingebracht. Dabei hatte sich Frau Würer doch nur verzweifelt um eine Waisenrente für ihre Kinder bemüht, nachdem ihr Mann im Krieg gefallen war.
Wegen der Schlamperei der Behörden waren aus ihrem Aufenthalt fast zwei Jahre geworden. Schlussendlich hatte die Criminal-Polizey sie wieder herausgeholt, aber nur damit sie in einer angenehmeren Umgebung an ihrer Krankheit zu Grunde ging. Wenn es nicht diese alte Marktfrau gegeben hätte, die den beiden Jungen ein Dach über dem Kopf und gelegentlich eine warme Mahlzeit gegeben hatte, wären die Kinder wahrscheinlich auch nicht mehr am Leben. Marie strobelte Tobi durch den dichten Haarschopf. „Komm, lass uns nur mehr nach vorne sehen.“
Er nickte und sah dann auf. „Schau sie kommen schon zurück.“ Seffi ließ Herbert aufsteigen und setzte sich dann neben Marie. „Nein, du musst jetzt unten bleiben“, sagte er bestimmt zu seinem Haustier. Büdi machte Sitz und wartete, dass ihm sein Herr die Wurst zuwarf, die Resi für ihn eingepackt hatte. „Hier, fang.“ Seffi nickte zufrieden. „So, jetzt haben wir für eine Weile Ruhe.“
Der Ausflug wurde ein voller Erfolg. Marie konnte für die gefundenen Schätze zwar nicht dieselbe Begeisterung aufbringen wie die Männer, aber der Spaziergang machte ihr großen Spaß. Sie genoss die Natur in vollen Zügen und lernte auch einiges. Der Beruf des Köhlers war ihr durchaus ein Begriff gewesen, diese Leute dann aber wirklich bei ihrer schweren Arbeit im Wald anzutreffen war doch etwas ganz anderes. Die Jungen kannten die charakteristischen Hügel schon und Toni erklärte ihr fachkundig den Aufbau eines Kohlenmeilers mit den akkurat geschichteten Holzscheiten, der Reisigschicht, der Erdabdeckung und dem Quandelschacht. Marie erkannte bedrückt die Armut der Köhlerfamilie. Ihre Wohnhütte war nur ein einfacher Bau aus vier groben Mauern, die weder besonders warm noch heimelig wirkten. Die Bewohner waren schlecht gekleidet und wirkten ausgemergelt. Auf ihre Frage hin nickte Seffi ernst. „Mama gibt unserem Lieferanten jedes Mal etwas Lebensmittel und Kleidung für seine Kinder mit.“ Er zeigte mit dem Kinn auf die armselige Hütte. „Wir können leider nicht für alle sorgen. Außerdem“, er fletschte kurz die Zähne, „hat dieser Wald einen Besitzer. Der ist für den Zustand seiner Leute verantwortlich.“
Toni lenkte Marie und Seffi von ihrem Gespräch ab. „Schau, ich habe einen besonders schönen Stein gefunden.“ Er strahlte übers ganze Gesicht. „Er glänzt in der Sonne.“
Joseph begutachtete den Fund. „Du kannst ihn ja dann morgen mit Herrn Montani in der Unterrichtsstunde bestimmen.“
Der Junge nickte eifrig. „Vielleicht ein Calcit oder ein Magnesit.“ Sein Ziehvater lächelte und neckte Toni: „Oder ein Wegwerfit?“
Der Junge zog die Nase kraus, doch dann lachte er vergnügt. „Dann taugt er immer noch für die Steinschleuder.“ Er zog ab, um seinen Fund von den anderen beiden bestaunen zu lassen.
„Kompliment. Du leistest gute Arbeit mit ihnen“, lobte ihn Marie.
Seffi lächelte. „Ja, Toni möchte unbedingt alles nachholen, damit er es in zwei Jahren vielleicht sogar auf ein Gymnasium schafft. Und Tobi möchte es ihm natürlich gleichtun.“ Er hob die Schultern. „Da Toni, als seine Mutter noch lebte, nur ein Jahr in der Volksschule gewesen ist, fehlt ihm natürlich einiges.“
„Er wird das schaffen“, erklärte Marie zuversichtlich. „Und welche Pläne hat Herbert?“
„Er hatte die Volksschule ein paar Jahre besucht, bevor seine Eltern starben. Sein Onkel hatte ihn ja dann zu diesem schrecklichen Töpfer in die Lehre gegeben, wo ich ihn kennengelernt habe.“ Seffi lächelte. „Er kommt gerne in den Unterricht, wenn er Zeit hat, aber er möchte unbedingt Hannes als Stallmeister nachfolgen. Er will alles lernen, was man über Pferde und deren Haltung wissen kann.“
Büdi hatte ein Stöckchen gefunden und heischte um Aufmerksamkeit. Joseph verzog das Gesicht zu einer leidenden Miene. „Ich bin doch schon heute früh hinter dir hergerannt. Kannst du dir nicht einen anderen Spielgefährten suchen?“
„Genügt es nicht, wenn du es wirfst?“, fragte Marie.
„Ha, da kennst du meinen Hund schlecht“, gab Seffi resigniert zurück. „Ich darf es werfen, aber dann besteht er darauf, dass ich ebenso danach renne wie er.“
Marie gluckste vor Lachen, doch Seffi fand es weniger komisch.
„Nein, Büdi. Lass den Stock fallen. Ich bin mir sicher, du hast noch nicht den ganzen Wald markiert. Ab mit dir.“
Joseph ignorierte Büdis beleidigte Miene und wandte sich an Marie. Er machte eine ausladende Geste mit dem Arm. „Und gefällt dir unsere Unternehmung?“
Sie lachte fröhlich. „Ja, sehr gut sogar. Ich möchte das gerne bald wieder mit euch machen.“ Marie überlegte kurz. „Am nächsten Sonntag geht es leider nicht. Da findet das Hauskonzert bei den Griensteins statt.“
Seffis Miene verdüsterte sich, denn er hatte ein gespanntes Verhältnis zu diesen langweiligen Nachmittagsveranstaltungen. Nach seinem Geschmack war der Überhang an tratschfreudigen Matronen zu groß und vor seiner Verlobung hatten deren unverheiratete Töchter regelrecht Jagd auf ihn gemacht. Er hatte seine Mutter immer nur dann begleitet, wenn sie ihm vorher zumindest sieben der zehn ägyptischen Plagen gewünscht hatte.
Marie stupste ihn an. „Gräfin Grienstein hat mich gebeten, mit meinen Freundinnen die Unterhaltung zu übernehmen.“
„Ah, ja, dein Damenensemble.“ Er verneigte sich in ihre Richtung. „Da werde ich natürlich nicht fehlen.“
5
Im Winterpalais der Familie Grienstein
M
arie wies den Lakaien die richtigen Plätze für die Sessel an, während ihre Schwester Gabrielle die Aufstellung ihrer Harfe überwachte.
„Wie geht es dem kleinen Stanislaus?“ Marie erkundigte sich nach ihrem einjährigen Neffen. Gabrielle lächelte verschmitzt. „Seit er gehen kann, treibt er uns in den Wahnsinn. Gottlieb nennt ihn nur mehr seinen ‚Satansbraten‘, aber er betet ihn an.“
„Er ist ja auch ein süßer Fratz.“ Marie seufzte. „Schade, dass ihr nur so selten in Wien seid. Ich vermisse dich sehr.“
„Ja, ich dich auch. Das Band zwischen uns war immer sehr eng.“ Gabrielle tätschelte ihrer Zwillingsschwester den Arm. „Aber bald wirst du ja deine eigene Familie haben.“ Sie schüttelte den Kopf. „Ich kann es immer noch nicht glauben. Ausgerechnet Seffi und du. Vor kaum einem Jahr hättest du ihn am liebsten auf einem Spieß gebraten. Und jetzt ...“ Gabrielle sah Marie prüfend an. „Jetzt kommt dir die Liebe aus allen Poren.“
Bevor Marie antworten konnte, ging die Tür auf und Christina kam herein. Wie üblich ging sie nicht einfach durch die Tür, sondern sie trat auf. Die ganze Welt war ihre Bühne und Christina tänzelte stets von einer Pose in die andere.
„Meine teuren Freundinnen!“ Sie warf die Arme in die Höhe und verteilte Luftküsschen. Dann wedelte sie mit der Hand in die Richtung, wo der Lakai den Kasten mit ihrer Viola abstellen sollte. Sie blickte sich um und entdeckte das Cello. „Ah, wie ich sehe, ist Amalia schon da.“ Dann hob sie die Augenbraue. „Wo ist denn Donna?“, fragte sie theatralisch.
Marie lächelte. „Sie kommt sicher gleich. Donna war doch immer pünktlich.“
Christina winkte ab. „Das weiß ich doch, meine Liebe. Aber bei dem kalten Wetter brauchen die Instrumente doch viel länger, um wieder warm zu werden.“ Nichts durfte den perfekten Auftritt des Ensembles gefährden.
Gabrielle platzierte sich hinter der Harfe und zupfte eine Kadenz. Marie arrangierte einige Noten und sah sich um. „Ich denke, es passt alles. Wir können zu den anderen gehen.“ Sie sah zu ihrer Schwester. „Alexander freut sich schon sehr darauf, dich zu sehen.“ Gabrielle nickte fröhlich. „Ja, es ist schon eine halbe Ewigkeit her, dass wir uns getroffen haben.“
Marie wandte sich an Christina. „Kommst du auch?“
„Gleich, gleich.“ Sie hielt ein Notenheft hoch. „Ich bringe das noch in Ordnung.“
Vor der Tür verdrehte Gabrielle die Augen. „Das macht sie immer.“ Marie kicherte. „Sie rückt sicher wieder so lange die Sessel zurecht, bis jeder Zuhörer einen guten Blick auf sie hat.“
„Ja, sie verträgt es einfach nicht, wenn Donna im Mittelpunkt ist.“ Marie zuckte mit den Schultern. „Aber das liegt halt auch einfach an ihrem Instrument. Die Viola hat nur selten die erste Stimme. Die hat Donna.“
Die Frau, von der sie sprachen, betrat den Salon. Donna entdeckte ihre Freundinnen. Anmutig hob sie ihre Hand und winkte. Gabrielle stupste Marie an. „Man muss einfach hingerissen von ihr sein.“ Donna hatte eine Art ätherische Schönheit, die einen ganzen besonderen Zauber aussandte. Wenn sie einen Raum betrat, hefteten sich sofort alle Blicke auf sie.
„Ja, aber mit ihrer Liebenswürdigkeit scheint es ihr selbst gar nicht aufzufallen.“
Die Violinspielerin erreichte sie. Leicht außer Atem stieß sie ihre Begrüßung hervor. „Meine Täubchen.“ Donna hauchte Küsschen in Maries und Gabrielles Richtung.
„Wie geht es deiner linken Hand?“, fragte Marie mitfühlend. Ihre Freundin bewegte ihre behandschuhten Finger. „Danke, besser. Ich habe den Arm ewig in einer schrecklich übelriechenden Tinktur gebadet.“
Sie schnupperte an ihrem Handgelenk und hielt den Arm dann besorgt Gabrielle hin. „Nein, ich rieche nur dein Lieblingsparfüm.“
Die junge Frau seufzte erleichtert auf. „Ah, dann ist ja gut. Dieser Kampfergeruch hat überall an mir geklebt.“ Donna schloss bewegt die Augen. Nach einem Atemzug schlug sie die Lider auf und sah sich um.
„Wird es eine große Gesellschaft?“
Gabrielle lachte. „Du bist im Haus der Gräfin Grienstein, meine Liebe. Da kommt alles, was Rang und Namen hat.“
„Oh“, war das Einzige, was Donna dazu sagte. Marie deutete auf die Tür zum angrenzenden Musikzimmer. „Amalia hat sich schon unter die ersten Gäste gemischt, Christina bereitet sich noch vor.“
Donna nickte ihren Freundinnen zu und bat den Lakaien, der ihre Violine trug, die Tür zu öffnen. Sie schwebte in den Raum. „Christina, mein Täubchen.“
Plötzlich warf Gabrielle die Arme hoch und quietschte vor Freude auf. „Alexander!“ Sie warf sich in die Arme ihres ältesten Bruders. Er drückte sie herzlich. „Die Mutterschaft steht dir, Schwesterchen. Du siehst blendend aus.“ Seffi war neben Gottlieb und seinem Schwager gestanden. Er trat vor und küsste Marie auf die Wange. „Und dir steht die Verlobung gut“, flüsterte er ihr zu.
Der immerzu gut gelaunte Gottlieb nahm Maries freie Seite in Beschlag und legte den Arm um sie. Er drehte sich trotz seiner Korpulenz schwungvoll mit ihr zu Alexander um. „Die Mutterschaft ja, aber du darfst ihren wundervollen Ehemann nicht vergessen, der sie stets auf Händen trägt.“
Er lachte dröhnend und sah dann Seffi an. „Dass du mir das ja auch mit unserer Marie machst.“
Joseph grinste. „Ich werde Rosenblätter streuen.“ Er sah seine Braut an. „Reicht das?“
Gabrielle gab Seffi einen Klaps auf den Arm. „Da musst dich aber mehr anstrengen.“ Sie wandte sich an Alexander. „Wie kommt es, dass du wieder in Wien bist? Ihr wart doch vor Weihnachten da?“
Der Graf hob die Schultern. „Die liebe Bürokratie.“ Er verzog kurz das Gesicht. „Van Swieten[7] hat mir nicht nur bei der Gründung der Findelanstalt geholfen, sondern er hat uns in seinem Testament vor zwei Jahren auch eine erhebliche Summe vermacht. Das Geld wird von einer eigenen Stiftung verwaltet und ich muss die Abrechnungsbücher vorlegen.“
„Das klingt langweilig“, erwiderte Gabrielle. „Aber so sehen wir uns wenigstens. Wie geht es Constanze und den Kindern? Du musst mir unbedingt alles erzählen.“
Gottlieb hatte schon mit Alexander geplaudert und er wollte die Geschwister nun einander überlassen. Er ließ den Blick durch den Saal schweifen und entdeckte einen Bekannten. Er sah zuerst Marie und dann Seffi an.
„Nimm dich deiner Dame an und trage sie bitte schön auf Händen.“ Er zwinkerte seiner Schwägerin zu. „Wir sehen uns dann später, meine Liebe.“ Gottlieb nickte Alexander zu und schlenderte davon. Zuerst warf er einen eingehenden Blick auf das Büffet. Er schnappte sich eine Pastete und schob sie sich genüsslich in den Mund, während er sich zu seinem Jugendfreund gesellte. „Gabriel!“, grüßte er erfreut.
Seffi nahm Maries Hand und lächelte, während er sie näher an sich heranzog. „Ich soll dich also auf Händen tragen, ja? Welche Wünsche darf ich denn erfüllen?“
„Oh, das ist eine lange Liste.“ Marie sah ihn überschwänglich an. „Ich habe sie schon zu Hause vorbereitet.“ Sie zog ihn mit sich und sagte: „Komm, lass uns die anderen Gäste begrüßen.“
Die Tochter des Hauses, Louise von Grienstein, rauschte in den Salon. Da sie immer noch unverheiratet war, hätte sie sich eigentlich den rigiden Modegesetzen für junge Damen unterwerfen müssen, doch dafür war ihr Dekolleté zu tief ausgeschnitten. Louise war eng mit Annemarie befreundet gewesen, bevor sich diese nach Egersfeld zurückgezogen hatte.
Sie entdeckte Joseph und stürmte beinahe auf ihn zu. „Seffi!“, trällerte sie. Im letzten Moment gelang ihr ein Nicken in Richtung seiner Begleitung und sie sagte mit deutlich weniger Enthusiasmus: „Marie, wie schön, dass ihr heute für uns spielt.“ Sie sah sofort wieder zu Joseph. „Hältst du mir für das Konzert bitte einen Sessel frei?“
Seffi strich betont langsam mit seinen Fingern über Maries Hand, die auf seinem Ärmel ruhte. „Wenn mich meine Verlobte nachher entbehren kann, bin ich dir gerne behilflich.“
Louise lächelte säuerlich. „Natürlich.“ Sie schenkte Marie einen Blick, der eindeutig sagte, dass sie sich ihres Bräutigams noch nicht allzu sicher sein sollte. Sie drehte sich zur Seite. „Verzeiht bitte, Mama braucht mich.“
Joseph tätschelte Maries Finger, die sich an seinem Arm verkrampft hatten. „Für diese Frau wird nie jemand Rosenblätter zu streuen.“ Er legte seine freie Hand unter ihr Kinn und hob ihren Kopf. Seffi sah ihr so lange liebevoll in die Augen, bis auch der der letzte Funken von Ärger daraus verschwunden war. „Na, also, so ist es schon besser.“ Er drückte ihr mitten im Salon unter den Blicken der anderen Gäste einen Kuss auf. „Ich glaube nicht, dass sich Annemarie das Ende ihrer Bekanntschaft besonders zu Herzen genommen hat.“
„Ja, ich weiß.“ Marie atmete tief ein. „Constanze hat mir erzählt, dass Louise Annemarie nach dem Tod von Walther überhaupt nicht beigestanden ist.“
Seffi nickte. Er presste kurz seine Lippen grimmig zusammen, bevor er den Kopf schüttelte. „Die Griensteins sind so nette und unkomplizierte Leute. Ich verstehe nicht, warum ihre Tochter einen so ... hm ... unerfreulichen Charakter hat.“
Er zeigte mit dem Kinn auf das kulinarische Angebot. „Möchtest du etwas essen?“
Marie schüttelte den Kopf. „Nein, ich werde schon ins Musikzimmer gehen. Es war so kalt bei der Herfahrt und ich muss die Querflöte wahrscheinlich etwas länger einspielen.“
Seffi nahm Maries Hand, hauchte einen Handkuss drauf und sah ihr nach, bis sie in den Nebenraum gegangen war. Er drehte sich zum Büffet um und grinste Gottlieb an, der schon herausgefunden hatte, was besonders gut schmeckte. Während er den Schwärmereien seines zukünftigen Schwippschwagers zuhörte, sah er aus dem Augenwinkel, dass die Tür zum Musiksalon erneut aufging. Er vermutete, dass Christina oder Amalia zur Vorbereitung ging, doch Marie kam wieder heraus. Sie war noch weißer als die Tür. Mit starrer Miene suchte sie den Raum ab. Doch sie suchte nicht nach ihm. Sie ging auf Alexander zu und krallte sich fast an dessen Ärmel.
Seffi nickte Gottlieb kurz zu und pflügte sich einen Weg durch die Gästeschar. Er fing einen Teil von Maries panisch gesprochenen Worten auf. „... keine Reaktion auf das Riechsalz. Sie bewegt sich nicht mehr.“
Alexander sah seine jüngste Schwester ernst an. „Einatmen und ausatmen, Marie. Ich gehe sofort zu ihr hinein.“ Er entdeckte Seffi, schob Marie in seine Richtung und sagte nur: „Ins Musikzimmer.“
Joseph verstand auch ohne Anweisungen, dass ihre Handlungen um jeden Preis völlig normal aussehen mussten. Er hatte keine Ahnung, was vorgefallen war, doch inmitten einer so großen Gästeschar musste auch bei einem herannahenden Orkan absolute Ruhe bewahrt werden.
„Ich muss mit Gabrielle reden.“ Seffi nickte und hielt nach dem blonden Haarschopf von Maries Schwester Ausschau. Nachdem er seine Verlobte in sicheren Händen wusste, eilte er zu Alexander.
Er fand seinen Schwager vorgebeugt über einer zusammengesunkenen Gestalt. Das Kinn der Frau war bis auf die Brust gefallen. Die Arme hingen schlaff an der Seite herab.
„Da hat jemand nachgeholfen“, stieß Alexander hervor und zeigte auf das zerfranste Ende einer Violinsaite, das aus der gelösten Frisur hervorstand.
„Erwürgt? Hier?“, presste Seffi ungläubig hervor.
Alexander nickte. „So wie es aussieht, ja.“ Er richtete sich auf und sah sich um. „Wohin führt diese Tür?“