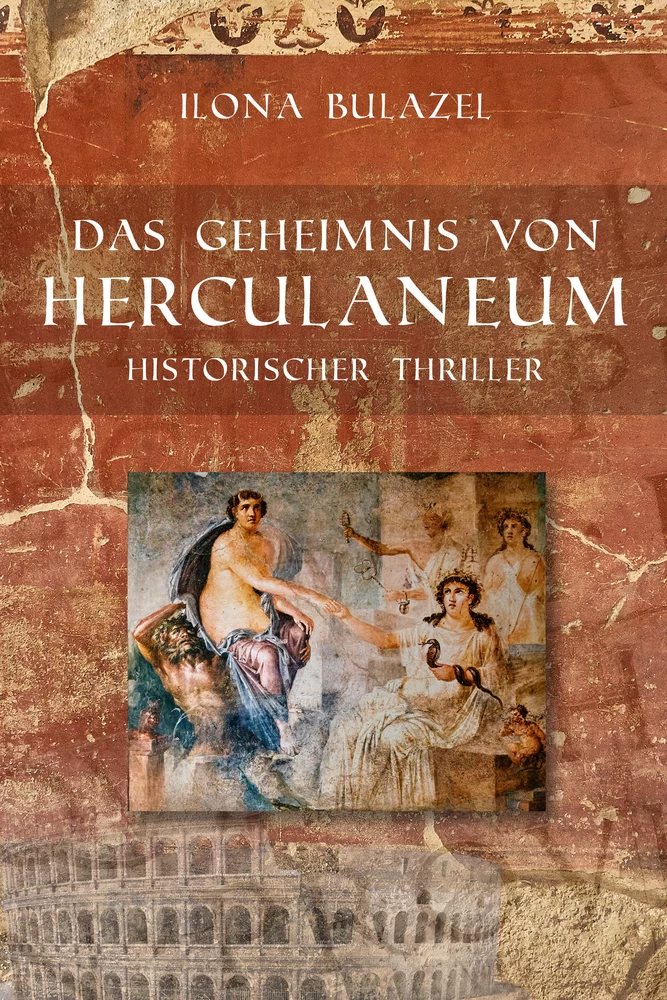Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Rom, im Jahre 62 nach Christus
»Es ist gleich geschafft«, rief die treue Dienerin Alba und drückte fest Tosias Hand.
Die Geburt war schwierig, und die werdende Mutter litt unter starken Schmerzen. Mit einem feuchten Tuch tupfte ihr eine der Sklavinnen die Stirn ab.
Die Hebamme machte ein besorgtes Gesicht, völlig unerwartet hatte man nach ihr gerufen.
»Es kommt zu früh«, murmelte sie und fing sich dafür von Alba einen bösen Blick ein.
»Sei ohne Sorge«, redete diese beruhigend auf die Gebärende ein. »Alles wird gut!«
»Es ist wie das letzte Mal«, schluchzte Tosia, bevor sie laut aufschrie. Eine weitere Wehe hatte schmerzhaft ihren Körper gequält.
Alba sah wieder zur Hebamme. Die hatte die Lippen fest zusammengepresst und versuchte, nach dem Säugling zu greifen, der so unbedingt schon jetzt das Licht der Welt erblicken wollte.
»Er wird es mir nicht verzeihen können. Was soll nur werden?«, weinte Tosia und sah Alba flehentlich an.
Die Dienerin war schon seit ihrem fünften Lebensjahr bei der Familie. Als Sklavin hatte man sie damals aus den Gebieten jenseits des Rhenus nach Rom gebracht. Sie stammte von einem der Barbarenstämme ab, zumindest wurde ihr das erzählt. Sie selbst hatte kaum eine Erinnerung an ihre früheste Kindheit. Manchmal sah sie in ihren Träumen dunkle Wälder und weißes Gespinst, das langsam und lautlos vom Himmel fiel. Außerdem war da stets das Gefühl von Kälte, aber mehr gab es nicht. Sie erinnerte sich weder an das Gesicht ihrer Mutter noch daran, wie sie von der Frau, die sie einst auf die Welt gebracht hatte, genannt worden war. Alba war der Name, den ihr die Sklavenhändler gegeben hatten. Er bedeutete hell, in Anlehnung an ihr blondes Haar, das mittlerweile jedoch bereits erste graue Strähnen zeigte. Sie hatte damals Glück gehabt und war in eine gute Familie gekommen, anständig behandelt worden, und schließlich hatte man ihr sogar die Freiheit geschenkt. Aber trotzdem wollte sie niemals von hier fort. Wo hätte sie auch hingehen können? Ihr Äußeres war nicht gerade das, was den römischen Männern gefiel: Sie war hochgewachsen und überragte die meisten Vertreter des anderen Geschlechts. Ihre kantigen Gesichtszüge wirkten irgendwie verdrießlich, und Männer fühlten sich dadurch nicht gerade ermuntert. Aber das hatte sowieso nie eine Rolle gespielt. Ihr ganzes Glück war immer schon Tosia gewesen, die man ihr vor fünfundzwanzig Jahren anvertraut hatte, als deren Mutter im Kindbett gestorben war. Alba selbst war zu dieser Zeit bereits vierundzwanzig. Sie hatte das Mädchen über den Verlust hinweggetröstet und war ihr immer mehr als nur eine Dienerin gewesen. Ja, sie liebte Tosia wie eine Tochter und hätte alles für sie getan.
Der Griff um ihre Hand wurde fester und riss sie aus ihren Gedanken.
»Es kommt«, stieß die Hebamme mit hochroten Wangen hervor. Auch ihr sah man die Anspannung an.
Mit einem letzten, schmerzerfüllten Aufschrei der werdenden Mutter endete die Geburt.
»Ist alles in Ordnung?«, rief diese nun mit zitternder Stimme. Da nicht sofort eine Antwort folgte, begann sie, in Panik zu geraten. »So sprich mit mir, Alba!« Der Ruf nach der getreuen Dienerin war mehr Flehen als Aufforderung.
Schnell berührte diese mit ihrer großen Hand sanft das schweißnasse Gesicht der jungen Frau.
»Alles wird gut. Der Säugling braucht Ruhe und du auch.«
»Ist es gesund?« Sie versuchte, sich zu erheben, aber die Erschöpfung war zu groß.
Die Hebamme wollte antworten, aber wieder war es Albas Blick, der sie verstummen ließ.
»Alles ist in Ordnung. Hier, trink!«, entgegnete die Dienerin und flößte Tosia eine bittere Flüssigkeit ein. »Das lässt dich schlafen, damit du bald wieder zu Kräften kommst.«
Mit einem unwirschen Befehl forderte Alba die Sklavinnen auf, ihr zu helfen, Tosia von dem Geburtsschemel ins Bett zu befördern. Kaum, dass sich die erschöpfte Frau ausgestreckt hatte, schlossen sich auch schon ihre Lider, der Schlaftrunk wirkte.
»Lasst uns allein«, zischte Alba, woraufhin die Sklavinnen sofort aus dem Raum huschten. Erst dann wandte sie sich an die Hebamme.
»Es kam zu früh«, sagte diese nun beinahe trotzig und hob ihr das blutige Leinen entgegen, in das das Kind eingewickelt war.
Alba seufzte unglücklich. Sie sah sofort, dass der Säugling tot war. Das winzige Geschöpf hatte bläulich verfärbte Lippen und eine merkwürdig wächserne Haut. Es war noch nicht bereit gewesen.
»Bei den Göttern. Du musst ihr sagen, dass das Kind tot ist.«
Die Dienerin gab darauf keine Antwort, sondern bemerkte: »Es ist ein Junge, nicht wahr?«
Die andere nickte.
Alba war nicht überrascht, sie hatte von einem Knaben geträumt. Einem Knaben, der in Blut badete. Sie hatte es geahnt.
Juno, hilf, flehte sie still, dann traf sie eine Entscheidung.
»Du bleibst hier in der Kammer. Sollte die Domina erwachen, so gib ihr noch mehr von dem Schlaftrunk. Unter keinen Umständen darf sie vom Tod ihres Kindes erfahren. Und auch sonst niemand.«
»Sieh es an«, zischte die Hebamme nun giftig. »Wie soll ich das verheimlichen?«
Alba machte einen Schritt auf die wesentlich kleinere Frau zu. Die massige Gestalt der Dienerin war beeindruckend, aber es waren die hellen Augen mit dem Ausdruck kalten Zorns, die der Hebamme Angst einjagten.
»Tu, um was ich dich gebeten habe. Ich bin bald zurück.«
Eingeschüchtert gab die andere nach. »Aber lass mich nicht zu lange warten!«
* * *
In der gleichen Nacht, fast zur selben Stunde, lag auch eine andere Frau in den Wehen. Sie hatte niemanden, der ihr Beistand leistete. Jedoch war nicht die Armut der Grund dafür, dass sie so völlig auf sich allein gestellt war, sondern die Umstände der Schwangerschaft. Ihr Mann durfte nichts davon erfahren. Die Veränderungen ihres Körpers unter den weiten Gewändern vor ihm zu verbergen, war nicht allzu schwierig gewesen. Aber die Geburt selbst stellte sie vor eine Herausforderung. Wie hatte nur alles so weit kommen können?
Vom eigenen Vater war sie mit vierzehn an ihren heutigen Ehemann übergeben worden. Sie war im heiratsfähigen Alter gewesen, und ihr Vater hatte Schulden gehabt; schnell war ein Arrangement getroffen worden. Seither lebte sie wie eine Sklavin unter der Fuchtel dieses alten Geizkragens, der sie anfangs regelmäßig misshandelt hatte. Dann war sie älter geworden und zu einer regelrechten Schönheit herangereift. Er verlor dennoch das Interesse an ihr und vergnügte sich seither mit blutjungen Sklavinnen und Sklaven. Bisher hatte er nie davon gesprochen, sich scheiden lassen zu wollen, schließlich schmückte er sich gerne mit seiner schönen Gemahlin. Wäre sie eine Frau aus der Oberschicht gewesen, mit eigenem Vermögen, dann hätte sie sich natürlich längst scheiden lassen können. Aber da ihre Eltern nicht mehr lebten und es auch sonst keine Familie gab, war sie voll und ganz abhängig vom Wohlwollen ihres Ehemannes. Sie hatte sich ihrem Schicksal bereits ergeben, als dieser junge, gut aussehende Legionär in ihr Leben getreten war. Sie glaubte ihm all seine Schwüre, gab sich ihm leidenschaftlich hin – aber als sie die Schwangerschaft bemerkte, da wollte er nichts mehr von ihr wissen.
Trotz ihrer Versuche, einen Ausweg zu finden, scheiterte sie. Die Tränke, Beschwörungen und Opfergaben waren vergebens. Sogar ihrem Ehemann bot sie sich zu sexuellen Gefälligkeiten an, um so ihre Schwangerschaft rechtfertigen zu können, aber der lehnte ab. Sie glaubte mittlerweile zu wissen, dass seine Männlichkeit bei erwachsenen Frauen versagte. Dennoch hatte sie es probiert, doch er war daraufhin ärgerlich und misstrauisch geworden.
Letzten Endes blieb ihr keine andere Wahl, als das Kind heimlich auf die Welt zu bringen.
Sie hatte aufmerksam zugehört, wenn über Geburten gesprochen worden war, hatte bei einer Hebamme unter einem Vorwand Informationen eingeholt und sich auf diesen Tag vorbereitet, so gut es eben ging. Aber trotzdem war das, was sie eben erlebte, weit entfernt von all ihren Vorstellungen. Sie biss auf das kleine Stück Holz zwischen ihren Zähnen, um den Schmerz nicht hinauszuschreien. Niemand im Haus durfte erfahren, was hier in ihrem Cubiculum gerade vor sich ging.
* * *
Alba hastete aus dem Haus. Sie musste sich beeilen, ihr Ziel war nicht weit, und so eilte sie, die Öllampe fest umklammert, die leeren Straßen entlang. In der Dunkelheit war es gefährlich, alleine unterwegs zu sein. Aber sie schob alle Bedenken beiseite und konnte nur noch an Tosias flehende Augen denken. Es war eine Schande.
»Oh Juno, so hilf ihr doch!«, wandte sie sich erneut flüsternd an die römische Göttin, die sie so sehr verehrte.
* * *
Auch eine andere Gestalt, verhüllt von einem langen Schal, einen frisch geborenen Säugling im Arm, schlich wenig später durch die Nacht. Sie hatte es vermieden, in das kleine Gesichtchen mit den großen Kulleraugen zu blicken. Was hätte das für einen Sinn gemacht? Es gab schließlich keine Zukunft für sie und das Kind. Den Platz, den sie jetzt aufsuchen wollte, hatten schon viele verzweifelte Mütter vor ihr betreten; dort legten sie ihre ungewollten Kinder ab, in der Hoffnung, dass sich ihnen ein barmherziger Mensch annehmen würde.
Hier hätte das Kleine vielleicht eine Chance. Die Frau redete sich das zumindest ein, denn nicht nur gute Menschen interessierten sich für die hilflosen Geschöpfe. Auch die herzlosen suchten an diesem Ort nach geeigneter »Ware«, die sie an die Sklavenhändler verkaufen konnten.
Die verhüllte Gestalt blieb nicht stehen. Sie konnte nur hoffen und beten, einen anderen Weg gab es nicht. Würde ihr Mann von dem Kind erfahren, dann wäre damit niemandem geholfen. Sie würde auf der Straße landen und wäre vermutlich gezwungen, sich als Prostituierte ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das Kleine bekäme zudem, den ganzen Jähzorn ihres Ehemanns zu spüren. Kaum denkbar, dass es dies überleben würde.
Sie hatte nun die Mitte des Platzes erreicht und sah sich verstohlen um. Es schien niemand da zu sein. Als sie in die Knie ging, um das Kind abzulegen, spürte sie einen heftigen Stich in ihrem Unterleib. Sie sagte sich, dass das vollkommen normal sei – immerhin hatte sie gerade erst entbunden und war schon wieder auf den Beinen. Noch einmal durchfuhr sie ein quälender Schmerz, und ein Keuchen entschlüpfte ihrer Kehle.
»Ich muss hier weg«, flüsterte sie leise.
Das Kind fing an, unruhig zu werden, so als würde es spüren, dass sich die Mutter für immer entfernen wollte. Deren Herz brach, als sie nun aufstand, den Platz verließ und in der Dunkelheit verschwand, während sie hinter sich ein leises Weinen vernahm. Es war nicht nur das körperliche Leid, das die Tränen nicht mehr versiegen ließ, die ihr nun über das Gesicht liefen.
Alba hatte die Szene beobachtet. Schnell näherte sie sich dem weinenden Kind, als die Schritte der fremden Frau, die es gebracht hatte, nicht mehr zu vernehmen waren. Ihre Gebete schienen erhört worden zu sein. Im Licht der Öllampe begutachtete sie den Säugling und war erleichtert, keine dunkle Färbung der Haut und keine Missbildungen entdecken zu können.
»Was haben wir denn hier?«, scherzte sie leise. »Ein kleines, gesundes Mädchen!«
* * *
»Du warst lange weg. Was, wenn der Herr nach Hause gekommen wäre?« Die Hebamme wartete bereits ungeduldig auf Alba.
»Er ist in Herculaneum und kümmert sich um die Geschäfte«, gab die Dienerin gereizt zurück.
Die Hebamme betrachtete den mitgebrachten Säugling. »Das ist nicht recht«, begehrte sie auf.
»Es wird dein Schaden nicht sein«, zischte Alba. »Ich kann dafür sorgen, dass man glaubt, du bist die Richtige in hoffnungslosen Fällen.«
Sie bemerkte das Interesse in den Augen der Frau und fuhr fort. »Stell dir vor, die ganzen Patrizierfamilien werden künftig dich rufen. Da sind eine Menge Sesterzen zu verdienen.«
Noch zögerte die Hebamme, und Alba legte nach. »Andererseits will dich vielleicht keiner mehr haben, wenn sich herumspricht, dass meine Herrin unter deinen Händen bereits ihr zweites Kind tot geboren hat.«
»Du hast ein Mädchen mitgebracht«, entgegnete die andere darauf gehässig. »Ich denke, der Herr wünscht sich einen Sohn.«
Die Augen der Dienerin blitzten schlau auf. »Ein gesundes Mädchen verheißt weitere Kinder. Der Erbe wird folgen.«
»Barbarenhexe«, giftete die Hebamme, ließ sich aber auf den Handel ein. Die Alte hatte recht, ein guter Ruf war tatsächlich Gold wert, immerhin war eine Geburt ein hohes Risiko. Von den reichen Damen geschätzt zu werden, würde sich sicher auszahlen. Und war es ihr nicht sowieso einerlei, was dieses riesenhafte Weib und deren Herrin hinter dem Rücken des Ehemanns trieben?
Wenige Stunden später erwachte Tosia aus einem unruhigen Schlaf. Ängstlich fragte sie nach ihrem Kind. Alba legte ihr das Mädchen in die Arme und sagte ruhig: »Alles ist in Ordnung, die Kleine wird eines Tages sicher eine Schönheit!« Tosia lächelte glücklich. Ein gesunder Säugling, das würde Spurius glücklich machen, auch wenn es kein Junge war. Sie würde noch viele Kinder bekommen. Nach zwei Fehlgeburten und einer Totgeburt war der Bann nun gebrochen.
Alba betrachtete liebevoll Mutter und Tochter. Sie würde das Geheimnis für sich behalten, Tosia und auch das Kind sollten nie etwas davon erfahren. Unbewusst berührte sie den Armreif in der Tasche ihres Gewandes; er hatte in der Decke gelegen, in der das Mädchen eingewickelt gewesen war. Allerdings ließ sich daraus nicht auf die Herkunft des Kindes schließen, was umso besser war. Alba nahm das als gutes Omen.
* * *
Während die eine Frau den Säugling sanft in ihren Armen schaukelte, kämpfte dessen leibliche Mutter ums Überleben. Fast wäre es ihr nicht gelungen, den Weg nach Hause zu bewältigen.
Eine schlimme Infektion trieb das Fieber hoch, und da niemand von der heimlichen Entbindung wusste, konnte man sich den Zustand der Herrin nicht erklären. Mehrere Tage kämpfte sie mit dem Tod. Ihren Ehemann interessierte das allerdings wenig.
Anfangs raubte ihr die Verzweiflung jeden Lebenswillen, und sie bat die Götter, sie endlich zu sich zu holen. Aber offensichtlich war ihre Zeit noch nicht gekommen. Als es ihr langsam besser ging, überkam sie eine unbändige Wut. Auf die Götter, die sie ihrem Schicksal überließen, auf den jungen Legionär, der sie so schamlos ausgenutzt hatte, und auf ihren Ehemann, der ein widerlicher, grausamer Mensch war. Mit einem Mal wusste sie, was sie zu tun hatte. Sie wollte künftig nach ihren eigenen Regeln leben – und wehe dem, der sich ihr dabei in den Weg stellen sollte.
Kapitel 2
Rom, auf dem Exerzierplatz der Prätorianergarde
Marcus’ Blick war verschleiert, Schweißtropfen hatten sich in seinen langen, dunklen Wimpern verfangen. Er blinzelte, um sie loszuwerden und klare Sicht zu erhalten.
Die Sonne stand hoch am Himmel, der sich strahlend blau präsentierte. Der Tag hatte sich so wundervoll angekündigt, und er, Marcus, erinnerte sich, wie Rom beim Sonnenaufgang in ein warmes rotes Licht getaucht gewesen war.
Seine ausgestreckten Arme fingen an zu zittern. Kurz gab er das Geradeausstarren auf und schielte auf die zuckenden Muskeln. Er presste die Lippen noch fester aufeinander, sodass es ihn schmerzte – er musste sich konzentrieren und seine Gedanken darauf lenken, die Strafe zu überstehen. Marcus atmete ruhiger und bemerkte zu seiner Erleichterung, dass das Zucken aufhörte. Obwohl er sich fest vorgenommen hatte, die körperlichen Qualen zu ignorieren, wurde ihm immer mehr bewusst, dass er dem Unvermeidlichen nicht entgehen konnte.
»Müde, Prätorianer?«, hörte er die tiefe Stimme seines Vorgesetzten, in der Zorn, aber auch Enttäuschung mitschwang.
Marcus antwortete nicht, sondern wappnete sich für den Schlag, der auch sofort folgte: Der knorrige Holzstock traf hart auf seinen Rücken. Er schloss für einen Moment die Augen und musste alle Kraft aufbringen, die ausgestreckten Arme nicht einfach sinken zu lassen.
In jeder Hand hielt er ein schweres Holzschwert. Sie dienten den Soldaten normalerweise als Trainingsgeräte und hatten mehr Gewicht als die Standardwaffe der Prätorianer, dem Gladius.
Marcus dachte zurück an den Morgen. Man warf ihm vor, er hätte seine Pflichten vernachlässigt, was allerdings nicht ganz der Wahrheit entsprach. Er büßte für den Fehler seines Kameraden und besten Freundes Quintus. Aber das konnte er unmöglich zu seiner Verteidigung vorbringen, denn das wäre einem Verrat gleichgekommen; etwas, das sein Ehrgefühl niemals zulassen würde.
Also stand er bei sengender Hitze auf dem Exerzierplatz, nur mit einem Subligaculum bekleidet, das seine Scham bedeckte, klaglos die Prügel ertragend, die so ungerechtfertigterweise auf ihn niedergingen.
Es war ein perfides Spiel mit nur einer Regel. Würde er die Schwerter sinken lassen, dann wäre er die längste Zeit Prätorianer gewesen. Es gab kein Zeitlimit und damit auch nicht den Hauch einer Chance für Marcus, seine Stellung zu behalten. Eigentlich hätte er sich auch gleich wie ein geprügelter Hund aus dem Tor schleichen können, denn am Ende würde ihm nur dieser Weg bleiben. Trotzdem wollte Marcus kämpfen. So war er immer schon gewesen, aufgeben kam für ihn nicht infrage.
»Du bist Prätorianer?«, bellte sein Peiniger ungehalten und holte erneut mit dem Stock aus. »Du willst zu der Leibgarde des Kaisers gehören?« Der Mann trat nun seitlich an Marcus heran. »Du bist nicht würdig!«, schnarrte er und sah verächtlich auf den Soldaten, der den Blick weiter stur geradeaus hielt.
Marcus ignorierte das Ziehen seiner verkrampften Muskulatur und dachte an Rom.
Sein Vater hätte ihn lieber zu Hause gewusst, aber er klagte nie darüber, dass sich der Sohn, der sich unter allen Umständen den Herausforderungen des Lebens stellen wollte, freiwillig zur Legion gemeldet hatte. Und natürlich hatte er auch Stolz empfunden, als sein Fleisch und Blut für die Prätorianergarde ausgewählt worden war. Marcus hatte bereits als kleiner Junge davon geträumt, mit den kaiserlichen Truppen zu den entlegensten Winkeln des Imperiums zu reiten. Er wollte die schrecklichen Barbaren im Norden besiegen, sich den kriegerischen Völkern im Süden stellen, die Aufstände an den Außengrenzen im Osten niederschlagen und in die Schlacht ziehen, um den Rest der Welt dem Römischen Reich unterzuordnen. Aber sein Plan war es nicht gewesen, das als gewöhnlicher Legionär zu tun – nein, er wollte an der Seite des Kaisers leben und sterben. Deshalb hatte er alles daran gesetzt, ein Prätorianer zu werden. Stationiert in Rom, solange das Staatsoberhaupt nicht auf einen Feldzug ging. Auch das war ein gewichtiger Grund für seine Entscheidung. Als Legionär hätte er zwischen den Schlachten womöglich Tag um Tag in einer öden Festung gesessen, aber hier in Rom ... Was es auf der Welt gab, das gab es auch in Rom! Etwas, das für Marcus unumstößlich feststand, und schon, als er die Stadt das erste Mal betreten hatte, wurde ihm das bestätigt.
Nirgendwo sonst waren die Straßen so vollgestopft mit Menschen aus allen Regionen des Reiches. Dunkelhäutige, Bleiche mit beinahe durchsichtiger Haut, schöne Nubierinnen, stolze Griechinnen und natürlich die modernen Römerinnen. Aber nicht nur das menschliche Sammelsurium übte so eine Faszination auf den jungen Soldaten aus, auch die Stadt selbst mit ihrer Lebendigkeit und dem stetig rastlosen Treiben hatte ihn verzaubert, ihn zu ihrem Gefangenen gemacht und für alle Zeiten Fesseln angelegt, sodass er dieser Magie niemals entfliehen könnte. Er dachte an die Wagenrennen im Circus. Noch nie zuvor hatte er etwas Vergleichbares erlebt. Inmitten dieser hunderttausend Menschen zu stehen, ihre begeisterten Schreie und Anfeuerungsrufe zu hören, die majestätischen Pferde zu beobachten, die schon vor dem Start unruhig schnaubten, hin und her tänzelten, angespannt und voller Ungeduld, genau wie die Zuschauer, bis endlich das weiße Tuch den Boden berührte und damit das erlösende Startsignal fiel, das war wie ein verrückter Rausch der Sinne. Begeistert hatte er die Gespanne beobachtet und dem Trommeln der Pferdehufe gelauscht, welches reinste Musik für seine Ohren gewesen war. Das harte Aneinanderschlagen der Wagen beim rücksichtslosen Kampf um den Sieg hatte ihn so sehr beschwingt, dass er einfach in das Jubelgeschrei, das dem Gewinner galt, mit einstimmen musste, selbst wenn seine Wette auf ein anderes Gespann platziert gewesen war.
Marcus hätte am liebsten laut geseufzt. Er dachte noch einmal an das abendliche Zechen in den Tabernae und die zufriedenen Momente in den Armen einer römischen Hure mit üppigen Rundungen. Er schmeckte immer noch ihre süßen Küsse, sah die schrille Farbe ihrer Perücke vor seinem geistigen Auge und erinnerte sich an die heißen, nackten Schenkel, die ihm so großzügig dargeboten worden waren. Zurück in sein altes Leben als Legionär zu müssen, wäre mehr Strafe als die Stockschläge und Beschimpfungen, denen er im Moment ausgesetzt war. Vielleicht würden die anderen Soldaten sein Versagen nicht kommentieren und ihn aufnehmen wie einen alten Freund – trotzdem würde er sich grämen. Und Quintus?
Plötzlich flammte Wut in ihm auf. Wut, die ihm die Kraft verlieh, die Arme weiter gestreckt zu halten. Solange er hier auf dem sandigen Boden stand, solange gehörte er immer noch zu den Prätorianern. Sie würden ihn hinaustragen müssen, denn er war nicht bereit, freiwillig zu gehen. Zwar nutzte er die Wut auf Quintus, durch dessen Schuld er zu spät zu seinem Dienst gekommen war, aber gleichzeitig schämte er sich für seine Gefühle. Jemand anderem die Verantwortung für das eigene Handeln aufzubürden, war nicht recht. So war er erzogen, und so wollte er eines Tages auch seine Kinder erziehen. Falls er nach dieser Schmach jemals eine ehrbare Frau finden würde.
Marcus’ Vorgesetzter hatte sich in den Schatten zurückgezogen. Neben ihm stand sein Adjutant, der sich zu einer Bemerkung hinreißen ließ. »Wir hatten noch nie einen, der so lange durchgehalten hat.« Er machte keinen Hehl aus seiner Bewunderung. »Wenn er so unerbittlich kämpft, wie er dir die Stirn bietet, Decimus Cornelius Britannicus, dann siehst du einen guten Mann dort in der Sonne stehen.«
Decimus Cornelius Britannicus war ein altgedienter Soldat. Er konnte Männer einschätzen. Allerdings waren ihm seine Feinde meist ein weniger großes Rätsel als seine Verbündeten. Das hatte er in den Jahren seiner Dienstzeit oftmals auf unangenehme Weise zu spüren bekommen. Die Prätorianer sollten Soldaten sein und keine Ränke schmieden. Seiner Meinung nach stand es der Leibgarde des Kaisers nicht zu, sich so dermaßen in die Politik einzumischen. Aber ihn fragte ja niemand, und mittlerweile machten unschöne Gerüchte die Runde. Man sprach davon, dass die Garde demjenigen den Eid leistete, der am besten bezahlte. Außerdem beäugte er kritisch, wie viel Einfluss die Befehlshaber der Garde, die Prätorianerpräfekten, mittlerweile nahmen. Das sorgte nämlich schon seit einiger Zeit für böses Blut und Feindschaften am Hof.
Decimus wollte mit Verschwörungen nichts zu schaffen haben und versuchte deshalb, dem Kaiser treu zur Seite zu stehen. Ganz offen verurteilte er Bestechung und Gemauschel. Mit ein Grund dafür, dass seine Karriere nicht steil nach oben verlaufen war, denn mit dieser Einstellung hatte er mehr als einmal seine Vorgesetzten verstimmt. Allerdings hatte man ihn nach Ablauf seiner regulären Dienstzeit dann von höchster Stelle auf diesen Posten gebeten. Somit gehörte er zu den Evocati, war heute für die Ausbildung der Gardemitglieder zuständig und gab Empfehlungen bezüglich ihres späteren Einsatzbereiches. Keine Frage, er hielt das, was er tat, für wichtig.
Vor knapp zwanzig Jahren, als junger Soldat, war er dabei gewesen, als Kaiser Claudius Britannien erobert hatte. Ihm war der Tod vertraut. Und er wusste auch, dass der Weg ins Jenseits jederzeit beginnen konnte. Denn die Gegner saßen längst nicht mehr nur in ihren Festungen außerhalb Roms. Nein, Decimus beobachtete mit zunehmender Sorge, dass sich die Feinde des Princeps in den kaiserlichen Palästen aufhielten, verborgen hinter Speichelleckerei und Schöngetue, das sie hervorragend beherrschten. Umso wichtiger war es, dass er mit Bedacht die Männer auswählte, die nach seinem Dafürhalten geeignet waren, den Kaiser zu schützen.
Allerdings machte ihm noch etwas anderes zu schaffen: das Wirken des Kaisers selbst.
Natürlich gab es bei jedem Herrscher Getuschel hinter vorgehaltener Hand, aber leider waren das in Neros Fall mehr als nur Gerüchte. Decimus hatte derlei bisher noch nie erlebt. Man munkelte, die Mutter des Kaisers, Agrippina, hätte Neros Vorgänger Kaiser Claudius vergiftet, um den eigenen Spross auf den Thron zu bringen. Sollte das stimmen, dann hätte es ihr Nero schlecht gedankt. Längst war Agrippina nämlich selbst tot, ihr Sohn hatte sie der Verschwörung beschuldigt.
Vor Kurzem war Decimus’ Vorgesetzter, der Prätorianerpräfekt Burrus, gestorben. Auch sein Ableben wurde von gehässigen Zungen als nicht natürlich kommentiert. Über kurz oder lang würde es Probleme geben, das spürte Decimus. Nero war sein Kaiser, und er war ihm verpflichtet, aber wenn der Imperator die Zeichen nicht erkennen würde, dann wären eines Tages nur noch wenige bereit, ihm die Treue zu halten.
Decimus bemühte sich zwar, die Eskapaden des Kaisers zu ignorieren, aber das wurde zunehmend schwerer, gebärdete sich Nero doch zuweilen ganz und gar nicht wie ein würdiger Herrscher. So widmete er sich vor aller Augen viel zu sehr dem Schauspiel und der Sangeskunst. Der Kaiser verbrachte seine Zeit mit Poesie oder dem Zupfen der Kithara, anstatt sich zu fragen, ob er wirklich die richtigen Berater an seiner Seite hatte. Weit entfernt von dem, was gemeinhin als standesgemäß galt, zerstreute sich der erste Mann im Staat als Wagenlenker. Nein, das ziemte sich wahrlich nicht für den Imperator des Römischen Reiches. Decimus war bei weit mehr peinlichen Gegebenheiten Zeuge gewesen, als ihm lieb war. Manchmal kam ihm Nero wie ein verwöhntes Kind vor. Fügsam und freundlich, wenn es seinen Willen bekam, jedoch trotzig und höchst gefährlich, wenn das einmal nicht der Fall sein sollte. Der Prätorianer war nicht blind. Er sah die verstohlenen Blicke, die die Senatoren dem Kaiser zuwarfen, hörte das Flüstern der reichen Bürger aus der Oberschicht, wenn sie sich im Palast unbeobachtet fühlten, und schnappte hin und wieder das Murren der Ritter auf. Nein, mit diesem Kaiser würde es nicht gut enden, auch wenn ihn das Volk augenblicklich noch verehrte, zeigte er sich doch verantwortungsvoll und zuverlässig, was die Getreideversorgung der Einwohner Roms anging. Außerdem gelang es ihm, seine Untertanen mit unterschiedlichen Spektakeln bei Laune zu halten. Aber die Plebs war eine undankbare Geliebte.
Erst gestern hatte Decimus einen bösen Traum gehabt. Seine Großmutter war ihm erschienen, das bedeutete nie etwas Gutes.
Sein Adjutant holte ihn zurück ins Hier und Jetzt. »Verzeih, Decimus, was soll nun mit Marcus Cassius Magnus geschehen?« Er deutete mit dem Kinn zur Mitte der Arena, in der Marcus immer noch mit ausgestreckten Armen und den schweren Holzschwertern stand.
Decimus drehte den Kopf von einer Schulter zur anderen und griff sich sein Kurzschwert samt Schild. »Bringt ihm seine Waffen, ich will sehen, wie bereit er für die Garde ist.«
Der so Geheißene machte ein verblüfftes Gesicht, wagte es jedoch nicht, nachzufragen. Er wusste, dass Decimus ein rauer Soldat war. Wer von ihm ausgebildet wurde, stand in dem Ruf, einer der Besten zu sein. Dennoch konnte man nicht umhin, seine Methoden manches Mal zu hinterfragen und bestenfalls als unorthodox zu bezeichnen. Wen er für einen Fehler bestrafte, würde diesen keinesfalls ein zweites Mal begehen.
Als sich der Ausbilder nun seinem Rekruten näherte, wusste er natürlich, dass dieser bereits am Ende seiner Kräfte war.
Ein zäher Bursche, dachte er insgeheim.
Doch von dieser Bewunderung konnte Marcus nichts spüren, als ihn der Vorgesetzte jetzt anblaffte: »Du kannst die Schwerter fallen lassen!«
Marcus’ Körper, der von der Sonne gerötet und schweißnass war, blieb starr. Nur sein Kopf bewegte sich Richtung Decimus, mit trotzigem Blick sah er den Mann nun an.
Dieser nickte auffordernd, woraufhin Marcus die Holzschwerter endlich auf den Boden warf. Als er die Arme senkte und das Blut langsam wieder zu zirkulieren begann, verzog sich sein Gesicht vor Schmerz. Er hatte diese Regung, sehr zu seinem Ärger, nicht verhindern können. Im Augenwinkel bemerkte er, wie jemand den Gladius und seinen Schild neben ihn legte.
Decimus bellte ihn mit befehlsgewohnter Stimme an: »Du willst Prätorianer sein?« Er wartete nicht auf die Antwort, sondern sprach weiter: »Dann beweise mir, dass du bereit bist, dafür zu sterben. Oder ...«, machte er eine dramatische Pause und ließ den Blick über die Arena schweifen, »... oder gehe sofort durch das Tor zu deiner Legion und kehre nie wieder hierher zurück!«
Marcus hatte verstanden. Er sollte kämpfen oder verschwinden, niemand würde ihn aufhalten. Ihm stand es frei, das Übungsgelände zu verlassen und ein ganz gewöhnliches Soldatenleben zu führen. Ein Leben, das für ihn immer den Beigeschmack der Ehrlosigkeit haben würde. Oder aber er würde die Herausforderung annehmen und den sicheren Tod finden – denn Decimus galt als begnadeter Schwertkämpfer. Manche behaupteten sogar, er könnte jeden Gladiator schlagen, ganz zu schweigen von den Feinden Roms.
Marcus atmete hechelnd ein und aus. Ein Umstand, der ihm selbst gar nicht bewusst war. Auf ein Zeichen von Decimus eilte ein Sklave mit einem Krug heran.
»Trink!«, rief der Ausbilder nicht ohne Spott. »Es möge später keiner behaupten, ich hätte einem schnappenden Fisch den Kopf abgeschlagen.«
Irgendwo wurde gelacht, aber Marcus registrierte auch das nicht. Er nahm dankbar den Krug und trank gierig den mit Wasser verdünnten, bitteren Wein. Ein letztes Mal hielt er sich vor Augen, dass es nur wenige Meter waren, die er durch den trockenen Sand hätte stolpern müssen, um dem sicheren Tod zu entgehen. Allerdings wäre das Leben, das ihm nach diesem Gang bevorgestanden hätte, niemals seines. Er warf wütend den Krug zur Seite und griff nach Schwert und Schild. Kurz erinnerte er sich an die Gladiatoren, die bei jedem Einzug in die Arena nicht wussten, ob sie diese auch wieder lebend verlassen würden.
Mehr Gedanken konnte er nicht verschwenden, denn schon im nächsten Augenblick schnellte Decimus’ Schwert auf ihn nieder. In allerletzter Sekunde riss er seinen Schild nach oben, um die stählerne Klinge des Gegners abzuwehren. Weitere Hiebe folgten. Wie eine Schildkröte duckte sich Marcus unter seinem Schild, versuchte, den harten Schlägen auszuweichen, und taumelte dabei rückwärts. Keinesfalls wollte er aufgeben und rief sich daher alles in Erinnerung, was er bisher über den Schwertkampf gelernt hatte. Und plötzlich verstand er, was ihm einer der altgedienten Prätorianer zu später Stunde und nach dem Genuss etlicher Becher Wein zu erklären versucht hatte: »Beim Kämpfen darfst du nicht denken, sondern nur kämpfen!«
Marcus gelang es, genau das zu tun. Er riss sein Schild hoch, benutzte es wie einen Rammbock und stürmte damit gegen Decimus. Den überraschte diese Attacke derart, dass er für einen kurzen Moment unachtsam wurde. Marcus stach zu. Sein Gladius erwischte den Ausbilder am Oberarm und ritzte die Haut auf, Blut tropfte auf den staubigen Boden, und mit einem Mal verstummten alle Anwesenden. Es war unfassbar: Dieser Niemand bot dem großen Decimus tatsächlich die Stirn. Schon wurden verstohlen die ersten Wetten platziert. Nicht auf den Sieger, der stand für sie längst fest. Aber ab jetzt würde es interessant werden, wie Decimus gedachte, seinen Gegner zu töten.
Marcus versuchte, einen zweiten Treffer zu landen, aber dieses Mal war das Überraschungsmoment nicht mehr auf seiner Seite. Das Kurzschwert des Angreifers hämmerte unbarmherzig auf seine Deckung nieder, Marcus blieb nur der Rückzug. Trotzdem versuchte er, die Schläge zu parieren. Niemand, der diesem Spektakel beiwohnte, hätte später behaupten können, er hätte nicht gekämpft. Obwohl er verzweifelt versuchte, erneut anzugreifen, fehlten ihm am Ende das Geschick und die Ausdauer seines Gegners. Bei einem weiteren kraftvollen Hieb wurde Marcus am Oberschenkel getroffen, die Klinge bohrte sich in die Haut. Er fühlte weder das warme Blut noch den brennenden Schmerz, als ihn ein weiterer Schwerthieb von den Beinen riss. Hart prallte er mit dem Rücken auf den Boden. Bevor er sich hätte aufrichten können, trat Decimus ihm mit so viel Wucht seinen Schild aus der Hand, dass der daraufhin quer über den Platz flog, als wäre er nur aus leichtem Stoff. Im nächsten Augenblick fiel ein Schatten auf Marcus’ Gesicht. Decimus stand über ihm, das Schwert auf sein Herz gerichtet.
»Ich vermute, du hast genug«, brüllte der Ausbilder.
Die Zuschauer verfolgten gespannt die Szene und erwarteten Marcus’ Flehen um Gnade.
Er hatte gekämpft, solange er konnte. Nun war er der Unterlegene, aber das würde nichts ändern. Für ihn gab es nur das Leben als Prätorianer oder gar keines. Und gleich eines besiegten Gladiators, dem die Gnade verwehrt wurde, streckte er Decimus deshalb seinen Oberkörper entgegen, damit der den tödlichen Stoß ausführen konnte. Die Anwesenden kamen ob dieses Mutes nicht um ein kollektives Aufstöhnen umhin.
Decimus starrte auf den Besiegten und war zufrieden. Er hatte sich also nicht in dem Jungen getäuscht.
»Wir sind nicht im Amphitheater«, blaffte er und verpasste dem Mann auf dem Boden einen unsanften Tritt. »Los, steh auf und lass dich von den Ärzten versorgen. Danach hast du dich umgehend bei mir zu melden.« Und im Weggehen fügte er noch ein »Dann sehen wir weiter, Prätorianer!« an.
Marcus atmete aus. Hände griffen nach seinen Armen, jemand flößte ihm Flüssigkeit ein, und anschließend schleifte man seinen geschundenen Leib in die kühlen Gemäuer des Arztes.
Der junge Prätorianer konnte es kaum fassen, dass er noch lebte und, was für ihn wesentlich mehr zählte, dass er womöglich immer noch ein Teil der kaiserlichen Garde war.
Die Sklaven hievten ihn unsanft auf die Bettstatt. Marcus stieg der beißende Geruch verbrannter Kräuter in die Nase, die Gewölbe waren durchzogen von diesem Duft. Der Assistent des Arztes hatte ihm bei einer anderen Gelegenheit einmal erklärt, dass das zur Genesung der Kranken und Verletzten beitragen würde. Trotzdem wäre der Soldat heute gut ohne die intensiv riechenden Nebelschwaden ausgekommen. Er schloss die Augen, versuchte, die Muskeln zu entspannen, und spürte plötzlich jede Faser seines schmerzenden Körpers. Die gerötete Haut spannte, die Arme schienen ihm zerreißen zu wollen, und die Wunde am Oberschenkel fühlte sich an, als würde sich langsam eine fette, giftige Natter durch das Fleisch schieben. Seine Kehle war ausgetrocknet, und sein Herz raste immer noch unkontrolliert.
Er spürte, wie man ihm einen Tonbecher an die Lippen setzte. Einer der medizinischen Helfer flößte ihm verdünnten Wein mit Honig ein.
»Er hat dich also am Leben gelassen«, ertönte unvermittelt die Stimme des Arztes neben ihm. Der Mann war ein erfahrener Chirurg, der auch schon die römischen Legionen auf ihren Feldzügen begleitet hatte. Allerdings war sein Mundwerk genauso scharf wie sein Skalpell, was Marcus sogleich zu spüren bekommen sollte.
»Vermutlich wollte mir dieser verflixte Decimus mit einem verletzten Überlebenden den Tag verderben!« Er seufzte geräuschvoll und betrachtete mit einem beinahe spöttischen Blick seinen Patienten.
Marcus musterte seinerseits den Mann. Er war unverkennbar griechischen Ursprungs, so wie viele Ärzte Roms. Der Medicus berührte mit den Fingern die Wunde am Oberschenkel und drückte unsanft die Haut zusammen. Aus der Kehle des Verletzten drang ein Stöhnen.
»Glück gehabt«, entgegnete der Arzt ungerührt.
Der Schmerz fühlte sich zwar nicht nach »Glück gehabt« an, aber Marcus hütete sich, durch einen Kommentar den Mann zu verärgern, der Herrscher über diese Vielzahl von scharfen, hinterhältig aussehenden Gerätschaften war. Deshalb presste er die Lippen zusammen und ließ das weitere Begutachten der Wunde über sich ergehen.
»Wir nehmen das Brenneisen«, konstatierte der Mediziner und nickte seinem Assistenten zu.
Sein Patient riss die Augen auf, schwieg aber weiterhin. Das Kauterisieren einer Wunde war zwar eine schnelle, aber auch äußerst schmerzhafte Behandlung.
»Wir geben dir einen Trank«, sagte der Arzt, der die Gedanken des Verletzten zu erraten schien.
Erst wollte der Prätorianer zustimmen, aber dann besann er sich anders. Er musste noch zu seinem Ausbilder Decimus, keinesfalls wollte er dort benommen oder im schlimmsten Fall überhaupt nicht erscheinen. Womöglich würde man einen Fehler bei der Dosierung machen. Das fremdländische Zeug, das in die Tränke gerührt wurde, konnte bei unsachgemäßer Mixtur einen Mann töten oder ihn für immer zum Idioten machen. Nein, plötzlich schien es Marcus einfach selbstverständlich, die Qualen der Behandlung auszuhalten.
»Ohne Trank?« Die Lippen des Griechen kräuselten sich belustigt, und er zog die Augenbrauen nach oben. »Nun gut, umso schneller wird der Platz hier wieder frei.«
Der Arzt winkte zwei seiner Helfer herbei und steckte Marcus einen ledernen Knebel in den Mund. Die beiden Assistenten sollten den Verletzten bei der Prozedur festhalten.
Jetzt brach dem Prätorianer doch der Angstschweiß aus, als er dem Medicus zusah, wie dieser das Brenneisen in die Glut eines Kohlenbeckens hielt, bis es sich tieforange verfärbte.
»Bereit?«, fragte der Arzt, wartete aber nicht auf die Antwort und legte schnell und gezielt das glühende Metall auf die Wunde. Es zischte, als der Schweiß verdampfte, der die Stelle um die Verletzung herum befeuchtet hatte. Sofort mischte sich der Gestank von verbranntem Fleisch mit dem allgegenwärtigen scharfen Geruch der Kräuter. Marcus biss auf das Leder, Tränen schossen ihm in die Augen, und er versuchte, sich unter der glühenden Klinge zu winden, aber der Griff der Assistenten war geübt. Ihre Hände umschlangen seine Gelenke wie dicke Stricke, denn noch war es nicht vorbei. Der Arzt musste gründlich sein, die Verletzung sollte sich schließlich später nicht entzünden. Da der Gladius seines Ausbilders einen breiten Schnitt hinterlassen hatte, war der Medicus gezwungen, das Eisen zu verrücken. Wieder schoss der Schmerz durch Marcus’ Körper, als das sengend heiße Metall erneut auf die blutende Wunde gedrückt wurde. Ganz automatisch bäumte sich sein Leib auf, dann fiel er in eine erlösende Ohnmacht.
* * *
Nachdem der junge Prätorianer wieder zu sich gekommen war, schoss er erschrocken hoch, sank aber sofort wieder mit einem Stöhnen zurück.
»Wie lange bin ich schon hier?«
Der Arzt lachte. »Keine Sorge, du warst nur ein paar Wimpernschläge bei deinen Ahnen. Hier, trink das!«
Mit unsicherer Hand griff der Soldat nach dem angebotenen Becher und verzog sofort das Gesicht, als er daran nippte.
»Zur Kräftigung und Heilung der Wunde. Leere den Becher in kleinen Schlucken, dann komme ich wieder und lege dir einen Verband an.«
Marcus gehorchte und versuchte, das undefinierbare, dickflüssige Gesöff die Kehle hinunterzuzwingen, wobei es ihm nicht gelang, einen Laut des Abscheus zu unterdrücken. Mit Unbehagen betrachtete er dabei die Gerätschaften, die überall herumlagen. Auch wenn er das niemals zugegeben hätte, waren es vor allem die kleinen Instrumente, die eine besonders Furcht einflößende Wirkung auf ihn hatten. Er hoffte zum Beispiel inständig, niemals mit einer der spitzen Nadeln behandelt werden zu müssen. Wusste er doch, dass die einem mitten ins Auge gestochen wurden, wenn sich dieses getrübt hatte. Sein Mund verzog sich angewidert, als er ein weiteres Utensil erkannte. Es handelte sich um eine Zange. Ihre Greifflächen waren breit und uneben, ideal, um die mandelförmigen Zäpfchen aus dem Hals zu entfernen, die manchmal so unangenehm anschwellen konnten. Marcus hatte so eine Behandlung einmal als Kind gesehen, als einer Sklavin die bösen Auswüchse im Gaumen zuerst mit der Zange lang gezogen und dann mit einem Skalpell abgetrennt worden waren. Die Schreie der Frau hatten ihn noch nächtelang in seinen Träumen verfolgt. Unwillkürlich erschauerte er bei der Erinnerung daran und wollte nicht weiter über die Pinzetten, Klammern, Sägen und Katheter nachdenken, die alle untrüglich dazu geschaffen worden waren, Schmerz zu verursachen, bevor man auf Linderung hoffen konnte.
Erst jetzt bemerkte er, dass noch ein weiterer Mann anwesend war. Er kannte den anderen vom Sehen; es war ein Centurio, der achtzig Mann unter sich hatte und dem man besonders viel Achtung entgegenbrachte. Marcus grüßte, und der Ranghöhere erwiderte dies mit einem entsprechenden Handzeichen. Zu einem Gespräch kam es nicht, denn jetzt erschien wieder der Medicus und hielt triumphierend eine Zahnzange nach oben, die dafür sorgte, dass der Centurio erbleichte, das konnte Marcus sogar in dem diffusen Licht der Öllampen erkennen. Außerdem sah er, wie der Soldat unwirsch nach dem Becher griff, den ihm der Arzt entgegenhielt, und ihn in einem Zug leerte.
»Wir werden dem Centurio zwei Zähne ziehen müssen«, flüsterte einer der Assistenten, der sich daran machte, Marcus’ Körper mit einer Salbe zu bestreichen. Der Geruch der gelblichen Paste war zwar unangenehm, aber die wohltuende, kühlende Wirkung glich das wieder aus.
Offensichtlich war der Helfer einer von der geschwätzigen Sorte, denn schon plapperte er munter weiter. »Hat sich so lange geweigert, die Zähne entfernen zu lassen, bis das ganze Fleisch im Kiefer entzündet war. Der Ärmste.«
Marcus hatte nicht den Eindruck, dass der Assistent besonders viel Mitleid für den Centurio empfand. Eher schien es, dass ihm der Gedanke an die bevorstehende Behandlung ein gewisses Vergnügen bereitete. Daher klangen seine nächsten Worte fast wie eine Bestätigung. »Wenn er Pech hat, ist die Sache mit den zwei Zähnen noch lange nicht erledigt, vielleicht muss sogar zum Brenneisen gegriffen werden, wenn die Fäulnis des Mundfleisches schon besonders weit fortgeschritten ist.«
Marcus blickte erschrocken auf, was dem Assistenten ein albernes Kichern entlockte.
Mittlerweile schien zumindest der Trank, den man dem Centurio gegeben hatte, zu wirken. Er war auf dem seltsamen Konstrukt eingenickt, das entfernt an eine Liege erinnerte, vermutlich eine Erfindung des Arztes. Sein Kopf sank nach hinten, und er begann leise zu schnarchen. Der Prätorianer fragte sich bei dessen Anblick, ob er nicht besser auch den Trank angenommen hätte. Vor allem, weil sein Bein inzwischen mehr schmerzte als vor der Behandlung.
»So, das ist getan«, sagte der Helfer des Arztes leutselig und stellte die stinkende Pomade zur Seite.
Der Medicus wandte sich nun noch einmal an seinen Patienten und legte den Verband an.
»Halte die Wunde sauber und komme morgen wieder.« Dann gab er Marcus noch eine kleine Amphore in die Hand. »Trinke das, bevor du dich schlafen legst, das lindert die Schmerzen!«
Ohne ein weiteres Wort drehte sich der Arzt nun um und widmete sich den Zähnen des Centurios. Marcus dachte nicht daran, dieser Prozedur beizuwohnen, und richtete sich mühsam auf. Man hatte ihm eine Tunika gereicht, die er jetzt vorsichtig überstreifte, dann humpelte er mit gemischten Gefühlen zu den Räumen seines Ausbilders Decimus Cornelius Britannicus.
Noch bangte Marcus um seine Zukunft in der Prätorianergarde. Decimus war nicht so leicht zu durchschauen, bei ihm konnte man nie wissen, was als Nächstes folgen würde.
Als der junge Soldat seinen ganzen Mut zusammennahm und beherzt gegen die Tür des Vorgesetzten klopfte, flehte er im Stillen seine Laren, die Schutzgeister der Familie, um Beistand an.
Die ruppige Stimme des Ausbilders zitierte ihn hinein.
Decimus sah abschätzig zu Marcus’ Verband, was diesen wiederum veranlasste, einen zufriedenen Blick auf das blutdurchtränkte Stück Leinen zu werfen, welches der Ausbilder um die Wunde am Arm gewickelt hatte.
Der Ältere bemerkte das, konnte ein Schmunzeln nur schwer unterdrücken und dachte: Dieser kleine Bastard ist wirklich ein stolzer Krieger.
Aber das behielt er für sich und schnauzte stattdessen: »Und? Gibt es eine Erklärung dafür, warum du deiner Pflicht nicht nachgekommen bist?« Dabei betrachtete er sein Gegenüber. Der Junge war gut aussehend, das stand fest. Vielleicht würden ihm ein paar Narben nicht schaden, sicher täte das der Männlichkeit gut. Nichtsdestotrotz, solange er nicht in der Ausübung des Kriegshandwerks zum Krüppel wurde, hätte er gute Chancen, nach seiner Dienstzeit ein angenehmes Weib zu finden. Jetzt natürlich, nach der Lektion, die er seinem Rekruten in der Arena erteilt hatte, wirkte der erschöpft und krank. Das dunkle, lockige Haar klebte ihm am Kopf, und die braunen, intelligenten Augen, die für den Geschmack des Ausbilders zu viel Güte erkennen ließen, strahlten nicht, sondern blickten müde zu Decimus.
Mit ernstem Gesicht antwortete ihm Marcus nun: »Ich kann keine Erklärung geben, Cornelius Britannicus. Nur meine Versicherung, dass das nie wieder geschehen wird!«
Decimus schlug mit der Faust so stark auf den Tisch, dass die Schale mit Oliven darauf vibrierte und eine der grünen, kleinen Kugeln heraushüpfte und schließlich auf dem Boden liegen blieb.
»Natürlich wird das nie wieder geschehen, sonst ...« Er brach ab und schnaubte wie ein unruhiges Pferd. Mit einer Hand fuhr er sich über sein bereits dünner werdendes Kopfhaar.
»Was soll ich mit einem von deiner Sorte nur anstellen?«
Marcus gab keine Antwort, sondern stand stramm und blickte geradeaus.
»Du bist ein Mann der Ehre, das weiß ich. Und du hast den Mut, den die Götter lieben.« Er wedelte mit seiner großen Pranke und knurrte: »Ich rede nicht vom Hang zum Leichtsinn, wie ich es bei deinen Kameraden für gewöhnlich erlebe. Und doch«, seufzte er, »und doch begehst du einen schlimmen Fehler.«
Dieses Mal hielt es der Getadelte für angebracht zu sprechen. »Es wird nie wieder vorkommen!«, antwortete er mit fester Stimme.
Decimus schürzte die Lippen. »Oh, ich rede nicht von der Pflichtverletzung.« Sein Ton wurde etwas milder. »Ich bin mir sicher, dass dir das nicht noch einmal passieren wird. Ich spreche von etwas anderem.«
Auf dem Gesicht des Rekruten spiegelte sich Unverständnis wider.
»Ich will sagen, es ist ein schlimmer Fehler, den falschen Menschen zu vertrauen. Du musst erkennen, wer Freund und wer Feind ist.«
Marcus’ Ratlosigkeit nahm weiter zu, und Decimus fand zu seiner gewohnt ungeduldigen Art zurück. »Beim Arsch des fettesten Weibes von Rom, bist du wirklich so dumm zu glauben, ich wüsste nicht, dass du heute deinen Freund gedeckt hast?«
Das von der Sonne gerötete Gesicht des Rekruten wurde noch einen Hauch dunkler, und er senkte den Blick.
Mit süffisantem Unterton fuhr sein Ausbilder fort: »Ich kenne meine Männer. Das ist eine meiner wichtigsten Aufgaben. Deshalb weiß ich auch ganz genau, wer sich an die Regeln hält und wer sie bricht. Du hast heute versucht, einem Kameraden die Treue zu halten, und das spricht für dich. Aber war der es auch wert? Quintus Porcius Russus mag in deinen Augen ein Freund sein – aber wo war er, als du für ihn die Strafe getragen hast? Wo war er, als du bereit warst, für seinen Fehler zu sterben?«
Marcus’ Kiefermuskeln spannten sich an, er wollte so etwas nicht hören. Quintus war sein Freund. Sie hatten zur gleichen Zeit die Ausbildung bei den Prätorianern begonnen und waren zu Vertrauten geworden. So verbrachten sie fast ihre gesamte Freizeit gemeinsam.
Die beiden Männer hätten unterschiedlicher nicht sein können, auch ihr Äußeres war voller Gegensätze: Während Marcus schwarzes Haar und dunkle Augen hatte, war Quintus rotblond und verführte die Damenwelt mit seinen blauen Augen. Nur in der Größe ähnelten sie sich, denn im Gegensatz zu ihren Geschlechtsgenossen überschritten die zwei die ein Meter siebzig und galten damit als besonders beeindruckende Erscheinung.
Im Wesen glichen sie einander wie Feuer und Wasser. Quintus war ein Lebemann, konnte mit Worten umgehen wie ein Senator und heckte die verrücktesten Dinge aus. Sein Freund Marcus hingegen ließ sich von der Vernunft leiten und war viel mehr Zuhörer als Redner.
Decimus schüttelte ungeduldig den Kopf. »Ich kenne Menschen wie diesen Quintus. Sie machen nichts als Probleme. Meine Wahl für die Garde war er nicht, das sage ich ganz offen. Aber er hatte einen einflussreichen Fürsprecher.« Wieder einmal verfluchte der Ausbilder im Stillen die Politik und das Ränkeschmieden, dann wandte er sich ein letztes Mal an seinen Soldaten. »Du wirst eines Tages selbst feststellen, ob er es wert war oder nicht. Und jetzt gehe in dein Quartier und behandle deine Verletzung.«
Mit respektvollem Gruß zog sich Marcus zurück. Erleichtert, dass er dem Rauswurf entgangen war, gleichzeitig aber auch nachdenklich angesichts der harschen Worte des Ausbilders über seinen Freund.
Aber noch jemand war in diesem Moment ins Grübeln gekommen. Nämlich Quintus selbst, der das Gespräch heimlich belauscht hatte. Seine Mimik war schwer zu deuten. Nur jemand, der ihn gut kannte, würde das leichte Zusammenkneifen der Augen bemerkt haben und den kurzen Ausdruck von aufflammendem Zorn, der über das ausgesprochen ansehnliche Gesicht gehuscht war. Äußerlich gab er sich gelassen, als er nun einen Moment abwartete und dann Marcus einholte, der auf dem Weg zu den Quartieren war.
»Mein Freund«, sagte er scheinbar mitfühlend, »lass mich dich stützen!«
Marcus brachte ein gequältes Lächeln hervor. »Besser, du berührst mich nicht, denn momentan fühle ich überall nur Schmerz!«
Die Männer sahen sich an. Quintus legte den Kopf schräg und murmelte ein »Danke«.
Den Rest des Weges gingen sie schweigend nebeneinander her, dabei begegneten ihnen einige Kameraden – auch ältere, die normalerweise mit den jüngeren Soldaten wenig im Sinn hatten. Heute aber richteten sich ihre Blicke respektvoll auf Marcus. Längst war bekannt, was sich auf dem Exerzierplatz zugetragen hatte. Ihre anerkennenden Mienen fachten Quintus’ Ärger noch weiter an, der Stachel des Neides bohrte sich grausam in sein Herz.
»Was hat er zu dir gesagt?«, fragte er seinen Freund schließlich und meinte damit natürlich den Ausbilder.
Marcus zuckte lediglich mit den Schultern. »Das wirst du dir doch denken können. Geschmeichelt hat er mir jedenfalls nicht!«
»Und hat er sich auch über mich geäußert?«, hakte Quintus nun vorsichtig nach.
Marcus hasste es zu lügen, wollte aber auch nicht Decimus’ Vertrauen missbrauchen, deshalb antwortete er ausweichend: »Warum hätte er das tun sollen?«
Quintus ließ es dabei bewenden. Es hatte keinen Sinn, sein Freund würde es ihm nicht erzählen. Wenigstens wusste er jetzt, woran er war; Marcus taugte also nicht als Verbündeter. Nicht, dass diese Freundschaft wirklich wichtig für Quintus gewesen wäre, allenfalls praktisch. Und dass Marcus ihm heute die Haut gerettet hatte, war schließlich das Mindeste, was man verlangen konnte. Immerhin hatte er diesem Landei alles beigebracht, was man über Rom und das Leben in der Hauptstadt wissen musste. Im Gegenzug stellte Marcus einen willkommenen Handlanger dar, dem man getrost die unangenehmen Dinge überlassen konnte. Dieser Gedanke besänftigte ihn ein wenig.
Sie verabschiedeten sich vor den Schlafräumen, und für Marcus war die ganze Geschichte erledigt. Aber in Quintus hatte ein Feuer zu schwelen begonnen, das von Missgunst, Hass und Eifersucht angefacht wurde.
Kapitel 3
Rom, zwei Jahre später, Iulius 64 nach Christus
Sie lag wach wie in so vielen Nächten. Immer wieder tauchte das Gesicht des Säuglings vor ihrem geistigen Auge auf. Nichts außer diesem goldenen Armreif hatte sie dem Kind mit auf den Weg geben können. Er war Teil eines Paares, beide Reifen waren gleich gearbeitet. Die Enden waren zu Schlangenköpfen geformt. Ihr einstiger Liebhaber, der Legionär, hatte ihr die Schmuckstücke geschenkt – damals, als er von ewiger Liebe gesprochen und angeblich eine tiefe Leidenschaft für sie empfunden hatte.
»Wir werden für immer zusammen sein«, hatte er beteuert, als er ihr mit glühendem Gesicht die Armreifen überreicht hatte. »Unsere Seelen und Körper sind miteinander verschlungen, das ist unser Schicksal.«
Schöne Worte eines schändlichen Lügners, dachte sie bei sich.
Und doch war einer der Armreifen das einzige Andenken gewesen, das sie dem kleinen, weinenden Bündel hatte mitgeben können.
Die Geburt hatte sie überstanden, das Kind verstoßen und dem nachfolgenden Fieber getrotzt, aber wofür? Nur um weiterhin als Gefangene zu leben?
Seit fast zwei Jahren machte sie Pläne. Einmal war ihr der Gedanke gekommen, einen Beutel Münzen zu stehlen und für immer zu verschwinden. Dann hatte sie diese Idee verworfen, denn ihre Umsetzung hätte bedeutet, ein Leben auf der Flucht zu führen. Ihr Ehemann wäre gnadenlos gewesen, zumindest bis er seine Gold- und Silberstücke wieder in den Händen gehalten hätte. Der Geiz und seine sadistische Natur wären ihr bis ans Ende ihrer Tage gefolgt. Zu allem Übel bescheinigte ihm der Arzt die allerbeste Gesundheit, sodass man nicht mit seinem baldigen Ableben rechnen durfte.
Fast täglich besuchte sie einen der Tempel, um den Göttern Opfergaben darzubringen. Aber der göttliche Beistand, so schien es, blieb bisher aus. Wie viel Zeit sollte noch vergehen? Eigentlich hatte sie sich doch geschworen, ein besseres Leben zu führen.
Es war im Prinzip ganz einfach: Sie wollte keinesfalls mittellos auf der Straße sitzen, also brauchte sie das Geld des Alten. Gleichzeitig musste ihr Ehemann für immer verschwinden. Anfangs war ihr bei diesem Gedanken noch der kalte Schweiß ausgebrochen, aber mit der Zeit freundete sie sich mit dieser Überlegung immer mehr an. Die Notwendigkeit machte es leichter, sich darauf vorzubereiten. Sie musste es endlich tun ...
Ihre Augen starrten auf die gegenüberliegende Wand, die Öllampe warf einen unförmigen Schatten auf die kahlen Mauern. Er war zu geizig gewesen, ein farbenfrohes Wandgemälde anbringen zu lassen.
»Du schließt nachts die Augen, wozu dann die Wände bepinseln?«, hatte er ihre Bitte barsch abgelehnt.
Ja, sie hasste ihn wirklich. Mit einem Schaudern dachte sie an die Zeit zurück, in der er noch regelmäßig in ihr Bett gestiegen war. Die Dinge, die er dann von ihr verlangt hatte, waren beschämend gewesen. Mit Vergnügen hatte er sie gedemütigt, so wie er es jetzt mit diesem Sklavenmädchen tat. Auch wenn sie wusste, dass man mit Sklaven kein Mitleid zu haben brauchte – schließlich stand es dem Besitzer auch von Gesetzes wegen frei, über diesen Menschen ganz nach Gusto zu verfügen –, verurteilte sie ihren Ehemann für das, was er mit seinen gekauften Frauen tat. Nicht wenige hatten in den letzten Jahren durch die Hand ihres Herrn den Tod gefunden. Allerdings gab sie sich nicht der Hoffnung hin, dass sich eines Tages eine dieser rechtlosen Kreaturen aufraffen und ihren Mann erschlagen würde. Dafür waren sie zu schwach. Selbst wenn ihr körperlicher Zustand nicht so erbärmlich gewesen wäre, seelisch gebrochen und voller Angst vor Strafe waren sie unfähig, sich zur Wehr zu setzen.
»Genau wie ich«, krächzte sie leise und bemerkte, wie sich vor Entsetzen über die eigene Hilflosigkeit ihr Magen verkrampfte.
Sie wollte gerade die Lampe löschen, um den trüben Gedanken wenigstens im Schlaf zu entkommen, als sie ein eigenartiges Hämmern hörte. Abrupt richtete sie sich auf.
Erneut drangen die dumpfen Töne an ihr Ohr. Jemand klopfte voller Ungeduld und bat um Einlass. Dem Tappen von nackten Füßen auf den Tonfliesen folgte das Geräusch der sich öffnenden Tür. Schließlich drangen aufgeregte Stimmen bis in ihre Kammer, sie glaubte, den schnarrenden Tonfall des Hausmeisters zu erkennen. Ein widerwärtiger, fauler Kerl mit hinterhältigem Blick und einem gehässigen Mundwerk. Was konnte der um diese Zeit hier wollen? Sie ging zu ihrer Tür und öffnete sie einen Spalt.
»Rom ... Rom brennt!«
Den Rest verstand sie nicht mehr, vermutlich hatte sich der Mann bereits entfernt. Mit viel Glück würde er noch die Bewohner des nächsten Stockwerkes informieren, mehr konnte man nicht erwarten.
Wer weiter oben wohnte, musste selbst sehen, wie er klarkam. Denn oben wohnte man nur, wenn man nichts besaß. Je näher man dem Himmel war, desto näher war man auch dem Tod. So lautete die Regel in den mehrgeschossigen Häusern, den Insulae. Unten lebten die Bessergestellten, oben die Armen. Die wiederum erfuhren grundsätzlich als Letzte von drohenden Gefahren und hatten den weitesten Weg, um sich in Sicherheit zu bringen. Ganz zu schweigen von der mangelhaften baulichen Qualität der oberen Stockwerke.
Sie öffnete ihre Tür ein Stück weiter. Die Sklaven sprangen bereits durcheinander und trugen auf Geheiß ihres Herrn, der sich behelfsmäßig einen langen Schal über seine Tunika geworfen hatte, Gegenstände hinaus. Bildete sie sich das ein, oder stieg ihr bereits ein beißender Geruch in die Nase?
»Feuer«, formte ihr Mund das Wort, während sie schnell zum Fenster eilte und wie versteinert sah, dass das Haus gegenüber bereits in Flammen stand. Kurz dachte sie daran, dass unter ihnen ein Tuchhändler sein Geschäft hatte. Die Stoffe würden dem Feuer bereitwillig Nahrung liefern.
Feuer!, schoss es ihr erneut durch den Kopf. Jeder wusste, dass die Flammen für gewöhnlich kein Erbarmen kannten. Sie verschlangen, was sich ihnen in den Weg stellte.
Die Götter hatten ihre Gebete also doch erhört und ihr ein Zeichen gesandt. Der Tag war gekommen, heute würde es sich entscheiden. Ohne auf das zu achten, was gerade um sie herum geschah, eilte sie zurück in ihre Kammer, öffnete ihre Truhe, zog eine lange Palla heraus und einen anderen Gegenstand, den sie schon eine ganze Zeit sorgfältig verbarg. Sie versteckte ihn nun unter den Falten ihres Gewandes und machte sich auf den Weg zum Tablinum. Zumindest nahm sie an, dass ihr Mann sich in seinem Arbeitszimmer aufhalten würde, denn dort hortete er seine Reichtümer.
»Was stehst du hier herum?«, fuhr er sie an, als sie eintrat. »Rom brennt, also pack deinen Kram zusammen, ich werde dir ganz gewiss nicht alles neu kaufen. Dieses Feuer wird mich vermutlich sowieso ruinieren!«
Sie sah ihn unverwandt an, während er lauter kleine Lederbeutel mit Münzen in einen größeren schmutzigen Sack packte. Dann öffnete er eine kleine Schatulle, und zum Vorschein kamen mehrere prächtige Ringe mit den unterschiedlichsten Edelsteinen, die er sich alle an die knochigen Finger steckte. Als er ihr überraschtes Gesicht bemerkte, grinste er gemein. »Bilde dir nicht ein, dass du jemals einen davon tragen wirst, das hast du dir nämlich nicht verdient.«
Sie überging diese Bemerkung mit einem Schulterzucken und warf einen Blick auf den alten Sklaven, der mit im Raum war. Er war von allen am längsten im Haus. Ein gebeugter Mann, der wenig sprach und nun darauf wartete, die Anweisungen seines Herrn entgegenzunehmen. Die anderen waren bereits beladen wie Packesel aus dem Haus gestürmt.
Ihr Ehemann hob den Kopf, ignorierte, dass sie immer noch anwesend war, und sagte zu dem Sklaven: »Du wirst hierbleiben!«
Die Augen des alten Mannes weiteten sich bei dieser Aussicht angstvoll. Jeder wusste schließlich, dass der Tod in den Flammen eine grausame Art war, diese Welt zu verlassen.
»Für den Fall, dass das Feuer uns verschont, will ich nicht, dass irgendwelche Plünderer mein Hab und Gut in ihre dreckigen Finger bekommen. Du wirst die Wohnung bewachen. Verstanden? Und wehe, du rührst dich vom Fleck!« Er hatte keinerlei Gewissensbisse, den Mann, der ihm all die Jahre so treu gedient hatte, in den sicheren Tod zu schicken.
Kurz zögerte sie noch und wägte ihr Vorhaben ab. Der Sklave, der demütig den Kopf senkte, gehörte nicht zu ihrem Plan, aber eine bessere Gelegenheit würde sich nie wieder ergeben. Damit war es entschieden. Flink machte sie ein paar Schritte auf ihren verhassten Gemahl zu, unauffällig zog sie dabei den Dolch unter der Palla hervor. Bevor er etwas sagen konnte, stach sie zu und trieb die Klinge dabei tief in den Bauch ihres Ehemannes. Die Gegenwehr blieb aus, sie musste ihm gleich beim ersten Stoß eine tödliche Verletzung zugefügt haben. Warmes Blut quoll aus der Wunde, lief über den Griff der Waffe und verfärbte ihre wohlgeformten weißen Finger, die den Dolch immer noch fest umschlossen, dunkelrot.
Den Ausdruck im Gesicht ihres Opfers wollte sie nie vergessen, war er doch eine willkommene Erinnerung an den Beginn ihres neuen Lebens.
Ein Röcheln entschlüpfte der Kehle ihres Gemahls, seine Hände versuchten erfolglos, nach ihr zu greifen, und sein Blick veränderte sich. Wut lag nun darin und abgrundtiefer Hass.
»Stirb endlich!« Sie drehte den Dolch und riss ihn dann zurück.
Er brach zusammen; sein Körper krümmte sich in den letzten Sekunden des Todeskampfes, bevor er schließlich reglos auf der Erde liegen blieb.
Sie trat unsanft mit dem Fuß nach ihm, und als kein Zucken wahrzunehmen war, fühlte sie sich mit einem Mal seltsam berauscht. Die Hilferufe und verzweifelten Schreie, die nun von überall her zu kommen schienen, schreckten sie nicht auf. Mit einem zufriedenen Lächeln betrachtete sie die Leiche, dann beugte sie sich hinab und zog dem Toten zwei wundervoll gearbeitete goldene Ringe vom Zeigefinger. Einer hatte einen karneolroten Stein, in den die Umrisse eines Vogels eingearbeitet waren, in den anderen hatte man einen grünen Jaspis eingesetzt.
»Und ob ich mir die verdient habe«, flüsterte sie versonnen, als sie die Schmuckstücke ansteckte, die Hand hob und geziert die Finger abspreizte, um sie besser betrachten zu können.
Erst der Sklave, der plötzlich neben sie trat und stammelte: »Herrin, das Feuer!«, holte sie in die Wirklichkeit zurück.
Die Flammen hatten sie erreicht, vermutlich waren sie vom Nachbarhaus auf ihr Gebäude übergesprungen. Den ganzen Tag schon hatte ein kräftiger Wind durch die Straßen von Rom gefegt, der offensichtlich jetzt die Funktion eines riesigen Blasebalgs übernahm und das Feuer über die ganze Stadt verteilte.
»Er ist in den Flammen gestorben, genau wie du und ich!«
Der Sklave verstand, blieb aber stumm.
Sie stürzte zu den Lederbeuteln mit den Münzen, griff sich einen und reichte ihn dem Mann. »Wenn du frei sein willst, dann nimm das Geld und verschwinde aus Rom.«
Er streckte die Hand aus, konnte sein Glück kaum fassen und sah sie deshalb ungläubig an.
»Du wirst mich doch nicht verraten wollen?«
Er schüttelte den Kopf. »Niemals!«
»Bedenke, dass dann mein Wort gegen das deine stehen wird«, rief sie ihm in Erinnerung. »Wir sind ab heute alle tot, Opfer des Feuers. Und jetzt geh!« Ihre Stimme klang scharf.
Der Sklave eilte davon, während sie überlegte, ob es ein Fehler gewesen war, ihn einfach seiner Wege ziehen zu lassen. Vermutlich wäre es künftig besser, auf Gnade zu verzichten.
Die Wohnung war bereits menschenleer. Mit wenigen Handgriffen packte sie die gefüllten Münzbeutel in eine Tasche; der Rauchgeruch wurde jetzt stärker, offensichtlich brannten bereits die oberen Stockwerke. Die Frau schlang ihre Palla um sich und verließ das Haus, ohne auch nur einen weiteren Blick auf ihren toten Ehemann zu werfen.
Sie hörte die Schreie über sich, das Treppenhaus stand bereits in Flammen. Die Menschen in den oberen Geschossen konnten nicht mehr entkommen. Als sie auf die Straße trat, bot sich ihr ein Bild des Grauens.
Das Feuer traf die Stadt mit rücksichtsloser Brutalität. Später würde man sagen, dass es beim Circus ausgebrochen wäre, aber auf die Bewohner Roms machte es den Eindruck, die Flammen würden in jedem Winkel der Stadt gleichzeitig aus dem Boden schießen, unkontrolliert, zerstörerisch und unaufhaltsam. Wo man sich auch hinwandte, die Brände versperrten den Menschen den Weg. Die Flüchtenden rannten miteinander, gegeneinander, riefen nach ihren Kindern, der Geliebten, der Mutter ... Rom war verloren und mit der Stadt auch ihre Bewohner.
Hustend überquerte sie die Straße und versuchte, dem Inferno zu entkommen, mit einem Aufschrei sprang sie jedoch im nächsten Moment zurück. Direkt vor ihren Füßen landete mit einem lauten Krachen ein seltsames Gebilde, das aussah wie eine große, verkohlte Holzkiste. Kurz danach fiel die Konstruktion auseinander und gab den Blick auf drei verkohlte Leichen frei. Nun wusste sie, was da vor ihr lag: Es handelte sich um die Reste einer Behausung, die man für gewöhnlich in den obersten Stockwerken der großen Insulae fand. Nachträglich eingezogene Holzwände schafften in den ohnehin schon winzigen Wohnungen die Möglichkeit, noch weitere Mieter unterzubringen. Diese drei Menschen, vermutlich eine kleine Familie, waren darin elend zugrunde gegangen, als das Feuer ihnen den Weg nach draußen versperrt hatte.
Sie spürte die Hitze der Flammen auf der Haut und beeilte sich, weiterzukommen. Hinter ihr stürzten Häuser ein, auch das, in dem sie viele Jahre so unglücklich gelebt hatte. Die Erleichterung auf ihrem Gesicht passte nicht zu den verzweifelten Blicken der Umherirrenden, aber in diesem Moment achtete niemand auf sie. Die Menschen hatten nur ein Ziel vor Augen, und das war, den heißen rotgelben Flammen zu entfliehen, die aussahen wie brennende Echsenzungen, die unerbittlich Jagd auf sie machten.
Die Frau war nicht weit gekommen, als sie die Schreie der Bewohner eines Hauses hörte. So wie es aussah, gelang es den verzweifelten Menschen nicht, die Tür zu öffnen. Jemand von außen rief: »So tretet doch zurück!«, aber das Rumoren hinter dem Holz wurde immer stärker. Wie in Panik geratenes Vieh drängten die Unglücklichen Richtung Ausgang und vergaßen dabei, dass sich die rettende Tür nur nach innen öffnen ließ. Wenn die Hausbewohner nicht bald zur Vernunft kämen, dann würden sie unter den Mauern begraben werden.
An der nächsten Biegung hielt man sie auf. Der Mann gehörte zu den Vigiles, der römischen Feuerwehr. Er verweigerte ihr den Durchgang.
Eine dicke Frau, die ein Baby auf dem Arm trug und an deren Seite drei schmutzige Kleinkinder standen, kreischte hysterisch: »Warum zündet ihr unsere Häuser an?« Und tatsächlich konnte man erkennen, dass die Männer dabei waren, ein Feuer zu legen.
»Wir haben unsere Befehle«, gab der Helfer gereizt zurück. »Und nun verschwinde, Weib!«
Die Handvoll Menschen, offensichtlich die Bewohner des Hauses, das man dem Feuer opfern wollte, rückte dichter heran und machte ihrem Unmut Luft.
»Unsere Unterkünfte sind bisher verschont geblieben, und jetzt wollt ihr sie anzünden?«, schimpfte ein alter Mann, der sich mühsam auf einen Stock stützte.
Die kleine Gruppe bestand nur aus Frauen, Kindern und Alten. Sie wussten nicht wohin, waren aber kaum in der Lage, Widerstand zu leisten. Zwei weitere Vigiles kamen dazu und schoben sie grob zur Seite.
Der Alte zeigte ihnen den Mittelfinger und rief: »Bestellt das dem Brandstifter von Rom, unserem Kaiser Nero!«
Bevor man sich auch ihr zuwenden konnte, stürzte sie weiter – keinesfalls wollte sie noch in einen Tumult hineingezogen werden. Die Feuerwehrleute hätten den Menschen vielleicht erklären sollen, was sie da taten. Aber offensichtlich war es den drei Vigiles nicht in den Sinn gekommen, welche Gerüchte durch ihr Schweigen schon bald in Rom kursieren würden. Jedenfalls wusste sie es besser. Mit dem absichtlichen Anzünden der Gebäude wollten die Männer eine Feuerschneise anlegen, um die Brände zu stoppen. Bei irgendeinem Festessen hatten einige Gäste von solchen Maßnahmen gesprochen.
Ihr war es einerlei, denn sie wollte nur die Stadt verlassen. Mit zittrigen Fingern tastete sie nach der Tasche, die Münzen würden ihr dabei behilflich sein, gab es darunter doch sogar einige aus purem Gold. Ihr altes Leben hier in Rom erlosch mit dem großen Feuer dieser Nacht. Das war alles, was jetzt noch zählte.
Kapitel 4
Rom, zwei Jahre später, im October 66 nach Christus
Über zwei Jahre war Marcus Cassius Magnus nicht mehr in Rom gewesen. Er gehörte heute zu den Immunes, den Prätorianern mit besonderen Funktionen. Allerdings unterschieden sich die Aufgaben, mit denen man ihn betraute, eindeutig von denen seiner ranggleichen Kameraden, und seine besondere Stellung hatte ihn in die entlegensten Winkel des Reiches geführt. Nach so vielen unterschiedlichen Eindrücken schien ihm Rom wie ein vertrautes Zuhause.
Der Prätorianer dachte daran, wie er das erste Mal im Auftrag des Kaisers aus den Toren der Stadt geritten war. Er sollte einen Transport begleiten, seine Reise führte ihn in die nördlichen Grenzgebiete. Etwas enttäuscht hatte er dort feststellen müssen, dass die wertvolle Fracht nichts weiter als das Wasser irgendeiner heiß aus dem Boden sprudelnden Quelle gewesen war. Unter widrigsten Umständen hatte man mehrere Amphoren davon aus dem Barbarengebiet geschmuggelt, das rechts des Flusses Rhenus lag. Offensichtlich hatte dieses besondere Nass eine unvergleichbar positive Auswirkung auf die Singstimme eines Menschen, weshalb es den Kaiser auch so sehr nach dem Wunderwasser gelüstet hatte. Was der Prätorianer nicht wissen konnte, war, dass man dort schon ungefähr zehn Jahre später eine Siedlung mit dem Namen Aquae errichten würde und die wohltuende Wirkung des heißen Quellwassers dann nicht mehr nur den kaiserlichen Stimmbändern, sondern eines Tages vor allem den Besuchern der dort errichteten Therme zugutekommen sollte. Marcus war es lächerlich erschienen, diesen Befehl auszuführen, aber so hatte er wenigstens einmal das Land der wilden Stämme sehen können.
Dann war er abgelöst und mit einem neuen Auftrag nach Britannien geschickt worden. Dieses Mal hatte er Licht in eine Angelegenheit bringen müssen, die weder mit Wasser noch mit den schönen Künsten zu tun gehabt hatte: Ein Statthalter war unerwartet gestorben, und seine Witwe, die von Nero sehr geschätzt wurde, hatte sich in ihrer Verzweiflung Hilfe suchend an den Imperator gewandt. Marcus hatte getan, was er konnte, und die Sache geklärt, übrigens zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten.
Einem persönlichen Dankschreiben des Kaisers war bereits der nächste delikate Auftrag gefolgt. Ob als Schlichter, Gutachter, Geleitschutz oder auch nur als Beobachter, seine Aufgaben waren meist eine Herausforderung und seine Einsatzorte vielfältig gewesen. Mittlerweile bediente man sich gern des Mannes, der mit ruhiger Art und gesundem Menschenverstand Situationen klären konnte, ohne Staub aufzuwirbeln. Seine letzte Reise hatte ihn nach Lutetia Parisiorum geführt. Als ihn dort die Nachricht seines ehemaligen Mentors Decimus erreichte, war er eilig nach Rom aufgebrochen. Natürlich hatte sich die Stadt verändert, vor allem nach dem großen Brand vor zwei Jahren.
Marcus war vieles zu Ohren gekommen, und nun konnte er endlich mit eigenen Augen die Baufortschritte sehen. Deshalb hatte er sich auch entschlossen, sein Ross in einem der Ställe unterzubringen und das wiederaufgebaute Rom per Fuß zu erkunden.
Als müsste er gleich in ein tiefes Gewässer eintauchen, hielt er unbewusst die Luft an, um sich sodann mutig von den Menschenmassen verschlingen zu lassen. Alles fühlte sich vertraut an, sogar seine berauschende Wirkung war Rom erhalten geblieben. Er spürte die vielen Körper, die sich an ihm vorbeidrängelten, ihn mit sich zogen, zur Seite schubsten oder einfach grob anrempelten. Es dauerte seine Zeit, bis er sich in dem Gedränge der Leiber zurechtfand und ganz selbstverständlich mit den vielen Menschen durch die Straßen zog. Er setzte seinen Weg fort, vorbei an den Markthändlern, die Waren aus aller Welt anboten. Selten hatte er auf seinen Reisen so eine Vielfalt gesehen, alleine die Farben waren ein Genuss. Die bunten Gewänder der römischen Frauen vervollständigten noch den Eindruck unendlicher Pracht. Deshalb war er auch fast verärgert, als sich ihm ein anderes vertrautes Bild zeigte, das auf unangenehme Weise die Harmonie zu stören schien: Er war ziellos immer weiter gelaufen und nun auf dem Sklavenmarkt gelandet. Eigentlich ein völlig normaler Anblick. Jeder, der etwas auf sich hielt, hatte Sklaven. Sein eigener Vater besaß neun Männer und Frauen, die er einst wie Vieh auf einem Markt wie diesem erworben hatte. Trotzdem wandte sich Marcus schnell ab. Er wollte sich den Tag nicht damit verderben, in ausdruckslose, ängstliche Gesichter zu blicken oder weinende Kinder zu hören, die in irgendeiner fremdländischen Sprache nach ihrer Mutter schrien.
Eine Ecke weiter stieg ihm ein leckerer Geruch in die Nase. Sofort steuerte er die nächste Popina an. Die dralle Bedienung schlenderte mit aufreizenden Bewegungen auf ihn zu.
Marcus hatte längst die jungenhafte Scheu abgelegt und war mit seinen sechsundzwanzig Jahren weder verunsichert noch unfreundlich, als er nicht auf das Tändeln der Frau reagierte. Mit ihren breiten Lippen formte sie einen Schmollmund und zog mit wogenden Hüften davon, um ihm einen Krug Wasser zu holen, den sie mit einer spöttisch hochgezogenen Augenbraue auf den Tisch knallte.
Während er auf das Essen wartete, konnte er nicht umhin, ein paar Gesprächsfetzen vom Nachbartisch aufzuschnappen. Der Gastraum war halb gefüllt, und überall wurden rege Unterhaltungen geführt. Vermutlich nahmen die beiden Alten in der Ecke deshalb an, man würde sie nicht hören. Marcus verfolgte interessiert das Gespräch.
»Das ist doch Wahnsinn«, flüsterte der eine, ein kahlköpfiges Männlein ohne Zähne, aber mit flinken, klaren Augen. »Da sage mir noch einer, der Kaiser hätte den Brand nicht gelegt.«
»Sie behaupten doch, dass es diese Sekte, die Christen, gewesen sind«, murmelte der andere zurück, der eine kräftige Statur hatte und dessen Frisur an die von Julius Caesar erinnerte.
»Ja, das war ein schönes Spektakel«, antwortete der Kahle mit einem nostalgischen Seufzer. Offensichtlich hatte er die grausamen Hinrichtungen vor zwei Jahren sehr genossen.
»Kann man wohl sagen!«
Kurz herrschte Stille, und es schien, dass die beiden den Moment des totalen Einverständnisses schweigend genießen wollten.
Dann schlürfte das Männlein geräuschvoll einen Schluck Wein in seinen zahnlosen Mund und kam auf das eigentliche Thema zurück. »Trotzdem ist es doch ein gewaltiger Zufall, dass Rom gerade zu dem Zeitpunkt niederbrennt, zu dem unser Kaiser schon die Baupläne für seine Domus Aurea auf dem Tisch hatte. Ich bin vielleicht halb blind, aber dieser Palast ist so groß, dass ich den auch ohne mein Augenlicht sehen könnte.«
»Red keinen Unsinn!«, ermahnte ihn sein Freund. »Der Kaiser muss ordentlich residieren. Schließlich kann der Rest der Welt ruhig wissen, mit wem er es zu tun hat.« Obwohl man den Eindruck hatte, der Mann wäre dem Herrscher treu ergeben, setzte er nun doch zweifelnd nach: »Aber seltsam ist es schon. Der Nachbar der Freundin meiner Schwester, der kennt einen, und der wiederum hat erzählt, dass er gehört hätte, dass ...«, jetzt beugte er sich weiter vor und senkte noch ein wenig mehr die Stimme, »... dass die Vigiles selbst die Brände gelegt hätten!«
»Bei Jupiter!«, entfuhr es dem anderen. »Also doch ...«
»Aber jetzt sei lieber still, du weißt ja, dass man dieser Tage vorsichtig sein muss.« Er sah sich verstohlen um und entdeckte Marcus, der so tat, als konzentrierte er sich auf das eigentlich verbotene Würfelspiel einiger Gäste am Nachbartisch.
Die Stimmung des Prätorianers war nun merklich gedämpft. Was er da hörte, gefiel ihm nicht. Nero war beim Volk stets beliebt gewesen – und jetzt solche Gerüchte?
Kurz dachte er daran, die beiden darauf hinzuweisen, dass es schließlich Nero gewesen war, der neue Sicherheitsbestimmungen bezüglich des Brandschutzes aufgestellt hatte, aber dann verwarf er den Gedanken. Sie würden ihm sein Lauschen übel nehmen und später erzählen, der Kaiser ließe sein Volk bespitzeln, damit war niemandem gedient.
Aus unerfindlichen Gründen wurde er langsam nervös. Was hatte seinen Mentor Decimus dazu bewogen, ihn nach Rom abzuberufen? Letzten Endes war die Mitteilung doch überraschend gekommen. Lange Zeit hatte es nämlich eher so ausgesehen, als wollte ihn sein einstiger Ausbilder von der Hauptstadt und dem Kaiser fernhalten.
Endlich kam das Essen und Marcus wurde aus seinen Grübeleien gerissen. Er machte sich mit Begeisterung über die mit Fisch und Pilzen gefüllten Schweinezitzen und den Käse mit dem duftend warmen Fladenbrot her. Aber besonders genoss er das Garum. Denn auf diese würzige Fischsoße hatte er die letzten Tage des Öfteren verzichten müssen.
Nach dem Mahl beschloss er, auf dem Weg zu seiner Verabredung mit Decimus einen kleinen Schlenker zu machen, um sich Neros neue Residenz ansehen zu können. Die Domus Aurea war tatsächlich gewaltig, und die Arbeiten würden sicher noch ein paar Jahre in Anspruch nehmen.
Sein eigentliches Ziel war aber einer von Roms Gärten, der den Einwohnern der Stadt als Ruhebereich zur Verfügung stand. Letzten Endes musste der Prätorianer eine ganze Weile gehen, bevor er die etwas abseits gelegene Parkanlage fand. Ein Tempel, der dem Kriegsgott Mars geweiht war, bildete das Zentrum. Bis auf die Vorderseite wurde das Götterhaus von einem Säulengang umschlossen, den man hervorragend zum Lustwandeln benutzen konnte.
Schon von Weitem erblickte Marcus die unverwechselbare Gestalt des Decimus Cornelius Britannicus, der im Säulengang auf und ab marschierte. Marcus wusste, dass es seinem Mentor schwerfiel, lange Zeit still zu sitzen. Dafür war Decimus zu sehr Soldat. Vermutlich vermittelte ihm das Durchschreiten der Rundbögen und das Passieren der Marmorsäulen das Gefühl, mit seinen Untergebenen zu exerzieren. Der Prätorianer musste unwillkürlich lächeln und eilte schleunigst zu dem Mann, der ihm stets mehr Freund als Vorgesetzter sein würde.
Als Decimus seinen ehemaligen Rekruten entdeckte, konnte er einen freudigen Ausruf nicht unterdrücken. Um diesen für ihn untypischen Gefühlsausbruch zu kaschieren, fuhr er Marcus jedoch gleich darauf in seiner raubeinigen Art an: »Du bist zu spät!«
»Ich freue mich auch, dich zu sehen, ehrenwerter Decimus Cornelius.«
»Ach, was soll das Getue, lass dich ansehen.« Decimus schnalzte mit der Zunge. »Wenn ich dein narbenloses Gesicht sehe, kann ich nur vermuten, dass du bisher vor den Hieben davongerannt bist?«
»Nein, ich war im Kampf nur geschickter als meine Gegner! Ich hatte schließlich einen guten Lehrer.«
»Du und ein Kämpfer? Vermutlich haben sie gedacht, du bist eine verkleidete Frau, so zart, wie deine Züge immer noch sind.«
Marcus lachte aus vollem Herzen. Er wusste natürlich, dass Decimus, der stolzer Träger einer Narbe war, die ihm quer über das Gesicht verlief, einen Soldaten an seinen Verletzungen maß.
»Mich als Frau zu verkleiden, könnte eines Tages vielleicht sogar hilfreich sein. Wer weiß, vielleicht werde ich das dann in meinen Aufzeichnungen die Decimus-Strategie nennen«, gab Marcus nun scherzend zur Antwort.
»Na, dein Mundwerk zu trainieren, ist dir offensichtlich gelungen. Wir werden noch sehen, was deine Schwerthand kann«, entgegnete Decimus und schlug mit seiner gewaltigen Pranke so unvermittelt auf Marcus’ Arm, dass dieser Mühe hatte, nicht einen Stolperschritt zur Seite zu machen.
»Immer noch standfest, das freut mich!«, sagte der Ältere nun und spielte damit auf die Vergangenheit an. »Komm«, ließ er das Thema fallen und forderte sein Gegenüber auf, ihn beim Durchqueren des Säulengangs zu begleiten.
Sie hatten keine Gesellschaft, also mussten sie nicht fürchten, belauscht zu werden.
»Ich habe dich hergebeten, weil ich jemanden brauche, dem ich absolut vertrauen kann«, fiel Decimus mit der Tür ins Haus.
In diesem Moment wurde Marcus erst klar, wie ernst die Angelegenheit sein musste. Dafür sprach nicht nur die Aussage selbst, sondern auch das unverblümte Kompliment, das ihm der Vorgesetzte damit gemacht hatte.
* * *
Zur gleichen Zeit in Neapolis
Sie betrachtete sich in dem polierten Silberspiegel. Mehr als zwei Jahre waren seit dem großen Brand in Rom nun vergangen. Genauso lange lebte sie frei und konnte tun und lassen, was sie wollte.
»Flavia Valona«, stieß sie stolz hervor. Das war der Name, den sie seither trug. Es war schon erstaunlich, was man alles mit ein bisschen Gold erreichen konnte. Die klimpernden Münzen hatten ihr einen neuen Namen und alle nötigen Papiere verschafft, um sich im Römischen Reich als wohlhabende Witwe uneingeschränkt bewegen zu können.
In den letzten Monaten hatte sie verschiedene große und kleine Städte besucht, das war nötig gewesen, um später mit einem glaubhaften Lebenslauf aufwarten zu können. Dort hatte sie sich in Herbergen einquartiert und behauptet, auf der Durchreise zu sein, um sich in der nächsten Stadt mit ihrem Mann zu treffen.
Heute war sie so weit, als ehemalige Gemahlin eines mittelprächtig erfolgreichen Kaufmanns aufzutreten, den sie auf seinen eintönigen Verkaufstouren durch die Provinz begleitet hatte. Mehr würde man künftig nicht von ihr wissen wollen, denn niemand interessierte sich für eine Siedlung oder ein Dorf am Ende der Welt. Alle lechzten nach Neuigkeiten aus Rom, von dem sie sich hüten würde, etwas zu erzählen. Man sollte ruhig glauben, dass sie bisher ein äußerst langweiliges Leben geführt hatte.
Valona drehte leicht den Kopf und begutachtete die feinen Linien, die sich unter ihren schönen grünen Augen gebildet hatten. Verärgert schnalzte sie mit der Zunge. Mit ihren dreiunddreißig Jahren war sie immer noch eine sehr schöne Frau, vor allem im Vergleich zu den meisten ihrer gleichaltrigen Geschlechtsgenossinnen. Viele erreichten nicht einmal die dreißig, weil sie vorher im Kindbett starben. Und wem dieses Schicksal erspart blieb, sah dann oftmals trotzdem nicht mehr sehr lebendig aus. Natürlich galt das vor allem für die Frauen aus den unteren Schichten. Sie waren gezeichnet von der harten Arbeit, die sie täglich verrichten mussten, vom Kampf ums Überleben, den sie gezwungen waren zu führen, und natürlich vom Hungern und Darben.
Valona hingegen glich heute einer aufgeblühten Rose, die von den wuchernden Blättern befreit worden war, die ihr in der Vergangenheit das Sonnenlicht abspenstig gemacht hatten.
Trotzdem war sie beunruhigt. Sie durfte nicht länger ihre Zeit verschwenden, der Lederbeutel mit den Münzen wurde von Tag zu Tag leichter. Sie brauchte dringend eine neue Geldquelle – und das bedeutete, schnellstmöglich einen geeigneten Ehemann zu finden. Ihr Aussehen war ihr Hauptkapital; das musste sie einsetzen, bevor es verloren ging. Da die Zeit also drängte, machte sie sich heute endlich auf den Weg, um die nötige Ausstattung für ihren großen Auftritt zu besorgen.
Wie immer, wenn sie in den Straßen unterwegs war, hüllte sie sich in eine unauffällige knöchellange Palla. Sie wollte keine Aufmerksamkeit erregen und die Anonymität nutzen, die ihr die Menschenmenge in den Gassen bot. Ihr Ziel war der Sklavenmarkt von Neapolis.
Valona betrachtete in aller Ruhe die menschliche Ware. Sie war sehr konzentriert, und das aufdringliche Verhalten eines Händlers machte es ihr schwer, nicht die Geduld zu verlieren.
»Beste Ware, schau!« Er deutete mit einem wurstigen Finger auf das Podest, auf dem ein exotisch aussehendes Mädchen stand. Sie mochte etwa vierzehn Jahre alt sein und war von beeindruckender Schönheit. Obwohl sie hier fast nackt vorgeführt wurde, schien sie keinerlei Scham zu empfinden.
»Die Kleine wäre eine hervorragende Dienerin und würde dir sicher sehr gefällig sein!«
Ja, und meinem zukünftigen Ehemann auch, dachte Valona grimmig.
Sie war nicht naiv. Natürlich wusste sie, dass Sklavinnen keine Wahl hatten, wenn der Hausherr von ihnen sexuelle Dienste forderte. Aber warum sollte man sich die Gegnerschaft absichtlich ins Haus holen? Sie schüttelte deshalb energisch den Kopf und ließ den Sklavenhändler stehen, der sich verärgert über seinen gewaltigen Bauch fuhr. Seine Miene heiterte sich jedoch sofort wieder auf, als ein vornehmer Herr sich dem Podest näherte und sich beim Anblick der schönen Sklavin lüstern mit der Zunge über die Lippen leckte.
Valona hatte derweil entschieden, sich mehr auf die Verkäufer zu konzentrieren, die ihre Ware auf den hinteren Marktplätzen anboten. Dort, bei den weniger ansehnlichen Verkaufsständen, nahm der Gestank von Schweiß und menschlichen Fäkalien zu. Einige der Sklaven saßen in Käfigen, die genauso wie die Insassen nicht gesäubert worden waren. In den Gesichtern der Sklaven hingen dreckige Krusten, aus ihren Gefängnissen tropfte Urin, und die Fliegen sammelten sich um diesen erbärmlichen Ort. Gerade als Valona den nächsten Käfig passierte, rief ihr jemand daraus etwas hinterher.
»Warte, ich flehe dich an!«, vernahm sie die Stimme eines Mannes.
Im gleichen Augenblick zischte eine Peitsche gegen das Holz des Gefängnisses, und die Insassen versuchten, sich vor den Hieben in Sicherheit zu bringen.
Valona blieb unvermittelt stehen, die Worte des Mannes passten nicht zu seinem Aussehen. Er war ein großer, grobschlächtiger Typ mit Furcht einflößendem Gesicht. Sein schmutziger Körper war mit eigenartigen Motiven bemalt, etwas, das Valona noch nie zuvor gesehen hatte. Interessiert trat sie einen Schritt vor und hob die Hand, als sie sah, dass der Wächter erneut mit der ledernen Geißel ausholen wollte. Sofort eilte jetzt der Sklavenhändler herbei, weil er ein Geschäft witterte.
Sie beachtete den schmierigen Kerl mit der schmutzigen Tunika nicht, sondern forderte den Insassen, der jetzt sein Gesicht an die eng nebeneinander stehenden Stäbe drückte, auf, sich zu erklären. »Du sprichst Latein? Das klingt nicht nach einem Barbaren.«
»Sei versichert, ehrwürdige Dame, ich bin einer. Aber ich lerne schnell.«
Seine Antwort hätte sie beinahe zu einem Lächeln veranlasst, aber das wäre unpassend gewesen. »Was tust du dann noch hier?« Die Abscheu, die sie gegen diesen Ort hegte, war ihr deutlich anzumerken. »So jemand wie du sollte doch längst verkauft sein.«
»Er ist erst gestern in meinen Besitz gekommen«, mischte sich der Sklavenhändler ein. »Und wäre sozusagen ein Glücksfall für dich!«
Noch bevor Valona antworten konnte, rief der Gefangene: »Er lügt!«
Wieder sauste die Peitsche unbarmherzig nieder und hinterließ rote Striemen auf den Fingern des Mannes, mit denen er die Holzstäbe des Käfigs umklammert hatte.
»Lass ihn sprechen!«, fuhr Valona in einem Ton dazwischen, der keine Widerworte zuließ. Oft genug hatte sie dieses herrische Auftreten vor dem Spiegel geübt.
»Ich kam in Schwierigkeiten«, sagte der Sklave und warf ihr einen trotzigen Blick zu, dann senkte er betrübt den Kopf und zeigte seinen rasierten Schädel. Augenscheinlich mochte er um die zwanzig sein.
»Erklär dich!«, erwiderte sie schroff.
»Ich wandte mich gegen meinen Herrn.«
Sie verlor sofort das Interesse. Ein sich widersetzender Sklave war das Letzte, was sie gebrauchen konnte.
Ihr Weitergehen veranlasste den Mann, erneut zu sprechen: »Ich habe die Wahrheit gesagt, nun gib mir die Chance, mich zu verteidigen. Ich tat es nicht für mich, sondern für jemanden, den ich schützen wollte.«
Jetzt war sie neugierig geworden und hielt inne. Sie drehte sich um und sah erneut in das grausam wirkende Gesicht, über das ein zärtlicher Ausdruck huschte.
»Sprich.«
»Mein Herr wollte meine Schwester vergewaltigen.«
Sie hob überrascht die Augenbrauen. »Du bist hier, weil du Rechte eingefordert hast?«
Der Sklavenhändler und sein Kumpan mit der Peitsche lachten derb, als sie ihre ironisch gemeinte Bemerkung vernahmen.
»Ich forderte nichts für mich, nur für sie.«
Valona beäugte ihn abschätzend. »Nun verrate mir, wie ist die Geschichte ausgegangen?«
Seine hellen Augen wurden einen Ton dunkler. Man hatte den Eindruck, ein Schatten würde sich über sein schmutziges Gesicht legen. Die Stimme des Mannes war völlig ruhig, und trotzdem erschauderte Valona, als sie den Hass heraushörte. »Mich hat man in Ketten gelegt, und meine Schwester wurde vor meinen Augen vergewaltigt. Als mein Herr ihre Schreie jedoch nicht mehr ertragen konnte, hat er ihr die Zunge herausgeschnitten und uns anschließend an diesen Unmenschen verkauft.«
»Ein schlechtes Geschäft, zugegeben«, warf der Sklavenhändler ein. »Aber ich habe auch gute Ware hier, kräftige Männer, die nicht ungefragt reden!«
Wieder hob Valona die Hand, und der Mann verstummte augenblicklich.
»Ich nehme an, du verlangst von mir, auch deine Schwester zu kaufen?«
Sie sahen sich schweigend an.
»Rette uns, und ich schwöre bei meinem Leben, dir bis ans Ende meiner Tage ein treuer Diener zu sein.«
»Der Schwur eines Sklaven«, antwortete sie ihm mit einem spöttischen Lächeln.
»Der Schwur eines Kriegers aus Kaledonien!«, schleuderte er ihr voller Stolz entgegen. »Ich werde für dich sterben, wenn du es verlangst, nur rette meine Schwester!«
Valona dachte nach. Ein Barbar bot ihr seine Loyalität an – konnte sie dieses Arrangement ernsthaft in Betracht ziehen? Andererseits brauchte sie jemanden, der ihr bei dem, was sie vorhatte, treu zur Seite stand. Noch während sie darüber nachgrübelte, richtete der Mann im Käfig abermals das Wort an sie: »Meine Schwester wird dir von großem Nutzen sein. Sie ist eine kundige Frau, sie kann dir helfen, schön zu bleiben.«
Seine vermeintliche Retterin horchte auf und ließ ihn damit unvorsichtigerweise erkennen, dass sie solchen Fähigkeiten gegenüber nicht abgeneigt war.
Hastig sprach er erneut: »Sie ist vertraut mit Kräutern und Mixturen und eingeweiht in die Schönheitsgeheimnisse der Frauen.«
»Auch dafür habe ich nur dein Wort ...«
Er sah sie unverhohlen an. Nein, dieser Mann würde sich einem Herrn sicher niemals unterwerfen. Nichtsdestotrotz gestand sie seinem Treueeid einen gewissen Wert zu. Die Dankbarkeit eines Menschen konnte manches Mal mehr Nutzen bringen als seine Furcht.
»Wie kannst du sicher sein, dass ich die richtige Herrin für euch bin? Was, wenn es euch bei mir noch schlechter ergeht als bisher?«
»Dann wird es eben so sein. Was habe ich zu verlieren? Und bedenke, ich wäre dir auch ein guter Leibwächter.«
»Wieso meinst du, dass ich einen bräuchte?«, antwortete sie schnippisch.
»Weil du jemand bist, der sein Schicksal herausfordern will, das sehe ich in deinen Augen. Und wäre es anders, dann würdest du dich nicht allein in diesem schäbigen Teil des Marktes umsehen.«
Dass der Fremde sie so durchschaute, war ihr unheimlich, vielleicht sollte sie doch besser gehen.
Wieder schien er ihre Gedanken zu erraten. »Wenn du mich an deiner Seite hast, könntest du ohne Sorge überall sein, und niemand würde irgendwelche Fragen stellen.«
»Begleiten kann mich jeder x-beliebige andere Sklave auch.«
Wieder umklammerte er die Holzstäbe. »Jeder Sklave kann dir in der Gefahr vielleicht beistehen, aber ich bin auch bereit, für meine Herrin zu sterben.«
Sie zögerte immer noch, da schaltete sich der Sklavenhändler ein, der seine Chance nicht verpassen wollte. »Ich werde dir einen guten Preis machen!«
Valona haderte mit sich. »Zeig mir die Schwester, dann sehen wir weiter«, befahl sie dem Mann, der sich sofort auf kriecherische Art verbeugte und sie mit wichtigtuerischer Miene zu einem weiteren Käfig führte.
Das Mädchen war als solches kaum zu erkennen. Sie kauerte in einer Ecke, und ihr mit Lumpen nur halb bedeckter Körper war so voller Dreck, dass man kaum die helle Hautfarbe erkennen konnte. Die wässrig blauen Augen blickten mutlos ins Leere, und Valona fragte sich, wie sie je geglaubt haben konnte, dass diese Barbarin eine Ahnung vom Erhalt eines jugendlichen Aussehens hätte.
»Sieh die Dame an, Elende«, zischte der Sklavenhändler kalt. »Wenn du dich richtig anstellst, wird sie vielleicht dich und deinen Bruder kaufen.« Ein verschlagenes Grinsen erschien auf seinem Gesicht, als er fortfuhr: »Immer davon ausgehend, dass wir uns einig werden.« Offensichtlich versuchte er gerade, einen höheren Gewinn zu erwirtschaften, und deutete somit an, sich bei Ermäßigungen nun doch kompromisslos zeigen zu wollen.
In den Körper der jungen Frau im Käfig kam plötzlich Leben. Sie sprang auf die Beine, machte in ihrem engen Gefängnis einen Schritt nach vorne und streckte die Hand durch die Stäbe.
»Bitte, rettet meinen Bruder!« Es war ein unverständliches Lallen, und Valona fiel wieder ein, dass man ihr die Zunge herausgeschnitten hatte. Tränen liefen der Sklavin über das Gesicht, die helle Streifen auf den schmutzigen Wangen hinterließen.
»Dein Bruder sagte mir, du bist kundig, was die Pflege der Schönheit einer Frau angeht?«
»Mein Bruder ...«, stammelte das Mädchen und nickte.
Valona hob unvermittelt die Hand. »Siehst du das?«
Der Sklavenhändler rollte mittlerweile mit den Augen. Diese Frau hielt seinen Betrieb auf, vielleicht sollte er ein weiteres Mal seine Meinung ändern und die Angelegenheit mit einem Sonderpreis beenden. Immerhin musste er ansonsten weiterhin dieses verlauste Geschwisterpaar durchfüttern, bis sich jemand fand, der die beiden kaufen wollte. Vermutlich wäre es das Beste, dem Bruder auch die Zunge herauszureißen. Der Kerl redete zu viel und vertrieb dadurch die Kundschaft. Sicher, er könnte die zwei Barbaren einfach töten, aber dann hätte er nicht einmal seine Unkosten gedeckt.
Das Mädchen starrte auf die makellose Hand dieser wunderschönen Fremden, an der zwei goldene Ringe steckten. Der eine mit einem grünen, der andere mit einem roten Stein, auf dem die Silhouette eines Vogels zu sehen war. Im Haus ihres vorherigen Herrn hatte es nur eine unansehnliche Matrone gegeben, die vor allem durch eines bestach: ihre Hässlichkeit.
»Siehst du die leicht bräunlichen Flecken auf meiner Haut?«
Sofort nickte die Sklavin, sie wusste, dass Frauen diese von der Sonne bekamen und darüber meist betrübt waren.
»Kannst du so etwas verschwinden lassen?«
Das Mädchen schüttelte den Kopf und Valona runzelte unzufrieden die Stirn. »Dann bist du nutzlos für mich.«
Jetzt begriff die Gefangene erst, worum es der Frau ging, und deshalb sprudelten die Worte nun regelrecht aus ihr heraus. Das Gestammel war schwer zu entschlüsseln. »Nicht verschwinden lassen, aber heller machen ...« Dann folgte eine Rezeptur.
Valona verstand das Mädchen zwar schlecht, aber die Worte »zwei Taubenherzen, Honig, Petersilie« und die Namen einiger anderer Kräuter entgingen ihr nicht.
»Scheint so, als würdest du tatsächlich etwas von diesen Dingen wissen.«
Dieses Mal nickte das Mädchen eifrig.
Und sprechen braucht sie nicht, dachte Valona nüchtern, dann kann sie auch keine Geheimnisse ausplaudern.
Außerdem hatte diese Sklavin nach dem, was ihr der Vorbesitzer angetan hatte, sicher kein Interesse an dem anderen Geschlecht. Und mit einem liebreizenden Äußeren war sie ohnehin nicht gesegnet, sodass keine Gefahr bestand, der Hausherr könnte in Versuchung geführt werden.
Aber noch etwas anderes bewog die schöne Valona dazu, diese beiden Sklaven wider jede Vernunft zu erwerben. Es war die eigene unschöne Vergangenheit, die sie einholte und eine Entscheidung treffen ließ, die zum Teil zumindest ihrem Mitgefühl geschuldet war. Sie hätte sich auch einen Bruder gewünscht wie diesen kräftigen Kaledonier. Aber sie hatte dem Schicksal alleine trotzen müssen. Ohne es zu wollen, sah sie in dem Geschwisterpaar mehr Verbündete als Sklaven. Sie schalt sich im Stillen dafür, dass wieder einmal eines dieser närrischen Gefühle in ihr die Oberhand gewann. Für die Zukunft war es nämlich unerlässlich, mit einer gnadenlosen Härte zu agieren, immerhin hing ihr Überleben davon ab.
Trotzdem wandte sich Valona an den Sklavenhändler und sagte scharf: »Ich nehme beide, aber wehe, du machst mir keinen Sonderpreis.«
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752135756
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (Februar)
- Schlagworte
- Nero Rom Pompeji Herculaneum verbotene Liebe Drama Legionär Mutter und Kind Roman Abenteuer Krimi Thriller Spannung Historisch Historischer Liebesroman Liebesroman Historischer Roman