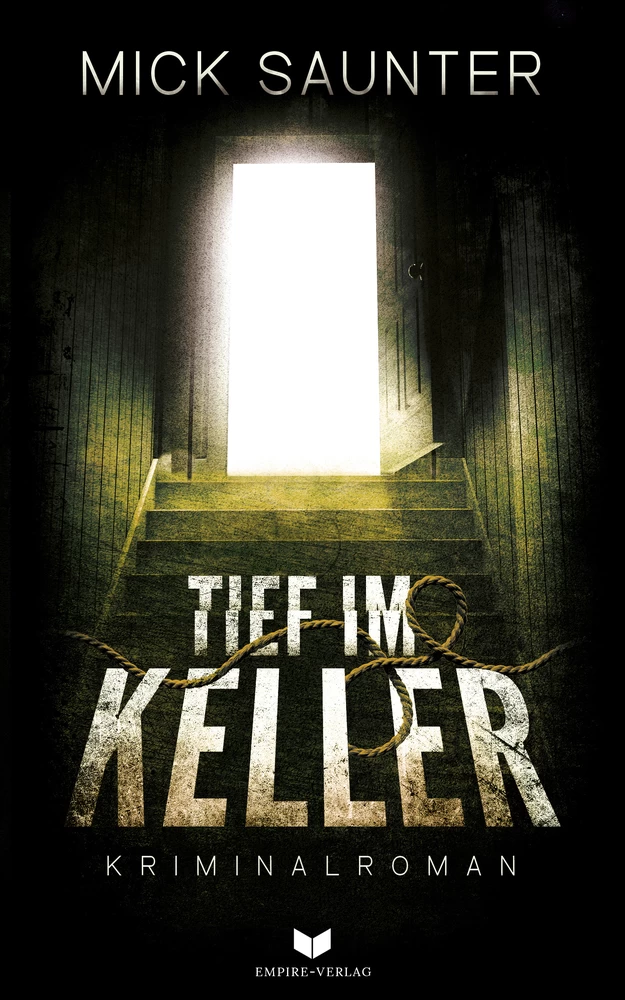Zusammenfassung
„Tief im Keller“ entfaltet sich behutsam, verwirrend; und lässt zu Anfang nicht erkennen, wohin der Protagonist unterwegs ist. Aber von Seite zu Seite und mit jedem neuen Charakter wird klarer, in welche Abgründe der menschlichen Seele die Geschichte führt – um am Ende nicht nur die schreckliche Wahrheit zu erzählen, sondern auch zu zeigen: Kein Keller ist tief genug, eine Schuld zu verstecken, die ans Licht will.
Komplett überarbeitete Neuausgabe von Manner sieht rot.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Tief im Keller

Mick Saunter, 1957 in Wuppertal geboren, flog mit sechzehn vom Gymnasium, wurde Eisenwarenkaufmann, war Funker beim Bund, fuhr Lkw, verkaufte Versicherungen und arbeitete in einer Autowerkstatt. Lernte das Tischler-Handwerk und holte den Schulabschluss nach, gründete eine Familie, studierte Holztechnik, und plante über viele Jahre Läden in ganz Deutschland. In der Lebensmitte lernte er durch Zufall (den es gar nicht gibt: Nichts geschieht zufällig, sondern alles hat immer einen Sinn.) eine Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung kennen. Das veränderte in seinem Leben alles: Er begann mit geistig und psychisch behinderten Menschen zu arbeiten, leitete die Arbeitstherapie in einer Suchthilfeklinik und lebte als Heimleiter gemeinsam mit Menschen, die ständige Betreuung brauchen. Lernte, wie unendlich wichtig es ist, das Leben mit dem zu verbringen, was man wirklich will – und fing mit fast sechzig an zu schreiben.
Konstantin Manner
Major der Salzburger Kriminalpolizei. Träumt merkwürdiges Zeugs, isst zu viel, und: muss sich entscheiden
Christian Möckel
Oberleutnant im LKA Salzburg, immer auf der Suche
Dr. Eva Mummenbrauer
Kriminalanwärterin – hat den Durchblick, ist neu und neugierig
Mag. Brammen
Manners Chef. Kann super Sarkasmus, und überrascht immer wieder
Sabine Schmitz
Kommt aus Köln, macht guten Kaffee, und sucht einen richtigen Mann
Tina
Ist eine richtige Schnitte
Mona Martínez
Gibt sich ganz hin
Fernando Klein
Nimmt, was er kriegen kann
Sebastian
Hat einfach Pech gehabt
Paul
Wird rücksichtslos ausgenommen
Dennis
Zum Glück ist er am liebsten in der Gärtnerei
Susi Kju
Weiß sich zu wehren; aber nicht immer
Maximilian
Kommt aus der Vergangenheit zurück
Hans aus der Trafik
Manners Kumpel. Überhaupt kein Fußballfan, hat aber pipifeine Beziehungen
Das Monster
Ist eigentlich ein ganz Netter
Der Tiroler
Tut nett – ist’s aber nicht
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind rein zufällig und keinesfalls beabsichtigt.
Prolog
Kapitel eins
Das unbekannte Land
Samstag, 11. Dezember
Das Meer, auf dem er in einem kleinen, weiß und blau gestrichenen Ruderboot unterwegs war, schimmerte in einem tiefen Türkisblau.
Das Boot war kaum länger als er selbst und eigentlich viel zu klein für ihn: Es bot gerade so viel Platz, dass er einigermaßen bequem aufrecht sitzen konnte. Die See war etwas kabbelig, kleine Wellen kreuzten sich, und das Licht der fast den Horizont berührenden Sonne brach sich in ihren Spitzen. Die Lichtreflexe stachen und kitzelten seine Augen, riefen in ihm ein altes Gefühl von Sommer und Freiheit hervor.
Gut fühlte er sich, ausgesprochen gut sogar. Völlig entspannt und gelassen ruderte er langsam Richtung Ufer, wo ein reges Strandleben herrschte: Er sah Menschen jederlei Alters in leichter, heller Sommerkleidung am Strand sitzen oder am Meeressaum flanieren, spielende Kinder liefen durcheinander, man hörte Lachen, Gesang und Musik. Neben einer Strandbude flatterte an einem Fahnenmast die weiß-blaue Nationalflagge, an den Ästen der hinter dem Strand stehenden Kiefern hingen überall kleine Lichterketten: Sie setzten farbige Lichtpunkte, die aus der Entfernung wie hunderte Glühwürmchen wirkten und der warmen, beginnenden Mittsommernacht eine besondere Stimmung gaben. Alles war voller fröhlicher Aktivität und Leichtigkeit, und die Erwartung von etwas Besonderem lag in der Luft.
Die Leute unterhielten sich in einer Sprache, deren Klang ihm vertraut schien, die er aber nicht verstand. Trotzdem freute er sich darauf, gleich bei ihnen zu sein: Noch ein, zwei Minuten, dachte er, dann würde er den Strand erreichen.
Plötzlich, ohne dass er eine Veränderung wahrgenommen hatte, verdunkelte sich der Himmel: Große, tiefgraue Wolken waren aufgezogen, türmten sich schnell höher und höher. Ein starker, böiger Wind kam auf, packte das Boot von vorne, drehte es herum, und trieb es vom Ufer weg. Er ruderte gegen, um es wieder in die richtige Richtung zu bringen; aber der Wind war stärker und schob es immer wieder aufs offene Meer. Schnell wurde ein Sturm daraus, der das Wasser zu hohen Wellen zusammenschob und vor sich hertrieb. Der schlagartig einsetzende starke Seegang schüttelte ihn in seiner Nussschale heftig auf und ab.
Heiße Angst überlief ihn, dass er die anderen nicht mehr erreichen würde. Seine Ruderschläge wurden hektisch, fahrig – immer öfter verfehlten sie das Wasser, die Ruderblätter peitschten mehr über als durch das Meer.
Gischt sprühte über die Bordwand, in seine Augen. Wellen schlugen ins Boot, schnell begann es sich zu füllen. Ich muss schöpfen, dachte er panisch, und um die Hände dafür frei zu haben, ließ er die Ruder los; da rutschten sie aus den Dollen und glitten ins Meer. Ehe er nach ihnen greifen konnte, trieben sie in großer Geschwindigkeit vom Boot weg: So, als ob sie, wie von einer unsichtbaren Kraft gezogen, immer schneller würden.
Verzweifelt sah er ihnen hinterher.
Die Sonne war jetzt ganz hinter den Wolken verschwunden, die über den Himmel rasten. Das vorher tiefblaue Wasser hatte nun eine dunkle, flaschengrüne Farbe angenommen, die Wellenberge wurden immer höher, mächtiger und die Täler zwischen ihnen immer tiefer und weiter.
Mit hoher Geschwindigkeit schoss das Boot hinunter in ein gewaltiges Wellental; aber so sehr ihn die Situation auch beängstigte, so wild, ungezähmt und schön war es auch, durch das brodelnde Wasser bergab zu schießen. Blitzartig kamen ihm Bilder in den Sinn, wie er als Kind im Winter auf seinem Schlitten den Rodelhügel am Untersberg hinuntergerast war; und das aufregende Gefühl von Abenteuer und Freiheit durchfuhr für einen Moment seinen Körper.
Unwillkürlich jauchzte er vor Begeisterung über die wilde Fahrt laut auf, mit weit aufgerissenen Augen und wehenden Haaren sauste er hinab ins Wellental, tauchte tief ein – dann wurde er wieder hoch hinauf auf den nächsten Wellenberg gehoben. Das winzige Boot schoss empor, durch die weiß schäumende Gischt der brechenden Krone hindurch, und flog einen Moment, der sich wie in Zeitlupe dehnte und dehnte, über dem Wasser durch die Luft. Er klammerte sich an den Bordwänden fest, um nicht hinausgeschleudert zu werden; aber er spürte keine Angst – das Gefühl des Fliegens schien ihm so vertraut, als ob es schon immer ein ganz normaler Teil seines Lebens gewesen wäre.
Das Ufer war noch ganz nah: Während er flog, sah er hinüber zu den bunten Holzhäusern, den Lichtern, dem Wald hinter dem Strand; sogar die Menschen sah er. Scheinbar hatten sie von seiner gefährlichen Situation und dem Sturm nichts mitbekommen und feierten weiter fröhlich die sommerliche Nacht.
Etwas zog seinen Blick magisch an, er wusste nicht warum: Unter den vielen Menschen fiel ihm eine Gestalt besonders auf. Sie war klein, stand ganz still und schien ihn direkt anzusehen. Das salzige Wasser brannte in seinen Augen, er konnte nicht erkennen, ob es eine Frau, ein Mann oder ein Kind war: Er sah das Gesicht nur verschwommen – so, als sähe man durch ein beschlagenes Glas. Aber sie sah ihn an, das spürte er deutlich.
Er war gemeint.
Auf einmal verschob sich die Perspektive, alles wurde seltsam verzogen und in sich gedehnt. Wie in einem surrealen Bild von Dalí veränderten sich die Dinge, verloren ihre festen Konturen, wurden weich, flüssig, schienen sich zu vermischen und flossen nach hinten von ihm weg – immer schneller werdend, auf einen imaginären Punkt zu. Dann entfernte sich auch das Ufer in rasender Geschwindigkeit, wie in einem rückwärts und zu schnell ablaufendem Film.
Abrupt fiel das Boot hinunter in das tobende Meer. Eine riesige, turmhohe Welle stürzte über ihm zusammen, die gewaltigen Wassermassen wirbelten ihn umher, zogen, drückten, rissen ihn in die Tiefe. Verzweifelt versuchte er mit fahrigen, hektischen Schwimmbewegungen, zurück an die Oberfläche, an die rettende, lebensspendende Luft zu kommen. Wie wild ruderte er mit Armen und Beinen – aber es war, als ob etwas an ihm zog: Gerade so, als ob ihn ein Wirbel aus der dunklen, bodenlosen Tiefe ansog, ihn verschluckte.
Weiter und weiter hinab sank er, um ihn herum wurde es dunkler, bedrohlicher. Er spürte, dass der Druck auf seine Brust zunahm, sie zusammenpresste. Er verschluckte sich, als salziges Wasser in seine Lunge geriet; und als er würgend versuchte, es auszuhusten, sah er, dass Blut aus seinem Mund strömte.
Meine Lunge ist zerrissen, dachte er erschrocken, blieb dabei aber eigentümlicherweise ganz ruhig; so, als hätte er es irgendwie schon erwartet.
Während er weiter in die Endlosigkeit sank, wurde im immer schwächer werdenden Licht aus dem Rot seines Blutes ein tiefes Schwarz, das ihn mehr und mehr einhüllte. Seine Bewegungen wurden langsamer, sein Herz hämmerte wie rasend in seiner Brust, und als ein unglaubliches Rauschen seinen Kopf erfüllte, wurde ihm schlagartig klar, dass er ertrank.
Eine seltsame Ruhe überkam ihn.
Das Klopfen in seiner Brust ließ nach, wurde weniger, ruhiger. Er schaute noch einmal nach oben, zum Licht: Da war ihm, als ob er wieder diese Gestalt sähe – die, die er vorhin nicht erkennen konnte; und die jetzt durch die aufgepeitschte Wasseroberfläche zu ihm herunter winkte.
Sein schon fast erloschener Lebenswille entflammte neu, mit aller Kraft kämpfte er vehement gegen den Sog aus der Tiefe – da wachte er auf.
Die Bettdecke hatte sich um seinen Kopf gewickelt, und er war kurz davor zu ersticken – zumindest fühlte es sich genauso an. In wilder Panik wühlte er sich heraus, setzte sich ruckartig auf, und rang nach Luft. Völlig verwirrt sah er sich um: Er saß in seinem Bett, das fest und sicher in seinem Schlafzimmer stand. Kein winziges Boot, kein Sturm, kein Meer.
Erleichtert sank er zurück in sein Kissen: Gott sei Dank – er hatte nur geträumt!
Als er sich nach ein paar Minuten beruhigt hatte, schüttelte er den Kopf. Wieso träumte er so was? Soweit er sich erinnerte, war er noch nie Rudern; und was war das für ein Begriff, als er die Riemen verlor – Dollen? Woher wusste er, was Dollen sind? Nachdenklich rieb er sich über die Stirn. Die Narbe, die er sich irgendwann in der Kindheit zugezogen hatte, juckte.
Wo war das überhaupt gewesen, und in welcher Sprache hatten die Menschen am Strand gesprochen? War das Finnisch? Und dann das Blut im Wasser, als er träumte zu ersticken. Das Meer, das sich erst rot und dann schwarz färbte. Völlig verrückt!
Er dachte an das Gefühl des Fliegens im Traum und dass er sich dabei seltsamerweise an seinen alten Schlitten erinnerte. Er hatte es so geliebt, mit ihm die Hügel hinaufzusteigen und dann in rasender Fahrt hinunterzufahren; früher als junger Bub. So lange hatte er schon nicht mehr an ihn gedacht. Ob er wohl noch immer bei seinen Eltern im Keller an der Wand hing?
Langsam setzte er sich wieder auf, drehte den Kopf hin und her, auf und ab; verschränkte die Finger ineinander, und dehnte sie genüsslich mit ausgestreckten Armen.
In seiner Lunge brannte es, er musste heftig husten: Schleim löste sich, kam die Luftröhre hoch und füllte seinen Mund. Hastig griff er nach einem Papiertaschentuch, spie hinein. Mit einem unguten Gefühl faltete er es auseinander: Aber es war nur klarer, zäher Schleim. Kein Blut darin.
Für einen kurzen, beängstigenden Moment hatte er gedacht, dass vielleicht doch …
Entschlossen schüttelte er den Gedanken ab.
So ein verdammter Scheiß-Traum!
Er schaute auf sein Smartphone, das auf dem Stuhl neben seinem Bett lag, der ihm als Nachttisch diente: Es war kurz nach acht. Genau die richtige Zeit zum Aufstehen, dachte er. Ausgiebig duschen, reichlich Kaffee – und dann diesen besonderen Tag genießen!
Mit einem energischen Ruck schlug Manner die Decke beiseite und stand auf.
Für die zweite Dezemberwoche war es schon ziemlich kalt geworden im Salzburger Land: Auch tagsüber hatten die Temperaturen fast durchgängig die Frostgrenze von null Grad nur geringfügig überschritten. Drei Tage hatte es immer wieder geschneit, und eine üppige, durchgehende Schneeschicht bedeckte bald das Land. Danach stellte sich eine Hochdrucklage ein, mit strahlenden Sonnentagen und klaren, eiskalten Nächten. Durch den ausgiebigen Sonnenschein am Tag waren die obersten Schichten leicht angetaut, und in den frostigen Nächten wieder gefroren. Große Eiskristalle waren auf dem Schnee entstanden, die nun im Schein der an einem blitzblauen Winterhimmel strahlenden Sonne wie Abermillionen Diamanten das Licht reflektieren. Sie erschufen ein märchenhaftes Zauberreich, und für romantische Naturen war es gerade so, als seien Sterne vom Himmel gefallen.
So war es auch heute Morgen am Untersberg, dem von Sagen und Mythen umwobenen Berg zwischen Berchtesgadener Land und Salzburg; genau das richtige Wetter für eine Winterwanderung.
Es war kurz nach 10 Uhr, als sich in der Nähe vom Parkplatz beim Fuchsbach an der B 20 zwischen Bayerisch-Gmain und Bischofswiesen eine kleine Gruppe von Menschen um einen etwa 50-jährigen, kleinen, stämmigen Mann in Lederhose, grüner Bergjacke und dicken Wanderschuhen versammelte. Unter seiner dunkelroten Strickmütze schaute am Hinterkopf ein langer, weißer Zopf hervor, und am linken Ohr trug er einen Ohrring mit einem schmalen, hauchdünnen Holztäfelchen, darauf ein chinesisches Schriftzeichen.
Er hatte sich auf einen niedrigen Baumstumpf gestellt, seine Hände in einer umfassenden Willkommensgeste ausgebreitet und lächelte die Teilnehmer fröhlich an.
Er nannte sich Qi, was wie „Tschi“ ausgesprochen wurde, vom chinesischen Wort für Energie und Atem. Seit vielen Jahren war das Leben im Wald und am Berg, besonders am Untersberg, zu seinem Lebensinhalt geworden; und nach und nach war es ihm gelungen, daraus eine Existenz aufzubauen. So veranstaltete er unter anderem geführte Wanderungen an wenig bekannte Plätze und Energieorte, wo es etwas anderes zu erleben gab, als es die gängige Wissenschaft lehrte. Ein esoterischer Spinner, ein „Schmarrenbeni“ eben, für die einen – aber nicht für die, die sich heute hier zusammengefunden hatten.
„So, hallo, griaß eichmiteinand. Sche, dass ihr kemma seids!“ Die leisen Gespräche unter den Wartenden verstummten. „Wir woll’n heut ein bisserl was vom Untersberg erfahren. Ihr wisst ja schon, dass dies hier ein ganz besonderer Ort ist, zu dem wir nun wandern wollen: ein Kraftort. Das Herzchakra Europas, wie der Dalai Lama sagt. Ich hab euch bei unserem ersten Treffen schon davon erzählt, und ihr habts ja schon viel dazu gelesen – jetzt wollen wir’s mal in der Natur direkt erleben, ob da was dran ist. Ich kann euch sagen: Wenn ihr euer Herz öffnet, wirklich öffnet, für neue Erfahrungen; wenn ihr euch frei macht von Überkommenem, frei von übernommenen Vorurteilen – dann werdets vielleicht etwas erleben, was ihr so nur hier, nur an dieser Stelle, auf unserem Planeten finden könnt.“
Er machte eine kleine Pause und senkte seine Hände, die seine Ansprache lebhaft begleitet hatten. Er schaute seine Zuhörer der Reihe nach an, bei jedem Einzelnen von ihnen ein paar Sekunden intensiv in seinem Blick verweilend. Sein Publikum bestand aus sieben Frauen und zwei Männern, und bis auf zwei Frauen von schätzungsweise Mitte zwanzig, die offenbar zusammengehörten, waren alle im mittleren bis leicht vorgerückten Alter. Sie hatten dem Redner aufmerksam zugehört, und auf ihren Gesichtern war durchweg so etwas wie gespannte Erwartung zu sehen.
„Also, wir werden sehen, was heut so passiert, was wir erleben werden; vielleicht treffen wir ja auf ein paar Untersbergmandl oder finden die eiserne Pforte am Hallthurm. Habts ihr alle was zu trinken und zu essen dabei? Seids warm genug angezogen? Seids alle fröhlichen Herzens? Fein. Dann: auf geht’s! Ich geh voraus: Zunächst laufen wir ein Stückerl den Waldweg hinauf, Richtung Bruchshäusl. Von da aus gehen wir zum Vierkaser, und dann schau’n wir mal weiter. Und bittschön, seids stad, soweit ihr’s könnt – umso mehr werdets erleben!“
„Wat soll‘n wir sein?“
Der Fragende war ein großer, sportlicher und breitschultriger, dunkelblonder Mann mit norddeutsch klingendem Dialekt und einem fröhlichen Blick aus strahlendblauen Augen, der offensichtlich mit den hier gebräuchlichen Ausdrücken noch nicht so ganz vertraut war.
Qi lächelte, als sich ein paar der Frauen nach dem Mann umdrehten und ihn interessiert genauer musterten.
„Ruhig, still sollst sein. Stad heißt ruhig – hast noch nie von der ‚staden Zeit’ gehört?“
„Ah!“ Der fragende Ausdruck im Gesicht verschwand.
„Jo, kloar! Hab ich nur noch nie drüber nachgedacht. So wat aber auch!“ Ein entwaffnendes Lächeln strahlte über sein Gesicht, und ein paar der Frauen merkten sich insgeheim vor, an welcher Position sie in der Gruppe auf der Wanderung gehen wollten.
„Gut. Dann also aufi!“
Qi drehte sich um und schlug einen Weg in den verschneiten Wald hinein ein. Die Gruppe schloss sich ihm an, einige redeten noch eine Weile mit gesenkter Stimme miteinander. Es gab noch ein paar kleine, fast unmerkliche Rangeleien unter den Damen bis klar war, wer den Platz neben dem Blonden ergatterte, nach und nach trat Ruhe ein. Bald hörte man nur noch die Schritte im Schnee.
Nachdem sie etwa eine dreiviertel Stunde bergauf gestapft waren, erklang plötzlich die Stimme einer der jungen Frauen.
„Ich weiß, das ist jetzt ziemlich blöd – aber ich muss mal pieseln! Mein Kaffee von vorhin drückt, ich hätt’ wohl doch besser nur eine Tasse trinken sollen.“ Etwas verlegen schaute sie in die Gesichter der Gruppe.
„Hey – wennst halt musst, dann is des so.“
„Jau“, hörte man die Stimme vom Mann aus dem Norden, „watmutt, dat mutt!“ Er grinste übers ganze Gesicht.
Sie verschwand im Gebüsch.
„Pass auf die Waldgeister auf!“, rief ihre Freundin feixend hinterher.
„Können wir eine rauchen?“, fragte eine Frau mit rot gefärbten, wilden Locken.
„Klar, warum nicht. Aber nehmt bitte eure Tschick mit – wir lassen nichts im Wald zurück!“, sagte Qi mit Nachdruck.
„Außer Pipi“, warf jemand ein, und alles lachte schallend.
Sie wollte nicht direkt am Weg pinkeln, wo sie jeder hören konnte; war ein Stück ins Unterholz gegangen, um eine günstige Stelle zu finden, als sich plötzlich vor ihr der Wald öffnete, und sie auf eine sonnendurchflutete Lichtung trat. Ungläubig sah sie sich um: Es war einfach nur märchenhaft und wie verzaubert, überall glitzerte und strahlte es um die Wette. Die Zweige der umstehenden Bäume waren weiß überzogen, auf den Ästen der Tannen lag reichlich Schnee, und auf ein paar verstreut liegenden Felsen lagen weiße, dicke Schneemützen, sodass manche aussahen, als seien sie geduckt hockende, dicke Zwerge. An einem bildete ein Vorsprung eine regelrechte Nase und ein Eiszapfen hing daran.
„Nein, also wirklich!“, sagte sie zu sich und vergaß völlig, warum sie eigentlich hierhergekommen war. „So eine Winterpracht! Wenn es doch bis Weihnacht so bliebe.“
Entfernt hörte sie das undeutliche Gemurmel und Gelächter der Gruppe, und jetzt fiel ihr wieder der Grund ein, weshalb sie hier war. Rasch lief sie zum nächsten Felsen, schaute sicherheitshalber noch mal, ob auch wirklich niemand da sei. Dann zog sie ihre Hose runter, hockte sich hin und ließ der Natur ihren Lauf.
„Nnnh …“, entfuhr ihr ein Seufzer der Erleichterung. Dann richtete sie sich wieder auf, zog die Hose hoch, richtete ihren Pullover und zog den Reißverschluss ihrer Jacke zu. Dabei schaute sie sich noch einmal um: Es sah wirklich alles so unglaublich zauberhaft aus, dass es kaum zu fassen war. Qi hatte recht gehabt, hier war es wirklich ganz besonders.
Gerade wollte sie sich umdrehen, um zurück zu den anderen zu gehen, da segelte ein großer Rabe an ihr vorbei, und landete hinter einem besonders mächtigen, dunklen Felsbrocken, der ein paar Meter von ihr entfernt auf der Lichtung am Waldrand lag. Sie hörte ein Krächzen und das Flattern von Flügelschlagen – es klang kurz so, als ob da noch weitere Vögel wären, die miteinander stritten.
Vorsichtig ging sie ihm nach, versuchte, so wenige Geräusche wie nur möglich zu machen, was im tiefen, verharschten Schnee gar nicht so einfach war. Doch die Raben waren offenbar so beschäftigt, dass sie nicht darauf reagierten. Als sie den Felsen erreichte, hörte sie ein leises, merkwürdiges Geräusch – so, als ob etwas Weiches zerriss. Vorsichtig streckte sie ihren Kopf vor, um an dem Stein vorbeizuschauen: Ja, da waren tatsächlich noch mehr der großen Vögel, vielleicht fünf oder sechs, und flatterten um etwas am Boden Liegendes herum. Pickten darauf ein, zogen und zerrten mit ihren Schnäbeln an etwas. Wieder diese leisen, reißenden Geräusche.
Ohne weiter zu überlegen, trat sie vor: Die Raben krächzten wütend, hüpften und flatterten umher, flogen auf, Richtung Wald. Neugierig trat sie näher: Der Schnee vor ihr war auf einer Fläche von vielleicht einem knappen Quadratmeter rot gefärbt. Sicher ein verendetes Tier, ging es ihr durch den Kopf, als sie sich bückte – und prallte erschrocken zurück: Unter dem Schnee erkannte sie die Konturen eines menschlichen Körpers. Die Raben hatten den Schnee vom Kopf gekratzt und daran herumgehackt. Ein grausam zerstörtes, augenloses Gesicht starrte sie an. Aus den Augenhöhlen, der Nase, dem Mund lief Blut, und im Schnee lagen Hautfetzen.
Entsetzt schlug sie eine Hand vor den Mund, stolperte rückwärts, fiel der Länge nach hin. Hastig rappelte sie sich wieder hoch und rannte, so schnell sie konnte zurück, ihren Fußspuren nach; erreichte den Waldrand, und hörte schon die Stimmen der anderen.
„He! Hallo! Hier! Ich hab was gefunden!“, rief sie atemlos, noch bevor sie den Weg erreicht hatte.
„Ah, da ist ja unsere Quellnymphe wieder!“, rief die rothaarige Frau, lachte und verschluckte sich dabei am Rauch ihrer Zigarette. Hustend warf sie den Glimmstängel auf den Boden, besann sich aber eines Besseren; drückte die Glut im Schnee aus und steckte ihn dann in ihre Jackentasche.
„Na“, empfing sie ihre Freundin, „biste erleichtert?“
„Da hinten liegt einer!“ Sie zitterte am ganzen Körper, und Tränen schossen ihr in die Augen.
Qi drückte sich durch die Wartenden.
„Wo liegt einer?“, fragte er.
„Dahinten – bei den Felsen!“ Ihre Augen waren weit aufgerissen, und er sah den Schrecken darin, den sie erlebt haben musste
„Bist sicher?“
„Ja, verdammt! Alles ist voller Blut, und …“, sie verstummte, vom Grauen geschüttelt. „Sie haben daran gefressen!“
„Wer hat daran gefressen?“
Sie war völlig aufgelöst, blass, zitterte, und das Entsetzen stand ihr ins Gesicht geschrieben.
„Die Raben! Die Raben haben am Gesicht gefressen!“
Alle starrten sie entgeistert an.
„Was hast du denn da am Handschuh?“
„Was? Wo?“
Sie hob ihre Hände, drehte sie hin und her – und tatsächlich, an der Unterseite der linken Hand, da, wo sie sich im Fallen abgestützt hatte, klebte etwas Rotes mit etwas Grauweißem darin. Entsetzt schüttelte sie ihre Hand, um den Handschuh loszuwerden, kreischte verzweifelt, zappelte panisch herum – bis er im hohen Bogen davonflog. Ihre Freundin nahm sie in den Arm, versuchte, sie zu beruhigen.
„Okay.“ Qi richtete sich mit einem angespannten Gesichtsausdruck auf. „Wir gehen mal nachschauen. Magst mir zeigen, wo das war?“
Sie schüttelte heftig den Kopf.
„Du brauchst ja nur meinen Spuren im Schnee zu folgen. Bitte – ich will da nicht wieder hin!“ Die Angst stand ihr im Gesicht. Das Nordlicht schob sich neben ihn.
„Komm, ich geh mit – vielleicht ist es ja was ganz anderes!“
„Gut. Ihr anderen wartet hier bitte; und kümmerts euch ein bisserl um sie!“
Als sie den Felsen erreichten, erkannte Qi sofort, dass dort tatsächlich etwas lag, das hier nicht sein sollte: Es war wirklich ein Mensch, bis auf den Kopf völlig von Schnee bedeckt; und darum herum waren die Spuren der Vögel zu erkennen, die dort herumgehüpft waren. Der Schnee war rot vom Blut, und das, was einmal ein menschliches Gesicht gewesen war, war völlig verwüstet, kaum noch als ein solches zu erkennen. Er war sich noch nicht einmal sicher, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Während seiner Zeit beim Roten Kreuz hatte er immer wieder mit schrecklich zugerichteten Unfallopfern zu tun gehabt. Aber das hier, mitten in der stillen, friedlichen Natur einen Leichnam zu finden, der wie ein verendetes Wildtier angefressen wurde, war dann noch einmal etwas anderes.
Er sah den erschrockenen Gesichtsausdruck des Blonden. Um seinen Mund zuckte es, er war leichenfahl. „Mann. So eine Scheiße.“
„Ja.“
„Jetzt wissen wir es. Wir müssen die Polizei rufen. Hast du ein Handy dabei? Machst du das?“
Das Nordlicht starrte ihn noch einen Augenblick entsetzt an, riss sich dann aber zusammen.
„Okay.“ Er knöpfte die Brusttasche seiner Jacke auf, holte ein Smartphone heraus und schaute auf das Display. „Ich bin im österreichischen Netz!“
„Ja, logo, wir sind ja hier auch schon die ganze Zeit in Österreich; die Grenze verläuft hier direkt am Bach, unten an der Straße.“ Er überlegte.
„Wie machen wir’s denn jetzt? Deutsche oder österreichische Bullerei?“
„Ist das denn wichtig?“, fragte Nordlicht, „die werden uns schon sagen, wat Ambach is!“
Qi schaute auf.
„Was was ist?“
„Wat Ambach is! Ach so – was zu tun ist. Nur so’n Ausdruck.“
„Also gut – rufst halt 112 an, wer’nmerscho seng, wo mer landen.“
Nordlicht drückte die Tasten, hielt sich das Gerät ans Ohr. Als sich jemand meldete, hielt er das Mikrofon kurz zu und flüsterte „Die Ösis!“. Dann meldete er sich, schilderte, was geschehen war.
„Wo wir sind, wollen sie wissen“, fragte er. Qi stand auf, nahm das Handy an sich. Er schilderte genau, wo sie waren, hörte aufmerksam zu.
„Okay, machen wir. Und danke! Servus!“ Dann gab er das Handy zurück.
„Tja“, sagte er, „wir sollen hier warten. Also am Weg. Und so wenig wie irgend möglich durcheinanderbringen. Am besten in den eigenen Fußspuren zurück!“
Die Gruppe wartete schon, die Menschen scharten sich aufgeregt um die beiden. Als sie erfuhren, dass dort tatsächlich eine Leiche im Schnee lag, verstummten alle. Die junge Frau, die den Fund gemacht hatte, begann wieder leise zu schluchzen; ihre Freundin nahm sie in den Arm, sprach tröstend auf sie ein.
„Also, wir müssen hier auf die Polizei warten; ich denk sie brauchen ungefähr eine Viertelstunde bis zum Parkplatz, dann noch eine halbe Stunde hier rauf. Ich bitt’ euch, versucht euch irgendwie abzulenken und warm zu halten. Aber schaut, dass ihr keine möglichen Spuren zertrampelt oder so, sie haben uns extra darauf hingewiesen. Und: Ihr könnt euch ja denken, dass mir das alles sehr leidtut – eigentlich wollten wir ja auf eine andere Art und Weise etwas Außergewöhnliches erleben!“
Alle nickten zustimmend und versuchten, irgendwo ein Plätzchen zum Hinsetzen zu finden.
Die Frau mit den wilden roten Locken zog ihre Zigarettenschachtel hervor und schaute kurz auf die fettgedruckte, drohende Aufschrift: „Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu“.
„Ha!“, dachte sie, „am Ende stellt sich noch heraus, dass der im Wald am Rauchen gestorben ist!“.
Sie zog ihr Feuerzeug raus, nahm eine Zigarette aus der Packung und zündete sie sich mit einem grimmigen Gesichtsausdruck an.
Es war bereits nach 13 Uhr, als Manner, zurückgekehrt von seinem morgendlichen Einkauf, es sich mit der Samstagsausgabe der Salzburger Nachrichten an seinem Küchentisch gemütlich machte. Vor sich hatte er eine Tasse Sencha-Grüntee: Den schickte ihm immer wieder einmal eine japanische Freundin aus Freiburg, und sie bekam ihn ihrerseits von ihrer Mutter, direkt aus Japan. Die war nämlich der Meinung, dass es in ganz Deutschland – eigentlich in ganz Europa – keinen guten Grüntee gäbe. Und wirklich: Wenn er ihn so zubereitete, wie Sonoko es ihm damals beigebracht hatte, – dann war es ein unvergleichlicher Hochgenuss. Im Büro reichte es immer nur für einen Verlängerten aus dem Automaten: einen „Dreckigen“, wie er ihn nannte, und seiner Meinung nach der schlechteste Kaffee von ganz Salzburg; oder für irgendeinen Teebeutel im heißen Wasser. Aber, wenn er frei hatte: Dann hatte er es sich angewöhnt, sich für das, was ihm wichtig war, wirklich Zeit zu nehmen.
Das hatte er in seinem Leben erstmals in der Reha gelernt, nach seinem Zusammenbruch: wie wichtig es ist, sich für etwas Zeit zu nehmen, das einem guttut. Auf sich selbst aufmerksam zu sein und die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen – ohne immer gleich ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Er durfte das!
So war auch sein Plan für den heutigen Abend ein Teil der neuen Erfahrung, sich selbst etwas zu gönnen – und nichts und niemand würde ihn davon abhalten: Im Fernsehen würde das Spiel Manchester United gegen Schalke 04 in der Champions League übertragen. Darauf freute er sich schon die ganze Woche! Er war sich sicher, dass ManU die Schalker im Stadion von Old Trafford aber so etwas von demontieren würden, dass die Blau-Weißen sich vor lauter Wut und Enttäuschung über ihr Versagen gegenseitig ihre Trikots von den verschwitzten Leibern reißen und noch im Stadion vor johlenden englischen und wehklagenden deutschen Fans verbrennen würden. Er grinste. Das wär’s doch mal!
Um nur ja nichts davon zu verpassen, hatte er sich extra dieses Wochenende frei genommen, die Kollegen würden mit dem vorweihnachtlichen Kram schon klarkommen. Es würde schon nicht ausgerechnet heut’ jemand umgebracht oder eine Bank ausgeraubt werden. War abends früh genug ins Bett, um wirklich ausgeschlafen zu sein – und dann dieser Traum!
Nach dem Aufstehen hatte er sich mit zwei Bechern starken Milchkaffees von dem immer noch nachklingenden und äußerst unangenehmen Gefühl des Erstickens erholt, frühstückte eine vom gestrigen Abendbrot übriggebliebene labbrige Scheibe Toast mit Bergkäse, der von den darauf liegenden Gurkenscheiben regelrecht aufgeweicht war und kümmerte sich kurz um das Allernotwendigste in seiner Wohnung.
Dann war er in aller Ruhe losgezogen, um sich die Grundversorgung für den Abend vorm Fernseher zu besorgen: Beim Metzger hatte er zwei Paar Würstel gekauft, beim Bäcker eine Tüte voll frischer Semmeln, dazu noch im Supermarkt ein Sechser-Tragerl TrumerPils und ein paar Knabbereien geholt. Anschließend war er noch in seine Lieblingstrafik gegangen, hatte sich die Zeitung gekauft und mit Hans, dem fast zwei Meter großen Besitzer und alten Motorradkumpel, einen kleinen Plausch über die chaotischen Straßenzustände in der Stadt gehalten. Über das Spiel heute Abend verlor er kein Wort, denn vom Fußball verstand Hans – schon weit in den Sechzigern, mit einem scheinbar ohne Hals übergangslos auf dem riesigen Körper aufsitzendem Kopf, auf dessen spiegelblank polierter Glatze das Licht der Ladenbeleuchtung glänzende Effekte hervorrief; und mit einer Geduld gesegnet, die ebenso umfangreich war wie sein gewaltiger Bauch, der in den wohl größten Hawaiihemden steckte, die Manner jemals gesehen hatte – leider nichts.
Ging es um Motorräder: Jederzeit, darüber konnten Manner und er nach wie vor stundenlang fachkundig ratschen und philosophieren. Jedoch über Fußball – nix.
Aber als guter Kaufmann hatte Hans es sich angewöhnt, mit seinen fußballnarrischen Kunden so zu tun, als würde er verstehen, worum es ging: Nur wenige wussten von dieser kleinen Schwäche, und Manner war einer davon. Er genoss es, zuzuhören – und vor allem zuzuschauen – wenn wieder einmal so ein Mensch, der sich für einen ausgesprochenen Fußball-Fachmann hielt, den armen Hans mit irgendwelchen Details über diesen und jenen unglaublichen Fehler vom Spieler XY und von einem Volldepp von Schiedsrichter namens Oarschloch vollquatschte. Der sich dann seinerseits mit seiner ganzen Körpermasse auf einem seiner muskulösen und überaus farben- und abwechslungsreich tätowierten Arme ganz interessiert an seine Theke lehnte, sich mit zusammengekniffenen Augenbrauen und halboffenem Mund mit Äußerungen wie „Ah!“, „So?“ und „Na, ned wirklich!“ am Gespräch beteiligte – bis der Kunde dann nach einer Weile zufrieden mit seinem Einkauf abzog. Hin und wieder konnte man in dem Gesicht des einen oder anderen so etwas wie einen fragenden, stutzenden Ausdruck erkennen, wenn Hans an der falschen Stelle eine unpassende Äußerung eingeworfen hatte. Aber meist machte er seine Sache ganz gut. Es war wirklich sehenswert und eigentlich eine durchaus honorable komödiantische Leistung, wie Manner fand.
Hans und er kannten sich schon eine Ewigkeit, waren vor langer Zeit beide Mitglieder in einem Salzburger MC, einem Motorradclub, gewesen – in der Zeit bevor er sich zu einer Polizeilaufbahn entschloss. Damals waren sie Motorrad-Brüder, und auch danach über die Zeit weiterhin gute Freunde geblieben. Aber während Hans immer noch Biker war und mit seiner alten Harley-Davidson Shovelhead namens „Putzi“ – so benannt nach einer seiner Lieblingstanten – nach wie vor Touren unternahm, stand Manners „Eisenschwein“ genannte Yamaha seit vielen Jahren eingemottet in der Garage.
In Hans‘ Trafik hatte er auch schon das eine oder andere Mal etwas erstanden, was normalerweise nicht zum Standardsortiment gehörte:Hans hatte immer noch gute Kontakte zu den Leuten von damals, die auch „ungewöhnliche“ Dinge technischer Art beschaffen konnten; was die nicht immer einfache Arbeit als Polizist im LKA erleichtern konnte. Inoffiziell natürlich.
Es war auch schon vorgekommen, dass er sich ein paar von Hans‘ selbstgebackenen Kräuterkeksen mit nach Hause nahm, die der für gute Freunde unter der Ladentheke parat hielt: Sie waren gut, wenn sich die depressiven Gedanken in ihm breitmachten. In der Vergangenheit speziell an einsamen Wochenenden, an denen er nichts Rechtes mit sich anzufangen wusste; und an denen der schwarze Schatten nur auf eine Schwäche von ihm wartete, um aus seinem Abgrund emporzukriechen, und seine gierigen Finger nach ihm auszustrecken. Aber das war zum Glück Geschichte.
Heute gönnte er sich zur Feier des Fußball-Tages noch ein 5er-Schachterl Villiger-Virginia-Zigarillos, die Hans extra für ihn immer bestellte. Viel rauchte er nicht mehr, aber so ganz wollte und konnte er nicht davon lassen. Vielleicht irgendwann mal, dachte er immer wieder. Vielleicht, wenn er doch noch einmal mit einer Frau zusammenzöge – seine Gedanken schweiften ab – zu Tina. Vielleicht!
Er warf noch einen kurzen Blick auf die Auslage der Motorradzeitschriften, entschied sich aber, dass die Wochenend-Zeitung genügte.
„Also, Hänschen, bis bald – baba!“
„Pfiat di, Konny, viel Freud‘ heut‘ Abend!“
Wieder zu Hause hatte er sich dann aus einem guten Esslöffel Dijonsenf, zwei Eigelb, Öl, etwas Zitrone, etwas Essig, gutem – das war ganz wichtig! – aromatischem Meersalz, frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer und einer Prise Rohrzucker schnell eine Mayonnaise gerührt. Seit seiner Kindheit war er ganz versessen auf Würstel mit Mayo – nur selbst gemacht und aus guten Zutaten musste sie sein!
Wenn dann das Spiel anfangen würde, dann säße er bereits gut vorbereitet in seinem alten Sessel, die heißen Frankfurter, die Schale mit der Sauce und den Semmelkorb auf dem Tischchen neben sich, und eine gut gekühlte Flasche Trumer in der Hand. Und dann – Fußballabend!
Ja, dachte er, während er in der Zeitung blätterte, seinen Sencha schlürfte und dabei in seiner etwas altmodischen und unpraktischen, aber, wie er fand, sehr gemütlichen Küche herumblickte: So eine eigene Wohnung, nur für sich, hatte eben manchmal auch etwas für sich. Im Radio hatte er Jazz-FM, einen Internetsender, eingestellt, in dem gerade der erste Teil von Keith Jarretts Köln-Konzert gespielt wurde. Manner lehnte sich befriedigt zurück und schloss die Augen; lauschte den entspannten Klängen, die er sich in seinem Leben schon viele dutzende Male angehört hatte. Er seufzte behaglich: So war es doch wirklich gut, sein Leben.
Und wenn er sich jetzt schon ein Zigarillo genehmigte? Wieso eigentlich nicht – niemand außer er selbst konnte ihn daran hindern! Er schob den alten Küchentisch ein Stück vor, sprang voll Elan auf und hatte schon fast sein Wohnzimmer erreicht, wo die noch geschlossene rote Packung für heute Abend bereitlag – da klingelte im Flur, auf dem kleinen alten Tischchen mit dem Wurzelholzfurnier, sein Diensthandy.
„Verdammt!“ Das hatte ihm gerade noch gefehlt. Er schaute auf das Display: Chris rief an.
Mist, dachte er – hoffentlich will er nur was fragen. Sofort spürte er wieder seinen altbekannten Druck im Magen: dort, wo der Knoten saß.
„Habe die Ehre“, meldete er sich. „Na, Kollege, willst mich für morgen zum Frühstück einladen?“ Sonntagmorgens trafen sich Manner und seine engen Kollegen hin und wieder zum Frühstück in der Altstadt im Escobar. Das machten sie schon seit einigen Jahren, waren gern gesehene Stammgäste geworden und hatten mittlerweile ihren Stammtisch. Hin und wieder kam Manners Freundin Tina mit – die „Manner-Schnitte“, wie sein Kollege, Oberleutnant Christian Möckel, bei jeder sich bietenden Gelegenheit breit grinsend betonte, wenn das Gespräch auf sie kam. Er konnte es eigentlich nicht mehr hören – auch, wenn das Wortspiel mit der weltberühmten Haselnuss-Kakaocreme-Waffel aus Wien eigentlich als nettes Kompliment entstanden war: Als Christian Tina das erste Mal zu Gesicht bekam, war ihm nach einem anerkennenden leisen Pfiff die Bemerkung „Na, das ist ja mal eine Schnitte!“ entfahren; und gleich danach, mit einem Blick auf ihn, rief er grinsend und laut: „Ha! Eine Manner-Schnitte!“
„Servus, Herr Major“, hörte er Christians Stimme; und er hörte sich gar nicht fröhlich oder locker an.
Auweh, dachte er, das wird jetzt was geben.
„Leider nein, mein Lieber, kein Frühstück – es hat einen Toten gegeben. Und so wie’s ausschaut möglicherweise mit Gewalteinwirkung. Der Erkennungsdienst ist schon vor Ort, und Dr. Fuhrmann ist auch schon unterwegs.“
Manner stöhnte laut und enttäuscht ins Handy.
„Komm – wennst Glück hast, bist zum Spiel wieder daheim!“ Chris hatte also nicht vergessen, wie sehr er sich auf heut Abend gefreut hatte.
„Also, kommst erst her oder sollen wir uns am Fundort treffen?“
„Wo müssen wir denn hin?“
„Zum Untersberg, eine Einfahrt kurz hinter dem Parkplatz am Fuchsbach, kurz vor Hallthurm.“
„Ist der Fundort auf unserer Seite? Oder auf der deutschen?“
Christian lachte leise.
„Die Hoffnung muss ich dir nehmen: eindeutig bei uns.“
Manner brauchte nicht lange zu überlegen: Wenn er mit seinem eigenen Wagen fuhr, sparte er definitiv Zeit. Würde er bei dem vorweihnachtlichen Verkehr in der Stadt erst zum LKA in der Alpenstraße und dann von dort nach Hallthurm fahren, dauerte es bestimmt eine halbe Stunde mehr wenn nicht noch länger, als wenn er von seiner Wohnung in Grödig direkt zum Fundort fahren würde. Außerdem war er dann auch schneller wieder zu Hause: ManU gegen Schalke! Das durfte er nicht verpassen!
„Ich fahr selbst“, sagte er, „wo genau muss ich hin?“
„In der Auffahrt zum Weg steht ein Kollege von der Inspektion Anif, der zeigt dir, wo du rauf musst. Nimm ein Licht mit, wird ja schon recht früh dunkel.“
„Okay, dann seh‘n wir uns dort. Ich beeil mich!“
„Alles klar, bis nachher.“
Er schaute auf den Anzeigebalken des Handyakkus: noch etwa ein Drittel voll. Wird schon reichen, dachte er. Aus dem Küchenradio hörte er, wie Keith Jarrett sein Klavierspiel mit orgiastischen Lauten wie „Ahhh!“ und „Ohhh!“ begleitete. Mit einem Gefühl zwischen Verärgerung und Resignation legte er das Handy zurück auf das Tischchen.
So ein Scheiß, jetzt wird’s doch nicht so gemütlich, wie ich’s mir so fest vorgenommen hatte, und du bistauch noch selbst schuld, dachte er mit einem müden Gefühl und schaute dabei auf sein leicht verzerrtes Spiegelbild im Glas der Wohnzimmertüre. Irgendwann war ihm mal, als er dort stehend, telefonierend und sich selbst betrachtend, bei so einer Gelegenheit eingefallen, in wie vielen Kriminalromanen die Autoren sich solche Momente ausdachten, um ihren Protagonisten zu beschreiben. Er sah sich schief an, wobei seine blauen Augen einen leicht spöttisch bis verzweifeltresignierenden Ausdruck hatten: Hatten die denn keine besseren Ideen?
Er schüttelte den Kopf und ging ins Badezimmer, um sich noch schnell die Zähne zu putzen. Mit der elektrischen Zahnbürste im Mund und vor dem Spiegelschrank stehend schob er seinen Unterkiefer hin und her, hob und drehte seinen Kopf, während das Summen und Brummen der Bürste seine Zähne in Vibration brachte: 56 war er dieses Jahr geworden, und dafür waren seine Zähne noch ziemlich gut in Schuss – guten Erbanlagen und regelmäßiger Zahnreinigung sei Dank; nur ein Backenzahn fehlte, aber das war die Folge einer Auseinandersetzung gewesen. 182 cm groß war er. Mittlerweile vielleicht nur noch 181, man schrumpfte ja angeblich, wenn man älter wurde, dachte er. Und: leider ziemlich stattlich, wie er es sich zum nicht näher zu benennenden x-ten Male eingestand. Sein Doppelkinn versteckte er schon fast dreißig Jahre unter einem Vollbart, dessen früher rote Haare seit ein paar Jahren überwiegend von grauen ersetzt wurden, während die Haare auf seinem Kopf nach wie vor voll und hellblond waren. Würde sein genetischer Code eher nach seinem Vater kommen, müsste er sich langsam einmal mit dem Gedanken an eine Glatze anfreunden. Aber seine Friseurin beruhigte ihn jedes Mal: Sie konnte nichts dergleichen erkennen. Sollte es aber doch einmal dazu kommen, würde er sich eine Glatze scheren und dann den Bart wild in die Länge wachsen lassen. Hatte er sich fest vorgenommen. Ganz sicher! Aber das alles in der gleichzeitigen, von milder Verzweiflung begleiteten und von einem halbherzig gen Himmel geschickten Stoßgebet unterstützten Hoffnung, dass er es niemals würde in der Realität umsetzen müssen.
Die programmierten zwei Minuten Putzzeit waren um und er spülte seinen Mund und die Bürste mit lauwarmem Wasser aus. Wischte sie am Handtuch trocken, bevor er sie wieder in ihre Ladestation zurückstellte; und als er sich mit demselben Handtuch über den Mund fuhr, schmierte er sich dabei einen Rest der Zahnpasta in den Bart, der im Stoff gelandet war.
Fluchend nahm er den Waschlappen und entfernte sie aus den Haaren, wusch den Lappen wieder aus und ärgerte sich über sich selbst: Er würde sicher niemals gescheit werden.
Nachdenklich strich er sich mit der Linken über seinen Bart: Morgen früh würde er ihn endlich einmal wieder etwas in Form bringen müssen – die Haare standen doch schon etwas sehr struppig herum. Manchmal hatte er das Gefühl, dass von einem auf den anderen Tag sein Bart zu lang geworden sei und urplötzlich wild und zauselig geworden war. Er zupfte nachdenklich ein wenig an den grauen, dicken und teilweise sich wie Draht anfühlenden Haaren herum. Gut – also morgen bestimmt!
„Eigentlich siehst ja noch recht gut aus, Bursche. Und – dir geht’s doch auch wirklich wieder ziemlich gut!“, murmelte er halblaut vor sich hin, um sich in eine positive Stimmung zu bringen. Nur – der Druck in der Magengrube ließ nicht davon ab, ihm zu zeigen, dass trotz seiner heutigen guten Laune nach wie vor irgendetwas nicht stimmte. Sanft rieb er über die vertraute Stelle.
„Ach, was soll’s“, dachte er: „Lebe einfach – und keine weiteren Ansätze zu trüben Gedanken, hörst?“ Life’s a longsong, hieß es in einem seiner Lieblingssongs aus den Siebzigern von Jethro Tull – das Leben ist ein langes Lied.
Hier und heute wird gelebt, begreif das endlich! Und außerdem – wirst jetzt gebraucht!
⁓
Seine Therapeutin in der Reha hätte jetzt zu ihm gesagt, dass er wieder seinen alten übernommenen Verhaltensmustern folgte: Eigentlich wollte er etwas ganz anderes – und doch ließ er sich wieder davon abbringen. Wie lange sollte das noch gehen? Wann würde er endlich damit anfangen, es zu ändern?
Immer, so hatte sie ihm eingebläut, wenn er ein „Eigentlich“ vor etwas setzte, dann bedeutete das, dass er dies nicht wollte. Aber, so wie er es schon von Kind auf gelernt hatte: Da kam jemand mit einer Aufgabe, einer Erwartung zu ihm und verlangte ganz selbstverständlich, dass er seine ganz persönlichen Bedürfnisse zurückstellte. Und er, Manner, hatte nichts Besseres zu tun gehabt, als seine guten Vorsätze blitzartig zu vergessen. Gut, jetzt gerade ging es um seinen Beruf, da blieben Kompromisse nun mal nicht aus. Aber trotzdem: sich zur Verfügung zu stellen und sein für ihn so typisches Verhalten gedanklich so hinzubiegen, dass er schon irgendeinen Grund dafür fände, dass es richtig sei, seine Wünsche hintan zu stellen – warum zum Teufel passierte ihm so was nach wie vor? War er nicht schon tief genug abgestürzt, damals?
Natürlich wusste er die Antwort ganz genau. Aber jetzt war einfach nicht der Zeitpunkt darüber nachzudenken, beschloss er. Wie so oft.
⁓
Er machte schnell die paar Schritte in die Küche, lauschte noch einmal dem Klang von Jarrets Klavierspiel und schaltete dann entschlossen ab. Kippte den nun kalten und nicht mehr zu genießenden Sencha in die Spüle und ging dann in die Diele. Dort lag noch sein schwarzer Rollkragenpullover auf dem Sessel, er hatte ihn gestern Abend schnell dort hingeworfen und später nicht mehr weggeräumt. Er streifte ihn über, holte aus dem Dielenschrank seine alte, dicke Roadmaster-Jacke, fuhr mit den Armen hinein und zupfte die hochgerutschten Pulloverärmel noch ein bisschen zurecht. Seine Dienstwaffe, eine Glock 17, lag auf dem Dielentisch, er hatte sie erst gestern Abend nach dem Heimkommen überprüft: Sie war wie immer mit 17 Schuss vollgeladen. Zum Glück hatte er sie schon lange nicht mehr gebraucht. Gewohnheitsmäßig sah er noch einmal nach, ob sie auch gesichert war, und steckte sie sich mit ihrem Holster an den Gürtel. Holte aus der Lade des Tischchens die Mini-Maglite, prüfte sie, und steckte sie in die Jackentasche. Dann zog er seine schwarzen Lederhandschuhe und eine blaue Strickmütze über, griff nach seinem Schlüsselbund. Schaute sich noch einmal um, ob er nicht doch etwas vergessen hatte, auszumachen und trat dann schwungvoll ins Treppenhaus. Er warf die Türe ins Schloss und lief zügig die drei Etagen Treppe hinunter bis zur Tiefgarage, sprang die letzten drei Stufen in einem Satz herunter – und zuckte zusammen: Nach einem lauten Knacken fuhr ein stechender Schmerz heftig durch sein rechtes Knie. Nicht schon wieder, dachte er.
Geräusche machten seine Knie schon länger. Der Schmerz war noch relativ neu, kam aber immer wieder. In beunruhigend wenig Zeit waren die Abstände, in denen er ihn nervte, kürzer geworden.
Nachdem er die graue Stahltüre zur Garage geöffnet hatte, sprangen mit einem klickernden Geräusch die Leuchtstofflampen an. Mit einem Blick sah er, dass die Röhre über seiner Parkbucht immer noch defekt war. Dieser verdammte Hausmeisterservice! Seit der Vermieter die Verwaltung einer sogenannten „Facility Management“-Firma übergeben hatte, funktionierte nichts mehr: Er hatte gefühlt schon zwanzigmal dort angerufen und den Defekt gemeldet – aber nichts passierte. Jetzt hatte er aber wirklich genug. Gleich am Montag würde er dort noch mal Dampf machen!
Beim Einsteigen in seinen Dienstwagen fiel sein Blick auf die silberne Plane, die seine 79er-Yamaha XS 1100 verdeckte, die in einer eigenen Parkbucht neben ihm stand: Als er hierhergezogen war, hatte er sie mit dem festen Vorsatz vom Anhänger geschoben, sie wieder fit zu machen. Seit seinen Anfängen beim LKA hatte er immer seltener Gelegenheit gefunden, sie zu fahren; bis er es vor etwa zehn Jahren ganz aufgab. Seitdem wartete sie darauf, wieder aus dem Dornröschenschlaf erweckt zu werden. Ein paar Mal hatte er kurz daran gedacht, sie jemand zu geben, der wirklich etwas damit anfangen konnte; wer weiß, hatte er überlegt, ob ich jemals wieder … Aber jedes Mal hatte er dann doch wieder fast zärtlich auf den metallic-roten Tank mit dem goldenen Schriftzug der Dicken geklopft und die Plane wieder über sie gezogen.
Die Vergaser sind sicher völlig verharzt und das Öl dick wie Honig, dachte er. Die Bremskolben sitzen bestimmt fest wie eingeschweißt in den Sätteln, und die Dichtgummis sind völlig versprödet. Aber nächstes Jahr mach ich sie wieder fit, ganz sicher; und ich werd Hänschen fragen, ob er Lust hat, mitzumachen. Die Aussicht darauf verbesserte seine Laune deutlich und ließ ihn den Ärger über das kaputte Licht vergessen.
Die Sonne stand schon ziemlich tief, als er aus der Garage fuhr, sie blendete fürchterlich. Manner kniff die Augen zusammen, fummelte umständlich seine Sonnenbrille aus dem Handschuhfach und setzte sie sich auf. Dann gab er Gas und fuhr Richtung Fürstenbrunn. Seine Eltern wohnten dort: Er war schon eine ganze Weile nicht mehr bei ihnen gewesen. Aber bald war ja Weihnachten.
Er würde über den Veitlbruch entlang des Untersbergs fahren, und dann über Großgmain direkt zur deutschen B 20 Richtung Hallthurm und Berchtesgaden – und dann wäre er auch schon da. Was würde ihn wohl heute erwarten?
Bevor er an den Ort eines Verbrechens kam, versuchte er immer, sich auf das einzustellen, was ihn da erwartete: Meistens waren es die Folgen von Gewalt, Schmerz, Tod. Er hatte mit der Zeit gelernt, eine gewissermaßen vorauseilende Distanz zu den ihm noch unbekannten Opfern aufzubauen – zu seinem eigenen Schutz. Bloß nicht das Schicksal des anderen zu nah an sich heranlassen! Aber das gelang ihm nicht immer: Schon von Kindheit an war er ein sehr empathischer Mensch; was sowohl für die Arbeit als auch privat manchmal ein Segen war, sich aber auch sicher ebenso oft als Fluch erwiesen hatte. Und: Er hatte schmerzhaft erfahren müssen, was geschehen konnte, wenn man nicht auf die immer vorhandenen Warnsignale achtete. Als er an dem Haus seiner Eltern vorbei die Straße zum Untersberg hinauffuhr, ging ihm durch den Sinn, dass er eigentlich wirklich etwas daran ändern müsste, dass sie sich so selten sahen. Immer war die Arbeit wichtiger. Wieder so ein „Eigentlich“, dachte er.
Im selben Moment, er passierte gerade die Stelle, an der der Glanbach in Höhe des Untersbergmuseums unter der Straße durchführte, spürte er ganz plötzlich eine Veränderung in sich: Es fühlte sich an, als ob in seinem Innern etwas aufging. Irgendetwas Unbekanntes war da auf einmal und breitete sich seltsam fremd und beunruhigend in ihm aus.
Eine Panikattacke war es nicht, die hatte er mittlerweile gut im Griff; anders, als sie ihn damals wie aus dem Nichts erwischte, da war er nur noch ein Häuflein Angst und Unsicherheit gewesen. Auch der Knoten war es nicht: Der saß unverändert an seiner leider nur allzu vertrauten Stelle. Was war das bloß?
Verunsichert hielt er neben der Straße an, schüttelte den Kopf, rieb sich über den Bauch. Sein Traum fiel ihm ein, wie er hatte husten müssen und froh war, dass kein Blut im Schleim war.
„Ach, Schmarr‘n“, dachte er, „mein Magen spielt wieder mal verrückt – sicher war der Sencha zu stark, ich hätte doch den zweiten Aufguss auch wegschütten sollen. Oder ich hab wieder zu viel von der Mayo genascht! Immer dasselbe mit mir!“
Doch je weiter er durch den verschneiten Wald den Berg hinauffuhr, umso stärker wuchs das Fremde in ihm.
„Hallooo? Jemand da?“
Die Frage klang aus der offenen, doppelflügeligen Balkontür hinaus auf die tief verschneite Terrasse, auf der noch die Gartenmöbel standen: Offenbar hatte keiner so früh in dieser Jahreszeit mit einer solchen Menge Schnee gerechnet; und so hatte sie niemand weggeräumt. Alles war dick eingeschneit, und auf der Platte des großen Tischs schaute ein prächtiger Adventskranz mit vier großen roten Kerzen aus einer Schneehaube. Durch den frühen Schnee war das Gelände wunderbar winterlich geworden. Genau passend zur Vorweihnachtszeit!
Gestern spät nachmittags hatten alle zusammen um den Tisch gesessen, dick in ihre Winterklamotten eingemummt: So kurz vor der Wintersonnenwende war es jetzt schon fast dunkel. Die Gruppenleiterin hatte die spontane Idee, den üblichen Nachmittagskaffee vom Esstisch im Wohnraum kurzentschlossen auf die Terrasse zu verlegen; und so war der Adventskranz nach draußen getragen worden und dann hatten sie im Kerzenschein ein paar selbst gebackene Plätzchen und Früchtebrot genossen. Hatten heißen Kaffee und Kakao getrunken, gelacht und erzählt – und danach noch zum Abschluss aus den roten Bechern mit einem Glühpunsch auf den schönen Tag angestoßen.
Allen hatte das gefallen: zum einen, weil es natürlich einfach wunderschön war, die winterliche Stimmung zu genießen. Zum anderen aber auch – und das war vielleicht für die meisten der wichtigere Grund –, weil so viele Bewohner Raucher waren. Im Haus war Rauchen streng verboten, nur vor den beiden Eingängen durfte geraucht werden: Die Aschenbecher, die draußen neben den Türen standen, quollen regelmäßig über, waren ein ständiger Streitpunkt, wer denn nun dafür verantwortlich sei, sie zu leeren.
Jedenfalls war es eine schöne, fröhliche Runde gewesen, und alle waren danach in freudiger Vorweihnachtsstimmung wieder zurück ins Haus. In der Nacht hatte es wieder geschneit und so waren die Stühle und der Tisch am nächsten Morgen wieder voller Schnee.
Jetzt saß dort auf einem der Stühle ein Mann, zurückgelehnt, die Beine ausgestreckt und mit der rechten Hand den Kopf im Nacken stützend, mit einer qualmenden Zigarette in der Linken. Er hatte den Schnee von der Sitzfläche des Stuhls gewischt, darauf ein von drinnen mitgebrachtes Kissen gelegt, und genoss mit geschlossenen Augen ganz offensichtlich die Wärme der strahlenden Wintersonne. Es war schon Mittagszeit und sie war über das Lattengebirge geklettert. Ohne Sonnenbrille war es fast nicht auszuhalten, länger in das weiße Wunder zu schauen.
Er trug einen olivgrünen Militärparka, hatte die mit einem Pelzstreifen besetzte Kapuze aufgesetzt. Seine Füße steckten in einem Paar grüner Kunststoffclogs. An der Hauswand, neben der großen Balkontür, lehnte eine ganze Batterie ähnlicher Gartenschuhe: Um einmal schnell draußen einen Glimmstängel durchzuziehen, reichten die Dinger allemal. Und wenn die Füße dann doch zu kalt wurden, warteten ja drinnen die warmen Filzpuschen, die für jeden Bewohner und für Besucher bereitstanden. Sie kamen aus eigener Werkstatt: Immer nach den Sommerferien begannen die Vorbereitungen auf die Herbst- und Winterzeit, und die Produktion in den Werkstätten wurde entsprechend umgestellt. In der Filzwerkstatt wurden dann Filzlatschen, Filzmützen und dergleichen produziert; im Laden waren sie gut gehende Verkaufsrenner, gern genommen von den Einheimischen und von Urlaubern. Warme Füße im Haus und warme Ohren draußen mochte halt jeder.
Das Haus stand etwas abseits auf dem weitläufigen Gelände, direkt neben dem alten Bauernhof. Weiter den Hügel hinunter sah man die Werkstattgebäude, die Gewächshäuser der Gärtnerei, und noch ein Stück weiter lagen die anderen Wohnhäuser. Hier, auf diesem mehrere Hektar umfassenden Anwesen Sonnenhof wohnten, arbeiteten, lebten viele Menschen, die woanders keine rechte Heimat hatten finden konnten – oder sich gerade hier ihre Heimat gesucht hatten: Menschen mit Behinderungen.
„Haaallooo – jemand daha?“ Wieder erklang die Frage, und eine dunkelhaarige Frau streckte den Kopf aus der Tür, schaute in Richtung des Rauchenden.
„Ach, hallo, Max – tut mir leid, dass ich später komm; aber mir ging‘s heut Morgen wirklich nicht so recht. Vielen Dank, dass du länger bleiben konntest. Hast echt was gut bei mir!“
Der Mann im Parka rappelte sich auf, drehte sich um und grinste breit, als er antwortete.
„Servus, Sabine – alletklärchen, null Problemo.“
Er schaute auf seine Kippe und schnippte die Asche in den Schnee. Steckte sie wieder zwischen die Lippen, nahm einen tiefen Zug, inhalierte tief und lange, und stieß dann den Rauch mit einem zufriedenen Seufzer in die Luft.
„Supi. Sag mal, ist der Sebastian eigentlich da? Ich bin grad kurz durchs Haus und hab ihn gesucht; muss was mit ihm wegen seines Taschengelds besprechen.“
Sabine Schmitz, die Leiterin der Wohngruppe Fülle, hatte Wochenenddienst: Der ging eigentlich von Samstagmorgen bis Montagmittag. Aber heute war sie später gekommen, und deshalb hatte Max noch den Frühdienst übernommen, im Anschluss an seine Nachtbereitschaft, hatte das Frühstück vorbereitet, die Bewohner, soweit sie nicht schon selbst aufgestanden waren, geweckt, Hilfestellung beim Waschen und Ankleiden geleistet, und dann die ganze bunte Truppe um den großen Esstisch im Wohnraum versammelt. Heute hatte es Brunch gegeben, wie fast immer samstags: Die meisten wollten endlich einmal so viel freie Zeit wie möglich haben, um Freunde zu besuchen, einen Ausflug zu machen oder einfach nur abhängen. Deshalb gab es ein sehr spätes, ausgedehntes Frühstück, mit etwas Warmem dazu; nachmittags wurde eine Kleinigkeit angeboten, und abends dann das warme Mittagessen. Außerdem konnte man so am Samstag länger schlafen, denn außer den Bäckern und den Köchen hatten alle an den Wochenenden frei.
Tagsüber versorgten sich alle auswärts – endlich mal selbst bestimmen, was es zu essen gab! Dafür war man gern bereit sich etwas vom eigenen Taschengeld zu holen – eine Leberkäsesemmel beim Neumeier, Curry-Pommes in der Spieß-Hüttn, oder auch bergeweise Chips und Nachos mit Dips aus der Tanke. Oder sonst was. Hauptsache: Was so richtig Ungesundes – wenn sonst schon immer alles „gesund“ war!
Thomas hatte heute Morgen die Aufgabe, den Tagesspruch aus dem Kalender vorzulesen, dann wurden die Hände der Nachbarn gefasst und sich gemeinsam ein „Guu-tenn Morr-genn!“ gewünscht. Und nachdem das alles endlich erledigt war, hatten sich alle auf die Semmeln, die Brezen und die Laugenstangen, Marmelade, Käse, Rührei mit Speck und auf Müsli, Milch und Joghurt, Kaffee und Kakao gestürzt. Brot und Backwaren wurden jeden Tag frisch in der Bäckerei der Einrichtung gebacken und von der Küchengruppe an die einzelnen Wohngruppen verteilt. Meistens ging es beim Frühstück recht lebhaft zu, waren doch die Bewohner noch recht jung – überwiegend junge Erwachsene, mit der entsprechenden Lebensenergie. Nur zwei waren schon älter, beide um die Mitte vierzig.
Max musste kurz überlegen.
„Ne, der hat bei seinem Mädel im Haus Vertrauen gepennt. Gestern am frühen Abend war‘n die und Paul doch noch im Kino – sich den neuen Nemo-Film anschaun.“
„Ach so. Wer hatte denn bei denen Dienst?“, fragte Sabine.
„Weiß nicht, irgendjemand Neuer. ‘ne Frau mit leichtem Akzent, ich denk mal aus Sachsen oder so. Ich glaub, sie heißt Mandy.“ Er grinste. „Nu joa“, versuchte er den Akzent nachzumachen. „Hat aber angerufen, als die beiden Turtel-Täubchen so gegen sieben zurück war‘n.“
„Na, dann ist’s ja gut“, antwortete sie. „Wo sind denn die anderen alle?“
„Thomas und Hans-Herbert sind in die Stadt, Zeitungen im Bahnhofskiosk anschauen. Melanie und Claudia sind übers Wochenende bei ihren Eltern, Sandra und Olaf wollten heute zusammen mit Verena zu den Lamas.“ Er überlegte kurz. „Susi ist auf ihrem Zimmer; ja, und Sebastian wie gesagt im Vertrauen, bei seinem Schnucki. Steht aber alles in der Doku.“
„Okay, dann weiß ich Bescheid. Gab’s sonst noch was Wichtiges?“
„Nö. Alles okay, alles pipifein.“ Wieder grinste er.
„Fein.“ Sie lächelte, und zog sich wieder ins Haus zurück.
„Pipifein“ – irgendwann musste sie einmal googeln, woher dieser österreichische Ausdruck eigentlich kam. Sie erinnerte sich noch genau daran, als sie, neu zugezogen, das zum ersten Mal auf einer Werbung in Salzburg gelesen hatte; und dachte, da hätte sich jemand verschrieben.
Sie ging durch den großen, in einem warmen Weißton gestrichenen Wohnraum und schaute sich um, ob alles an seinem Platz war. Rückte ein paar Stühle zurecht, zog die Tischdecke auf dem Esstisch gerade, hob einen Brotkrümel auf. Sie schaute noch kurz nach, ob der Bewohner-Tischdienst alles ordentlich in die Spülmaschine geräumt hatte, aber alles war perfekt. Sicher hatte Hans-Herbert heute Tischdienst gehabt: So ordentlich ausgerichtete und sortierte Gabeln, Löffel und Messer gab es nur bei ihm! Man merkte bei ihm immer wieder ganz deutlich, dass er aus einem Elternhaus kam, das auf Ordnung und Sauberkeit größten Wert legte; und dies wurde ihm auch in seiner Erziehung beigebracht. Überhaupt hatten sich seine Eltern damals, vor fast fünfzig Jahren, nicht von den Prognosen zur eingeschränkten Entwicklung von Menschen mit Down-Syndrom abschrecken lassen – sondern ihn, soweit es immer nur ging, gefördert. Zu seinem Glück verfügten sie auch über entsprechende finanzielle Mittel; andere hatten weniger Glück gehabt.
Am Büro angekommen schloss sie die Türe auf, ließ sie weit offenstehen. Das war Teil ihres Anspruchs an die Arbeit im Wohnheim: Die Bewohner sollten immer das Gefühl haben, dass sie mit ihren großen und kleinen Sorgen und Wünschen jederzeit zu den Mitarbeitern kommen konnten. Nach Möglichkeit sollte keiner vor einer verschlossenen Tür stehen. Nur nachts und wenn niemand im Büro war, wurde die Türe verschlossen – das war schon aus Datenschutzgründen vorgeschrieben. Aber sonst war jederzeit Sprechzeit; und das verlangte Sabine auch von ihrem Team.
Sie trat ans Fenster und schaute kurz hinaus auf die Straße, und hinüber zum verschneiten Hochstaufen, der majestätisch über der prachtvollen, in weiße Kristalle gehüllten Landschaft thronte. „Sagenhaft“, dachte sie wie schon so oft, und: „Dass ich hier gelandet bin! So ein Glück!“
Am Schreibtisch schaltete sie den PC und die Kaffeepad-Maschine an: Jetzt erst mal einen dicken, heftigen Schwarzen, der würde ihr helfen, endgültig wieder einen klaren Kopf zu bekommen; nach dem Abend gestern!
⁓
Die Vorweihnachtszeit war auch hier, in der bayerischen Provinz, immer mit irgendwelchen Einladungen und Feiern ausgefüllt; und so war es auch gestern Abend wieder später geworden – sogar sehr viel später: Es musste wohl so gegen drei Uhr morgens gewesen sein, als sie endlich wieder in ihre Wohnung zurückkam. Sie war ohne große Waschaktivitäten direkt ins Bett gefallen, hatte nur eben, noch in der Wohnungstüre stehend, die Schuhe abgestreift und unter die Kommode im Flur gepfeffert. Die Jacke und ihre Tasche in der Küche eben schnell über die Stuhllehne gehängt, Hose und Socken irgendwie abgestreift und sich dann schnurstracks in Morpheus‘ Arme begeben. Als dann der Wecker morgens um sechs läutete, hatte sie gerade von einem ihr wildfremden, sehr großen und äußerst attraktivem, dunkelhaarigen Mann in einem blauen Jogginganzug und Adiletten, mit grauen Schläfen, einem gepflegten Dreitagebart, muskulöser Statur, Unterhemd und einem dicken Goldkettchen auf der beharrten Brust geträumt, der sie an der Tür zur Wohnung ihrer Mutter mit den Worten begrüßte „Hallo, mein Kind, da bist du ja endlich, wir warten schon auf dich! Komm rein – ich bin dein neuer Papa!“ Als sie ihm völlig verdattert die Hand reichte, klingelte es erneut an der Wohnungstür.
„Ah, das wird deine neue Schwester sein!“, sagte er, hielt ihre Hand fest und drückte mit seiner anderen Hand auf den Türöffner, der ein schnarrendes Geräusch an der Haustür machte – aber nichts geschah. Ihre Mutter kam aus der Wohnung, im gleichen Aufzug wie der Kerl, der sie da nicht losließ, und machte ein genervtes Gesicht, als sie sie sah. Beide schauten sie jetzt vorwurfsvoll an, während es unten im Hausflur an der Türe schnarrte. Das Klingeln dauerte an, vermischte sich mit dem Surren des Öffners, wurde immer lauter und lauter – bis sie aufwachte und den Lärm ihres Weckers erkannte, der sich da in ihren Traum gemischt hatte. Sie tastete nach dem Aus-Knopf, bekam ihn zu fassen, und nach einigen vergeblichen Versuchen gelang es ihr, ihn auszuschalten.
Sie setzte sich auf und starrte eine Weile fassungslos und völlig benommen vor sich hin. Was für einen Mist hatte sie denn da geträumt! Und wie real es ihr erschienen war: Sie sah noch ganz deutlich den Gesichtsausdruck ihrer Mutter vor sich; den kannte sie leider auch in Echt zu Genüge.
Ein paar Minuten lauschte sie dem Sausen in ihren Ohren und versuchte, ihren Kopf nicht zu stark zu bewegen. Sie spürte genau, dass der Restalkohol im Blut zusammen mit den Nachwirkungen der zwei Joints des gestrigen Abends ihr irgendwie ganz deutlich klarmachten, dass es absolut noch nicht die richtige Uhrzeit zum Aufstehen sein könne. Auch ihre Augen wollten wohl eigentlich weiter geschlossen bleiben; und so entschied sie, in der Arbeit anzurufen und zu versuchen, noch ein paar Stunden für sich herauszuschinden. Bis mittags würde es schon wieder gehen, und wenn Max so lange bleiben könnte …! Sie hatte Glück, er hatte nichts weiter vor und übernahm gern ein paar Stunden Dienst zusätzlich – am Wochenende wurden sie doppelt gutgeschrieben. Aufatmend war sie wieder ins Bett zurück, hatte noch kurz darüber nachgedacht, wieso zum Teufel sie wohl ihrer Mutter im Traum einen solchen Kerl zugedacht hatte und schlief wieder selig ein.
⁓
Sie ging in das kleine Badezimmer, das zum Büro gehörte, schaltete das Licht am Spiegel an und schaute hinein: So ganz allmählich musste sie sich wohl doch eingestehen, dass so lange Feten nicht mehr das Richtige für eine Frau waren, die sich nun auch bei optimistischster Betrachtung ganz und gar nicht mehr auf der eher der vierzig zugewandten Hälfte ihres Lebensjahrzehnts befand: Nächstes Jahr würde sie fünfzig. Fünfzig! Sie! Unfassbar!
Als sie sich jetzt so im Spiegel betrachtete fand sie, dass sie aber trotzdem noch ganz passabel aussah – bis auf die dunklen Schatten unter den Augen und den resignativen Falten in den Mundwinkeln. Sie strich sich über die Taille, drehte sich ein wenig zur Seite, zog dabei den Bauch etwas ein. Alles doch noch recht ansehnlich, sagte sie sich. Die Männer fanden das auch, da konnte sie sich ebenfalls nicht beklagen.
Sie war eine einigermaßen schlanke, knapp 170 cm große Frau mit dunklen Augen und hatte dunkelbraun, fast schwarz, gefärbte, schulterlange Haare; mit einem deutlich sichtbaren grauen Ansatz. „Muss ich dringend nachfärben lassen“, dachte sie.
„Ja, meine Liebe – es wird aber trotzdem Zeit, dass du endlich solide wirst!“, sagte sie zu ihrem Spiegelbild.
Solide – ja gern; wenn, ja – wenn sie nur endlich den richtigen Mann dafür fände! Denn allein bleiben wollte sie auf keinen Fall. Aber, wer war der Richtige? Seit Jahren dachte sie immer wieder darüber nach – ohne sich so wirklich entschließen zu können. Und ohne einen getroffen zu haben, der es ihr hätte sagen können! Vielleicht… so einen wie dem aus ihrem Traum?
„Was“, dachte sie sofort, „so einen Macho-Typ? Niemals!“ Als Sozialpädagogin ihrer Generation hatte man doch einen ganz anderen Umgang! Legte Wert auf Emanzipation, auf intellektuelle Gespräche bei Bio-Rotwein und Wildlachs an Wildreis, Kerzenlicht und Musik von Van Morrison, Michael Bublé oder Element of Crime.
Aber andererseits – so ein bisschen „richtiger Kerl“ sollte auch dabei sein; schließlich war sie ja von soften Sozial-Luschen fast tagtäglich in der Arbeit umgeben; und die waren aber so was von gar nicht ihre Vorstellung von einem richtigen Mann.
Warum konnte es so was eigentlich nicht geben? So ein wenig attraktiv, ein wenig feinsinnig, ein wenig intellektuell, ein wenig romantisch … ein wenig versaut … vielleicht auch ein bisschen mehr … sie grinste. Mit tiefer, rauer Stimme vielleicht? Ein sanfter Womanizer wie George Clooney? Sie seufzte. Ach ja. „Träum ruhig weiter", dachte sie und schaute noch einmal auf die dicken Ringe um ihre Augen. Dann machte sie das Licht am Spiegel aus und ging zurück ins Büro.
Die Kaffeemaschine war mittlerweile bereit und sie legte gleich zwei Pads in die Aufnahme; drückte auf das Symbol für eine Tasse und hörte zu, wie der heiße Kaffee in die Tasse lief. Dann zwei Stück Zucker hinein, einen guten Schuss Milch, umrühren und dann – endlich Koffein! Sie setzte sich an den Schreibtisch, nahm ihre Lesebrille und schaute ins Übergabeprotokoll; wechselte dann zum Programm mit den Dienstplänen und versuchte, die längst überfällige Planung für die Osterfreizeit zu machen.
„So“, kam da die Stimme von Max aus dem Flur, „ich bin dann mal wech.“
Er trat ins Büro und ging ins Nebenzimmer, wo das Bett für die Nachtbereitschaft war, griff sich die Reisetasche mit seinen Sachen und nahm seine Tasse vom Nachttisch.
„Mir is‘ noch wat eingefallen: Mona vom Haus Entfaltunghat vorhin angerufen, wollte dich sprechen. Aber sie meldet sich wieder.“
Sabine sah auf.
„Okay, weiß ich Bescheid. Ich wünsch dir einen richtig schönen Sonntag; und noch mal vielen, vielen Dank!“, sagte sie.
„Also, tschö dann!“ Er winkte, und ging Richtung Ausgang.
„Bis dann, schönes Wochenende!“
Sie schaute ihm hinterher, dann ging sie wieder an die Dienstplanung. Wann war noch einmal Ostern nächstes Jahr? Und wer hatte an Weihnachten Dienst – und wer Silvester? Sie hatte für dieses Jahr zwischen dem zweiten Weihnachtsfeiertag und dem 6. Januar Urlaub eingereicht – endlich einmal wieder richtig frei zwischen den Tagen.
In den vergangenen zwei Jahren hatte sie immer wieder alle Dienste um Weihnacht und Neujahr übernehmen müssen: Die Wohngruppe Fülle, ihre neue Gruppe für das Service-Team im Bistro, war noch im Aufbau gewesen; und es war schwierig gewesen, zuverlässige und fähige Mitarbeiter zu finden: Wieder und wieder hatte sie mit ihrem Bereichsleiter über Bewerbungen gesessen, Gespräche geführt, Hospitationen begleitet und, und, und… Aber irgendwie waren es immer nur kurze Gastspiele, die die Interessenten absolviert hatten. Doch schließlich war das Team komplett: Maria und Max waren astreine Teamplayer, sie ergänzten sich mit Sabine perfekt.
Sie hatte sich freiwillig für die Weihnachtstage gemeldet, und ihre Kollegen würden sich Silvester und Neujahr teilen. Die meisten Bewohner waren eh bei ihren Eltern oder Verwandten, nur die beiden ältesten, Hans-Herbert und Thomas, und Dennis würden dableiben. So würde es eine ganz gemütliche, eine stade Zeit werden. Und danach: Sie würde frei haben!
„Ach, herrlich“, dachte sie – „endlich hab ich dann mal wieder Zeit und Ruhe für mich!“ Sie würde im Pyjama auf dem Sofa herumlümmeln, sich alle alten Filme anschauen und jede Menge ungesundes Essen in sich reinstopfen. Und Silvester – da war sie schon zur nächsten Party eingeladen. Sie nahm sich fest vor, es diesmal etwas vernünftiger anzugehen. Und sich nur dann auf einen Mann einzulassen, wenn er wenigstens ein bisschen etwas von dem hatte, was sie sich wirklich wünschte. Echt!
Ihre Aufmerksamkeit für die Dienstpläne hatte deutlich abgenommen. Sie zwang sich zurück an den Bildschirm, hatte gerade die Maus angeschoben, da klopfte es heftig an der Tür; sie schrak hoch, blickte auf: Susi stand im Türrahmen, ihre kurzen, braunen Haare wie immer strubbelig wild durcheinander, und schaute sie mit ihren großen, so ungemein ausdrucksstarken Augen mit den stark pigmentierten Ringen um die Iris fragend an.
„Hallo, Sabine“, sagte sie mit ihrer tiefen, etwas dumpf klingenden Stimme.
„Ja, servus, Susi Kju! Na, wie geht’s dir?“
„Danke, gut.“ Susis Art zu sprechen hatte immer etwas Grobes, Ungeschliffenes – polterig vielleicht. Die Worte kamen oft so, als ob sie sie herausstoßen müsse.
„Und, was hast heut‘ schon gemacht?“
„Och, nix Besonders. Nur so Musik gehört und so.“
Susi konnte stundenlang auf ihrem Bett sitzen und über Kopfhörer Schlager hören. Weil sie auch so gern Musik aus den Siebzigern hörte, war ihr beim Hören von Suzie Q von CCR aufgefallen, dass da über eine Susi gesungen wurde, und ein Betreuer hatte ihr daraufhin den Songtext übersetzt. Dass da jemand offenbar über sie „I like the way you talk, I like the way you walk“ sang, hatte ihr so gut gefallen, dass sie von da ab nur noch so genannt werden wollte: Suzie Q.
So war sie zu ihrem Spitznamen gekommen: Im ganzen Sonnenhof nannten sie alle mittlerweile nur noch „Susi Kju“.
Sabine schmunzelte, als Susi jetzt ins Büro trat und neugierig auf den PC-Monitor schaute.
„Hast Lust, mir nachher beim Kochen zu helfen?“
„Ja, klaro! Was machen wir denn?“ Susi rückte ins Büro vor, leicht vorgebeugt stand sie nun neben Sabine und legte ihr eine Hand auf die Schulter.
„Von der Küche bekommen wir nachher Dampfnudeln, da müssen wir Vanillesoße zu machen.“
„Super! Aber gaaanz viel machen wir, sonst ham wir nich‘genuch – die Buamnehm’ immer so viel!“ Susis Augen wurden dabei noch größer, und dabei drückte sie Sabines Schulter so fest, dass die leicht zusammenzuckte.
„He – nicht so fest!“ Blitzschnell wurde die Hand zurückgezogen.
„‘tschuldige, Sabine!“, sagte sie und schaute schuldbewusst.
Sie arbeitete in der Bäckerei und vom täglichen Brotlaibkneten hatte sie Mordskräfte in den Händen bekommen. Das hatte schon mancher Mitbewohner erleben dürfen, wenn er Susi wieder einmal ärgern wollte. Sie war zwar eine Seele von einem Menschen, aber sie wusste sich schon zu helfen!
„Okay, dann machen wir das heut‘ Abend“, sagte Sabine. „Jetzt muss ich aber arbeiten, ja?“
„Was machst‘n?“ Susi beugte sich vor, versuchte, etwas zu erkennen.
„Ich arbeite was für die Osterfreizeit aus. Freust dich schon drauf?“
„Boah – und wie! Fahr’n wir wieder hin, wo die Mary her ist?“ Maria wurde von den Bewohnern allgemein so genannt; nur nicht von Hans-Herbert: Dem war das zu unkorrekt.
Maria kannte in ihrer Heimat Tirol am Haldensee einen Campingplatz, wo sie günstig Wohnwagen mieten konnten. Letztes Jahr waren sie in den Sommerferien dort gewesen, und alle hatten sich gewünscht, so bald wie möglich wieder dorthin zu können.
„Ja, wahrscheinlich. Es ist nur noch nicht ganz klar, ob wir wieder die gleichen Wagen bekommen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Gell?“
„Joo, klar! Du machst das schon, Chefin!“ Susi wollte ihr schon kräftig auf die Schulter klopfen, besann sich dann aber noch rechtzeitig und tätschelte sie nur ganz leicht und vorsichtig. Wieder musste Sabine lächeln, als sie „Chefin“ genannt wurde: Eigentlich sah sie sich ja als Dienstleisterin für ihre Bewohner, quasi als ihre Angestellte. Sie versuchte, ihnen so gut wie möglich ein schönes, sicheres Zuhause zu bieten; das war eigentlich schon alles. Am besten gelang das, indem sie einfach zuhörte, wenn die Menschen miteinander sprachen, sich unterhielten; und dann das Gehörte umsetzte. Wichtig war ihr, dass es um die Leben der ihr anvertrauten Menschen ging und nicht um ihres. Aus ihrer Sicht waren eigentlich die Bewohner des Hauses ihre Chefs. Aber in der täglichen Arbeit war sie es, die sich mit Konzepten, Gesetzen, Sachzwängen und immer wiederkehrenden Problemen herumschlug. Für alle die wichtigste Ansprechpartnerin war sie. Und, nicht zu vergessen: Sie verwaltete das Taschengeld! Ganz klar für ihre Schäfchen – SIE war die Chefin!
„So, jetzt muss ich aber wirklich was tun!“ Sabine lächelte Susi an. „Bis nachher, ja?“
„Ja, ist gut. Ich geh dann mal runter zur Bäckerei, schau nach, ob wir alle Fenster zugemacht haben.“
„Gut, mach das. Aber zieh dich warm an, und lauf vorsichtig – es ist ganz schön glatt!“
„Ist gu-hut!“, rief Susi im Rauslaufen.
Sabine sah ihr nachdenklich hinterher: Susi war seit einigen Tagen anders als sonst, stiller und zurückhaltender; manchmal wirkte sie sogar etwas bedrückt; aber niemand vom Team hatte bisher herausbekommen, welche Ursache es für ihr Verhalten gab. Wir müssen das unbedingt auf der nächsten Mitarbeiterkonferenz mit den anderen Gruppenleitern besprechen, dachte sie. Vielleicht wissen sie ja auch etwas in der Bäckerei? Am besten, ich ruf gleich einmal an. Sie hatte schon die Hand am Hörer, da kam ihr jemand zuvor: Es klingelte.
„Verflixt!“ Sie hob ab, meldete sich mit „Haus Fülle, Sabine Schmitz!“ und lauschte.
„Ja, hallo, hier ist Mona von der Entfaltung. Du, ist der Paul bei euch?“
Paul war der beste Freund von Sebastian, die beiden waren unzertrennlich – wenn Sebastian nicht grade mit Schnucki, die in Wirklichkeit Sandrine hieß, „allein sein“ wollte.
„Ne, du, hier ist keiner, das Haus ist ganz verlassen. Alle sind on the road again. Vielleicht ist er bei Sebastian und Sandrine?“
„Nein, ist er nicht, ich hab da schon angerufen, sie sind alle drei nicht da. Hast du nicht ‘ne Idee? Er ist schon den ganzen Tag weg, hat sich nicht abgemeldet und nix. Ich mach mir so langsam echt Sorgen.“
Sabine überlegte. „Weißt was? Ruf einfach den Chef an, vielleicht weiß der, wo er ist. Du kennst das doch – oft sind irgendwelche Informationen steckengeblieben, wär ja wirklich nicht das erste Mal!“
„Soll ich? Der ist doch zu Hause und hat frei!“ Mona zögerte. So lange war sie noch nicht Gruppenleiterin und sie wollte nur ja keine Fehler machen.
„Du – der hat oft genug gesagt, dass wir ihn jederzeit anrufen können. Jetzt machen wir das einfach mal! Kannst ja sagen, dass ich das vorgeschlagen hab.“ Bei dem Gedanken musste sie grinsen: Na, das wollen wir doch mal sehen, ob er wirklich zu seinem Wort steht!
„Gut. Dann versuch ich’s mal. Bis später! Und danke!“
„Alles klar – bis später.“
Seltsam, dachte sie, nachdem sie aufgelegt hatte, wo ist denn dann Sebastian? Eigentlich war er ganz zuverlässig und sagte Bescheid, wenn er woanders hin ging. Aber manchmal war er eben auch nur ein ganz normaler junger Erwachsener, der gerade erst dem Teeniealter entwachsen war und ungehindert herumstromern wollte.
„Ach“, dachte sie, „die sind bestimmt wieder irgendwo auf dem Gelände unterwegs. Jetzt aber an die Arbeit!“ und begann zu tippen.
Susi hatte sie ganz vergessen.
„Kreuzbirnbaumhollerbusch – wie oft hab ich euch schon gesagt, dass ich die Leich‘ genauso vorfinden will, wie sie aufgefunden worden ist!“
Mit hochrotem Kopf polterte der Leiter der Rechtsmedizin an der Uni Salzburg, Mag. Dr. Herbert Fuhrmann, zu seinen beiden Assistenten, die schon eine halbe Stunde vor ihm an der Fundstelle der Leiche eingetroffen waren. Sie hatten sofort die nötigen Gerätschaften aufgebaut, den faltbaren Wetterschutz darüber gestellt, und gerade eben vorsichtig den Schnee vom Körper des Toten entfernt. Rund um Kopf und Oberkörper war der Schnee vom Blut rot gefärbt, und auch am schwarzen Felsen daneben hatte die Spurensicherung vom LKA unter dem Neuschnee viel Blut gefunden, das jetzt sichtbar war.
Nun war ihr Chef eingetroffen, war wie üblich schlechtester Laune und hatte sie direkt zusammengeschissen. Dabei hatten sie gar nichts verändert, was bei der ersten Inaugenscheinnahme von Bedeutung sein konnte: Die Spurensicherung hatte alles bereits aufgenommen, was an möglichen und unmöglichen Spuren oder Hinweisen direkt rund um die Leiche vorhanden gewesen war und war nun schon mit dem Gelände drumherum beschäftigt. Jetzt waren die Rechtsmediziner dran, den Toten zu untersuchen, um etwas zur Todesursache sagen zu können.
Weil sie ihren meist unleidlichen Chef kannten, hatten sie es tunlichst vermieden, etwas zu verändern. Nur eben den Schnee hatten sie vorbereitend schon einmal beiseite geräumt: Umso schneller würde die Untersuchung vonstattengehen können, und sie wären alle vielleicht etwas früher wieder zu Haus. Aber auch das war diesmal nicht richtig gewesen – sie hätten es sich eigentlich aus Erfahrung denken können. Außerdem: Seine Frau hatte ihn vor einer knappen Woche vor die Tür gesetzt, nachdem sie erfahren hatte, dass er eine Dienstreise nach Linz um einen Abend mit einer neuen Doktorandin „erweitert“ hatte. Seitdem war er überhaupt nicht mehr zu ertragen. Er schimpfte lauthals vor sich hin, als er sich nun über den liegenden Körper beugte.
Manner hatte nur knapp 20 Minuten bis zum Parkplatz gebraucht. Ein uniformierter Kollege hatte ihm den Weg gezeigt, und nun traf er etwas außer Atem am Fundort ein. Auf dem Weg durch den winterlichen Wald hatte das fremde Gefühl nachgelassen, bis es schließlich ganz verschwunden war. Sicher nur der Ärger, dass sein sorgsam geplanter Samstag wieder einmal anders ablief als ihm lieb war, dachte er. Und das Fett von der Mayo auf mehr oder weniger nüchternen Magen – dass er es aber auch nicht sein lassen konnte, davon zu „probieren“! Bei der Erinnerung daran leckte er sich über die Lippen, und augenblicklich meinte er, den würzigen Duft von heißen, dampfenden Frankfurtern zu riechen.
Als er Fuhrmann schon von weitem herumschimpfen hörte, hatte er den kleinen Zwischenfall schon vergessen. Er blieb kurz stehen, verdrehte ein wenig die Augen, und beschloss, sein übliches Spielchen mit dem Rechtsmediziner zu spielen.
„Einen schönen guten Tag wünsch ich, Herr Doktor, habe die Ehre!“, rief er betont fröhlich, als er nähertrat. Er wusste, was nun als Nächstes passieren würde; und genau so kam es auch.
„Halt! Bleiben S‘ ja dort stehen, Sie trampeln ja alle Hinweise kaputt, Sie geistiges Nackerpatzl[Fußnote 1]!“ Fuhrmann blickte noch nicht einmal richtig auf, sondern befasste sich weiter mit seiner Leiche.
Manner grinste.
„Ich freu mich auch sehr, Sie zu sehen, Herr Doktor. Wie geht’s der Gemahlin? Ich hoff, alles geschmeidig?“
Fuhrmann fuhr blitzartig herum, richtete sich ruckartig zu seiner vollen Größe von 171 cm auf und funkelte Manner böse an. Der blinzelte nur freundlich und offenbar ahnungslos zurück – was er natürlich in Wirklichkeit nicht war: Moritz, einer der beiden Assistenten, traf er immer wieder einmal am Stand der Würstelkönigin am Ferdinand-Hanusch-Platz. Und da hatte der ihm, bei einer Waldviertler Wurst und einem Stiegl, brühwarm und mit breitestem Feixen, die Geschichte von des Magisters familiärem Rauswurf erzählt.
„Ah! Sie wieder!“
„Genau – ich wieder. Und, gibt’s schon Erkenntnisse?“
„Sie werden es nicht glauben, Herr Kommissar, auch entgegen anderslautender Gerüchte können wir nicht hexen! Ich bin grad kurz vor Ihnen angekommen – also lassen S’ mir und meinen Mitarbeitern gefälligst noch Zeit für meine Begutachtung, wenn’s nicht zu viel verlangt ist!“ Noch ein giftiger Blick, dann drehte sich Fuhrmann wieder seiner Arbeit zu.
Assistent Moritz hatte bei dem Dialog aufgeschaut und freute sich sichtlich über den Erfolg seines Loyalitätsverrats. Verstohlen winkte er Manner zu, was von seinem Chef bemerkt wurde und ein fragendes Stirnrunzeln hervorrief.
Manner drehte sich zufrieden zu seinen Kollegen von der Polizeiinspektion, die ein wenig abseits standen.
„Servus, Kollegen, was habts ihr denn für mich?“, fragte er, nachdem er sie mit Handschlag begrüßt hatte. Der Revierinspektor setzte ihn ins Bild, beschrieb ihm, was sie bisher in Erfahrung gebracht hatten.
„Also, gefunden wurde die Person von einer Gruppe Wanderern. Eine Frau musste pieselnund fand dabei den Toten.“
„Ist’s sicher, dass es sich bei der Leich‘ um einen Mann handelt?“
„Ja, ganz eindeutig – wenn auch von seinem Gesicht nicht mehr allzu viel zu erkennen ist. Die Frau hat gesagt, dass Raben an ihm herumgepickt haben, als sie ihn fand. Wir vermuten mal, dass er den Hang heruntergestürzt und dann auf dem Felsen aufgeschlagen ist. Er hat wohl auch ‘ne Menge Blut gespuckt – es ist überall auf seiner Kleidung. Richtige Fußspuren haben wir nicht gefunden, aber es hat ja die Nacht auch arg geschneit. Nur so ein paar merkwürdige, rundliche Tapser waren drumherum noch grad zu erkennen. Aber das sah irgendwie mehr nach einem Tier aus. Papiere hat er nicht dabei.“
„So“, sagte Manner. „Sonst noch irgendwas? Von den Wanderern vielleicht?“
„Hallo zusammen!“, ertönte es hinter ihm: Christian war eingetroffen.
„Servus, Chris – hast schon den Fundort angeschaut?“ Möckel schüttelte den Kopf.
„Dann komm mal mit. Oder – war doch noch was?“ wandte er sich den Polizisten wieder zu. Die schüttelten ihre Köpfe.
„Tut mir leid, dass ich dich aus deiner Freizeit holen musste.“ Manner lächelte etwas gequält.
„Ich hab dich auch lieb! Ach was, das kennen wir doch schon – so was geschieht halt immer dann, wenn’s einem am wenigsten passt.“
Christian blieb kurz stehen, hielt ihn zurück.
„Nein, wirklich! Du musst auf dich aufpassen. Hast du mir doch schließlich selbst gesagt!“
Manner grinste schief, erwiderte aber nichts. Sie blieben am Rand des Wetterschutzzeltes stehen und sahen sich an, was dort gefunden worden war.
„Na, Herr Doktor, gibt’s schon etwas Neues? Können wir jetzt mal einen Blick drauf werfen?“
Der Rechtsmediziner hatte gerade seine Einmalhandschuhe abgestreift und sie mit Nachdruck in einen Müllbeutel geworfen, der an einem Haken des Zeltes aufgehängt war. Er sah den Kommissar nachdenklich und sehr ernst an. Normalerweise war Fuhrmann immer sehr zynisch und machte am Fundort einer Leiche gern bissige Bemerkungen über die Kieberer,[Fußnote 2] die Politik und darüber, was er über den Wert der Gesellschaft im Allgemeinen so dachte. Diesmal jedoch wirkte er betroffen, und war ungewöhnlich ruhig.
„Servus, Herr Oberleutnant“, grüßte er Christian, „das hier ist nichts, was man als mitfühlender Mensch gern erleben möchte. Also: Der Tote ist etwa zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre alt, circa einen Meter fünfundsechzig groß, ca. siebzig Kilo schwer. Seine Verletzungen sind mit großer Wahrscheinlichkeit durch einen sehr heftigen oder ausgiebig dauernden Sturz den Abhang hinunter verursacht. So wie es aussieht, hat er sich dabei den rechten Arm gebrochen und wohl auch ein paar Rippen; eine oder mehrere haben dann beim Sturz höchstwahrscheinlich seine Lunge perforiert: Das Blut im Mund könnte davon stammen, das kann ich aber erst in der Klinik genau feststellen. Genauso gut kann es auch von den Gesichtsverletzungen stammen – die sind nämlich außerordentlich schwer und haben viel Gewebe aufgerissen. Sehr blutig.“ Er machte eine Pause.
Manner wollte schon nach der Todesursache fragen, aber irgendwas am Verhalten des Arztes hielt ihn davon ab. Er erinnerte sich an sein Gefühl, als er hierher unterwegs war.
„Mindestens ein Halswirbel ist gebrochen, möglicherweise die Todesursache; aber wie gesagt: Genaueres erst nach der Obduktion. Todeszeitpunkt gestern Abend so etwa zwischen 20 und 0 Uhr.“ Wieder eine Pause. „Und dann ist da noch etwas: Mit großer Wahrscheinlichkeit hat der Mann das Down-Syndrom.“
Manner blickte erstaunt auf.
„Was? Wie kommen Sie denn darauf?“
Fuhrmann kniete sich neben den Toten, hob eine Hand und drehte sie so, dass man die Handfläche sah.
„Sehen Sie, wie kurz und dick die Finger sind? Ganz typisch. Aber noch viel typischer ist die so genannte Vierfingerfurche, eine durchgezogene Linie in der Handfläche. Auch die Kopfform – soweit man das bei den Verletzungen noch erkennen kann – ist typisch: klein und mit flachem Hinterkopf. Und, seine Zunge ist stark gefurcht und groß. Alles zusammen schon ziemlich eindeutig. Aber, wie gesagt, später mehr.“
Christian räusperte sich.
„Aber wenn es tatsächlich ein Downie ist, …“
Manner war mit seinen Gedanken gerade bei seinem seltsamen Gefühl auf der Anfahrt hierher gewesen und hatte nicht richtig zugehört.
„Ein was? Ein Brownie?“
„Ein Downie – sagt man so. So, wie man früher von Mongoloiden oder Mongis gesprochen hat.“
„Nein, sagt man nicht“, unterbrach ihn Fuhrmann barsch. „Wenn überhaupt, spricht man von Menschen mit Down-Syndrom oder Trisomie 21 – weder ,Downie‘ noch ,Mongi‘ wird mehr benutzt. Die Betroffenen reagieren mit Recht empfindlich auf solche verniedlichenden Bezeichnungen. Oder würden Sie gern so genannt werden, wenn Sie betroffen wären? – Sehen Sie!“
Möckel errötete und nickte zustimmend.
„Sie haben natürlich völlig recht, Entschuldigung. Also, wenn’s ein Behinderter mit Down-Syndrom ist – wieso ist er dann hier allein im Wald? Wo ist oder war seine Betreuungsperson?“
Der Arzt schaute ihn nachdenklich an.
„Ja, nicht? Genau das hab ich mich auch gefragt!“
Manner hatte sich neben die Leiche gekniet, und versuchte, im zerschmetterten Gesicht etwas zu erkennen. Die blonden Haare, das noch junge, von unzähligen Kratzern, Schnitt – und Platzwunden verunstaltete, rundliche Gesicht. Das viele Blut. Was war hier geschehen? War es wirklich ein Mongoloide… nein, wie hieß das jetzt richtig? Mensch mit Down-Syndrom? Und wenn: Warum war dieser arme Behinderte hier so zu Tode gekommen? Warum war er allein im Wald gewesen? Warum war kein Betreuer da? War es das, was er gespürt hatte, als er hierher unterwegs war?
Er sah sich um, nahm die Szenerie in sich auf, und versuchte sich vorzustellen, wie es gewesen sein konnte. Sein Blick wanderte vom Fundort den Hügel hinauf, folgte von dort der blutigen Spur bis zu der zerschmetterten Leiche. Er schloss die Augen, und stellte sich den Sturz vor: Der fallende, sich immer wieder überschlagende Körper, der haltlos gegen Bäume und Felsen schlägt. Sieht, wie der Schnee aufgewirbelt wird, hört die Geräusche brechender Knochen, spürt Haut zerreißen. Sieht, wie der Körper eine rote Spur hinter sich herzieht, den Abhang hinunter – und wie das Leben aus ihm entweicht, als er hier, an dem schwarzen Felsen, tödlich verletzt liegen bleibt.
Plötzlich hat er ein starkes Déjà-vu: Er spürt Angst in sich aufsteigen, heiße, intensive Angst. Eine blutrote Spur im Schnee, einen Abhang hinunter… das hat er doch schon mal erlebt! Genau das! Kurz hat er das Gefühl sein Gleichgewicht zu verlieren, dann hat er sich wieder gefangen. Er schüttelt den Kopf: War das nur Einbildung oder tatsächlich Erinnerung?
„Und warum ist da so viel Blut an seinen Augen?“„Das linke ist völlig zerstört, so, als ob da etwas hineingestoßen hätte. Vielleicht ein Ast. Und das rechte fehlt ganz.“
„Wie?“
„Das rechte Auge fehlt“, wiederholte Fuhrmann. Seine Stimme war leiser geworden, traurig und resigniert angesichts der schlimmen Überlegungen, was wohl geschehen war. „Gut möglich, dass die Raben es gefressen haben: Die fressen vom Aas immer zuerst die weichsten Teile.“
„Die Raben? Welche Raben?“, fragte Möckel und Manner klärte ihn über die Aussage der Wanderin auf.
Nachdem er sich etwas gesammelt hatte, versuchte er, etwas zu erkennen – aber da war nur geronnenes Blut.
„Oder kann das mit dem anderen beim Sturz passiert sein?“
Der Arzt zuckte die Schultern.
„Keine Ahnung, das muss ich mir genauer ansehen, um mehr dazu sagen zu können. Warten S‘ meinen Obduktionsbericht ab, ja?“
Manner richtete sich wieder auf.
„Nun gut, wir werden herausbekommen, was dahintersteckt. Dr. Fuhrmann, wann wissen S’ mehr?“
Fuhrmann packte bereits seine Sachen zusammen. Ein Assistent beschäftigte sich mit den soeben eingetroffenen Bestattern, die den Leichnam ins Klinikum transportieren sollten.
„Ich denk, spätestens Montag gegen Mittag haben S’ das Ergebnis.“ Dann hielt er inne und schaute auf. „Nein. Ich werd schon morgen mit der Obduktion beginnen. Irgendjemand wartet ganz bestimmt schon dringend auf Nachricht über ihn.“ Er stockte – so, als ob er noch etwas Ergänzendes sagen wollte. Manner schaute den sonst so schroffen und ablehnenden Arzt fragend an; aber Fuhrmann wandte sich mit zusammengepressten Lippen ab, schloss seine Tasche und verließ grußlos den Fundort, stapfte Richtung Waldweg durch den Schnee.
Manner fragte die wartenden Kollegen der Inspektion, ob sie von einer aktuellen Vermisstenanzeige wüssten. Veit zuckte mit den Schultern und schüttelte den Kopf, sah seine Kollegin fragend an.
„Nicht, dass ich wüsste – aber ich frag gleich mal nach, ja?“
Sie ging ein paar Schritte beiseite, und sprach leise in ihr Sprechfunkgerät. Kurz darauf war sie zurück.
„Nein, nichts Neues, alles nur die Sachen, die schon seit Wochen akut sind.“
Er dankte ihr, und ging noch einmal zu den Kollegen der Spurensicherung, schaute dabei zu, wie sie vorsichtig versuchten, Schneeschichten von möglichen Spuren zu entfernen.
„Und – wie schaut’s aus? Habt‘s irgendwas gefunden?“
„Nichts Konkretes, der Neuschnee letzte Nacht hat alles zugedeckt. Wir versuchen‘s zwar, aber es dauert halt. Sollen wir dich direkt anrufen, wenn wir was finden?“
Er kannte den älteren Kollegen schon seit vielen Jahren und wusste, dass er sich auf seine Arbeit verlassen konnte: Wenn es etwas gab, dann würde der es auch finden.
„Ja, machst des bitte.“
Er grüßte und ging zurück zu Christian, der bei den beiden Polizisten stand und sich leise unterhielt.
⁓
Eigentlich hatte er sich ja wirklich vorgenommen, dieses Wochenende nur für sich zu nutzen. Nur das zu machen, was ihm guttat. Und jetzt war er doch wieder mitten in der Arbeit, mitten im nächsten Fall. Dabei hatte er nicht vergessen, was ihm die Psychologin am Ende der Reha mit auf den Weg gegeben hatte.
„Wenn Sie nicht endlich anfangen auf sich zu schauen, wenn Sie weiterhin Ihre wirklichen, tiefen Bedürfnisse hinten anstellen: Dann bin ich mir sicher, dass es nicht bei einem Burnout bleiben wird!“
Er war damals sehr erschrocken. Was sie denn damit sagen wolle, fragte er.
„Bisher haben Sie irgendeinen Teil Ihres Lebens verdrängt, aus irgendeinem Grund Ihre wahren Gefühle dazu unterdrückt. Haben unbewusst immer Ihre Arbeit in den Vordergrund gestellt, waren wie besessen, wie getrieben; und sind dabei – offensichtlich unbewusst – der Beschäftigung mit sich selbst und Ihrer Vergangenheit aus dem Weg gegangen. Die Seele macht so etwas, um sich zu schützen: Wenn man es nicht ertragen würde, die Wahrheit zu erfahren. Sie haben mir erzählt, dass Sie, solange Sie sich zurückerinnern können, immer als Grundstimmung ein Gefühl von Anspannung in sich hatten, sogar schon als Kind. So, als würden Sie auf etwas warten, eine Gefahr, eine Bedrohung – ohne zu wissen, was oder warum. Und dass diese Anspannung immer da ist – Sie spüren es ja sogar als harten Knoten in ihrem Solarplexus.“
Eigentlich hatte er immer wieder vermutet, dass es vielleicht doch eine organische Erkrankung sei. Aber – wenn es nun tatsächlich so wäre, wie sie sagte? Verstohlen rieb er über sein Brustbein.
„Ich bin mir sicher, dass etwas in Ihrem Unterbewusstsein arbeitet; etwas, dass Sie Ihr Leben lang im Zaum haben halten können. Es unterdrückt haben, mit aller psychischen und auch physischen Kraft – allerdings ohne, dass Sie sich dessen bewusst waren. Das ging solange gut, solange Sie genügend Energie dazu hatten. Erst jetzt, als Sie älter wurden, als die Belastungen immer größer wurden – der Verlust der Sicherheit durch die Trennung von Ihrer Frau, das Unstete in Ihrem Privatleben, die übermäßige Belastung durch die Arbeit, die Sie auf sich nahmen – reichte Ihre Kraft dafür schließlich nicht mehr aus. Und das, was da jahrzehntelang in Ihnen schlummerte, hat sich auf den Weg gemacht; nach oben, ans Licht sozusagen. Um endlich die Beachtung zu bekommen, die es braucht. Die Sie brauchen!“
Sie machte eine Pause, um ihre Worte auf ihn wirken zu lassen.
„Was Sie da alles verdrängen, kann ich Ihnen nicht sagen; vielleicht etwas sehr Schlimmes und Schmerzhaftes. Um das herauszufinden, müssen Sie tiefer in die Therapie einsteigen, hier hatten wir nicht genügend Zeit dafür.“
Manner sah ihr an, dass dies etwas war, was sie an ihrem Job in einer Reha-Klinik wirklich störte, aber das sie als unabänderlich hingenommen hatte.
„Wissen S’, ich hab wieder und wieder die Erfahrung gemacht, dass Menschen wie Sie immer jemand retten wollen – als Ersatz für einen Menschen, den sie nicht haben retten können. Vielleicht ja auch Sie?“ Sie sah ihn fragend an.
Ihm wurde unter ihrem Blick unwohl, er fühlte sich unsicher. Als ob sie ihn bei etwas ertappt hätte – nur wusste er nicht wobei.
„Sie sollten sich meiner Meinung einen passenden Therapeuten oder eine Therapeutin suchen und damit weitermachen: herauszufinden, was ihr unterdrücktes Thema ist. Wenn Sie es nicht tief in sich bereits wissen.“
Und wenn nicht, hatte er gefragt.
„Wenn nicht, dann bin ich mir sicher, dass Sie irgendwann depressiv werden; und das wird sicher gar nicht lange auf sich warten lassen. Und, das kann ich Ihnen sagen: Wenn das passiert – dann ist das wirklich kein Spaß! Das ist nicht so wie manchmal schlechte Laune zu haben oder mies drauf zu sein: Dann verändert sich Ihr Leben völlig! Und Ihre Arbeit: Die können Sie dann vergessen.“
Ihre Augen waren dabei schmal geworden, ihr Blick besorgt.
„Und, auch heute ist es noch so, dass sich sehr viele Menschen – und ganz besonders Männer – wegen einer Depression das Leben nehmen. Also: Nehmen Sie dies hier ernst! Wirklich! Es war ein erster, aber schwerer Warnschuss: Noch haben Sie Zeit. Das, was Sie verdrängen, will und muss nach oben kommen. Darf nach oben kommen!“ Dann hatte sie ihm viel Glück gewünscht, eine Liste mit Therapeuten im Salzburger Land in die Hand gedrückt, und er war wieder nach Haus gefahren.
In der Arbeit hatte er Christian etwas mehr ins Vertrauen gezogen, aber ihre Diagnose für sich behalten; die anderen mussten nun wirklich nicht erfahren, dass er einen seelischen Knacks hatte. Wenn sich das herumspräche – nicht auszudenken: ein Psycho im LKA, das fehlte gerade noch! Aber, er war aufmerksam geworden. Auf sich. Nur, so richtig hatte er noch nicht damit angefangen, was sie ihm geraten hatte: Die Liste hing in seiner Küche am Kühlschrank, wo er sie seit Monaten täglich in seiner gedanklichen Prioritätenliste nach hinten schob.
⁓
Es war nun schon ziemlich dunkel geworden, und Manner schaute auf das sich ihm bietende, etwas surreale Bild: Im Licht der aufgestellten Scheinwerfer glitzerten die Abertausenden Schneekristalle und erzeugten damit einen märchenhaften Winterzauber – in der die grausame Realität des blutigen, zerstörten menschlichen Körpers schrecklich und brutal herausstach. Die Spurensicherung würde sicher noch ein paar Stunden in Anspruch nehmen, Möckel und er konnten nun nichts mehr ausrichten. Er schaute auf die Uhr: kurz nach fünf. Er würde es gerade noch rechtzeitig bis zum Anpfiff des Spiels nach Haus schaffen.
Aber irgendwie konnte ihn die Aussicht auf sein kaltes Bier mit Würstel und Mayonnaise nicht wirklich erfreuen.
„Frau Schmitz?“ Es klopfte leise.
Sabine schaute vom Schreibtisch auf: Ihr Chef, der Bereichsleiter Wohnen stand an der offenen Bürotür. Sie hatte gar nicht gehört, dass die Haustür geöffnet worden war – so vertieft war sie in ihre Dienstplanung.
„Ach, Herr Schering, ich hab Sie gar nicht gehört! Kommen Sie rein!“ Sie stand auf und streckte ihm über den Schreibtisch ihre Hand entgegen. Herr Schering stand bereits mitten im Büro, drückte ihr die Hand und setzte sich dann auf einen der beiden Besucherstühle, die am Besprechungstisch standen. Bernd Schering war ein großer, schlanker Mann um die vierzig, mit sehr kurz geschorenen, schon grauen Haaren, und meistens einem freundlichen, energischen Gesichts-Ausdruck. Jetzt aber sah er besorgt aus, als er ohne Smalltalk direkt zum Wesentlichen kam.
„Frau Schmitz, Frau Martínez hat mich angerufen und mir gesagt, dass sie nicht weiß, wo der Paul ist. Ist Sebastian mittlerweile wieder aufgetaucht? Der ist nämlich auch nirgends zu finden. Die zwei hängen doch immer zusammen!“
Sabine lehnte sich zurück und antwortete erstaunt: „Ich denk‘, der ist im Vertrauen? Max hat mir bei der Dienstübergabe gesagt, dass er bei Sandrine übernachtet hat. Das machen die beiden ja öfter!“
Herr Schering grinste ein wenig gequält. „Ja, ich weiß: Hab ja erst vor einer Woche den Reparaturauftrag für ihr Bett bei der Haustechnik genehmigt. Sie waren wohl etwas stürmisch, die beiden. Und es war auch nicht zum ersten Mal zusammengebrochen, hab ich dann auch bei der Gelegenheit vom Hausmeister erfahren!“
Sabine lachte laut auf, strahlte übers ganze Gesicht. Ja, die beiden hatten sich wirklich gesucht und gefunden – in jeder Beziehung! Bei der letzten „Bettendemontage“ hatte sie die beiden ins Gebet genommen, etwas vorsichtiger mit dem Mobiliar der Einrichtung umzugehen; und hatte dabei erstaunliche Details erfahren, die ihr die zwei da in voller unschuldiger, ahnungsloser Offenheit erzählt hatten. Insgeheim hatte sie Sandrine beneidet: So etwas fehlte ihr auch!
„Aber jetzt ist nur Sandrine da, ich hab grad angerufen und mit Herrn Schmidt gesprochen – Sebastian ist nicht da, ich wollte ihn fragen, ob er vielleicht was von Paul weiß.“
Das Telefon klingelte, und sie hob ab:
„Schmitz, Fülle?“ Sie lauschte. „Augenblick.“ Sie reichte den Hörer weiter. „Es ist Mona, Frau Martínez.“
„Schering?“ Er hörte aufmerksam zu. „Was?“ Er richtete sich alarmiert auf. „Und das wussten Sie nicht?“
Sabine hörte, dass Mona ganz schnell und offenbar aufgeregt antwortete – da musste etwas nicht stimmen.
„Also, darüber reden wir später. Jetzt ist erst mal wichtig, herauszufinden, wo er ist.“ Schering überlegte kurz. „Bitte rufen Sie jeden an, der etwas wissen könnte. Halt – aber keinesfalls den Betreuer! Das übernehme ich dann, wenn nötig. Und melden Sie sich sofort, wenn es etwas Neues gibt, okay? – Gut.“
Er atmete tief durch.
„Und bitte – regen Sie sich nicht auf. Wird sich schon alles klären!“ Er legte auf.
Sabine beugte sich vor: „Was ist denn passiert?“
Schering lehnte sich zurück und machte ein nachdenkliches Gesicht.
„Paul war anscheinend die ganze Nacht nicht im Haus: Nach dem Abendbrot hat er Bescheid gesagt, dass er noch eine Runde im Dorf drehen wolle, steht auch so in der Übergabe von 20 Uhr. Die Nachtbereitschaft hat dann den Abend vor dem Fernseher verbracht und nicht mehr weiter dran gedacht. Offenbar hat sie auch keinen abendlichen Hausrundgang mehr gemacht, weil sie vor dem Fernseher die Zeit einfach vergessen hat und dachte, sie wolle die Bewohner so spät nicht unnötig wecken, ist dann gegen 0:30 Uhr selbst ins Bett. Und da Paul oft morgens schon in aller Frühe das Haus verlässt, um vor dem Frühstück nach den Kühen auf dem Hof zu schauen, hat sie sich auch nicht gewundert, als er beim Wecken nicht da war und sein Bett anscheinend schon gemacht war. Beim Frühstück hat sie ihn dann zwar vermisst, aber da hat sie sich noch immer nichts dabei gedacht. Erst als Mona dann heut vormittags zum Dienst kam und ins Übergabebuch geschaut hat und das da drinstand, hat sie sich bei Ihnen und mir gemeldet. Ja, wozu zum Kuckuck haben wir eigentlich immer wieder unsere Teamgespräche und die vielen Fortbildungen, erklären immer wieder die notwendigen Abläufe – wenn dann doch jeder macht, was er will, und nicht, was er soll? Herr Färber setzt größte Hoffnungen auf unser neues Konzept; aber das funktioniert nur, wenn alle auch wirklich mitmachen!“
Bei den letzten Worten war er laut geworden, und sein Gesicht drückte einen ziemlichen Ärger aus. Er wusste genau, dass er beim Bereichsleiterfrühstück am kommenden Montag von Herrn Färber, dem Geschäftsführer, nach dem Stand der konsequenten Einführung des neuen Wohnkonzeptes gefragt werden würde. Und wenn er ihm von diesem Zwischenfall berichtete, von einem der gefürchteten fragenden Blicke seines Chefs getroffen würde, der durch eine hochgezogene Augenbraue noch unterstrichen wurde. Herr Färber würde sich zurücklehnen, mit dem Stift in der Hand ein, zwei Mal auf seinen Block tippen und sich dann ein paar Notizen machen – bevor er zum nächsten Punkt übergehen würde.
So kannte Sabine ihren Bereichsleiter gar nicht – er war sonst immer ein sehr besonnener, zugewandter Mensch; meistens sehr ruhig und sachlich, konnte hervorragend und sehr empathisch mit den Betreuten umgehen. Und man spürte eigentlich immer, wie sehr ihm das Wohl der Menschen am Herzen lag.
„Ja, und Sebastian? Was ist denn mit dem?“ Sie war plötzlich sehr nervös.
Schering sah sie gereizt an.
„Keine Ahnung. Wieso wissen Sie das eigentlich nicht?“
Sabine antwortete nicht, griff zum Telefon und tippte die Nummer vom Haus Vertrauen ein.
„Ja, hallo Jürgen, hier ist Sabine. Sag mal, ich denk, der Sebastian ist bei Sandrine?“ Sie lauschte. „Und wann etwa?“ Pause. „Ja, okay! Ne, passt schon. Danke, Jürgen!“ Sie legte auf, war etwas blass geworden.
„Und?“, fragte Schering.
Sabine sah ihn an – ihr war ganz komisch zumute.
„Also, da muss irgendwas gewesen sein: Jürgen sagt, die Neue habe aufgeschrieben, dass Sebastian, kurz nachdem er Sandrine abgeliefert hat, sich wieder verabschiedete; er wolle angeblich nach Haus, also hierhin kommen.“
„Ja, und wann war er dann hier?“
„Scheinbar gar nicht – sonst hätte Max mir doch was gesagt. Er wusste nur, dass Sebastian bei Sandrine übernachten wollte.“ Sie stand auf und ging zur Kaffeemaschine. „Wollen Sie auch einen? Mir ist ganz schlecht.“ Sie nahm die alten Pads heraus und legte ein Neues ein, stellte ihre Tasse in die Maschine und drückte den Startknopf.
„Nein, danke. Sagen Sie mal, ist so was schon mal gewesen?“ Ihr Chef schaute sie streng an.
„Also, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Er ist mal was später als vereinbart gekommen – und einmal sind wir ihn auch suchen gegangen. Da saß er dann beim Küchenschuppen, und kickte Kieselsteine gegen die Türe. War da wohl ziemlich geknickt oder so. Deprimiert. Haben wir aber dokumentiert.“ Sie nahm ihre Tasse, tat drei Stück Zucker hinein und setzte sich wieder. Das brauchte sie jetzt.
„Ja, ich erinnere mich. Solche Phasen hatte er immer schon mal, schon seit er hier ist. Kein Wunder bei seiner Vorgeschichte.“
Sabine schaute ihn an – da war er wieder, der empathische Mensch, dem die Schicksale seiner Bewohner so nah gingen.
„Ja, nicht? Furchtbar, so was.“
Eine Weile saßen beide schweigend da und versuchten, die Bilder in ihren Köpfen zu verdrängen. Sabine nippte an ihrem Kaffee. Susi fiel ihr wieder ein.
„Sagen Sie, die Susi ist in den letzten Tagen so komisch, ganz anders als sonst – so, als ob sie irgendwas bedrückt. Gab es irgendwas in der Bäckerei?“ Schering überlegte.
„Nicht, dass ich wüsste. Bei der letzten Besprechung mit den Werkstattleitern am Freitag ist nichts gesagt worden, das wüsste ich. Haben Sie sie schon darauf angesprochen?“
Sabine nickte.
„Klar, alle aus unserem Team haben versucht, etwas aus ihr rauszubekommen, aber vergeblich.“
„Ich kann’s ja mal versuchen, wenn ich sie treffe, okay? Manchmal redet sich’s außerhalb der Gruppe leichter. Das stellen wir doch immer wieder fest, oder?“
„Ja, machen Sie das bitte. Ich mach mir wirklich Gedanken um sie. Sie wissen ja, wie sie war, als sie damals zu uns kam. Nach den ganzen schrecklichen Vorgängen bei ihr zu Haus.“
„Also“, Schering stand auf, „wir machen erst mal nichts. Bitte versuchen Sie, Ihre Kollegen zu erreichen und etwas heraus zu finden. Ich rufe in allen Gruppen an, die sollen das Gleiche tun.“ Er gab Sabine die Hand.
„Wird sich sicher als was ganz Banales herausstellen. Wenn sich einer der beiden meldet, sagen Sie mir sofort Bescheid – ich bin weiterhin immer zu erreichen. Und wenn sich bis, sagen wir mal“, er blickte nachdenklich auf seine Armbanduhr, „sagen wir mal, 17:00 Uhr nichts getan hat – dann sehen wir weiter. Danke erstmal!“ Er lächelte ihr aufmunternd zu und machte sich auf, das Büro zu verlassen. In der Tür drehte er sich noch einmal um: „Ach, ich wollt doch eigentlich noch mit Ihnen über einen Neuzugang reden. Egal, verschieben wir auf später. Servus!“
Sabine setzte sich wieder auf ihren Stuhl, drehte sich zum Fenster und sah hinaus. Die Sonne war verschwunden, und der nun wolkenverhangene Himmel sah so aus, als würde es bald neuen Schnee geben.
„Hoffentlich ist wirklich nichts passiert!“, dachte sie.
Sonntag, 12. Dezember
Dritter Advent
Manner hatte gut geschlafen, war einigermaßen zeitig aufgestanden, hatte sich nach dem Duschen einen großen Becher Kaffee gemacht und war damit noch einmal zurück ins Bett. Hatte sein Handy eingeschaltet und Tina einen Guten-Morgen-Gruß gesendet. Sie hat noch nicht geantwortet – wahrscheinlich war sie gestern lange unterwegs gewesen. Sie arbeitete im Wellnessbereich eines Sterne-Hotels am Chiemsee und das oft bis spätabends. Ihre Wohnung hatte sie in Salzburg, aber da war sie nur am Wochenende – unter der Woche hatte sie in der Hotelanlage ein kleines Zimmer, die Fahrerei war ihr einfach zu viel. Sie hatte schon einmal überlegt, dorthin zu ziehen, es gefiel ihr in der oberbayerischen Seenlandschaft recht gut – aber dann hatten Konstantin und sie sich kennen gelernt. Sie telefonierten oft miteinander, sahen sich normaler Weise nur am Wochenende. Meistens waren sie dann bei ihm. Da er aber für den gestrigen Abend fußballmäßig ausgebucht war, wollte sie nach ihrem Feierabend noch mit einer Freundin in einen Klub am Rudolfskai. Sie würde sich schon melden, wenn sie wieder ansprechbar wäre.
Schalke hatte gestern Abend tatsächlich verloren, ManU hatte die Schalker regelrecht vorgeführt. Und trotz des Ereignisses am Untersberg war es ihm gelungen, sich für das Spiel zu begeistern: So hatte er sich das vorgestellt!
Danach hatte er noch eine Runde um den Block gedreht, um etwas runterzukommen. Hatte dabei noch eine Virginia geraucht und war dann für seine Verhältnisse früh im Bett verschwunden.
Zum Frühstück hatte er sich die Reste der Mayonnaise, die von gestern Abend noch übriggeblieben war, zusammen mit zwei gekochten Eiern und zwei aufgetoasteten Semmeln gegönnt, kämpfte nun mit seinem Magen und ständigem Aufstoßen und überlegte, wie er den freien Tag nutzen wollte.
Christian hatte ihm gesagt, dass er zu Hause bleiben solle – er würde die ersten Schritte in der Ermittlung einleiten, die bereits bekannten Fakten aufbereiten, die Ergebnisse der Spurensicherung würden sicher auch noch am Vormittag eintreffen; und wenn das Ergebnis der Autopsie doch schon am Sonntag vorläge, würde er sich bei ihm melden. Und, o Wunder – es war ihm tatsächlich geglückt, sein Angebot anzunehmen, ohne sich weiter einen Kopf zu machen!
Er schaute aus dem Fenster: Vom Küchentisch aus sah er am verschneiten Untersberg vorbei Richtung Tennengebirge. Der Himmel sah nach noch mehr Schnee aus und die Prognose für die nächste Woche sagte, dass eine Kaltfront aus Skandinavien unterwegs in den Süden war – wahrscheinlich würde der Schnee liegenbleiben. Sollten sie heuer tatsächlich weiße Weihnacht erleben? Das wäre ja einmal wirklich so ganz nach dem Geschmack einer Romantikerin, wie Tina eine war. Sie würde mit zu seinen Eltern fahren: Sie hatte sie erst einmal kennengelernt, und es war gleich ein gutes, vertrauensvolles Gespräch mit ihnen entstanden. Als sie sich verabschiedeten, hatten sie Tina herzlich umarmt und verabschiedet – nicht nur so das übliche „Baba“.
Tina hatte es bei ihnen auch gefallen: Sie hatte ihre Mutter schon früh, noch als Kind, verloren; und ihr Vater war vor vier Jahren gestorben. Geschwister hatte sie keine, so wie er; und Manner wusste, wie gern Tina wieder eine Familie hätte. Nun, man würde sehen. Wenn etwas richtig war, dann würde es auch geschehen; und wenn nicht, dann war es auch noch nicht das Richtige.
⁓
Nach seiner Scheidung vor über zwei Jahren hatte er zuerst ein gutes Jahr in einer kleinen möblierten Ein-Zimmer-Wohnung am Mönchsberg gewohnt und versucht, sein Leben irgendwie wieder in den Griff zu bekommen; nach Grödig war er erst später gezogen. Ihm war damals schon klar, dass seine Arbeit und sein Umgang damit, seine Getriebenheit, Verbrechen aufzuklären, letztendlich der Grund war, weshalb ihn seine Frau verlassen hatte. Neunzehn Jahre lang waren sie zusammen gewesen, fast fünfzehn davon verheiratet. Kinder hatten sie nicht: Ihre Berufe – sie war mit Leib und Seele Ärztin in einer Klinik – standen immer im Vordergrund, eigene Kinder hatten da keinen Platz. Vielleicht später, hatten sie sich ohne große Überzeugung gesagt, wenn ihre Gespräche doch einmal auf das Thema kamen. Als sie dann mit Anfang vierzig ihre biologische Uhr ticken hörte, ihre Einstellung änderte und plötzlich doch Nachwuchs wollte, hatte er es nicht geschafft, seine Arbeit etwas mehr zugunsten seines Privatlebens zurückzustellen.
Nein, das stimmte nicht, wenn er ehrlich zu sich war: Er hatte es nicht gewollt, sein Leben umzustellen – und die Verantwortung für ein Kind zu übernehmen.
Ein paar Jahre lang hatte sie versucht, ihn umzustimmen, hatte seine Vertröstungen hingenommen – und dann die Konsequenzen gezogen.
Wie gesagt: Es war ihm schon klar, warum. Aber, zu hinterfragen, ob es einen Grund dafür gäbe, dass er sein Leben immer wieder der Arbeit zuliebe hintanstellte: Darauf wäre er nie gekommen.
Dann war sie weg und die plötzliche Einsamkeit und der unerwartete Verlust der Sicherheit eines Lebens in einigermaßen geordneten Bahnen stürzte in voller Wucht auf ihn ein. Um nicht zu viel davon wahrzunehmen, hatte er sich wie ein Besessener erst recht in die Arbeit gestürzt. Hatte alles nur irgendwie Mögliche getan und unternommen, um sich nicht mit sich selbst, dem Scheitern seiner Ehe und der Ungewissheit, wie es mit seinem Leben nun weitergehen sollte, befassen zu müssen. War immer tiefer und tiefer in eine Abwärtsspirale von Selbstüberschätzung, Rastlosigkeit und Nicht-Nachgeben-Wollen geraten und hatte alles an sich gerissen, an Fällen und an Aufgaben.
Nach nicht einmal einem Jahr konnte er eines Morgens, blass, energielos und vor Unruhe und Nervosität nur noch ein fahriges Häufchen seines früheren Selbst, nicht mehr auf seinem Bürostuhl stillsitzen. Und als er dann noch beim Verhör eines besonders arroganten Dreckschweins die Fassung verlor, der zwei hilflose Rentner in ihrer Wohnung stundenlang gefoltert hatte, weil ihnen in ihrer Panik einfach nicht mehr einfiel, wo sie den Schlüssel für ihren Haustresor versteckt hatten, konnte er von Christian gerade noch so eben zurückgehalten werden, als er sich auf das erstaunt grinsende Stück Dreck werfen wollte, um ihm seine Zähne aus der widerlichen Fresse zu schlagen.
Daraufhin war er sofort von seinem Abteilungsleiter zum Betriebsarzt geschickt worden und der hatte ihn direkt wegen eines typischen Burnout-Syndroms aus dem Verkehr gezogen. Sein Chef hatte ihn dann dazu verdonnert, erst einmal in eine sechswöchige psychosomatische Reha zu gehen und anschließend endlich seinen Resturlaub von über vier Wochen auf einen Satz zu nehmen; vorher wolle er ihn nicht wiedersehen.
Er wurde als Notfall eingestuft und als Beamter bekam er schnell einen Platz in einer psychosomatischen Klinik in Bad Aussee. Packte seine Koffer und machte sich auf den Weg. Als er dort eingecheckt und die Aufnahme-Gespräche hinter sich hatte, ging er auf sein Zimmer, packte seinen Koffer aus, setzte sich auf sein Bett und sah aus dem Fenster auf die Berge. Er versuchte, etwas zu fühlen, etwas zu spüren. Irgendwas. Suchte nach etwas in sich drin, dass ihm sagen könnte, was eigentlich geschehen war. Was dazu geführt hatte, dass er jetzt hier war. Aber da war nur Leere. Und: Er war müde. Unendlich müde.
Er legte sich hin und schlief 17 Stunden in einem Stück durch. Danach war er zum ersten Mal seit vielen Monaten ausgeschlafen und fühlte wieder so etwas wie ein Quäntchen Energie in sich. Und dann – ging es los.
In den Gesprächen mit einer Therapeutin war er zum ersten Mal von einem Außenstehenden auf den Gedanken gebracht worden, dass er einem Verhaltensmuster folgte, das möglicherweise nicht seins war. Dass es dafür einen Grund gäbe, dass er alles seiner Arbeit unterordnete.
Und dass er, wenn er nicht achtgäbe, wahrscheinlich auf dem besten Wege wäre, das Wichtigste zu verlieren, was er in seinem Leben hatte: sich.
⁓
Gerade wollte er sein Radio einschalten, da meldete sich sein Telefon: Tina war dran, mit noch etwas verschlafener Stimme. Hörte sich so richtig gemütlich nach Bett und Kuscheln an. Was er denn heut so vorhätte. Und, ob es einen Plan gäbe.
Einen Plan! Eigentlich könnte sie mittlerweile schon wissen, dass er seine wenigen freien Tage niemals vorausplante. Das war wohl einer der wichtigen Punkte in ihrem Zusammensein, die sie noch klären mussten: Sie war ständig in Aktion, plante ihre Freizeit, „unternahm“ was. Einfach einmal nur die Zeit beim Verstreichen zu beobachten –also das war nicht ihres. Aber seins war’s!
Gerade wollte er ihr eine entsprechende Antwort geben, da klingelte sein Diensthandy: Christian war dran. Auch gut, ein Grundsatz-Gespräch wäre eh zu einer besseren Gelegenheit angebracht.
„Schatz, Christian ruft an, ich muss mal eben hören, was er will, Augenblick.“ Er legte den Hörer beiseite, und nahm das Smartphone ans andere Ohr.
„Servus, Chris – und, schon was Neues?“ Er hörte zu. „Na, das ging ja schnell. Okay, ich mach mich fertig und komm dann raus. Bis später.“
Er legte auf, und nahm den Hörer vom Telefon auf:
„Tina?“
„Jaaa, ich hab es schon mitgehört. Mal wieder die Arbeit, gell?“ Gut, dass sie jetzt sein Grinsen nicht sehen konnte.
„Ja, leider. Wir haben gestern am Untersberg einen Toten gefunden; und die Ergebnisse der Untersuchungen sind schneller da als gedacht. Da muss ich jetzt hin; wir müssen die Aufgaben verteilen und so weiter. Kennst du ja.“
Er schwieg.
Auch Tina schwieg eine Weile. Dann, im spitzen Ton:
„Na ja. Dann mach ich mir’s erst mal weiter im Bett gemütlich. Kannst dich ja melden, wenn du Zeit für mich übrig hast – vielleicht bin ich ja dann immer noch im Bett.“
Pause.
„Ich war übrigens gestern nach dem Dienst noch bei Kollegin Siggi…“
Bedeutungsvolles Schweigen.
„Siggi?“, fragte er, nachdem er erst einmal einen kleinen Moment brauchte, um seine Gedanken vom Untersberg herunter wieder zu ihr zurück zu holen.
„Die Siggi, die das Peeling und die Körperenthaarung macht?“
„Genau die.“
Manner schwieg.
„Und?“, fragte sie keck.
Er seufzte.
„Du musstest mir das noch sagen, nicht? Unbedingt, ja? Jetzt hab ich das den ganzen Tag im Kopf!“
Sie lachte.
„Ach, du hast da jetzt was im Kopf? Tatsächlich? Daran hatte ich gar nicht gedacht!“
Ein Pruster.
„Biest. Also, dann.“ Manner seufzte noch mal. „Ehrlich! Du bist manchmal so ein Mistst…“ Noch ein Lacher von ihr.
„Baba!“
Sie legte auf.
Da stand er nun, den Hörer in der Hand und Bilder im Kopf, die ziemlich aufregend waren. Er legte auf und drehte sich zum Glaseinsatz in seiner Wohnzimmertür, aus dem ihn wieder einmal und nicht wirklich unerwartet sein Spiegelbild vorwurfsvoll anschaute.
„Wirklich! Wirklich, wirklich, wirklich! Konstantin Blödmanner, du bist solch ein Vollpfosten!“
Als er in der Dienststelle ankam, saßen Christian und Anwärterin Mummenbrauer am Besprechungstisch und hatten Butterbrezen und Kaffee vor sich. An die Stellwände hinter ihnen waren Fotos vom Fundort gepinnt und ein paar beschriebene Zettel, und auf dem Tisch lagen ein paar Hefter.
„Servus Kollegen – na, dann machen wir uns mal wieder einen schönen Sonntag!“
Christian sah ihn mit langen Blicken an: Irgendwie schien er anderer Meinung zu sein. Nur die Neue, Dr. Eva Mummenbrauer aus Wien, machte einen energiegeladenen Eindruck. Obwohl noch nicht lange in der Abteilung, war sie schon mehrmals durch ihr scharfes, analytisches Denken und das Erkennen nicht so offensichtlicher Zusammenhänge aufgefallen. Der Chef der Abteilung Mordkommissariat, Rat Mag. iur. Peter Brammen, setzte große Hoffnung auf sie: Sie hatte Kriminologie und Psychologie studiert, im zweiten Fach promoviert. In Manners Gruppe sollte sie jetzt die praktische Kriminalarbeit kennenlernen. Eine auffallend attraktive Hoffnung war sie mit ihren hüftlangen rotblonden Haaren noch dazu. Und ihre leicht mollige Weiblichkeit wusste sie durch ausgefallene und offensichtlich teure Kleidung attraktiv zu betonen; nicht nur Christian zeigte immer wieder sein deutliches Interesse an einer näheren Bekanntschaft. Aber bisher waren von ihr noch alle um sie herumflatternden und gackernden Hähne mit verbalen Schnabelhieben aus ihrem Hof verscheucht worden. Manner sah dem Ganzen immer belustigt zu: Er wäre nie auf den Gedanken gekommen, Berufliches mit Privatem so nah zu verbinden, dass eine Beziehung daraus hätte entstehen können. Ein bisschen Freundschaft, gut. Besuche auf Geburtstagen oder so, auch okay; aber mehr? Niemals. Man musste sich das Leben nicht mit aller Gewalt schwieriger machen, als es eh schon von allein war. Wie hatte es Stromberg noch gleich gesagt: „Tauche nie deinen Füller in Firmentinte. Nie im eigenen Haus rumheften, tackern, lochen.“ Recht hatte er! Vielleicht sah Eva das genauso – er musste sie einmal danach fragen, wenn sich die Gelegenheit ergeben sollte.
„Grüß dich, Konstantin – tut mir leid, dass du aus deinem Frei musstest!“, begrüßte ihn Christian und Eva nickte ein Hallo. Manner winkte ab. Möckel lehnte sich zurück, streckte seine ineinander verschränkten Hände vor und dehnte sich, wobei seine trainierte Armmuskulatur zu sehen war. Dabei sah er wie zufällig zu Eva Mummenbrauer, die sich, als sie seinen Blick erwiderte, mit der linken Hand ihre Haare zurückstrich.
„Okay, dann legen wir also mal los. Was hat denn die Obduktion ergeben?“
Christian öffnete den obersten Hefter
„Es ist erst mal eine vorläufige Inaugenscheinnahme. Die ganze Obduktion machen sie morgen vormittags, und wenn sie abgeschlossen ist, rufen sie an, damit wir dann hinkommen. Also – laut Dr. Fuhrmann handelt es sich wirklich um einen Mann mit Down-Syndrom, 163 cm groß, 76 kg schwer, etwa 25 Jahre alt. Todeszeitpunkt ist a bisserl schwierig, weil die Körpertemperatur durch die Kälte sehr schnell herunter ist. Wahrscheinlich aber gestern Abend zwischen 20 und 22 Uhr. Gestorben ist er ziemlich sicher an den Folgen des Genickbruchs, genaueres morgen. So wie er schon am Fundort sagte, hat er sich mindestens zwei Rippen gebrochen; und mindestens eine hat dann seinen linken Lungenflügel durchstoßen, dadurch hat er keine Luft mehr bekommen. Er könnte aber auch an seinem Blut erstickt sein. Im Gesicht und an den Händen hat er überall schwere Kratzer, Hautabschürfungen und tiefe Schnitte, sah wohl wirklich sehr, sehr übel aus. Der rechte Arm ist gebrochen, und es gibt am ganzen Körper schwere Prellungen.“
Manner unterbrach ihn.
„Waren es frische Prellungen?“
„Ja!“
„Und die anderen Verletzungen? Anzeichen auf Fremdeinwirkung?“ Christian schüttelte den Kopf:
„Nicht direkt. Die SpuSi hat seine Spuren im Schnee zurückverfolgt – besser gesagt seine Blutspuren an den Ästen und Baumstämmen. Er muss wohl wie ein Wahnsinniger durchs Unterholz gelaufen sein, sich dabei die Verletzungen zugezogen haben – bis er an einem Abhang gefallen und dann gestürzt ist. Der Felsen, an dem er gefunden worden ist, hat dann seinen Sturz abrupt gestoppt, und ihn hat‘s dabei zerlegt.“ Er brach kurz ab, räusperte sich und fuhr fort: „Sein Auge könnte auch beim Sturz herausgerissen worden sein, durch spitze Äste im Unterholz; oder eben die Raben haben’s ihm heraus gefressen. Vielleicht finden wir’s ja noch.“ Er schaute von der Akte auf. Alle schwiegen.
„Also doch ein Unfall?“
„Vielleicht ja, vielleicht nein. Wie gesagt, die SpuSi hat heut Morgen seine Spur durch den Wald ein ganzes Stück zurückverfolgen können: überall abgebrochene Äste und Blut, und immer wieder mal seine Fußspuren im Schnee. Sie haben eine Skizze vom mutmaßlichen Weg gemacht.“
„Aber es hat doch in der Nacht vorher geschneit?“
„Ja, aber dadurch, dass im Wald die Bäume teilweise so nah beieinanderstehen, sind die Äste so dicht, dass nur wenig neuer Schnee auf den Boden gekommen ist und noch Fußspuren zu erkennen waren. Und außerdem hat er wohl wirklich eine kleine Schneise von abgebrochenen Ästen und Zweigen hinterlassen. Unfassbar, dass so ein kleiner Kerl solche Kräfte aufbringt!“
Manner hatte sich den Obduktionsbefund herangezogen und blätterte darin herum. Dann blickte er auf.
„Und weiter?“ Er legte den Hefter beiseite, schaute auf.
„Also, die SpuSi vermutet, dass er wohl erst den Waldweg heraufgegangen und dann in den Wald gelaufen ist. Sicher sind sie sich nicht, weil eventuelle Schuhabdrücke auf dem Weg durch den Neuschnee verschwunden sind; aber sie meinen, dass die Spuren im Unterholz nur diesen Schluss zulassen. Dann ist er eine Brandschneise entlang, dann wieder in den Wald, bis zu dem Abhang; da hat er wohl das Gleichgewicht verloren und ist etwa 25 Meter tief gestürzt – bis zum Felsen.“ Christian machte eine kleine Pause. „Die Kollegen meinen, sie hätten sich überlegt, dass er in Panik vor etwas davongelaufen sein könnte.“ Dann stand er auf und ging an den Kühlschrank, nahm sich eine Milchtüte heraus und goss davon in seinen leeren Kaffeebecher: Milch war nach Wasser sein absolutes Lieblingsgetränk. Kaffee trank er ganz selten, und Alkohol so gut wie nie. Gesundheit und Fitness waren ihm sehr wichtig, weshalb er auch dreimal die Woche in eine Muckibude ging. Wohlgemerkt, eine Muckibude, nicht in einen Fitnessclub: Er mochte den ganzen Hype und die damit verbundenen Begleiterscheinungen nicht; er war mehr für das Ehrliche, das Handfeste, Echte. Und deshalb hatte er damals auch eine ganze Weile gesucht, bis er einen Laden fand, in dem es, so wie früher, noch nach Eisen und Schweiß roch. Wo keine Tralala-Musik lief oder man bei frischgepressten Fitnesscocktails in stylischen Klamotten an der Theke herumhing. Hier wurde trainiert und basta. Sein Trainer war ein ehemaliger Boxer und die Trainingsatmosphäre hatte etwas vom ersten Rocky-Balboa-Film. Das gefiel ihm, da fand er sich sofort wieder; und seit über zwei Jahren war er nun dort. Mit seiner schlanken, durchtrainierten Figur sah er wesentlich jünger als 34 aus, was ihm bei seinen Bemühungen, bei den Frauen zu landen, zugutekam. Angeblich suchte er immer noch nach der Frau fürs Leben – und das ziemlich oft. Er kam zurück, setzte sich und trank mit sichtlichem Genuss die kalte Milch.
Manner nahm die Fotos und schaute sie sich an. Warum nur war der arme Kerl alleine im Wald unterwegs gewesen?
„Also hatte er womöglich vor etwas panische Angst; das würde erklären, warum er so durchs Gehölz ist.“
Christian nickte.
„Da ist noch was“, sagte er und rückte auf seinem Stuhl nach vorn. „Was Seltsames: Die SpuSi hat an den Ästen Haare gefunden. Die aber nicht vom Opfer stammen.“
„Haare? Was für Haare?“ Manner blätterte die Fotos durch.
„Ja. Also: graue Haare. Ziemlich zottelige, struppige. Wie von einem Fell.“
Er setzte das Glas an, verschluckte sich und prustete die Milch über den Tisch. Er hustete, murmelte so etwas wie „…uldigung“ und stand auf, um einen Lappen zu holen.
Manner blickte erstaunt auf.
„Einem Fell? Von einem Tier? Und was für eins? Graues Fell – vielleicht von einem Wolf?“
Er hatte erst vor ein paar Wochen einen Bericht darüber gesehen, dass in den Bergen und dem Vorland einzelne Wölfe gesehen worden waren. Aber es hieß doch immer, dass sie für den Menschen harmlos seien!
„Das wird noch untersucht. Ich denke aber, dass es was anderes gewesen sein muss: Wenn es ein Wolf oder so etwas gewesen wäre, dann hätte man doch keine Fellspuren in der Höhe von 160 cm und höher gefunden. Und dann waren da, wo er durchs Gebüsch ist, noch große, ovale Spuren im Schnee, ziemlich verwischt.“ Eva mischte sich ein.
„Also Wölfe sind doch auch viel kleiner und aufrecht laufen werden sie doch wohl sicher nicht. Und die hinterlassen auch nicht solche Spuren!“
Christian hatte die Milch aufgewischt, richtete sich auf und lachte plötzlich laut auf: „Ich weiß: Dann sind sie bestimmt vom Kaiser Barbarossa. Und von seinem Bart!“
Eva schaute erstaunt. „Von wem?“
„Na, von Friedrich Barbarossa. Kaiser Barbarossa! Der schläft der Legende nach im Untersberg bis zu seiner Auferstehung. Sein Bart wächst angeblich um einen runden Tisch, zweimal ist er schon rum. Und wenn er das dritte Mal herum ist, dann beginnt das Ende der Welt. Na, hoffentlich ist es nicht schon so weit!“
Er grinste und brachte den Lappen zurück zur Spüle.
„Es gibt über den Untersberg eine ganze Reihe Sagen und Mythen, musst wissen. Höhlen gibt es da auch jede Menge. Musst mal nachlesen, ist interessant.“
Dr. Mummenbrauer schaute ihre Kollegen an: Also, diese Leute in den Bergen! Vielleicht sollte sie es sich doch noch einmal überlegen mit ihrem endgültigen Umzug von Wien nach Salzburg.
„Na gut.“ Manner klappte den Hefter zu. „Das war’s bisher? Gut. Also, wir wissen noch nicht, wer der Tote ist oder wo er her ist. Gibt es schon irgendwo eine Vermisstenmeldung über einen – wie hast du ihn noch mal genannt?“
„Einen Downie.“
„Okay, also über einen Downie. Lass das aber nicht den Fuhrmann hören! Eva, Sie überprüfen das bitte und arbeiten eine Beschreibung des Toten aus, also sein Aussehen, Größe, Kleidung und so weiter. Rufen Sie den Fuhrmann in der Rechtsmedizin an – vielleicht gibt es ja irgendwelche Besonderheiten. Und machen S’ mir bittschön eine Kopie von den Skizzen der Spuren im Wald, die von der SpuSi. Ich hol sie mir gleich; vorher informier ich noch den Chef über unseren Stand. Und danach fahren Christian und ich raus, schauen uns alles noch mal an. Alles klar? Dann los.“
In Bad Reichenhall waren an diesem Wochenende eine ganze Menge Menschen unterwegs: Die Stadt hatte durch den Schnee ein schönes romantisches Aussehen erhalten, die Cafés hatten lange geöffnet, und der Weihnachtsmarkt vor dem alten Rathaus war mit seinen gemütlichen schönen Holzbuden, der ruhigen Bläsermusik und den von jungen Sängern vorgetragenen traditionellen alten Weihnachtsliedern ein regelrechter Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen geworden. Alles war so, wie man es sich zu Weihnachten wünscht – ein richtiges Postkartenidyll.
Auf der Polizeistation hatte Polizeioberwachtmeisterin Gruber gerade die Kaffeemaschine neu befüllt und eingeschaltet, als ihr Kollege durch die Tür hereingepoltert kam, mit einem großen Teller voll Gebäck in der einen und einer Kanne mit dampfender Flüssigkeit in der anderen Hand.
„Da, schau mal: großzügige Spende vom Stand der Bergwacht!“ Polizeiobermeister Oberbichler strahlte, marschierte durch die Amtsstube bis zur Küche und stellte dort alles ab. „Alkoholfreier Punsch! Vanillekipferl! Zimtsterne! Früchtebrot! Noch Fragen?“
Christel Gruber stand nun neben ihm, griff zum Teller und angelte sich einen Zimtstern.
„Kollege – manchmal bist ja doch zu was zu gebrauchen. Kaffee ist auch gleich fertig. Na, dann können wir es uns ja gut gehen lassen. Wie bist du denn dazu gekommen?“
„Ja, weißt du“, sagte Oberbichler „als ich da so meine Runde drehte und bei der Bergwacht vorbeikam, da hab ich dort eine kleine Pause eingelegt. Und von unserem Wochenenddienst erzählt, und wie schad‘ es ist, dass wir nicht zu Haus mit Familie und so sein können. Und war ganz traurig…“ Er grinste. „Und dann hat die Frau vom Huberbauern gesagt, dass sie sich das gar nicht vorstellen mag, wie wir zwei da so traurig in der Dienststube hocken – und hat mir das förmlich auf‘drängt!“
„Ja, das kann ich mir gut vorstellen – so was könnt ihr Männer ja besonders gut: leidend ausschau‘n! Aber diesmal hat es sich ja gelohnt.“ Sie holte einen Becher aus dem Schrank und schüttete sich vorsichtig etwas vom Punsch ein.
„Mmmh, das duftet!“ Sie griff sich noch zwei Vanillekipferl und ging dann zurück an ihren Schreibtisch. Sie saß noch keine Minute, da klingelte das Telefon. Am anderen Ende war Bernd Schering – er hatte mit dem Geschäftsführer gesprochen und vereinbart, wenn sich am Nachmittag nichts ergeben hätte, eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Jetzt war es kurz nach 17 Uhr und er erklärte der Polizistin, dass zwei männliche Bewohner seit gestern Abend vermisst würden.
„Da müssten Sie aber persönlich vorbeikommen – am Telefon geht so was nicht!“, sagte sie. „Sind Sie der Heimleiter?“
„Nein, der Wohnbereichsleiter; aber ich habe mit dem Geschäftsführer vereinbart, dass ich die Anzeige aufgebe, weil ich die Bewohner am besten kenne. Kann ich dann sofort kommen?“
„Ja, natürlich. Wir sind rund um die Uhr hier. Bitte bringen Sie Ausweise und Fotos mit, wenn vorhanden.“
„Mach ich, danke. Servus.“
Schering öffnete im PC die Datei mit den Bewohnerdaten: Von jedem neuen Bewohner wurden beim Einzug Fotos gemacht, für alle Eventualitäten. Schnell hatte er Paul Wagner und Sebastian Kern gefunden, druckte jeweils ein Bild aus.
Dann suchte er die Personalausweise heraus und steckte sie mit den Fotos ein. Bevor er losfuhr, rief er noch einmal Sabine Schmitz und Mona Martínez an; aber es gab keine Neuigkeiten.
Er machte sich auf den Weg zur Polizei und zehn Minuten später saß er mit Oberbichler am Schreibtisch, während dieser die Anzeigen aufnahm. Er machte Kopien von den Ausweisen, notierte die Namen und die Umstände, die bisher bekannt waren.
„Okay, also vermutliche Kleidung haben wir, Fotos haben wir. Gibt es irgendwelche Besonderheiten bei den beiden – ich mein, außer dass sie behindert sind?“
Schering überlegte.
„Also, bei Sebastian sieht man es ja: Er hat das Down-Syndrom – das, was man früher als Mongolismus bezeichnete. Außerdem ist er nicht besonders groß und ziemlich untersetzt. Ah, mir fällt noch was ein – Sebastian trägt immer, also wirklich immer, eine Kappe vom BVB Dortmund.“
„Gut, das hilft uns bestimmt, ihn zu finden. Und Paul Wagner?“
„Ja, der Paul. Was ist an ihm auffällig?“
Gerade um ihn machte er sich große Sorgen: Paul hatte schon Furchtbares erlebt, hatte eine Vorgeschichte aus Missbrauch und Gewalterlebnissen zu Haus; und umso schöner, umso herrlicher war es, wie er sich in den Jahren, in denen er nun im Sonnenhof lebte, verändert hatte. Wie fröhlich und lebenslustig er jetzt war. Nur manchmal holte ihn die verdrängte Erinnerung an seine Mutter und deren Männergeschichten wieder ein: Wie er als kleiner Junge wieder und wieder hilflos die sexuelle Gewalt von betrunkenen Kerlen miterleben musste, die seine Mutter im Suff mit nach Hause brachte. Wie er gezwungen wurde, mitanzusehen, wie ihr von einem besonders sadistischen Liebhaber brutalste Verletzungen mit glühenden Zigaretten zugefügt wurden. Dann fiel er in tiefe Gefühlslöcher und seine Gedanken verdunkelten sich. Wenn ihm nun irgendetwas Schlimmes zugestoßen wäre – Schering wollte sich gar nicht ausmalen, was das bedeuten könnte.
„Entschuldigung? Und was ist bei Paul Wagner auffällig?“ Die Stimme des Polizisten holte ihn wieder zurück.
„Pardon, ich musste nur grad an was denken. Ja, der Paul, was ist bei ihm: Also, auf den ersten Blick ist da nichts Besonderes. Ich denke, wenn man das erste Mal mit ihm zusammentrifft, dann fällt einem zuerst gar nichts auf – Paul hat ja in erster Linie eine starke Lern- und eine seelische Behinderung. Das macht sich hauptsächlich in seinem Verhalten bemerkbar: Er ist mit allem ganz schnell überfordert – jede kleinste, neue und für ihn unbekannte Belastung, ja, nur eine unvorbereitete Veränderung in seiner Umgebung kann dafür sorgen, dass er zusammenbricht.“
Er seufzte tief auf bei dem Gedanken an Paul.
„Er hat zwar bei uns im Laufe der Jahre gelernt, damit umzugehen, es zu verbergen; deshalb merkt man bei ihm auch nichts. Erstmal. Aber in ihm drin – ist ganz schnell eine große Unsicherheit, die ihn aus der Bahn werfen kann. Und eigentlich verlässt er die Einrichtung auch nie allein; deshalb haben wir ja die Vermutung, dass die beiden zusammen unterwegs sind!“ Schering machte eine kleine Pause. Dann: „Er ist auch Fußballfan, hat immer seine Kutte an – eine blaue, verwaschene Jeansweste mit vielen Bayern-München-Aufnähern drauf. Aber sonst …?“
Oberbichler hatte alles notiert. „Gut, das ist ja schon viel besser als nichts. Sie werden sehen, wir werden sie schnell wiederfinden.“
„Kann ich oder können wir noch irgendwas machen?“
„Nein, ich denke, Sie sollten sich jetzt alle beruhigen und abwarten. Meistens geht alles gut aus, wirklich. Wir leiten jetzt die Fahndung ein und geben sie auch gleich an die Kollegen in Österreich weiter. Also, wenn es etwas Neues gibt, melden wir uns sofort bei Ihnen. Und, wenn Sie etwas erfahren, sagen Sie uns bitte auch umgehend Bescheid, ja?“ Bei diesen Worten stand er auf und reichte Schering die Hand.
„Wir melden uns!“
„Was zum Teufel treibt denn nur ein Behinderter bei diesem Wetter allein hier im Wald?“
Sie waren gerade am Waldparkplatz an der B 20 ausgestiegen. Christian hatte sich umgeschaut und sich laut diese Frage gestellt.
„Ja, das geht mir auch dauernd durch den Kopf: Wieso ist der hier gewesen? Und warum ausgerechnet hier – hier ist doch sonst nix!“ Manner schüttelte den Kopf, während sie weiter den Waldweg hinaufgingen.
„Den muss doch jemand hierhergefahren haben, er wird wohl kaum am Straßenrand die Bundesstraße hier heraufgelaufen sein. Und wenn, wieso hat ihn derjenige dann hier allein gelassen? Kann ihn doch wohl kaum vergessen haben!“ Sie drehten sich um, aber alles, was sie sahen, war, dass hinter den Bäumen auf der anderen Seite der Bundesstraße und etwas weiter entfernt eine dünne, graue Rauchfahne aufstieg, wie von einem Schornstein.
„Ja. Sehr seltsam. Na, vielleicht hat sich ja in der Zwischenzeit jemand gemeldet und Eva findet’s raus.“
„Woll’n wir’s hoffen.“ Schweigend gingen sie den Berghang hinauf, bis sie zu der mit Leuchtfarbe markierten Stelle kamen, wo sie zur Fundstelle der Leiche in den Wald gehen mussten. Am Felsen angekommen, zog Manner die Skizze der Spurensicherung heraus.
„Hier hat er gelegen.“ Er blickte zum Waldrand. „Also, für die Kollegen sieht es so aus, als ob er den Weg heraufgekommen ist und dann, warum auch immer, ins Gestrüpp ist. Dann ist er gestürzt, den Abhang herunter bis hierher – und aus. Komm, lass uns mal nachschauen, was die Kollegen da gefunden haben.“
Sie folgten den markierten Spuren bis zur Absturzstelle, kletterten dann darumherum und drückten sich durch das Unterholz, bis sie wieder auf dem Weg standen.
„Ein Stück weiter oben ist er aus dem Wald, den Weg hier runter. Dann wieder rein ins Unterholz. Und warum? Welchen Grund hatte er dafür? Hat ihn was erschreckt? Ein Tier? Vielleicht doch ein Wolf?“
Manner schaute auf die Skizze.
„Aber ich denk, für einen Wolf waren die Spuren zu untypisch und zu weit oben an den Bäumen? Ein Bär vielleicht?“
Christian schaute sich um.
„Mensch, stell dir das mal vor: Du bist hier allein im Wald, es ist dunkel und eisig – und dann begegnet dir irgend so ein Vieh. Da würd‘ ich auch abhau‘n, egal wie!“
Manner nickte.
„Ja. Aber noch mal: Warum sollte er den Weg überhaupt hier rauf sein? Und wenn, wo kam er her?“ Er schaute den Berg rauf. „Und wenn er aus der anderen Richtung gekommen ist? Komm, lass uns mal den Weg raufgehen – mal sehen wo der hinführt. Vielleicht ist er ja gar nicht von der Straße heraufgekommen.“
Als sie etwa 100 Meter gelaufen waren, wurde der Weg ebener, und bog nach links ab. Sie gingen weiter, versuchten, etwas im Schnee zu entdecken, aber vergeblich. Nach etwa einem Kilometer öffnete sich der Wald, und in vielleicht fünfzig Metern Entfernung sahen sie Häuser, an denen eine kleine Querstraße vorbeiführte. Sie gingen weiter bis zur Straße und blieben dort stehen. Erstaunt erkannten sie, dass sie oberhalb von Großgmain waren, einem kleinen Tourismus- und Kurort auf der österreichischen Seite des Untersbergs. Zur linken Hand, auf der deutschen Seite, lag Bayrisch-Gmain, und dahinter, zum Staufen hinüber, war Bad Reichenhall zu sehen.
„Ach, nein! Da sind wir!“
Manner war verblüfft, irgendwie hatte er sich über die geographische Lage des Fundorts keine Gedanken gemacht.
„Sag mal, und wenn der Kerl von hier losgelaufen ist – und gar nicht den Berg rauf? Wenn er aus dem Dorf kam? Sich verlaufen hat oder nur mal kurz in den Wald wollte?“
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752125580
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (Dezember)
- Schlagworte
- Thriller Nazi krampus Regionalkrimi Österreich mord Serienmörder Sadomaso Salzburg geheime Organisation älterer Ermittler Krimi Spannung Noir