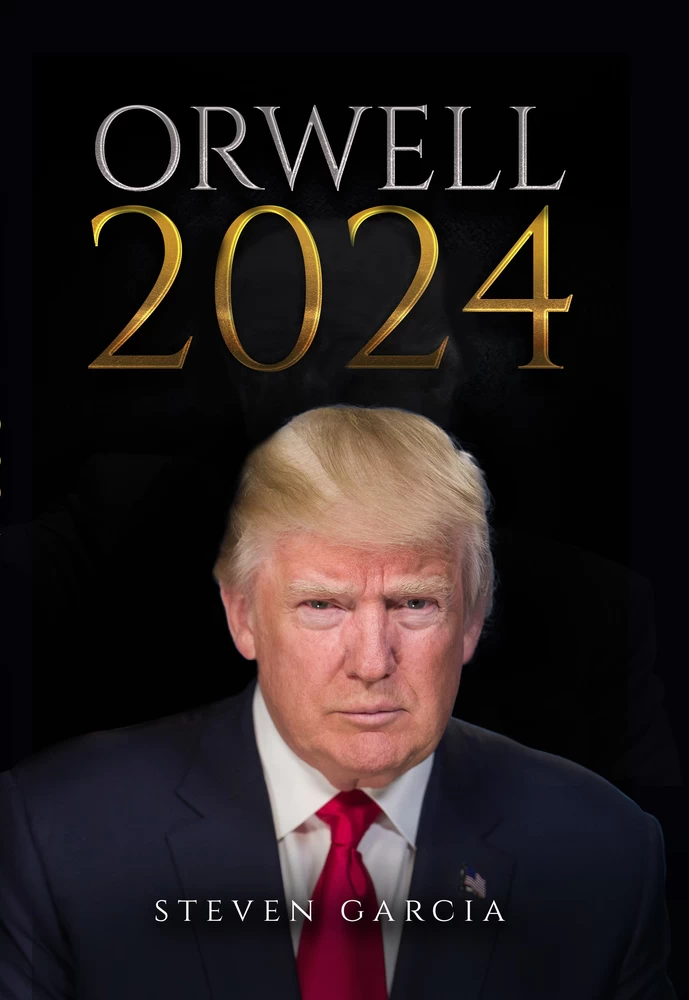Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Brian Miller, einfaches Mitglied der Partei, arbeitet im eurasischen Ministerium für Gemeinwohl-Ökonomie (Minimarkt). Der Friedensvertrag von Maastricht (1992) hatte mit Ozeanien, Eurasien und Ostasien drei annähernd gleichstarke Riesenreiche geschaffen.
Brian Millers Aufgabe ist es, den Absolventen marxistischer Fakultäten angenehme Tätigkeiten beim Staat und seinen NJOs zu besorgen. Wie auch Brian Miller zählen sie zur Oberschicht des Landes, den Electi. Sie leben auf Kosten der Proles, zu denen auch die zahlreichen Immigranten zählen.
Während die Electi ein geruhsames Leben führen, müssen die Proles in den Fabriken schuften – und das zu geringem Lohn.
Obwohl Miller seine Tätigkeiten pflichtbewusst ausübt, rebelliert sein Hausverstand innerlich gegen das totalitäre System, in dem er lebt. Sprache und Gedanken werden kontrolliert und mittels ständiger Überwachung durch die Mobiltelefone entgeht der Partei nicht der geringste Akt des Widerstandes. Der ‚Große Bruder‘ sieht alles.
Miller sehnt sich nach Wahrheit und Freiheit.
Er glaubt an einen Zufall, als er auf eine Frau stößt, die ähnlich denkt wie er. Gemeinsam wollen sie das System bekämpfen – und erfahren bald am eigenen Leib, wie umfassend die Macht des Staates ist.
‚Orwell 2024‘ spielt im Jahr 2024. Autor Steven Garcia hat sich an George Orwells Roman ‚1984‘ orientiert.
Und Garcia mahnt energisch: „Die Diktatur, vor der Orwell im Jahr 1949, dem Erscheinungsjahr von ‚1984‘ gewarnt hatte – sie ist im Westen längst zur Realität geworden!“
Steven Garcia
Orwell 2024
Eine Dystopie
Ein großer Philosoph und Revolutionär,
zum Demokraten gereift:
Eric Arthur Blair
Besuchen Sie uns doch...
www.orwell2024.com
Facebook: Steven Garcia, Orwell 2024
Instagram: Stevengarcia

Bilharzstraße 6
72488 Sigmaringen
Ungekürzte Ausgabe
herausgegeben von Baier Media
1. Auflage Januar 2021
Umschlagsgestaltung: Carlodesign, Dominik Reuter
ISBN 978-3-9822675-0-0 (Taschenbuch)
ISBN 978-3-9822675-1-7 (eBook)
Prolog
2024 lebte Eurasien im Frieden.
Die Bombenkriege, die die Welt immer wieder in Schutt und Asche gelegt hatten, waren Mitte der 1990er-Jahre abgeklungen. Am Ende hatte das Großreich Eurasien die Gebiete Großbritannien und Irland von Ozeanien erobert, musste dafür aber auf Gebiete in Ostasien verzichten.
Der Friedensvertrag von Maastricht (1992) hatte mit Ozeanien, Eurasien und Ostasien drei annähernd gleichstarke Riesenreiche geschaffen. Ozeanien. Es bestand nur noch aus den Kontinenten Amerika und Australien.
Eurasien. Es erstreckte sich zwar noch über den europäischen Kontinent, reichte aber nur noch bis Polen im Osten und die Türkei im Süden. Es zählte 620 Millionen Einwohner.
Ostasien. Reichte von Russland über China und Indien bis Japan und galt als aufstrebende Macht.
Afrika und Vorderasien waren in unzählige von Chaos und Hunger geplagte Länder zerfallen, die niemanden interessierten.
Noch galt Eurasien als ökonomisch starkes Land. Weil die Zahl seiner Bewohner aber stark geschrumpft war, wurde im kleinen Ort Schengen 1997 der Plan geboren, die Grenzen für Zuwanderungswillige aus aller Welt zu öffnen. Ideologisch unterstützt wurde das historische Vorhaben von der sozialistischen Verfassung Eurasiens. Sie besagte, dass alle Menschen auf der Welt gleich technisch-talentiert, gleich ehrgeizig und gleich diszipliniert wären. Damit würden also alle Menschen zu gleich großem Wohlstand gelangen. Deshalb sollten alle Menschen dieser Welt auch an jedem Platz der Welt leben dürfen.
Außerdem wollte sich Eurasien durch die Aufnahme weiterer Territorien (vor allem in Nordafrika und Arabien) an die Weltspitze schieben. Endziel: die politische Einigung der ganzen Welt zu einem einzigen Superstaat – mit einer Ideologie (jener des Egalitarismus), einer Partei (jener der EUSoc), einer Sprache (Englisch), einer Währung (dem Globo) und einem Wohlstandsprinzip; dem Leben auf Kredit, beziehungsweise dem Leben mit Geld, das der Staat in seinen Notenpressen druckte.
Um ihren Weltanspruch zu unterstreichen, hatte sich die alte INGSOC (Englische Sozialistische Partei) schon 1992 in EUSoc (Eurasische Sozialistische Partei) umbenannt. In Deutschland schrieb man die EUSOC auch EUSoz.
Die EUSoc war in zwei Klassen unterteilt: jener des Inneren und jener des Äußeren Kreises. Dem Äußeren Kreis konnte jeder beitreten, der das wollte (das taten rund 13% der Bevölkerung). Zur Inneren Partei konnte nur stoßen, wer einer Gemeinwohl-Score von über 900 Punkten vorweisen konnte. Zusätzlich mussten drei namhafte Persönlichkeiten der Inneren Partei für einen bürgen (diese Hürde übersprang nur 1%).
Die EUSoc konnte man nicht direkt wählen. Man konnte sich nur für eine ihrer acht Tochterparteien entscheiden, den sogenannten Blockparteien. Da alle acht mehr oder weniger dieselben, sozialistischen Positionen vertraten, trugen sie zur besseren Unterscheidbarkeit unterschiedliche Farben. So gab es die roten Sozialisten, die „Dunkelroten“, die „Grünen“, die „Gelben“, die „Blauen“, die „Violetten“, die „Schwarzen“ und die „Rosafarbenen“. Wobei sich nur Mitglieder der Inneren Partei in die oberen Funktionen der Blockparteien wählen lassen konnten.
Eurasien bestand aus 32 Bundesstaaten mit 32 nationalen Parlamenten. In jedem von ihnen waren alle acht nationalen Blockparteien vertreten. Ihre Mandatare wurden alle fünf Jahre in freien Wahlen gewählt. Je nach Größe des Landes saßen mehr oder weniger Abgeordnete eines Landes in Brüssel, der Hauptstadt Eurasiens. Dort bestimmten sie – unter Ausschluss der Bevölkerung – den Präsidenten Eurasiens: den Großen Bruder. Dieser wiederum bestimmte dann seine Kommissare (so hießen Minister in Eurasien).
Dabei entschieden sich die nationalen Regierungen immer für ein und denselben an der Spitze: den Großen Bruder. Was kein Wunder war – hatte er doch als einziger Eurasier einen Gemeinwohl-Score von 1 000 Punkten.
Wie die Partei, so teilte sich auch die Bevölkerung in zwei Hälften: die Electi und die Proles. Eine Mittelschicht gab es nicht. Die Electi waren die obere Schicht. Sie stellten 40% der Bevölkerung. Ihre Mitglieder rekrutierten sich aus dem öffentlichen Dienst. Also, aus allen (teil-) staatlichen Behörden und Betrieben; den Schulen, Universitäten, Interessensvertretungen, Museen, Kirchen, Stiftungen und NJOs (No-Job-Organisations).
Die zweite Gruppe waren die Proles (60%). Sie rekrutierten sich aus den Arbeitern privater Betriebe. Ihre Löhne waren wesentlich geringer als die der Electi, ihre Arbeit härter. Ihre niedrigen Realeinkommen wurden gebraucht, um die Güter des täglichen Lebens günstig zu erzeugen und damit die Kaufkraft der Electi zu stärken. Außerdem entstanden so hohe Unternehmensgewinne, die in Form von Steuern an den Staat flossen. Sie wurden dringend benötigt, um den staatlichen Sektor zu finanzieren, die Electi.
Die Schicht der Proles unterteilte sich in zwei Untergruppen: in die der heimischen und die der zugewanderten Proles. Die zugewanderten hatten die heimischen Proles mittlerweile an Zahl übertroffen. Tendenz: steigend.
Für Einwanderer gab es nur drei Regeln. Sie hatte der Immigrant in dem Moment akzeptiert, als er seinen Fuß auf eurasischen Boden setzte. Damit willigte er ein
• sich eine Generation lang zu Sklavenlöhnen ausbeuten zu lassen
• ausschließlich unbeliebte, körperliche Tätigkeiten zu verrichten und
• keine politischen Forderungen zu stellen.
Dafür durfte der in seiner Heimat gescheiterte Einwanderer in einem disziplinierten Land wie Eurasien leben.
Mit der Zeit gelang auch hier der Aufstieg. Nach 20 Jahren durften viele Zuwanderer bereits leichtere Tätigkeiten verrichten und wurden etwas besser bezahlt. Mit Verleihung der Staatsbürgerschaft schafften es viele in die Schicht der inländischen Proles. Manchmal gelang sogar der Sprung in die untere Schicht der Electi, und sei es nur als städtischer Sozialarbeiter oder Elektriker in einem kirchlichen Altenheim.
Der Aufstieg zu einem angesehenen Electi gelang ohnedies nur durch Absolvieren eines marxistischen Studiums (wie der Soziologie, der Pädagogik, Philosophie oder Politologie).
Staatsfeind Eurasiens war Daniel Goldstein. Vater Emmanuel Goldstein, war in seiner Jugend sogar Parteimitglied der INGSOC gewesen. Er hatte sich aber in den Untergrund geschlagen. Dort hatte er in den 1960ern eine Konterrevolution gegen die INGSOC angezettelt. Er soll mit der sogenannten Bruderschaft, einer rechtsextremen Gruppe sympathisiert haben. Vor allem in London war es zu heftigen Kämpfen gekommen.
Aber Goldstein hatte sich verschätzt: am Ende gewann Eurasien die Oberhand und eroberte England und Irland (verlor dafür Russland). Goldstein musste nach Amerika fliehen. Dort kam sein Sohn Daniel zur Welt. Schnell gelang dem Konterrevolutionär der Aufstieg in die höchsten Kreise Amerikas. Um seinen jüdischen Hintergrund zu verbergen, färbten sich die Goldsteins ihre Haare blond. Emmanuel Goldstein nutzte seine Kontakte aus und ließ Sohn Daniel sogar einmal zum US-Präsidenten wählen.
Ihre Herrschaft übte die Zentralregierung Eurasiens über ihre vier Ministerien aus. Jedes Ministerium hatte in jedem der 32 Mitgliedsländer eine Landesvertretung. Die eurasischen Zentralen der vier Ministerien waren in Brüssel, London, Paris und Straßburg angesiedelt. Die Zahl der Beamten war unüberschaubar. Selbst in der Provinz kamen die Regional-Ministerien noch auf 100 000 Beamte und mehr.
Das eurasische Ministerium für Wahrheit (Miniwahr) saß in Brüssel. Es beschäftigte sich mit der Ausrichtung aller Medien, Schulen, Unis, sozialen Medien sowie der Staatskunst am marxistischen Gleichheitspostulat.
Das Miniwahr hatte drei Einzelabteilungen. Nach der Zahl ihrer Angestellten war die größte jene für Geschichtsrelativierung. Ihre Experten schrieben die eurasische Geschichte im Sinne der Gleichheitsideologie um. Ihr Credo: »Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert auch die Vergangenheit. Wer die Vergangenheit beherrscht, der herrscht auch in der Zukunft«.
Die zweitgrößte Einzelabteilung trug den etwas sperrigen Namen »Straßen-, Berg-, und Flussnamenvariabilisierung«. Die ideologisch wichtigste war zugleich die kleinste Abteilung: die Gesellschaft für englische Sprache. Ihr zur Seite stand die Sprachpolizei. In der Gesellschaft für englische Sprache entstand Neusprech, die Weltsprache Eurasiens – auch »Political Correctness« genannt. Im Volksmund galten ihre Beamten als »die 120%igen«.
Das Ministerium für Gemeinwohl-Ökonomie (Minimarkt) saß in London. Es bekämpfte ökonomisches Denken, Wettbewerb, Welthandel und Privateigentum. Und es versorgte die Absolventen marxistischer Fakultäten mit angemessenen Tätigkeiten bei Staat und NJO. Daneben betrieb es die Eurasische Zentralbank (EZB) mit Sitz in Frankfurt.
Und dann war da noch das Ministerium für Liebe (Minilieb). Es saß in der »Stadt der Liebe«, in Paris. Das Minilieb beherbergte Geheim- und Gedankenpolizei. Es vaporisierte alle, die rechtes Gedankengut verbreiteten. Seine größte Waffe war das SERPH-System. Dazu betrieb das Minilieb – über die gesamte Union verstreut – 4 500 Megarechenzentren. Alle 620 Millionen EU-Bürger wurden täglich einem sozialen Rating unterzogen, das sich in einer individuellen Maßzahl ausdrückte, dem Gemeinwohl-Score (GWS). Berühmt war das Minilieb zudem auch für den 2-Minutenhass. Technisch basierte die Überwachung auf 5G.
Um den Partei-, Verwaltungs- und Disziplinierungsapparat Eurasiens zu kontrollieren, brauchte es das vierte Ministerium; das Ministerium für Freiheit (Minifrei). Das Minifrei kontrollierte die Gesetzgebung. Es hatte seinen Sitz in Straßburg. Ihm unterstanden große NJOs wie die UNO, der IWF, das Nobelpreis-Komitee oder der Eurasische Gerichtshof für Menschenrechte, EUGH – im Volksmund auch Minirecht genannt.
TEIL 1
1
„Krach!“
Mit einem dumpfen Ton verschwand der Kopf des Hammers hinter einer Gipskartonplatte. Schnaubend zog Brian das staubige Werkzeug heraus. Der nächste Hieb saß schon fester, und nach wenigen Minuten war der Spalt zu einem großen Loch herangewachsen. Sachte führte er die Spitze des Hammers hinter die nächste Gipskartonplatte. Dann ein schneller Ruck – und auch diese lag in Trümmern.
Staub lag in der Luft. Brian Miller schwitzte. Es war Samstag, der 11. Mai 2024. Brian schuftete im Wohnzimmer einer pensionierten Parteigenossin, Margaret Poppe. Sie lag wegen einer schweren Bronchitis schon seit Monaten im Krankenhaus. Die Krankheit soll vom allgegenwärtigen Schimmel in der kleinen Mietwohnung ausgelöst worden sein. Die Außenwände des alten, in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts errichteten Wohnblocks, waren nicht gedämmt. Nun sollten Heizungsrohre verlegt werden, um den Schimmel auszutrocknen. Allerdings hatten sich die Genossenschafter des Hauskollektivs gewehrt, die Arbeiten vom gemeinsamen Hauskonto zu bezahlen.
Das war bis ins Ministerium für Gemeinwohl-Ökonomie gedrungen, Poppes ehemaligem Arbeitgeber. Sofort meldeten sich Freiwillige, die das an den Wochenenden erledigen wollten. In sechs Wochen sollte die 81jährige Poppe (mit dem Spitznamen »Maggy«) aus dem Krankenhaus entlassen werden. Bis dahin sollte die Wohnung renoviert sein.
Auch Brian Miller arbeitete im Ministerium für Gemeinwohl-Ökonomie (Minimarkt). Er war dort für die Gründung von NJOs zuständig. Millers Aufgabe war es, nach gesellschaftlich angesehenen Tätigkeiten für neue NJOs zu suchen. Die Tätigkeiten durften aber nicht mit körperlicher Anstrengung verbunden sein. Miller stellte auch die EU-Anträge zur Finanzierung der neuen NJOs mit Steuergeld. Schlussendlich vergab er die heißbegehrten Stellen an verdiente Electi (mit Gemeinwohl-Scores von über 750).
Sein Vorgesetzter, Charles Radeck hatte selber acht Jahre lang ein NJO geleitet (die sogenannte »Stéphane Hessel-Friedensbibliothek«). Der Verein war nach einem kommunistischen Philosophen benannt, der die Jugend zur Revolution angestachelt hatte. In Radecks NJO hatten ein Dutzend Politologen und Soziologen gearbeitet. Sie organisierten Lesungen linker Experten zu linken Themen und kauften die Bücher linker Autoren an. Die Arbeitsbedingungen waren fantastisch: 25-Stundenwoche, Top-Gehalt - und nicht ein bisschen Leistungsdruck.
Radeck hatte Maggy, die verdiente Genossin, noch persönlich als Arbeitskollegin erlebt. Als Charles (»Charly«) Radeck vor kurzem in der Kantine erzählte, dass man Margaret Poppe helfen müsste, war Brian Miller sogleich Feuer und Flamme. Man konnte in Eurasien nämlich ordentlich Gemeinwohl-Punkte abstauben, wenn man sich um ältere Mitbürger kümmerte! Spontan bot Miller seine Hilfe an. Nur eine Woche später saß Brian in Maggys staubiger Wohnung, vor ihm ein großes Loch in der Mauer.
Brian saß vor der Wand. Im Radio machte der Moderator gerade Witze über Rechte. Wie man die Kinder von Rechten in der Grundschule erkenne? – Sie wären fit, weil sie sich vor dem Schulbesuch noch körperlich ertüchtigten! Der im Hintergrund eingespielte Applaus hysterisch lachender Menschen ließ auch Brian schmunzeln.
Brian war nicht besonders schnell. Maggys Problem ließ ihn in Wahrheit kalt. Ihm war wichtig, sich nicht zu verletzten. Jetzt war wieder Zeit für eine Pause! Müde ließ er sich auf ein altes, braunes Sofa fallen. Der Cordstoff war verschlissen. Davor ein alter, fettig glänzender Eichen-Couchtisch aus den 1960ern. Die Wände waren hier wohl irgendwann einmal weiß gewesen, dachte Brian. Nun waren sie gelbgrau und fahl. Ließen die Wohnung noch dunkler wirken als sie das ohnedies schon war.
Überall roch es nach Moder. Brian trank etwas kalten Tee, dann biss er in das mitgebrachte Jausenbrot. Miller sinnierte über Maggy. Ob die Menschen zu Maggys Zeit auch schon von Geburt an gechipt wurden? Wahrscheinlich nicht. Dabei fiel ihm ein, dass der Chip seines SERPH-Handys bereits seit 2 Tagen Störungsmeldungen an die Zentrale sendete. Ein Wunder, dass sich noch niemand bei ihm gemeldet hatte.
SERPH stand für Social Examine Rating Phone. Auf Deutsch etwa: Soziales Prüf- und Bewertungstelefon. Die Proles nannten es schlicht Handy.
Über dem Sofa hing ein brauner Kunststoffrahmen. Darin das verblichene Farbbild einer jungen Frau, wahrscheinlich Maggy Poppe. Im Hintergrund waren Teile eines kleinen Gartenhauses zu erkennen. Das Bild war sicher vierzig, wenn nicht sogar fünfzig Jahre alt. Maggy war heute 81 Jahre alt, sie hatte die schweren Bombenkriege also noch selber miterlebt. Bei dem Gedanken schauderte es Brian.
Im Ministerium hatten Brians Vorgesetzter immer wieder Maggys Einsatz für die Gesellschaft gepriesen. Obwohl sie nur einfaches Parteimitglied war, hätte sie sich immer für andere aufgeopfert. Vor ihrer Zeit im Minimarkt war sie in diversen NJOs beschäftigt.
NJO, das war das Neusprech-Vokabel für No-Job-Organisations, also Nicht-Arbeit-Organisationen. NJOs waren staatliche oder staatsnahe Stellen, die die sozialistische Gesellschaft weiterentwickeln sollten. Sie erfüllten vornehmlich soziale Aufgaben; und waren – vor allem nach dem Niedergang der Industrie – mittlerweile der größte Wirtschaftszweig des Landes. Jobs bei NJOs waren beliebt: guter Verdienst und wenig Stress – und das bei einer 25-Stundenwoche.
Brian kannte Maggys Gemeinwohl-Score nicht. Er würde wohl über 800 liegen, sonst hätte sie sich wohl keine Mietwohnung in der Karl-Marx-Allee leisten können. Brians GWS pendelte um die 640. Aber Brian war ja auch erst 38 Jahre alt. Ok, 38½.
Technisch wurde der Gemeinwohlscore durch das SERPH-System ermittelt. Ideologische Basis war der Marxismus der 1920er und 1960er-Jahre. Damals stellten sich die Sozialwissenschaft die brennende Frage: wie könnte man die als reaktionär erachtete Bevölkerung nachhaltig umerziehen? Alleine durch das sukzessive Umschreiben der Geschichte war das nicht zu machen. Denn wer kontrollierte das Gespräch zu Hause, im Kreise der Familie?
Bis zum Beginn der Digitalisierung Mitte der 1980er-Jahre hatte die Überwachungsarbeit auf zig Millionen Richtmikrofonen und Teleschirmen gelastet. Ab 1995 dann der Durchbruch! Von nun an übernahmen Internet und Mobiltelefon die Gedankenkontrolle.
Im Jahr 2024 konnten Serfys (so hießen SERPH-fähige Mobiltelefone im Volksmund) bis zu einhundert Parameter eines Menschen gleichzeitig und permanent verarbeiten und via Internet bzw. 5G-Technik vollautomatisch an die Rechenzentren senden. Dabei maßen die kleinen Maschinen physiologische Eigenschaften wie Puls und Bluttemperatur, sie maßen die Klangfarbe der Stimme („Unsicher? Aggressiv?“) und die Mimik (Überfordert?), sie analysierten die verwendeten Höflichkeitsfloskeln („Hat er »bitte« gesagt?“) und interpretierten den Gesprächsinhalt („Plauderei? Geschäftlich? – und wenn letzteres: »War es erfolgreich«?“). Die Parameter wurden in Rechnerzentren zusammengeführt und vollautomatisch nach sozialen Gesichtspunkten bewertet. Einziges Kriterium: wieviel trägt eine bestimmte Handlung eines bestimmten Bürgers zum Erreichen einer gleicheren Welt bei?
Das Serfy eines jeden Bürgers sendete via 5G-Netz permanent an dessen Volksordner. Denn für jeden der 620 Millionen Eurasier war ein eigener Volksordner angelegt – irgendwo in einem der 4 500 Rechenzentren. Datenvolumen pro Ordner: 100 Terrabyte.
Aus der Datenfülle rechneten die SERPH-Programme einen Punktewert aus – ähnlich einer Schulnote, den Gemeinwohl-Score. Er nahm einen Wert zwischen 0 und 1 000 an (bei 1 000 war man die perfekte Mischung aus einem Kommunisten und Mutter Theresa, bei 0 war man ein verkrachter Kapitalist wie Gottfried Daimler oder Henry Ford). Grundsätzlich galt: je mehr das Verhalten eines Individuums das marxistische Gleichheitspostulat beförderte, desto mehr Punkte gab es. Je individualistischer, Freiheitsorientierter eine Handlung war, desto heftiger waren die Abzüge.
Wer sich mit Bürgern von hohem Gemeinwohl-Niveau umgab, verbesserte seinen eigenen Score. Wer sich mit niedrig-gescorten Leuten abgab, schickte den eigenen in den Keller. Wer sich sozial engagierte, erhielt Punkte. Wer hingegen mit dem Flugzeug flog oder Witze über Frauen oder Grüne machte, verlor sie. Egal, was man tat – alles, einfach alles im Leben hatte Konsequenzen. Ob man sich am Arbeitsplatz oder in der Wohnung aufhielt; was man sagte, dachte oder fühlte; wie man sich gegenüber Familienmitgliedern, der Umwelt, gegenüber Freunden, Fremden oder Verwandten verhielt – alles veränderte den Score. Selbst Triviales wurde abgespeichert: welche Pizza hatte man über den Sprachassistenten bestellte? Wann hatte man die Heizung in der Wohnung eingeschaltet – und wen hatte man dort erwartet? Jede Handy-App meldete im Hintergrund an den Volksordner.
Vor allem junge, idealistische Menschen wie Brian Miller stellten weiß Gott was an, um ihren Score zu pushen. Den Proles hingegen schien es egal zu sein, wie die Partei oder die Gesellschaft über sie dachten. Auf Gemeinwohl-Konventen und Sozialausschüssen, deren Teilnahme besonders viele Punkte einbrachte, ließen sie sich selten blicken. Dabei war die Auswahl riesengroß: da waren Konvente gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen Islamophobie, gegen Rechte, gegen Konterrevolutionäre, gegen christlichen Extremismus, gegen Konzerne, gegen körperliche Arbeit, und, und, und.
Durch ihre Verweigerung nahmen sich die Proles freilich jede Möglichkeit des sozialen Aufstiegs - von einer echten Beamtenkarriere einmal ganz zu schweigen. So blieb Proles oft keine Alternative, als sich in privaten Produktionsbetrieben zu verdingen. Bei geringen Löhnen und hohem Leistungspegel.
Brian hatte schon zu Schulzeiten erkannt, wie das System bedient werden wollte. Und er wollte es zu seinem Vorteil bedienen. Denn Brian Miller wollte ganz hinauf - gesellschaftlich und ökonomisch. Obwohl man das mit »ökonomisch« nicht aussprechen durfte, denn das Wort »ökonomisch« war in der Öffentlichkeit mit dem Begriff »Gier« gleichgestellt. Und ein Begriff wie »Gier« war in höchstem Ausmaß angetan, jemandes Gemeinwohl-Score in die Niederungen der Zweistelligkeit zu bombardieren. Nur Begriffe wie konservativ oder Kapitalismus waren noch schlimmer besetzt – ausgenommen, man ergänzte sie um Neusprech-Bausteine wie »Anti-« oder »-kritik«.
Die Kirchen waren Meister im Gebrauch solcher Neusprech-Anhängsel. Darum übertrafen die Gemeinwohl-Scores vieler Glaubens-gemeinschaften sogar das Niveau soziologischer Fakultäten.
Miller saß auf der Couch und grübelte: um wieviel würde dieser Arbeitseinsatz seinen Score jetzt wohl nach vorne bringen? Immerhin schuftete er ja außerhalb der Arbeitszeit! Miller grübelte: würde man ihm die Punkte erst bei Fertigstellung der Wohnung gutschreiben – oder pro Arbeitstag? Und: sollte er Maggy nicht auch persönlich im Krankenhaus aufsuchen, ein Bild mit ihr zusammen machen? Um es dann auf Instagram zu posten?
Internet-Aktivitäten hatten die SERPH-Rechner besonders schnell auf ihrem Radar. Über 40 000 Beamte waren mit Kontrolle und Zensur des Internets beschäftigt. Führer dieser Behörde war Joseph Maasmidon – ein eurasienweit anerkannter Sozialist.
Miller brauchte Gemeinwohl-Punkte. Denn wenn Miller etwas wirklich wollte, dann einen anderen Job. Wollte dem engen, stickigen Büro entkommen, wollte im Wolkenkratzer des Minimarkts um mindestens fünf Stockwerke aufsteigen. Dorthin, wo es Fenster gab. Und wo man nicht am Schweiß des Sitznachbarn erkannte, was es am Vortag in der Kantine zu essen gegeben hatte.
Doch Miller war nur Equality Private. So hießen die Sachbearbeiter im Ministerium für Gemeinwohl-Ökonomie (Minimarkt). Um in eine höhere Abteilung aufzusteigen, musste man aber mindestens Equality Specialist sein. Oder noch besser: Equality Sergeant. Dazu brauchte es aber einen Score von über 700 Punkten.
Brian seufzte. Unter lautem Jammern drückte er sich aus dem durchgesessenen Sofa. Die rechte Hälfte der Wand lag bereits in Trümmern. Nun kam die linke Seite an die Reihe. Er hob den Hammer mit der Spitze vorne an und schlug ihn gegen die Mauer. Doch dem »Krach!« folgte diesmal ein »Schscht!«. Zwar hatte der niedersausende Hammer einen langen Riss in die Gipskartonplatte gegraben, doch als er den Hammer aus dem etwa 4 Zentimeter breiten und 15 Zentimeter langen Spalt herauszog, hingen zerrissene Papierfetzen daran. Verdutzt nahm Brian das Papier vom Hammer, wischte den Staub von seiner Brille und sah in den Spalt.
Er traute seinen Augen nicht. Da waren Bücher hinter der Wand versteckt! Ängstlich blickte er um sich. Hatte das Teleauge seines Handys schon Alarm geschlagen? Wohl nicht, er hatte es ja in der Küche abgelegt! Aber die Teleschirme hier im Raum? Ihre Bildschirmoberflächen waren von einer dichten Staubschicht bedeckt – und immer noch schwarz. Obwohl das nicht zwangsläufig bedeutete, dass die Kameras des Teleschirmes nicht aufzeichneten. Allerdings stand zwischen dem Riss in der Wand und dem Teleschirm der schwarzbraune, etwa zwei Meter lange Wandverbau. Brian hatte ihn in die Mitte des Raumes gerückt, um besser zur Wand zu kommen.
Unsicher zog Miller das erste Buch heraus. Es war eine Original-Ausgabe des Korans. Millers Arme begannen zu zittern. Noch nie im Leben hatte er ein unkommentiertes Buch in seinen Händen gehalten. Also eines, das weder von einem linken Verlag kam, noch von einem linken Publizisten kommentiert war. Bekannte Originalwerke gab es in Eurasien ausschließlich als kommentierte Ausgaben. Nicht selten waren 75% des überflüssigen Originaltextes durch die Analysen ideologisch versierter Sprachwissenschaftler, Historiker oder Politologen ersetzt worden. Dabei war es offiziell nicht einmal verboten, unkommentierte Bücher zu lesen. Trotzdem konnte es den Tod bedeuten.
Bedächtig blätterte er im Koran.
„Sure 5 Vers 38 Der Dieb und die Diebin: trennt ihnen ihre Hände ab als Lohn für das, was sie begangen haben, und als ein warnendes Beispiel von Allah.“
Erschrocken legte er das Buch zur Seite. Miller war wie paralysiert. Sein T-Shirt klebte am Rücken und Schweißperlen tropften von der Stirn. Obwohl er es gar nicht wollte, griff seine Hand immer wieder in den Spalt hinein. Als nächstes hatte er ein Buch von Ludwig von Mises in der Hand, »Die Gemeinwirtschaft«. Es war ein dickes Buch, und sicher hundert Jahre alt. Zumindest ließ die Papierqualität darauf schließen. Erst jetzt begriff er die Tragweite des Namens: Lud – wig – von – Mi – ses.
„Verdammt!“, entfuhr es Miller: „Ein Rechter!“
So lautete die EU-weite Bezeichnung für Menschen, die verbotene, also nicht-linke Gedanken aussprachen. Wer Kritik am marxistischen Gleichheitsideal der Partei äußerte, war etwa rechts. Kam so etwas an das Tageslicht (und es kam immer ans Tageslicht), dann verlor man Job, Vermögen und Familie. Und landete nicht selten im Umerziehungslager. Rechte Autoren wie Mises kamen in der Öffentlichkeit Eurasiens nicht vor. Sie wurden auf keiner Universität gelehrt, auf keinem Kolleg, ihr Name stand in keinem Schulbuch. Sie waren Unpersonen. Miller war der Name aber vom Besuch eines Gemeinwohl-Konventes zum Thema Hate Speech geläufig. Mises Werke hatten als abschreckende Warnung gedient, wie bürgerlich-rechtes Gedankengut die Gesellschaft aufwühlen würde.
Jetzt hielt er gerade solch ein Werk in seinen Händen! Millers Gesicht fühlte sich plötzlich wie aufgedunsen an. Sein Puls raste. Ihm wurde heiß, er musste das Fenster öffnen. Wie unter Strom las er Silbe um Silbe:
„§1. Sozialismus ist die Losung unserer Tage. Die sozialistische Idee beherrscht heute die Geister. Ihr hängen die Massen an, sie erfüllt das Denken und Empfinden aller, sie gibt der Zeit ihren Stil.“ Und auf der nächsten Seite: „Auch der Nationalismus bejaht den Sozialismus; was er ihm vorwirft, ist lediglich das, dass er international ist.“
Brian blätterte auf die erste Seite und erschrak. Da stand: Umgearbeitete Auflage, 1932 (Original 1924).
Mit Spannung blätterte er zum Vorwort:
„Der unvergleichliche Erfolg des Marxismus beruht auf tief verankerten, uralten Wunschträumen. Er verspricht ein Paradies auf Erden, ein Schlaraffenland voller Glück und Genuss und, was den Zukurzgekommenen noch süßer mundet, die Erniedrigung aller, die stärker und besser sind als die Menge.“
Miller las weiter:
„Der Marxismus lehrt, Logik und Denken, die die Ungereimtheit solcher Wunschträume entgegenstehen, beiseitezuschieben.“
Schmunzelnd musste Brian an die Hunderttausendschaften von Soziologen denken. Mit den obskursten Erklärungen versuchten sie ihre Mitbürger zu überzeugen, dass afrikanische Zuwanderer technisch genauso erfolgreich waren wie indigene Engländer.
Als Schüler hatte er das auch noch geglaubt. Beobachtungen, die er in den Jahren nach der Schule machte, hatten aber gehörige Zweifel in ihm aufkommen lassen.
Natürlich hatte er seine Zweifel niemandem mitgeteilt, auch nicht seiner Frau. Das war zu gefährlich. Denn wer sich politisch unkorrekt verhielt (so lautete das Aussprechen nicht-linker Ansichten), der wurde schnell vaporisiert. Da reichte es schon, wenn man im kleinen Kreis den Wahrheitsgehalt der Abendnachrichten in Zweifel zog. Und war man erst einmal auf dem Radarschirm der Obrigkeit gelandet, dann richteten Gemeinwohl-Konvente über den Aufmüpfigen. Von einem Tag auf den anderen verschwand man von der Bildfläche, wurde schnell zur Unperson erklärt. Der Arbeitsplatz, der blieb am nächsten Tag ganz einfach leer. Und keiner stellte Fragen. Am übernächsten Tag saß schon ein anderer da. Die Wohnadresse war aus Internet-Verzeichnissen gelöscht, Emailadressen waren wieder frei. Man war nicht einfach nur physisch weg – man war es auch digital.
Miller las weiter:
„Marx und Engels haben nie versucht, ihre Gegner mit Argumenten zu widerlegen. Sie haben sie beschimpft, verspottet, verhöhnt, verdächtigt, verleumdet. Und ihre Nachfolger stehen darin in nichts zurück.“
Miller erschrak. In der Eurasischen Union wurden die Gegner des linken Mainstreams als rechts stigmatisiert – und wie Dreck, ja schlimmer noch: wie Kriminelle behandelt. Die Presse verhöhnte und verspottete sie. Nur weil sie eine andere Meinung als die linke Presse vertrat.
Langsam wurde sich Miller der Lage bewusst. Er sollte den Bücherfund so schnell als möglich den Behörden melden! Aber irgendetwas hinderte ihn, die Augen von den zerknitterten Blättern zu nehmen.
„Der Sozialismus ist Antilogik, Antiwissenschaft und Antidenken, wie denn auch seine vornehmste Grundlage ein Verbot des Denkens und des Forschens bildet. Marxismus ist Opium für die geistige Oberschicht; für die, die denken könnten und die, die er des Denkens entwöhnen will.“
Miller schauderte es: Maggy hatte verbotene Bücher versteckt! Doch statt das Handy in die Hand zu nehmen und die Presse zu informieren, griff Brian hinter die Wand und holte weitere Bücher hervor. Und etwas Stoffliches: Brian hielt eine Dokumentenmappe in den Händen. Sie bestand aus dunkelblau bedrucktem Pappkarton, der mit Stoff überzogen war.
Vorsichtig hob Miller den Deckel an – schon fielen Zeitungsausschnitte und Fotos heraus. Behutsam hob er ein Schwarzweiß-Bild vom Boden auf. Es war vielleicht 12 mal 18 Zentimeter groß und zeigte ein junges Pärchen in seinen besten Jahren. Verliebt lächelte es sich in die Augen. »Er« – groß, stattlich mit schwarzem, streng gekämmtem Haar, steckte in einem grauen Anzug. Weißes Hemd und dünne Krawatte. Daneben stand »Sie«. Eine unscheinbare Frau mit halblangem, dunkelblondem Haar. Sie trug ein graues Kostüm, wirkte etwas pummelig. Ob das da Maggy war? Wahrscheinlich hatte das Bild einmal in einem Glasrahmen gesteckt.
Nun war Brian alles egal. Noch einmal griff er in das Loch. Sein Puls pochte, als hätte er stundenlang 100-Kilo-Steine im Stechschritt den Hang hinaufgetragen. Da war ein gelbes Buch: »GUINESS BUCH DER REKORDE 1984« stand in dicken Lettern auf dem Cover.
Zitternd blätterten Millers Finger durch die Seiten. Auf Seite 172 blieben sie stehen. Da waren einige Passagen seitlich mit Kugelschreiber angestrichen. Oben hatte jemand mit krakeliger Handschrift in blauer, mittlerweile vergilbter Tinte gekritzelt: »Die Partei lügt – in Wahrheit wurden diese Erfindungen von Nordeuropäern gemacht«.
Der Satz war doppelt unterstrichen. Die angestrichenen Passagen betrafen allesamt Erfindungen rund um Fahrzeuge. Da stand:
| Erfindung | Jahr | Erfinder |
|---|---|---|
| Erster Motorwagen | 1885 | Karl-Friedrich Benz |
| Erster Viertakt-Benzinmotor | 1867 | Nikolaus August Otto |
| Erster Kraftwagen | 1886 | Gottlieb Daimler |
| Erster Drehkolbenmotor | 1957 | Felix Wankel |
Erster Luftreifen für Fahrräder |
1988 | John Boyd Dunlop |
Brian war ratlos. Obwohl er eine hohe Affinität zu Naturwissenschaften und Technik hatte, erkannte er keinen einzigen Namen. Den Wankelmotor hätten doch Westafrikanerinnen erfunden, Martha Savindi und Julia Nyarare. Genauso wie den Fahrradreifen. Die waren doch im Afrika des 14. oder 15. Jahrhundert entstanden! Er erinnerte sich an sein altes Geographiebuch. Darin wurde Afrika als ehemals hoch industrialisiert bezeichnet. Westliche Konzerne aber hätten Privatarmeen ausgerüstet und den blühenden Kontinent erobert. Hätten alles gestohlen, was nicht niet- und nagelfest war. Selbst Straßen und Stromleitungen wurden demontiert, Brunnen und Bewässerungsgräben zugeschüttet, Stromleitungen abgebaut, Fabriken gesprengt, zehntausende Wissenschaftler umgebracht – eine ganze Industriekultur gelöscht.
Die gestohlenen Erfindungen hätten die Nordhalbkugel dann so reich gemacht wie sie es heute war. Ginge es nach den Schulbüchern, dann wäre es heute die moralische Verpflichtung Eurasiens, Afrikas Infrastruktur wiederaufzubauen.
„Der erste Motorwagen?“, murmelte Miller. „War das nicht diese Indianerin aus dem Regenwald, diese Yanomami? Aber doch niemals dieser Benz – ein Deutscher!“
„Peng!“ - ein alter Regenschirm war umgefallen. Es staubte ein wenig. Brian war zu Tode erschrocken. Plötzlich war er klar im Kopf: er hätte diesen Fall sofort einer Zeitung melden müssen! Verlage, Buchhändler und Zeitungen wurden von Parteimitgliedern des Inneren Kreises herausgegeben (die angestellten Journalisten selber distanzierten sich offiziell zwar von der Partei, um ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren, teilten aber deren Ansichten).
Allerdings wäre die Meldung des Bücherfundes einer offiziellen Anzeige Maggy Poppes gleichgekommen. Dann hätte es eine Untersuchung gegeben. Miller hätte sich öffentlich von dem »rechten Schund« distanziert – und alles wäre gut gewesen.
Aber Brian Miller, der in seinem Leben immer das Richtige getan hatte, um weiterzukommen, dieser Miller tat dieses eine Mal das Falsche. Mit einem schnellen Ruck riss er die Seite aus dem »Guiness Buch der Rekorde 1984«, faltete sie zusammen und steckte sie in seine linke Hosentasche. Dann packte er die Bücher mitsamt der dunkelblauen Mappe in die schwarze Sporttasche, in der er seine Jause aufbewahrte. Er vergewisserte sich, dass nichts mehr hinter der Mauer war. Dann begann er, wie ein Irrer auf die Wand einzudreschen.
Er hatte Einiges aufzuholen! Und er wollte ja nicht gleich die Teleschirme nervös machen. Die konnten nämlich von sich aus aktiv werden. Etwa, wenn sie jemand beim Arbeiten wahrnahmen, und die theoretisch dafür notwenige Zeit nicht mit der tatsächlich aufgewendeten übereinstimmte.
Zwei Stunden später lagen die Reste der gesamten Gipskartonwand auf der Ladefläche eines Pritschenwagens. Der alte Toyota war ein Oldtimer, lief noch mit Diesel. Er gehörte einem Arbeitskollegen. Am Vortag war in den Wagen eingebrochen worden, Teleschirm und Navi fehlten deshalb. Weil in der Werkstatt kein Termin frei war, wurde die eingeschlagene Beifahrerscheibe notdürftig mit Karton und braunem Paketband verklebt. Die verdunkelte Scheibe störte Brian nicht im Geringsten. So konnten die Kameras entlang der Straße das Auto weniger leicht ausspähen.
Um siebzehn Uhr lud Miller seinen Schutt ab. Als der Pritschenwagen vom Gelände des Entsorgungsplatzes rollte, ließ die Anspannung etwas nach. Miller bog rechts ab und fuhr die Straße langsam hinunter. Seine Blicke suchten nach der Tasche. Sie lag am Boden vor dem Beifahrersitz. Was sollte er nur machen?
Brian grübelte. Würde man im Rahmen einer Untersuchung denn nicht seine Fingerabdrücke auf den Büchern finden? Dann könnte man ja schließen, dass er von Poppes rechten Gedanken infiziert worden wäre! Oft reichten schon zwei falsche Klicks auf Facebook, um auf SET (Second English Television) als Rechter zum Gespött gemacht zu werden. Selbst wenn alle Vorwürfe im Sand verlaufen würde – am Ende bliebe immer etwas hängen! Das könnte seinem Score schaden, und seiner Karriere.
Brian malte sich gerade aus, wie er mit hundert anderen Proles am Fließband stand und Regenschirme im Akkord zusammensteckte. Die Luft in der Maschinenhalle war stickig und feucht. Er schwitzte am ganzen Leib. Das metallene Klappern der Maschinen verhinderte jede Kommunikation. Schweißtropfen klatschten auf seine Brille.
Vollbremsung!
„Scheiße!“ Brian flog in seinen Gurt.
Der Wagen hatte vollautomatisch an einer roten Ampel gehalten. Miller spielte alle Varianten durch: sollte er der Presse das Material anonym zuspielen? Dann würde Maggy zum Thema im nächsten 2-Minutenhass werden – und das auf ihre alten Tage! Das Land würde über sie herfallen und am Ende würde sie doch vaporisiert werden. Wo sie doch ihr ganzes Leben den Armen gewidmet hatte – das hatte sie sich nicht verdient! Und außerdem: um das anonyme Paket zu ihm zurückzuverfolgen, dazu brauchte es in diesen Tagen wahrlich keinen Sherlock Holmes mehr. Der Chip im Arm verriet dem System, wann Miller in der Nähe welchen Briefkastens gewesen war, und was er dort gemacht hatte.
Zu sich nach Hause gehen konnte Miller aber auch nicht, denn da war ja Betty. Seine Frau war eine »Hundertsexprozentige«. So nannte man jene fanatischen Parteianhängerinnen, die von Kindesbeinen an ihr Leben dem Gemeinwohl opferten. Mit siebzehn hatte Betty einen inhaftierten Kriminellen geheiratet (als der nach drei Jahren rauskam und Betty halbtot schlug, ward sie flugs wieder geschieden). Dann war sie vier Jahre mit einer lesbischen Frau zusammen. Und das, obwohl sie heterosexuell war. Sie wollte einfach nur beweisen, dass es keine Rolle spielte, ob man sich gerade als Mann, als Frau oder als Birke fühlte – oder als alles drei zusammen. Am Ende war die Lesbe mit einer anderen durchgebrannt.
Dann wurde Betty Krankenschwester. Dieser Beruf verband den hehren Gedanken des Helfens mit den Annehmlichkeiten eines öffentlich Bediensteten. Betty war also Pflegerin, als sie dem aufstrebenden Beamten Brian Miller begegnete. Es war Liebe auf den ersten Blick.
Mit Anlaufschwierigkeiten. Denn Betty wollte zwar ein Kind – aber ihre Zeit nicht mit Schwanger-sein vertrödeln. Keinesfalls wollte sie »wie die faulen, reaktionären Proles« zu Hause bei ihrem schreienden Balg herumhängen. Besser sich verwirklichen – das lernte man schon in der Schule. Deshalb adoptierten die beiden ein vierjähriges Kind aus Bolivien: Rose Horatia. Heute ist Rose sieben Jahre alt. Der Kindsmutter, eine indianische Proles, hatte die Importfirma etwas Geld zugesteckt.
Miller konnte also weder zu seiner Frau gehen, noch zu irgendeinem Freund. Streng genommen hatte er auch keinen – weil niemand in Eurasien Freunde hatte. Außer auf Facebook oder Instagram. Denn jede Kommunikation barg stets die Gefahr einer Enttarnung als vermeintlich Rechter; und so war die eurasische Gesellschaft von extremer Selbstkontrolle geprägt – und seelischer Einsamkeit.
Wer im Gespräch nicht jedes Wort bedachte, wurde schnell zurückgepfiffen: „Das war jetzt aber nicht gerade politisch korrekt!“, entrüstete sich dann sein Gegenüber. Sich politisch korrekt auszudrücken bedeutete, die von der Partei erfundene Sprache, Neusprech zu verwenden. Damit übernahm man automatisch auch das »moderne, linke Denken« der Partei.
Gefährlich auch das Mittagessen in Kantinen: man saß am Tisch zusammen, kleine Runde, kannte sich vom Arbeitsplatz. Da reichte eine flapsige Bemerkung über NJOs, und „dass die auch nicht gerade das Arbeiten erfunden hätten!“ – Zack, schon stand man im Büro des Vorgesetzten. Der redete dem Unvorsichtigen dann ins Gewissen: „Denken Sie doch an den guten Ruf der Firma!“
Selbst zu Hause lauerte Gefahr. Wer glaubte, im Freundeskreis Witze über Zuwanderer machen zu dürfen, nur weil die mit acht Kindern und zwei Ehefrauen mehr Sozialhilfe kassierten als fünf heimische Proles-Familien mit körperlicher Arbeit, der kriegte schnell mal Post von der Justiz. Weil er vom besten Freund oder gar dem eigenen Kind angeschwärzt worden war (vor allem wenn dieses bei den Kinderspitzeln war).
Eurasienweit waren im letzten Jahr über 6 Millionen Hinweise über ökosozial-unerwünschtes Verhalten eingegangen. Eine Million davon über die Eltern-Denunzierungs-Website des Wahrheitsministeriums (»Der kleine General erzieht jetzt seine Eltern!«).
Auch im Internet hatte man auf der Hut zu sein. Einen süffisanten Kommentar gelikt – weil Soziologen eine vierköpfige Familie mit 2 600 Globo netto im Monat als armutsgefährdet bezeichneten? Da schaltete das Serfy schnell auf Neoliberalismus-Alarm.
Im Alltag gab es immer irgendjemanden, der sich schnell ein paar Gemeinwohl-Punkte verdienen wollte. Der Verräter kam auf´s Titelblatt, wurde für gutdotierte Preise vorgeschlagen. Der Verratene hingegen hatte schlechte Karten. Beharrte er auf seinen rechten Thesen, war ein One Way-Ticket in die Hölle fix gebucht.
Hinter Miller hupte jemand. Erschrocken blickte er sich um. Da - ein freier Parkplatz! Eine kleine Lücke, mitten zwischen großen Lastern. Im Nu war Millers kleiner Pritschenwagen eingeparkt. Er wischte sich den Schweiß von seiner Stirn und atmete tief durch. Da bemerkte er, dass die beiden 360 Grad-Kameras, die an den Lichtmasten am Gehsteig installiert waren, von den LKWs verdeckt wurden. Der Toyota stand quasi in einem toten Winkel.
Mit dem Aufkommen des Mobilfunkstandards 5G hatten Lawinen von Antennen Einzug in Eurasiens Städte gehalten. Die kleinen sahen wie Igel aus: sie hatten kleine Stacheln, nur eben aus Metall. Jeder Laternenpfahl, jede Ampel, jeder Balken, der über die Straße ragte, jedes Gebäude: auf beinahe jedem Bauteil Eurasiens prangte eine solche 5G-Antenne. Und jede war mit einer hochauflösenden 360-Grad-Kamera versehen, die permanent filmte, fotografierte und lauschte.
Die Daten wurden in Echtzeit in die einzelnen Volksordner der Bürger überspielt und einsortiert. Am Ende hatte der Staat von jedem Tag eines Eurasiers ein 24-Stunden-Video. Und das aus mehreren Perspektiven.
Miller stellte den Motor ab. Ängstlich beobachtete er den menschenleeren Gehsteig. Seine linke Hand suchte mit kreisenden Bewegungen nach der Tasche. Da war der blaue Ordner! Miller zog ein verblichenes Farbbild heraus. Es zeigte Margaret Poppe im Arm eines großen Mannes. Im Hintergrund war ein Gartenhaus aus groben Holzbohlen zu erkennen. Es stand inmitten eines gepflegten Gartens mit Blumen und sorgfältig gestutzten Büschen. Irgendwie erinnerte ihn die Blockhütte an jene auf dem Bild in Maggys Küche. Zitternd wendete Brian das Bild. Mit feinem Bleistift standen die in Handschrift geschriebenen Worte: »Mit Oscar, Gunnar-Myrdal-Weg 69b«.
In Eurasiens Schulen lernten die Kinder schon seit langem keine Handschrift mehr. Wäre zu konservativ, hieß es. Außerdem bräuchte es für digitale Geräte ja keine Handschrift.
„Gunnar-Myrdal-Weg?“ Wo hatte Brian Miller das schon mal gehört?
Selbst wenn das Navigationsinstrument seines Pritschenwagens nicht gestohlen worden wäre – er hätte die Adresse nicht eingeben können. In Millisekunden wäre er auf dem Radar des Ministeriums für Liebe gewesen. Ein automatisierter Anruf hätte in gefragt, warum er dorthin fahre und was er dort vorhabe. Das System würde wissen wollen, warum er nicht den öffentlichen Bus nehme und warum er mit einer Individualfahrt unnötig CO2 produziere.
Brian versank in Gedanken: Gunnar-Myrdal-Weg. War er dort nicht schon einmal gewesen? Bilder aus der Kindheit tauchten auf: ein altes Ehepaar in einem kleinen Bungalow. Niedere Decke, winziges Wohnzimmer mit großen, gläsernen Terrassentüren. Davor ein kleiner Pool im Schatten großer Bäume. Tante und Onkel... die eigentlich keine echten Tanten und Onkel waren, sondern Freunde der Familie. Thujen-Hecken, sauber geschnitten. Wie hießen die beiden schnell noch mal, Tante Harriet und...?
Gemeinsam mit der Mutter waren er und Bruder Robert immer wieder mal zum Baden eingeladen gewesen, hatten unbeschwerte Stunden verbracht. Wenn sie von der Bushaltestelle zu Tante Harriet gingen – war da nicht dieser Myrdal-Weg gleich um die Ecke gewesen? Da war doch diese Gartenhaussiedlung aus den 1970ern; die mit den großen alten Bäumen! Langsam kamen die Erinnerungen.
Ohne über die Konsequenzen seines Handelns nachzudenken, parkte Miller aus der engen Lücke aus. Dann fuhr er in jene Richtung, in der er das Gartenhaus vermutete. Miller zitterte am ganzen Leib, als ob er Hunger hätte. Er fuhr so unauffällig wie nur irgendwie möglich. Also nicht zu schnell – und auch nicht zu langsam! Ein Glück, dass der Wagen einem hohen Funktionär gehörte. Da lösten die SERPH-Systeme nicht so schnell Alarm aus.
Es war stockfinster, als Miller das Proles-Viertel erreichte. Die Straßen waren ungepflegt, Laternenmasten Mangelware. Damit war aber auch die Dichte an 5G-Kameras niedriger. Jetzt noch schnell unter der düsteren Autobahnbrücke hindurch, und nach einem Kilometer scharf rechts abgebogen.
Und tatsächlich – auf dem digitalen Straßenschild stand Gunnar-Myrdal-Weg. Behäbig steuerte der Pritschenwagen durch Pfützen und Schlaglöcher. Wo der Asphalt fehlte, ging es über alte Pflastersteine. Und überall lag Unrat. Da waren Reste eines rostigen Fahrrades. Es lehnte an einer großen Birke. Davor ein kleiner See schwarz glänzenden Wassers. Er nahm die Hälfte der Straße ein. Gehsteige konnte Brian nicht erkennen. Wofür denn auch? Menschen waren nicht zu sehen.
Da die Nummern der etwas nach hinten versetzten Häuschen von der Straße aus nur schlecht zu erkennen waren, musste Miller immer wieder anhalten. Die Häuschen hier schienen alle gemauert zu sein, vom Holzbohlenhaus Maggys keine Spur. Ob es irgendwann einmal einem Ziegelbau gewichen war?
Automatische Vollbremsung – schon wieder! Miller hatte übersehen, dass der Weg hier eine scharfe Linkskehre machte – und sogleich zu Ende war. Nun saß er also hier: in einem fremden Auto, in der schwärzesten Nacht des Jahres, in der trostlosesten Gegend einer an sich schon trostlosen Stadt! So trostlos, dass die Partei hier nicht einmal Kameras angebracht hatte!
Verzweifelt stieg Miller aus und lehnte sich an einen Stromkasten. Er fror. Sein Blick verlor sich in der vor Regennässe schwarz glänzenden Straße. Da bemerkte er, dass er an einem Wiesengrundstück vorbeigefahren war. Wahrscheinlich, weil kein Gartenhaus darauf zu sehen war. Das Grundstück war keine 20 Meter lang. Links und rechts liefen im rechten Winkel Zäune nach hinten, verloren sich im Dunkel. Wie in Trance spazierte Brian auf das Grundstück zu, die Sporttasche lässig um die Schulter gehängt. Je näher er kam, desto weiter schien sich das Grundstück nach hinten zu erstrecken.
Das Gras stand meterhoch, ausgewachsene Büsche verdeckten die Sicht. Hierher drang kein Laternenschein. Millers Schuhe versanken in kalten Pfützen, Zweige schlugen ihm ins Gesicht.
Und dann die Sensation: da war ein altes Holzhaus! Die Umrisse passten exakt zu jenem Bild, das Miller im Kopf hatte. Unsicher blickte er hinter sich. Konnte man ihn etwa sehen? Sein Serfy hatte er jedenfalls im Wagen gelassen. An der Vorderseite des Hauses war eine Veranda. Vor der Türe türmte sich Sperrmüll auf, die Fenster waren mit schmiedeeisernen Gittern versehen. Auch seitlich der Hütte lag Bauschutt, überdeckt von tiefhängenden Fichtenzweigen.
Da, an der hinteren Seite – eine Eingangstüre! Doch leider verschlossen. Geschickt drückte Miller eine Scheibe aus dem morschen Fensterrahmen und öffnete die Türe durch das Fenster. War da nicht ein kleiner Tisch? Und stand da nicht eine alte Nachtwächterlampe auf dem Tisch? Und da – ein altes Feuerzeug! Schnell waren ein paar Teelichter zum Leuchten gebracht.
Volltreffer! Die Hütte bestand aus einem großen länglichen Raum, der mit Fichtenholzpanelen verkleidet war. Die schmälere, zur Straße gerichtete Seite beherbergte die Haupteingangstüre, dahinter (draußen) die Veranda.
An der hinteren Wand stand ein Rattan-Ausziehsofa in gelbrotem Karo. Links und rechts davon zwei weiße Plastikstühle. In der Mitte des Raumes stand ein kleines Rattan-Tischchen. Auf ihm brannten jetzt die Kerzen. An den Wänden hingen viele Fotos. Am häufigsten waren die junge Margaret Poppe und ihr Mann, dieser Oscar zu sehen.
Erschöpft ließ sich Miller auf das alte, modrige Sofa fallen. Wenn ihn jemand vom Ministerium so sehen würde! Radeck etwa, was würde der jetzt sagen? Was sollte er Betty sagen, wenn sie heute wissen wollte, wo er den Abend über gesteckt hätte? Ob sie sein Bewegungsprotokoll anfordern würde?
Angst überkam ihn. Hastig zog Miller die Bücher mitsamt der Dokumentenmappe aus der Tasche. Seine Blicke durchsuchten den spärlich erleuchteten Raum. An einem alten, dunkelbraunen Wandkasten blieben sie hängen. Die schwere Vollholztüre knarrte beim Öffnen. Brian ertastete einen Stapel voller Decken. Flugs waren Maggys Bücherschätze darunter geschoben.
Jetzt entdeckte er auf dem Rattan-Tischchen etwas Metallenes: es war ein alter Schlüssel. Ob der wohl in das Schloss der Seitentüre passte? Er passte!
Müde verließ Brian die Hütte. Draußen legte er den Schlüssel unter einen alten Ziegel. Dann hastete er – ohne sich auch nur einmal umzusehen – zum Auto. Die Fahrertüre stand halboffen als er kam. Es schien niemandem aufgefallen zu sein!
Um 23:00 öffnete ihm eine genervt wirkende Ehefrau die Haustüre.
2
„Klack – klack, klack – klack - klack. Klack.“
In flinkem Stakkato klimperten Anna Hardys Fingernägel auf der Tastatur. Da konnte doch etwas nicht stimmen! Hardy arbeitete beim MIRROR, dem bekanntesten Nachrichtenmagazin Englands.
Es war Montag und schon knapp vor zehn. Schon eine Viertelstunde bemühte sich die Journalistin, sich im System anzumelden – doch ohne Erfolg. Immer wieder gab sie Namenskürzel und Passwort ein, doch statt ihrem Familiennamen erschien der einer fremden Person: Anna Knightly. Das verrückte dabei: alle anderen Daten, die am Bildschirm zu lesen waren, stimmten mit den ihren überein. Da war ihr Bild, ihre Funktion im Verlag und ihr Gemeinwohl-Score.
Hardy klickte auf das Feld Gemeinwohl-Score. Sofort erschien die Bepunktung ihres gestrigen Tages – aber eben unter fremdem Namen; eben dieser Anna Knightly. Sie überflog den gestrigen Sonntag – und schluckte. Da stand ein Minus von 0,825 Punkten!
Anna war verdutzt, hatte sie doch mit einem Zuwachs gerechnet. Natürlich wusste sie, dass man sich als normaler Mensch moralisch immer ein bisschen besser einstufte als dies die soziologisch ausgeklügelten Computer-Programmen taten – aber gleich ein Minus?
Sie las die knappe Begründung: sie hätte für 2:12 Minuten Eigennutz-orientiertes Verhalten an den Tag gelegt. Kurz schob Hardy ihr Problem mit dem verkorksten Systemeinstieg beiseite und klickte weiter. Ein Fenster poppte auf. Darin war Schwarz auf Weiß zu lesen: „anna.knightly.15.02.85,DVR42587541LON.verwendet12.05.2024/11:21:10.gier.profit.in.gespräch.bis.12.05.2024/11:23:22.materialist.verhalten.diagnost,perspiration+11%/pulse.68+4/rate.speaking-7%/voice177Hz+4“.
Am Seitenrand dann die Erklärung: Anna Hardy hätte mit langsam werdender Stimme die Wörter Gier und Profit verwendet. Dabei wäre ihr Puls angestiegen, ihre Haut hätte um 11% mehr Schweiß als üblich produziert.
Ratlos ließ Anna den gestrigen Tag revuepassieren. Da ging ihr ein Licht auf! Sie war bei einer Freundin zum Frühstück eingeladen. Beiläufig hatte sie der Freundin geraten, sich doch einen Kaffeeautomaten anzuschaffen, ihre ganze Familie könne davon profitieren. Sie solle doch bloß ihren Sohn Fred beobachten, wie gierig der eine Tasse nach der anderen in sich hineinleere.
Dass SERPH-Telefone Situationen falsch interpretierten, kam immer wieder vor. Immerhin analysierte sie Tag und Nacht jede einzelne Bewegung eines Menschen und dessen Umgebung auf ihre öko-soziale Moralgüte hin.
Alle Daten, die das SERPH-System untertags sammelte, wurden von Mitternacht bis 4 Uhr morgens ausgewertet und in Form aktualisierter Gemeinwohl-Scores in den 620 Millionen Volksordnern abgelegt. Ab 4:01 konnten sie über das Serfy abgerufen werden. War man mit seiner automatisierten Bewertung unzufrieden, konnte man diese binnen 24 Stunden beeinspruchen.
Anna drückte den Button mit dem GWS-Einspruchsformular, da öffnete sich eine Fehlermeldung: „Anna Knightly – bitte einloggen!“
Anna sah sich den Report an: es war ihre DVR-Nummer! Anna checkte die Einstellungen. Tatsächlich: selbst die Adresse des Benediktinerinnen-Heimes, in dem sie groß geworden war, stimmte: Paul-Bronfstein-Platz 4a. Sogar ihre Bewegungsdaten waren korrekt aufgezeichnet worden. Auch, dass sie gestern achtmal auf der Toilette war, und dass sie beim letzten Mal 20 Minuten lang geblieben war. Das alles stimmte. Anna schmunzelte: das Apothekensymbol rechts neben dem Gemeinwohlbericht empfahl ihr ein bekanntes Medikament gegen Durchfall. Daneben blinkte nervös ein grünes Dreieck: es warnte vor dem heimlichen Konsum rechter Literatur auf der Toilette. Darunter das rote Sozio-Symbol. Es mahnte Anna, nicht so viel Zeit alleine zu verbringen. Deshalb schlug es Anna vier Personen in ihrer näheren Umgebung vor, die sich ebenfalls gerade einsam fühlen könnten.
Wie viele Journalisten war Anna nur äußeres Mitglied der Partei. Es war ihr wichtig, nach außen hin ein gewisses Maß an ideologischer Unabhängigkeit auszustrahlen. Was natürlich nicht gleich hieß, das ideologische Staatsgrundziele der »totalen Gleichheit aller Menschen« in Frage zu stellen. Alleine der Gedanke schien ihr schon absurd.
Es war ja auch nicht schwer zu kapieren: alle Erdenbürger waren exakt gleich talentiert, gleich ehrgeizig, gleich diszipliniert und gleich friedfertig. Folglich müssten auch alle Menschen dieser Welt irgendwann auch gleich viel besitzen und gleich zufrieden sein. Doch weil die Kluft zwischen den Schichten nicht und nicht kleiner wurde (wie Heerscharen von Soziologen immer wieder auf´s Neue enttäuscht feststellten), schlossen sie, dass die Reicheren ihren Wohlstand den Ärmeren wohl gestohlen haben mussten. Sie mussten diese offensichtlich ausgebeutet, ausgetrickst und durch das Einziehen gläserner Decken diskriminiert haben.
Deshalb brauchte es die Medien. Journalisten wie Anna sahen es als ihre Lebensaufgabe an, diese gläsernen Decken, die die Ärmeren am Aufschließen zu den Reicheren hinderten, sichtbar zu machen und zu bekämpfen.
Besonders stark widerte Anna die Weltverschwörung gegen Afrikaner an. Wo immer in der Welt sich Afrikaner ansiedelten, verdienten sie weniger als die anderen Bevölkerungsgruppen. Sie lebten in labileren Beziehungen, waren krimineller und öfter drogenabhängig als die anderen. Anna konnte sich das nur so erklären, dass es eine gigantische Weltverschwörung geben musste. Eine, in der sich sechseinhalb Milliarden Menschen gegen eine Milliarde Afrikaner verschworen haben musste.
Um diesen geheimen Bünden auf die Schliche zu kommen, musste man sich als Redakteurin immer wieder in die kranken Gehirne von Rechten und Rassisten hineinversetzen. Das war gefährlich. Denn die Gedankenpolizei war schnell zur Stelle, wenn die Mobiltelefone Kontakt mit vermeintlich Bürgerlichen meldeten. Das brachte dann nicht nur die Person mit rechten Gedanken in die Bredouille – sondern alle Personen, die sich in der Nähe des Bösewichtes, beziehungsweise dessen Serfys aufgehalten hatten. Sie alle wurden vom SERPH-System erfasst und an die Behörden gemeldet – oder an die Presse.
Ebendiese Anzeigen waren das tägliche Brot des MIRRORs und seiner bunten Ableger: Star und PICTURE.
Der Star war ein linkes Magazin mit Bildern nackter Frauen und viel Moral. Letztens hatte der Star behauptet, die 64jährige, verrunzelte Ehefrau des linken Präsidenten Frankreichs wäre objektiv hübscher als das 35-jährige Fotomodell, mit dem der rechte US-Präsident verheiratet war. Damals hatte sogar Anna ihre Stirne runzeln müssen.
PICTURE hingegen war ein Revolverblatt für männliche Proles; großformatige Bilder, viel Fußball und flammende Appelle, dem Rechtsextremismus zu entsagen.
Wurden der Presse kleinere Gemeinwohl-Vergehen angezeigt, oblag es Redakteuren wie Anna Hardy, wie sie damit umgingen. Oft reichte ein scharfer Artikel, um den Linksabweichler zur Vernunft zu bringen. Etwa: »Mietenhai flog jahrelang mit dem Flugzeug in den Urlaub – sein CO2-Footprint scherte ihn so wenig wie die Menschen in seinem Haus!« (Mietenhai war Neusprech und hieß Vermieter). Nach der Veröffentlichung verlor er Freunde und Gemeinwohl-Punkte. Beharrte er dann immer noch auf seiner rechten Meinung, schalteten sich Gerichte und Verbände ein. Die deckten den Unbelehrbaren mit Anzeigen wegen Verhetzung und Beleidigung ein. Das rief dann auch die Antira auf den Plan. Die demonstrierte vor dem Haus des rechten Recken, verprügelte die Kinder. Spätestens dann waren auch Familie, Job und Sparbuch weg. In letzter Konsequenz wurden solche Volksschädlinge einfach vaporisiert.
Manchmal kamen solche Fälle auch vor einen Gemeinwohl-Konvent. Dieser bildete einen bunten Schnitt der Gesellschaft ab. Da waren einmal die Absolventen marxistischer Fakultäten (vor allem der Soziologie, Philosophie, Politologie und Psychologie. Manchmal auch der Erziehungswissenschaft und der Volkswirtschaft). Dazu gesellten sich Gewerkschafter, Sozialpolitiker, Gender-, Feminismus- und Rassismus-Beauftragte. Immer mit dabei: die Experten der Sprachpolizei. Abgesandte des Miniliebs prüften, ob sich die Geschichte für den 2-Minutenhass verwenden ließ. War selbst vaporisieren noch zu wenig, koordinierte das Minilieb auch die Verfrachtung in Gemeinwohl-Camps (auf Neusprech auch Lustlager genannt). Dort wurden sie moralisch auf Kurs gebracht, oft ein Leben lang.
Anna Hardy starrte zum Fenster hinaus. Ob Kollege Herb von Zimmer 32 helfen konnte? Für einen Gemeinwohlpunkt machte der doch alles! Doch Fehlanzeige. Auch Herb gelang es nicht, Annas Namen auf den Schirm zu zaubern.
Plötzlich, Anna hatte sich gerade eine Tasse Tee geholt, fuhr ihr Rechner wie von Zauberhand gesteuert von alleine runter – und dann wieder rauf. Und plötzlich stand Anna Hardys korrekter Name auf dem Schirm: Anna Hardy.
„Geht doch, Scheiß-Ding! – Oh, Entschuldigung, ich meinte: du liebes Ding!“ murmelte Anna erleichtert (um ein Haar hätte Anna eine weitere Kürzung ihres Gemeinwohl-Scores riskiert).
Mit zwei Stunden Verspätung begann sie ihre Arbeit. Es mussten drei Presseaussendungen der staatlichen Presseagentur zu MIRROR-Geschichten umgeschrieben werden. Natürlich, ohne kritisch zu recherchieren. Wer sich als Redakteur nämlich selber Gedanken machte, der musste sich dem Vorwurf aussetzen, die Datengüte einer staatlichen Quelle anzuzweifeln. Außerdem wollte man sich nicht die Blöße geben, ideologisch-korrekt formulierten Direktiven geistig nicht folgen zu können. Beispiel Goldstein: egal, was der Konservative tat und sagte – es war stets zu 100 Prozent schlecht. Es war daher nicht die Aufgabe eines guten Journalisten, Meldungen über Goldstein auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Man musste nur herausfinden, warum genau eine konkrete Goldstein-Handlung schlecht war.
Mittlerweile war es 17 Uhr geworden, und Anna wollte eben ihre Sachen packen. Da kam er wieder, dieser Schmerz. Verkrampft schloss Hardy ihre Augen. Ihr Unterleib tat höllisch weh. Das tat er immer bei Wetterumschwung, oder wenn sie unzufrieden war. Medizinisch war das schon lange abgeklärt. Die letzte Ärztin hatte sie sogar aufgefordert, sich wegen dem lächerlichen Bauchzwicken nicht so anzustellen. Jede weitere Behandlung wäre eine Verschwendung von Steuergeldern, meinte sie.
Gedankenverloren schlenderte Hardy in die Tiefgarage. Da stand sie nun vor ihrem Auto und hielt inne. Ihr war, als bekäme sie keine Luft zum Atmen, ihr Unterleib schmerzte, und ihr war richtig übel. Statt die Türe zu öffnen, drehte sie sich einfach um und schritt die Tiefgaragenabfahrt hinauf. Als sie an der Straße oben war, fühlte sie sich besser.
Erleichtert blinzelte sie in den dunklen Himmel. Eine kühle Meeresbrise strich über ihr Gesicht. Ihr Kopf war gedankenleer. Ohne ein konkretes Ziel vor Augen, schlenderte sie die Straße entlang.
Anna musste niemandem Bescheid sagen, sie war Single. Ob sich die Sprachassistentin ihres Handys Sorgen machte? Ein bisschen Kopf auslüften – das müsste doch erlaubt sein, oder?
Anna kam zu einer Bushaltestelle. Gerade fuhr ein Autobus mit dem Schild »East End« in die Haltestelle ein. Ohne zu zögern stieg sie ein. Den linken Oberarm an die Chiplesestelle im Bus gehalten, dann zum nächsten Fensterplatz. Leise surrend nahm der Wasserstoffbetriebene Bus an Fahrt auf.
Nach einer Weile wurde die Gegend, die an Annas leeren Blicken vorbeizog, immer schmuddeliger. Die Häuserfassaden waren dunkel vor Schmutz, die Straßenlöcher wurden größer. Frauen sah man keine mehr. Und wenn, dann waren sie verschleiert. Die älteren Männer trugen wallende Tücher, oft in Weiß. Anna wechselte den Bus, gelangweilt blickte sie ins Schmuddelwetter, das an ihr vorüberzog. Als sie an einem heruntergekommenen Backsteingebäude vorbeikam, erhellte sich mit einem Male Annas Gesicht. Es war jener Ort, an dem sie bis zu ihrem 18. Geburtstag gelebt hatte: das Waisenhaus am Bronfstein-Platz!
Der Baukörper war etwa fünfzehn Meter nach hinten versetzt. Große Linden standen vor dem alten Haus. Ohne zu zögern, sprang Hardy aus dem Bus. Jetzt war alles klar: sie hatte sich nach ihrem alten Heim gesehnt! Lag wohl an dem Namenswirrwarr auf dem Firmen-Rechner heute Morgen. Egal. Hier, am Bronfstein-Platz, da hatte niemals jemand an ihrer Identität gezweifelt. Wenn sie sich recht entsann, hatte sie hier sogar die glücklichste Zeit ihres Lebens verbracht. Und zwar als Anna Hardy.
Langsam schlurfte sie zu einer alten, vermoderten Parkbank. Was wollte sie jetzt tun? Ihr Kopf war leer, und ihr Körper schmerzte. Heute mehr als sonst. Wieder musste Anna an ihr Serfy denken. Wenn ihr Assistent sie fragte: welchen Grund hatte sie, jetzt hier zu sein?
„Anna?“ „Anna!“
Anna hatte das Rufen anfangs gar nicht gehört.
„Anna Hardy!“ Eine alte Dame stand neben Anna, eine Tragetasche in der Hand. Sie stützte sich auf einen Gehstock.
„Greta Boskovich!“, entkam es Anna wie aus dem Mund geschossen. „Das ist doch nicht möglich!“ Greta war Anna Hardys liebste Erzieherin gewesen. Anna durfte sie sogar Gretchen nennen.
„Was machst du denn hier – ich kann doch noch Anna zu Dir sagen?“ Die alte Frau strahlte über das ganze Gesicht. Und noch ehe Anna es sich versah, wurde sie schon von Gretchen umarmt.
Jetzt kullerten beiden Frauen die Tränen über die Wangen.
„Magst du auf einen Tee hereinkommen? Ich bin schon lange in Rente, aber was soll ich alleine zu Hause tun? Da bin ich lieber in meinem alten Heim zu Besuch und halte die jungen Erzieherinnen vom Arbeiten ab!“
Drei Minuten später saßen sie im Pausenraum der diensthabenden Erzieherin.
Bis auf die neuen Gesichter der jüngeren Angestellten hatte sich im Haus nicht viel verändert. In den Gängen standen noch immer die dunklen, mannshohen Holzmöbel aus billigem Sperrholzfurnier. Selbst die grünen Spannteppiche waren noch da. Das ließ die Räume noch kleiner wirken als sie ohnedies schon waren.
Diensthabende Erzieherin war an diesem Abend Fanny Farnsborough. Sie war 30 Jahre alt. Eine freundliche Person, was gut zu ihrer pummeligen Statur passte. Als sie einen Streifgang durch das Heim machte, entspann sich zwischen Anna und Greta eine nette Plauderei. Seit Anna ausgezogen war, hätte der Staat nichts mehr ins Heim investiert. Einzig in die EDV wäre Geld geflossen. Dann fiel das Gespräch auf Annas Erlebnis von heute Morgen.
Fanny, die von ihrem Rundgang gerade zurückgekommen war, schlug vor, im Computer des Waisenhauses nachzusehen. Leider ergab auch dieser Versuch nichts. Anna Hardy war immer Anna Hardy gewesen. Zwar standen auf ihrem digitalen Datenblatt Kürzel wie „FC“ oder „BMT11/H“ – aber sie betrafen immer eine Anna Hardy. Nichts Auffälliges an Annas Akt, sogar der Button »weitere Quellen« war mangels Daten inaktiv.
Auf der einen Seite war Anna erleichtert, andererseits aber auch enttäuscht. Hatte sie doch für ein paar Momente gehofft, etwas über ihre Eltern zu erfahren. Aber wer weiß – vielleicht hätte sie diese Erkenntnis ohnedies nur verletzt. Anna wurde von einer leichten Melancholie erfasst. Ihr war nach Alkohol zumute.
Fanny ließ sich nicht lange bitten, und schon stand eine Flasche selbst gemachten Eierliköres auf dem Tisch. Anna schenkte fleißig ein. Alte Geschichten wurden aus der Versenkung geholt, und Greta brachte die Runde mit Anekdoten zum Lachen. Gegen elf Uhr zog sich Fanny in das Erzieherinnen-Schlafzimmer zurück. Greta Boskovich und Anna Hardy erkannten, doch etwas zu viel getrunken zu haben. Schnell löste sich die Runde auf.
Vor dem Heim bestellte Anna ein Taxi für Greta. Nachdem Greta weg war, wollte sich auch Anna eines rufen – doch sie änderte mit einem Male ihre Meinung. Sie war doch nicht in Eile! Sie war leicht betrunken, nun wollte sie den kleinen Rausch genießen. Vorsichtig setzte sie sich auf eine moosige Parkbank.
Ihre Gedanken begannen zu rattern. Warum war der Button für »weitere Quellen« auf ihrer Karteikarte inaktiv? Hatten die Kürzel auf ihrem Datenblatt doch eine Bedeutung? Konnte FC vielleicht Filing Cabinet bedeuten? Stand BMT für Basement, und die 11 für eine Zimmernummer? War »H« gar die Abkürzung für Hardy?
Mit einem Schlag war Anna nüchtern. Sie erinnerte sich: wer sich im Heim als Kind früher eines Solidaritätsvergehens schuldig gemacht hatte, kam für ein paar Stunden in den Keller.
Mit einem Schaudern dachte sie zurück: Anna hatte sich einmal vor dem gemeinschaftlichen Aufräumen gedrückt. Am Abend sperrte man sie deshalb in einen dunklen Kellerraum. Sie mochte dort schon einige Stunden weinend verbracht haben, als sie hörte, wie eine Erzieherin die Treppen herunterschlurfte. Die Schritte gingen an ihrem Raum vorbei und stoppten erst vor dem anliegenden Nebenraum. Durch die dünne Zwischenwand hörte sie metallische Rollgeräusche, wofür sie damals keine Erklärung hatte. Was, wenn in dem Raum Rollschränke aus Metall waren? War da unten etwa ein Archiv?
Wie von einer höheren Macht gesteuert, erhob sich Anna Hardy von der Bank. Eilig huschte sie in Richtung Haupteingang. Der war komplett in Dunkelheit gehüllt. 10 Meter links vom Haupteingang war früher der Abgang zum Keller gewesen. Annas Herz schlug höher: der Abgang war noch immer da!
Langsam stieg Anna die engen Stufen hinab. Es roch nach Gully. Da war noch immer diese schwere Holztür! Mittlerweile war der grüne Lack so stark abgeplatzt, dass das blanke Holz fast frei lag.
Oberhalb der Türe saß noch immer dieses alte Teleauge. Es war vor 25 Jahren schon defekt gewesen. Jetzt war es mit einer Schicht von Dreck und Spinnweben überzogen. Ob das Innenleben der Kamera erneuert worden war? Sah nicht danach aus. Die Kameras am Bronfstein-Platz waren jedenfalls neuerer Bauart. Die konnten den dunklen Abgang hier aber unmöglich im Auge haben. Schnell eilte Anna zur Parkbank zurück, und versteckte ihr Serfy hinter einem Zierstrauch. So als ob sie es verloren hätte. Nun hatte Anna 20 Minuten Zeit, bis der SERPH-Assistent von sich aus Alarm schlug und das Fundbüro der Polizei verständigte.
Eilig huschte Anna zum Kellerabgang, stemmte sich fest gegen die alte Türe – doch verschlossen! Anna gab nicht auf. Hatte es damals nicht diese Ivy gegeben? Die wilde Ivy? Die, die mit dem Bonzen aus dem Minilieb liiert war? Irgendwie war der frühreife Teenager seinerzeit zu einem Nachschlüssel gekommen. So konnte sie sich nachtsüber mit ihrem Lover treffen. Wahrscheinlich war das der Grund, warum die Kameras hier im Kellerabgang nie aktiv gewesen waren!
Anna bückte sich und rüttelte an ein paar Mauersteinen.
Tatsächlich, einer hier war locker! Unter ihm ein zusammengefaltetes Stück Plastikfolie – darin eingewickelt: der Schlüssel! Er hatte all die Jahre unbeschadet überstanden. Die Tür öffnete mit sanftem Knirschen. Anna Hardy war im Keller! Eine alte Glühbirne spendete Licht. Nur wenige Schritte, schon stand sie vor Raum 11. Im Basement – also doch!
Die Türe war nur angelehnt. Dahinter lag ein großes, langes Zimmer. In Reih und Glied ein Heer von Aktenschränken aus Metall. Der Raum war fensterlos, auf den Schränken zentimeterdicker Staub.
Da – in diesem Aktenschrank die Lade mit der Aufschrift »H«.
Ohne mit der Wimper zu zucken, durchwühlte Anna die Laden. Da war ihre Akte! Zittern holte sie die orangefarbene Hängekartei heraus. Auf dem Einband stand: »Anna Hardy, geb. 15.2.1985; Heim der Benediktinerinnen: 1992-2003«.
Auf den vergilbten Blättern waren Informationen über jene Familie, die sie als Baby aufgezogen hatte. Annas Eltern waren nur wenige Tage nach ihrer Geburt bei einem Autounfall um´s Leben gekommen. Sogar der Zeitungsausschnitt von damals fand sich in den Akten. Da waren alte Zeugnis-Kopien, Meldeformulare, Beurteilungsschreiben hinsichtlich ihrer sozialen Lernfähigkeit. Alles mit Stempeln und handschriftlichen Notizen versehen. Anna schmunzelte ob der analogen Atmosphäre.
Mit einem Schlage war Annas Ruhe wie verflogen. Das letzte Blatt im Ordner, es trug den Titel »A. Knightly«. Darüber prangte ein roter Stempel:
G E H E I M E – V E R S C H L U S S S A C H E!!
Also doch, der Name »Knightly« hatte was mit ihr zu tun! Zittern las sie die drei Zeilen auf dem Blatt:
Anna Knightly, geb. 15.02.1985, ab 19.02.1985 ren. Anna Hardy;
Archiv staatsfeindlicher Aktivitäten,
Minilieb II. Hauptverwaltung, KNIG-0987-1103/Top Secret!“
Verbindungsoffizier G. Heyworth, Equality Second Lieutenant
Anna schluckte. Also doch!
Jetzt vermisste sie ihr Serfy, um das Blatt zu fotografieren.
Wie benommen stolperte sie durch den Raum. Fand einen Kugelschreiber; einen alten ohne Telesensor. Aufgeregt kritzelte sie sich die Zeilen auf ein Papier, das sie aus einer fremden Kartei herausgerissen hatte. Wie in Trance stolperte sie aus dem Raum, rannte die feuchten Stufen hinauf auf die Straße. Erst bei der Parkbank bemerkte sie, dass sie den Kellereingang offengelassen hatte.
Also noch einmal zurück und zugesperrt. Dann den Schlüssel unter den losen Stein geschoben.
Momente später saß sie in einem leeren Autobus. Unzählige Gedanken rasten durch Annas Kopf. Mit Entsetzen wurde ihr bewusst: sie kannte nicht nur nicht das Grab ihrer Eltern – sie wusste noch nicht einmal, was ihr echter Namen war!
Ob das an den Wirren der Bombenkriege lag? Regungslos lehnte sie am Fenster, drückte ihre Wange an die kalte Scheibe. Sie atmete so flach, als ob sie tot wäre. Als sie sich zu Hause auf ihr Bett fallen ließ, zeigte der Radiowecker zwei Uhr morgens an.
Doch Anna war hellwach, an Schlaf war nicht zu denken. Erst ein paar Gläser Rotwein später dann ein bisschen Schlaf.
Ihr letzter Gedanke: wie ihr Serfy diesen Ausflug wohl bewerten würde?
3
„Piiep, Piiep, Piiep, Piiep, Piiep!“
Wuchtig klatschte eine Hand auf den Wecker. Der knallte scheppernd zu Boden – um dort unbeirrt weiter zu piepen.
An diesem Montag erwachte Brian Miller mit einem mulmigen Gefühl im Bauch. Obwohl sein spätes Heimkommen in der Nacht auf Sonntag unbemerkt geblieben war. Denn Betty war erkältet und hatte – wie Brian – dann noch bis Mittag geschlafen. Den Sonntag verbrachte das Ehepaar schweigsam vor dem Teleschirm. Sahen Shows. Brian gingen viele Gedanken durch den Kopf. Da war er froh, dass Betty nicht in Redelaune war und Rose bei einer Freundin schlief.
Doch nun war Montag. Brian Miller fuhr ins Ministerium. Auf dem Serfy Radio zu hören, das getraute er sich nicht. Es war diese Angst, den eigenen Namen in den News zu hören.
Da – bei dieser Haltestelle musste er jetzt raus! Langsam schritt er auf den Wolkenkratzer des Ministeriums zu. Je näher er kam, desto mulmiger wurde ihm zumute. Würde man ihn schon am Eingang schnappen und vor allen Leuten niederschlagen? Waren auf dem Dach da oben Scharfschützen postiert?
Doch Fehlanzeige. Nichts passierte.
„Morgen, Brian!“, grüßte Charles Radeck freundlich, als Brian sich an seinen Rechner setzte. Brian Miller war erleichtert – war die Katastrophe also abgesagt?
„Bist du weitergekommen?“
„Wo – wohin? Wohin de – denn gekommen?“
Brian stotterte. Es dauerte ein wenig, bis er sich gefasst hatte und zum Gegenangriff blasen konnte. Es ginge gut voran, er würde aber noch zwei Wochenenden brauchen. Ob er solange noch den alten Pritschenwagen haben könne? Das wäre kein Problem, so Radeck, der Eigentümer wäre auf Dienstreise in Straßburg, es bestünde keine Eile.
Als sich Brian ins Netz einloggte, kam das Bauchweh wieder.
Doch da die Überraschung: Millers Gemeinwohl-Score hatte ein Allzeit-Hoch erreicht! Der samstägliche Arbeitseinsatz war mit vier Punkten belohnt worden. Ein wohliges Gefühl machte sich in Brian Millers Magengegend breit: er war nicht nur unentdeckt geblieben – auch karrieremäßig stand er da wie nie zuvor!
Brian Miller war 38 Jahre alt und etwa 1,80 groß. Er hatte brünettes, kurzes Haar. Meistens war es zu einem kecken Seitenscheitel gekämmt. Sein schmales, ebenmäßiges Gesicht war gepflegt. Gerne ließ er sich einen Dreitagesbart stehen. Brains Figur war knapp daran, sportlich genannt zu werden (tatsächlich betrieb er aber keinen Sport). Sein Wohlstandsbäuchlein ließ eher auf ein komfortables Leben schließen.
Miller war Mathematiker und arbeitete im Ministerium für Gemeinwohl-Ökonomie (Minimarkt). Der Leitgedanke Europas, „Omnia in mundo similis est! “ – hier im Minimarkt, da war der Spruch ein ehernes Gesetz!
Brians Ministerium war das höchste Gebäude in der Umgebung.
Es gliederte sich in drei gleich hohe Baukörper, die übereinandergestellt waren. Von ihrem Aussehen hätten sie allerdings nicht unterschiedlicher sein können: die unteren 60 Stockwerke (Grundfläche circa 100 x 60 Meter) beherbergten Großraumbüros. Es gab nur wenige Fenster. Die Decke war 2,35 Meter hoch. Man zwängte sich durch enge Gänge. Außen war der Stahlbeton mit schmutzigen Styroporplatten beklebt. Die Platten waren allerdings schon so stark mit Schimmel und Moos überzogen, dass man die Stöße zwischen den Platten erkennen konnte. Hier arbeiteten wohl 70% aller Bediensteten des Minimarkts.
Brians Arbeitsplatz war im 26. Stock – also schon weit oben – aber immer noch im letzten Drittel. Außerdem war das nächste Fenster gut und gerne 15 Meter weit von Brians Arbeitsplatz entfernt. Dazu kam noch, dass man durch das Fenster auf ein Werbeplakat sah, das am gegenüberliegenden Haus angebracht war. In großen Lettern stand darauf zu lesen: „Ungleichheit ist Gleichheit!“
Auf die 60 Stockwerke des unteren Drittels folgten die 40 Stockwerke des Mittelbaus (Grundfläche etwa 80 x 40 Meter). Sie waren außen weiß verputzt. Die Fenster waren richtig groß, und die Räume waren gut drei Meter hoch.
Doch das alles war nichts gegen das oberste Drittel des Wolkenkratzers: er war komplett verspiegelt, die Zahl der Stockwerke war von außen nicht erkennbar. Angeblich waren die Räume vier Meter hoch. Jedenfalls musste der Ausblick von dort oben atemberaubend sein!
Kleine Beamten wie Brian Miller hatten dort nichts verloren. Musste mit Beamten aus höheren Bauteilen etwas persönlich besprochen werden, so ging dies über Internet und Teams. War ein persönlicher Kontakt unumgänglich, kam der höhere zum niederen Beamten herunter.
Der Große Bruder sollte dort oben ein Luxusbüro haben, auf mehrere Stockwerke verteilt. So sagten es sich jedenfalls die Leute. Dabei war der Namen des Großen Bruders nicht einmal bekannt, nicht einmal sein Alter. Theoretisch müsste er schon über 80 sein, auf den Bildern wirkte er jedoch wie unter 60. Natürlich wagte es kein Journalist, Fragen zu stellen, oder gar zu recherchieren.
Das Luxusleben des Großen Bruders machte auch auf Brian Miller einen starken Eindruck. Denn auch Brian wollte ganz nach oben. Oder wenigstens in die Mitte!
Das oberste Drittel war für ihn tabu. Denn Brian hatte kein marxistisches Studium absolviert (dafür waren seine Zensuren zuerst beim Abitur und später bei der Uni-Zulassungsprüfung zu stark von der Mitte abgewichen).
Für´s erste wollte Brian ohnedies nur einen Fensterplatz! Also galt es, den Gemeinwohl-Score zu pushen. Aus diesem Grund arbeitete Miller samstags in Maggys Wohnung – und abends in der Abendschule. Und zwar gratis, ohne jeden Lohn.
„Ach herrje, die Abendschule!“
Brian musste weg, sonst verpasste er den Bus!
Nur eine Stunde später betrat Miller das Schulzentrum des St. Ignatius College. Die Nähe dieses Ordens zur Partei war stadtbekannt. Und tatsächlich – nach jedem College-Abend rückte Millers Gemeinwohl-Score um einen halben Punkt nach oben.
Es war also Montagabend, knapp nach sechs, als Brian das schmuddelige Klassenzimmer betrat. Neonröhren verbreiteten ein kaltes Licht. Fast alle 16 Halbwüchsigen stammten aus armen Zuwandererfamilien. Sie waren zwischen 14 und 18 Jahre alt, nur Elton war schon 22. Elton war Künstler, und der einzige Engländer in dieser Runde.
Elton war ein Unikum. Bei einer seiner »Art Sessions« hatte Elton einmal vergammelte Lebensmittel aus Mülltonnen zu einem mannshohen Haufen geschlichtet und fotografiert. Ein anderes Mal warf er vor laufender Kamera faule Eier auf einen ausgebreiteten Anzug, kotete und onanierte darauf. Dann wälzte er sich in dem Dreck. So etwas versetzte seine Fans, die er vor allem in der Zivilgesellschaft hatte (und die man an ihren schwarzen Rollkragenpullovern, den grauen Sakkos und den bunten Brillen erkennen konnte) regelmäßig in Ekstase.
Der Begriff »Zivilgesellschaft« war übrigens ein Neusprech-Vokabel. Die sogenannte Zivilgesellschaft bestand aus den obersten Zehntausend im Staat. Ihre Mitglieder riefen die Gesellschaft zu Moral, Bescheidenheit und Gleichheit auf – lebten selber aber in Saus und Braus. Neben hohen Beamten und Firmenlenkern zählten auch kommunistische Verleger, Schauspieler, Sänger und Maler zum erlauchten Kreis.
Eltons staatliches Künstlergehalt betrug 1 500 Globo. Weil die Londoner Zivilgesellschaft Eltons Aktionskunst für ihre Chefbüros ankaufen ließ, war Eltons Girokonto reich gefüllt. Streng genommen verdiente der Schüler Elton zehnmal mehr als der Lehrer Miller – und hatte 900 Gemeinwohlpunkte im Volksordner.
In Eltons Leben gab es nur ein Manko: seine üppigen Honorare zu addieren, das stellte ihn vor eine unlösbare Aufgabe. Zwar hatte er von der Kunstakademie in Düsseldorf gerade eine Professur angeboten bekommen, doch ein Hauptschulabschluss war ihm bisher nicht vergönnt gewesen (seine Schwester hatte ihm das Jobangebot vorgelesen). Jetzt saß der bunte Vogel in der Abendklasse und träumte schon vom großen Geld im roten Deutschland.
Von den zwei Unterrichtseinheiten, die Miller jeden Montag hielt, war die erste immer Mathematik. Danach kam Geographie. Das hatte Brian zwar nicht studiert, er hatte sich mit dem Stoff aber intensiv vertraut gemacht. Außerdem konnten viele der Migranten (so hießen Einwanderer auf Neusprech) weder schreiben noch lesen, sodass Miller ohnedies nur langsam vorankam.
Immer wieder wunderte sich Miller, wie manche Schüler auf B-Noten kamen. Streng genommen wusste er es - aber wie so oft in der EU: man durfte nicht darüber reden! Denn in allen Schulformen Eurasiens wurden schriftliche Arbeiten in Korrekturmaschinen eingescannt.
Die Computer korrigierten die Arbeiten vollautomatisch und berücksichtigten bei der Notenerstellung die soziale Herkunft der Schüler. Normalerweise. Letzte Woche hatte die Korrekturmaschine der Klosterschule aber plötzlich ihren Geist aufgegeben. Miller hatte das bei der Direktion auch bekannt gegeben, war aber auf nächsten Monat vertröstet worden.
Also hatte Brian Miller die Matheklausuren kurzerhand mit der Hand korrigiert – so wie das früher üblich war. Wortlos ließ er sie jetzt austeilen.
In Eurasien gab es eine dreigliedrige Notenskala. 99 Prozent der Schüler erhielten eine Note um den Mittelwert, also ein B+, ein B oder ein B-. A und Cs kamen in der Praxis eigentlich nicht vor. Außer heute: denn im Gegensatz zu sonst waren die Ergebnisse heute weit gestreut. Neben einem A gab es sogar ein A+, dafür erstmals nur sechs B. Aber acht C, eines sogar als C-! Es war Eltons Arbeit. Sogar seinen eigenen Namen hatte er falsch geschrieben.
Brian machte den Job als Lehrer noch nicht lange, hatte keinerlei pädagogische Ausbildung. In vielen Dingen verließ er sich einfach auf sein Bauchgefühl, oder die Erinnerung an seine eigene Schulzeit.
Brian maß den Ergebnissen also keine besondere Bedeutung bei. Auch in seiner Schulzeit waren Klassenarbeiten mal schlechter, mal besser ausgefallen. Außerdem entsprach es seinem Gerechtigkeitssinn, dass der klügere und fleißigere auch die bessere Note erhalten sollte – egal ob er aus einer reichen oder einer armen Familie stammte.
So etwas vor Eltern auszusprechen, könnte ihn allerdings den Job kosten – so viel war ihm bewusst.
Langsam wurde es in der Klasse unruhig. Einige Schüler waren erkennbar unzufrieden und machten ihrem Protest nun lautstark Luft. Miller hätte die Arbeiten unfair benotet, hätte Jungen bevorzugt. Miller begann zu schwitzen. Um Druck aus der Sache rauszunehmen, sammelte er die Arbeiten kurzerhand wieder ein. Die restliche Stunde wollte er Geografie unterrichten.
Der Plan ging auf, die Situation beruhigte sich. Heute sollte Jussuf ein Referat über die wichtigsten Erfindungen der Neuzeit halten.
Jussuf liebte Autos, und so handelte sein Referat über die Erfindungen rund um das Automobil. Sein Referat begann der Pakistani wie folgt: „Kein Land der Erde ist mit der Geschichte des Automobils intensiver verbunden als das Griechenland des 19. Jahrhunderts. 1851 erfand Avraam Zachariadis den ersten benzinbetriebenen Viertaktmotor, noch heute bezeichnete man dieses Prinzip als den Zachariadis-Motor. Den ersten Kraftwagen baute ein gewisser Karlos Florakis im Jahr 1884. Beide Erfinder waren Kommunisten, deren einziges Streben der Beförderung des öffentlichen Gemeinwohls galt. Bewusst hatten sie auf jede Art von Patentschutz verzichtet, um ihre Segnungen der gesamten Menschheit zugutekommen zu lassen...“
„Jussuf!“, unterbrach ihn Brian etwas fahrig. „Ich glaube, den Benzinmotor hat ein gewisser Herr Otto erfunden, zumindest habe ich das noch in der Schule gelernt. Und das erste Auto stammte von einem gewissen Herrn Daimler! Und beide kamen aus Deutschland! Das mit den Griechen, ich weiß nicht so recht...“
„Aber nein!“, riefen nun die Schüler aus der ersten Reihe. In ihren Stimmen war jenes Triumphgefühl zu erkennen, welches Kinder befällt, wenn sich der Lehrer einmal geirrt hatte. „Otto und Daimler hatten ihre Erfindungen den Griechen gestohlen! Weil die Griechen auf die Patentierung verzichtet hatten!“ Die Kinder waren empört. Nun erhob sich Elton von seinem Platz und erklärte Miller, dass er auf Fake News hereingefallen wäre: „Daimler und Otto war es nur um den Profit gegangen, die Griechen waren ihnen komplett egal. Das deutsche Großkapital hatte griechische Autofabriken in die Luft gesprengt, hatte sogar Söldnerarmeen ausgerüstet. Die haben dann die griechischen Ingenieure entführt und umgebracht!“
Miller hielt inne. Konnte es sein, dass die Partei die Geschichte rund um das Automobil umschreiben hatte lassen? Das passierte ständig. Maggy musste das aufgefallen sein. Wahrscheinlich hatte sie mit dem Ausschnitt aus dem Guiness Buch der Weltrekorde von 1984 wohl die alte Version für kommende Generationen retten wollen. Aber was war jetzt wirklich wahr? Miller versuchte, sich aus der Affäre zu ziehen: „Also, ich habe da etwas anderes gelesen...“
Langsam erinnerte sich Miller an die Zachariadis-Florakis-Version. Die Einzelabteilung für Geschichtsrelativierung hatte sie vor zehn, zwölf Jahren mit einer großen Medienkampagne eingeführt – und die alte Version mit den Deutschen zu rassistischen Fake News erklärt.
Nun meldete sich zu allem Überfluss noch Nahla.
„Jussuf hat Recht, Herr Miller! Gucken Sie doch. Hier, auf Equalpedia!“
Nahla streckte ihr Mobiltelefon in die Luft. Equalpedia war die unabhängige Wissensplattform der Partei und zugleich das größte Online-Lexikon der Welt.
Tatsächlich sah man unter dem Titel „Erfindungen in Zusammenhang mit dem Automobil“ ein großes Bild mit grimmig dreinblickenden Söldnertypen. Sie trugen nordische Gesichtszüge und standen – triumphierend auf ihre Karabiner gestützt –vor einem Haufen Leichen. Mit ihren schwarzen Haaren waren die Toten eindeutig als Griechen zu erkennen. Die Soldaten trugen preußische Pickelhauben, die groben Waffenröcke waren zerschlissen. Ihre Opfer hingegen steckten in modischen Anzügen, der feine Zwirn in Blut getränkt. Darunter der Text: „Deutsche Geheimsoldaten vor getöteten Ingenieuren in Saloniki, 1910. Autor: John Brickle.“
John Brickle war nicht irgendjemand. Der Schweizer Kommunist und Soziologe war einer der führenden Autoren auf Equalpedia. Er genoss große Sympathien bei Kunst und Medien, bekleidete hohe Positionen beim Flüchtlingswerk der UNO. Und die UNO wiederum war dem Ministerium für Freiheit (Minifrei) direkt unterstellt. Landesweit galt Brickle als großer Kämpfer für einen demokratischen Kommunismus.
„John Brickle! Haben Sie gehört, Herr Miller, John Brickle selber!“
„Vielleicht lügt John Brickle ja?“, ätzte Brian trotzig. Millers Stimmung war am Tiefpunkt. Der Lärm in der Klasse wurde jetzt unangenehmer, und Miller immer hektischer. Schweißperlen standen auf seiner Stirn. Ohne an die Konsequenzen zu denken, kramte er die Kopie aus Maggys Buch hervor und hielt sie in die Luft.
„Hier habe ich die Seite aus einem ganz alten Buch, es handelt von Erfindungen. Da steht, wer die wirklich erfunden hat. Das waren keine Griechen. Die Griechen haben keine Autos erfunden. Noch nie!“
Ein kurzer Befehl an Brians Sprachassistenten - und jeder in der Klasse hatte die Seite auf seinem Schirm.
Brian wusste nicht, warum er auf seiner Version beharrte, warum er sich jetzt mit Brickle anlegte, und warum er seinen Schülern die Seite aus Maggys Buch geschickt hatte. Es war wie verhext: seit dem Samstag in Maggys Wohnung konnte er keinen klaren Gedanken mehr fassen. Während sich die Klasse bereits lautstark über Miller lustig machte und Papierkugeln durch die Klasse schoss, erinnerte sich Brian an seine Kindheit.
Da war diese Sendereihe auf FET (First English Television). Eine moderne, bayrische Familie musste auf einem bayerischen Bergbauernhof leben – so wie ihre Vorfahren vor 150 Jahren gelebt hatten. Bei der modernen Familie handelte es sich jedoch um Türken. Aber hatten vor 150 Jahren überhaupt Türken im deutschen Bayern gelebt – oder war das auch nur wieder gelogen? Was war wahr und was war Lüge? Brian war zutiefst verunsichert. Sicher war nur: Maggys Erbe konnte ihm gefährlich werden! Am sichersten wäre es, es ein für alle Mal aus dieser Welt zu schaffen. Noch heute wollte er zum Holzhaus fahren und die Bücher in ein Feuer werfen!
Andererseits zeigten Maggys Aufzeichnungen nur, wie kompliziert das Leben in der Eurasischen Union doch geworden war. Die tägliche Heuchelei, die geistigen Verrenkungen, um nur ja nicht aus Versehen einmal doch die eigene Meinung auszusprechen! Die permanente Angst, als Chauvinist oder Rassist beschimpft zu werden!
Gerade wollte Miller ansetzen, um den Lügenvorwurf gegen Brickle zurückzunehmen, da gingen alle Teleschirme an. Schon die Signation der 20-Uhr-Nachrichten wurde in Überlautstärke abgespielt. Dann verwackelte das Bild, die hasserfüllte Stimme des amerikanischen Präsidenten, Daniel Goldstein nahm das Klassenzimmer in Beschlag. Der 2-Minutenhass hatte begonnen.
Der 2-Minutenhass wurde vom „Ministerium für Liebe“ (Minilieb) organisiert. In unregelmäßigen Abständen kam er statt der 20-Uhr-Nachrichten. Und wenn er kam, dann kam er wie ein Tornado, der über ganz Eurasien fegte. In Supermärkten und an Haltestellen – überall blieben jetzt die Menschen vor den Teleschirmen stehen. Das Krächzen der Lautsprecher diktierte jetzt den Takt im Land. Entziehen konnte man sich dem Spektakel kaum – auch Mobilgeräte hatten automatisch auf das Programm des Miniliebs geschaltet. Und zwar in jedem Bundesstaat Eurasiens.
Auch in Brians Klasse gingen jetzt die Lichter aus. Sofort fühlte man sich anonym. Gleich glaubte man, man sei im Fußballstadion. Wie von Sinnen johlten einige Halbwüchsigen ob des nun kommenden Spektakels. Und sie wurden nicht enttäuscht. Von den Teleschirmen brüllte ein außer sich geratenen US-Präsident auf sie herunter.
Weil sich die Stimme des Wahnsinnigen laufend überschlug, wurden seine Wortfetzen simultan übersetzt. Die Sätze wirkten wie aus dem Text geschnitten und aneinandergereiht. Dabei brüllte die Übersetzerstimme genauso wie Goldstein, und so hörte man von Goldstein gar nichts – und selbst von der Simultanstimme nur Wortfetzen:
„Ich hasse ... (Vom Krächzen der Tonanlage unterbrochen) „Frauen! Ich („Krächz!“)... hasse Einwanderer! Ich hasse alle Armen... Armen... („Krächz!“)! Ich hasse Behinderte und ich hasse den Sozialismus und Eure Eliten! Ich liebe nur Geld („Krächz!“) und Macht – und meine Konzerne („Knarz!“) werden euch mit meinen Lebensmitteln vergiften! .... hasse auch Eure Kinder!“
Man konnte den Speichel förmlich sehen, wie er aus Goldsteins Mund herausspritzte. Goldstein, er war das Sinnbild allen Bösen. Er war der Feind des Volkes, die Inkarnation der Unmenschlichkeit. Die Medien Eurasiens hielten ihm täglich Tausende Spiegel vor. In ihnen erblickte man einen Materialisten; ein Monster, das sein eigenes Wohl über das der anderen stellte. Der nichts so sehr hasste wie den Frieden. Unzählbare Aufdecker-Filme haben Goldstein als Teil einer skrupellosen Elite enttarnt, die sich den kleinen Wohlstand der Armen unter den Nagel reißt. Goldsteins Konzerne überschwemmten die Welt mit giftigen Lebensmitteln. Sie verführten die Menschen zu Alkoholismus, Fettleibigkeit und Tabaksucht. Längst war Goldstein als Rassist, Steuerhinterzieher, Zuhälter, Kinderschänder, Islamhasser, Psychopath, Mitglied des Ku-Klux-Klans und manisch-Depressiver enttarnt worden.
Für Goldstein waren die Menschen nicht alle gleich talentiert und auch nicht gleich ehrgeizig. Für ihn war das Christentum friedfertiger als der Islam. Auch Mann und Frau hielt Goldstein für genetisch unterschiedlich. Und Kulturen für unterschiedlich erfolgreich. Nur so war es zu erklären, dass Daniel Goldstein an seiner Grenze Mauern bauen ließ, um Zuwanderer aus dem Süden von »seinem« Land fern zu halten.
Goldstein war das Sinnbild des Antisozialisten: er stellte die Natur- über die Sozialwissenschaften, stellte das kühl Beobachtete über die schmeichelnde Utopie und er bewertete hektisches Leistungsstreben höher als planvollen Müßiggang.
Goldstein war der Verführer, der Unreine, der Urverräter, der wortgewaltige Aufwiegler, der Antipode zum modernen, linken Eurasien. Obwohl Goldsteins Theorien tagtäglich auf Rednertribünen, auf Teleschirmen, in Zeitungen und Büchern widerlegt, zerpflückt, lächerlich gemacht und öffentlich als der erbärmliche Schwachsinn hingestellt wurden, der sie nun einmal waren – so schien sein Einfluss nicht zu schwinden.
Sein wahres Ziel, die kleinen Leute vom Sozialismus wegzubringen, schien nicht und nicht an Gefährdungspotential zu verlieren. Beherzte Medien hatten irgendwann einmal begonnen, die Lügen Präsident Goldsteins zu zählen. Wann immer Goldstein vor einer Kamera sprach, war unten rechts ein Lügen-Zähler eingeblendet. Hatte man sich einmal kurz nach einem Tee umgedreht, hatte sich der Lügenzähler auf dem Teleschirm schon wieder um zwei, drei Zähler weiterbewegt.
Jetzt gerade wieder eine Lüge! Da behauptete Goldstein, Frauen hätten genetisch einen geringeren Muskelanteil als Männer, weswegen sie im Sport immer hinter den Männern landen würden.
„Welch unglaubliche Diskriminierung von Frauen!“, dachte Brian zornig. Wie musste dieser Mann doch Frauen hassen!“
Dabei wusste die soziologische Forschung schon seit über einem halben Jahrhundert, dass die Leistungsfähigkeit eines Menschen nicht genetisch-biologisch festgelegt ist, sondern alleine ein Produkt von Erziehung und sozialem Umfeld war. Und wenn eine Frau einmal weniger Muskeln hatte als ein Mann, dann nur, weil sie in ihrer Kindheit offenbar von ihren Eltern schlechter behandelt worden war als der Bruder! Und da machte sich Goldstein auch noch über Frauen lustig? Brian ballte seine Fäuste.
Nun stellte dieser Goldstein auch noch Forderungen: Journalisten sollten objektiv berichten, auch Bürgerliche sollten ihre Meinung sagen dürfen. Brian war entsetzt. Die Presse hatte Recht: wie hasserfüllt doch Goldstein war! Und wie hinterhältig er den Europäern Fallen stellte. Denn würden sich unsere Medien tatsächlich mit bürgerlichen Ideen befassen – würde man den rechten Dreck dann nicht auf ein Podium heben? Ihn aufwerten – als wäre er dem Sozialismus ebenbürtig?
Nun schimpfte Goldstein noch auf Eurasiens Sozialismus! Die Steuern wären hierzulande viel zu hoch, Eurasiens Eliten tief korrupt. Millionenschaften fauler und unproduktiver Beamte würden sich ein Leben in Müßiggang ergaunern – und das auf Kosten hart arbeitender Proles! Den Sozialstaat hätten die Electi nur ausgebaut, um sich selber gemütliche Versorgungsjobs beim Staat zu schaffen!
Millers Klasse tobte jetzt vor Wut. Ihre Eltern waren wegen des Sozialstaates nach Eurasien eingewandert – und der sollte jetzt schlecht sein? Die neunköpfige Familie von Ayana stammte aus Äthiopien und erhielt – nach Anerkennung des Asylgrundes Klimawandel jetzt 6 000 Globo Sozialhilfe im Monat, kostenfreie Krankenversicherung und ein kleines Haus im Grünen – ohne dafür arbeiten zu müssen. Immerhin war Ayanas Familie von der Hitze Afrikas ja schwer traumatisiert! So wie man Goldstein kannte, würde er Ayanas Familie die Sozialleistungen am liebsten streichen, wenn er in Eurasien herrschen könnte. Würde die vom Klimawandel gebeutelte Familie gar arbeiten schicken! Oder gleich nach Äthiopien zurück, damit sie dort ihre Heimat aufbauen könnte – das war Rassismus in Reinkultur!
Ayana verstand zwar kaum etwas von Goldsteins Rede, brüllte sich aber trotzdem ihre kleine Seele aus dem Leib. Die Zuseher waren von brachialem Furor erfasst worden, wie ein Tsunami, der über einem kleinen Dorf zusammenbrach. Längst flogen Äpfel und Schuhe gegen die Teleschirme.
Eigentlich wollte sich Brian zurückhalten. Doch auch bei ihm brachen jetzt die Dämme. Wie am Spieß schrie er „Dreckschwein!“ und „Kapitalistensau!“ gegen die Teleschirme.
Brian fühlte sich nicht einmal schuldig – alle schrien. Je länger der 2-Minutenhass andauerte, desto weniger hatte man sich unter Kontrolle. Irgendwann brauchte man sich nicht mehr zu verstellen. Den Hass, den jeder in sich trug, und den der staatliche Sender mit monumentalem Hass zu Monstern aufblies – den konnte man nicht nur auf Bösewichte wie Goldstein richten. Nein – in Gedanken konnte man ihn auch gegen den eigenen Vorgesetzten lenken, gegen die ungepflegte Verkäuferin an der Supermarktkasse oder den Stromkonzern, der schon wieder die Preise erhöht hatte.
Vor seinem geistigen Auge sah sich Brian als Aufseher in einem Steinbruch, den Schlagstock in der Hand. Immer wieder sauste der Knüppel auf den dicken Kapitalisten mit der Glatze hernieder.
„Du Schwein, ins Umerziehungslager mit dir!“, hörte sich Brian brüllen. „Dort prügeln sie dir dein geldgieriges Grinsen schon noch aus der Birne!“
„Wir vaporisieren dich wie einen räudigen Köter, von dir bleibt nicht einmal mehr Staub über!“, hörte Brian jetzt die kleine Polin mit den roten Zöpfen krächzen. Erregt fuchtelte sie mit ihrem Serfy in der Hand herum.
Endlich wich die Fratze Goldsteins dem strengen aber wohlwollenden Gesicht des Großen Bruders. Nun war auch die Qualität des Tones besser, das Bild auch nicht mehr so verwackelt. Mit fester Stimme erklärte der Große Bruder die wahren Zusammenhänge. Dass sich Rassisten, Chauvinisten und Großkonzerne gegen die edlen, hart arbeitenden Proles verschwören würden. Dass die Electi aber ihre Hände schützend über die Proles halten würden. Und mit leiser, aber bestimmter Stimme erklärte er noch einmal die großartige Staatsidee des Landes; dass alle Menschen, Völker, Kulturen und auch die Geschlechter exakt gleich talentiert, gleich ehrgeizig und gleich diszipliniert wären. Und dass es eine Schande wäre, dass nach siebzig Jahren Sozialismus, Frauen noch immer weniger verdienten als Männer, dass Afrikaner noch immer krimineller wären als Asiaten und die einen Menschen noch immer schlanker als die anderen.
Gerade hatten Brians Schüler mit Sesseln eine Fensterscheibe eingeschlagen, da flog die Türe auf und Mitglieder der Antireaktionären Aktion stürmten in die Klasse. Sie riefen die Schüler auf, mit ihnen die Autos von Rechten anzuzünden. Im Nu war das Klassenzimmer geleert.
Die Antireaktionäre Aktion (Antira) war – wie der Rote Block – eine Einrichtung des Ministeriums für Liebe (Minilieb). Kinderspitzel und Junge Internet-Zensoren hingegen gehörten zum Ministerium für Wahrheit (Miniwahr).
In den staatlichen Jugendorganisationen konnten sich die Kinder aus höherem Hause ein wenig die Hörner abstoßen. Da konnte es schon vorkommen, dass bei einem G20-Gipfel 5 000 Antiras es mit 30 000 Polizisten aufnahmen. Letztere durften sich nicht wehren, mussten sich von den Schülern grün und blau schlagen lassen. Keinesfalls durfte geschossen werden.
Rechtlich hatten die »Schlägerbanden im Dienste der Moral« (wie ein berühmter Pulitzerpreisträger sie einmal anerkennend bezeichnete) auch nichts zu befürchten. Denn öffentlich standen Staat und Presse hinter ihnen. Wenn die Antira ganze Straßenzüge demolierte und Autos in Brand steckte, dann zeigten die Kameras nicht die verzweifelten Menschen, deren Existenzen soeben in Flammen aufgegangen waren, sondern junge Studenten, wie sie mutig ihre Banner mit dem ‚Anarchisten-A‘ ins Blitzlichtgewitter hielten.
Für die Presse waren die Krawalle logisch nachvollziehbar: ein um sich greifenden Kapitalismus, ein außer Kontrolle geratener Klimawandel und der explodierende Rassismus reaktionärer Schichten – das alles würde jungen Menschen doch gar keine andere Wahl lassen, als ihren Zukunftsängsten freien Lauf zu lassen.
Der Gebrauch von Schlagstöcken oder gar Schusswaffen war Polizisten bei solchen Einsätzen strengstens untersagt. Immerhin demonstrierten hier die Kinder von Electi. Von der Waffe Gebrauch machen durften Polizisten nur, wenn Proles in die Villen von Electi einbrachen oder im Suff gar den menschengemachten Klimawandel leugneten.
Die Ironie bei der Geschichte: die jungen Polizisten kassierten ihre Prügel nicht einmal ungern. Sie entstammten der Schicht der Proles. Polizist zu sein war für sie die einzige Chance, der eintönigen Arbeit in den Fabrikhallen zu entkommen. Als Polizist stiegen sie in (die unterste) Schicht der Electi auf. Als Preis für diesen Aufstieg mussten sie den Kindern der etablierten Electi allerdings ein bisschen Spaß ermöglichen. Immerhin lernten kleine Hunde das Beißen ja auch beim Spielen mit den Älteren. Für Polizisten war das Spiel jedoch nicht ungefährlich: wurde einem Molotow-Cocktail-werfenden Electi-Kind auch nur ein Haar gekrümmt, war die Chance auf den Aufstieg schon vertan. Der junge Polizist verlor den Job und seine Wohnung in dem Wohnblock mit den Polizistenwohnungen. Mit etwas Glück fand er sich nach Jahren der Arbeitslosigkeit am Fließband einer Fischfabrik wieder. Bei weniger Glück verschwand er sang- und klanglos aus der Welt.
Nach zehn Minuten war der 2-Minutenhass vorbei. Brian saß allein im Klassenzimmer. Am Boden lagen Zettel und Bücher verstreut, dazwischen umgekippte Stühle. Auf den Teleschirmen war jetzt nur noch die Losung der Partei zu lesen (untermalt mit Beethovens Neunter):
Ungleichheit ist Gleichheit
Lüge ist Wahrheit
Unwissenheit ist Stärke
Ministerium für Wahrheit
Miller erinnerte sich an seinen Tagtraum von soeben; er als Aufseher im Lustlager: „Wie hässlich Kapitalisten doch aussehen!“
Angewidert verließ er den Raum. Eine Viertelstunde später saß er im Bus. Mit Getöse prasselte der Regen aus dem schwarzen Himmel auf das Blech des Autobusses. Mit einem Male wurde Miller bewusst, dass der heutige Tag seinen Gemeinwohl-Score wohl nicht gerade befördern würde.
4
„Iiiitsch, iiiitsch-iiiiietsch!“
Mit großen Schwämmen entfernten die Greifer der Fensterputzmaschine den Dreck von Annas Fenster. Es war Dienstag, neunuhrdreißig und Anna Hardy war nicht besonders guter Laune: Unterleibschmerzen. Wieder einmal.
Anna Hardy arbeitete beim Nachrichtenmagazin The MIRROR. Sie hatte langes, dunkelblondes Haar und eine sportliche Figur. Und wenn sich im Frühling die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolken kämpften, dann war ihr zierliches Näschen im Nu mit winzigen Sommersprossen bedeckt.
Hardys Verlag logierte in einem 13stöckigen Glasgebäudekomplex inmitten des Londoner Hafenviertels. Kern des Hochhauses war ein 13stöckiges Atrium, das von zahlreichen Laufstegen überspannt war. Die Wände waren fast überall aus Glas. Jene zwischen den Büros genauso wie jene zu den Gängen hin. So konnte man den Nachbarn nicht nur sehen, sondern auch hören – und ihm im Bedrohungsfall zu Hilfe kommen.
Am meisten fürchtete man sich beim MIRROR vor einem rechten Umsturz. Angezettelt von konservativen Politikern wie Daniel Goldstein. Er war der Erzfeind des Blattes. Ihn zur Strecke bringen – das war das erklärte Ziel des Magazins.
Im Unterschied zu »normalen« Magazinen gehörten im MIRROR nicht nur die Chefs der Inneren Partei an, sondern auch alle 1 100 Mitarbeiter. Von der Geschäftsführung angefangen, über die Mitglieder in den Gemeinwohl-Ausschüssen, den Betriebsräten, Gewerkschaften, Verbindungsoffizieren bis hinunter zu den Redakteuren. Selbst der Hauswart kämpfte bei den Omas gegen Rechts.
Wer wie Anna im MIRROR arbeiten durfte, der trug Verantwortung für das Land. The MIRROR war das Frontmagazin im Kampf für den »Marxismus des 21. Jahrhunderts«. Blaupause war Deutschland: dort hatte man in den 1990ern das politische System des marxistischen Ostdeutschlands (unter Führung roter Sozialisten) mit der gemischten Wirtschaft Westdeutschlands (unter Führung schwarzer Sozialisten) verschmolzen.
Seinen Kampf musste der MIRROR nicht alleine kämpfen. Über die Hälfte der 13 000 m2 Fläche waren an befreundete Organisationen vermietet. Etwa an die Gedankenpolizei. Auch Miniwahr und Minilieb hatten hier Büros (da waren die Wände aber aus Beton). Dazu kam die Plattform gegen Rechts (PAR). Sie betrieb ein Callcenter mit 600 Mitarbeitern. Engagierte Staatsbürger konnten vermutete Reaktionäre hier rund um die Uhr denunzieren. Kein Zufall, dass hier auch die EPA nicht weit entfernt war.
Die Eurasische Presseagentur (EPA) hatte sich einen Stock unter der PAR angesiedelt. Sie produzierte ideologisch korrekte Pressemeldungen. Die anderen Medien des Landes schrieben sie dann ab. Wer nicht auf die EPA warten wollte, schreib sogleich vom MIRROR ab. Vom MIRROR abzuschreiben, das war für jeden Publizisten eine große Ehre.
Der MIRROR hatte auch eine eigene Story-Abteilung (um fehlende Fakten stimmungsvoll zu kompensieren), Fernsehstudio inklusive. Hier entstand nicht nur der 2-Minutenhass für das Minilieb, sondern auch das MIRROR-TV Magazine. MIRROR-TV spürte die Sympathisanten rechter, also »politisch unkorrekt« denkender Menschen auf und brachte sie zur Strecke.
Besonders erfolgreich war die Story-Abteilung bei der grafischen Gestaltung von Titelblättern. Berühmt wurde jenes Titelblatt, bei dem der widerliche Jude Goldstein in seinem noch widerlicheren, schwarzen Kapitalistenanzug mit weißem Hemd und roter Krawatte den abgeschnittenen Kopf der Freiheitsstatue in die Höhe reckte – und in der abgesunkenen Hand noch den blutigen Dolch hielt. Oder jenes, wo Goldstein als Baby auf einer Atombombe saß, mit der er die Welt in neue Bombenkriege verstricken wollte. Für das Cover, das Goldstein mit einer Ku-Klux-Klan-Mütze zeigte, heimste die Redaktion den hoch dotierten „Left Hate Award“ ein. Einer von zig Tausenden Staatspreisen, die in Eurasien an anständige Menschen und Organisationen verliehen wurden.
Anständig war ein Neusprech-Wort. Es bezeichnete Menschen mit linken oder linksextremen Ansichten. Rechtsdenkende Menschen (dazu zählten marktliberal oder konservativ denkende Menschen) waren folglich unanständig.
Ein MIRROR-Titelblatt, bei dem Goldstein als King Kong mit fletschenden Zähnen und Fratzengesicht einen Wolkenkratzer emporkletterte, fand sich in zwei Dutzend 2-Minutenhass-Filmen wieder. Als der 2-Minutenhass zum ersten Mal gezeigt wurde, stürmten Tausende Jugendliche in eurasischen Städten zur amerikanischen Botschaft. Dort attackierten sie Leute, die wie Goldstein aussahen.
In Berlin erschlugen sie damals gleich zwei Männer. Einer hatte tatsächlich blond gefärbte Haare. Er trug auch einen schwarzen Anzug mit roter Krawatte – so wie Goldstein im 2-Minutenhass. Einen zweiten Goldstein knüpften sie an einem Laternenmast auf. Dann ritzten sie ihm mit einem Messer den Davidstern auf die Stirn. Auf die Wange schrieben sie »Reaktioner«, mit »e«. Die Augen hatten sie ihm ausgestochen. Die Täter hatten später alles gestanden. Sie hätten Goldstein nicht als Mensch, sondern als Tier empfunden. Schließlich würden ja auch die MIRROR-Covers Goldstein als Tier und ohne Augen zeigen.
Das Landesgericht Berlin setzte ihre Strafe zur Bewährung aus.
Die Familie des Erhängten entschuldigte sich später öffentlich. Der Verstorbene hätte sich über die Jahre wohl den kranken Ideen Goldsteins, wenn nicht sogar der Bruderschaft angenähert. Wahrscheinlich hätte der Erhängte seine Bekleidung intuitiv an jene Goldsteins angenähert, weil er sich auch dessen Idealen angenähert hatte.
Anna Hardy sah zum Fenster hinaus, sie war müde. Ein Tagtraum überkam sie. Sie stieß gerade die Tür zur Cafeteria im 5. Stock auf, wollte sich mit einer befreundeten Redakteurin treffen – da verschlug es ihr die Sprache: mitten im Raum saß US-Präsident Goldstein – bei Kaffee und Kuchen! Und plauderte gemütlich mit MIRROR-Herausgeber, Multimillionär und Konzernführer, Rudy Eyeston. Gerade wollte sie nach der Polizei rufen, da standen die beiden Männer auf, um sich zu verabschieden. Sie umarmten sich – und küssten sich dabei auf den Mund!
Erschreckt fuhr Anna aus dem Stuhl – was war das denn für ein Traum!
Sie begann, über ihre Rolle als Redakteurin nachzudenken. Wie weltweit üblich, bestand das tägliche Brot eines Redakteurs auch beim MIRROR im Umschreiben staatlicher Pressemeldungen zu Nachrichten, Kommentaren und Analysen. So gelangten Informationen von der ersten auf die zweite Ebene, den großen Medienkonzernen.
Die dritte Ebene in der Pressewelt, das waren die tausenden, kleinen Medienunternehmen. Sie schrieben vom Mittelbau ab, etwa dem MIRROR. Oder von Sendern wie FET, SET oder RTL. Dadurch war die Glaubwürdigkeitskette – von der linken Presseagentur über die linken Riesen und den linken Mittelbau bis ganz hinunter zum linken Kirchenblatt nie unterbrochen worden. Eine gesunde Struktur, um gesundes Denken im Lande zu fördern.
Anna Hardy war stolz, beim MIRROR zu arbeiten, dem Leitorgan der Inneren Partei. Hier wurden die »vier eisernen Regeln des Journalismus« auf Punkt und Komma befolgt.
Erstens. Medien hatten Menschen zu »moralisch besseren«, also zu sozialistischen Menschen umzuerziehen. Nur weil eine Nachricht wahr und relevant war, hieß das noch lange nicht, dass sie auch publiziert wurde. Entscheidend war, ob sie das Streben der Gesellschaft nach totaler Gleichheit oder Multikultur befördern würde.
Zweitens. Ließen Ereignisse oder Experten bürgerlich-rechte Position in einem positiven Licht erscheinen, so wurden diese ignoriert. So, als hätte es sie nie gegeben.
Drittens. Setzten sich Personen dem Verdacht aus, Sympathien für bürgerlich-rechtes Gedankengut zu empfinden, so mussten diese an den Pranger gestellt werden. Man konnte nach ihren Schwächen suchen oder auch einfach nur Geschichten erfinden, welche ihre verkommene Geisteshaltung erkennen ließen. Jungredakteure trainierten am liebsten am Beispiel Goldsteins.
Viertens. Naturwissenschaftler, liberale Ökonomen oder gar Techniker durften in der Öffentlichkeit nicht persönlich zu Wort kommen. Nie. Gesellschaftliche Vorgänge hatten alleine von Sozialwissenschaftlern diskutiert zu werden. Auch die Bücher (vermuteter) konservativer Autoren durften unter keinen Umständen erwähnt werden. Abgesehen davon, dass es sie ohnedies nicht gab, weil kein Verlag in der EU sie publizieren würde. Weil kein Großhändler sie vertreiben würde, kein Sender über sie berichten würde.
Weil einige wenige Menschen die Presse (aus unerfindlichen Gründen) für gleichgeschaltet hielten, sanken die Auflagen quer über alle Verlage schon seit Jahren. Deshalb subventionierte der Staat die linken Verlage mit Hunderten Millionen Globo jährlich. Manchmal gab er dafür einen Vorwand an. Etwa, dass er die digitale Transformation der Verlagshäuser unterstützen wollte. Oder die Meinungsvielfalt in der Union. Manchmal überwies er den linken Verlagen das Geld auch einfach so.
Neben der Presse brachte der Staat sein modernes (also linkes) Weltbild mit Hilfe des Kabaretts unter die Leute. Die Kabarettisten kritisierten das Tagesgeschehen im linken Eurasien – aus linksextremer Sicht.
Wer es eine Nummer härter liebte, schaute gleich Satire. Satire war ein Neusprech-Vokabel und bedeutete so viel wie: bürgerlich denkende Menschen, also Rechte, medial zu vernichten und dabei hysterisch zu lachen. Zu den Aufzeichnungen von Satireshows waren ausschließlich Mitglieder der Inneren Partei geladen.
Berühmt war die Today´s Show auf SET (Second English Television). Ihr Showmaster war früher selber in Lustlagern gewesen – als Gemeinwohl-Trainer. Er soll hunderten Rechten die Kehle durchgeschnitten haben. Szenen, in denen er »verkappte Konservative« vor laufender Kamera demütigte, verspottete und erniedrigte, quittierte seine Fangemeinde mit Lachanfällen und Standing Ovations.
Satire-Formate waren nichts für Zartbesaitete – sie waren aber notwendig. Denn obwohl seit 60 Jahren kein Konservativer mehr öffentlich zu Wort gekommen war, vermuteten Soziologen vor allem unter den Proles (in ihren verstunkenen Fabriken) noch immer rechte Geisteshaltungen.
Hardys Computer piepte laut und aufdringlich.
Jäh erwachte Anna aus ihrem Tagtraum. Ihr PC hatte Untätigkeit vermutet (Day Dream Alert). Wahrscheinlich hatten die Sensoren in Annas Oberarm-Chip das Abfallen von Blutdruck und Puls festgestellt. Wenn Anna jetzt nicht sofort eine produktive Handlung setzte, würde ein Alarm an jene Gedankenpolizei ergehen, deren Büro nur wenige Schritte von dem ihren entfernt lag. Und dann konnte es schnell unangenehm werden. Denn die vermutete schnell ein rechtes Gedankenvergehen (Thought Crime Alert). Schnell gab Anna Hardy ein paar Zeichen auf der Tastatur ein. Der Signalton verstummte.
»Mist!«, dachte Anna Hardy. Die Unachtsamkeit hatte ihr mit Sicherheit einen Viertel Gemeinwohl-Punkt gekostet! Jetzt galt es, verlorenes Terrain wieder gut zu machen.
»Werde in 10 000 Stunden zu Mozart!«, tippte sie in ihren Computer. Vor ihr lag eine umzuschreibende Pressemeldung. Soziologen und Psychologen waren zum Schluss gekommen, dass Intelligenz und Talente nicht vererbt wurden. Ganz im Gegenteil: menschliche Höchstleistungen würden sich alleine aus der Anzahl an geleisteten Übungsstunden ergeben.
»10 000 Stunden Krafttraining – und der Leptosome wird zum World Box Champion. 10 000 Stunden Klavierunterricht – und man toppt selbst Mozart!«
Anna war vom Einstieg ihres Beitrags begeistert.
Die Suche auf Equalpedia bescherte ihr das Foto eines heruntergekommenen Proles. Es stammte von 1896 und zeigte einen bärtigen Obdachlosen, der auf einer Parkbank saß. Das viel zu große Sakko hatte er über ein Bündel alter Kleidung gelegt.
Schmunzelnd tippte Anna darunter: „Das ist der obdachlose Hilfsarbeiter Albert Einstein. Nachdem ihm der Sozialfond seiner Stadt 10.880 Stunden Schul- und Universitätsbildung ermöglicht hatte, veröffentlichte er seine Arbeit »Zur Elektrodynamik bewegter Körper“. 1921 erhielt er sogar den Nobelpreis für Physik«.
In ihrem Artikel folgerte Anna Hardy, dass selbst versoffene Penner ein Physikstudium absolvieren und den Nobelpreis gewinnen könnten, wenn der Staat ihnen nur 10 000 Stunden Unterricht anbieten würde. Anna war jetzt so richtig im Flow, darum flunkerte sie noch ein bisschen und schrieb: „Mit einer genetisch ererbten Intelligenz hat Einsteins Aufstieg nichts zu tun. Einsteins Eltern waren Hilfsarbeiter in einer Ulmer Schuhfabrik. Beide waren einst an der Volksschule gescheitert.“
Anna konnte davon ausgehen, dass kein Journalist der Welt ihre Worte anzweifeln, geschweige denn überprüfen würde. Schließlich stammte der Beitrag ja vom MIRROR. Außerdem galt es unter Journalisten als Tugend, jede Form von Skepsis gegenüber öffentlichen Einrichtungen – und als solche wurde der MIRROR wahrgenommen – zu unterdrücken.
Den 10 000 Stunden, wie es auf der Aussendung einer soziologischen Fakultät stand, fügte Anna eigenmächtig 880 Stunden hinzu. Denn Annas Lieblingszahl war acht.
Gut gelaunt öffnete Anna Equalpedia. Sogleich stieß sie sie auf eine interessante Meldung: bei der Eurasischen Olympiade von 2004 hatte der russische Schwergewichtheber, Dmitri Wladimirowitsch eine Goldmedaille gewonnen. Anna Hardy überlegte kurz. Dann öffnete sie auf ihrem Rechner ein Programm, um bei der Abteilung für Geschichtsrelativierung einen Antrag auf Veränderung der Geschichte zu stellen. Das Fenster öffnete sich. Nun trug Anna den neuen Text auf Equalpedia ein:
„Bei der Eurasischen Olympiade von 2004 war dem russischen Schwergewichtheber, Dmitri Wladimirowitsch Berestow die Medaille aberkannt worden, nachdem der bekannte Flötenspieler Gabor Vosteen nachweisen konnte, 12 000 Stunden Gewichtheben geübt zu haben. Berestow konnte nur 7 800 Stunden nachweisen.
Verfasser des Beitrages: Anna Hardy.“
„Ein Wunder, dass sie Berestow angesichts solcher Verbrechen nicht sofort vaporisiert hatten“, kicherte Anna keck.
„Klatsch!“ - Ein Akt war auf Annas Schreibtisch gelandet. Tim Woolves, Annas Verbindungsoffizier vom Minilieb, hatte ihr einen orangen Ordner auf den Tisch geknallt. Auf dem stand bloß ein Name: »Brian Miller«.
„Das muss noch heute Abend raus. Als Internetmeldung auf MIRROR Online.
„Gern ganz kurz!“, lautete die Anweisung, „Machst du das, Anna?“ Dann drehte er sich in der Türe um: „Morgen hast du dann gut Zeit für einen langen Beitrag für das MIRROR-Magazin!“
„Aber klar! – Lass doch mal sehen!“
Auf dem Akt klebte ein gelber Notizzettel. Darauf die Stichwörter: „Lehrer diskriminiert Migranten und Frauen in Abendschule – bezeichnet John Brickle als Lügner – behauptet, Deutsche hätten Auto erfunden.“
„Junge, Junge, der hat Nerven!“, murmelte Anna. Dann öffnete sie in ihrem Textprogramm eine neue Seite.
„Wie heißt denn unser Amokläufer? Aha – Brian Miller!“
5
„Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee!“
Brian Miller erschrak. Auch die Menschen vor der Sicherheitsschleuse zuckten zusammen, als der laute Signalton anging. Für Miller blieb das Drehkreuz heute zu.
„Ist vielleicht ein Irrtum!“, brummte der Wachmann und drückte auf zwei Knöpfe. Doch vergebens: der Alarm ließ sich nicht abstellen.
Dabei hatte Brians Tag schon beim Frühstück schlecht begonnen. Der Victory-Kaffee (von Fairtrade) war zu dünn geraten, Betty schlecht gelaunt, das Wetter feucht und nebelig. Außerdem war die Musik im Radio einfach schauerlich. Gut, das hing vielleicht mit der Abschaffung der klassischen Hitparade zusammen.
Früher hatte man jene Musik am häufigsten gespielt, die vom Markt, also von den Menschen, am häufigsten gewünscht bzw. gekauft wurde. Das hatte die Asian-European Society for Sociology (ASS) auf den Plan gerufen. Ihr Credo: niemals dürften Märkte über Menschen herrschen! Hieß: niemals dürfe man Konsumenten in die Machtposition versetze, sich ihr Produkt, in diesem Falle die Musik, selber auszusuchen. Das würde automatisch jene Produkte (oder Künstler) diskriminieren, die beim Publikum weniger gut ankamen.
Der MIRROR hatte damals sogar ein Interview mit dem Chef von ASS abgedruckt. Nur wenige Tage später konnte man es auf Equalpedia nachlesen, unter dem Eintrag »Populismus«:
„Die nachfrageorientierte Musikauswahl der Radiosender ist Kapitalismus in seiner reinsten Form. So etwas löst einen unmenschlichen Wettbewerb aus, bei dem am Ende des Abends alle verlieren. Sender, die das spielen, was die Mehrheit der Menschen hören möchte, handeln rechtspopulistisch.“
Rechtspopulismus war das Neusprech-Wort für eine »freie, ungelenkte Demokratie«. In dieser Demokratie konnten die Menschen unreflektiert und spontan ihre gesellschaftlichen Wünsche ausdrücken – ohne auf das Erreichen marxistischer Staatsziele Rücksicht zu nehmen.
Ein Politiker galt als populistisch, wenn er die Wünsche der Bürger umsetzen wollte. Das Gegenteil von Populismus war die „liberale Demokratie“ – so wie sie in der EU gelebt wurde. Liberale Demokratie bedeutete, dass im Lande nur Linke zu Wort kamen, und auch nur Electi aus der obersten Schicht. Da sie materiell an der Spitze der Gesellschaft standen, wussten sie am besten, was für die Menschen da unten von Bedeutung war.
So empfanden es die Bürger in einer liberalen Demokratie als ganz natürlich, wenn ihre politische Führung Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg traf – oder Wahlversprechen nicht erfüllte. Wahlversprechen waren in einer liberalen Demokratie da, um die Proles zur Stimmabgabe bei den Wahlen zu animieren. Das wusste doch jeder – außer die Proles, vielleicht.
Jedenfalls hatten wegen der Musik im Radio hunderte Gemeinwohl-Konvente getagt. Brüssel hatte die Ergebnisse dann in ein Gesetz gegossen. Und von da an wurden nur mehr die Lieder jener Interpreten gespielt, die die meisten Übungsstunden nachweisen konnten. Außerdem durfte jeder Song einmal auf Platz eins. Die Befragung eines soziologischen Institutes (unter den 40 Hörern eines Campus-Radiosenders) konnte eine hohe Akzeptanz der neuen Regelung in der Bevölkerung feststellen. Die ehemaligen Hitparadenstars, denen es nur um den Profit gegangen war – sie wurden vaporisiert. Besonders kapitalistische Fälle verschwanden in Lustlagern.
Wie ein begossener Pudel stand Brian vor der Schleuse.
„Vielleicht lag es am Chip, die Batterie war ja schon schwach!“
Zwar konnte so etwas tatsächlich einen Alarm auslösen, doch Brian fuhr ja regelmäßig Bus. Dabei lud sich der Chip induktiv auf: man brauchte sich dazu bloß auf speziell geformte Sitzschalen im Fahrgastraum zu setzen. Die Seitenteile umschlossen den Körper bis zum Schulterbereich. Sie beherbergten die Oszillatoren zum drahtlosen Laden der im linken Oberarm implantierten Chips.
Jeder in Eurasien trug einen Chip. Wer ein öffentliches Gebäude (und dazu zählten Wohnblocks genauso wie Ministerien) betrat, der musste im Eingangsbereich an Schleusen vorbei. Nicht immer waren diese als solche zu erkennen wie bei einem Ministerium. Und nicht immer war dort Wachpersonal postiert. In vielen Gebäuden waren die Sensoren im Türrahmen des Eingangsbereiches eingelassen.
Den ersten Sozial-Chip bekam man schon im Säuglingsalter, meist schon nach fünf Tagen. Mit sechs Jahren bekam man den berühmten Kinderchip in rosa/blau/grün oder orange – je nachdem, welches Geschlecht die Eltern für das Kind gewählt hatten. Mit 14 Jahren bekam man dann im Rahmen einer Jugendweihe den Sozial-Chip für Erwachsene. Viele feierten dies mit großen Festen.
Mittlerweile waren zwei Sicherheitsleute dem Wachmann zu Hilfe geeilt. „Herr Miller, dürfen wir Sie bitten, mit uns zu kommen?“, rief einer der beiden, ohne lange auf die Antwort Millers zu warten. Beherzt packten die beiden Brian an seinen Armen und bugsierten ihn durch das Foyer zum Personalaufzug. Wortlos fuhr man in die Tiefe. Im Keller zerrten die Kerle Miller in einen fensterlosen Raum und drückten ihn an einen Tisch. Er solle warten, schnauzte ihn der eine mit Glatze an. Dann postierten sich die beiden Wachen vor der Tür.
Im Raum flackerte eine Neonröhre. Da standen einige Seminarstühle: Metallgestelle, mit schwarzem Lederimitat überzogen. Sie waren um weiße Kunststofftische angeordnet.
Brian musste nicht lange warten, da sprang die Türe auf. Drei Herren in grauen Anzügen traten in den Raum – ohne zu grüßen. Der in der Mitte war Brian bekannt. Es war der Direktor seiner Abendschule, Sullivan Albrecht. Seine Fächer waren Psychologie und Soziologie. Sein Begleiter an der linken Seite war von gedrungener Statur und hatte ein grobschlächtiges Gesicht. Das schüttere und fettig glänzende Haar war zu einem Seitenscheitel gekämmt. Sein Gesicht war so rot, als ob er gerade einen Baumstamm entzwei gesägt hätte. Der Typ an der rechten Seite erinnerte Miller an einen pensionierten Oberstudienrat, groß und hager. Einzig markanter Punkt im mausgrauen Beamtengesicht: eine dicke Hornbrille. Nur mit Mühe konnte er seinen ländlichen Dialekt verbergen. Mit einem gelispelten „Hier!“ knallte er die Morgenausgabe der Tageszeitung PICTURE auf den Tisch.
„Rechte Umtriebe im St. Ignatius College – Lehrer außer Rand und Band! Er schikanierte Zuwanderer und Frauen. Zu Picture sagte der Pädagoge: »Ich hasse Frauen«! Ein Bericht von Anna Hardy.“
Den Text darunter konnte Brian nicht entziffern. Er sah nur sein Foto auf dem Titelblatt. Es musste von einer Wandkamera aufgenommen worden sein. Er sah darauf wie ein gesuchter Schwerverbrecher aus. Miller lief es heiß und kalt über den Rücken. Das war exakt jene Tonart, die der Staat bei Menschen verwendete, bevor er sie vaporisierte. Brian spürte, wie ihm der Schweiß den Nacken hinablief. Die Sekunden der Stille kamen ihm wie Stunden vor.
„Miller, fällt Ihnen dazu nichts ein?“, stichelte der Glatzkopf. Wahrscheinlich war er vom Miniwahr, schoss es Miller durch den Kopf. Dann musste der Mausgraue jemand von der Schulbehörde sein. Wahrscheinlich jemand aus der Rechtsabteilung.
Brian verstand die Welt nicht mehr.
„Miller, ich habe Ihnen vertraut! – Was ist da nur in Sie gefahren?“, wandte sich Direktor Albrecht an Brian. Seine theatralischen Worte erinnerten Miller an eine Shakespeare-Aufführung.
„Was, was, .... was ist passiert?“, stotterte Brian.
In seinem Gehirn war bleierne Leere.
„Miller, Sie haben eine wichtige Mathematik-Klausur zurückgegeben! In der haben Sie Mädchen schlechter benotetet als Jungen, und Afrikaner schlechter als Osteuropäer – das ist Rassismus, das ist Sexismus, und ich weiß nicht, was noch alles!“
Mit aufgesetzter Verzweiflung rang er nach Worten: „So etwas hat unser Haus noch nicht erlebt!“
Nun setzte der mausgraue Oberstudienrat nach: „Warum um Himmelswillen haben Sie denn nicht den Korrekturcomputer verwendet? Damit wären Ihre unterschwelligen Aggressionen gegenüber Minderheiten und Frauen unbemerkt geblieben!“
„Obwohl sie natürlich da gewesen wären - was ohnedies schon problematisch genug ist!“, beeilte sich Direktor Albrecht zu ergänzen. „Miller, nun sind Sie ein Fall für´s Minilieb!“
Ach herrje – das Minilieb! Hitzewellen durchzuckten Brians Körper. Hätte es keine Lehne gegeben, er wäre rücklings zu Boden gefallen. Dem Minilieb unterstanden alle Arten von Geheimdiensten. Es führte auch die Vaporisierungen durch. Seine Mitarbeiter standen nicht gerade im Ruf, übertriebene Berührungsängste mit Gewalt zu haben.
Langsam ahnte Brian, was schiefgelaufen sein könnte. In einzelnen Wortfetzen kam es nun aus ihm heraus. Die Korrekturmaschine wäre außer Betrieb gewesen. So habe er – wie früher – händisch korrigiert. Was ihn überdies Stunden gekostet hätte. Und das, wo er doch so wenig Zeit hätte, weil er sich gerade für eine alte, kranke Frau engagiere, für die er gerade die Wohnung saniere. Und außerdem, das alles sei ein Irrtum, er hasse doch keine Frauen. Egal, ob zugewandert oder nicht. Er hätte auch mit keiner Journalistin gesprochen.
Direktor Albrecht nahm einen neuen Anlauf. „Miller, diese Maschinen wurden von Soziologen programmiert, weil es noch immer Pädagogen gibt, die sich bei der Notengebung von Vorurteilen beeinflussen lassen. Noch immer bekommen Kinder aus wohlhabenden Familien bessere Noten als jene aus einkommensschwachen Familien. Hätten wir die Korrekturmaschinen nicht, dann wären Jungen in Mathematik und Technik besser als Mädchen, und Mädchen besser als Jungen, wenn es um Sprachen und Soziales ginge! Und das, obwohl Eurasien seit über 60 Jahren unzählige Milliarden Globo in die Mathe-Förderung von Mädchen steckt, und in die Sprach-Förderung von Jungen!“
Albrecht war jetzt richtig wütend. Er verlor sich in einer akademischen Abhandlung über »unsere reaktionäre Gesellschaft“. Brian wäre in Verhaltensweisen zurückgefallen, die sich in »300 Jahren Kapitalismus« psychosozial verfestigt hätten. Nur kranke Naturen würden zwischen den Menschen künstliche Unterschiede kreieren. Die Korrekturcomputer wären die wichtigste Errungenschaft der Soziologie. Sie hätten die Gesellschaft gerechter gemacht, weil sie die schlechten Mathematiknoten von Zuwanderern und Frauen um »soziale Korrekturfaktoren« nach Oben verbesserten, und die besseren Noten von Jungen und Heimischen einfach nach Unten verschlechterten. Somit wären alle gleich – und auch alle gleich zufrieden.
„Vielleicht bekommt ja der eine Schüler eine B+ und der andere eine B-, aber nie im Leben hat sich ein junger Mensch eine A oder eine C verdient!“, warf nun die graue Maus von der Schulaufsicht ein.
Und Albrecht hob den rechten Zeigefinger zu einem feierlichen Spruch: „Alle Kinder dieser Welt haben sich die gleiche Note verdient – denn sie sind ja auch gleich viel wert! Lesen Sie bei John Brickle nach, Kollege Miller!“
„Mit John Brickle hat Ihr Herr Miller ja auch so seine Probleme, Kollege Albrecht!“, konterte jetzt der von der Schulaufsicht.
Die beiden hätten noch ewig weitergeschimpft, hätte sich Brian nicht etwas gefasst und stammelnd unterbrochen: „Die Korrekturmaschine.... die war kaputt!“
„Ach reden Sie doch keinen Scheiß, Miller!“
Der mittlerweile nach Schweiß riechende Minilieb-Beamte war einen Schritt auf Miller zugegangen. „Das Ding geht besser denn je! Sie haben es ja nicht einmal versucht! Wir haben Ihren Bewegungschip ausgelesen – Sie waren nicht einmal in der Nähe der Maschine!“
Der Beamte kochte fast vor Wut.
„Das stimmt nicht – mein Serfy kann es belegen! Ich war dort!“ Brian fiel wieder in die Defensive. Unruhig rutschte er auf seinem Sessel hin und her. „Ich habe beim Korrigieren ja nicht einmal auf die Namen gesehen, es hat jeder die Punkte bekommen, die er verdiente...“
Brian schwor nun Stein und Bein, dass sein Korrekturschema leicht nachvollziehbar sei. Er wäre auch gerne behilflich, wenn seine Mathematik-Arbeiten von unabhängiger Seite noch einmal benotet würden.
Für Momente schien es, als könnte er verlorenes Terrain zurückgewinnen.
Dann mischte sich wieder der mit dem grobschlächtigen Gesicht ein: „Was uns auch nicht gefällt, ist, dass du Fake News in Umlauf bringst, Miller! – Was sollen die Lügen mit den Europäern, die den Benzinmotor erfunden hätten? Woher stammen diese Fake News?“
Nun saß Brian in der Falle: gab er seine Quelle Preis, dann stellten sie zuerst Maggy´s Wohnung auf den Kopf, danach ihr Gartenhaus – und am Ende Brians Haus. Sagte er aber nichts, stellte er sich gegen das System und hatte dessen volle Härte zu befürchten.
Er versuchte einen Mittelweg. „Ich habe das wohl irgendwann einmal wo gehört, oder gelesen. Ich hatte mir nicht viel dabei gedacht, Sie wissen ja, wie schnell die Leute verbotene Literatur ins Netz laden!“
Brian spielte den Ahnungslosen.
„Glauben Sie das denn, das mit den Nordeuropäern, dass die so viele technische Erfindungen gemacht hätten?“
Direktor Albrechts Augen waren zusammengekniffen. Immerhin schien er Brian einen Ausweg anbieten zu wollen.
„Aber natürlich nicht!“, ereiferte sich Brian hektisch. „Da bin ich sicher den Lügen rechter Agenten aufgesessen!“
Wortreich empörte sich Brian jetzt über den Materialismus, der nichts zum Wohle der Welt beitragen würde, aber alle Völker dieser Welt bestohlen hätte. Und dass dieser Materialismus in Amerikas Goldsteins ein Comeback feiere.
„Wollen Sie sich öffentlich entschuldigen?“, brachte sich »Stiernacken« wieder ins Spiel. „Wir könnten da was mit der Presse arrangieren! Immerhin spricht Ihr Gemeinwohl-Score ja für Sie!“
Hektisch willigte Brian ein, der Eurasischen Presseagentur ein Interview zu geben. Die Atmosphäre schien sich etwas zu erhellen. War es am Ende doch nicht so schlimm wie befürchtet?
„Sie gehen jetzt mal nach Hause, Miller. Denken sie einmal nach, wie Sie auf andere Menschen wirken! Und was Menschen fühlen, wenn Sie ihren Vorfahren technisches Talent absprechen!“
Die graue Maus von der Schulaufsicht blickte plötzlich gar nicht mehr so böse wie zu Beginn.
„Um ein Disziplinarverfahren werden wir aber nicht herumkommen, Miller!“, so Direktor Albrecht. Er bat Brian inständig, in sich zu gehen und sich öffentlich zu entschuldigen, um Schlimmeres von sich und von der Schule abzuwenden. Man hätte Millers Vorgesetzten im Ministerium schon informiert, für heute wäre Miller freigestellt. Er solle jetzt heimgehen und sich auf morgen vorbereiten.
Miller sah den Männern gedankenverloren nach, wie sie tuschelnd den Raum verließen. Dann brachten ihn die Wachleute wortlos nach oben. Mit starrem Blick stieg er in den nächsten Bus ein. Er wollte jetzt nur noch nach Hause.
6
Brian lebte mit seiner Frau Betty in Hackney, einem Wohnviertel im Nordosten von London. Ihre siebenjährige Tochter Rose besuchte dort die Grundschule. In der Cecilia Road gehörte den beiden ein kleines Reihenhäuschen. Beide führten das ruhige Leben von Electi: komfortable, sichere Jobs beim Staat. Hohe Gehälter, wenig Leistungsdruck.
Hackney war ein Stadtteil, den Soziologen gerne als unterprivilegiert oder benachteiligt bezeichneten. Das mochte mit dem hohen Anteil an Zuwanderern liegen, und an der hohen Kriminalität. Manchmal fragte sich Brian, wer die Menschen hier eigentlich benachteiligt hätte, ihnen also etwas weggenommen hätte. Und vor allem: was man ihnen weggenommen hätte.
Die meisten Zuwanderer waren bettelarm nach Großbritannien gekommen. Sie waren meistens ungebildet und der englischen Sprache nicht mächtig. Nur selten konnten sie auf Erfahrungen mit produktiver Arbeit verweisen. In England bekamen sie Sozialwohnungen, Jobs und waren krankenversichert – obwohl ihre Vorfahren das Krankensystem nicht aufgebaut hatten. Warum Soziologen sie dann als unter-privilegiert bezeichneten, erschien Brian Miller schleierhaft. Für Brian waren die Zuwanderer eher über-privilegiert.
Das konnte er seiner Partei-hörigen Ehefrau Betty natürlich nicht sagen. Betty nahm alles Offizielle für bare Münze. So etwa bei TV-Dokus. Dass der sozialistische Staat oder Regierungsvertreter Hintergedanken haben könnten, das war für Betty unvorstellbar.
Brian war da anders. Die Gutgläubigkeit war ihm mit der Zeit abhandengekommen. Wenn er mit Betty abends vor dem Teleschirm saß, nahm er den Film oft gar nicht wahr. Meist sinnierte er vor sich her. Dachte, wie viele Menschen da draußen gerade Dinge dachten, die sie gar nicht denken durften. Und wie viele Menschen Angst hatten, solche Gedanken mit dem eigenen Ehepartner zu teilen – geschweigen denn, mit den eigenen Kindern? Aus Angst, man könnte verraten werden. Brian liebte seine Familie über alles. Was ihn tief in seiner Seele aber wirklich bewegte – das getraute er sich seiner Familie nicht mitzuteilen.
Nach dem schrecklichen Erlebnis von heute Morgen war Brian mit dem Bus nach Hause gefahren. Nicht einmal Betty hatte er angerufen, so deprimiert war er. Gedankenverloren tapste er an der Haltestelle in der Cecilia Road aus dem Autobus. Dann schlenderte er langsam in Richtung seines Hauseinganges. Bauchweh plagte ihn.
Brian hatte die jungen, schlecht gekleideten Menschen anfangs nicht einmal bemerkt. In losen Trauben lungerten sie am schmiedeeisernen Zaun, der die Reihenhäuschen in der Straße von den kleinen Vorgärten trennte. Ihm waren weder die Transparente aufgefallen, noch die Wut, die in ihren Gesichtern geschrieben stand. Bis einer rief: „Da ist ja das rechte Schwein!“
Erschreckt riss Brian seinen Kopf in die Höhe. Doch es war zu spät.
„Wir - wollen - keine – Rassisten – Schweine!“, plärrte es ihm plötzlich entgegen. Ein junges, schwarz gekleidetes Mädchen fuchtelte mit der Faust vor seinem Gesicht herum und keifte: „Du rechtes Arschloch!“ Ihre Stimme überschlug sich. Sie war keine 16 Jahre alt, hatte Piercings in Ohren und Mund, und kurz geschorenes Haar.
Brian Miller sah sich inmitten einer Gruppe Vermummter. Nun nahm er die Plakate wahr. „Fake News töten!“, stand auf einem Transparent, das ihm den Weg zu seiner Haustüre versperrte. Es waren Aktivisten des Roten Blocks, mindestens 20 an der Zahl. Und an der Bushaltestelle stieg gerade eine Traube weiterer Demonstranten aus. Gerade entrollten sie ihr Plakat: „Im Marxismus gefordert – im Hass vereint!“
„Der Roter Block – Scheiße!“, ging es Brian durch den Kopf.
Die Schläger des Roten Blocks entstammten meist der unteren Electi-Schicht. Sie waren stets vermummt und in uniformes schwarz gekleidet. Sie kämpften für die ethnische Buntheit ihrer Gesellschaft und ein arbeitsfreies Einkommen. Das würde sie in fleißige und kreative Menschen verwandeln – behaupteten sie im Fernsehen.
Wie die Antira (bei der sich die Kinder eher aus der obersten Electi-Schicht rekrutierten) war auch der Rote Block eng mit der Politik verwoben. Wollte man einen konkurrierenden Politiker ausschalten, streute man das Gerücht, er wäre rechts. Dann schickte man ihm den roten Mob vorbei. Wenn der mit dem Linksabweichler fertig war, dann wollte der nicht nur kein Politiker mehr sein – er konnte es auch rein physisch nicht mehr.
In vielen Ländern Eurasiens stellten die Blockparteien den beiden Jugendorganisationen Autobusse, Geld und Informationen zur Verfügung. In China hatte der Rote Block in den 1960ern über eine Million Menschen totgeschlagen. Nannte sich damals Kulturrevolution. Diese Tatsachen hatte man inzwischen aus den Geschichtebüchern entfernt, älteren Eurasiern waren sie aber noch bekannt.
Brian hatte den Satz auf dem Plakat noch nicht zu Ende gedacht, da verspürte er einen heftigen Schmerz am Kopf. Mit den Worten, „Du Rassistenschwein!“ hatte ein schlanker Langhaariger Brian einen so starken Fausthieb versetzt, dass er auf ein abgestelltes Auto knallte. Ohne nach dem Täter zu blicken, rannte Brian auf die Straße – Hauptsache, weg von hier. Autos hupten, Reifen quietschten. Brian wollte zu den Anyones auf die andere Straßenseite. Er wusste, dass Frau Anyone am Vormittag immer zu Hause war. Schon war die rettende Eingangstür zum Greifen nahe, da hörte er, wie sich innen ein Schlüssel im Schloss umdrehte. In den daneben liegenden Fenstern wurden die Vorhänge hastig zugezogen.
Brian saß in der Falle. Zahlreiche Hände drückten ihn jetzt gegen die Haustüre der Anyones. Er ging in die Knie, schützte den Kopf mit seinen Armen – da sauste ein Baseballschläger auf Brians rechten Oberarm. Dann ein Tritt mit einem groben Schuh – mitten in´s Gesicht.
„Sie haben meine Klausur gefälscht – dafür hasse ich Sie!“
Brian nahm die Stimme einer Schülerin wahr. War das nicht die Kleine mit den roten Zöpfen, jene aus der Abendschule?
Brian stieg der Rauch brennender Autoreifen in die Nase. Sollte er auf diese Weise sterben – auf der Treppe seiner Nachbarn? Jener Nachbarn, denen man früher gerne mit Zwiebeln, Milch und Fahrradpumpen ausgeholfen hatte? Jetzt versperrten sie einem die Tür! Millers Kehle war trocken, er konnte kaum noch schlucken. Tränen standen in seinen Augen.
Noch immer sausten Tritte auf ihn nieder. Da griff Miller – wie blind vor Angst – mit beiden Händen nach einer schweren Tonvase, die zur Zierde vor der Tür der Anyones stand. Mit großem Schwung (und mit einem gellenden Schrei) riss er das riesige Ding (mitsamt dem kleinen Bäumchen darin) hinter seinem Rücken hoch – und ließ es auf seine Gegner herniederdonnern.
Mit lautem Ächzen fiel ein Vermummter rücklings die Treppen hinunter. Für einen Augenblick war die Meute wie gelähmt. Brian nutzte den Moment, sprang auf und stürmte durch ein Spalier aus Schlägen und Tritten auf den Gehsteig. Dann rannte er, so schnell er konnte, die Straße hinauf. Nach gut einem Kilometer wagte es Brian, hinter sich zu blicken.
Niemand da. Keuchend lehnte er sich an einen Straßenbaum. Die Nase blutete, Speichel tropfte aus seinem Mund. Links schmerzten mehrere Zähne und in seinen Schläfen spürte er sein Blut pochen. Vor seinem geistigen Auge hatte er die Bilder seiner geliebten Tochter Rose. Ob der Mob auch ihr etwas antun würde?
Da kam ein Bus – Rettung in letzter Not! Ohne nachzudenken, stieg Brian ein. Duckte sich an ein Fenster auf der linken Seite des Busses. Langsam rollte der Wagen an. Die wasserstoffbetriebenen Omnibusse Londons benötigten keine Fahrer. Sie wurden zentral gesteuert.
Doch was war das? Der Autobus bremste sich schon wieder ein – dabei hatte er noch nicht einmal richtig beschleunigt! Nun bog er sogar links ab, schob zurück auf die Straße und wendete um 180 Grad! Jetzt fuhr Brian wieder die Cecilia Road zurück. Das widersprach dem Busfahrplan! Brian konnte es nicht fassen.
„Aufgrund eines unerwarteten Schadens kehrt dieser Wagen in den Busbahnhof zurück. Für die Passagiere besteht keine Gefahr. Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen sitzen!“
Die Stimme aus dem Lautsprecher klang streng.
„Aber der Bus fährt doch ganz einwandfrei!“, meckerte ein junger Mann. Und eine ältere Dame beschwerte sich: „Der Busbahnhof liegt doch auf der ursprünglichen Route!“
Noch ehe Brian wusste, wie ihm geschah, verlangsamte der Omnibus seine Geschwindigkeit – und hielt vor den brennenden Autos. Entsetzt erkannte Brian, dass auch sein eigenes darunter war. Aber auch das jener Nachbarin, die ihm die Zuflucht verweigert hatte. Der Bus hielt direkt vor seinem Haus!
Was die Passagiere am meisten erstaunte: obwohl sich der Bus inmitten eines wütenden Tumultes befand, und auch niemand zu- beziehungsweise aussteigen wollte, machte der Omnibus keine Anstalten, weiterzufahren. Er blieb einfach stehen.
Das Gellen der Trillerpfeifen drang gellend bedrohlich durch die Fensterscheiben. Draußen erkannten jetzt die ersten Vermummten, wen ihnen der parkende Autobus da auf dem Präsentierteller serviert hatte. Sofort sprinteten sie zum Bus und trommelten mit den Fäusten gegen die Einstiegstüre, in den Händen Knüppel und Pflastersteine. Die Fahrgäste wussten nicht, wie ihnen geschah.
Vielleicht war bei dem Omnibus ja etwas mit der Elektronik kaputt, denn zu allem Unglück sprangen jetzt noch alle Türen auf. Wie von der Tarantel gestochen stürmten vier, fünf kräftige Jungs auf Brian zu und zerrten ihn auf die Straße.
„Wir haben das Schwein!“, tönte es aus ihren Kehlen.
Brian lag mitten auf dem Gehsteig, über sich der linke Mob.
Die Fahrgäste des Autobusses waren heilfroh, dass der Unruhestifter aus dem Bus entfernt war (und es nicht sie getroffen hatte). Einer nach dem anderen wechselte auf die andere Seite des Busses, und begann, mit dem Serfy zu spielen. Sie taten einfach so, als ob sie die Sache auf der Straße drüben nichts anginge. Nur zwei Mädchen blieben sitzen und filmten die schaurigen Szenen, um sie auf tiktok zu teilen.
„Du erzählst deinen Schülern also, dass nicht Griechen, sondern Deutsche das Auto erfunden hätten?“, schrie ein Vermummter mit der Aufschrift „Gegen Rechts!“ und trat mit Springerstiefeln in Brians Oberschenkel. „Mein Vater ist Grieche!“
„Aber es stimmt!“, brüllte Brian in Todesangst. „Und den Drehkolbenmotor haben auch nicht die Afrikaner erfunden, sondern ein Herr Wankel, und der war auch Mitteleuropäer! Ihr hirnlosen Idioten! Genauso wie der Fahrradreifen, den hat ein Dunlop aus Schottland erfunden, und kein Inder! Ihr glaubt den Nachrichtensprechern doch jeden Blödsinn, nur weil sie in weißem Hemd und schickem Anzug vor der Kamera sitzen!“
„Du lügst! Du lügst! Du bist ein von Goldstein bezahlter Agent! Ein rechter Agent! Ein Rassist und Menschenhasser! Prügelt ihm seine Fake News aus dem Leib!“
„Mörder, Mörder!“, schrie es plötzlich vom Haus der Anyones mit gellender Stimme. Brian war verwirrt. War da noch jemand, den sie am Kicker hatten? Etwa einen echten Mörder? Für Sekunden schöpfte er Hoffnung – vielleicht ließen die Angreifer ja dann von ihm ab.
„Miller, du bist Mörder – du hast Aabid erschlagen!“
Über die drei Stufen zum Hauseingang der Anyones lagen zwei lange Beine in schwarzen Jeans herunter – regungslos. Es dürfte der Bursche sein, dem er die Tonvase an den Kopf gedonnert hatte. Da packte Brian die Wut des Verzweifelten. Wie von der Tarantel gestochen boxte er um sich, trat einem Vermummten mit voller Kraft in den Bauch. Dann knallte er einer jungen, hysterisch keifenden Frau mit voller Kraft die Faust ins Gesicht, sodass sie mit schrillem Schrei zu Boden ging.
Erschreckt wichen die anderen zurück. Brian nutzte die Lücke – und lief. Lief, so schnell, wie er nur konnte. Er lief und lief und lief. Er lief, als ob ihm der Leibhaftige im Nacken säße. Bog in kleine Gassen ein, rannte über rote Fußgängerampeln, jetzt hinauf zur stark befahrenen Allee. Dann endlich, der Millfields Park! Schnell hinter immergrünem Ziergesträuch versteckt! Blicke zurück – niemand war ihm gefolgt!
Erschöpft ließ er sich auf die kalte Wiese fallen. Es brauchte Minuten, bis sich sein Puls wieder etwas beruhigt hatte.
An einer Parkbank zog er sich hoch. Es war Spätvormittag und außer ein paar Rentnern schlenderten nur wenige Leute die Kieswege entlang. Brian gab kein gutes Bild ab: der Schweiß lief ihm über das Gesicht, in den Achseln klebte das Hemd. Der linke Hemdsärmel hing blutverschmiert herunter. Die Hose war voller Erde und aufgerissen, bei jedem Atemzug schmerzte der Bauch. Und wenn er sich vorsichtig an die wackelnden Zähne griff, da durchzuckte ein stechender Schmerz seinen Körper.
Brian war am Boden zerstört. Er fühlte sich aus dem Leben gerissen, unendlich in seiner Ehre gekränkt, vom Leben verraten. Hatte er denn nicht alles gemacht, um dem Staat, der Gesellschaft und ihren Idealen zu dienen? War er nun wirklich ein Mörder und musste ins Gefängnis? Vielleicht entschied das Gericht auf Totschlag – dann kam er mit fünf, sechs Jahre davon. Danach in eine Fabrik, gemeinsam mit Proles ans Fließband! Aber auch nur, wenn das Opfer ein Proles von der Straße war! Wie es schien, hatte er aber das linke Muttersöhnchen einer feinen Electi-Familie erwischt! Damit war Brian für die Medien auf einen Schlag ein Rechtsextremer. Das hieß: kurzer Prozess, von den Medien zerrissen und ab ins Umerziehungslager. Und irgendwann einmal: Genickschuss.
Brian Miller entschloss sich, Betty anzurufen.
Endlich, nach langem Läuten ging sie ans Telefon. Brian atmete auf. „Schatz, du kannst dir nicht vorstellen...“
„Was ist nur in dich gefahren, Brian? Bist du wirklich ein Rechter, ein Rassist? Du wirst uns noch alle ins Gefängnis bringen! Brian, was hast du nur getan!“
Hysterisch plärrte Betty ins Telefon. Es dauerte eine Weile, bis sie ihm zuhören konnte. Er schilderte, was ihm zugestoßen war. Sie vereinbarten, sich bei Betty im Altersheim zu treffen. Sobald er an der Hintertüre angekommen wäre, sollte er Betty kurz anrufen. Da er von Autobussen genug hatte, machte sich Brian zu Fuß auf den Weg.
Eine Stunde später war er beim Altersheim. Das imposante Gebäude war im Jahrhundertwendestil gebaut.
Lässig spazierte Brian an der schmalen Seite des Baukörpers vorbei. An der Ecke tat er, als würde er sich die Schnürsenkel binden. Vorsichtig schielte er zum Haupteingang. Dieser befand sich zentral an der vorderen Längsseite. Welch ein Schock: da war ein Meer von Kameras und Scheinwerfern! Enttäuscht schlenderte Brian zurück, um die Hinterseite des Heimes zu inspizieren. Sie war von einem weitläufigen Park umgeben. Hier waren nur weniger Kameras zu sehen.
Brian kam ins Grübeln. Sein Leben lang waren ihm Kameras und 5G-Datenübertragung egal gewesen. Man wusste von der permanenten Überwachung durch den Staat, doch ignorierte man sie. Immerhin schützten sie einen ja vor dem Bösen. Nun hatte der Staat einen aber selber zum Bösen erklärt. Damit waren Kameras und 5G-Datenübertagung plötzlich von Bedeutung für Brian. Sogar von existentieller.
Das schmiedeeiserne Türchen zum Garten war angelehnt. Es quietschte, als Miller es öffnete. Bedächtig schlenderte er über den Kies. In der Mitte des Parks setzte er sich auf eine von Bäumen beschattete Parkbank. Von hier aus konnte man die Rückseite in ihrer vollen Breite überblicken: von Brians Bank zu dem kleinen Kellerabgang waren es gerade einmal hundertfünfzig Meter.
Brian wollte gerade Bettys Nummer wählen, da sah er seine Frau schon die Stufen vom Kellerabgang heraufsteigen. Sie schien leichenblass zu sein. Als sie ihn erblickte, begann sie auf Brian zuzulaufen.
Brian sprang auf und lief auf Betty zu. Tränenerstickt brüllte er: „Betty! Beeettyy!“
Nur noch wenige Meter, dann läge Betty in seinen Armen!
Aber was war das? Zwei in Weiß gekleidete Pfleger waren Betty im Laufschritt gefolgt.
„Brian!“, schrie Betty aus voller Kehle, „Lauf – die wollen dich….!“
Betty stolperte und stürzte zu Boden.
Geschickt wichen die Pfleger aus und liefen jetzt direkt auf Brian zu. Brian hörte noch, wie Betty rief: „Brian, ich liebe dich! Lauf – Brian, lauf!“
Schon warf sich der erste Pfleger auf Brian. Brian sprang geistesgegenwärtig zur Seite, schlug einen Haken und rannte just zu jenem Kelleraufgang zurück, aus dem Betty und die Männer gerade gekommen waren.
Sollte er zur Gartentüre auf die Straße rennen? Brian hatte den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, da sah er zwei Typen in grauen Anzügen durch ebendiese Gartentüre treten. Sie schienen Brian zu erkennen, denn sie liefen sofort auf ihn zu.
Brian blieb kein anderer Ausweg, als sich in das Gebäude zu flüchten.
Da, der zentrale Hintereingang! Er lag im ersten Halbgeschoß.
Die schwere Holztür war nur angelehnt. Geistesgegenwärtig verriegelte Brian die Tür mit dem eisernen Türfeststeller an der Innenseite. Würde es ihm den nötigen Vorsprung verschaffen? Gleich mit Riesenschritten in den ersten Stock hinaufgerannt, dann rechts um die Ecke, in das erstbeste Zimmer hinein. Keuchend verriegelte er die Türe von innen.
Brian sah sich um: er war im Wäschedepot gelandet. Der Raum war bis zur Decke hinauf mit Verbandszeug, frischer Bettwäsche und Decken gefüllt.
Wo könnte er sich nur verstecken? Mit dem Chip im Arm und dem Serfy in der Hosentasche war er jederzeit zu orten – auf den Millimeter genau! Brian war sich bewusst: der Staat war jetzt nicht mehr sein Freund – er war sein Feind. Und wer den Staat zum Feind hatte, der hatte Tausend Feinde.
Vorsichtig schlich sich Brian aus dem kleinen Lagerraum und trippelte zum Schwerlastaufzug am Ende des Ganges. Mit einem Quietschen öffnete sich die orangefarbene Eisentür. Es roch nach Maschinenöl – und nach jener Kälte, die alte Bauwerke in ihren dicken Mauern speicherten.
Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis der alte Lastenaufzug den dritten Stock erreichte. Vorsichtig trippelte er den kühlen Gang in Richtung Treppenhaus zurück. Da erblickte er ein kleines Raucherzimmer: es ging auf die Hauptseite des Gebäudes hinaus, hatte sogar einen kleinen Balkon. Im Raum zwei Männer. Regungslos saßen sie auf abgewetzten Fauteuils und zogen an ihren billigen Victory-Zigaretten aus Kuba. Ihre Blicke gingen zur Wand.
Ohne zu grüßen durchquerte Miller das Zimmer und betrat den Balkon. Er lehnte sich auf die Brüstung. Nun sah er auf den prachtvollen Platz vor dem Heim hinunter. „Eine eigenartige Stille da oben!“, dachte er laut.
Unten rollte der Kleinbus eines Medikamenten-Lieferdienstes vom Parkplatz, gefolgt von weißen Autos mit verdunkelten Scheiben.
Schon wollte Brian den Balkon verlassen, da sah er sie: Betty! Ein Stich ging mitten durch sein Herz! Da unten, da verließ Betty gerade das Gebäude. Langsam schritt sie die breiten Stiegen hinunter – begleitet von Männern in grauen Anzügen und schwarzen Sonnenbrillen. Hätte Betty jetzt nach oben gesehen, zehn Meter in die Höhe – sie hätte in das geschundene Gesicht ihres Ehemannes geblickt.
Brian überkam eine bleierne Schwere. Bilder vom Begräbnis seines Vaters zogen an ihm vorbei. Er neben der Mutter, hinter dem Sarg seines Vaters gehend.
Brian war gerade einmal 14 Jahre alt, als sein Vater ihn verlassen hatte. Und mit jetzt war auch noch seine Betty weg! Würde er sie jemals wiedersehen? War alles seine Schuld – und wo war seine geliebte Tochter Rose? War sie in Sicherheit? Gedankenfetzen rasten durch sein Gehirn.
Betty war mit ihren Aufpassern in ein verdunkeltes Auto gestiegen. Die Reifen knirschten im Kies, als sie den Parkplatz verließen und in die Hauptstraße einbogen. Brian blickte ihnen nach, bis sie hinter den Bäumen verschwunden waren.
Was war in dem Wäschedepot passiert? Ein Blick zurück.
Brian war in die Kammer im ersten Stock geflüchtet. Fieberhaft riss er Schränke und Laden auf: nichts als Decken und Polster! Doch dann, im Glasschrank die Rettung: Operationsbesteck. Dutzende Packungen, allesamt in Plastik geschweißt. Schnell so ein Päckchen aufgerissen. Mit der Wut des in die Enge Getriebenen setzte sich Brian einen langen, tiefen Schnitt in den linken Oberarm. Mit Daumen und rechtem Zeigefinger den Sozial-Chip herausgedrückt. Dann den Chip mitsamt Serfy in die leere Verpackung gewickelt. Flink noch Verbandsmaterial eingesteckt. Jetzt noch den sendenden Sondermüll loswerden!
Durch die Türe hörte er schon die Stimmen seiner Verfolger. Sachte drückte Brian das alte Holzfenster auf. Es öffnete zum Hinterhof. Geschickt schlüpfte er hindurch, hantelte sich am Fensterbrett hinunter und ließ sich in den Park hinunterfallen. Schnell zum Hintereingang zurückgelaufen. Doch dieses Mal nicht in den ersten Halbstock hinauf, sondern in den Keller hinab. Zu den Warteräumen.
Brian hatte Betty früher öfters von der Arbeit abgeholt. Dann musste er manchmal warten, bis sie sich umgezogen hatte. Hier unten, bei den Ärzte-Besprechungszimmern konnte man es sich gemütlich machen. Die alten Ledersofas waren immer noch da, und auch heute warteten Patienten, um aufgerufen zu werden.
Auf dem Teleschirm in der Ecke lief eine Nachrichtensendung. In dicken Lettern stand da: „London: Rechtsradikaler attackiert Soziologiestudenten!“
Ein Blitz durchzuckte Brian. Er schien tatsächlich jemanden getötet zu haben. Und es tat ihm nicht einmal leid. Brian war ganz klar im Kopf: jetzt galt es, zu verschwinden. Nur wohin?
Suchend blickte Brian durch den Raum: links waren die Toiletten, neben dem Teleschirm der alte Getränkeautomat – und auf dem Sessel rechts davon, da hatte jemand eine rote Sanitäter-Jacke über einen Gegenstand geworfen. Brian sah genauer nach: es war ein offener Medikamentenkoffer! Sein Besitzer war wohl gerade auf der Toilette. Unauffällig näherte sich Brian der Jacke, beugte sich zu den Schuhen herunter, und tat so, als ob er diese fester zuschnüren würde. Blitzschnell glitt das Knäuel aus blutverschmierter Kunststoffverpackung, Serfy und Sozial-Chip in die Erste Hilfe-Tasche.
Ohne sich umzublicken, stieg Brian die Treppen hinauf – und das keine Sekunde zu früh. Noch auf der Treppe hörte er, wie jemand aus der Toilette kam. Nun hieß es abwarten, bis sich der Staub im Altersheim etwas gelegt hatte.
Er schlich in den ersten Stock. Da war diese Toilette für »Diverse Geschlechter«.
Sie war noch nie benutzt worden, das wusste er von Betty.
Dort schloss er sich ein. Nun saß er da – ganz ohne Chip und ohne Serfy.
Brian schmunzelte ob der grotesken Situation: noch nie in seinem ganzen Leben war er so frei von staatlicher Kontrolle gewesen wie jetzt – und war doch auf einer Toilette eingeschlossen! Wenigstens hatte er jetzt Zeit, sich um seine Fleischwunde am Oberarm zu kümmern. Eine saubere Mullbinde, fest über die Verletzung geschnürt. Darüber ein paar große Pflaster und gut.
Brian wartete eine Viertelstunde, dann fuhr er mit dem Schwerlastaufzug nach oben. Da war ein Raucherzimmer!
Ohne zu grüßen schritt er hindurch und betrat den Balkon.
Er schmunzelte, als er die Minilieb-Agenten hektisch hinter dem Medikamenten-Wagen herfahren sah. Ihre Ortungsgeräte sagten ihnen, dass Brian sich im Medikamentenwagen befinden musste. Dabei war dort bloß die Tasche, in der sich Serfy und Chip von Brian befanden.
Von oben seine Betty zu sehen, und sich nicht bemerkbar machen zu dürfen, das hatte Brian einen seelischen Magenstoß versetzt.
Betrübt verließ er den Balkon.
Als er den Aufenthaltsraum mit den alten, rauchenden Männern durchschritt, bemerkte er auf der linken Seite die kleine Garderobe! Flink griff Brian nach einer Baseball-Kappe und einem abgetragenen, schwarzen Plüschbademantel. Auf dem Weg zum Hinterausgang kam Brian noch am Pausenraum für das Nachtpersonal vorbei. Im Kühlschrank fanden sich Fischkonserven, dazu etwas Wurst und Käse, und ein in Plastik eingeschweißter Nudelsalat. Gemeinsam mit zwei Dosen Victory-Bier („Frei von Gentechnik!“) verschwand die Beute in den Taschen seines Bademantels.
Nun stand er auf der Straße, neben dem Fahrrad-Parkplatz.
Da war noch immer dieses 30 Jahre alte Campingrad. Das Personal des Heimes verwendete es, um schnell einmal zur Post oder zum Supermarkt zu radeln. Zwar war es gechipt, doch die Batterie war schon seit Jahren entleert. Dass sie mittlerweile ersetzt worden wäre, das hielt Brian für sehr unwahrscheinlich.
Langsam radelte Brian die Straße hinab, blickte ratlos vor sich her. Er wusste: von nun an war er vogelfrei! Wollte er überleben, musste er also unerkannt bleiben. Doch das war leicht gesagt und schwer getan. Denn London war – genauso wie das übrige Riesenreich – mit Abermillionen Kameras, Teleaugen und 5G-Antennen gepflastert. Selbst auf Geh- und Radwegen war man ständig auf dem Radar irgendeines technischen Systems.
Doch so schlecht Brians Karten gerade waren, er besaß einen riesigen Trumpf: er sah aus wie ein Penner! Wie ein Proles, oder gar ein illegaler Immigrant. Und so was interessierte keine Polizei – solange er sich nur den feinen Vierteln der Electi fernhielt.
7
„Puh!“
Anna kam ins Schwitzen. Es war Mittwochabend, knapp vor fünf. Der Text, an dem sie seit Stunden arbeitete, sollte längst freigeschalten sein. Aber sie kam einfach nicht weiter! Es ging um die Verstrickung von Präsident Goldstein ins organisierte Verbrechen. Oder sollte sie gleich sagen: mit der amerikanischen Mafia?
Anna hasste solche Aufträge: es gab weder Beweise, und eigentlich nicht einmal Indizien. Aber US-Soziologen hatten Vermutungen geäußert, dass solche Verstrickungen bei Goldstein durchaus denkbar wären – und da musste man als Journalist halt kreativ werden.
In der Redaktionssitzung war die Wahl auf Anna gefallen.
Jetzt fragte sich Anna, ob man den Begriff »amerikanische Mafia« überhaupt verwenden sollte. Könnte man dann nicht schließen, es gäbe auch in Eurasien eine Mafia? Man wollte ja den rechten Erzfeind in Amerika anpatzen. Keinesfalls sollten die Eurasier das Vertrauen in die Integrität der EU verlieren. Anna wollte das mit einem Verbindungsoffizier vom Miniwahr abklären.
Für Anna Hardy als Journalistin, Stadtkind und Geistes-wissenschaftlerin war der Sozialismus das natürlichste auf der Welt. Nicht-Sozialisten, das waren entweder Dummköpfe, denen die Augen noch nicht geöffnet wurden. Oder schlimmer noch: sie waren Profiteure eines auf Ausbeutung basierenden Systems. Oder einfach nur von Grund auf böse Menschen. In jedem Fall war es ihr Auftrag als Publizistin, die Welt vor diesen Menschen zu schützen!
Anna war ein Waisenkind. Gleich nach der Geburt waren ihre Eltern bei einem tragischen Autounfall um´s Leben gekommen. Erste Station: Pflegeeltern. Dann in´s katholische Waisenheim. Dort vermittelte man Anna den Glauben an die Nächstenliebe. Wie alle Eurasier unter sechzig glaubte auch Anna an keinen christlichen Gott – mit Erbschuld, höchstem Gericht und alledem.
Was Anna aber faszinierte, das war die Radikalität, mit der Christen die Nächstenliebe lebten.
Liebe deinen nächsten – bis zur totalen Selbstaufgabe. Ohne Rücksicht auf das eigene Überleben, das der eigenen Familie, der eigenen Kultur, der eignen Werte! Eine Gesellschaft, die von der Liebe um die Mitmenschen, die Tiere, die Pflanzen getragen wurde. Eine Welt in der die Menschen frei von materiellen Bedürfnissen lebten. Was war das für ein phantastischer Traum!
Im bedingungslosen Wohlfahrtsstaat sah Anna die Irdisch-Werdung des göttlichen Versprechens von der bedingungslosen Liebe. Aber wie auch die katholische Kirche und ihr marxistischer Papst, so wollte auch Anna nicht auf den Tod warten, um die gerechte Gesellschaft zu erleben. Noch zu Lebzeiten wollte sie ein Leben frei von Verpflichtungen führen. Und es anderen ermöglichen.
Denn Anna Hardy war überzeugt, dass jeder Mensch nach einer besseren Gesellschaft strebe. Dass jeder Bürger alles gäbe, um das Leben anderer zu verbessern. Und wenn Crisaner (das war das Neusprech-Wort für Roma) an der Pforte zum Waisenheim läuteten und mit grimmiger Miene Geld forderten (und das Fahrrad einer Schwester stahlen), dann taten sie das nicht, weil sie faul waren, sondern weil (nicht-konkretisierbare) gesellschaftliche Umstände sie zu diesem Verhalten zwangen. Soziologen, Psychologen und Sozialarbeiter hatten das in Untersuchungen bestätigt.
Anna war schon früh zur Partei gestoßen. In ihrem Zimmer hingen zwei Bilder; das eine von Jesus mit langem, wallendem Bart und friedlich-entrücktem Blick. Das andere vom Großen Bruder: auch mit längeren Haaren, aber mit festem Blick.
Bereits im Alter von sieben hatte Anna bei den Kinderspitzeln begonnen. Dort schauten die Kindern Erwachsenen auf die Finger, ob sie sich auch richtig bemühten, zu besseren Menschen zu reifen. Etwa, wie fleißig sie Neusprech-Vokabel verwendeten. In ihrer Kindheit hatte Anna einen Kassettenrekorder. Mit dem zeichnete sie am Bronfstein-Platz die Gespräche von Erwachsenen auf und analysierte sie dann am Abend in ihrem Zimmer.
Mit dreizehn wechselte sie zu den Jungen Internet-Zensoren. Hier säuberten Teenager ihre digitale Umgebung von konservativen Gedanken. Etwa von Materialismus, Patriotismus oder Rassismus. Anna liebte die Tätigkeit. Manchmal schwänzte sie sogar die Schule, um Rechte auszuforschen. Es gab Wochen, da konnte sie 20 oder 30 digitale Verschmutzungen ausforschen. Die gab man dann auf einer Seite im Minilieb bekannt.
Bei leichten Internet-Vergehen, wie sie in Gedankenlosigkeit von Proles verübt wurden, sperrte man die Täter einfach vom Internet aus. Löschte den Beitrag, sperrte den Youtube-Account. Das wurde nicht einmal begründet. Man hatte halt gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen, hieß es dann kryptisch. Bei Wiederholung Strafanzeige wegen Verhetzung oder Beleidigung von Minderheiten.
Bei mittleren Vergehen ging der Fall schon an die Presse. Das kostete dann Job, Freunde und Familie. Oft wurde man vaporisiert, wurde aus dem digitalen Gedächtnis des Landes gelöscht.
Wann immer Anna mit ihrer Arbeit jemanden von der Bildfläche schoss, beschlich sie ein Gefühl tiefer Zufriedenheit: sie hatte etwas Gutes für die Gesellschaft getan.
Zwei Jahre hatte Anna im Kinderchor des Second English Television (SET) gesungen. Mit den Songs „Meine Oma ist `ne Umweltsau“ und „Fick die Cops – sie sind Bullenschweine“ war man in vielen Ländern zu Gast. Etwa in Nordkorea, Venezuela, Kuba oder Bhutan.
Einmal durfte sie für ein Sommerpraktikum ins Londoner Miniwahr. Und zwar in die Einzelabteilung für Geschichtsrelativierung (das sollte ihr später bei der Bewerbung im MIRROR zugutekommen).
Im Ministerium lief gerade ein großes Projekt: nichts sollte mehr an die Konzentrationslager, Hungersnöte und Bombenkrieg des Sozialismus erinnern. Nichts sollte mehr an die totale Verarmung von drei Milliarden Menschen in der kommunistischen Welt erinnern. Nichts mehr an den Massenhunger in Indien, in China oder Kambodscha. Dass der Sozialismus des 20. Jahrhunderts fast alle Völkerwanderungen des 21. Jahrhunderts ausgelöst hatte – alles das sollte aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht werden!
Dass der Sozialismus 100 Millionen Menschen ermordete, teils in den brutalsten Konzentrationslagern der Welt – man denke an russische Gulags oder an die in Nordkorea – das würde die Eurasier von heute nur unnötig verwirren. Schließlich waren die Ideale des Sozialismus immer nur falsch interpretiert worden. Aber deshalb war ja automatisch nicht gleich die ganze Idee zu verdammen!
Einzig die Existenz deutscher Konzentrationslager wurde nicht aus den Büchern gestrichen. Im Gegenteil. Deutschlands Politiker walzten sie bei jeder Gelegenheit breit – so als wären sie nicht vor einem dreiviertel Jahrhundert, sondern gerade erst vor ein paar Wochen geschehen.
Von den Verbrechen anderer Völker erfuhren die Deutschen hingegen wenig. Nichts von den Millionen Getöteten durch Napoleon. Nichts vom chinesischen Sozialismus, der 50 Millionen Bürger durch Hunger ermordete. Nichts von den kambodschanischen KZs, in denen die Väter ihre Kinder mit Eisenstangen erschlagen mussten, bevor man sie selber erschlug.
Anna Hardy arbeitete in der Arbeitsgruppe Türkei. Ihre Aufgabe bestand in der Vertuschung türkischer Völkermorde. Das war gar nicht so leicht. Denn die Türken hatten weit über zwei Millionen Armenier, Kurden, Griechen und syrische Christen systematisch ermordet – und das in mehreren Wellen.
Wie dem auch sei. Weil die Deutschen nichts über die Verbrechen anderer Völker erfuhren, so meinten sie, einem außergewöhnlich bösen und unnützen Volk anzugehören. So begrüßten sie es frenetisch, als Millionen Zuwanderer in ihrem Land angesiedelt wurden. Das verdünnte den schlechten Charakter ihres Volkes. Zumindest behaupteten dies grüne Politiker.
Für die EU war dies von großem Vorteil. Denn mit ihrem Minderwertigkeitskomplex ließen sich die Deutschen besonders leicht lenken; quasi wie die Lastochsen vor dem schweren Karren durch ein Kind auf dem Kutschbock geführt wird.
Beim Praktikum war man von Anna Hardy begeistert. Im nächsten Jahr durfte sie ein weiteres Praktikum machen, dieses Mal in der Einzelabteilung für Straßen- Berg- und Flussnamenvariabilisierung.
Die Technik stammte aus dem Mittelalter. Wenn ein Herrscher getötet wurde, dann wurden jene Straßen, die seinen Namen trugen, umbenannt. Zumindest für ein paar Jahrzehnte. Solange, bis ein anderer an die Spitze gelangte.
Da die Straßenschilder heutzutage meist digital waren, konnten Persönlichkeiten, die vaporisiert wurden, mit einem einzigen Mausklick von Straßenschildern, Navigationssystemen und eBooks gelöscht werden. Immer wieder passierte es, dass einzelne Straßen zwei- oder dreimal im Jahr umbenannt wurden. Dann murrten die Anwohner leise.
In den Bezirken der Proles hingegen blieben die Straßennamen oft jahrelang gleich. Die interessierten sich nicht so für Politik, hieß es aus dem Miniwahr. In den Straßen ihrer heruntergekommenen Betonblocks gab es bisweilen sogar noch Straßenschilder aus Blech. Die Kehrseite der Digitalisierung: ohne Serfy und dessen Google Maps-Funktion brauchte man sein Zuhause erst gar nicht zu verlassen.
Bei diesem Praktikum arbeitete Anna bei einem Gender-Projekt mit. Das Problem bestand darin, dass Frauen in der Geschichte weder als Tüftlerinnen, Erfinderinnen noch als Unternehmensgründerinnen aufgetreten waren. Folglich waren Straßen und Plätze oft nach Männern benannt. Eine große Ungerechtigkeit! Und eine noch größere Herausforderung: denn auch heute, nach 100 Jahren Gleichberechtigung, hatten Frauen auf technischem Gebiet noch immer nichts Bahnbrechendes erfunden. Geschweige denn, dass sie Firmen gegründet und neue Produkte in großer Stückzahl produziert hätten. Kein einziger Konzern der Welt ging auf ein weibliches Superhirn zurück ....aber viele NJOs!
Diese Erkenntnis schuf die Basis für das Projekt. Es sah die Neubenennung von Straßennamen in über 3 000 Orten vor, und Anna war mit von der Partie.
Eine Neubenennung ging sogar auf sie zurück.
Ihr waren die zahlreichen Nikola Tesla-Straßen und -Plätze aufgefallen. Auf ihre Initiative hin wurden alle Nikola-Tesla-Straßen in Daisy-Smith-Straßen umbenannt. Während Tesla nur den Wechselstrommotor erfunden hatte (»Man denke nur an die Toten, die durch Strom um´s Leben gekommen waren!«), hatte Daisy Smith mit drei Freundinnen ein NJO gegründet, das mit Dutzenden ägyptischen Flüchtlingskindern sinnvoll Zeit verbrachte; etwa mit dem Batiken bunter Kleider (»Da leuchteten die Kinderaugen!«).
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752126549
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (Januar)
- Schlagworte
- Sozialismus Überwachung Freiheit 5G Political Correctness Liberalismus Demokratie Europa Diktatur