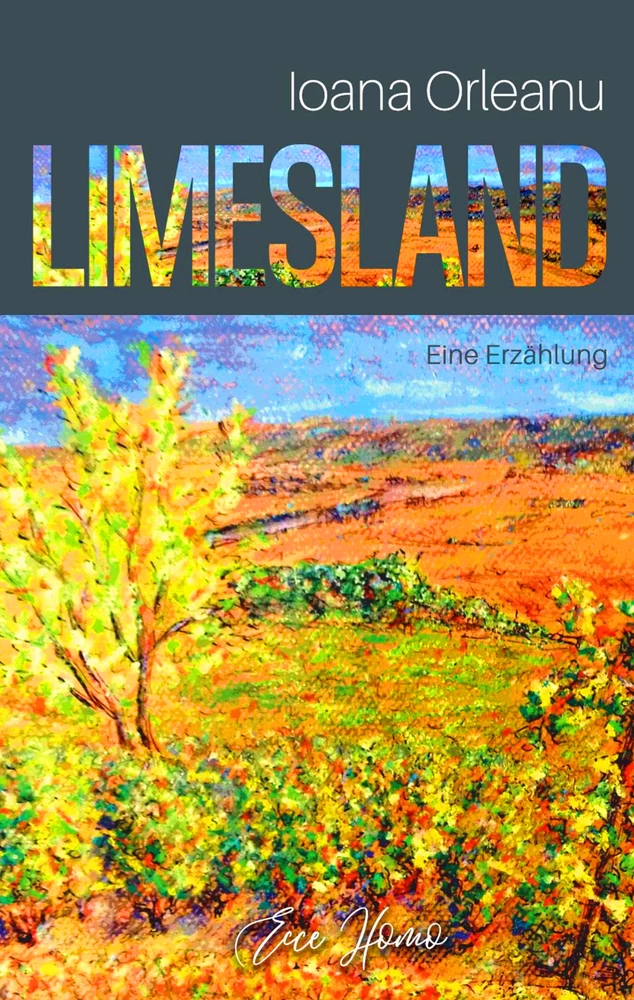Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Table of Contents
Ioana Orleanu
LIMESLAND
Roman
Motto
Das Doppelleben war ein unumstößliches Faktum
unserer Zeit und niemand konnte es umgehen.
Nadeschda Mandelstam
1
Und es begab sich, dass ein rotes Band an der Türklinke hing. Da lief sie hinters Haus, pisste sich auf die Hände, kam zurück und strich bedächtig über Tür und Fensterrahmen. Dann erst trat sie ein.
Die Leiche war arg zugerichtet, so arg, dass der Kommissar einen Augenblick lang etwas wie Ekel empfand. Das Gesicht: bis zur Unkenntlichkeit zerschlagen, eine bluttriefende, schmutzige Fleischmasse. Die Gliedmaßen: unnatürlich verdreht, wie ausgerenkt, ja, ausgerenkt, sie zeigten gen alle Himmelsrichtungen. Und die Kleidung war an vielen Stellen durchlöchert. Die Ratten. Kein Wunder bei dem Müll ringsherum. Der Kommissar bückte sich und betastete den Pullover des Toten. Ein schönes Teil, bestimmt aus Seide, teuer. Aber das Etikett war ausgerissen.
Da fiel sein Blick auf die zerschnittenen Fingerkuppen. Erstaunt drehte er sich zum Unterkommissar, der hinter ihm stand. Dieser nickte fröhlich: Ja, jemandem sei offensichtlich viel daran gelegen, die Identität dieses feinen Herrn, denn er war fein gewesen, diese zarten Händchen, damit hatte er bestimmt nicht gepflügt!, zu verheimlichen. Sehr akkurat sei die Chose aber nicht gemacht. Irgendein Fingerabdruck würde sich schon rekonstruieren lassen. Der Kommissar zog eine skeptische Grimasse. Doch, Chef, summte der Unterkommissar, ganz bestimmt, machen Sie sich keine Sorgen. Ich mach mir überhaupt keine Sorgen, mir ist nur kalt, widerliches Wetter.
Das war es in der Tat. Es nieselte, fein und unaufhaltsam. Der Schnee, der die armseligen Häuschen dieses gottvergessenen Stadtviertels, die ungepflasterte Straße, den Müll auf dem maidan, wo eine alte Frau, eine verwahrloste, gekrümmte Kreatur, die Leiche entdeckt hatte, spärlich bedeckte, verwandelte sich unter der ständigen Berieselung in Matsch. Grau, klebrig, schmutzig, so war alles hier, die niedrig hängenden Wolken, der Regen, die Gesichter der Schaulustigen, die in einiger Entfernung beisammenstanden und das Geschehen mit lüsterner Neugierde beobachteten.
Das sieht mir ganz nach einem bestellten Mord aus, sinnierte der Unterkommissar. Klugscheißer, murmelte der Kommissar. Müde gab er seine Anweisungen – Spurensicherung, Vermisstenmeldungen: Wenn was rauskommt, sagt mir Bescheid, aber nicht vor Montag, ich fahre aufs Land. Verstanden, Chef, ich werde Sie nicht unnötig stören. Nein, Marian, du sollst mich überhaupt nicht stören.
Der Kommissar entfernte sich, schwankend und fluchend, denn im glitschigen Schlamm rutschte er bei jedem Schritt aus.
Der Montag war immer laut und voll. Der erste Tag der Woche. Ein grässlicher Tag.
Kaum hatte der Kommissar die Hauptwache betreten, da runzelte er schon die Stirn. Im langen, grüngräulichen, seit Jahrzehnten nicht mehr renovierten Flur versperrte ihm ein wild gestikulierender Mann den Weg. Vor ihm, leicht mit einem Bein wippend – der Unterkommissar. Er hatte den Kopf etwas in den Nacken geworfen, um auf die bizarre Gestalt, die sich vor ihm so verausgabte, besser herabzuschauen. Dabei wiederholte er monoton: Wir können Ihnen nicht helfen, das können wir nicht. Wer soll mir dann helfen? Sie hören mir nicht zu. Nein, Sie hören mir nicht zu, es interessiert Sie gar nicht, was ich sage! Sie müssen den Gerichtsvollzieher holen, klagen, den üblichen Rechtsweg gehen.
Der Kommissar wollte unbemerkt an den beiden vorbeischleichen, der Wachtmeister trat aber an ihn heran und zog ihn zur Seite. Seit einer halben Stunde ginge das so, irgendetwas mit einer Erbschaft, was genau, das sei nicht zu verstehen: Er will Sie sprechen, Chef. Mich? Der Wachtmeister nickte bedeutungsvoll. Der da sei irgendwie Ausländer und schwadroniere etwas von Europa und Folgen und so.
Der Kommissar zögerte, ging dann halbherzig auf den Fremden zu: Kommissar Angelescu. Jener aber, blass, die Lippen zusammengepresst, die Hände zur Faust geballt, konnte kaum noch an sich halten: Seine Beschwerde nicht aufzunehmen, unerhört, Orient, reinster Orient, in einem zivilisierten Land würde so etwas nicht passieren! Im grüngräulichen Flur hallte seine etwas zu schrille Stimme metallen wider. Dann geh doch zurück in dein zivilisiertes Land, hier wird dich keiner vermissen! Es war der Unterkommissar, der dies gesprochen.
Der Fremde lief rot an: Was sagen Sie, was erdreisten Sie sich zu sagen? Kollega! Der Kommissar gab sich alle Mühe, ruhig zu bleiben.
Und in der Tat wirkte er sehr gelassen, als er sich danach erkundigte, was den Fremden denn in die Hauptwache geführt hatte. Er sei nicht von allein gekommen, antwortete jener: Ihre Polizeistreife hat mich mitgebracht. Warum? Um Beschwerde einzulegen. Der Kommissar verdrehte leicht die Augen: Worüber wollten Sie sich denn beschweren, mein Herr? Da brach, empört, der Wortschwall wieder los: In der Wohnung der verstorbenen Mutter …, vermietet …, eine schlafende Person …, meine Schwester hat ohne mein Wissen …, dazu hatte sie kein Recht! Woher er denn wisse, dass die schlafende Person ein Mieter sei, fragte der Kommissar. Von der Person selbst, triumphierte der Fremde, sie hätte der herbeigerufenen Polizeistreife verraten, dass sie 300 Euro an die Schwester zahle, schwarz, versteht sich: Sie hat aber überhaupt kein Recht dazu, die Wohnung gehört uns beiden!
Der Kommissar hob seine Hände in einer Geste absoluter Hilflosigkeit. Er wisse beim besten Willen nicht, was er tun könne, den Mieter rausschmeißen dürfe er ohne richterlichen Beschluss nicht: Sie müssen sich mit Ihrer Schwester verständigen – oder gegen sie klagen. Erst mal müsse er Beschwerde einlegen, Beschwerde dagegen, dass die Wohnung illegal vermietet sei, versetzte der Fremde. Er lasse sich nicht abwimmeln, er werde sich nicht von der Stelle rühren, bis diese gottverdammte Beschwerde nicht aufgenommen sei: Haben Sie das verstanden?
Der Kommissar machte ein nachdenkliches Gesicht, der Ärger war ihm deutlich anzumerken. Nimm es auf und komm dann zu mir, sagte er schließlich zum Unterkommissar.
Dann ging er, ohne sich umzuschauen.
Er ging durch den langen, grüngräulichen Flur, durch das kahle, schlecht beleuchtete Treppenhaus, er öffnete eine Tür, die laut aufquietschte, dann eine zweite und noch eine dritte und gelangte in einen großen, ebenso schlecht beleuchteten Raum. Die Farbe an den Wänden war überall aufgesprungen, an der Decke klafften weite Risse, der bräunliche Teppichboden war zerfleddert und fleckig. Ein paar Metallschränke, seit langem nicht mehr geputzt, reihten sich an den Wänden. Der Kommissar setzte sich an einen der vier wackeligen Schreibtische, die in der Mitte des Raumes standen, und packte sein Frühstück, zwei Speckbrötchen, drei hartgekochte Eier und eine Thermoskanne, aus, zündete sich eine Zigarette an und begann genüsslich zu essen.
Eine Viertelstunde später klopfte es kurz an der Tür und der Unterkommissar trat grinsend ein. Fertig? fragte der Kommissar. Ja, antwortete der andere höchst zufrieden. Und plötzlich lachte er, laut und unbeherrscht, über die idiotische Nervensäge, die alles bis ins kleinste Detail aufschreibt und dann ohne Registriernummer weggeht: Kann man sich das vorstellen? Hast du deinen Namen genannt? Ich habe es vermieden. Dann schmeiß den Scheiß weg, Marian, in den Müll damit, schnell.
Nun war auch der Kommissar zufrieden: Wie steht’s mit unserem Toten? Bestens, keiner vermisst ihn. Wirklich? Wirklich. Der Unterkommissar prüfte konzentriert die glänzende Spitze seines Schuhes, der auf einem der wackeligen Schreibtische ruhte. Die Beschreibung, erklärte er nachlässig, passte auf einen Typen, der vor einer Woche verschwunden sei, doch die Angehörigen, die in aller Herrgottsfrühe angetanzt seien, sagten, es sei nicht ihr Sohn. Sicher nicht? Hundertpro. In den Hotels? Nichts. Komisch, wunderte sich der Kommissar, unser Mann ist bestimmt auch schon eine Woche tot. Ja. Des Unterkommissars Gesicht erstrahlte wieder in großer Fröhlichkeit, denn eine Neuigkeit gab es doch zu berichten. Na, spuck’s schon aus, ermunterte ihn sein Chef. Er ist nicht an den Schlägen gestorben. Sondern? Schätze, man hat ihn vergiftet. Und der Unterkommissar kicherte vergnügt.
Der Kommissar wollte es ihm gleichtun, doch dann schüttelte er nur leicht den Kopf: Ist der Obduktionsbericht fertig? Noch nicht. Und die Fingerabdrücke? Dauern auch noch. Fein. Da konnte man in Ruhe seine Tasse Kaffee ausschlürfen. Und während er dies tat, betrachtete der Kommissar mit väterlicher Herablassung sein Gegenüber. Marian, sagte er bedächtig, mäßige in Zukunft etwas deine Zunge. Haben Sie Angst um mich, Chef? Eher um deinen Vater, wie geht es ihm? Gut, Chef, er hat keine Toten in seinem Revier. Tja, er ist ein Glückspilz.
Der Montag war wirklich ein grässlicher Tag.
Drei Tage später, es war gegen 13 Uhr, der Kommissar schickte sich wie immer an, Feierabend zu machen, da ging mit einem Knall die Tür auf und der Unterkommissar, ganz außer sich, stürmte herein. Unglaubliches sei passiert, wirklich Unglaubliches! Es sei nicht zu fassen, aber: Wir haben ihn, wir haben IHN, IHN, ja, IHN! Beinahe hätte er noch ein Trallala hinterhergeschickt.
Der Kommissar verzog wie unter akuten Zahnschmerzen das Gesicht. Wen haben wir? Voinea, Chef, wir haben Voinea, er ist unser Toter! Das gibt’s doch nicht. Etwas Gebrochenes, fast Flehendes schwang in der Stimme des Kommissars. Er fiel in seinen Sessel zurück. Aber ja doch, ja, sang der andere fröhlich. Der Fingerabdruck des rechten Zeigefingers – eindeutig rekonstruiert, abgeglichen, identifiziert, es bestand kein Zweifel, der Computer sagte Voinea, der Computer irrte nie.
Mannomann, stöhnte der Kommissar, wenn ich jetzt keinen Herzinfarkt bekomme, bin ich für die Ewigkeit davon gefeit! Aber wieso denn, Chef, wieso denn, das ist die Sensation, Sie kommen in die Zeitung, Sie werden berühmt, wir werden berühmt! Trallalala. Du hast keine Ahnung, mein Gott, keine Ahnung. Plötzlich wurde der Kommissar wütend: Kein Wort zur Presse, hörst du, keine Zeitung, kein Journalist, Journalisten haben Eintrittsverbot, ich will diese Kanaillen hier nicht sehen! Und ein schwerer Faustschlag fiel auf den armen Schreibtisch. Aber Chef, das ist die Chance!, klagte der Unterkommissar. Du bist ein Idiot, ein ausgesprochener Idiot, erwiderte der Kommissar in nüchtern feststellendem Ton. Und faltete die Hände zusammen. Und schwieg. Lange.
Der fassungslose Unterkommissar wagte nicht, sich zu bewegen. Das widerfuhr ihm äußerst selten. Wir werden es nach oben melden, entschied schließlich der Kommissar, ja, sollen die sich doch den Kopf mit diesem Scheiß zerbrechen. Und er verlangte einen Termin beim Polizeipräsidenten: Sofort.
Ich verstehe deine Sorgen, wirklich, mein Lieber, aber du irrst, die Nachricht ist gut, sogar ausgesprochen gut, endlich! Der Polizeipräsident lehnte höchst zufrieden in seinem Sessel, die etwas dicklichen Fingerchen trommelten munter auf die Armlehne. Der Anblick des Kommissars, ach, dieses bekümmerte Häufchen Elend, wie steigerte er seine Vergnügtheit noch! Aber seine Stimme blieb ernst, eindringlich, sie mahnte: dass man Druck ausüben werde, natürlich, von allen Seiten, aber es galt standzuhalten, eisern zu ermitteln, nach allen Richtungen, ohne jede Rücksicht. Der Kommissar seufzte: Auch in Richtung – Ploaie? Vor allem in Richtung Ploaie!, entgegnete der Polizeipräsident. Es sei von größter Wichtigkeit, den Eindruck der Bevorzugung oder gar der Vertuschung zu vermeiden: Haben wir uns verstanden? Der Kommissar nickte schicksalsergeben.
Da lächelte der Polizeipräsident. Er lächelte das Lächeln des Mächtigen, der plötzlich so etwas wie Mitleid mit der unwissenden Kreatur an seinen Füßen empfindet und sich gnädigerweise ihrer erbarmen will. Und so beugte er sich vor und klopfte seinem Gegenüber auf die Schulter und machte ihm Mut: Man werde ihn aus der Schusslinie heraushalten, versprochen! Aber, mein Lieber, und sein Blick bohrte sich regelrecht in die Augen des Kommissars, du berichtest mir, nur mir, zur Presse kein Wort, das mache ich, und es wird nur das Nötigste sein, eine kleine Pressemitteilung, hast du mich verstanden? Selbstverständlich, Herr Polizeipräsident, selbstverständlich. Die dicklichen Fingerchen trommelten wieder und der Polizeipräsident summte fröhlich: Kein Grund zur Beunruhigung, gar keiner. Wirklich nicht?, entgegnete der Kommissar zaghaft. Nein, glaub mir doch, alles wird gut, also trink aus und fahr heim, es ist schon spät.
Als der Kommissar das Polizeipräsidium verließ, war er tatsächlich ruhiger.
2
Auf dem Schlachtfeld des Wahlkampfes platzte die Nachricht wie eine Bombe. Sie drängte alles in den Hintergrund. Der Auffahrunfall des Premiers, die Korruptionsklage gegen den Oppositionsführer, die Immobilienmachenschaften des Provinzbonzen, ja nicht einmal das unbekümmerte Eingeständnis des Staatsoberhauptes, in der traurigen, alten Zeit sehr erfolgreich das getan zu haben, was seine Landsleute auch bei jeder Gelegenheit getan, nämlich: zu schmuggeln (ein Eingeständnis übrigens, das ihm die Wählergunst nicht entzog, sondern, im Gegenteil, seine Beliebtheit noch steigerte) – nichts von alledem schien noch eine Schlagzeile wert.
Die Zeitungen überboten sich in Berichten über den vor Jahren ins Ausland geflüchteten und jetzt tot aufgefundenen George Voinea, die rechte Hand jenes irgendwie geheimnisumwitterten, weil wie aus dem Nichts zum Magnaten aufgestiegenen Horatiu Ploaie. Man rollte den ganzen Skandal seines Investmentfonds, der wie eine Seifenblase geplatzt war und in dessen Folge mehrere Hunderttausend Menschen ihre Ersparnisse eingebüßt, Ploaie und die meisten seiner Getreuen aber mit heiler Haut und vollgestopften Konten davongekommen waren, wieder auf. Man beugte sich mit plötzlich erwachter Gewissenhaftigkeit über dicke Prozessakten, in der naiven Hoffnung, die wahren Gründe für Ploaies Freisprüche und Voineas in Abwesenheit erfolgten Verurteilungen doch noch zu finden. Man stritt über Voineas Rolle in dieser mehr als schmutzigen Sache, man schwankte zwischen Abneigung und Mitleid: War er Schurke oder Sündenbock? Man spekulierte über die Umstände seiner Flucht – so unmittelbar vor seiner endgültigen Verurteilung, über seinen bisherigen Aufenthaltsort, über die Gründe seiner Rückkehr. Hatten die Behörden ihn nicht schon für tot erklärt? Wer hatte ihm geholfen? Wer – gewusst, dass er zurückgekommen war? Und wer hatte ihn ermordet? Und warum?
Ploaies Villa, dort, in jenem vornehmen Viertel, wo die Emporkömmlinge der letzten hundert Jahre so gern zu residieren pflegten, wurde von Journalisten belagert. Erfolglos, freilich, denn Ploaie hüllte sich in Schweigen. Ja, eigentlich schien er sich in Luft aufgelöst zu haben. Man munkelte, er halte sich auf seinem riesigen Anwesen in den Bergen auf und terrorisiere von dort mit den berühmt-berüchtigten Wutausbrüchen seine Getreuen, aber das waren wirklich nur Mutmaßungen, Gerüchte aus der Journalistenküche.
Tatsache war, dass niemand, nicht einmal die Mitarbeiter der Zeitungen, die ihm gehörten, Genaues wusste. Die Polizei hielt sich bedeckt. Abgesehen von ein paar lapidaren Pressemitteilungen, in denen es hieß, man werde zum gegebenen Zeitpunkt alle notwendigen Enthüllungen machen, sickerte keine brauchbare Information durch. Man tappte wirklich im Dunkeln.
In der großen Stadt, die sich gern als Metropole präsentierte, gab es aber jemanden, der mehr wusste und seit Tagen, wie im Fieber, nur eine Frage wiederkäute: Wohin – mit diesem Wissen? Wohin nur? Jemand.
Ich.
Die prächtige Eichentür öffnete sich quietschend und ein rundes, freches Frauengesicht erschien im Türspalt. Frau Dudu?, fragte der Unterkommissar. Dudu? Die Frau hatte die Augenbrauen hochgezogen und wirkte irgendwie beleidigt. Ja, wir suchen Frau Mona Dudu. Ach, Frau Mona – wer sind Sie aber? Die beiden Kommissare streckten ihr die Ausweise entgegen. Die Frau betrachtete sie einen langen Augenblick, bat sie dann zu warten.
Fünf Minuten vergingen im Schneckentempo. Nichts hasste der Kommissar mehr, als im kalten Regen vor geschlossenen Türen, und seien sie noch so prächtig und aus Eiche, zu warten. Er hätte selbstverständlich in aller Ruhe das gegenüberliegende Glitzertor zum Schloss jener gefeierten Queen Mary, die vor langer Zeit so manchen Dichter mit ihrem frostigen Charme betört, bewundern können. Aber seine Augen sahen nur die Gräue.
Schon wollte er wieder schellen, da ging die Tür auf und das runde Frauengesicht bat sie unter Entschuldigungen herein. Frau Mona ginge es gar nicht gut, die Ärmste, ihr Zustand sei wirklich bedauernswert: Nun ja, uns alle hat es sehr mitgenommen, Sie verstehen.
Sie ging voran. Der nicht gerade schlanke Körper, in enge Jeans und eine tiefdekolletierte Bluse eingezwängt, wogte im Rhythmus ihrer Schritte. Sie führte die beiden durch eine große Empfangshalle, à l’americaine, in einen halbrunden, salonartigen Raum, wo in der Mitte ein Leopardenfell ruhte. An den Wänden hingen Ölgemälde, auf den Kommoden thronten abstrakt anmutende Bronzeskulpturen.
Frau Mona werde sie dennoch empfangen, sagte die Frau, und die Art, wie sie ihren Kopf zur Seite neigte, belehrte die Kommissare darüber, dass ihnen eine außergewöhnliche Gunst erwiesen wurde. Sie hieß die beiden auf einem ledernen Sofa Platz zu nehmen. Ein bedrohliches Knurren riet ihnen jedoch davon ab, sich dem Sofa zu nähern. Oh mein Gott, Blacky – die Frau war sichtlich erschrocken: Sehen Sie sich bloß vor, er beißt! Mit größter Liebenswürdigkeit: Blacky, Lieber, komm, brav, Leckerli, lockte sie den Hund aus seinem Versteck und geleitete ihn zur Tür. Der Hund schien ihre Bemühungen jedoch nicht richtig zu honorieren, denn kaum war die Tür hinter ihm geschlossen, dass er furchtbar zu bellen begann. Er hasse es, ausgeschlossen zu sein, entschuldigte ihn die Frau.
Der Kommissar, obwohl etwas bleich, nickte unbeeindruckt. Ob sie hier angestellt sei, erkundigte er sich. Die Frau lächelte. Gutmütig. Bescheiden. Sie sei Frau Monas Gesellschafterin. Schon lange? Schon lange. Ob sie auch Voinea gekannt? Ja. Und wie sei er gewesen? Nett, ja, nett. Wissen Sie, ob noch Kontakt …
In diesem Augenblick wurde eine Seitentür ruckartig geöffnet und eine hochgewachsene, ausgesprochen dürre Person in einem langen, aufwendig gestickten Gewand trat hastig in den salonartigen Raum ein. Im Takt ihrer schnellen Schritte klirrten unzählige Armbänder an ihren Handgelenken. Sie griff nach einer der vielen Zigarettenschachteln, die überall herumlagen, und ließ sich wortlos in einen Sessel fallen. Für einige Augenblicke wurde es mucksmäuschenstill.
Frau Mona Dudu?, fragte der Kommissar vorsichtig. Dudu?, nein, Gruia, das heißt für Sie doch Dudu, ja, Dudu. Der Kommissar runzelte die Stirn. Frau Mona hatte etwas Eigenartiges, ja Unheimliches an sich. Sie sprach, ohne die Lippen zu bewegen. Und sie zog so verzweifelt an ihrer Zigarette. Wie war ihm das alles lästig! Doch er war ein Profi, also musste er sich zusammennehmen, wie immer, das Beileid aussprechen und sich entschuldigen, für die Störung, jetzt, in dieser Situation, die Routinefragen mussten aber gestellt werden, ganz schnell, versteht sich: Sie, Gnädigste, sind also die Exfrau von George Voinea? Die Frau blickte ihn mit großen Augen an, ihr ganzes Gesicht schien nur aus diesen immensen, staunenden und sehr hellen Augen zu bestehen. Ja, kam schließlich die Antwort. Sie haben einen Sohn mit ihm? Ja. Haben Sie oder Ihr Sohn seit Voineas Flucht Kontakt zu ihm gehabt, hat er versucht, Sie zu sprechen, vor allem jetzt, in letzter Zeit?
Mona Dudu schwieg. Lange. Ob sie die Frage überhaupt gehört hatte? Der Kommissar beugte sich ein bisschen vor und rief ihr ein leises Gnädige Frau? zu. Da, plötzlich, sprach die Stimme aus dem starren Gesicht, leise und mahnend, dann immer erregter, bei Gott, eine wahre Sturmflut, Vorwürfe, Klagen, Flüche, was hat man da bloß angestellt? Mutter, sprach die Stimme, sie sei Mutter, sie habe ein Kind, verstehen Sie?, ein Kind, ein Kind, das nichts verbrochen, gar nichts, aber in den letzten Jahren …, ach, großer Gott, was er, was ich durchgemacht …, wollen Sie uns zerstören, am Boden liegen sehen, zerschmettert, tot, auch tot, wollen Sie das?
Und Frau Mona sprang auf und schrie die Gesellschafterin an, wo denn Tomi sei, Tomi, sie hätte ihn nicht erreichen können, er dürfe die Zeitungen nicht lesen. Er wird sie schon längst gelesen haben, erwiderte die andere lakonisch. Die Gnädigste schien sie aber nicht zu hören, sie rang die Hände, Tomi, wieso er sich nicht melde? Und Pit, man solle Pit anrufen, er solle sofort kommen, sofort: Ich ertrage es nicht mehr, wieso lässt er mich immer allein, warum holt mich denn nicht endlich der TEUFEL, dann ist alles vorbei, Pit, Pit, ich ertrage es nicht mehr, Pit!
Zitterndes Kinn, bebende Lippen, Zähnegeklapper. Die Gesellschafterin wollte sie beruhigend in die Arme schließen, doch Mona Dudu wehrte sich mit kraftlosen Bewegungen: Nein, lass mich, lass mich, alles meine Schuld, ganz allein meine Schuld, das sagt ihr doch immer alle, und das stimmt auch, ich habe ja den Schuft damals geheiratet, jawohl, nun zahle ich, zu naiv, zu dumm – werde ich denn ewig dafür büßen müssen, wird es nie enden, nie?
Die Kommissare hatten sich schon erhoben, die Gesellschafterin wies ihnen, sanft, aber bestimmt, die Tür: Sie sehen selbst, sie kann jetzt nicht. Und der Hund? Ach, ja, Blacky, Blacky!
Der Hund ließ sich nicht blicken.
Als die beiden den Vorhof der Villa verließen, hörten sie hinter sich lautes Kläffen und heftiges Schluchzen.
Die Ermittlungen kamen nicht richtig in Gang. Niemand, weder Verwandte noch ehemalige Freunde, wollte von Voineas Rückkehr etwas gewusst haben. Niemand hatte ihn gesprochen oder gesehen. Die Grenzpolizei wusste nichts von seiner Einreise. Er war nirgendwo gesichtet worden, in keinem Hotel, in keinem Restaurant, in keinem Club. Man wusste nicht, seit wann er sich in der Stadt aufgehalten, wo er übernachtet, wen er gesehen hatte. Man wusste selbstverständlich auch nicht, wo der Mord begangen worden war. Der Kommissar hatte das Gefühl, einem Gespenst nachzujagen.
Auch die Befragung von Petre Dudu, der eine Stiftung für Menschenrechte und Demokratie leitete und unter dem Pseudonym Pietro Gruia anspruchsvolle Kriminalromane verfasste, führte zu keinen neuen Erkenntnissen.
Der Kommissar hatte ihm in der Stiftung einen kurzen Besuch abgestattet, er wollte ja alles ganz gewissenhaft überprüfen, die Aussichtslosigkeit der Aufklärung dieses Falles sollte keineswegs ihm angelastet werden! Wie erwartet, wusste Dudu nichts. Er habe, sagte er, die Worte langsam, fast mühevoll aussprechend, Voinea seit Jahren nicht mehr gesehen. Überhaupt hätte er nichts mit ihm zu tun. Und das Haus, in dem Sie wohnen, hat nicht Voinea das gekauft? Der Kommissar wusste, dass er sich mit dieser Frage etwas weit herauswagte, er stellte sie aber dennoch – obwohl er die Antwort, die sein Gegenüber noch langsamer und mühevoller hervorbrachte, kannte, seine Hausaufgaben hatte er ja gemacht: Das Haus gehörte Mona Dudu.
Ob Dudu diese Heirat letztendlich nicht mehr geschadet als genutzt hatte, fragte der Unterkommissar, als sie die Stufen des Prachtbaus, in dem sich die Stiftungsräume befanden, herabstiegen. Der Kommissar blieb stehen und betrachtete ihn entgeistert: So viel Gerissenheit nebst so schrecklicher Naivität – in ein und derselben Person! War das überhaupt möglich? Dreimal darfst du raten, wer hinter dieser Stiftungssache steht. Ploaie?, fragte der Unterkommissar unschuldig. Der Kommissar schüttelte nur den Kopf: Ob ihm das geschadet hat, geschadet!
An einem Bogenfenster, hoch über ihnen, bewegte sich leicht die Gardine: Ich habe damit nichts zu tun, nein, wirklich, ich habe damit nichts zu tun und ich will damit auch nichts zu tun haben, ich bin doch nur … Die Muße, schnurrbartkauend Selbstgesprächen nachzuhängen, ward Petre Dudu jedoch nicht gegönnt. Worauf er denn warte, ob er wirklich nicht Bescheid geben könne, dass die da schon weg seien, das sei ja nicht so schwer, denke er denn überhaupt nicht an sie – Mona Dudus Gesicht, ihre Stimme, die Hand, die noch die Klinke festhielt, waren ein einziger, ein riesiger Vorwurf.
Er seufzte.
Erschöpfung, bleierne Erschöpfung, in den Gliedern, in der Seele, in den letzten Geistesresten, wo hätte er sich bloß hinkauern und ruhen können, bis in alle Ewigkeit ruhen? Wollte dich gerade rufen, Liebes. Die Antwort: ein ununterbrochenes Hämmern. Ihrer Stilettos auf dem blankpolierten Parkett. Und ihrer einst so weichen Stimme (sie war doch weich gewesen?) in seinen Ohren: Wie sie alles das mitnehme, was sie durchmache, er verstehe nichts, gar nichts! Doch, Liebes, doch, ich verstehe dich, aber weißt du, ich brauche Ruhe, ich bin doch nur ein – Phantast, du bist ein Phantast, das weiß ich, brauchst mich nicht ständig daran zu erinnern, es ist ja auch so schwer genug, aber Phantasten müssen ab und an auch was mampfen, da irre ich mich doch nicht, oder?
Nein, ihre Stimme war nie weich gewesen. Wie hatte sie aber diesen metallischen Klang (oh, er tat dem Hörnerv höllisch weh!) so lange tarnen können? Oder lag es an ihm, war er erst jetzt hörend geworden, hörend und so wund, dass jedes Wahrnehmen schmerzte?
Die metallische Stimme nahm keine Rücksicht auf seine Empfindlichkeit, sie forderte herrisch: Ruhe, ich brauche sie auch, viel mehr als du! Aber damit sei es jetzt aus, sie würden wieder wühlen und wühlen, diese Maulwürfe, keine Sekunde würden sie locker lassen, genau wie damals, Pit, sie werden uns fertig machen! Mona Dudu schlug die Hände vors Gesicht und er, der am liebsten geflohen wäre, irgendwohin, für immer, er streckte tröstend die Hand nach seiner Frau.
Seine Frau.
Da richtete sie sich auf, selbstsicher, nüchtern. Sie werde ihn kontaktieren, es ginge nicht anders, diese Geier müsse er ihnen vom Leibe halten, schließlich sei alles seine Schuld, seine und die seines herzallerliebsten Laufburschen. Ja, ja, Petre Dudu war dazu geboren, Ja zu sagen, aber etwas trieb ihn jetzt an, einen Versuch zu wagen, jenes Bedürfnis nach Ruhe, vielleicht, also: Warum es hier durchstehen, warum nicht einfach wegfahren, Liebes? Wohin denn? Aufs Land. Aufs Land?
In dem schönen, altehrwürdigen Raum gab es alles Mögliche, Wandvertäfelungen, Stuckverzierungen, erlesene Möbel, ein Wespennest aber mit Sicherheit nicht, und doch sprang Mona Dudu so heftig auf, als ob ein ganzer Schwarm hinter ihr her gewesen wäre: Nein, ausgeschlossen, ganz und gar, aufs Land – keine zehn Pferde bringen mich dahin. Aber warum nicht? Will nicht, es hängt mir zum Hals raus, dein Land, immer dieses Land, habe es satt. Aber warum denn, warum, es ist so friedlich dort!, bettelte er in einem fort. Eben, zu friedlich, es erdrückt mich, geht das in deinem Kopf, schlag mir was anderes vor, Amerika, Australien, Neuseeland, von mir aus, aber nicht dein gottverdammtes Land, ich werde es verkaufen! Was?
Das Landhaus war seine Zuflucht, sein Stolz, das ganze Dorf beneidete ihn, den armen Jungen des wilden Trunkenbolds, um jenes kleine Schmuckstück, das er mit Monas Geld in einem Waldhain hatte bauen lassen. Verschlungene Wege, auf denen sich gewöhnlich niemand verirrte, führten dorthin. Mona Dudu hielt es dort nie lange aus, die Stille gelle ihr so in den Ohren, sagte sie. Umso dankbarer war er, dass sie ihn es dennoch hatte bauen lassen. Das kannst du mir nicht antun, Mona, sagte er leise.
Sie sah ihn an, hart, als gefiele ihr das, was sie da sah, ganz und gar nicht, doch gleich darauf schweifte ihr Blick ab – durch ihn hindurch, in eine imaginäre Ferne und aus dem halboffenen, unbeweglichen Mund brach es heiser hervor: dass der Schuft zurückgekommen sei – um uns zu zerstören, und dass es ihm gelingen werde, jawohl, es werde ihm gelingen. Aber wie denn, Liebes, er ist jetzt tot, tot. Mona Dudu schien ihn nicht zu hören: Zurückgekommen, um uns zu zerstören, der Schuft, der Schuft!
3
In der Tat war es Horatiu Ploaie gelungen, ein mehr als stattliches Medienimperium aufzubauen. Der anfängliche Misserfolg, als die Zeitung mit dem großen, alten Namen, die er geschluckt hatte, ihm beinahe im Halse stecken blieb, war längst vergessen. Ploaie war jetzt der dünkelhafte Besitzer mehrerer Blätter, die er genüsslich verdaute, und einiger Fernsehsender, die zu den beliebtesten im Lande gehörten. Selbstverständlich wurde – mit neidischer Bewunderung, wenn es sich um seine Anhänger, jedoch mit bewunderndem Neid, wenn es sich um seine Feinde handelte – seine Weitsicht bestaunt, die ihn, wie keinen anderen, veranlasst hatte, gerade in diesem Bereich zu investieren. Beeinflusste er nun die Öffentlichkeit nicht nach Lust und Laune, ganz so wie seine Interessen es erforderten? Das war nur allzu klar und dennoch nur halb wahr.
Denn das, was Ploaie antrieb, war nicht reine Überlegung, sondern vielmehr Sucht: zu sammeln, und zwar VIPs. Schriftsteller, Journalisten, im Zweifelsfalle auch Philosophen, wenn sie nur wirklich berühmt waren – alle Größen des Kulturlebens, alle, die etwas zu sagen hatten, die crème de la crème der Elite, sie sollte ihm gehören! Diesen da – in voller Größe und auf einen Sockel gehoben, von jenem – den Torso, von dem anderen – einen Arm, eine Hand oder zumindest einen Finger: Wie in einem Museum wollte er sie betrachten, wie in einem Harem über sie verfügen!
Viele standen so, mehr oder weniger versteckt, auf seiner Gehaltsliste. Hätte ein von allen guten Geistern Verlassener beabsichtigt, gegen Ploaie vorzugehen, seine Machenschaften zu enthüllen, Aufklärungskampagnen gegen ihn anzustrengen, er hätte mit Grauen festgestellt, dass nirgendwo ein offenes Ohr, nirgendwo eine helfende Hand sich aufgetan hätte. Sein Versuch wäre aussichtslos gewesen – was letztendlich jenem Naivling nur zum Wohle gereicht hätte, denn nichts ist peinlicher, als der unbezähmbare Drang, dort aufzuklären, wo keine Aufklärung erwünscht ist. Zur allgemeinen Zufriedenheit waren aber solche von allen guten Geistern Verlassene kaum in Erscheinung getreten.
Und es begab sich, dass sie im Herbst einen Storch auf einem Mast sitzen sah. Da plagten sie den ganzen Winter über unerträgliche Schmerzen in den Beinen. Im nächsten Jahr sah sie aber den Storch über das Haus fliegen. Und siehe da, ihre Schmerzen verschwanden.
Es war nicht einfach gewesen, bis zum Kommissar vorzudringen. Maria Nancovici hatte am Eingang den Presseausweis, den sie immer noch bei sich trug, vorgezeigt. Normalerweise war er ein verlässlicher Türöffner, jetzt bewirkte er das Gegenteil: Keiner von euch setzt den Fuß hier rein, fuhr sie der Wachtposten an. Er hatte eine richtige Verbrechervisage, unmöglich, an ihm vorbeizukommen. Also schwenkte sie um: Ich bin in eigener Sache hier. Ob sie ihn denn für oberblöd halte. Nein, entgegnete sie, es sei die Wahrheit, sie hätte eine Aussage zu machen, eine sehr wichtige. Dann stell dich gefälligst an!
Der Warteraum war eng: ein fensterloser Gang, der in einem kleinen, rechteckigen Vorraum mit vier Stühlen mündete. Die Stühle waren besetzt, ringsherum wogte ein ganzer Menschenpulk, Männer und Frauen unterschiedlichsten Alters, blass und gramerfüllt. Die Luft war schlecht, der Gereiztheitspegel hoch: Geschlagene zwei Stunden und morgen bestimmt die ganze Prozedur von vorn! Bin schon zum dritten Mal hier und es ist immer noch nicht fertig! Ja, ja, es hat sich nichts geändert, gar nichts, aber was will man machen, sie sitzen am längeren Hebel! Man ist ja schon froh, wenn sie einen nicht anschreien!
Finster starrte man vor sich hin.
Meine Lieben, das alles passiert nur, weil wir blöd sind, unverzeihlich blöd, wie heißt es so schön in unserer Staatshymne: Erwache, erwache, das heißt – wir schlafen noch! Wie auf Kommando drehte sich alles zu dem jungen Mann mit dunklen Mandelaugen und pechschwarzem Haar, der so gesprochen hatte. Tadelnde, missmutige, ja sogar hasserfüllte Blicke: So ein Frechling, pfui!
Doch im betretenen Schweigen, das diesen Worten gefolgt war, erklang plötzlich ein kristallenes, befreiendes Lachen. Helle Reiterhose, flache Stiefel, bunte Halsketten – die Dame, die so kristallen gelacht, wirkte jugendlich, obwohl sie bestimmt schon Mitte 40 war. Die missmutigen Blicke nahmen sie sofort ins Visier. Unangebracht fand man ihr Lachen, demonstrativ, eigentlich schon beleidigend, ein Auslachen war das, was maßte sie sich an, und überhaupt – sie wirkte seltsam, fremdartig, etwas störte, aber ja doch, gewiss, man konnte es fast greifen, das Fluidum sorgloser Gelassenheit, das die im Ausland Lebende verriet! Was zum Kuckuck hatte sie hier zu suchen, was wollte sie, Feldforschung betreiben? Sind wir etwa Menschenaffen in der Wildnis?
Der Mandeläugige lächelte ihr dankbar zu. Er sei in Deutschland gewesen, erklärte er, drei Monate, gut hätte es ihm da gefallen. Was hat Ihnen denn so gut gefallen? Ringsherum wechselte man bedeutungsvolle Blicke: Sie siezt ihn, ist das möglich, sie siezt ihn! Die Autobahnen, die Sauberkeit, die Ruhe. Die Dame nickte zufrieden. Gib ihm eine Eins für seine Antwort! Und was haben Sie dort gemacht? Ich war Kellner. Kellner, freilich, oder Autodieb oder Gigolo, sieh zu, vielleicht nimmt sie dich mit, wenn sie dich kauft, hast du ausgesorgt! Und jetzt, fuhr der Mandeläugige fort, fahre er wieder dahin, eine neue Stelle, für die er ein Führungszeugnis brauche, deshalb stehe er hier an, wie ein Idiot stehe er an: Wir sind ja keine Bürger, wir sind Untertanen!
Die Dame nickte wieder, der Mandeläugige wollte fortfahren, doch da ging, mit einem kräftigen Stoß, die Tür auf und Maria Nancovici, die danebenstand, wurde unfein an die Wand gedrückt. Zum Kuckuck und Donnerwetter, kannst du nicht aufpassen?, schrie sie wütend.
Die mächtige Frauengestalt in langen, bunten Röcken würdigte sie keines Blickes. Gemächlich aber unbeirrt bahnte sie sich den Weg dem Gang entlang. Es wurde laut: Nicht vordrängen, was fällt dir ein, können euresgleichen nicht Schlange stehen? Keine Bange, Bürschchen, will nur was fragen. Das wollen wir alle, also, linksrum, da hinten stellst du dich an. Die Mächtige warf ihre langen Zöpfe zur Seite: Brauch 'n Formular. Auch da hinten. Hilfst mir, es auszufüllen? Nein. Ach, komm, hab dich nicht so.
Aber das Bürschchen kehrte ihr den Rücken zu.
Eine junge Frau mit hübschem Lausbubengesicht kramte einen Stift aus ihrer Tasche: Komm her, ich mache das schon. Danke, Kleines, kann gar nicht schreiben. Spaßvogel! Ehrenwort, bei meinen Toten, kann wirklich nicht. Und wieso nicht? Die Mächtige zuckte mit den Achseln: Als ich jung war, vor 30 Jahren …! Gab es keine Schulen vor 30 Jahren? Die gehen doch nicht in die Schule, tönte es von irgendwoher, die heiraten ganz früh. Freilich heiraten wir früh, erwiderte die Mächtige, wie sollen wir sonst viele Kinder in die Welt setzen? Wie viele Kinder hast du denn?, erkundigte sich die Lausbübin. Neun. Auch Töchter? Auch. Und gehen die zur Schule? Das Bürschchen schnaubte: Bestimmt, im Ausland, zur Fortbildung ihrer langen Finger, eine schöne Goldkette trägst du da am Hals. Ein leichtes Zucken fuhr über der Mächtigen Gesicht: Sag mal, Bürschchen, hast gestern Nachrichten geschaut, ja, und – was haben sie gesagt, wer hat gerade von dort, von Europa, Millionen geklaut, einer von uns oder einer von euch? Die Lausbübin brach in schallendes Gelächter aus: Bravo, das nennt man den Spieß umdrehen! Ihr seid nicht besser, wirklich nicht. Rau war der Mächtigen Stimme.
Das Bürschchen lief rot an, doch er konnte nichts mehr erwidern, weil die Tür, vor der alle standen, aufgerissen wurde und eine bleiche 20-Jährige aus der Amtsstube trat. Geschafft, geschafft, murmelte sie nach allen Seiten. Hinter ihr geriet ein glatzköpfiger Jeansträger an einen dicklichen Yuppie: Ich bin jetzt dran! Von wegen, Sie sind viel später gekommen! Spinnst du, ich bin schon seit heute Morgen hier! Schon waren die Fäuste geballt, die Köpfe hochrot, die Augen am Rollen.
Die Mächtige versuchte die Gunst der Stunde zu nutzen und, an ihnen vorbei, in die Amtsstube zu schleichen. Dabei stieß sie fast mit der schmächtigen Beamtin zusammen, die unvermittelt in den rechteckigen Vorraum trat und ein schrilles Ruhe, Ruhe verdammt noch mal oder es ist Schluss für heute hinausschrie. Fast zeitgleich erschien am anderen Ende des Gangs der Wachtmeister: Ich schmeiß euch alle raus, wenn ihr nicht still seid! Diese Doppelattacke imponierte den Streithähnen, sie ließen sofort voneinander los. Da sprang wie eine Wildkatze die Dame auf: Miserabel, schrie sie, miserabel sei alles hier organisiert, die Leute so lange warten zu lassen und dann zusammenzuschimpfen, sei das inzwischen nicht ein demokratisches Land, was erlaube man sich? Von einem der vier Stühle erhob eine silbergraue Sechzigjährige den Blick aus ihren Kreuzworträtseln: Bitte, bitte, können wir denn nicht friedlich miteinander umgehen?
Ich konnte nicht mehr!
Kurzentschlossen nahm Maria Nancovici den Wachtposten beiseite und erklärte ihm, dass ihre Aussage von solcher Wichtigkeit sei, dass die Skandalzeitungen sie bestimmt fürstlich entlohnen würden, wenn sie sich doch entschlösse, sie darüber zu informieren: Ich werde jetzt sofort vorgelassen oder ich gehe, haben Sie mich verstanden? Unter diesen Umständen befand es der Wachtmeister für angebracht, seinen Vorgesetzten zu Rate zu ziehen. Dieser gebot, dass man die Aufmüpfige zu ihm brächte.
Und so saß sie nun vor diesem Kommissar, der ihr, anstatt sie zu begrüßen, lediglich mit einer kurzen Kopfbewegung einen Stuhl zugewiesen hatte. Der Stuhl wackelte, sie aber hielt sich aufrecht, sie war ja dort, dort, wo sie unbedingt hatte sein wollen. Erstaunlicherweise konnte sie jedoch kein Wort hervorbringen. Die sorgfältig zurechtgelegte Aussage – sie war wie weggepustet.
Hübsches Gesichtchen, blonder Lockenkopf – der Kommissar lächelte in sich hinein, mitleidig und zufrieden: was für ein leichtes Opfer. Fast alle, die sich in diesem Raum vor ihm setzten, pflegte hoffnungslose Verwirrung zu befallen. Zu Recht, denn die natürlichste Rechtfertigung konnte hier ganz anders, als Ausdünstung schlechten Gewissens, Hinweis nicht eingestandener Schuld, willkommener Beweis für die Anklage gewertet werden. Wie viele hatten sich hier nicht schon verplappert! Und er, er brauchte gar nicht viel zu tun, nur so dazusitzen und unheilvoll vor sich hinzublicken, eine kurze Frage stellen, ein bisschen anstacheln. So auch jetzt. Sie habe unbedingt eine Aussage machen wollen, also, worauf warte sie noch: Sprechen Sie endlich, Fräulein Nancovici!
Ich griff nach diesen Worten wie nach einem Rettungsanker: Ich habe ihn gesprochen. Wen? Voinea. Wann? Kurz vor seinem Tod; er hat gesagt, dass er zurückgekehrt ist und dass er auspacken will.
Konnte er hoffen? Durfte er es? Die Vision eines großartigen Erfolges erhob sich für einen Augenblick vor seinen Augen und der Kommissar schwelgte im Gefühl herrlichster Genugtuung. Vielleicht war dieser verdammte Fall doch noch zu lösen! Aber nein. Nein! Mehr denn je war jetzt höchste Skepsis geboten. Sonst verbrennst du dir die Finger, Alterchen! So ein Fall kann einen – nur zu Fall bringen.
Verbissen drückte er die Zigarette aus: Spät kommen Sie zu uns, mein Fräulein, sehr spät. Seien Sie froh, dass ich überhaupt komme, Ihre Behörde genießt nicht den besten Ruf, das wissen Sie, oder? Diese Bemerkung war keine vorbereitete und die Tatsache, dass sie ihr mit einem Mal, so wunderbar herausfordernd, entschlüpfte, löste die Starre, der Maria Nancovici anheimgefallen war. Nur mit Mühe unterdrückte sie ein leichtes Auflachen: Der Kontrast zwischen der sehr roten, fleischigen Nase des Kommissars und seinen dünnen, blassen Lippen kam ihr urkomisch vor. Auch nur ein Mensch, ein kleiner, aufgeblasener, unzufriedener Mensch.
Ein leichtes Zittern vibrierte noch in ihrer Stimme und für einen Augenblick befürchtete sie, der rote Faden könne ihr entgleiten, aber sie hielt nicht inne, sondern sprach weiter, immer weiter, von jenem Dienstagvormittag, als ihr Handy geklingelt und eine etwas süßliche, sehr eindringliche Männerstimme ihr einen wunderschönen Tag gewünscht und sie gefragt hatte, ob sie wüsste, mit wem sie spräche. Sie verneinte und da erinnerte der Unbekannte sie an den Rat, den sie ihm wohl vor Jahren gegeben und der darin bestanden, offenzulegen, was sich zugetragen hatte, damit er nicht als Alleinschuldiger ende. Nun, erinnern Sie sich?
War das zu glauben? Ja, ich erinnerte mich, obwohl es lange her war, zur Zeit des großen Finanzskandals, jeden Tag gab es neue Schlagzeilen und ich, ich wollte auch daran teilhaben, die Theaterrezensionen, Buchbesprechungen, Lesungen, sie hingen mir zum Halse raus, tagein, tagaus nur dieses Kurzlebige, so Absehbare, Beziehungen, Grüppchen, Clans, diesen lobt man in den Himmel und jenen verreißt man, weil dieser zu uns gehört und jener eben nicht, mein Gehirn streikte, ich dachte, ein Interview mit ihm, dem Star der Stunde, könnte mir helfen groß herauszukommen. Aber daraus wurde nichts und meinen Rat, einen sehr naiven, über den er, der nunmehr Wiedererkannte, damals herzlich gelacht hatte, wollte er freilich nicht befolgen. Wenn er irgendwann seine Memoiren schreibe, werde er auf mich zurückkommen, hatte er noch gesagt. Kurz darauf war er untergetaucht.
Sie hätten damals auf mich hören sollen, sagte Maria Nancovici an jenem Dienstagmorgen. Für manche Dinge sei es zu spät, für andere nicht, erwiderte George Voinea. Dann verriet er, dass er einiges vorhabe, auf ihren Beistand zähle und sich bald wieder melden würde.
Und tatsächlich erschien ein paar Tage später wieder die gleiche Nummer auf dem Display ihres Handys, als sie aber abnahm, meldete sich niemand. Das fand sie seltsam. Im Nachhinein verstand sie, dass zum Zeitpunkt dieses zweiten Anrufs Voinea schon tot war. Sein Mörder hatte also angerufen. Um Voineas Verbindungen zu überprüfen.
Das hatte ich zu sagen.
Maria Nancovici war vollkommen ruhig. Deshalb verwirrte sie die Frage des Kommissars, ob sie denn mit Voinea eine Beziehung gehabt hätte, zu seiner Verwunderung, denn er hielt sehr viel von seinen Überraschungsangriffen, überhaupt nicht. Was für ein abstruser Gedanke! Der Kommissar war aber anderer Meinung. Kein anderer hätte Voinea gesehen oder gesprochen, also dürfe man annehmen, dass zwischen ihnen beiden etwas ganz Besonderes ablief. Man dürfe auch annehmen, dass die anderen logen, entgegnete sie. Aber Sie kannten ihn schon besser? Wie man Leute so kennt, hätte sie antworten können, flüchtig, zwischen Tür und Angel, Hallo, wie geht’s?, und nicht weiter hinhören, die eigenen Träume, Pläne, Gelüste im Sinn, dass keiner dazwischenfunke und ihren Gang störe, deshalb nicken, lächeln, weitergehen. Ja, sie war ihm mehrmals begegnet, damals, als sie noch für Unsere Zeit schrieb. Ploaie wollte gerade die Zeitung übernehmen und Voinea sondierte für ihn das Terrain.
Aber ich schwieg.
Der Kommissar trommelte ungeduldig auf dem Schreibtisch: Also, Sie kannten ihn besser?
An der Tür wurde kurz geklopft und eine junge, blasse Frau trat donnerwetternd ein, weil, Chef, unten ein Typ lauthals einen Bericht über irgendeinen Unfall verlange, er wisse aber weder, wann der Unfall stattgefunden habe, noch, wer daran beteiligt, noch, was sonst passiert sei, gar nichts: Aber er beruft sich auf Sie, Chef, was soll das, was behelligt er mich? Sie schien entnervt. Das muss der Unfall von… Das schrille Klingeln des Telefons unterbrach den Kommissar. Er hob den Hörer und gab sein gewohntes Ja von sich. Doch dann sprang er auf: Meine Verehrung, natürlich, erledigt, Verehrtester, kein Problem, ist schon unterwegs, aber ja, nur keine Umstände, auf Wiedersehen und meine besten Wünsche! Sein Oberkörper skizzierte während des Sprechens kleine, rhythmische Verbeugungen. Als er auflegte, hörten sie schlagartig auf. Wie eine Medusa fixierte er nun die junge Beamtin: Was bist du für eine blöde Kuh, das ist der Unfall an der Tankstelle, Naes Unfall, los, zieh Leine, jener darf keinen Augenblick länger warten!
Erschöpft ließ er sich in seinen Sessel fallen.
Da begegnete ihm Maria Nancovicis staunend-spöttischer Blick. Und er wurde wütend. Richtig wütend. Ob Voinea ihr denn ausdrücklich gesagt habe, dass er auspacken wolle. Mit dieser Frage gelang sein Überraschungsangriff doch noch. Nein, antwortete Maria Nancovici zögernd, nicht wörtlich, aber was sollte man sonst aus Voineas Worten schließen? Na ja, vielleicht – dass er Sie anmachen wollte oder – dass Sie wieder einen Ressortwechsel versuchen und das alles erfunden haben? Erfunden, ja, sind Sie noch bei Trost?
Maria Nancovici war jetzt ganz rot und der Kommissar – hocherfreut, wie der Wissenschaftler über sein Versuchskaninchen, das genau so reagiert, wie er es wünscht. Den Anruf könne man zurückverfolgen, rief sie. Oh, den Anruf werde man zurückverfolgen, keine Sorge, ganz bestimmt: Doch jetzt, mein Fräulein, möchte ich von Ihnen die ganze Wahrheit hören, was haben Sie gegen Ploaie, denn das ist so, nicht wahr, ihn verdächtigen Sie?
Ich fühlte, wie meine Finger krampfhaft die Armlehne umklammerten. Wieso stellte er diese Fragen? Was wollte er? Mich aushorchen? Und Ploaie dann Bericht erstatten?
Stehen Sie auch auf seiner Gehaltsliste? Dunkler als die Nacht wurde nun die Stirn des Kommissars und seine Stimme – nichts als ein Zischen: Fräulein, sehen Sie sich vor, solche Behauptungen können Sie teuer zu stehen kommen. Aber Maria Nancovici hatte ihren Stuhl schon beiseitegestoßen und nach ihrer Tasche gegriffen. Nichts hätte sie behauptet, rief sie, lediglich gefragt, und das Fragen sei jetzt nicht mehr verboten, und einschüchtern könne einer wie er sie auch nicht mehr: Und überhaupt können Sie mich mal! Mit einem lauten Knall fiel die Tür ins Schloss. Wir sehen uns noch – vielleicht, murmelte der Kommissar. Er war froh, sie losgeworden zu sein.
4
Eine entartete Mutter, so hat sie mich genannt; oh, was für eine furchtbare Szene und das vor jenem Trampeltier, das Tag und Nacht bei ihr herumlungert; sie ist völlig ausgeflippt, hat sogar einen Zaun gestreift, so wütend war sie; ich wäre am liebsten ausgestiegen, aber sie wollte nicht anhalten – Elena Craciunescu keuchte. Es ging ihr gar nicht gut. Sie war so schwach, dass sie sich auf dem Sofa, wo sie zusammengesunken war, kaum aufrichten konnte: Sie sagt, ich hätte sie nie geliebt und dass ich sie verraten hätte, sie kann es nicht ertragen, dass ich dich sehe, Alexandru, erzähl ihr nichts mehr davon, hörst du, sie wird meine Medikamente nicht mehr bezahlen! Dann werde ich sie bezahlen, erwiderte er.
Alexandru Voinea hatte Elena Craciunescus Hand ergriffen. Sie tat ihm leid. Er wusste, dass sie krank war, sterbenskrank. Auf Anweisung ihrer Tochter hatte man ihr bis vor kurzem das wahre Ausmaß ihrer Erkrankung verheimlicht.
Mona hatte nämlich erklärt, ihre Mutter könne die grausame Wahrheit nicht ertragen und dürfe daher nichts erfahren. Und alle, Angehörige, Freunde, Ärzte – sie hatten diese ach so fürsorgliche Vorgehensweise gebilligt, weil es die übliche war. Jeder hätte an ihrer Stelle genauso gehandelt. Der Kranke muss geschont werden! Und – alle Beteiligten mit ihm, ist es doch viel leichter heile Welt zu spielen, als sich mit den Todesängsten eines Sterbenden, der weiß, dass er stirbt, auseinanderzusetzen. Womöglich will er dann dies und jenes noch selbst entscheiden, verkompliziert also das Ganze, das zerrt an den Nerven und schafft nur Chaos. Viel besser, er weiß von nichts.
Mona entschied mit größter Selbstverständlichkeit über das Schicksal ihrer Mutter. Sie setzte die Krebsbehandlung ab. Wozu einen aussichtslosen Kampf kämpfen, wozu die Kranke unnötig quälen? Das schien tiefempfunden und wohlüberlegt. Die Kranke spürte aber, wie es um sie stand, und letztendlich erfuhr sie die Wahrheit doch. Die Eigenmächtigkeit ihrer Tochter erschütterte sie zutiefst, da jene ihr aber eine Pflegerin bezahlte und auch für die Schmerzmittel aufkam, behielt sie ihre Verzweiflung für sich.
Mit Alexandru Voinea hatte sich Elena Craciunescu auf Anhieb gut verstanden. Sie hatten sich auf Monas und Georges Hochzeit kennengelernt und ihre Freundschaft hatte fortgedauert, der späteren Entzweiung der beiden Brüder zum Trotz. Wenn Alexandru in die alte Heimat zurückkehrte, was nicht oft geschah, weil jede Rückkehr Wunden aufriss, besuchte er auch Elena Craciunescu. Ihre kleine Wohnung befand sich in einer jener unansehnlichen Siedlungen am Rande der Stadt, im fünften Stock eines heruntergekommenen, grauen Wohnblocks. Im kahlen Treppenhaus vermischten sich stets beißende Küchengerüche mit dem Gestank der Katzen, die irgendwo unter der Treppe hausten. Wenn der Fahrstuhl nicht funktionierte, und das war meistens der Fall, mussten die Stockwerke zu Fuß erklommen werden.
Trotzdem hielt sich Alexandru gerne bei Elena Craciunescu auf. Sie empfing ihn immer mit allerlei Leckerbissen, erzählte Familiengeschichten, manchmal sang sie, mit tiefer, rauer Stimme, die Romanzen ihrer Jugendzeit. Bei ihr fand er die Geborgenheit seiner Kindertage wieder, denn die Freude, in der ihr Gesicht erstrahlte, wenn sie die Tür öffnete und ihn vor sich stehen sah, erinnerte ihn an die Seinen. Er war sehr jung gewesen, als er sich verliebte und seiner Herzallerliebsten in den Westen folgen wollte. Auszuwandern war schwierig, gefährlich, doch die Seinen unterstützten ihn. Sie ahnten, dass das Leben hier (ein Daseinfristen war das, ein Dahinvegetieren!) ihn zugrunde richten würde. Und sie wollten nur sein Bestes. Sein Fortgang brach ihnen aber das Herz.
Auch Alexandru litt unter der Trennung, doch er war eben jung, ein neues Leben lag vor ihm, das lenkte ab. Freilich dachte er oft an sie, mehr noch, er spürte sie neben sich, da, wie geisterhafte Wesen, die ihre schützende Hand über ihn hielten. Allein, wenn Briefe eintrafen oder wenn er mit ihnen telefonierte, was damals verdammt schwierig war, weil man Stunden auf eine Verbindung warten musste, wurde ihm bewusst, dass seit seiner Abreise ihr Leben irgendwie hängen geblieben war, dass sie sich furchtbar nach ihn sehnten, sich sorgten, alterten und dass er nicht bei ihnen war, um ihnen beizustehen. Und ihm war, als könne er ihnen nie genug sagen, wie sehr er sie liebte, wie sehr er sie vermisste.
Nach ein paar Jahren ging seine Ehe in die Brüche, die Herzallerliebste war nicht wirklich herzallerliebst. Dann setzte das große Sterben ein, die Seinen verschwanden, einer nach dem anderen – alle, bis auf George, mit dem er zwar nicht mehr sprach, über den er aber durch diesen und jenen dennoch einiges erfuhr.
Tomi sei am Boden zerstört, erzählte Elena Craciunescu weiter, nach all den Jahren der Scham – nun dieses Unglück. Und Mona, anstatt dem Kleinen zu helfen, gebärdete sich furchtbar: Weiß Gott, sie ist meine Tochter, aber ich muss sagen, sie ist wie von Sinnen, hüte dich vor ihr, Alexandru, hüte dich vor ihr! Angsterfüllt umklammerte sie seinen Arm. Machen Sie sich keine Sorgen, ich passe schon auf mich auf, versuchte er sie zu beruhigen. Seine Stimme klang gefasst. Doch er sah so bekümmert aus, ein kleiner Junge, für den die Welt zusammengebrochen war. Quäl dich nicht mein Lieber, sagte sie, hörst du, das alles war vielleicht abzusehen, aber nicht zu verhindern, glaub mir, jeder ist, wie er ist, unabänderlich.
Mit einer unbestimmten Bewegung deutete sie auf ein Bild, das neben ihr auf dem Nachttisch stand: sie als stolze, maßlos stolze junge Mutter und Mona, dieses heißersehnte Kind. Ihr Glück. Das Beste, was sie im Leben zustande gebracht! Wie war sie froh gewesen, es geboren zu haben und nun in den Armen zu halten.
Jahrein, jahraus hatte sie dann alles, aber auch wirklich alles versucht, um dieses Wesen glücklich zu machen. Sein Wohlergehen war ihr einziges Ziel. Aber das Wesen war unersättlich, nichts schien ihm auszureichen. Nie war es zufrieden. Warum? Warum nur? Hatte sie Mona vielleicht überfordert, so dass diese gar nicht mehr merkte, wie sehr sie geliebt wurde? Denn das stimmte schon, sie war streng gewesen, hatte Gehorsam verlangt, gutes Benehmen, gute Zensuren, aber doch nicht über das Maß hinaus und nur, weil sie von Mona so viel hielt. Sie ist intelligent, sie ist begabt, sie kann alles: Das war Elena Craciunescus Credo. Ein falsches? Jetzt hätte sie diese Frage womöglich bejaht.
War das der Grund für die unversöhnliche Ablehnung, die Mona ihr entgegenbrachte? Sie hatte aber nichts verbrochen! Mona war offensichtlich anderer Meinung. Aberwitzig die Vorwürfe, die sie ihr entgegenschleuderte. Und sie glaubte jedes Wort, das sie da von sich gab, ihre Wahrheit – die einzig gültige, ja, zutiefst überzeugt, durchdrungen war sie von ihren Anschuldigungen, kein Schwanken, kein Infragestellen: So ist es! Basta.
Was konnte man da noch sagen, was tun, zumal, wenn man, wie Elena Craciunescu, den anderen verstand, ihm zwar nicht recht gab, ganz und gar nicht, aber doch verstand, man bemühte sich ja um nichts anderes, als ihn zu verstehen, von innen heraus, seinem Inneren, wohlgemerkt! Freilich, wenn man so in den anderen hineinkrabbelte, sich durch ihn hindurchwühlte, kam manches zutage, was mit dem Herzen nicht mehr nachzuvollziehen war. Man verstand, jedoch nur mit der Vernunft und – resignierte: So bist du, unfähig, den Blick von dir abzuwenden, versteinert, hart, so bist du, kannst nichts dafür, bist so gemacht, von mir so gemacht, ich werde daran zugrunde gehen, aber dich nicht verurteilen.
Dass er sie besuche, das solle Alexandru nicht verraten, bat sie wieder: Mein Lieber, Mona ist so eifersüchtig. Alexandru versprach es, doch Elena Craciunescus Erregung steigerte sich mehr und mehr. Hastig, verzweifelt sprach sie davon, dass Mona dem Kleinen nicht mehr zu kommen erlaube, könne man sich so etwas vorstellen, dass ein Enkel seine kranke Großmutter nur heimlich besuche? George hätte sich anders verhalten, trotz allem sei er kein böser Mensch gewesen, nein, wirklich nicht: Er hat sich ja um mich gekümmert, er, nicht Mona, und in jene Sache, ja, da ist er hineingeschlittert, weil er schwach war, um so einer Versuchung zu widerstehen, bedarf es innerer Stärke, die hatte er nicht, und Ploaie war er auch nicht gewachsen …
Ein heftiger Hustenanfall hinderte Elena Craciunescu daran, weiterzusprechen. Alexandru Voinea gab ihr ein Beruhigungsmittel und blieb, bis sie einschlief.
5
Maria Nancovici nahm ein Taxi, um aus dem elenden Vorort, in dem sich das Polizeikommissariat befand, in die Innenstadt zurückzufahren. Aber sie hielt es nicht lange darin aus. Sie brauchte frische Luft. Bewegung. Also ließ sie in der Nähe der Universität den Fahrer anhalten, stieg aus und lief entlang des großen Boulevards, wo sich eine endlose Blechlawine im Schneckentempo vorwärtskämpfte. Die Luft war alles andere als frisch, das Gehupe fürchterlich und auf den engen, zugeparkten Bürgersteigen kam man nur mühsam voran. Sie ging aber schnell, so schnell, dass sie keuchte. Ein paar geziert schnatternde Gören drängten sie im Vorbeigehen gegen eine Mauer. Sie schaute ihnen nach und sah sie trotzdem nicht. Ein Junge näherte sich ihr und versuchte, ihr eine echte Gucci-Uhr zu verkaufen. Sie ignorierte ihn.
Sie beachtete auch die alte Frau nicht, die, in sich versunken und in die Leere stierend, auf einem Treppenabsatz hockte. Hätte sie sie gesehen, wirklich wahrgenommen, so wäre sie wohl stehen geblieben, sie hätte ihr ein Geldstück in die Hand gedrückt und ein paar Worte mit ihr gewechselt. Sie kannte sie ja, sie und ihre Lebensgeschichte, wusste, dass die Tochter seit fünf Jahren in Italien arbeitete und kaum noch etwas von sich hören ließ, nie schickte sie der kranken Mutter Geld, deshalb saß die Alte da, die Leute reichten ihr manchmal zwei, drei Münzen, ein dürftiges Zubrot zu ihrer miserablen Rente.
Maria freute sich jedes Mal, wenn sie sie sah. Die Alte hatte so klare blaue Augen. Fenster zur Vergangenheit öffneten sich in ihnen. Durch sie blickte Maria in jene anderen, die ebenso blau und klar über ihre Kindheit gewacht hatten. Auch gefiel ihr die Dankbarkeit in diesen Augen, eine maßlose, stumme, irgendwie mit Unglauben vermischte Dankbarkeit, die so wohltat, weil sie in ihr ihre eigene Güte auskosten konnte. Dann fühlte sie sich wie trunken und leicht, federleicht, wie auf weichen Schwingen emporgetragen, eine mit sich selbst höchst zufriedene Gottheit auf ihrer rosaroten Wolke! Manchmal war es einfach, Menschen glücklich zu machen.
Doch jetzt war es anders. Sie stolperte sogar ein paar Mal, obwohl sie keine Stöckelschuhe trug. Aber sie gab auf die Schlaglöcher im zerfetzten Bürgersteig nicht mehr Acht. Ab und an blieb sie vor einem Geschäft stehen und tat so, als betrachtete sie die Auslage. In Wirklichkeit versuchte sie nur, sich an dem Buch oder an dem Paar Schuhe, das sie anstarrte, festzuhalten. Wenn sie dann zufällig die suchenden, ja, flehenden Augen ihres Spiegelbildes in den Glasscheiben entdeckte, erschrak sie und rannte weiter. An einer Straßenecke merkte sie, dass sie fror. Sie war mit offenem Mantel, die Mütze in der Hand, durch die Eiseskälte gelaufen. Zwei Schritte weiter blieb sie wieder stehen: Gerade hatte sie ziemlich laut vor sich hingesprochen!
Wie ich es bereute, zur Polizei gegangen zu sein. Was für ein dummer Einfall, was für ein Fehler. Ich hätte mich ohrfeigen können. Das Schaf rennt zum Wolf und verlangt, dass er es beschützt. Wie nennt man das? Blauäugigkeit? Nein: Fahrlässigkeit. Ich war ja nicht ahnungslos, wusste, mit wem ich es zu tun hatte, diese Herrschaften waren keine Freunde und Helfer in der Not, sondern Schurken, die mit Schurken, Ganoven, die mit Ganoven paktierten. Auf Schritt und Tritt – bewusst verschlammte Untersuchungen, souverän getätigte Rechtsbrüche, Korruption. Sie war schon alltäglich geworden, die Käuflichkeit dieses blutsaugenden, nur auf das eigene Wohlergehen bedachten Packs!
Bis zum Erbrechen kannte ich das alles. Ich wusste, dass gegen sie nichts auszurichten war. Wenn man einen angriff, waren gleich zehn zur Stelle, um den Gefährten zu decken, zu trösten, zu rächen. Manchmal gab es spektakuläre Enthüllungen, die nichts bewirkten, weil in diesen Kreisen das Zusammenhalten so fest war wie in einer römischen Legion. Nur wenn aus irgendwelchen obskuren, für Außenstehende nicht nachvollziehbaren Gründen innere Kämpfe ausbrachen und sich Grüppchen gegenseitig bekriegten, rollte hier und da vielleicht ein Kopf. Das war erfreulich und blieb dennoch folgenlos. Jeder wusste das, wirklich jeder, also auch – ich!
Sie stieg die Stufen zu einem stadtbekannten Café, dem Treffpunkt der Schickeria. Geschniegelte Geschäftsleute, selbsternannte Bohemiens, verwöhnte Muttersöhnchen, allesamt inbrünstig prahlerisch und weltmännisch lässig, schlürften hier gelangweilt ihren Espresso und kauten, mehr oder weniger laut schmatzend, ihre bruschettas und crostinis. Die Frauen an ihrer Seite waren durchwegs jung, schlank und sorgfältigst aufgeputzt. Aus halboffenen Augen blickten sie herablassend um sich und registrierten, mit der Verlässlichkeit feinster Präzisionsgeräte, auch den kleinsten Fauxpas im Erscheinungsbild ihrer potentiellen Rivalinnen. Das Tragen eines eben gestern – wer weiß warum?! – aus der Mode gekommenen Accessoires konnte hier ebenso diskreditierend wirken wie in geistig-elitären Kreisen das unbesonnene, weil rufmörderische Eingeständnis seinen Kant nicht in der Cassirer-Ausgabe von, sagen wir, 1902 gelesen zu haben. Fast fünf Jahrzehnte hatten Narzissmus und Gier ein erzwungenes, den Psychen im Hades nicht unähnliches Schlummerdasein führen müssen (wie hoffnungslos kleinbürgerlich, wie sträflich provinziell wirkte im Nachhinein der Lebensstil des großen Conducators, den goldenen Wasserhähnen im Bad zum Trotz!), jetzt waren sie auferstanden und wüteten mit der gleichen Leidenschaft wie in den goldenen Zeiten vor dem Krieg.
Noch vor wenigen Jahren hatte sich das Imponiergehabe in eine durch gute Beziehungen ergattere Whiskyflasche oder eine Levis erschöpft, nun waren dem Haben und Zeigen keine Grenzen gesetzt. Große Autos, große Häuser, teuerste Designerklamotten, Schmuck, exklusive Clubs, exklusive Reisen – besitzen, genießen, konsumieren, alles, sofort, wie machte das Spaß, wie gab das Sinn, wie war das Leben schön! Dass die großen Autos durch kaum befahrbare Straßen fuhren, die großen Häuser von Müllbergen umringt waren, die Designerklamotten an zahllose Trauergestalten vorbeispazieren mussten – das war wirklich alles andere als unbedeutend: Vor dem Hintergrund der Misere sticht der zur Schau gestellte Reichtum noch malerischer ins Auge.
Hol also ruhig der Teufel – die anderen! Man muss sich, Gott sei Dank, nicht mit existentialistischem Ballast herumplagen, um zu wissen, dass das Bestaunt-, ja, besser noch: das Beneidetwerden das wunderbarste Gefühl der Welt ist, unbeschreiblich erfüllend, hinreißend entzückend – die Brust schwillt an, man wird größer und größer, bedeutungsvoll, mächtig, sieh einer an, ist das denn möglich, man hebt ab – ja, wirklich, wie ein bald zerberstender Luftballon!
Wie alle anderen behauptete auch Maria Nancovici, das stadtbekannte Café wegen des hervorragenden Essens zu bevorzugen. Wie alle anderen ging natürlich auch sie aus purer Angeberei dahin.
Es stimmt, ich gebe es zu. Da ich aber nicht zu den VIPs des Augenblicks gehöre und somit, leider!, nicht bestaunt werde, begnüge ich mich damit, meiner voyeuristischen Neugierde zu frönen und – zu beobachten. Den Kopf nach links drehen, dann nach rechts, wahrnehmen: das, was der Augennerv registriert. Es aufnehmen, in sich aufsaugen, sich darin verlieren. Gesprächsfetzen: Ich verteidige nur meine Stellung … Wenn du meinst, du seist der Gescheiteste … Versuch doch offener zu sein, versuch doch zu verstehen! Blicke: anzügliche, strafende, fragende. Lippen, die sich vorwurfsvoll zusammenziehen oder spielerisch spitzen. Hände, die sich verkrampfen, streichen, suchen. Kurzlebiges Lebensspektakel, das gerade durch die Vergänglichkeit seiner Erscheinungsformen rührt. Es kann süchtig machen.
Im Vorbeigehen griff sie nach einer der Zeitungen, die am Eingang auslagen, und setzte sich an einen Fenstertisch. Doch darin lesen konnte sie nicht.
Ich hatte so viel überlegt, so lange gezögert, ganz wie damals, als die Übernahme durch Ploaie bevorstand und ich nicht wusste, ob ich bei der Zeitung bleiben oder gehen sollte. Am Morgen entschied ich dies und am Abend das, die Wahl wurde wirklich zur Qual, denn was immer ich auch entschieden hätte, es wäre falsch gewesen. Das Bleiben hätte mich beschmutzt, das Gehen meine Karriere gefährdet. Ehrgeiz und Gewissen standen sich unversöhnlich gegenüber und ich zappelte, bangend, wie in einer Falle.
Eines schönen Tages wagte ich aber, im Grunde immer noch unentschlossen, das Mutigere und kündigte. Mein Schritt, den ich mit meinem Drang nach unbedingter Unabhängigkeit und Rechtschaffenheit rechtfertigte, wurde nicht besonders gewürdigt. Von nicht nur einer Seite versicherte man mir, dass ich lediglich sture Weltfremdheit bewiesen und in sträflicher Weise gegen mein Interesse gehandelt hätte. Das verunsicherte mich.
Im Nachhinein konnte ich mich freilich beglückwünschen, doch die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ploaies Führungsstil hatte nämlich unheimliche Folgen. Wenn er in der Redaktion erschien, befielen Stotteranfälle den immer so streitlustigen Chefredakteur und meine ehemaligen Kollegen, sonst auch nicht auf den Mund gefallen, wurden regelmäßig von Stummheit heimgesucht.
Untereinander seufzten sie über Ploaies Härte und seinen Sarkasmus, der ihnen das Blut in den Adern gefrieren ließ, sie seufzten und zitterten, weil sie nicht wussten, wie mit ihm umzugehen, und auch nicht erkennen konnten, was er eigentlich wollte. Gegen vernünftige Einwände war er genauso immun wie gegen Schmeichelkünste, sein innerster Beweggrund schien einzig darin zu bestehen, sie alle mürbe zu machen. Das war keine besonders glückliche Rolle, die der Patron ihnen da zugewiesen hatte. Aber was konnten sie schon tun? Brav absolvierten sie ihre Bücklinge und ließen immer öfter kleine, bewundernde Bemerkungen über seine mephistophelische Intelligenz und über sein Genie in Finanzdingen fallen. Nun ja, die Prostration vor einem wirklich höheren Wesen, dem Alphatier, ist bekanntlich alles andere als eine Schande! Man tut es gerne.
Manchmal jedoch befiel den einen oder anderen ein enervierendes Zweifeln, das Quälende, mühsam Verdrängte bebte und wollte ausbrechen, dann fragte man sich, wie es denn möglich sei, einfach so, wie ein Leibeigener, mitsamt der Zeitung gekauft zu werden. Und wo die Meinungsfreiheit, die so hochgeschätzte, die eben frei und ohne Bedenken zu äußernde, bliebe. War das jetzt nicht wieder wie in der alten Zeit, als man, ohne große Umstände, das schrieb, was man nicht dachte? Wahrlich, im Rückenkrümmen war man schon geübt; um etwas besser zu leben, dafür gab es ja nur einen Weg, ihn wies die Partei, was sollte man also tun? Den Helden spielen? Dazu war man nicht geboren. Also beugte man sich und lebte friedlich dahin.
Nun aber hatten sich die Zeiten geändert, warum also auf vorgegebenen Pfaden dahintrotten? War das der Sinn der Umwälzung, der Ertrag der glorreichen Revolution? Ein Tausch der Herren, denen man zu dienen hatte? Nichts haben wir erreicht, wir lecken lediglich an einem anderen Hintern, sagten die Kühnsten. Derlei Betrachtungen waren aber nur Ausgeburten der Nacht und des Weins, wenn der Morgen nahte, pflegten sie mit dem Rausch zu verfliegen.
Ich hatte damals insgeheim gehofft, dass einige meinem Beispiel über kurz oder lang folgen und ebenfalls kündigen würden. Und einige hatten in der Tat mit dem Gedanken gespielt, eine neue, wirklich unabhängige Zeitung zu gründen. Aber Ploaie zahlte gut. Zu gut. So wurde es bald ziemlich leer um mich und das umso mehr, als sich das Gerücht festsetzte, ich sei gar nicht von selbst gegangen, sondern man hätte mir wegen Inkompetenz gekündigt. Das hätte sehr unangenehm werden können, aber zum Glück war ich nicht ganz allein.
BBC? Wunderbar, wenn das klappt …
Maria schreckte auf. Ein paar Tische weiter saß eine hagere Frau in einem blauen, offensichtlich sehr teuren Pelzmantel. Sie rauchte. Neben ihr, und nicht zu übersehen – Cati Saulescu, Journalistin, eine Moralinstanz. Wenn ich dir irgendwie behilflich sein kann, sprach die Frau im blauen Pelzmantel. Cati Saulescu bedankte sich überschwänglich: Oh, allerliebst, aber ich habe schon mit Mischa gesprochen. Mit Mischa, gerade Mischa? Ich weiß, ich weiß ... Er kann sich nicht rausreden, Cati, Pit hat die Akte bei Nikki gesehen, es ist monströs! Ich weiß ... Die Beweise sind erdrückend, Cati, geh ihm jetzt besser aus dem Weg. Du hast recht, meine Liebe, aber wir beide kennen auch meinen Nikki sehr gut, nun ja, also, ich muss, du bleibst noch? Ja, ich warte auf – jemanden. Umarmungen, Küsschen und Cati Saulescu flatterte davon.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752120578
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (November)
- Schlagworte
- Finanzwelt Bukarest Rumänien Liebsroman Krimi Osteuropa Liebesroman Liebe