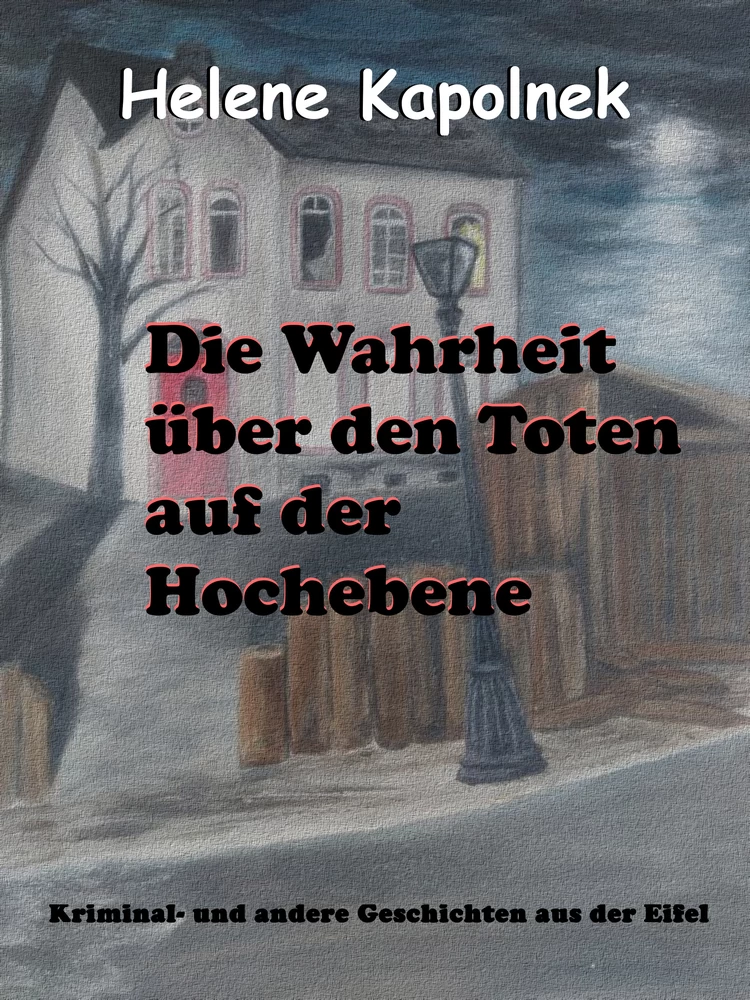Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Die Wahrheit über den Toten auf der Hochebene
Als der Völkerkundler Günther Remscheid sich Mitte der siebziger Jahre daran machte, die Eifel zu erkunden, mietete er ein Haus, um seinem Studienobjekt nahe zu sein. Das Gebäude stand zwischen vom Wind gebeutelten Bäumen auf einer ausgedehnten Hochebene und hielt angemessenen Abstand zu dem einzigen größeren Dorf des Landstrichs.
Es war ein einfaches Haus mit mehreren niedrigen Nebengebäuden, ein Schuppen und eine winzige Hütte aus Backsteinen mit einem Zementdach, über das sich eine Kletterpflanze ausbreitete. Der Gelehrte fand es praktisch, dass er gleich neben dem Haus sein Auto abstellen konnte. Dort ragten mehrere Eisenstangen in einigem Abstand wie stumpfe Speere aus dem Boden. In einem kleinen Anbau neben dem Hintereingang entdeckte er einen alten Bottich und ein völlig zerschundenes Waschbrett. Draußen hatte sicher schon lange niemand mehr Wäsche aufgehängt. Trotzdem wirkte der yachtförmige Citroen dort fehl am Platz.
Das Dorf lag gute hundert Meter entfernt und bestand aus einigen Gehöften, die, obschon derb, mit Misthaufen und grimmigen Hofhunden ausgestattet, von einem gewissen Wohlstand zeugten. An den Rändern der Hauptstraße bewiesen geräumige Neubauten mit üppigen Balkonen und Doppelgaragen, dass den Einwohnern der Wert ihres Baulandes deutlich geworden war. Das Dorf hatte zwei oder drei einfache Lokale, eine Metzgerei, eine Bäckerei und einen kleinen Laden, die den Dorfkern bildeten. Auf einem Platz an einer abzweigenden Straße stand die Kirche. Der sich anschließende Kirchhof führte ans Dorfende. Dahinter breiteten sich viele Kilometer von Wind und Regen gepeitschten Waldes aus. Remscheids Haus lag auf der anderen Seite des Dorfes und von dort führte die Straße nach einigen Hundert Metern steil bergab in das Tal, dessen, als „Mühlen-Sage“ bekannte Volkssage den Professor bewogen hatte, sich für einen begrenzten Zeitraum in der Gegend niederzulassen.
Das Haus des Professors war nicht das einzige, das Abstand zum Dorf hielt. Am anderen Ende standen am Waldrand einige kleine Unterkünfte, die ihm gleich aufgefallen waren, als er die Gegend im Auto erkundete, und die er zunächst für Lagerräume eines Bauern gehalten hatte.
Mit den Einwohnern des Dorfes verstand sich Professor Remscheid recht gut. Da ihm Leutseligkeit nicht gegeben war, stellte er sich bei den Spitzen der Dorfgesellschaft und denjenigen vor, mit denen er nähere Verbindung pflegen würde, und erklärte ihnen ernst und respektvoll den Zweck seines Aufenthaltes. Die Lokalzeitung aus der Kreisstadt brachte einen informativen kleinen Artikel über den Professor und seine Nachforschungen. Der Pfarrer besuchte den Gelehrten nach einer geziemenden Weile in seinem neu eingerichteten Haus und die Leute waren im allgemeinen froh, dass es sich bei dem Universitätsvertreter nicht um einen langhaarigen Hippie, sondern um einen gestandenen Herren im besten Alter handelte, der dem Landleben entsprechende vernünftige Kleidung trug.
Die „Mühlen“-Sage behandelte die verschiedenen Varianten eines Volksglaubens, der sich um die einsam gelegene mittelalterliche Mühle im Steinbachtal rankte, die drei oder vier Kilometer entfernt lag und nur über einen steilen Pfad zu erreichen war. Die Mühle war inzwischen völlig verfallen und galt als einsturzgefährdet. Da der Bau-Boom aber das kleine Tal bisher verschmäht hatte und niemand aus der Umgebung freiwillig den Abriss der „Teufels-Mühle“ gefordert hätte, stand sie, von Menschenhand unangetastet, furchteinflößend mit einem verwitterten Mühlrad am Rand des Baches, der das Rad gelegentlich in unheimliche Bewegung versetzte.
Remscheid hatte die Legende, die es in verschiedenen Varianten auch in anderen Landstrichen gab, schon immer fasziniert. Sie zeigte die Reaktion einer ländlichen Bevölkerung auf die Härte ihres Lebens in einer unwirtlichen, schwer zu bändigenden Landschaft. Die kalten Winter, die Abgeschiedenheit, Missernten und Hunger hatten das Gesicht der Eifel über die Jahrhunderte geprägt. Die Religion war eine zweischneidige Waffe gegen die Angst, denn Gott und seine verführbaren Vertreter auf Erden trösteten nicht nur: Sie kontrollierten, drohten, raubten und erzeugten neue Furcht. Der Müller, der den Teufel herausforderte, verletzte nicht nur den Stolz des Satans, er verletzte auch den Stolz seiner Gegenspieler, die glaubten, ein Privileg auf das Fernhalten des Bösen zu haben. Das Schelmenstück des Müllers wirkte inmitten des finsteren Aberglaubens wie ein Schlaglicht der Aufklärung. Ein selbstbewusster Mensch, der sein Leben in die eigenen Hände nimmt, etwas riskiert und – mit Rücksicht auf die Forderungen der Kirche jener Zeit – seine vermeintlich gerechte Strafe dafür auf sich nimmt, jedoch nicht ohne Augenzwinkern.
Prof. Remscheid liebte es, über die Bedeutung der Sage nachzugrübeln. In einer dieser Stimmungen begab er sich auf eine Wanderung über die Hochebene. Hier oben wirkte die Mühle so fern, als befinde sie sich in einer anderen Welt. Die karge Landschaft schien nirgendwo hin zu führen. Sie verschwor sich mit dem bleiernen Himmel und verwandelte die fernen Wälder in blassblaue Silhouetten. Und doch war die Mühle in ihrem schmalen grünen plätschernden Tal nur wenige Kilometer entfernt. Der Professor dachte über diesen markanten Unterschied nach und ob die Mühlen-Sage auch mit dem extremen Gegensatz der Lebensumstände auf so knappem Raum zusammenhängen mochte. Oben die wütenden Winde, im Tal die versteckten Gestalten. Beide so rätselhaft, sich so ähnlich und doch so unterschiedlich.
In diesem Augenblick tauchten die Hütten oder Baracken am Ortsausgang vor ihm auf. Remscheid fragte sich, wie lange sie dort wohl standen, denn sie entsprachen wenig der traditionellen Bauweise der Region. Es waren keine hutzeligen Bauernhäuschen mit dicken Fachwerkwänden, die klein, dramatisch eng, aber auch anheimelnd wirkten, sondern hastig zusammengezimmerte Buden, in die hin und wieder lieblos ein Fenster eingelassen war. Es mochten Waldarbeiter-Unterkünfte gewesen sein oder sie waren nach dem Krieg aufgestellt worden, um einen Wohnungsmangel zu beheben. Der Professor beschloss, im Dorf danach zu fragen. Die Baracken interessierten ihn, ebenso wie die Tatsache, ob sie bewohnt waren. Es war ihm peinlich, darauf zu starren, denn er besaß ein altmodisches Taktgefühl und es war ihm zuwider, andere zu bedrängen.
Trotzdem fühlte er sich versucht, an eine der hölzernen Türe zu klopfen.
Die Behausungen lagen so still, dass er es schließlich riskierte, näher zu kommen, um einen verstohlenen Blick durch die Fenster zu werfen. Ein schmaler Steg aus rohem Holz führte über einen Graben auf das Grundstück, das durch keinen Zaun und keine Hecke begrenzt wurde, auf dem Unkraut wucherte und das auf der anderen Seite der Baracken in den Wald überging. Ein Pfad führte zum Eingang der ersten Hütte. Der Professor überlegte schnell, welche Ausrede er vorbringen würde, wenn plötzlich die Tür aufgerissen werden sollte. Es fiel ihm nichts ein. Und die Tür blieb geschlossen. Er folgte dem Pfad zur nächsten Tür, neugierig, ob vielleicht irgendwo ein Namensschildchen angebracht war. Aber die Hütten blieben anonym, auch bei der dritten und letzten Tür. Er schaute durch das nächstbeste Fenster und sah einen Raum voller Möbel, so vollgestopft, dass er zunächst wieder an einen Lagerraum denken musste. Dann sah er einen Tisch, der mit wenig und unwirklich aussehendem Geschirr gedeckt war, Teller, Tassen, Brot und Messer. Das wirkte nicht spartanisch, sondern wie Treibgut. Unwillkürlich hielt Remscheid Ausschau nach dem dazu passenden Robinson Crusoe. Schließlich riss er sich los und kehrte auf die Landstraße zurück. Er bemerkte, dass er vom Friedhof her, der ganz in der Nähe der Baracken lag, beobachtet wurde. Leute aus dem Dorf. Er winkte ihnen zu und der Gruß wurde erwidert. Ländliche Neugier, dachte er amüsiert. Aber war das nicht ein Vorurteil?
Er folgte der Landstraße, bis er auf einen Weg stieß, der in das als „Schöfers Bösch“ bekannte Waldgebiet führte. Tatsächlich handelte es sich eher um eine Heide, nachdem im Krieg große Portionen des Baumbestandes für strategische Zwecke gerodet oder in Gefechten und durch Feuer vernichtet worden waren. Jetzt wurde nur noch ein Teil des übrig gebliebenen Waldes bewirtschaftet. Der Rest blieb sich selbst überlassen. Dort hatten seltene Pflanzen, Insekten und Kriechtiere ein Zuhause gefunden. Im Unterholz lebten Rehe und Rotwild. Inzwischen selten gewordene Vögel bauten hier ihre Nester.
Der Professor ging gern dort spazieren und freute sich über jede Entdeckung, eine flinke schillernde Eidechse, eine behäbige Kröte an einem Tümpel, der Schatten eines nicht zu identifizierenden Vogels. Wenn die Sonne schien, so wie an diesem Tag, konnte er alles vergessen und Stunden auf der Wanderschaft verbringen.
Doch dazu kam es nicht.
Er war dem Fußweg vielleicht zwei Kilometer gefolgt und blieb an einer Abzweigung stehen, um zu überlegen, ob er den erheblich unzugänglicheren Pfad einschlagen sollte. Der führte in eine geschlossene Heckenlandschaft, aus der hin und wieder ein kranker Baum herausragte. Der Pfad schlängelte sich dazwischen hindurch und der Professor wusste von Einheimischen, dass er zu einer Stelle führte, an der im Krieg ein verlustreiches Scharmützel stattgefunden hatte. Was genau dort geschehen war, darüber schwiegen sich die Gewährsleute aus. Der Professor hatte in der Fachliteratur nachgeschlagen, konnte die Begebenheit aber nicht eindeutig zuordnen.
In seinem Rucksack hatte Remscheid Trinkwasser, Kaffee in einer Thermoskanne, Butterbrote und eine Landkarte. Es sprach also nichts dagegen, es anzugehen und die Stelle zu suchen.
Er bog auf den Pfad ab und stellte nach etlichen Metern fest, dass er seine Ausrüstung um ein Buschmesser hätte erweitern sollen. Die dornenreichen Hecken neigten dazu, seine Kleidung zu ritzen, und der Weg führte immer weiter in das grüne Labyrinth, aus dem es keinen Ausweg zu geben schien. Gerne hätte er sich auf einen Baumstumpf oder dergleichen gesetzt, um die Karte zu konsultieren, aber das Gestrüpp wirkte wie eine Mauer. Das Gefühl der Eingeschlossenheit wurde übermächtig. Verzagt drehte er die Karte in den Händen herum.
In diesem Augenblick hörte er Stimmen aus der Dickicht-Hölle und die Entscheidung, die Expedition abbrechen, schien jetzt das einzig mögliche. Stolpernd und am Rande der Panik machte er kehrt und nahm kaum wahr, wie sich die gleichen Hecken noch einmal an seiner Kleidung vergriffen. Es war schwierig, den Laufschritt beizubehalten, denn der Boden war uneben und mit Wurzeln bedeckt. Als er stehen blieb, um zurückzuschauen, trug der Wind die Überbleibsel menschlicher Stimmen herüber. Keine Äste, die unter dem Gewicht fremder Menschen barsten, keine Hetzjagd schien stattzufinden. Der Professor holte tief Luft und stolperte weiter über seinen Pfad aus dem Inneren des Hochlandes, dessen Ende sich nun wie ein Portal in die Realität abzeichnete. Er gelangte zu der Abzweigung, an der er sich kurz zuvor zu seinem Abstecher entschlossen hatte.
Eine Welle der Erleichterung überkam ihn, als er wieder auf übersichtlichem Boden stand. Das Tageslicht kam ihm sofort anders vor, als sei es heller, freundlicher oder vertrauter. Und da war auch ein umgestürzter Baumstamm, etliche Meter entfernt, vor einigen struppigen Hecken, die nach der Erfahrung im Dickicht sehr übersichtlich wirkten. Remscheid beschloss, dass er einen Augenblick der Rast benötigte. Also marschierte er zu dem Baumstamm, ließ sich mit einem Ächzen nieder und trank einen Kaffee aus seiner Thermoskanne. Er war nicht mehr furchtsam, denn diesen Teil der Heide kannte er gut, und die Wahrscheinlichkeit war groß, Spaziergänger oder Bauern zu treffen, die den Weg als Abkürzung zu bewirtschafteten Flächen benutzten. Nun fragte er sich, warum ihn die Stimmen im Dickicht so in Furcht versetzt hatten. Als er seine Reaktion analysierte, versuchte er die Worte „böse“ und „unheimlich“ zu vermeiden. Er hörte wieder die beißende Stimme eines überreizten Menschen, der etwas beanstandete oder jemanden zurechtwies. Die andere Stimme war weniger gut zu hören gewesen. Sie hatte heller geklungen, wie ein kurzes erschrecktes Intermezzo. Und sofort hatte die erste Stimme wieder die Initiative ergriffen und mit einem heiseren Flüstern weitergesprochen. Und ja: die Stimme hatte „böse“ und „unheimlich“ geklungen.
Remscheid ermahnte sich, nicht in diesen Kategorien zu denken, weniger aus ideologischen Gründen, sondern weil sie den klaren Blick auf die Realität trübten. Er wollte sich noch eine Tasse Kaffee eingießen und dann über die Episode lächeln, als er sah, dass jemand auf dem Pfad aus dem Dickicht erschien. Der Professor hechtete, die Kaffeekanne noch in der Hand, hinter die Hecken, die seinen umgestürzten Baum einfassten. Er warf Kanne, Rucksack und Karte vor sich auf den Boden und kauerte sich hin, um die Person zu beobachten, die jetzt auf dem Weg Richtung Dorf stand.
Remscheid sah einen großen, kräftigen Mann, der ländlich wirkte, aber doch nicht so ganz wie die Menschen, die er hier kennengelernt hatte. Es fehlte die Arglosigkeit, die ihre Umgebung als etwas Selbstverständliches wahrnimmt. Dieser Mann wirkte wachsam. Er schaute sich um, als wolle er sichergehen, nicht beobachtet zu werden. Der Professor fühlte sich unwohl in seinem Versteck. Was sollte er sagen, wenn der andere ihn aufspürte? Zum Glück bemerkte dieser nichts. Er hielt wohl eher Ausschau nach Bauern und anderen Einheimischen, die nicht sehen sollten, aus welcher Richtung er gekommen war. Mit Professoren, die hinter Hecken lauerten, rechnete er nicht.
Sobald er den Mann aus den Augen verlor, als dieser im Waldstück, das an die Landstraße grenzte, verschwand, kam Remscheid aus seinem Versteck hervor, setzte sich wieder auf den Baumstamm und verbrachte dort noch eine unbehagliche Viertelstunde, um dem Fremden einen Vorsprung zu geben. Das Lächeln über die Episode war ihm vergangen. Er fragte sich, warum der Mann sich so ungewöhnlich verhalten hatte. Mit wem hatte er sich im Dickicht mit so wütender Stimme unterhalten? Warum die Heimlichkeit? Remscheid lag nichts daran, sich in die Angelegenheiten der Leute einzumischen. Er wollte auch den Ablauf des Dorflebens nicht durcheinanderbringen. Doch der Vorfall schien ihm zu bizarr, um ignoriert zu werden.
Langsam und etwas missgestimmt machte er sich auf den Weg zurück ins Dorf. Als er das Waldstück verließ und auf der Landstraße an den Baracken vorbei ging, fiel ihm eine Bewegung an dem Fenster auf, durch das er auf dem Hinweg gespäht hatte. Unwillkürlich sah er hin und bemerkte mit Schrecken den Fremden aus dem Wald, der an dem nun geöffneten Fenster stand und ihn unverwandt ansah. Geistesgegenwärtig grüßte der Professor würdig und bekam ein kurzes unfreundliches Kopfnicken zur Antwort, das jeden Versuch, ein Gespräch zu beginnen, von vorneherein zum Scheitern verurteilte.
Gereizt ging der Professor weiter und statt zu seinem Haus zurückzukehren, spazierte er bis zur Dorfmitte und betrat den Gasthof, der neben der Kirche stand. Dieser war groß wie ein Anwesen. Die Gaststätte befand sich im Haupthaus. Aber durch einen Torbogen neben dem Haus gelangte man in einen geräumigen Innenhof, der kundgab, dass das Wirtshaus nicht die einzige Erwerbsquelle der Inhaber war, sondern dass diese auch Landwirtschaft betrieben. Im Sommer wurde ein Teil des Innenhofes als Biergarten für Ausflügler aus der Stadt genutzt. Heute, an einem Arbeitstag, war alles still. Als Remscheid die Gaststätte betrat, befanden sich dort nur der Hausherr und zwei alte Männer, die stumm an einem der Tische saßen.
Als sie den Professor erkannten, grüßten alle, der Wirt fast überschwänglich, die beiden alten Herren mit größter mürrischer Würde. Sie kannten den Akademiker aus der Stadt und waren leicht geschmeichelt, noch mehr jedoch misstrauisch gegenüber dem auswärtigen Besucher. Remscheid kannte das. Anders als bei dem unheimlichen Mann in der Baracke ärgerte es ihn nicht. Er wandte sich direkt an den Gastwirt, bestellte auf Nachfrage einen Kaffee und eine kräftige Suppe und kam dann zu seinem wirklichen Anliegen.
Als er nach den Baracken an Dorfende fragte, wurde das Schweigen der beiden Alten noch deutlicher. Wie zwei bissige Spitze, die sich ärgerten, nicht kneifen zu dürfen, sahen sie aneinander vorbei und zogen die Köpfe ein. Der Gastwirt war erwartungsgemäß mitteilsamer. Nach dem Krieg waren diese Hütten gebaut worden, um Leute unterzubringen, die in der Region Arbeit suchten oder die aus einem anderen Grund keine Unterkunft mehr hatten.
Ob derzeit dort Menschen lebten, wollte der Professor wissen. Das konnte der Wirt nicht abstreiten. Es lebten dort hin und wieder Leute. Es gebe aber wenig Kontakt mit dem Dorf.
Ob das Forstarbeiter seien, fragte der Professor.
„Das sind Asoziale“, sagte der Gastwirt hintergründig.
„Asozial?“
„Die werden vom Sozialamt dort untergebracht.“
In diesem Augenblick mischten sie die beiden alten Männer ein.
„Die gehören abgerissen, diese Buden“, sagte der eine.
Der Professor musste sich ein wenig anstrengen, um die Eifeler Mundart der Region zu verstehen.
„Die kommen ins Dorf und treiben sich hier herum,“ sagte der andere.
„Wie viele sind das denn?“ fragte der Professor aus Neugier und weil ihm nie aufgefallen war, dass sich Leute im Dorf herumgetrieben hatten.
„Es sind ja nicht immer dieselben,“ lenkte der Wirt ein. „Die Leute bleiben eine Weile und ziehen dann wieder aus, vielleicht wenn sie Arbeit finden. Und es gab ein paar Vorfälle im Dorf, ja, aber das ist lange her. Nur für die Leute im Dorf sind die Baracken eine Belastung. Wir sind eine enge Gemeinschaft. Leute, die sich ausschließen, machen sich in einem Dorf nicht beliebt.“
Der Professor verzichtete auf Belehrungen. Ebenso wenig wie Fremde, die sich ausschlossen, waren in kleinen Dörfern Wichtigtuer beliebt, die den Leuten erklären wollten, wie sie jenen Fremden zu begegnen hatten.
Er überlegte, wie er die Sprache auf den Mann bringen konnte, der jetzt gerade in den Baracken lebte. Vorsichtig erkundigte er sich, ob im Augenblick Leute dort untergebracht seien.
Er hatte das Gefühl, dass sich die drei Dorfbewohner vielsagende Blicke zuwarfen und erhielt die Gegenfrage, ob ihm etwas aufgefallen sei. Schließlich sah er nicht ein, was das Versteckspiel sollte und berichtete, dass ihm ein Mann im Wald aufgefallen war, der dort nicht hinzugehören schien, und den er auf dem Rückweg in den Baracken gesehen habe.
Das machte mehr Eindruck als erwartet. Der Wirt und die alten Bauern wollten wissen, wo genau er den Fremden gesehen hatte, und als er den Pfad ins Dickicht erwähnte, gerieten sie für ihre Verhältnisse in helle Aufregung.
„Am Endershof,“ sagte einer der alten Männer und die anderen nickte mit besorgten Mienen.
Der Professor fragte, was es mit dem „Endershof“ auf sich habe.
Daraufhin setzte einer der alten Männer zu einer längeren Rede an, gelegentlich unterbrochen von dem anderen und den beschwichtigenden Anmerkungen des Gastwirts. Der Professor fand es erneut schwierig, den Dialekt der alten Leute zu verstehen, und ging zu guter Letzt mit folgender Darstellung aus dem Gespräch hervor: Der „Endershof“ war ein Ort, an dem nichts Gutes vor sich ging. Schon in der Vergangenheit war es ein verrufener, gar verhexter Platz, den die anständigen Menschen mieden. Vor vielen Jahren hatte sich dort ein Bauer angesiedelt, der Schafe gezüchtet hatte. Seine Hunde waren bösartig gewesen und Leute fürchteten sich in die Nähe zu gehen. Der Bauer Enders machte Geschäfte mit finsteren Gesellen. Das ging eine ganze Zeitlang so. Dann kam der Krieg und das Anwesen des Bauern wurde zerstört und die Überreste vom Dickicht überwachsen.
Der Professor war begeistert über eine so schöne Geschichte. Er verzehrte Suppe und Brot, trank seinen Kaffee und bedankte sich bei allen. Dann kehrte er zurück in sein Haus und setzte sich an den alten Holztisch im Wohnzimmer, den er als Schreibtisch benutzte, um sich Notizen über diese eindrucksvolle Überlieferung zu machen. Der Tisch stand am Fenster, mit Blick über die karge Landschaft der Hochebene. Weit entfernt waren dichte Wälder zu sehen, die teils zu einem Ausflugsziel mit Seen, Booten und Imbissbuden, teils zu einem militärischen Sperrgebiet gehörten. Dem Professor schien es, als verstärke dieser malerische Rahmen noch die Abgeschiedenheit der Region. Mittlerweile hatte Remscheid eine umfangreiche Sammlung von Notizen angelegt. Er schrieb alles auf: die Art und Weise, wie die Milch und die Post geliefert wurde, die Kleidung und die Redewendungen, die die Leute benutzen, wie die alten Häuser gebaut waren ebenso wie die neuen, die die alten ersetzten, die Feiertage und Gebräuche, denkwürdige Begegnungen und bedeutungsvolle Orte. Und nun hatte er seinen ersten „Ort, den man besser meiden sollte“ gefunden, und seine Neugier wurde noch angestachelt durch die merkwürdigen Begleitumstände seiner Entdeckung.
Er setze sich in einen gemütlichen alten Ohrensessel, den er aus seiner Wohnung in Köln mitgebracht hatte, und dachte an die Leute im Dorf und ihren strengen Glauben an das Übernatürliche, das das Schicksal des Endershofes beherrschte. Er überlegte, dass der „Fremde“, der sich in der einfachen und isolierten Unterkunft für „Asoziale“ aufhielt, eine signifikante Ähnlichkeit mit dem Müllerburschen aus der „Mühlen“-Sage aufwies. Eine Konstante in allen Varianten der alten Volkssage war die Ablehnung, die dem jungen Fremden entgegenschlug, als er sich erbietet, die verhexte Mühle zu übernehmen, die kein Einheimischer auch nur betreten wollte. Nun waren die Aktivitäten des jungen Müllerburschen in der „Teufels-Mühle“ alles andere als heilig. Auch wenn er dem Bösen letzten Endes ein Schnippchen schlug, führte der Fremde die wohlanständige Landbevölkerung rücksichtslos an der Nase herum, indem er ihr das verfluchte Mehl des Satans verkaufte. Im Grunde entwertete er die Anstrengungen der Bauern, die das Getreide angebaut und geerntet hatte, ebenso wie das Vertrauen derjenigen, die in ihren Backstuben ahnungslos sein Teufelsbrot zubereiteten. Der Professor lächelte, als er sich überlegte, dass die Vorurteile der Leute gegen den Fremden in dieser Sage in jeder Beziehung bestätigt wurden.
Warum war der Müllerbursche dem Rezipienten der Volkssage dennoch sympathisch? Die Sage stellte den jungen Mann als kühn und außerordentlich dar - ein Teufelskerl eben. Die Rücksichtslosigkeit gegenüber den Mitmenschen wurde weniger kritisiert als die Dreistigkeit Gott gegenüber, die darin bestand, sich überhaupt mit dem Gegenspieler des Allmächtigen einzulassen. Dafür wurde er am Ende bestraft. Teufelsmehl und Teufelsbrot waren nur Nebensächlichkeiten. Vielleicht hatten die Leute auch nichts anderes verdient, nachdem sie dem Müllerburschen so schroff ablehnten?
Nun hatte der Fremde in den Baracken wenig Ähnlichkeit mit dem Abbild des dreisten jungen Teufelskerls. Er war nicht mehr jung, sondern im mittleren Alter, er wirkte ungepflegt und wenig ansprechend – und er war real.
Dennoch ließ den Professor die Idee nicht los, ausgerechnet diesen Fremden und die Gerüchte um den verfluchten Endershof in seiner Untersuchung über die „Mühlen“-Sage in Form eines Exkurses abzuhandeln. Er verfügte nun über zwei Orte, die verfallene Teufelsmühle und den zerstörten Endershof, in fast unmittelbarer Nähe, das heißt, wie unter dem Mikroskop des Sozialwissenschaftlers. Jene Leute, die den Fremden in der Baracke als „asozial“ bezeichneten, hatten ihre Wurzeln in der Umgebend, die viele Jahrhunderte zuvor die „Mühlen“-Sage hervorgebracht hatte.
Der Professor stellte sich vor, wie er in seinem Buch auf die Tatsache einging, wie sich die Ansichten der Menschen änderten – oder eben nicht.
Er beschrieb im Geiste die Teufelsmühle in ihrem jetzigen Zustand. Und er beschrieb den Endershof. Dafür musste er ihn aber erst kennenlernen. Der Gedanke, auf den zugewachsenen Pfad zurückzukehren und die Erinnerung an die zornige Stimme, die aus dem Dickicht drang, ließen ihn zögern. Zunächst sollte er sich die alte Teufelsmühle noch einmal anschauen. Und Näheres über den unbeliebten Fremden aus der Baracke herausbekommen.
Am nächsten Tag machte sich der Professor auf den Weg zur alten Mühle. Es war schönes Wetter und der Weg, der stets bergab ging, fiel ihm leicht. Im Gegensatz zur Hochebene stand an den Hängen, die ins Tal führten, ein herkömmlicher Wald, Tannen und Kiefern mit ranken Stämmen, mit Nadeln bedeckter überschaubarer Untergrund, dazwischen Laubbäume, durch die Sonnenstrahlen fielen und eine friedliche, beschauliche Stimmung schafften. Im Tal plätscherte der Bach fröhlich und die Ruine der alten Mühle trug bei diesem Wetter trotz der alten Geschichten ihren Teil zur Idylle bei.
Der Professor machte Fotos von der Mühle, dem Mühlenbach, der verfallenen Brücke, die über den Bach zur Ruine führte, und von der umgebenden Landschaft. Ein gut befestigter Wanderweg führte entlang des Baches in den Wald. Der Professor folgte ihm einige Schritte und kehrte dann zur Mühle zurück. Er hob die Kamera, um den Eingang zur Mühle aus dieser Perspektive zu fotografieren, und drückte den Auslöser in dem Moment, als er eine Bewegung auf der Brücke wahrnahm. Als er die Hand mit der Kamera sinken ließ, sah er den Fremden, der zu ihm herübersah. Er wirkte alles andere als freundlich.
Der Professor brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, dass er den Mann vermutlich auf seinem letzten Foto festgehalten hatte. Er näherte sich dem Fremden, um sich dafür zu entschuldigen, ihn freundlich zu fragen, ob es ihm etwas ausmache, und ihm einen Abzug von dem Foto anzubieten.
Als er sich jedoch der Brücke näherte, sah er den Mann sich brüsk abwenden und entschlossen dem Wanderpfad in die entgegengesetzte Richtung folgen. Remscheid blieb ratlos stehen. Er wollte dem Mann hinterherrufen, auf sich aufmerksam machen, entschied aber, dass dies keinen Sinn hatte. Der Fremde hatte ihn durchaus bemerkt und er vermied bewusst den Kontakt zu ihm.
Der Professor war verstimmt. Ein so abweisendes Verhalten war er nicht gewöhnt. Andererseits war es den Ärger nicht wert. Er tat besser daran, den Fremden als Forschungsobjekt und auf diese Weise als Herausforderung anzusehen. Er folgte ihm in sicherer Entfernung den Weg zurück zur Hochebene.
Während der Mann mit gesenktem Kopf ins Dorf stapfte, bog der Professor in sein Haus ab, spulte die Filmrolle in seiner Kamera zurück und versteckte sie im Geheimfach eines Sekretärs, den er auf einer Auktion erstanden hatte, auf der Suche nach passenden Möbeln für seine Wohnstätte in der Eifel. Das verspielte Geheimfach hatte ihn amüsiert, allerdings hatte er nie ernsthaft daran gedacht, es zu benutzen.
Nachdem er die Filmrolle so in Sicherheit gebracht hatte, machte er sich auf den Weg ins Dorf, um Erkundigungen über den Fremden einzuziehen.
Diesmal tat er dies nicht im Gasthaus des Ortes, sondern er suchte den Ortsvorsteher auf, den er bereits bei seinem Einzug in das Dorf kennen gelernt hatte. Josef Laurens, im Hauptberuf Bäcker und Konditor, leitete in der vierten Generation einen großen Familienbetrieb, den er kürzlich um einige Filialen in anderen Ortschaften erweitert hatte. Als der Professor ihn an seinem Hauptsitz, der alten geräumigen Bäckerei in der Nähe der Kirche, aufsuchte, saß er im Hinterzimmer und bereitete die Bestellungen für den nächsten Tag vor.
Der Professor schätzte Laurens und dies bestand auf Gegenseitigkeit. Laurens setzte sich für sein Dorf ein. Stets aufgeschlossen für neue Initiativen, setzte sich jedoch nie über die Einstellungen seiner bodenständigen Bevölkerung hinweg.
Als er Remscheids Anliegen hörte, fragte er aufmerksam: „Hat der Mann Ihnen Ärger gemacht?“ Der Professor verneinte dies. Aber als der Ortsvorsteher sich besorgt zeigte und dem Wissenschaftler wiederholt versicherte, dass ein solches Verhalten im Dorf keinesfalls toleriert würde, gestand er ein, dass das Auftreten des Mannes ihn ein wenig verunsicherte.
Laurens erklärte, der Mann sei auch ihm aufgefallen. Er hielt sich von allen fern, was allerdings nicht erstaunlich sei, da die Dorfbevölkerung den Bewohnern der Baracken im allgemeinen die kalte Schulter zeige. „Soziale Außenseiter,“ sagte Laurens. „Man wünschte sich in einer modernen Demokratie ein anderes Aufeinander-Zugehen. Aber die Leute hier haben viele Vorurteile.“ Der Professor nickte verständnisvoll. In einer bäuerlichen Gesellschaft gab es nicht unbedingt Voreingenommenheiten gegen Arme. Aber: Arm und ortsfremd – das musste für Abneigung sorgen, da diese Notleidenden ihren Platz in der Gesellschaft nicht kannten und als gefährlich angesehen wurden.
Da es zu dem Fremden offenbar wenig zu sagen gab, erkundigte sich Remscheid nach dem Endershof. Laurens anerkannte mit einem Lächeln, dass ihm bewusst war, dass der Professor sich für die unheimlichen Orte der Umgebung interessierte. Der Endershof sei schon lange verfallen, erklärte er. Schon sein Großvater habe ihm Geschichten über das verrufene Gehöft erzählt. Geister und Unholde lebten in den Gemäuern, als diese noch standen. Im Krieg war das Anwesen zerstört worden. Gleichwohl standen noch die Ruinen dort. Als Junge war Laurens einige Male mit Klassenkameraden dort gewesen. Sie hatten in den Überresten des Hofes nach Beweisen für die geisterhaften Vorkommnisse gesucht, die dem Hof nachgesagt wurden, und hatten sich gegenseitig mit dämonischen Geräuschen und angeblichen Fundstücken aus der Geisterwelt erschreckt.
„Aber sie haben nichts gefunden?“ fragte Remscheid.
Laurens zögerte, und als er schließlich verneinte, hatte der Professor den Eindruck, dass der andere ihm etwas verschwieg.
„Der Endershof ist nur eine Ruine,“ sagte Laurens. „Er ist noch nicht einmal unheimlich, wenn man nicht gerade ein Vierzehnjähriger ist, der Abenteuer sucht. Schauen Sie es sich selber an! Es ist völlig ungefährlich.“
Der Professor nahm ihn beim Wort und machte sich noch am selben Tag auf, den Endershof zu erkunden. Obwohl er den Eindruck hatte, dass Laurens ihn nicht ganz ins Vertrauen zog, glaubte er dem Mann, dass es dort ungefährlich war. Ehrlich gesagt, ermutigte ihn vor allem diese Zusicherung, sich die Ruinen mit eigenen Augen anzusehen. Ein wenig grämlich gestand er sich ein, dass die Begegnung mit dem Fremden, der im Dickicht herumspukte, ihn verunsichert hatte. Dass ein Ortskundiger, noch dazu eine Respektsperson, sich so wenig beeindruckt von dem unheimlichen Gehöft zeigte, weckte seinen Optimismus, und er war gespannt, ob er selbst eine geheimnisvolle Atmosphäre an dem Ort wahrnehmen würde.
Diesmal musste sich Remscheid nicht der Herausforderung des Dickichts stellen. Laurens hatte ihm einen Weg beschrieben, der zwar einen kleinen Umweg darstellte, den Professor aber ohne Hindernisse ans Ziel führen würde. Er ging an den Baracken vorbei, in denen sich kein Lebenszeichen wahrnehmen ließ, und folgte eine ganze Weile der Hauptstraße. Kurz vor dem Ende des Waldgebiets bog eine kleine asphaltierte Straße ab, die in eins der anderen Dörfer der Hochebene führte. Nach einigen Minuten stieß er auf das Wegekreuz, das Laurens ihm genannt hatte. Es war ein einfaches Kreuz ohne Widmung, relativ groß, solide befestigt, vor dem heute ein welker Blumenstrauß lag. Ab hier ging es auf einem unauffälligen Waldweg weiter, der ein wenig feucht und holprig, aber gut erhalten war. Nach einer Weile vollführte der Weg eine absonderliche Biegung und wenig später endete der Wald und der Professor stand am Rande einer brachen Landschaft, in deren Mittelpunkt die Ruinen des Endershofes standen.
Remscheid blieb eine Weile am Waldrand stehen, um die Aussicht auf sich wirken zu lassen. Er hatte gedacht, das vom zerstörten Endershof wenig übriggeblieben war, aber die Grundmauern des Haupthauses standen, und eine der Wände schien fast vollständig intakt. Er sah ein Fenster, dort, wo früher ein Dachgeschoß gewesen sein mochte. Dicht neben dem zerstörten Haus stand ein einzelner kahler Baum. Aus dieser Perspektive wirkte der verlorene Hof unendlich trostlos. Remscheid blickte in Richtung des Dorfes und war bestürzt über den Anblick, der sich ihm aus dem neuen Blickwinkel bot. Von jener Seite des Waldes schien sich das Buschwerk den Ruinen zu nähern. Als sei das Dickicht aus dem Waldstück herausgeströmt und stehe kurz davor, sich den Endershof einzuverleiben. Der Professor schloss die Augen und schüttelte sich, wie um das unheimliche Bild gerade zu rücken. Als er wieder hinschaute, sah er einen von dichtem Gebüsch umgebenen Weg, der nicht mehr instandgehalten wurde, weil der Hof verfallen war und es keinen Grund mehr dazu gab, auf kürzestem Weg einen freien Zugang zwischen Endershof und Dorf aufrechtzuerhalten.
Solchermaßen rational gestärkt, machte sich der Professor auf den Weg zu den Ruinen. Er musste über einen schmalen, kaum noch wahrnehmbaren Feldweg stapfen, der mit struppigem Gras bewachsen war. Kaum Wildblumen gab es hier am Feldrain zu sehen, und Remscheid fragte sich, warum der Boden nicht bewirtschaftet wurde. Er schien nicht weniger unfruchtbar als der Rest der Hochebene. Vielleicht gab es da Erbschaftsangelegenheiten, überlegte er sich. Was wohl aus den Nachkommen des verrufenen Schafzüchters geworden war?
Schließlich stand er vor den Ruinen des Hofes. Die übriggebliebenen Mauern waren mit struppigen Sträuchern bewachsen, die denen im Dickicht glichen. Hof und Dickicht standen sich von dieser Stelle aus nur wenige Dutzend Meter gegenüber. Mit den Augen folgte der Professor der Schotterstraße, die von den Ruinen in das Gestrüpp führte. Die Pflanzen säumten den Weg wie Hecken, und rückten immer dichter zusammen, bis sie sich schließlich über der Straße wie eine Höhle schlossen. In dieser Höhle glaubte der Professor nun eine Bewegung wahrzunehmen. Eine dunkle Bewegung, die er nicht zuordnen konnte, und sogleich sagte er sich, dass ihm seine Fantasie einen Streich gespielt hatte.
Remscheid fand die Ruinen nur mäßig interessant. Er kletterte in das zerstörte Haus und stellte fest, dass er keinen Beklemmungen empfand, die eine Beziehung zur Geisterwelt nahelegen konnten. Das Haus war leer. Auch waren keine Überreste von Einrichtungsgegenständen zu sehen. Vielleicht war es nach der Zerstörung im Krieg ausgeräumt worden, um dringend benötigte Baumaterialien und Brennholz zu beschaffen. Obwohl er sich auf das Haus konzentrieren wollte, wanderten Remscheids Gedanken zu der Straße, auf der sich der Eingang in das dichte Buschwerk auftat. Ob er wenigstens einmal einen Blick darauf werfen sollte und sei es auch nur, um ein Foto zu machen, das in seinem Buch die Umgebung des Endershofes dokumentierte? Neugier und Gewissenhaftigkeit trieben ihn an. Doch er verspürte auch eine gewisse Furcht, die ihn zurückhielt.
Er wollte nicht noch eine Begegnung mit dem Fremden aus der Baracke riskieren, sagte er sich. Ein finsterer Bursche. Doch würde er es wagen, den Professor direkt anzugehen? Schließlich hatte auch dieser Fremde einiges zu verlieren. Er spürte immerhin jetzt schon die Feindseligkeit der Dorfbewohner. Wenn er Streit mit dem allgemein geschätzten Professor anfing, würde die Lage nicht besser werden. Er spürte, dass diese Überlegung nicht ganz ausgereift war und versuchte, auf weiteres Nachgrübeln zu verzichten. Plötzlich entschlossen suchte er sich einen dicken Ast als Spazierstock und Waffe und machte sich auf den Weg zum Eingang der Höhle.
Das Gefühl, das sich in der Ruine des Endershofes nicht einstellen wollte, war auf dem Weg in das Dickicht überwältigend. Der Professor empfand kalte Schauer, als er sich dem grün überwucherten Eingang in eine lebendige Höhle aus Sträuchern und Bäumen näherte. Ein Durchgang, natürlich entstanden oder von Hand angelegt, führte in das Dickicht. Remscheid machte das Foto, wie er es sich vorgenommen hatte, und mit dem Gefühl, eine andere Welt zu betreten, wagte er sich auf den überwucherten Pfad und folgte ihm einige Schritte. An beiden Seiten drängte sich das Buschwerk und er fragte sich, wie weit es wohl zum Ausgang auf der anderen Seite war. Es konnte sich nicht um eine große Entfernung handeln. Vielleicht sollte er es wagen, um diesem Unbehagen, das ihn erfüllte, etwas entgegenzusetzen. Er war kein Feigling und hatte dies an entlegenen Orten der Welt, an die ihn sein Beruf geführt hatte, bewiesen. Dass er ausgerechnet in einem Dorf in der Eifel ein Opfer der Angst wurde, stimmte ihn verdrießlich. Er wusste auch, dass es einen Unterschied zwischen Mut und Leichtfertigkeit gab. Diese letztere erkannte er nicht bei sich selbst. Es war eine Abwägung von Risiken: Dass in dem undurchdringlichen Dickicht etwas Gefährliches lauerte, sei es von Geister- oder doch eher von Menschenhand, oder dass seine Angst ihn lähmte und Aberglauben und Kleinmut Besitz von ihm ergriff. Entschlossen packte er die ersten biegsamen Zweige, die er vor sich sah, und folgte dem kaum wahrnehmbaren Weg weiter in den Dschungel. Wenn er den Kopf gesenkt hielt und Ausschau nach dem Pfad hielt, kam er recht gut voran. Einen Blick auf die Wildnis, die ihn umgab, durfte er nicht werfen. Die haarigen Zweige, die grünen Schatten, das dornige Laub verursachten ihm Schwindel. Äste stellten sich ihm in den Weg, Unterholz drohte, ihn zu Fall zu bringen. Der Professor stolperte über einen verrotteten Stamm, der am Boden lag, und konnte sich nur mit Mühe auf den Beinen halten. Als er wieder im Gleichgewicht war, bemerkte er eine kleine Lichtung, die sich im Waldstück auftat. Er trat näher und überlegte, ob er hier einen Augenblick zu Atem kommen sollte. Die Lichtung war sonnenbeschienen, auf dem Boden wuchs spärliches Gras, Farn und wilde Kräuter. Sie wirkte einladend bis auf einen Erdhaufen, der am äußeren Rand lag. Der Professor näherte sich vorsichtig und glaubte, seinen Augen nicht zu trauen. War das ein Grab?
Es handelte sich um einen Hügel Erde, auf dem trotz des Frühjahrs kaum Pflanzen wuchsen. Die Erde war aufgehäuft und am Kopfende, wenn man davon ausging, dass es sich um ein Grab handelte, lagen zwei trockene Äste wie zu einem Kreuz übereinander gelegt. Unwillkürlich suchte der Professor nach einem Gedenktäfelchen, wie man es auf Wegekreuzen fand, und sofort wurde ihm klar, dass dies nur seiner eigenen Beruhigung dienen sollte. Dieser Erdhügel hatte keinen Platz in einer einheimischen Überlieferung. Er erinnerte sich an seine erste Begegnung mit dem Fremden, als er dessen wütende Stimme im Dickicht gehört hatte. Den Professor ergriff Panik. Er spürte, wie er in Schweiß ausbrach und trocknete sich die Stirn. Zu einem weiteren klaren Blick auf das vermeintliche Grab fühlte er sich nicht in der Lage. Aber er machte ein Foto, wobei er sich immer wieder ängstlich umsah.
Da er nicht wusste, wie lange der Weg ins Dorf durch den Wald dauern würde, kehrte er zur Ruine des Endershofes zurück, wobei er sich wieder an den dornigen Zweigen der Hecken zerkratzte und sich einen hässlichen Riss im Gesicht zuzog.
So schnell er konnte, ließ er das Dickicht hinter sich. Er blieb erst stehen, als er die Ruine erreichte, und das auch nur, um kurz zurückzuschauen. Doch niemand folgte ihm. Fast erschreckte es ihn nicht, noch einmal eine leichte Bewegung in dem Eingang zur waldigen Höhle wahrzunehmen. Ihm war, als schicke ihm die Wildnis ein höhnisches Grinsen hinterher. Er packte seinen behelfsmäßigen Spazierstock fester und kehrte auf dem Weg ins Dorf zurück, auf dem er gekommen war.
Als er in sein Haus zurückgekehrt war, hatte sich der Professor etwas beruhigt. Er hatte versucht, auf dem Rückweg mit dem Ortsvorsteher Laurens zu sprechen, doch dieser war unterwegs und sollte erst am späten Abend zurückkommen.
In seinem Lehnstuhl überlegte Remscheid, dass er möglicherweise überreagiert hatte. Dann dachte er wieder an den unheimlichen Fremden, und er war überzeugt, dass dieser in welcher Weise auch immer mit dem Grabhügel in Verbindung stand.
Weil er nicht untätig bleiben wollte, setzte er sich ans Telefon und sprach mit dem Sozialamt der Kreisstadt. So verbindlich und überzeugend wie möglich, erkundigte sich Remscheid nach den derzeitigen Bewohnern der Baracken. Vor allem ein Mann mittleren Alters interessiere ihn, den er gerne für sein Buch interviewen wollte. Ohne die recht lahme Ausrede in Frage zu stellen, klärte ihn der Beamte darüber auf, dass zur Zeit kein Mann in den Baracken gemeldet sei.
Verwirrt bedankte sich Remscheid und wollte sich schon verabschieden, als der Beamte sagte: „Aber eine Frau ist dort angemeldet. Vielleicht ist der Herr ein Bekannter von ihr.“
Er sagte das so anzüglich, dass Remscheid sich nur rasch den Namen der Frau notierte, sich bedankte und auflegte. Eine Frau hatte er in den Baracken nicht bemerkt, und er hatte nach Mitbewohnern Ausschau gehalten: einer Frau, Kindern. Niemanden hatte er bemerkt, nur den Fremden, der sich im Dickicht am Endershof herumtrieb und dort eine nicht bekannte Person in der Nähe des Grabhügels wütend angeherrscht hatte.
Professor Remscheid versteckte auch die Filmrolle mit dem Foto des Grabes im Geheimfach seines Sekretärs und nahm sich vor, die Rollen so bald wie möglich entwickeln zu lassen.
Dann setzte er sich wieder in seinen Lehnstuhl, um die Situation zu überdenken. Dies fiel ihm nicht so leicht wie sonst. Die Angelegenheit berührte ihn persönlich. Er fühlte sich gedemütigt. Wie um alles in der Welt war er dazu gekommen, den unerwünschten Fremden mit dem übermütigen Teufelskerl aus der „Mühlen“-Sage zu vergleichen? Er schenkte sich - was er sonst selten tat - ein Glas Cognac ein und nippte daran, während er seinen düsteren Gedanken nachhing. Eine Verkettung von Umständen hatte ihn mit dem Fremden aus den Baracken zusammengeführt. Das war nicht seine Schuld. Den Mann in seinen Vorstellungen aber zum Exempel für die Vorurteile der tumben Dorfbewohner zu machen und eine wirre Parallele zur der alten vergessenen Sage zu konstruieren, das war seine eigene grenzenlose Dummheit.
Dann dachte er an die Frau, die verschwunden war, und die seiner festen Ansicht nach in dem Grab im Waldstück beim Endershof begraben lag. Er erinnerte sich, welche Abneigung der Mann gleich bei der ersten Begegnung bei ihm hervorgerufen hatte. Als er begann, sich die Gesichtszüge der bedauernswerten Frau auszumalen, klingelte es an seiner Haustür.
Schwerfällig erhob er sich, um zur Tür zu gehen.
Als er sie öffnete, sah er das Gesicht, das er am meisten fürchtete.
Er wollte seinem Impuls folgen und die Tür gleich wieder zuschlagen, aber der Fremde war schneller.
Er trat einen Schritt vor, weshalb der Professor zurückwich, und sich der Möglichkeit beraubte, den Fremden auszusperren.
Der Mann war wütend und das machte ihn nicht anziehender. Remscheid schaute ihn angewidert an und glaubte, dass man ihm seine eigene Furcht ansah.
Er hörte sich stumm die Anschuldigungen an, die ihm der Mann entgegenschleuderte.
„Das Dorf verlassen! Was bildest du dir ein? Was glaubst du, wer du bist?“
Um die Wahrheit zu sagen, verstand Remscheid nicht alles, was der Mann ihm sagte. Er sprach einen ausgeprägten Dialekt, den der Professor nicht zuordnen konnte, und es fiel ihm schwer, sich auf den Inhalt der Worte zu konzentrieren. Er fürchtete, dass die drohenden Fäuste des Mannes zum Einsatz kämen und überlegte fieberhaft, ob er es riskieren konnte, die Tür freizugeben und zum Telefon zu laufen, um die Polizei anzurufen.
Aber dann bremste der Mann schlagartig seinen Redefluss, starrte den Professor an und murmelte einige beleidigende Worte. Schließlich drehte er sich um und wankte davon. Erst in diesem Augenblick wurde es Remscheid klar, dass der Mann betrunken war.
Er beobachtete, wie der Fremde die Straße zum Dorf entlang ging, und als er sicher war, dass er nicht wieder umkehrte, knallte der Professor die Haustür zu und verschloss sie.
Dann rief er noch einmal bei Laurens an und erfuhr, dass der Konditormeister immer noch unterwegs war. Remscheid hinterließ die Nachricht, dass es sehr dringend sei und dass er sich um seine Sicherheit Sorgen machte.
Die Dame am Telefon wirkte wenig beeindruckt, versprach aber, dass ihr Ehemann sich melden würde, sobald er wieder im Dorf sei.
Remscheid warf noch einen Blick aus dem Fenster und wagte es, das Haus zu verlassen und sich in den Nebengebäuden umzusehen. Auf dem Grundstück fand sich kein Störenfried.
Er prüfte alle Schlösser, schaute auch, ob sein Auto verschlossen war, und kehrte etwas zuversichtlicher ins Haus zurück.
Er ließ die Jalousien in allen Zimmern außer dem Wohnzimmer herunter und verschloss die Haustür und die Hintertür sorgfältig. Dann kehrte er in seinen Lehnstuhl zurück und überlegte, ob er nicht doch die Polizei alarmieren sollte.
Er entschied sich dagegen, weil er davon ausging, dass Laurens in allernächster Zeit zurückkommen würde. Wahrscheinlich war es ihm nicht recht, wenn der Professor ihn bei Entscheidungen überging, die das Dorf betrafen.
Offensichtlich hatte man den Fremden gebeten, den Ort zu verlassen. Soviel hatte er dem Kauderwelsch des Mannes entnehmen können. Das konnte nur auf Laurens zurückgehen. Niemand sonst würde solche Entscheidungen im Dorf zu treffen wagen. Bevor er den Mann anzeigte, sollte er erst einmal mit dem Ortsvorsteher sprechen.
Das Grab auf der Lichtung beim Endershof kam ihm in Erinnerung. Er stellte sich vor, wie er der Polizei seinen Verdacht mitteilte, ein wütender Außenseiter, der ihn beleidigt hatte, habe außerdem eine ermordete Frau auf einer Lichtung im Wald vergraben. Die Unwahrscheinlichkeit der Situation war kaum zu überbieten.
Es war weitaus besser, auf Laurens zu warten.
Plötzlich fühlte sich der Professor sehr müde und spürte seine Jahre.
Er genehmigte sich noch ein Glas Cognac und lehnte sich zurück, um sich eine Weile auszuruhen.
Als er aufwachte, war es bereits dunkel.
Zunächst wusste er nicht, wo er war. Er hatte einen faden Geschmack im Mund und fand sich in einer unbequemen Stellung wieder. Verwirrt starrte er ins dunkle Wohnzimmer, in das durch die beiden kleinen Fenster ein schwacher Lichtschein fiel.
Dann erinnerte er sich wieder an sein Erlebnis und rappelte sich auf.
Ein seltsamer Luftzug fiel ihm auf, als sei eine Tür geöffnet worden, und er erinnerte sich genau, dass er alle Türen gewissenhaft verschlossen hatte.
Noch bevor er den Mann wahrnahm, der hinter ihm stand, war der Professor hellwach. Sein Verstand arbeitete auf Hochtouren. Er erinnerte sich an die Filmrollen mit den belastenden Bildern, das Grab und den Mann, den er für einen Mörder hielt. Natürlich musste der Mann zurückkommen und den Beweis für seinen Aufenthalt in dem Dorf vernichten, bevor er den Ort für immer verließ. Er war nicht als Bewohner der Baracke gemeldet. Doch mit dem Foto, das der Professor unten an der Mühle gemacht hatte, konnte man ihn mühelos identifizieren und zur Fahndung ausschreiben.
Und nun war der Mann in seinem Haus!
In diesem Moment hörte er den Fremden.
Alle Sinne konzentrierten sich auf dieses eine Geräusch. Als der Mann sich über ihn beugte, handelte der Professor sofort. Er versetzte der dunklen, warmen, drohenden Gestalt, die ihn offenbar schlafend wähnte, einen festen Stoß, so dass sie zurückwich, taumelte und stürzte.
Der Professor sprang auf und hastete durch den Raum. Er wollte blindlings fliehen, doch die Stille hinter ihm hielt ihn auf. Er blieb an der Zimmertür stehen, drückte auf den Lichtschalter und wappnete sich, dem Angreifer ins Gesicht zu sehen.
Die Gestalt, die jetzt auf dem Boden lag, rührte sich nicht. Sie trug eine dunkle Jacke und feste Schuhe.
Remscheid verstand, was geschehen war. Der Angreifer war durch den Stoß, den er ihm versetzt hatte, über die schmale Perserbrücke gestolpert und auf der Kante des Schreibtisches aufgeschlagen.
Der Mann musste ohnmächtig oder verletzt sein.
Vorsichtig näherte sich Remscheid dem Fremden. Mit äußerster Willenskraft berührte er den Mann. Der lag schwer und regungslos da. Er bemerkte keine Atmung. Der Mann musste tot sein.
Ein Unfall, sagte sich Remscheid. Es war ein Unfall. Der Mann hatte ihn angreifen wollen. Er hatte sich nur verteidigt.
Er drehte den Körper des Mannes, um sicherzugehen, was mit dem Eindringling geschehen war.
Mit einem Aufschrei ließ er wieder los und blieb fassungslos stehen.
Vor ihm lag nicht der unheimliche Fremde aus der Baracke, sondern Laurens, der Ortsvorsteher.
Der Professor war sich nicht sicher, ob eine Träne über sein Gesicht lief.
Er musste einen Krankenwagen und die Polizei rufen. Es war ein Unfall, sagte er sich wieder. Laurens Frau musste ihm ausgerichtet haben, dass er angerufen hatte, weil er sich von dem Fremden bedroht fühlte. Da er in seinem Lehnstuhl eingeschlafen war, hatte Remscheid den Ortsvorsteher nicht gehört, der an seiner Haustür klopfte. Besorgt um die Sicherheit des Professors hatte sich Laurens Zugang zum Haus verschafft. (Remscheid war gelinde erstaunt, wie einfach dies möglich gewesen sein musste. Tatsächlich entdeckte er später ein eingedrücktes Fenster in seinem Schlafzimmer, das er sorgfältig reparierte.)
Während der Professor überlegte, wie er nun vorgehen sollte, verfestigte sich ein kleiner Gedanke in seinem Bewusstsein. Er versuchte, eine schlüssige Reihenfolge festzulegen, nach der er vorgehen wollte: das Gesicht waschen, um die Mattigkeit zu überwinden, die ihn befallen hatte, die Zähne putzen, um dem Rettungsdienst und der Polizei nicht mit einer Cognacfahne entgegenzutreten, die Notfallnummern wählen, um den Vorfall zu schildern und Hilfe herbeizurufen. Er bemerkte einen Widerstand in sich, der ihn verwirrte, denn er war im allgemeinen ein sehr seriöser und pflichtbewusster Mensch. Und doch sagte er sich nun, dass es nicht seine Schuld war, dass Laurens dort tot auf dem Boden lag. Nichts an dieser Situation war sein Verschulden. Er hatte ein geruhsames Forschungsobjekt gefunden, das ihm Freude bereitete, und er hatte sich auf einige Monate stiller Kleinarbeit in seinem gemütlichen Haus gefreut.
Nun lag hier auf seinem Wohnzimmerteppich ein Toter, den er umgebracht hatte, wenn auch nicht vorsätzlich. Das war Totschlag und würde vor Gericht gehen. Er konnte nicht beweisen, dass es sich um einen Unfall gehandelt hatte. Er wollte sich nicht ausmalen, was geschehen würde, die Zeitungsmeldungen, die Spekulationen, der Verlust seiner Stelle, seinen entwerteten Lebensabend.
Tatsächlich dauerte der innere Kampf nicht so lange, wie es von einem Menschen mit ausgeprägtem Gewissen zu erwarten gewesen wäre. Das lag auch daran, dass sich Remscheid in der Gesellschaft des Toten äußerst unwohl fühlte und ihm seine Vernunft sagte, dass es besser wäre, eine noch schlimmere Tat als unbeabsichtigt den Tod eines Menschen verursacht zu haben, so schnell wie möglich zu begehen, solange es noch dunkel war und im Dorf niemand unterwegs sein würde.
Er vergewisserte sich, dass die Luft rein war, öffnete den Kofferraum seines Wagens, breite eine alte Decke aus und schleppte den Leichnam des Ortsvorstehers aus dem Haus. Dies tat er völlig kaltblütig, denn er war entschlossen, nichts falsch zu machen. Er musste vermeiden, entdeckt zu werden, verdächtigt zu werden. Das Gewissen musste schweigen und mit der Aussicht auf spätere, grauenvolle Schuldgefühle vertröstet werden. Er erinnerte sich an einen Film, den er gesehen hatte, in dem der Mörder abstruse Probleme hatte, eine Leiche aus seiner Wohnung zu beseitigen. Er verbat sich die Erinnerung. Er war kein gemeiner Mörder. Er hatte keine Schuld an dieser Situation. Niemandem war geholfen, wenn er sein Leben ruinierte.
Er verstaute den Toten und einen Spaten aus dem Nebengebäude im Kofferraum und dachte auch daran, den Wohnzimmerteppich einzupacken. Dann startete er den Wagen, fuhr durch das stille Dorf und hoffte, dass wirklich niemand an einem der Fenster stand und ihn auf seinem nächtlichen Weg beobachtete.
Er steuerte den Wagen die Landstraße entlang und bog an der Stelle ab, an der er so viele Stunden vorher den Weg zum Endershof eingeschlagen hatte. Er riskierte es, den schwergewichtigen Citroen dem unebenen Waldweg auszusetzen. Er fuhr sehr langsam, weil er unsicher war, ob die grellen Scheinwerfer, die auf die undurchdringlichen Schatten der Nacht und des Waldes trafen, ihn nicht in einen Graben führten. Es durfte keinen Zwischenfall geben. Es wäre sicherer gewesen, das Auto versteckt im Wald abzustellen, aber er hatte nicht die Kraft, den Toten den langen Weg bis zum Dickicht am Endershof zu tragen.
Zunächst hatte er überlegt, die Leiche aus dem Dorf zu schaffen, indem er sie unten an der Mühle versteckte oder ins Wasser warf. Er hatte sich dagegen entschieden, weil er mit der Gegend nicht gut genug vertraut war, um ein geeignetes Versteck zu kennen. Das Grab auf der Lichtung am Endershof hingegen war bereits angelegt. Sollte man die Leiche dort entdecken, würde man sie mit dem Verbrechen des Fremden in Verbindung bringen, der dort seine ermordete Frau vergraben hatte.
Fast empfand er so etwas wie ein Hochgefühl, als ihm klar wurde, wie gespenstisch klar und durchdacht sein Plan war.
Er erreichte das Feld. Im Scheinwerferlicht sah er den entfernt liegenden Endershof. Er bewaffnete sich mit einer Taschenlampe und schaltete das Standlicht des Autos aus. Mit dem Teppich schleifte er die Leiche über das Feld und gestattete sich nicht, auch nur einen Gedanken des Mitleids mit dem Mann zu empfinden, den er getötet hatte. Ließe er es zu, so sagte er sich, würde er auf der Stelle zusammenbrechen. Den Spaten stieß er alle paar Meter in den Boden, um ihn nachzuholen, wenn er den Toten wieder ein Stück weiterbefördert hatte.
Auf diese Weise schleppte er seine Last bis zur Ruine des Hofes und von dort bis zum Dickicht, das ihn erwartete. Anders als am Tag fühlte er keine geheimnisvollen Stimmungen, empfand kein Grauen, keine Vorgefühle, sah nur rettendes dichtes Buschwerk, das ihn vor allen Blicken verbarg, und wo er sein verlorenes Leben wiederherstellen konnte. Dies vor allem erfüllte ihn mit Energie. Wie bei seinem ersten Besuch schlugen ihm die Äste ins Gesicht und Dornen zerkratzten ihn und den Toten, aber dies erschien ihm nicht wichtig. Das war in einem dichten Wald nicht anders zu erwarten.
Er fand die Lichtung, auf die eine freundliche Sichel des Mondes schien. Er legte den Toten neben sich ab und begann, mit dem Spaten das Grab zu öffnen. Schweiß rann ihm über das Gesicht, aber er war zuversichtlich.
Nachdem das Grab immer tiefer wurde und der Haufen Erde oben auf der Lichtung immer größer, hoffte Remscheid bald auf die Leiche der ermordeten Frau zu stoßen. Er war nur milde erstaunt, dass dies nicht so war. In dem Grab lag keine Leiche. Schließlich versenkte er Laurens’ Körper in der Grube, und schaufelte das Grab, das nun wirklich eines war, wieder zu.
Als er fertig war, gestattete er sich ein kleines Gebet für den armen Mann. Vielleicht hatten Kinder wie Laurens dieses „Grab“ angelegt, um sich zu gruseln, dachte er, als er sich erinnerte, dass Laurens mit seinen Schulfreunden hier gespielt hatte. Dies erschien ihm wie eine Fügung und er kehrte mit seiner Schaufel zum Endershof und dann zu seinem Wagen zurück. Er fühlte sich befreit.
1996 wurden die Erbschaftsstreitigkeiten um den Endershof endlich beigelegt. Das Land wurde verkauft und die neuen Eigentümer machten sich daran, die Landwirtschaft wieder aufzunehmen, die über Jahrzehnte brach gelegen hatte. Auf dem Gelände des verzauberten Hofes wollten sie nicht leben. Deshalb ließen sie die Ruinen beseitigen und an anderer Stelle, in unmittelbarer Nähe einer kleinen Landstraße, ein neues modernes Haus bauen. Da sie einen direkten Zugang zum Dorf haben wollten, der ihnen den Umweg mit Trecker und landwirtschaftlichem Gerät rund um den Wald abnehmen sollte, ließen sie das Dickicht, das das Land des ehemaligen Endershofes vom Dorf trennte, abholzen und mit staatlichen Fördergeldern einen asphaltierten Weg anlegen. Auf diese Weise wurde das Grab auf der Lichtung und nach mehr als zwanzig Jahren die Leiche des verschwundenen Ortsvorstehers Laurens entdeckt. Eine Autopsie ergab, dass Laurens an einem schweren Schlag auf die Schläfe gestorben sein musste.
Laurens Kinder, die inzwischen in den Dreißigern waren, waren trotz allem erleichtert, dass ihr Vater nicht, wie sie und die meisten Leute im Dorf angenommen hatten, die Familie für einen anderen Partner verlassen hatte. Laurens Ehefrau - inzwischen eine gestandene Witwe weit über Sechzig, die immer noch die Geschäfte der Konditoreien führte – gab niemals öffentlich zu, dass ihr dies als die einzige Möglichkeit erschienen war, nachdem Laurens nach einem nächtlichen Streit über sein spätes Ausbleiben das Haus im Zorn verlassen hatte. Da kein Geld vom gemeinsamen Konto abgehoben wurde und er keine persönlichen Gegenstände mitgenommen hatte, meldete die Familie Laurens schließlich als vermisst. Den Polizeibeamten, die den Fall untersuchten, kam die Ehefrau sehr verbittert vor. Offenbar glaubte sie, dass Laurens schon eine ganze Weile ein Doppelleben geführt hatte. Dies hätte erklärt, warum der Mann kein Geld mitgenommen hatte. Er hatte seine Familie versorgt zurückgelassen und vielleicht in einer anderen Stadt bereits ein neues Leben, ein anderes Konto, andere Menschen, die ihm wichtiger waren als seine zerrüttete Ehe.
An den Anruf des Professors an dem Tag, als ihr Mann verschwand, erinnerte sich Fr. Laurens nicht mehr, obwohl sie ihrem Mann den Anruf ausgerichtet hatte. Durch seine ständigen Aktivitäten, die ihn von zu Hause fernhielten, bekam Laurens so viele Briefe, Bitten und Anrufe, dass sie auf deren Inhalt nicht mehr besonders achtete.
Nach der Entdeckung der Leiche ging sie gemeinsam mit den Ermittlungsbeamten noch einmal die Vorgeschichte des Verschwindens durch. Sie erinnerte sich an einen Mann, der in den „Baracken“ am Dorfausgang lebte, ein Sozialfall, den ihr Mann einen oder zwei Tage zuvor gebeten hatte, das Dorf zu verlassen, weil er den Leuten Angst einjagte. Sie wusste den Namen des Mannes nicht, erinnerte sich aber daran, dass sie ihn unheimlich fand. Um ihre Ansicht zu untermauern, sagte sie, dass selbst der nette Professor, der damals im Dorf war, um die Lokalgeschichte zu erforschen, den Mann furchterregend gefunden hatte. Aus der alten Vermissten-Akte erfuhren die Polizeibeamten den Namen und die Anschrift des Professors. Er war damals befragt worden und hatte ausgesagt, dass er Laurens schon einige Tage vor seinem Verschwinden nicht mehr gesehen hatte. Er hatte mit ihm telefonieren wollen, Laurens sei aber abwesend gewesen und hatte sich nicht zurückgemeldet.
Als die Polizei den Professor erneut kontaktieren wollte, um ihn angesichts des Leichenfundes zu befragen, erfuhren die Beamten, dass Remscheid Anfang der 80er Jahre Deutschland verlassen hatte, um im damals von Bürgerkriegen geschüttelten Mittelamerika eine Legende der Mayas zu untersuchen, die Ähnlichkeiten mit seinem Forschungsgebiet, der so genannten „Mühlen“-Sage, aufwies. Von dieser Reise war Remscheid niemals zurückgekehrt. Er galt als verschollen und wahrscheinlich tot.
Die alte Schule
Die alte Schule lag im Tal, wie beinahe das gesamte Dorf. Nur ein paar Häuser krochen die schmalen Straßen hinauf. Eine Art Herrenhaus stand oben am Waldrand. Die Kirche, das Pfarrhaus, der ehemalige Laden, Häuser, die einst Werkstätten waren, und eine Handvoll Wohnhäuser drängten sich im Tal aneinander und gönnten sich wenig Raum. Hier und da verschaffte sich ein Busch Rosen oder eine Hecke Geltung, die sich den Platz mit einem eisernen Gitter teilten. Die alten Steinhäuser waren grau, aus groben Steinen, und die einzelnen roten Rosen wirkten wie Farbtupfer.
Die alte Schule war verwinkelt. Sie war das größte Gebäude im Dorf. Hier waren im Laufe der Zeit zwei Häuser zusammengelegt, ausgebaut und an vielen Stellen zugemauert worden. Die Haustür des ersten Hauses war der Haupteingang, als es noch als Schule gedient hatte. Diese Tür war rot und bestand aus zwei schmalen Flügeln. In einem davon war ein kleines vergittertes, verschließbares Fensterchen eingelassen, wie an der Pforte eines Klosters. Diese Haustür war das einzig Schöne an dem Gebäude. In den sechziger Jahren, als die Schule noch geöffnet war, war überlegt worden, sie durch eine moderne Tür zu ersetzen, mit gläserner Füllung, dekorativen Goldstreifen, ausladendem Griff und der Tendenz, immer zuzuknallen. Glücklicherweise hatte das Dorf kein Geld für diese Ausgabe und die Tür blieb wie sie war. Das erste Haus hatte etliche schmale Räume und einem geräumigen Dachboden. Im ehemaligen Lehrerzimmer war eine Ofenplatte mit einem ritterlichen Motiv in die Wand eingelassen. Sie gehörte aber nicht zum ursprünglichen Haus und man sah die Spuren unsachgemäßen Einbaus.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752136180
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (März)
- Schlagworte
- Eifel Geheimnis Lost Places Häuser Krimi Kurzgeschichten Gechichten Regional