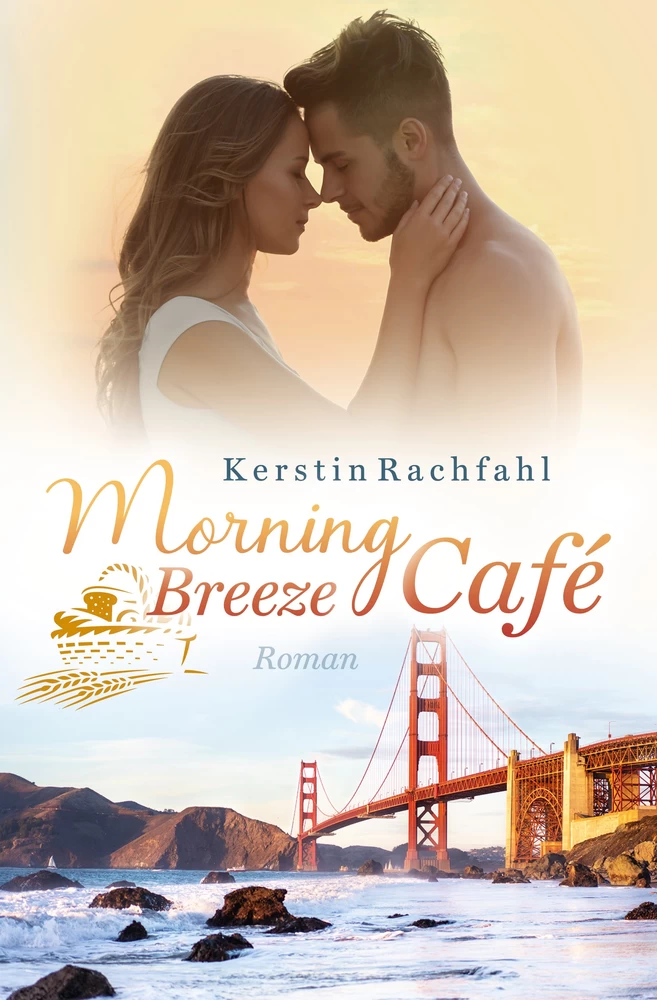»Wie machst du das?« Keith runzelte verärgert die Stirn. »Dein Smoothie ist grasgrün und schmeckt auch besser als meiner.«
»Du musst die Reihenfolge einhalten, was wie lange gemixt wird, damit die wichtigen Nährstoffe erhalten bleiben. Er soll ja nicht nur gut schmecken, sondern auch gesund sein. Schau, ich zeige es dir noch mal.« Bree schob ihn beiseite, säuberte seinen Mixer und fing von vorne an. »Grundsätzlich gilt die Regel: Alle harten Zutaten, die cremig werden sollen, werden als Erste gemixt. Du beginnst mit der Flüssigkeit, der Süße, dann die harten Komponenten. Der Rucola darf nur kurz gemixt werden, weil er sonst seine Nährstoffe verliert. Gib noch einen Schuss Zitronensaft hinzu, dann bleibt das Aroma erhalten.«
Sie nahm einen sauberen Löffel, schöpfte eine winzige Menge ab und ließ ihn probieren.
»Mhm, perfekt.«
Bree, Keith und Maja arbeiteten Seite an Seite die Bestellungen ab. Immer wieder griff Bree korrigierend bei Keith ein, der nach der Backstube nun auch die Küche eroberte. Erstaunlicherweise blieb der Mann voll konzentriert, obwohl ihm Lulu, die neben Alicia und Mona die Kunden bediente, bei jeder Bestellung, die sie ihm überreichte, ein strahlendes Lächeln schenkte. Ganz konnte sie es ihr nicht verdenken. Sein asiatischer Einschlag verlieh ihm etwas Exotisches. Die schwarzen, vollen Haare waren einfach nur beneidenswert. Außerdem besaß er jede Menge Humor. Seit er bei ihnen arbeitete, hörte man die Angestellten viel häufiger lachen. Für Brees Geschmack war er allerdings eine Spur zu klein. Zu Lulu hingegen würde er perfekt passen. Langsam flaute der Strom der Kundschaft ab.
»Ich hab dich gestern in der Liveshow von Ethan gesehen. Ist es nicht seltsam, mit so jemanden befreundet zu sein?«, flötete Lulu.
Keith grinste sie an. »Nicht befreundet, eher bekannt, um ehrlich zu sein. Ich bin schon jahrelang ein großer Fan von ihm und war ganz schön von den Socken, als er mich fragte, ob ich ihm Unterricht in Martial Arts gebe.«
»Du machst Martial Arts?«
Keith blinzelte ihr zu. »Oh ja, ich war eine Zeit lang Stuntman, doch auf Dauer war mir der Job zu gefährlich. Ethan hatte den Tipp, mich anzusprechen, von einem seiner Interviewpartner erhalten, dem ich private Stunden gegeben hatte.«
»Und wie ist Ethan so?«
»Er ist ein echt netter Kerl und hat überhaupt keine Starallüren. Im Grunde ist er so, wie er bei den Podcasts und Videos rüberkommt.« Keith zuckte die Schultern. »Ist allerdings schon ziemlich cool, wie locker er mit all den bekannten Persönlichkeiten umgeht und per Du ist. Egal wen er anruft und fragt, ob er bei seinem Podcast dabei sein möchte, jeder sagt ihm zu.«
»Podcast?«, klinkte Bree sich in das Gespräch ein. »Ist das eine Fernsehshow?« Die beiden rissen die Augen auf und starrten sie an. »Was? Habe ich was Falsches gesagt?«
»Macht euch nichts draus.« Mona gesellte sich mit einem leisen Klimpern ihrer Armreifen, das sie immer zu begleiten schien, zu ihnen. »Bree hat ihr Smartphone nur, damit sie Shelly erreichen kann, und den Computer kann sie erst bedienen, seit ihr Shelly gezeigt hat, wie sie damit ein Rezeptbuch anlegen kann.«
»Manchmal höre ich auch Musik mit meinem Telefon«, verteidigte Bree sich.
»Smartphone«, korrigierte nun Maja von der anderen Seite.
»Ist doch egal, wie das Ding heißt.«
»Soll das heißen, du weißt ehrlich nicht, was ein Podcast ist?«, hakte Lulu nach.
»Nein.«
»Und du weißt nicht, wer Ethan Franklin ist?«
»Nein.«
Keith legte Bree den Arm um die Schultern und gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Du bist meine Heldin.«
Sie schob ihn zur Seite und wischte sich mit dem Handrücken über die Stelle, wo er sie geküsst hatte. In Lulus Augen sah sie die Enttäuschung aufblitzen.
»Hände weg, mein Lieber, sonst kürze ich dir das Gehalt«, drohte sie ihm lachend mit dem Kochlöffel. »Also, wer erklärt mir jetzt, was ein Podcast ist?«
»Letztlich nichts anderes als eine Audio- oder Videodatei, die du über das Internet runterladen kannst. Der Begriff setzt sich aus Broadcasting – also Rundfunk, ›cast‹ – und iPod, ›Pod‹ von Apple zusammen, weil darüber die ersten Sendungen verteilt worden sind. Es gibt übrigens zig Podcasts zum Backen und Kochen. Du könntest auch einen produzieren. Ist ganz simpel«, erklärte Keith.
Mona schüttelte den Kopf. »Vergiss es, dazu bekommst du Bree nie!«
»Das Ambiente hier wäre aber genial. Außerdem wäre es eine super Referenz für euch. Du könntest den Bekanntheitsgrad steigern, Backbücher herausgeben und deine eigene kleine Backshow aufziehen. Und wenn ich mal wieder nicht weiß, wie ich einen Smoothie richtig zubereite, schaue ich mir auf Youtube dein Video an.«
»Youtube?« Bree hob die Augenbrauen.
»Jetzt sag mir nicht, dass du auch nicht weißt, was Youtube ist.« Leichte Verzweiflung klang aus Keiths Stimme.
»Klar kenne ich Youtube, aber was soll ich da? Ich hab alle Hände voll zu tun und unser Café läuft.«
»Ja, aber du könntest dir ein Internetbusiness aufbauen.« Keith begann, sich in Begeisterung zu reden. »Ethan braucht in seinem ganzen Leben nie mehr zu arbeiten, wenn er keine Lust dazu hat. Sein Geld verdient er sozusagen im Schlaf. Alle reißen sich darum, in seinem Podcast zu erscheinen. Seine Bücher sind Megabestseller. Er steht auf, wann es ihm passt, geht in den Urlaub, wenn ihm danach ist, und überhaupt lebt er sein Leben so, wie er will. Er kennt keine Bürozeiten und kann alles machen, was ihm Spaß macht.«
»Wie alt ist er? Achtzehn?«, schmunzelte Bree.
»Einunddreißig.«
»Dann wollen wir mal hoffen, dass es ihm nicht langweilig wird.«
»Langweilig, pfft!« Keith verdrehte die Augen.
»Okay, mein Lieber, verrate mir eines. Wenn du so begeistert von diesen Podcasts, Videos und Büchern bist, warum stehst du dann morgens um drei mit mir in der Backstube und jetzt in der Küche?«
Keith rieb sich mit der Hand über die Bartstoppeln an seinem Kinn. »Ja. Warum eigentlich? Weil ich keine Ahnung habe, worüber ich reden und was ich online verkaufen möchte? Abgesehen davon gefällt es mir bei dir. Du hast es echt drauf, wenn es um gesunde Ernährung aus frischen, einfachen Zutaten geht, ganz zu schweigen von deiner Backkunst, bei der man, wenn man schon nascht, wenigstens vollwertig nascht. Außerdem bringst du das Flair von Europa nach San Francisco.«
»Europa? Hey, ich komme aus einem winzig kleinen Dorf im tiefsten Sauerland. Nix Europa. Ich bin ein Dorftrampel.«
»Sauerland?«
Sie schlug ihm mit dem feuchten Handtuch, das sie gerade zum Trocknen hatte aufhängen wollen, auf den Arm. »Vergiss es, ihr Amerikaner wisst ja gerade mal, wo in Deutschland Berlin und vielleicht auch noch Heidelberg und München liegen.«
»Cool – deutsches Mädchen vom Dorf erfüllt sich den Traum eines eigenen Cafés in San Francisco.« Er wischte sich die Hände an einem sauberen Tuch ab und langte in seine Hosentasche. »Muss gleich mal Ethan anpingen.«
»Warum?«
»Ihm vorschlagen, dass du unbedingt in seinem Podcast auftreten musst.«
»Hak's ab, für so einen Blödsinn habe ich keine Zeit.«
»Könntest du das wirklich hinbekommen?«
Bree sah in Monas Augen die Dollarzeichen aufblitzen.
»Keine Ahnung. Wie gesagt, wir kennen uns nur von dem Unterricht, den ich ihm gegeben habe, aber Ethan ist immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern, die aus dem Nichts ein Business aufgebaut haben. Darum geht es in seiner Show. Menschen und ihr Erfolgsgeheimnis und was andere davon lernen können. Sein letztes Buch hatte den Titel ›Rezept für Erfolg‹ und war monatelang auf der New-York-Times-Bestsellerliste und ist immer noch unter den Top 20 der Ratgeberbücher. Sein allererstes Buch ›Mehr Zeit zum Leben‹ findest du selbst nach sieben Jahren noch immer unter den Top-50-Sachbüchern.«
»Wow«, kommentierte Bree amüsiert und verkniff sich angesichts von Keiths Begeisterung ein Schmunzeln. Offensichtlich nicht gut genug.
Keith runzelte die Stirn. »Das klingt nicht begeistert.«
»Nein, nein, so ist es nicht. Ich bin total beeindruckt.«
»Du machst dich lustig über mich.« Er verschränkte die Arme vor der Brust.
»Okay, ja, ein bisschen. Du klingst wie ein Teenager, der über sein Idol spricht.«
»Das ist er auch«, mischte sich Maja ein. »Hast du eine Ahnung, wie viele Leute seinen Podcast hören? Millionen. Sein Blog ist der totale Renner, und wenn er ein Produkt erwähnt, dann ist es am nächsten Tag ausverkauft. Dabei macht er das nur für Produkte, von denen er absolut überzeugt ist. Ich habe mit seinem Buch ›Forme deinen Körper von innen‹ zwanzig Kilo abgenommen und halte mein Gewicht seit drei Jahren, weil es nicht um Diät geht, sondern um Ernährungspsychologie. Warum du isst, was du isst. All das, was wir im Café anbieten, passt perfekt zu dem, was er geschrieben hat. Wenn du in seinem Podcast auftrittst, können wir uns vor Kundschaft nicht mehr retten.«
»Hallo? Noch mal, ich trete in so einem Dingsda nicht auf. Außerdem bin ich kein erfolgreicher Mensch.«
»Siehst du, und genau da liegst du falsch!« Begleitet vom Klimpern ihrer Armreifen, das beinahe empört klang, stemmte Mona die Hände in die Hüfte. »Schau dich doch um, was du geschaffen hast.«
»Einen Moment mal, was wir geschaffen haben. Ohne dein Händchen für den Verkauf und die Zahlen wären wir in den ersten Jahren pleitegegangen. Nicht zu vergessen Katlin, die uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat, die Büroarbeit erledigt, mich in der Backstube vertritt, damit ich ab und an mal frei habe, und uns ein Dach über dem Kopf gegeben hat.«
»Papperlapapp. Du bist das Herz dieses Unternehmens. Wegen deiner Backwaren, deiner Gerichte und Getränke kommen die Leute in unser Café. Ohne dich gäbe es nichts, was ich verkaufen könnte.«
»Mein Reden«, warf Keith ein. »Ich bin schließlich nicht hier, weil ich etwas von Mona lernen möchte, sondern von dir.«
Mona drohte nun ihm mit dem Finger. »Du solltest vorsichtig sein, Keith, immerhin bekommst du deinen Gehaltsscheck von mir.«
»Okay, okay, vergesst was ich gesagt habe.« Bree zog ihre Schürze aus und befreite ihre Haare von dem kiwigrünen Bandana. »Von mir aus könnt ihr gerne weiterdiskutieren, ich mache für heute Schluss. Shelly, Jimin und ich wollten noch eine kleine Fahrradtour machen.«
Auf einer Anhöhe packte Bree das Picknick aus. Von hier hatte man einen wunderschönen Blick auf die Bucht. Das Wetter war ungewöhnlich klar, sodass sie sogar rechts die Golden Gate Bridge sehen konnten. Hungrig stürzten sich die Mädels auf ihre Blondies, deren Hauptbestandteil Süßkartoffeln waren und die viele Vitamine enthielten.
»Wieso heißt der Kuchen eigentlich Blondies?«, wollte Jimin wissen, die die letzten Krümel aufpickte.
»Na, weil es das Gegenteil von Brownies ist.« Shelly schob sich den letzten Rest genüsslich in den Mund.
Jimin betrachtete ihr Smartphone. »Mist, hier oben gibt es gar keinen Empfang.«
Bree warf ihr einen amüsierten Blick zu. »Wozu brauchst du hier Empfang?«
»Na ja, weil BTS einen neuen Song herausbringen und ich doch unbedingt voten muss, damit sie die meisten Likes haben.«
»Ehrlich Jimin, du bist regelrecht besessen davon, es gibt doch genug andere Fans in der Army, die voten können. Die Welt geht nicht unter, wenn wir es in zwei Stunden machen«, konterte ihre Tochter.
»Doch geht sie, weil es eben auch auf die Geschwindigkeit ankommt.«
Bree streckte sich auf dem Gras aus. Von oben wärmte sie die Sonne und gleichzeitig wehte eine kühle Brise, die ihr angenehm über die nackte Haut strich. »Ich verstehe kein Wort von dem, was ihr erzählt. Angefangen bei: Wer oder was ist BTS?«
»Eine Boygroup aus Seoul, die sind gerade total in bei uns in der Schule. Stell dir vor, Lara hat von ihren Eltern eine Karte für das Konzert in New York geschenkt bekommen, 990 Dollar!« Shelly tippte sich an die Stirn. »Abgesehen von dem Flug und dem Hotel.«
Bree grinste. Das war so typisch für ihre Tochter, dass sie über solche Dinge nachdachte. Dann verschwand ihr Grinsen wieder. Ein elfjähriges Mädchen sollte nicht über Geld nachdenken und darüber, was sinnvoll war oder nicht. Sie sollte Blödsinn machen, Geschenke lieben und Abenteuer erleben. Bree drehte sich auf die Seite und stützte den Kopf auf die Hand.
»Also ich finde das genial, wenn die Eltern ihrer Tochter einen solchen Traum erfüllen. Aber seit wann kostet ein Konzertticket 990 Dollar? Oder ist es eine VIP-Karte für den Backstage-Bereich?« Bree ließ ihrer Fantasie freien Lauf. »Vielleicht gehört ja sogar ein Essen mit der Band dazu?«
Jimin ließ sich ins Gras fallen. »Oh wow, was für eine Vorstellung, mit Jungkook zu Abend zu essen.«
»Das Konzert war nach einer halben Stunde ausverkauft und die Eltern von Lara haben die Karte auf einer Auktionsplattform ersteigert«, ließ Shelly die Seifenblasen zerplatzen.
»Also gut, ich gebe dir recht, das ist tatsächlich übertrieben. Selbst mein Dad meinte das, als ich ihn fragte, ob er mit mir dort hinfliegt«, seufzte Jimin ergeben.
»Siehst du, habe ich dir doch gesagt. Dabei kannst du dir online alles von ihnen ansehen, ganz zu schweigen von ihrer Youtube-Red-Dokumentation ›Burn the Stage‹.«
»Was ist denn das?« Bree hatte schon wieder das Gefühl, nur die Hälfte von dem Gespräch zu verstehen.
Jimin drehte ihr den Kopf zu. »Youtube?«
»Nein, das weiß ich schon.« Zum zweiten Mal an einem Tag wurde sie das nun gefragt. Sollte ihr das zu denken geben? »So ganz ist dieser Social-Media-Hype ja nun nicht an mir vorbeigegangen.«
»Mom glaubt ernsthaft, sie wäre an der innovativen Spitze, weil das Café eine Facebook-Fanpage hat.« Die Mädels kicherten.
»Nur weil ich nicht den ganzen Tag im Internet verbringe und dir ständig irgendwelche Bilder, Links oder Kurznachrichten sende, heißt das nicht, dass ich keine Ahnung von diesem modernen Zeugs habe.«
Shelly gab ihr einen Kuss. »Weißt du Mom, ich finde es toll, dass du mit uns Fahrrad fährst und nicht den ganzen Tag an deinem Rechner verbringst oder auf dem Smartphone herumtippst.«
»Danke. Und nun los, ihr Digital Natives, wollen wir mal sehen, ob ihr ohne eure technischen Geräte den Weg zurück findet.«
Bree maß die Mengen für die verschiedenen Brotteige ab und stellte sie bereit. Sie schaltete die Teigmaschinen an und fügte nach und nach die Zutaten hinzu. Während der Teig ruhte, schob sie die Holzscheite in den Steinofen. Das gab dem Brot und auch später dem Blechkuchen, den sie in der Nachglut buk, das spezielle Aroma. Sie liebte diese stillen Morgenstunden, wenn die Welt draußen dunkel war und noch alle schliefen. Das war schon in ihrer Teenagerzeit so gewesen. Während ihre Freundinnen bis in die Puppen geschlafen hatten, hatte ihr Tag um drei Uhr morgens mit den Vorbereitungen begonnen. Das hatte sich nicht geändert. Den Duft der frisch gebackenen Brote, Brötchen, Croissants, Plunderteilchen, Blechkuchen, der die Backstube ausfüllte, würde sie für nichts in der Welt eintauschen. Die Hitze, die ihr das Blut in die Wangen trieb, egal wie kalt es draußen war. Die eckigen Kastenbrote in verschiedenen Varianten mit Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen, Leinsamen oder das deftig-salzige Kräuterbrot. Das nur durch die getrockneten Aprikosen, Datteln und Pflaumen gesüßte Früchtebrot wurde geschnitten und für die Sandwiches vorbereitet. Die Eckstücke wurden sorgsam verwahrt und zu Croûtons für die frischen Blattsalate verarbeitet, die sie zur Lunchzeit anboten. Bree hasste es, wenn Essen weggeworfen wurde, weshalb sie kleine Portionen zu niedrigeren Preisen verkauften, anstatt dem Trend vieler amerikanischen Restaurants zu folgen und Riesenportionen anzubieten.
»Mach du weiter mit den Apfeltaschen, ich übernehme das Rollen der Croissants, Zimt- und Mohnschnecken.« Katlin band sich erst die Schürze fest, bevor sie ihre blond gefärbten Haare in einem violetten Bandana verbarg. Die Farbe des Kopftuches passte exakt zu ihrem mauvefarbenen Kostüm. Wie man in dieser eleganten Kleidung in der Backstube stehen konnte, war Bree ein Rätsel. Katlin legte sehr viel Wert auf ihre äußere Erscheinung. Noch nie hatte Bree ihre Mitinhaberin ungeschminkt oder in einem Schlafanzug gesehen. Geschweige denn in einem Jogginganzug.
Hand in Hand arbeiteten sie weiter, in einem stetigen, konstanten Rhythmus, der beruhigend auf Bree wirkte. Als Kind hatten ihre Pflegeeltern sie anfangs von Kinderarzt zu Kinderarzt geschleppt, weil bei ihr ein Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom diagnostiziert worden war. Tatsächlich stellte es sich am Ende als eine Spätfolge des Drogenkonsums ihrer Mutter heraus. Sie war und blieb eine schlechte Schülerin, die Probleme hatte, dem Unterricht konzentriert zu folgen. Eines Tages durfte sie ihrer Pflegemutter beim Backen helfen, und siehe da, sie blieb geduldig, ruhig und arbeitete sorgfältig. Es machte ihr nichts aus, stundenlang Kekse auszustechen oder geduldig den Teig zu kneten, bis er die richtige Konsistenz besaß. Dass am Ende duftendes, wohlschmeckendes Backwerk entstand, welches sie geschaffen hatte, grenze für sie an Magie. Das war der Moment, in dem sie ihre Liebe zum Backen entdeckte.
»Mona hat mir erzählt, dass Keith dich in die Show von Ethan Franklin bringen möchte.«
»Hat sie das?«, murmelte Bree, völlig in das Falten der Apfeltaschen versunken.
»Ich liebe seinen Podcast. Einer der wenigen, die ich mir anhöre. Ich meine, nicht alle. Die über Fitnesstraining oder Bodybuilding lasse ich aus, aber die mit Oprah, Cal Fussman oder Katie Couric – unglaublich inspirierend. Ich weiß nicht, wie er es macht, doch er schafft es, dass sie wirklich von sich selbst erzählen, über ihr Leben, welche Fehler sie gemacht haben, vor welchen Herausforderungen sie standen und was sie daraus gelernt haben.«
Bree hob überrascht den Kopf. »Du hörst seinen Podcast?« Immerhin war Katlin siebenundfünfzig und damit um einiges älter als sie selbst.
Katlin lächelte sie an. »Nur weil du dich weigerst, dich mit der modernen Technik auseinanderzusetzen, die außerhalb der Backstube existiert, muss das ja nicht jeder so handhaben. Ja, natürlich höre ich Podcasts, sie sind einfach anders, persönlicher, authentischer als die Talkshows im Fernsehen. Außerdem kann ich beim Zuhören gleichzeitig etwas anderes machen.«
»Hm«, stieß Bree nachdenklich aus.
»Allerdings muss dir klar sein, dass die Gefahr besteht, dass wir uns vor Kunden nicht retten können, wenn du in seinem Podcast auftrittst, und wir dann außer Keith noch weitere Mitarbeiter brauchen, die dich in der Backstube unterstützen. Was generell eine gute Idee wäre. Ich wüsste nicht, wann du jemals mehr als drei Tage Urlaub gemacht hast.«
»Du findest, dass ich es machen sollte?«
»Die Entscheidung liegt bei dir. Mona kann ihre Mannschaft rasch aufstocken. Bei deiner Arbeit ist es etwas anderes. Einfache Aufgaben kannst du delegieren, doch die Zubereitung der Teige? Die Anzahl der Brote, die du in dem Steinofen backen kannst? Du kannst natürlich die andere Ware aufstocken, indem wir einen weiteren Backofen anschaffen. Mona hat bereits angefangen zu kalkulieren.«
»Warum muss immer alles größer werden? Ich meine, wir verdienen doch genug, oder etwa nicht?«
»Shelly ist ein kluges Mädchen. Möchtest du nicht, dass sie eines Tages aufs College geht?«
»Natürlich möchte ich das. Aber ich möchte auch Zeit mit ihr verbringen und nicht den ganzen Tag in der Backstube sein. Weißt du, was ich daran liebe, ein eigenes Café zu haben?«
»Dass du dir deine Zeit in gewisser Weise einteilen und dir Freiheiten nehmen kannst?«
»Genau.«
»Du weißt, dass das nicht wirklich der Wahrheit entspricht?«
»Nein, natürlich nicht. Ich arbeite mehr und wesentlich länger als zu der Zeit, in der ich angestellt war. Außerdem musste ich mir da nie Gedanken um Einkaufspreise, Strom, Holz oder sonst etwas machen. Das hat mein Chef erledigt.« Bree grinste. »Und jetzt machen das Mona und du für mich. Doch ich hätte niemals Shelly allein großziehen können, hätte ich sie jeden Tag allein lassen müssen.«
»Nun ja, sie hat einen Vater.«
»Der wollte, dass ich sie abtreibe.«
»Er war jung, fing gerade mit dem College an.«
»Und was war mit mir? Ich war auch jung, noch dazu völlig auf mich allein gestellt, in einem fremden Land, nur mit einem Besuchervisum.«
»Weshalb es verständlich, ja vielleicht sogar vernünftiger gewesen wäre, abzutreiben.«
Bree stoppte mit dem Schälen der Äpfel. Legte das Messer beiseite und starrte Katlin an.
»Bevor du auf mich losgehst, vergiss nicht, wer dich aufgenommen hat. Ich habe lediglich gesagt, dass es vernünftiger gewesen wäre. Ihr beiden«, Katlin hob ihre Hand und strich Bree über die Wange, »habt mir das Leben gerettet. Durch euch hatte ich wieder eine Aufgabe. Shelly ist für mich wie eine Enkeltochter. Und sie ist die Enkeltochter von Arthur und Leandra Wright.«
»Sie ist meine Tochter.«
»Und die Tochter von Brady Wright.«
»Der sich all die Jahre einen Scheißdreck um sie gekümmert hat!«
»Hättest du es denn erlaubt?«
Bree verschränkte die Arme vor der Brust. »Okay, raus mit der Sprache. Was ist los?«
Katlin war die älteste und beste Freundin von Bradys Mutter Leandra Wright, schon seit der Zeit, als sie noch nicht die Frau eines Milliardärs gewesen war, sondern eine einfache Weintechnikerin. An dem Tag, als Bree an der Türschwelle der Wrights aufgetaucht war, um Brady zu sagen, dass sie von ihm schwanger war, war Katlin ebenfalls dort gewesen. Nie würde Bree den Wutanfall von Arthur Wright vergessen. Wie er sie als deutsches Flittchen und Erbschleicherin beschimpft hatte. Eine Schlampe, die glaubte, sich in das gemachte Nest setzen zu können. Aber er würde ihre Durchtriebenheit durchschauen und sie würde kein Cent von ihm bekommen, geschweige denn, dass er sie bei sich im Haus aufnehmen würde. Brady hatte nichts gesagt. Schließlich war Katlin energisch eingeschritten und hatte Arthur die Stirn geboten. Sie nahm Bree mitsamt dem Rucksack, in dem alles steckte, was sie besaß, mit sich nach Hause und bot ihr eine Bleibe für die Nacht an. Brady war kurze Zeit später aufgetaucht und hatte ihr angeboten, die Kosten für die Abtreibung zu übernehmen und ihr 50.000 Dollar zu geben. Als könnte man ein gebrochenes Herz mit Geld bezahlen. Mein Gott, was war sie für ein Naivchen gewesen. Dabei hätte sie es besser wissen müssen. Vielleicht stimmte es ja, dass die Kinder die Fehler ihrer Eltern wiederholten, bis sie irgendwann daraus lernten. Shelly würde es einmal anders machen, da war sie sicher.
»Versprichst du mir, dass du nicht wütend auf mich wirst?« Katlin konzentrierte sich weiter auf das Rollen und Formen von Croissants, diesmal mit einer Füllung von reinen Kakaonibs.
»Ich versuch's.«
»Du weißt, dass Leandra und ich seit Ewigkeiten befreundet sind. Und dass wir es auch weiterhin sind, egal ob es Arthur in den Kram passt oder nicht.«
»Der Tyrann und seine demutsvolle Frau«, spottete Bree.
»So einfach ist das nicht, und ich weiß auch, dass du es nicht wirklich meinst.«
»Sag schon, was hast du gemacht?«
»Nichts gemacht, nur geredet. Leandra und ich waren gestern Abend zusammen essen. Sie hat mir erzählt, dass Jacklyn und Brady seit einem Jahr erfolglos versuchen, Kinder zu bekommen. Offensichtlich klappt das nicht, weil Jacklyn Probleme hat. Ich erzählte ihr von Shelly, wie gut sie in der Schule ist und wie stolz sie uns alle macht. Ich wollte sie nur trösten, mehr nicht.«
»Was will sie?«
»Sie möchte sie kennenlernen.«
»Nein!« Bree drehte sich um, nahm das Messer und begann in einer irrsinnigen Geschwindigkeit die nächsten Äpfel zu schälen.
»Du darfst nicht nur an dich denken, Bree.«
»Ich lasse nicht zu, dass sie Shelly wehtun.«
»Leandra würde ihrer Enkeltochter niemals wehtun.«
»Woher willst du das wissen?«
Katlin legte das letzte Croissant auf das Backblech und schob es in den Ofen. Sie wischte sich ihre Hände an einem Trockentuch ab.
»Weil sie und Shelly seit einem Jahr Kontakt miteinander haben.«
Bree schrie auf, als das scharfe Messer in ihren Finger schnitt. Blut quoll hervor und strömte ihr Handgelenk hinab. »Mist, Mist, Mist!« Sie presste ein Küchentuch auf die Wunde und rannte zum Waschbecken.
Katlin eilte mit dem Notfallset an ihre Seite. »Lass sehen.«
»Wie konntest du mich so hintergehen?«, wisperte Bree und blockte sie ab.
»Ich habe dich nicht hintergangen. Ich weiß es auch erst seit gestern Abend. Aber ich hatte meine Vermutung.«
»Deine Vermutung?«
»Ja, und wenn du ehrlich bist, hättest du auch zwei und zwei zusammenzählen können. Du erinnerst dich an den Forschungswettbewerb vor knapp einem Jahr, bei dem Shelly den dritten Platz gemacht hat und wo es um den Vergärungsprozess bei Weintrauben ging?«
Mit schmalen Lippen klebte Bree ein Pflaster mit viel Zug auf ihre Schnittwunde. Natürlich erinnerte sie sich. Sie war völlig geschockt gewesen, als Shellys Lehrerin ihr von dem Projekt erzählt hatte. Ausgerechnet ihre Tochter befasste sich mit der Herstellung von Weinen! Konnte es nicht Backen sein?
»Ihr Projekt erhielt einen Sonderpreis von der Familie Wright. Eine Besichtigung der Weinberge und der Weinkellerei.«
»Die sie nicht wahrgenommen hat.«
»Wegen dir, weil du es nicht wolltest. Es war das erste Mal, Bree, dass du deine Tochter dermaßen enttäuscht hast. Du hast ihr nie erzählt, dass Brady ihr Vater ist, nicht wahr?«
Sie wollte sich nicht daran erinnern. An die strahlenden Kinderaugen, in denen das Licht einfach so erloschen war, als die Tränen darin hochstiegen. Eine Woche hatte Shelly nur noch das Nötigste mit ihr gesprochen. Noch nie in ihrem Leben hatte Bree sich so elend gefühlt.
»Leandra ist in die Schule gegangen, um dem Mädchen stattdessen ein Buch über die Weinherstellung zu schenken. So haben sich die beiden kennengelernt, und ab und zu haben sie sich getroffen. Kannst du ihr das verübeln? Und erinnerst du dich, wie begeistert Shelly von dem Klassenausflug letzten Monat war, als sie das Weingut besucht haben?«
Bree drückte die Fäuste gegen die Augen und versuchte, das Pochen in ihrem Kopf zu ignorieren.
»Was will sie?«, presste sie schließlich hervor.
»Sie möchte, dass Shelly ihren Vater kennenlernt. Es hat ihr fast das Herz zerrissen, als Shelly bei ihrem letzten Treffen erzählte, dass ihr Vater sie nicht wollte. Natürlich ist ihr bewusst, dass sie kein Recht hat, dich darum zu bitten.«
»Weshalb sie damit zu dir gekommen ist.«
Katlin schwieg einen Moment und seufzte. »Versprich mir, dass du es dir wenigstens durch den Kopf gehen lässt.«