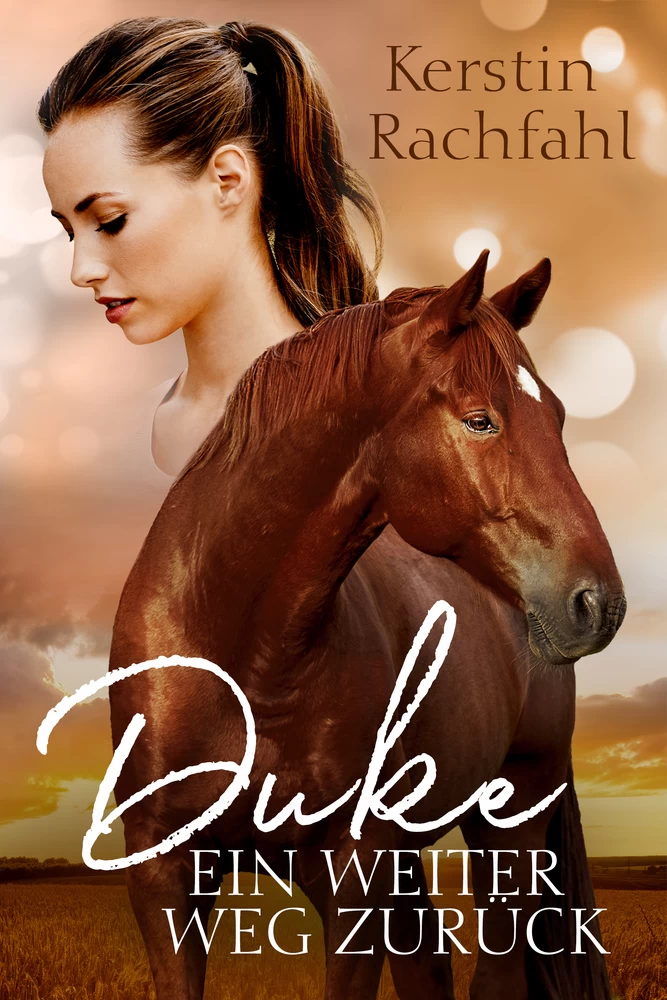In Erinnerung an SF Silver Star. Die für immer einen Platz in meinem Herzen hat.
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1
Kapitel
Rund und voll stand der Mond am Himmel. In den Bäumen wisperte die Nacht ihre Geschichten. Zweige knackten unter den Füßen der schleichenden Jäger. Eine Eule breitete die Schwingen aus und stieß sich ab, aufgescheucht von den weichen Tritten des Pferdes. Gespenstische Schatten zogen vorbei. Ich spürte den Wind, der die Wolken am Himmel entlangjagte, er zog an meinen Haaren. Von unter mir stieg die Wärme des Pferdekörpers auf. Gleichmäßig und sicher stapfte Flying High den dunklen Waldweg entlang. Wenn keine Wolke den Mond verdeckte, konnte ich den Weg erkennen. Ich versuchte erst gar nicht, mein Pferd zu lenken, vertrauensvoll überließ ich Fly die Führung. Seine Augen waren besser, seine Sinne in der Dunkelheit feinfühliger als die meinen.
Eigentlich hatte ich nur eine kleine Runde mit Fly drehen wollen, bevor es morgen nach Aachen ging. Eine lange Fahrt im Hänger, endloses Stehen in einer Box. Im Gedanken sah ich bereits die vorwurfsvollen Blicke von Fly, weil er beides nicht mochte. Dafür liebte er den Wettbewerb, das Springen und vor allem das Siegen wie kein anderes Pferd.
Ich hätte ewig durch die Nacht reiten können. Immer weiter, immer tiefer in den Wald. Weg von den Menschen mit all ihren komplizierten Gefühlen, den falschen Worten, die sie sprachen. Hinein in die Stille, der Rhythmus von zwei Körpern im Gleichklang. Diese Harmonie hatte mir in den letzten Wochen beim Reiten so schmerzhaft gefehlt. Was ganz allein an mir lag. An mir und an meiner Blödheit. Wieso um alles in der Welt hatte ich auf dieser dämlichen Wohltätigkeitsgala mit Thomas Sander geschlafen? War es seine Art gewesen, mich beim Tanzen so eng an seinen Körper zu drücken? Seine warme Stimme, die mir zärtliche Worte ins Ohr flüsterte? Oder der Alkohol, der mir zu Kopf gestiegen war? Vermutlich alles zusammen, ich war berauscht gewesen von all der Aufmerksamkeit, die er mir an diesem Abend schenkte. Von seinen braunen Augen, die so lebendig gefunkelt hatten wie sonst nur die seines Bruders Henning. Seinen geflüsterten Liebesbeteuerungen. Es war allein meine Schuld. Wie dumm war ich gewesen! Die Quittung erhielt ich direkt danach. Schon beim Aufwachen war er aus dem Hotelzimmer verschwunden gewesen. Und die letzten Wochen? Kein Thomas, kein Anruf, kein Zettel. Nichts, als wäre er ein Gespenst.
Und dann war Henning mit seiner Verlobten aufgetaucht. Selina Sanchez. Allein schon der Name ließ mich aufstöhnen, ein Blick hatte gereicht und jedes Selbstwertgefühl in mir war abgestorben. Ein Albtraum für jedes Mädchen, das so durchschnittlich aussah wie ich. Sie hatte schwarzes langes, lockiges Haar. War mindestens 1,80 Meter groß, wog höchstens sechzig Kilo und bestand vor allem aus Beinen. Beine, die in schlanken Fesseln endeten, so wie ich es bei Pferden schön fand. Der Busen üppig genug, dass er einen guten Blick in ihr Dekolleté gestattete, und mit einer schmalen Taille. Sie war sogar nett gewesen, als Henning mich ihr vorstellte. Noch jetzt schüttelte es mich bei dem Gedanken an diese geballte Weiblichkeit. Sie in Jeans, dunkles T-Shirt, tiefer Ausschnitt und eine weiße Bluse darüber. Dezent geschminkt, die braunen Augen mit einem Hauch Gold betont, reichte sie mir ihre gepflegte Hand mit den gestylten Fingernägeln. Ich unterdrückte meinen Impuls, mir erst meine Hände, die kurz zuvor den Pferdemist aus den Hufen von Fly gekratzt hatten, an der Hose abzuwischen. Tapfer ergriff sie die raue Hand von mir, runzelte kurz die Nase, als ihr mein Geruch von Mist entgegenwehte, und schüttelte sie. Insgeheim verfluchte ich Henning, der mich in diese missliche Lage gebracht hatte. Er ignorierte meine Signale zu verschwinden geflissentlich. Stattdessen grinste er mich frech an, schenkte Selina verliebte Blicke und erzählte ihr von den Streichen unserer Kindheit. Ich verdrehte genervt die Augen, während Selina höflich an den richtigen Stellen lachte. Die Pointen gingen natürlich auf meinen Kosten. Mit einem kurz gemurmelten „Ich muss trainieren“ schwang ich mich auf Fly und steuerte auf ein Hindernis zu in der Absicht, wenigstens in einer Sache eine gute Figur zu machen. Es war, als hätte sich alles gegen mich verschworen. Drei Stangen flogen vom Hindernis. Wild buckelnd machte Fly mir bewusst, auf was ich mich zu konzentrieren hatte. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Henning mit Selina Hand in Hand in Richtung des Anwesens der Sanders im Wald verschwand.
Während sich Thomas mit Selina und Henning die Zeit in den Nachtclubs vertrieb, hatte ich mich um Dumont zu kümmern. Dabei gab es auf dem Hof schon genug Arbeit. Was für eine Idiotie. Ich, Vera Kamphoven, trainierte das Pferd meines stärksten Konkurrenten. Das einzige Paar, das es derzeit mit mir und Fly aufnehmen konnte. Bald ist es vorbei damit, dachte ich grimmig. Wenn ich erst den Pokal in meinen Händen hielt, würde ich triumphieren. Die Sanders konnten mir den Buckel runterrutschen: Dann würde Fly mir gehören. So lautete mein Deal, den ich vor acht Jahren mit Erich Sander geschlossen hatte. Erich Sander, mein Chef und der Vater von Thomas und Henning, der Patriarch dieser eingebildeten Familie, die sich alle für etwas Besseres hielten. Aber nicht mehr lange, dachte ich frohlockend. Wenn Flying High erst mal mir gehörte, würde ich meine eigenen Wege gehen.
Während mich Fly durch die Nacht trug, malte ich mir unser Leben in allen Einzelheiten aus. Zuerst war da mein eigener kleiner Hof. Zwei, drei Stuten, die ich von Fly decken lassen würde. Ein kleiner Springplatz, schöne Koppeln mit einem Bach, damit ich mich nicht um das Wasser kümmern musste. Ein Platz für das Training mit einem Dach, aber ohne feste Wände. Ich brauchte Luft beim Training. Nichts verabscheute ich mehr als staubige Hallen. Ich grinste, meinen Grundstock für den Traum hatte ich bereits zusammengespart. Ein Investor noch dazu würde natürlich nicht schlecht sein. Ja, genau so würde meine Welt in weniger als zehn Tagen aussehen. Gut, noch fehlte mir die passende Immobilie. Na ja, ich konnte ja noch ein wenig bei meinen Eltern bleiben.
Ich träumte mit halboffenen Augen, als sich Worte flüsternd einen Weg durch meine Bilder bahnten. Was, wenn du es nicht schaffst? Ärgerlich schob ich den Gedanken beiseite, ich und Fly waren besser als Thomas und Dumont. Vor allem, da sich Thomas während der letzten Wochen nicht dazu herabgelassen hatte, sein Turnierpferd zu reiten. Ein Fuchs huschte über den Weg. Fly machte einen Satz rückwärts, brachte mich aus dem Gleichgewicht. Mein Herz raste, ich sprang ab, tastete vorsichtig die Beine von Fly ab. Alles in Ordnung. Das fehlte mir noch, eine Verletzung kurz vor der Abfahrt zum Turnier.
Ich sah zum dunklen Himmel hoch, wie spät mochte es sein? Papa reißt mir den Kopf ab, dachte ich, und dazu hatte er jedes Recht. In der Dunkelheit mit Fly, der in den nächsten Tagen Höchstleistung zeigen musste, durch einen Wald zu reiten. Ich stieg wieder auf. Es war dort oben sicherer, als im Dunkeln über den Weg zu stolpern. Zehn Minuten später öffnete sich der Wald. Vor mir breitete sich der Hof der Sanders aus.
Der Stall, die Reithalle, der Springplatz, das kleine Gutshaus, in dem ich mit meinen Eltern wohnte. Ich atmete erleichtert auf, wir waren heil angekommen, dank der Instinkte meines Pferdes. Wieso auch nicht, dachte ich aufmüpfig und zuckte mit den Achseln.
Früher hatte ich mir über mögliche Verletzungen nie Gedanken gemacht. Das war vor der Zeit des großen Turniersports gewesen. Vor dem ganzen Druck, der dazu geführt hatte, dass ich mich heute mit Papa gestritten hatte. Seine Kritik an meinen Sprüngen mit Fly ärgerte mich maßlos. Natürlich wusste ich, dass es an mir lag. Ohne ihm ein Wort zu gönnen, war ich über den Zaun vom Platz gesprungen und mit Fly in den Wald galoppiert.
Jetzt lenkte ich Fly sanft auf den Stall zu, löste meine Beine aus den Steigbügeln, ließ sie baumeln. Die Muskeln schmerzten von dem langen Ausritt. Ich war ja den ganzen Tag bereits im Sattel gewesen und hatte die Jungpferde trainiert. Sie alle würden die nächsten Tage auf der Weide verbringen. Fly griff freudig aus, um die letzten paar Meter zum Stall zu überwinden, und ich ließ ihn gewähren.
Abrupt unterbrach Flying High seine Schritte, kurz vor den Paddocks, die die Boxen der Pferde um einen Auslauf erweiterten. Alle vier Beine in den Boden stemmend, verharrte er auf der Stelle, sodass ich von dem unerwarteten Stillstand nach vorne rutschte. Nur der aufgerichtete Hals des Pferdes verhinderte, dass ich auf dem Boden landete. Die Ohren wachsam nach vorne gerichtet, die Muskeln unter mir gespannt, starrte er vor sich auf die kleine Baumgruppe, die sich an das erste Paddock anlehnte. Ich wusste, dass Duke, der kleine Bruder von Fly, wie jede Nacht statt in seiner Box im Paddock stand. Ich ahnte seine Gestalt in der Dunkelheit mehr, als dass ich sie sah. Aber das konnte nicht der Grund sein, weshalb Fly so beunruhigt war. Die Anspannung von Fly übertrug sich auf mich. Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug. Eine Gestalt löste sich aus dem Schatten. Flying High machte einen Satz zur Seite und brachte mich erneut aus dem Gleichwicht. Ich geriet in eine gefährliche seitliche Rutschlage, krallte mich schnell in seiner Mähne fest und zog mich langsam wieder in den Sattel.
„Sachte, mein Süßer, ganz sachte, wir brauchen beide heile Knochen“, sprach ich beruhigend auf ihn ein. Angespannt und jede Sekunde bereit, vor der Gefahr wegzugaloppieren, verharrte er. Ich kraulte seinen Mähnenkamm, murmelte weiter beruhigende Worte in sein Ohr. Die Gestalt blieb regungslos stehen und wartete ab. Fly beruhigte sich, ich konnte spüren, wie sich sein Körper entspannte. Unser beider Herzschlag verlangsamte sich. Jetzt konnte ich es wagen, mich aus dem Sattel gleiten zu lassen. Die Zügel behielt ich fest in der Hand aus Sorge, er könnte doch noch eine Kehrtwendung vollziehen und vor der vermeintlichen Gefahr flüchten. Wütend wendete ich mich der Gestalt zu. Mein Vater konnte es nicht sein, er wäre niemals aus den Bäumen getreten und hätte riskiert, dass Fly durchging. Wer immer es war, von Pferden hatte er keine Ahnung.
„Tut mir leid, ich wollte euch nicht erschrecken“, flüsterte es mir leise entgegen.
„Bist du völlig übergeschnappt, hier draußen unter den Bäumen zu stehen? So viel Pferdeverstand müsstest selbst du haben.“ Ärgerlich schlug ich Henning vor die Brust. „Mann, du hast uns fast zu Tode erschreckt. Was suchst du hier überhaupt?“
„Ich habe auf dich gewartet, tut mir leid, ehrlich. Ich habe einfach nicht darüber nachgedacht“, beteuerte Henning. Er streckte Fly seine Hand hin, der keinen Schritt näher kam, dafür den Hals streckte und vorsichtig an seiner Hand roch. Ich kraulte die Stirn des Pferdes, mein Ärger wich langsam der Neugier, warum Henning hier in der Dunkelheit auf mich wartete. Bei meinen Eltern im Haus wäre er garantiert mit Essen und Trinken versorgt worden. Überhaupt hatte er gar nicht wissen können, wann ich nach Hause kam, schließlich war es kein geplanter Ausritt gewesen.
Henning zog die Hand von Fly zurück und beobachtete mich. Ich drehte mich zu ihm um. Er hatte die Hände in der Hose vergraben, die Schultern eingezogen, ich musste zu ihm aufblicken, da er ein Stück größer war als ich. Er sah so schuldbewusst aus, dass ich mir ein Grinsen nun doch nicht verkneifen konnte. Typisch dieser Hundeblick, mit dem er immer alles erreicht hatte, während ich trotzig reagierte, wenn man mich bei einer Missetat erwischte. Erleichterung machte sich in seinem Gesicht breit.
„Wieso wartest du hier draußen auf mich?“
„Tja, vielleicht könntest du selber darauf kommen. Bei euch ist gerade keine gute Stimmung. Der wollte ich mich freiwillig nicht aussetzen. Ich war erst im Stall, bis mich dieser kleine Kerl“, er zeigte auf Duke im Paddock, „rausgelockt hat. Ich glaube, er hat gespürt, dass ihr kommt.“
Puh, mein Vater, den hatte ich völlig vergessen. „War er verärgert oder sauer?“
Henning zuckte mit den Schultern. „Das lässt sich bei deinem Vater schwer einschätzen. Aber wenn ich es mir recht überlege, doch, ja, er war richtig sauer.“ Er grinste breit, vermutlich weil er sich vorstellte, was mich zu Hause erwartete.
Papas Vorwürfen würde ich nichts entgegensetzen können, denn er hatte recht: Ich war in meiner Wut leichtsinnig gewesen. Im Grunde genommen hatte ich genauso wenig Pferdeverstand gezeigt wie Henning gerade. Ich zog sachte an den Zügeln und ging mit Fly zum Stall, meine Neugier war verflogen. Stattdessen überlegte ich, was ich Papa sagen sollte. Tut mir leid, ich bin total durcheinander, weil ich mit Thomas geschlafen habe und er, seitdem kein Wort mehr mit mir redet? Einen Herzinfarkt würde er kriegen, und Mama gleich mit. So ein verfluchter Mist! Besser, er regte sich über meinen mangelnden Pferdeverstand auf.
Ich öffnete die Tür der Box, streifte die Trense von Flys Kopf und ließ ihn das Gebiss ausspucken. Kaum war es raus, macht er sich über das Kraftfutter her. Henning war mir in den Stall gefolgt. Er blieb vor der Box stehen und sah Fly beim Fressen zu. Ich holte ein Handtuch sowie einen Hufkratzer aus der Sattelkammer. Fly ließ es sich gefallen, dass ich ihn mit dem Handtuch abrieb. Gelegentlich zuckte er unruhig mit den Ohren oder schlug mit dem Schweif. Mit gebührender Vorsicht kratzte ich ihm die Hufe aus und achtete auf jedes noch so kleine Steinchen. Er mochte das nicht beim Fressen, doch ich war müde und wollte ins Bett. Das rechte Vordereisen gab leicht nach, als ich den Huf auskratzte. Ich rüttelte dran, es blieb fest am Huf. Vermutlich nur Einbildung. Aber ich würde es in den nächsten Tagen im Auge behalten.
„Morgen geht’s los, euer großer Tag.“
Ich zuckte zusammen. Völlig in Gedanken versunken hatte ich tatsächlich vergessen, dass Henning an der Boxentür stand.
„Wie meinst du das?“ Selbst in meinen Ohren klang meine Stimme barsch und abweisend. Es war unfair, Henning konnte nichts für meinen Ärger. Mit einem schiefen Grinsen versuchte ich ihn entschuldigend anzusehen. Seine braunen Augen fingen meinen Blick auf und hielten ihn fest. Schnell wandte ich mich ab, seine Augen waren so lebendig. Manchmal schien es mir, als ob er allein mit ihnen alles erzählen konnte, was er dachte oder fühlte. Wenn er mich so intensiv ansah, dann ging es mir mit ihm wie mit den Pferden. Ich sah in die Augen hinein, verschwand in den Tiefen des Brauns, und unten angekommen sah ich mich wie in einem Spiegel selbst.
„Na ja, wenn du auf dem Turnier den ersten Platz machst, gehört Flying High dir.“
Ich lehnte meine Stirn an den warmen Pferdehals, schloss die Augen. Tiefe Ruhe kehrte in mir ein, ich spürte ein Lächeln auf meinen Lippen. „Das weißt du noch?“
„Ich war damals dabei, falls du dich nicht mehr erinnerst“, antwortete er ernst.
Ich schüttelte den Kopf. Als ob ich diesen Abend jemals vergessen konnte. Den Abend, an dem ich, die kleine sechzehnjährige Vera Kamphoven, dem großen Erich Sander die Stirn bot. Dieser Abend war eingebrannt in meinem Gedächtnis. Der Tag von Flying Highs Geburt.
Es war Liebe auf den ersten Blick gewesen. Nein, wenn ich ehrlich war, liebte ich ihn bereits, seit ich wusste, dass Nobless sich heimlich in der Nacht auf und davon gemacht hatte, um sich selbst einen Hengst für ihr nächstes Fohlen auszusuchen. Es gab sonst auf dem Hof der Sanders, den mein Vater führte, nur sorgsam geplante Fortpflanzungen. Und nun so etwas. Wie ein Wunder war es mir erschienen. Gemeinsam mit Papa hatte ich die ersten Aufstehversuche von dem kleinen Wesen beobachtet. Ich erinnerte mich genau an das Fohlen beim ersten Trinken – und wie Papa es mit traurigem Blick angesehen hatte. „Schade, dass es weg muss. Schau mal, wie frech er auf seinen wackligen Beinen Nobless anstupst. Ein wackerer kleiner Bursche, der weiß, was er will.“
„Wieso weg?“, hatte ich ihn erstaunt gefragt. Schließlich bildeten wir, mit wenigen Ausnahmen, den Nachwuchs auf dem Hof selber aus, und erst dann verkauften wir ihn. Meist zu einem sehr guten Preis, denn Papas Züchtungen waren begehrt unter den Turnierreitern. Papa hatte nur mit den Schultern gezuckt.
„Das ist eine Entscheidung von Erich. Er möchte kein Pferd großziehen von einem Hengst, der keine Turniererfolge in seinem Lebenslauf aufweist. Das lohnt sich finanziell nicht.“
„Aber der Hengst hat doch Papiere und wir haben ihn uns angesehen. Ein wenig kurz im Rücken, aber dafür macht er einen charakterstarken Eindruck.“
Er hatte mir lachend meine Haarsträhne, die sich ständig aus meinem Pferdschwanz löste, hinter mein Ohr gesteckt.
„Vera, du solltest langsam wissen, dass ein guter Körperbau, starke Beine und gute Gelenke am wichtigsten für ein Springpferd sind. Erst dann kommt der Charakter. Und der Körperbau von Regent entspricht nun mal nicht diesem Ideal. Hänge dein Herz lieber nicht an diesen kleinen Burschen.“
Oh, wie gut mich Papa kannte, doch mein Entschluss war bereits gereift. Ich würde das Fohlen kaufen und ausbilden. War ich nicht letztlich dafür verantwortlich, dass es ihn gab? Ich war mit Nobless an der Koppel von Regent vorbeigeritten. Woraufhin die Stute in der Nacht ausgebrochen und in die Koppel von dem Hengst gesprungen war. Ja genau, es war Schicksal. Ich und dieses Fohlen gehörten zusammen.
Als Mama und Papa in der Küche saßen, machte ich mich durch den Regen auf den Weg zum Anwesen der Sanders. Leise schlüpfte ich über die Hintertür durch die Küche in das Haus. Mathilda, die Köchin, bemerkte mich nicht. Sie sang ein Lied im Radio mit. Ich kannte mich bestens in dem Haus aus. Schließlich hatte ich viel Zeit dort mit meiner Mama verbracht, als ich noch klein war.
Ich folgte den leisen Stimmen. Erst als ich die Tür zum Wohnzimmer öffnete und ein Blick auf die fein gekleidete Abendgesellschaft warf, rutschte mir das Herz in die Hose. Ich hätte mir einen besseren Zeitpunkt für mein Anliegen aussuchen müssen, spürte ich. Aber ich blieb, denn ich hatte Angst, dass ich nie wieder den Mut für mein Vorhaben aufbringen würde. Nass wie ich war vom Regen bildete sich ein feuchter Fleck auf dem Parkett, wo ich stehen geblieben war. Erich Sanders Blick richtete sich abschätzig auf mich. Er musterte mich von oben bis unten, und einen Moment befürchtete ich, dass er mich wie eine nasse Katze mit einem Tritt aus dem Haus befördern würde.
In dem Raum war es absolut still, bis seine leise tiefe Stimme sie durchbrach. Er hatte eine faszinierende Stimme, wohltemperiert und klangvoll. „Was ist passiert, Mädchen?“ Er nannte mich nie bei meinem Namen. Warum sollte er sich auch den Namen von den Kindern seiner zahlreichen Angestellten merken. Ich unterdrückte meine Angst, hob trotzig das Kinn und sah Erich Sander fest in die Augen.
„Ich möchte Flying High kaufen. Ich biete ihnen dafür 3000 Euro.“ Einen Moment sah mich Erich irritiert an, dann lachte er los. Tränen der Wut füllten meine Augen und ich ballte die Fäuste.
„Sprichst du von dem Fohlen, das Nobless heute geboren hat? Ich wusste noch gar nicht, dass es einen Namen hat.“
„Den habe ich ihm gegeben.“ Ich schob mein Kinn ein wenig weiter vor.
„Flying High, soso, ist es nicht ein bisschen früh für so einen Namen?“
Ich schüttelte den Kopf. „Nein, er wird mal Olympiasieger.“ Die Worte rutschten mir aus dem Mund, bevor ich wusste, was ich sagte. Es klang selbst in meinen Ohren kindisch. Diesmal lachte die ganze feine Abendgesellschaft zusammen mit Erich Sander. Ich blieb tapfer und verkniff mir die Tränen. Stattdessen hob ich den Kopf ein Stück höher und versuchte, ihm weiter ins Gesicht zu sehen. Sollte er doch ruhig lachen. Ich würde es ihm schon beweisen, dass in Fly das talentierteste Pferd steckte, welches je auf diesem Hof geboren worden war. Meine selbstbewusste Haltung brachte den alten Herrn aus seinem Konzept. Er spürte, dass es mir ernst war, und das schien ihn, zu meinem Ärger, noch mehr zu amüsieren.
„Ist es in diesem Fall nicht etwas wenig Geld, was du mir anbietest, wenn es einmal Olympiasieger wird? Überhaupt, Mädchen, woher hast du so viel Geld?“
Darauf hatte ich gewartet. Ich zog mein Sparbuch aus der Hosentasche. Es war ebenfalls nass geworden. Ich ging die fünf Schritte zu seinem Tisch und reichte es Erich Sander. Er nahm es an, öffnete es aber nicht. Auf dem Sparbuch war alles, was ich jemals gespart hatte. Mein ganzes Taschengeld und das Geld, das meine Großeltern mir zum Geburtstag oder bei einem Besuch schenkten. Scheine, die mir ab und zu die Käufer der Pferde zusteckten, damit ich es in den Hänger brachte. Nicht zu vergessen die Trinkgelder, wenn ich meiner Mutter beim Servieren auf einem Fest der Sanders half.
„Ich finde, das ist ein gutes Angebot. Schließlich ist er ein Fohlen und hat keine Ausbildung. Ein Händler bezahlt Ihnen auf keinen Fall mehr.“ Ja, das wusste ich von meinem Papa. Ich ignorierte, dass es durchaus Käufer gab, die für ein Fohlen vom Sanderhof gerne mehr bezahlen würden.
Meine Worte waren gut gewählt, das konnte ich Erich Sander ansehen. Das Lächeln verschwand aus seinem Gesicht. Er schob seinen Stuhl zurück und stand langsam auf, mein Sparbuch in der Hand. Wie groß er war. Er betrachtete das Buch in seiner Hand, dann schlug er es unter einigen Schwierigkeiten auf, denn die feuchten Seiten ließen sich nicht so leicht trennen. Er prüfte den Betrag, dann reichte er mir das Buch zurück. Seine grauen Augen bohrten sich in meine, die Geräusche um mich herum waren verschwunden, sein Blick hielt mich gefangen. Wir sahen uns an. Es schien, als würde er in die Tiefe meiner Seele blicken und nach einer Antwort suchen auf eine Frage, die er mir nicht stellte.
„Tut mir leid, Mädchen, das Fohlen ist nicht zu verkaufen.“
Eine Lüge. Das war eine glatte Lüge. In mir brodelten die Worte bereits hoch, doch ich blieb stumm, als er die Hand hob.
„Aber ich mache dir einen Vorschlag. Du gibst mir die 3000 Euro, dafür finanziere ich die ersten zwei Jahre. Du kommst für das Futter und die Ausbildung der nächsten Jahre auf. Dann kann es hier bleiben.“
„Pah, und was hab ich davon?“, fauchte ich ihn an.
„Du kannst beweisen, dass du recht hast“, erwiderte er gelassen.
„Und dafür bekommen Sie das Geld?“
Erich Sander verzog den Mund. Es sollte ein Lächeln sein, doch es erreichte seine Augen nicht.
„Ich dachte, du wärst dir so sicher? Dann muss dir das Fohlen doch so viel wert sein.“
„Aber wenn er so gut ist, dann verdienen Sie hundert Mal mehr durch die Preisgelder.“
Erich Sander ging einen Schritt auf mich zu. Er stand dicht vor mir. Ich musste meinen Kopf in den Nacken legen, um den Augenkontakt zu halten. Ich blieb stehen, zitternd, aber ich wich nicht zurück.
„Wenn du den ersten Platz im Springen beim Großen Preis von Aachen machst, bevor das Pferd neun Jahre wird, dann gehört es dir.“ Warum er sich zu der Aussage hinreißen ließ, ich wusste es bis heute nicht. Doch ich ergriff ohne zu zögern die Gelegenheit und hielt ihm wortlos die Hand hin. So wie es mein Vater machte, wenn er eine Abmachung mit einem Käufer traf. Einen Moment sah Erich Sander auf meine Hand, dann ergriff er sie. Seine Hand war groß, stark und kraftvoll. Ich drückte mit aller Kraft zurück.
„Abgemacht, und jetzt sieh zu, junges Fräulein, dass du nach Hause kommst, bevor du mein Parkett ruinierst.“ Damit wandte er mir den Rücken zu.
Ich rannte die ganze Strecke zurück nach Hause. Getragen von dem Sieg, den ich errungen hatte. Vor meinem geistigen Auge sah ich bereits den Pokal. Und mein eigenes Pferd, Flying High. Das Donnerwetter meiner Eltern, als ich zu Hause eintraf, und das Fieber am nächsten Tag ertrug ich mit Leichtigkeit.
„Ich fand dich damals beeindruckend. Wie ein nasser Pudel standest du da und hast mit Erich verhandelt“, nahm Henning den Faden wieder auf. Er nannte seinen Vater immer beim Vornamen. Ich konnte es verstehen. Einen Mann wie Erich Sander mit Papa anzusprechen, hätte ich mir im Traum nicht vorstellen können.
Ich war fertig mit Fly. Meine Finger streichelten ein letztes Mal seinen Hals, dann kam ich aus der Box, verriegelte die Tür und gesellte mich zu Henning. Wir hörten dem Mahlen der Zähne zu, die Korn für Korn das Futter verkleinerten. Fly ließ sich Zeit beim Fressen.
„Erst mal müssen wir gewinnen.“ Ich sprach aus, was ich den ganzen Abend zu ignorieren versucht hatte. Wieder schlich sich die Angst der letzten Tage in mein Herz.
„Du zweifelst nicht ernsthaft daran, oder?“ Er musterte mich von der Seite. Ich vermied seinen Blick. „Ihr habt bei fast jedem Turnier den ersten Platz gemacht. Weißt du eigentlich, wie viel Stress Thomas deshalb mit Erich hat?“ Seine Stimme klang amüsiert. Die Brüder verstanden sich nicht besonders gut, sie waren zu unterschiedlich. Ich biss mir auf die Lippen und schüttelte den Kopf. War das der Grund für Thomas’ Schweigen? Weil er wegen mir Stress mit Erich hatte? Lag es gar nicht daran, dass er es bereute, mit mir geschlafen zu haben? Fehlte ihm der Mut, zu mir zu stehen? Auch ich hatte meinen Eltern gegenüber kein Wort darüber verloren, was in der Nacht des Wohltätigkeitsballs passiert war. Ich war genauso feige wie er. Henning wartete darauf, dass ich redete.
„Es kommt auf viele Dinge bei einem Turnier an“, beendete ich mein Schweigen. Was würde Henning dazu sagen, dass ich mit Thomas geschlafen hatte? Ein Schauer lief über meinen Körper. Henning zog seine Jacke aus und legte sie mir um, seine Hände blieben einen Moment auf meinen Schultern liegen. Die Jacke war warm von seinem Körper. Ein bisschen fühlte ich mich geborgen, wie immer, wenn er den großen Bruder spielte.
„Du machst dir wirklich Gedanken?“ Er ließ nicht locker. Ich zuckte nur mit den Achseln. „Was ist mit deinem Traum?“, forschte er nach und stupste mich sanft am Arm. „Dein Haus in den Bergen mit dem Stall und einem Bach?“ Seine Worte lockten ein Lächeln auf mein Gesicht. Er kannte mich so gut wie niemand sonst auf der Welt, außer vielleicht Papa. Ja, es wurde Zeit, dass ich meine Flügel ausbreitete und woanders hinflog.
„Du hast mir immer noch nicht gesagt, warum du hier bist“, kehrte ich den Spieß mit der Ausfragerei um.
„Ich wollte euch beiden viel Erfolg für das Turnier wünschen.“ Erstaunt sah ich ihn an. Immerhin war er ein Sander und musste zu seiner Familie halten. Sein Blick war ehrlich.
„Und deshalb wartest du im Dunkeln seit…“, ich zuckte die Achseln, da ich keine Ahnung hatte, seit wann er auf mich wartete.
„Seit über einer Stunde.“
„Was um alles in der Welt hast du in der Zeit hier gemacht?“
„Nachgedacht und mich mit diesem kleinen Kerl da vorne befreundet.“ Mit dem Kopf nickte er zu der ersten Box, die zu dem Paddock gehörte auf dem Duke stand. „Übrigens, ein hübsches, freundliches Pferd, nicht so wie Fly.“
Ich lachte. „Ach nein? Er hat aber die gleichen Eltern.“
„Ehrlich? Na, dann hat er die besseren Eigenschaften von seinen Eltern abbekommen.“
Ich verzog das Gesicht. Henning und Fly mochten sich nicht besonders. Warum, war mir schleierhaft, denn es hatte eine Zeit gegeben, wo sich Henning sehr um die Freundschaft mit dem Pferd bemühte. Seine indirekte Kritik an Fly verletzte mich. Feinfühlig bemerkte Henning meinen Stimmungswechsel.
„Sei nicht böse, dass ich das jetzt gesagt habe.“
„Doch, ein bisschen schon.“ Ich wollte ehrlich sein.
„Es gibt noch einen Grund, weshalb ich mit dir sprechen wollte.“
Seine Stimme war ernst. Ich musterte ihn von der Seite.
„Brauchst du noch einen Investor für dein Projekt?“ Er grinste mich spitzbübisch an.
Viel hätte ich mir vorstellen können, das nicht. Er hatte mich überrumpelt. „Das würdest du riskieren? Du willst in meinen eigenen Zucht- und Ausbildungsstall investieren?“ Aufmerksam betrachtete ich sein Gesicht, suchte nach einem Anzeichen von Spott. Doch ich konnte keinen Spott finden, seine Augen waren vertrauensvoll auf mich gerichtet.
„Ja, Vera, jederzeit. Ich glaube an das, was du vorhast. Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der so zielstrebig seine Träume verwirklicht wie du. Der harte Arbeit nicht scheut und der, nicht zu vergessen, eine Menge Talent hat.“
Zum ersten Mal in den letzten Tagen fühlte ich, wie so etwas wie Zuversicht in mir aufstieg.
„So, das Lächeln gefällt uns viel besser, nicht wahr, Fly?“, fragte er den Hengst, der den Kopf erhoben hatte und aufmerksam unserem Gespräch zu lauschen schien. Fly nickte mit dem Kopf, als hätte er die Frage von Henning verstanden. Wir lachten. Was für eine Seltenheit, Henning und Fly waren einer Meinung. Freundschaftlich knuffte ich Henning in seinen Arm.
„Siehst du, er mag dich. Bist du auf dem Turnier?“
„Nein, Selina und ich fliegen morgen nach Kanada. Noch ein Grund, weshalb ich heute so lange ausgeharrt habe, um auf dich zu warten.“
Wir schwiegen. Ich war traurig, die Vorstellung, dass Henning beim Turnier dabei gewesen wäre, sich für mich freute, mir den Rücken stärkte, hätte mir gefallen. Aber was für ein unsinniger Gedanke, dass er nach all den Jahren ausgerechnet für mich da sein sollte. Ich biss die Zähne aufeinander. In letzter Zeit hatte ich ganz schön nah am Wasser gebaut. Bloß nicht heulen, dachte ich, auf keinen Fall heulen. Doch da suchte sich bereits eine Träne einen Weg über meine Wange. Ich schämte mich und wollte sie heimlich mit dem Ärmel wegwischen. Henning hatte sie bereits bemerkt, behutsam fasste er mich an den Schultern. Seine Hände zuckten kurz zurück, als er mich berührte. Vermutlich war er keine Muskelpakete gewohnt, sondern eher schmale Schultern. Er zögerte, griff erneut zu, diesmal fester, und drehte mich zu sich herum. Mit seinem Finger wischte er mir die Träne von der Wange.
„Was ist los, Vera? Stefan hat auch schon gesagt, dass du im Moment ganz durcheinander bist. Bedrückt dich etwas?“
Ich schüttelte den Kopf, befreite mich von seinen Händen. Ihm konnte ich am allerwenigsten erzählen, was mich beschäftigte.
„Ich bin immer noch dein Freund.“ Er zögerte kurz. „Okay wohl eher Brieffreund. Es tut mir leid, dass ich mich in den letzten Jahren nicht mehr hab sehen lassen. Ich glaube, ich brauchte einfach etwas Abstand von all dem hier.“ Ich spürte in seinen Worten die alte Vertrautheit zwischen uns. Außerdem verstand ich zum ersten Mal, was er meinte.
„Ich glaube, ich habe furchtbar Angst, etwas falsch zu machen“, rutschte es mir raus.
Es dauerte eine Weile, bis er antwortete. „Das kann ich sehr gut verstehen.“ Konnte er das wirklich? Konnte ein Henning Sander verstehen, wie sich eine Vera Kamphoven fühlte? Ich schüttelte den Kopf. „Nein, kannst du nicht.“
„Warum nicht? Ich habe in meinem Leben schon viele Fehler gemacht, mehr als du.“
„Das ist etwas anderes.“
„Inwiefern? Erkläre es mir.“
„Wenn ich morgen nicht gewinne, verliere ich alles.“
„Darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Du verlierst nicht.“
„Und wenn doch?“
„Dann kaufst du Fly und verwirklichst deinen Traum.“
„Ich wusste, du verstehst es nicht.“
„Warum, weil ich der Sohn von reichen Eltern bin und du die Tochter unserer Angestellten?“ Er verdrehte die Augen. „Manchmal bist du wirklich etwas kompliziert. Ich habe dir doch gesagt, ich gebe dir das Geld, was immer du brauchst, damit du deine Träume verwirklichen kannst.“
„Und woher kommt das?“
„Ah, daher weht der Wind. Es ist meines. Schon seit unserer Geburt besitzen Thomas und ich Anteile an der Firma. Die Dividende ist gut, da kommt was zusammen. Bisher habe ich davon nichts gebraucht.“
Ich schüttelte den Kopf. Aus Hennings Perspektive sah die Welt leicht und einfach aus. Er trennte zwischen sich und dem Rest der Familie. Ich nicht, er war ein Sander, und es kam nicht infrage, dass ich mir für den Kauf von Fly von ihm Geld leihen würde. Eine Diskussion über unsere verschiedenen Standpunkte machte keinen Sinn. Er würde es nicht verstehen. Also wechselte ich das Thema.
„Wann heiratest du deine Selina? Darf ich Brautjungfer sein?“ Er schwieg. Ich sah, wie sich sein Körper anspannte. Verwirrt musterte ich ihn von der Seite, da mir nicht bewusst war, dass ich etwas Falsches gesagt hatte. Ich versuchte einen Scherz, als mir sein Schweigen zu lange dauerte.
„Oder besser nicht, sonst kommt noch jemand auf die Idee, ich wäre das hässliche Entlein neben dem Schwan.“
Er ging nicht darauf ein. Die Stirn in tiefen Falten sah er Fly an. Das Pferd hörte mit dem Kauen auf, fixierte ihn. Es erstaunte mich, das Fly heute so feinfühlig auf die Stimmungsschwankungen von Henning reagierte. Ich boxte ihn vor die Brust. „Hey, du bekommst doch jetzt keine kalten Füße bei der Frau?“
Ein schiefes Grinsen erschien auf seinem Gesicht. „Sie gefällt dir?“
Ich nickte. „Klar, wäre ich ein Mann, würde ich sie dir ausspannen“, versuchte ich noch einen Scherz, der in einem neuen Schweigen verebbte.
„Sie ist doch nicht lesbisch?“
Ein scharfer Blick aus seinen Augen traf mich.
„Nein, ganz bestimmt nicht.“ Der Unterton in seiner Stimme klang seltsam in meinen Ohren. Zumal ich ja nur witzig hatte sein wollen. War er unsicher, was ihre Gefühle für ihn betrafen?
„Sie liebt dich“, flüsterte ich mit sanfter Stimme, die ich benutzte, um Fly zu beruhigen.
„Tatsächlich? Woher willst du das wissen? Du hast sie nur einmal mit mir gesehen.“ Seine Augen durchbohrten mich.
Ich zuckte mit den Achseln. Im Grunde hatte ich es nur so dahergesagt. Das ganze Gespräch wurde mir zu ernst. „Genug geplaudert. Morgen wartet ein anstrengender Tag auf mich, und du musst einen Flieger nach Kanada bekommen.“
Ich fühlte mich stark, voller Zuversicht. Nach dem Turnier würde ich mich der Sache mit Thomas stellen. Ich musste mir erst über meine eigenen Gefühle klar werden, bevor ich diesen Schritt wagen konnte, und im Moment war es wichtiger, dass ich mich auf mein Ziel konzentrierte. Dank Henning sah ich mein Ziel wieder klar vor Augen. Ich brauchte nur noch zu gewinnen. Ich wusste, Henning würde mich niemals im Stich lassen, er würde mir mit Geld dann weiterhelfen. Egal, wie sehr sich sein Vater darüber aufregen würde. Im Gegensatz zu Thomas scheute er die Konfrontation mit seinem Vater nicht.
Ich gab Henning seine Jacke zurück und ging zur Stalltür. Er folgte mir. Ich knipste das Licht aus und verriegelte die Tür. Als ich mich umdrehte, zog mich Henning in seine Arme und drückte mich fest an sich. Völlig überrumpelt von seinem plötzlichen Gefühlsausbruch, verharrte ich in seiner Umarmung.
„Ich weiß, ihr beiden schafft das, aber tu mir bitte einen Gefallen, pass auf dich und Fly auf, versprichst du mir das?“, flüsterte er in mein Ohr.
„Wie meinst du das?“ Ich wusste nicht, woran ich mit Henning und seinen Stimmungsschwankungen war. Das war doch immer mein Part in unserer Freundschaft gewesen. Gleichzeitig fühlte ich wieder die Angst aus einer der hintersten Ecken meines Herzens hervorkriechen.
„Wir Sanders verlieren nicht gerne.“ Seine Stimme war ganz rau.
„Nun, dann werdet ihr das wohl lernen müssen“, erwiderte ich mit fester Stimme. Der Angst wollte ich heute Abend keine Nahrung mehr geben. Ich befreite mich aus seiner Umarmung.
„Tut mir leid, ich wollte dich nicht so überfallen“, entschuldigte er sich.
„Ist okay. Ich glaube, wir sind beide heute nicht ganz wir selbst. Ich geh jetzt besser. Papa hat bestimmt schon gesehen, dass ich zurück bin. Je länger ich warte, desto wütender wird er.“
Ich hob die Hand kurz zum Gruß und drehte mich um.
„Vera?“, bremste er mich.
„Ja“, wandte ich mich ungeduldig noch einmal um. Inzwischen war es vollkommen dunkel. Ich konnte gerade noch seine Umrisse an der Stalltür sehen. Er hüllte sich wieder in Schweigen.
„Henning, du bist heute echt komisch.“ Ich schüttelte den Kopf, wandte mich ab und ließ ihn stehen. Mutig ging ich auf unser Haus zu meinem Vater entgegen.
2
Kapitel
Ich kam als letzte Reiterin auf den Springplatz. Drei Reiter ohne Fehler, sie waren damit bereits im Stechen. Ein Stechen, in dem neben den Abwürfen die Zeit entscheiden würde. Davor lag ein Parcours, den ich ohne Fehler absolvieren musste. Ich parierte Fly durch, der sofort stillstand, und in diesem Moment fiel jede Nervosität von mir ab. Seine Ruhe, seine Gelassenheit, ja die Freude, die er in den letzten Tagen am Springen gezeigt hatte, flossen durch meinen Körper und gaben mir Sicherheit. Natürlich trugen dazu auch meine Erfolge in den letzten Tagen bei, der vierte Platz beim Stawag-Preis, ein zweiter Platz beim Warsteiner-Preis und der erste Platz beim RWE-Preis. Bereits beim ersten Umlauf im Großen Preis von Aachen waren wir nur so über die Hindernisse geflogen. Meine Aufgabe in dieser Runde würde darin bestehen, Fly die richtige Reihenfolge zu zeigen und ihn zu bremsen, denn noch war die Zeit nicht wichtig und ich wollte mir auf keinen Fall einen Flüchtigkeitsfehler erlauben. Mit einem Lächeln auf meinen Lippen hob ich die Hand zum Richtergruß an die Kappe, der Startgong ertönte.
Fly reichte es, dass ich mein Gewicht nach vorne verlagerte, er sprang in den Galopp, ich lenkte ihn auf das erste Hindernis zu. Ein Steilsprung, und schon waren wir drüber. Mit Fly zu springen, glich für mich dem Gefühl zu fliegen. Unsere Körper waren eins. Er bewegte sich mit großer Leichtigkeit über die Hindernisse und federte jeden Sprung über seine Gelenke ab. Ich lächelte, als wir die Kombination mit den drei Hindernissen übersprangen. Ein leises Raunen ging durch die Zuschauermenge. Fly spielte kurz mit den Ohren, und fast wäre uns ein Fehler passiert. Ich legte kurz meine Hand auf seinen Hals. Ein Weitsprung, ein Steilsprung und der letzte Sprung, dann waren wir durch.
„Null Fehler für Vera Kamphoven auf Flying High. Damit stehen die vier Teilnehmer für das Stechen fest.“ Der Beifall der tobenden Zuschauer legte sich über die Stimme des Stadionsprechers. Menschen sprangen von ihren Plätzen, winkten mir zu und pfiffen. Fly galoppierte buckelnd zum Ausgang, sodass ich Mühe hatte, auf ihm zu bleiben. Ich winkte grüßend in den Zuschauerraum.
So war es die ganzen letzten Tage gewesen. Wir beide ritten auf einer Welle der Sympathie, und Fly genoss jede Sekunde. Was er nicht leiden konnte, war, wenn ihn jemand von den Besuchern streicheln wollte. Ich lenkte Fly zum Ausgang, dort standen Mama und Papa, beide strahlten.
„Ihr habt es geschafft“, sagte Stefan, „ihr seid im Stechen.“
Ich sprang von Fly und klopfte ihm den Hals. „Kannst du ihn nehmen, ich muss mal ganz dringend.“
Papa nahm die Zügel, und ich rannte zu den Toiletten für die Reiter. Aachen war in vieler Hinsicht ein besonderes Turnier. Es gab so viele Menschen aus verschiedenen Nationen und mit unterschiedlicher Herkunft, die sich hier tummelten. Es fanden sich Leute in eleganten und teuren Markenklamotten genauso wie welche in Shorts und T-Shirts aus irgendwelchen Billigläden. Manch einer kam sogar, um zu shoppen. Ja, es gab eine regelrechte Einkaufsmeile, bestehend aus Zelten, mit Geschäften, die alles Mögliche anboten. Nicht jeder der anwesenden Besucher interessierte sich für Pferde. Manch einer kam, um gesehen zu werden. Natürlich waren auch die Vertreter von den Sponsoren anwesend, zusammen mit wichtigen Kunden. Darunter befanden sich auch die Sanders. Um das VIP-Zelt machte ich aus diesem Grund einen großen Bogen, obwohl ich als Reiterin durchaus Zutritt dazu hatte. Na ja, vielleicht nicht zu allen Bereichen. Das Medieninteresse bei diesem Turnier war besonders groß. In dem letzten Jahr war es eine richtige Plage für mich geworden. Es lag mir nicht, im Rampenlicht zu stehen. Sobald mir jemand ein Mikrofon unter die Nase hielt, trocknete mir der Mund aus und meine Stimme überschlug sich vor lauter Nervosität.
Den ganzen Vormittag über war es heiß gewesen. Am Nachmittag war es dann kühler geworden und es war Wind aufgekommen. Um die Essstände hatten sich dichte Trauben gebildet. Bei den Würstchenbuden trafen sich die normalen Menschen, wie ich es empfand. Während man bei den Buden mit exquisiteren Essen die feinere Gesellschaft fand. Auch um diese Bereiche machte ich sicherheitshalber einen Bogen. Ein paar Mädchen in Reithosen erkannten mich und fragten nach einem Autogramm. Mir stieg die Röte ins Gesicht. Als sie mich danach fragten, ob es schwierig sei, Fly zu reiten, weil er so gerne buckelte, verflog meine Unsicherheit. Ich erklärte ihnen, dass es sicherlich nicht seine angenehmste Eigenschaft wäre, dass es aber auch einfach seine Freude am Springen ausdrückte.
Als ich von meinem Gang zurückkam, konnte ich meine Eltern nicht mehr sehen. Sie waren vermutlich schon zu den Ställen gegangen, damit sich Fly vor dem Stechen ausruhen konnte. Wir hatten gut eineinhalb Stunden Zeit, bevor es in die letzte Runde ging. Dazwischen gab es Siegerehrungen aus den anderen Disziplinen. Heute war der letzte Abend des Turniers.
Auch für den Weg zu den Ställen hatte ich meine Schleichwege. Ich betrat den Stall, wo unsere Pferde untergebracht waren. Neben Fly und Dumont hatten wir noch Pippa, Sir Henry, Grimaldis und Vanderbilt dabei. Pippa und Sir Henry war ich geritten, Grimaldis und Vanderbilt Thomas. Papa stand bei Fly, der bereits abgesattelt war. Ich sah, wie er das rechte Vorderbein von Fly in der Hand hielt. Seine Stirn war gerunzelt, ich spürte ein flaues Gefühl in der Magengegend.
„Das Hufeisen sitzt locker.“ Papa reichte ein Blick. „Kein Wunder, wenn du stundenlang in der Nacht im Wald herumreitest.“
Ich stöhnte innerlich auf. Diesen Spruch hatte ich in den letzten Tagen mindestens tausend Mal gehört. Was in mich gefahren sei. Ob mir klar wäre, welche Verantwortung wir Menschen für ein Tier hätten. Anfangs hatte mich das schlechte Gewissen geplagt, inzwischen war ich es nur noch leid.
„Bring Fly nach draußen, ich gehe und hole den Hufschmied“, befahl Papa mir knapp. Gemeinsam gingen wir raus, dann machte er sich auf die Suche nach einem der Turnierschmiede. Papa mochte es nicht, wenn unbekannte Menschen an „seine“ Pferde gingen.
Draußen vor den Ställen war alles gut ausgeleuchtet, die Luft war angenehm kühl. Das war der eigentliche Grund, warum Papa lieber nach draußen wollte, denn im Stall steckte noch die Hitze des Tages und die Luft war stickig. Ich atmete tief durch. Es war nie gut, vor einem Stechen die Grundlagen zu verändern. Ich hoffte, dass Fly das alte Eisen dran behalten konnte. Ich machte einen weiteren bewussten Atemzug, als ich merkte, dass ich die Luft angehalten hatte. Jetzt nur nicht nervös werden, durchfuhr es mich. Mein Ziel war zum Greifen nahe. Wir waren drin im Stechen. Im ersten Durchlauf war es knapp gewesen. Das lag nicht an Fly, sondern an mir. Ich war nicht konzentriert bei der Sache, immer wieder tauchte das Bild von Thomas in meinen Gedanken auf, ich spürte seine Lippen auf meinen. Unwillig hatte Fly mit dem Schweif geschlagen, wenn ich wieder abgelenkt war. Ich verstand, was er mir damit sagte: Bleib verdammt noch mal bei mir.
Die Preisgelder der letzten Jahre, die wir gewonnen hatten, waren hoch gewesen. Allein auf dem CHIO lagen wir bereits bei 38000 Euro aus meinen Platzierungen. Der erste Platz beim Großen Preis war mit 115000 Euro hoch dotiert. Zwar floss der größte Teil davon zurück in den Hof, doch ein Teil würde bei mir bleiben. Erich Sander würde vermutlich heute mit wechselnden Gefühlen dem Geschehen folgen, lagen die Preisgelder von Thomas doch weit hinter Meinen.
Heute war Thomas mit Dumont allerdings in Topform. Die beiden hatten sich bereits für das Stechen qualifiziert, genauso wie der Engländer David Livingston mit Dancing Girl und die Kanadierin Lucy Melbourne auf King Lui. Nur noch das Stechen, vier Reiter, sieben Einzelsprünge und die zweifach Kombination lagen vor mir. Ich wusste, dass wir die Schnellsten waren. Einzig Dancing Girl konnte das Tempo genauso anziehen, Abkürzungen reiten und die Kraft aufwenden für einen sauberen Sprung. Also mussten wir fehlerfrei bleiben. Und das lag ausschließlich an meinem Vermögen, mich voll und ganz auf den Parcours zu konzentrieren. Fly sprang in die Höhe so gut wie in die Weite. Doch die Reihenfolge und den kürzesten Weg, der für einen guten Absprung noch reichte, den musste ich finden. Dass Dumont und Thomas ins Stechen gelangt waren, ärgerte mich. Die Topform des Pferdes war ganz allein mein Verdienst. Thomas hatte jeden Kontakt mit mir vermieden, was gar nicht einfach gewesen war, da ich mich mit Papa um die Pferde gekümmert hatte. Er hatte ein Gespür dafür entwickelt, immer dann aufzutauchen, wenn Papa alleine im Stall war.
„Atme, Vera“, flüsterte Mama neben mir, und ich gehorchte. „Mein Gott, Kind, so nervös habe ich dich noch nie erlebt. Möchtest du eine Baldrianperle?“ Ich starrte meine Mutter an und schüttelte den Kopf, unsicher, ob sie das tatsächlich ernst meinte. Sie zuckte mit den Achseln und warf sich selbst vier Dragees in den Mund. Marianne kam selten auf ein Turnier mit.
„Wie fühlen Sie sich als Neuling, der gegen so ein hochkarätiges Feld antritt?“ Ein Reporter, dem ein Kameramann dicht folgte, hielt mir ein Mikrofon unter die Nase. Fly machte einen Satz zur Seite.
„Hoppla, ihr Pferd ist aber schreckhaft“, rutschte es dem Reporter heraus.
Ich verkniff mir eine bissige Bemerkung, stattdessen setzte ich mein öffentliches Lächeln auf. Mein Mund wurde trocken, Schweiß trat auf meine Stirn. Ich beantwortete freundlich alle Fragen des Reporters, egal, wie blödsinnig sie mir erschienen. Gleichzeitig sah ich mich nach einem Ordner um. Es gab Zonen, wo die Reiter ungestört von Reportern waren, und dieser Platz vor den Ställen gehörte eindeutig dazu. Papa kam mit einem Hufschmied im Schlepptau zurück. Er nahm mir Fly ab und stellte sich mit dem Schmied ein wenig abseits. Marianne begleitete das Trio, während ich weitere Fragen beantwortete.
Im Augenwinkel sah ich, wie Papa dem Hufschmied das lockere Eisen zeigte. Endlich kam ein älterer Mann vom Ordnungsdienst heran, entschuldigte sich bei mir und brachte den Reporter weg. Ich ging rüber zu meinem Pferd. Papa sah kurz auf.
„Wir können das alte Eisen dran lassen. Es müssen nur ein paar neue Nägel rein, das sollte genügen“, erklärte er mir. Der Schmied nickte zustimmend.
Ich blickte hoch und sah zu meiner Überraschung Thomas mit einer Frau auf uns zusteuern. Sie trug eine Kamera um den Hals. Es konnte nicht wahr sein, dass wir zum zweiten Mal hier in der reporterfreien Zone von den Medien gestört wurden. Thomas stoppte bei uns, lächelte höflich und wandte sich dann der Frau zu.
„Das, Frau Wolfram, ist Vera Kamphoven.“ Er deutete auf mich. „Stefan Kamphoven“, er zeigte auf Papa „und die Mutter Marianne Kamphoven.“ Meinem Blick ausweichend, wandte sich Thomas meinen Eltern zu. „Frau Wolfram ist ganz angetan von Vera und Fly. Sie möchte gerne einen kleinen Bericht schreiben und ein Foto von der Familie machen. Wärt ihr so nett?“
Ich starrte ihn an. Das war doch jetzt nicht sein Ernst? Oder war es eine Taktik, um mich aus meiner Konzentration zu bringen? Während Marianne sich mit einem freundlichen Lächeln an Frau Wolfram wendete, sah Papa mit gerunzelter Stirn Thomas an, er öffnete den Mund, doch Thomas kam ihm zuvor. „Es ist wichtig für uns. Frau Wolfram schreibt für die St. George.“
Papa schüttelte den Kopf. „Tut mir leid Thomas, aber Fly geht vor. Ich habe für solche Sachen jetzt keine Zeit. Dumont steht auch noch im Stall und muss fertiggemacht werden.“
Frau Wolfram mischte sich ein. „Aber vielleicht könnte Herr Sander das Pferd halten, es dauert auch wirklich nicht lange.“
„Klar kann ich das“, sagte Thomas. Er kam zu uns rüber, nahm Papa Fly ab. Wir beide waren viel zu überrascht, um ihn abzuweisen oder weiter zu protestieren. Ehe wir uns versahen, posierten wir vor dem Zaun, der den Aufwärmplatz abgrenzte, und ließen uns von Frau Wolfram fotografieren. Papa war kurz angebunden, fast unhöflich zu der Dame. Daran merkte ich, wie nervös er war. Auch mir behagte es nicht, Fly in der Obhut von Thomas und einem wildfremden Menschen zu haben, ohne Sichtkontakt zu ihm.
Schließlich war Frau Wolfram zufriedengestellt. Gemeinsam gingen wir zurück zu den Ställen. Der Hufschmied war bereits weg, Thomas kam aus dem Stall. „Ah, da seid ihr ja wieder. Ich habe Fly in seine Box gebracht, weil ich nicht sicher war, wie lange ihr noch braucht.“ Mit einem strahlenden Lächeln ging er auf Frau Wolfram zu, die errötete und die Augen niederschlug. Verwirrt sah ich mir die Frau genauer an. Sie war absolut nicht der Typ von Thomas. Er wich meinem forschenden Blick aus. Mein Vater runzelte die Stirn, schüttelte irritiert den Kopf. „Möchtest du vielleicht Dumont selber fertigmachen?“ Das konnte Papa nur ironisch meinen, denn ich konnte mich nicht erinnern, wann Thomas zuletzt sein Pferd auf einem Turnier geputzt oder gesattelt hatte.
Bedauernd zog Thomas die Schultern hoch. „Würde ich sehr gerne, aber ich möchte Frau Wolfram noch zu Erich bringen. Es wäre klasse, wenn du alles vorbereiten könntest.“ Mit offenem Mund starrten Papa und ich Thomas hinterher, der in einem vertrauten Gespräch vertieft mit der Reporterin verschwand.
„Was sollte denn die Show?“, rutschte es mir endlich heraus.
„Keine Ahnung, vielleicht macht sich das gut bei der Presse“, antwortete Papa.
„Ihr seid wirklich schlimm. Immer müsst ihr so schlecht von Thomas denken. Er hat es im Moment nicht leicht in der Familie, und ich fand es sehr nett, dass er geholfen hat.“ Klar, das war Mutter.
Ich öffnete schon den Mund, als ich einen mahnenden Blick von Papa auffing. Er hatte recht, das war nicht der richtige Zeitpunkt für eine Diskussion über Thomas. Schon gar nicht, wenn die Gefahr bestand, dass mir etwas herausrutschte, das ich später womöglich bereuen würde.
Inzwischen war es frisch geworden, ich zitterte in meiner kurzärmeligen Bluse. Ich sah auf die Uhr. Dreißig Minuten blieben mir bis zum Start. Nach mir kamen Lucy Melbourne und David Livingston, und zuletzt würde Thomas starten.
„Bist du nervös?“, fragte mich Papa. Ich nickte. Er lächelte mir zu und legte mir einen Arm um die Schulter. „Du schaffst das, Vera, ganz bestimmt. Ihr zwei seid so gut, und wenn nicht, werde ich mit Erich reden. Egal, was ihr damals vereinbart habt, du hast es verdient, dass Fly dir gehört. „Ich umarmte meinen Vater und küsste seine Wange. Mir war klar, dass ihm sein Angebot nicht leichtfiel. Papa war nicht der Mensch, der Wünsche an seinen Arbeitgeber stellte. Lieber überzeugte er mit seiner Leistung. Allein deshalb würde ich heute gewinnen. Mama lächelte mich an.
„Du schaffst das, Vera, ganz bestimmt“, erklärte sie zuversichtlich.
Mein Vater löste sich aus meiner Umarmung, wischte sich verlegen über die Augen und gab mir einen Klaps. „Und jetzt mach dein Pferd fertig.“
Gemeinsam gingen wir zum Stall zurück. Während sich Papa um Dumont kümmerte, putzte ich Fly den getrockneten Schweiß aus dem Fell. Seine Mähne bürstete ich durch, bis sie seidig an seinem Hals lag. Sorgfältig bearbeitete ich die Sattellage. Kein Dreck sollte uns stören. Zuletzt sattelte ich ihn und führte ihn hinaus zum Aufwärmplatz. Als ich mich auf seinen Rücken schwang, drehte Fly den Kopf zu meinem linken Fuß und biss rein. Ich klopfte seinen Hals. „Keine Angst, mein Großer, diesmal bin ich ganz bei dir.“
Ich lenkte Fly auf den Platz. Vom Stadion konnte ich die Musik für die Siegerehrungen herüberschallen hören. Meine Hände krampften sich um die Zügel, mein Herzschlag beschleunigte sich. Das Licht der Lampen leuchtete jeden Zentimeter des Platzes aus. Kalt und nackt wirkte das Gras unter dieser Beleuchtung, jeder Gegenstand zeichnete sich scharf ab. Die Umgebung wirkte unnatürlich, genauso wie der grünliche Schimmer meiner Haut. Ich schluckte, Schweiß bildete einen feinen Film auf meiner Stirn. Abrupt blieb Fly unter mir stehen. Ich fühlte, wie sich die Augen der paar Reiter, die sich noch auf dem Platz mit ihren Begleitern und Fans befand, auf mich richteten. Den Bruchteil einer Sekunde erwog ich, Fly vom Platz zu reiten und einfach mit ihm zu verschwinden, so wie damals im Wald. Der Kopf von Fly drehte sich zu mir. Ich streckte mich, kraulte sein Ohr. „Ich fürchte, ich bin ein wenig nervös, mein Süßer.“
„Is everything all right with you?“, kam eine Stimme von der Seite. Ich richtete mich auf. Neben mir tänzelte Dancing Girl unter David Livingston. Die Nervosität seiner Stute übertrug sich auf Fly. Ich nahm die Zügel auf. „Yes, I’m okay, thanks for asking.“
Er grinste und nickte kurz, dann hatte er alle Hände voll mit seiner Stute zu tun. Livingston hielt die Stute kurz, was ihre Aufregung nur noch verstärkte.
Mit einem leichten Andrücken der Schenkel setzte ich den Impuls für Fly, gehorsam ging er los. Ich achtete darauf, dass ich zu der Stute Abstand hielt, verlängerte die Zügelführung, sodass sich Fly unter mir lang machen konnte. Meine Konzentration richtete sich nach innen. Tief atmend versuchte ich, meinen Körper dem Rhythmus von Fly anzupassen. Langsam beruhigte sich mein Herzschlag. Meine Aufmerksamkeit richtete sich auf das Zusammenspiel unserer Körper. Ich konnte das Kauen seiner Zähne auf dem Gebiss, die schwingenden Muskeln unter meinem Hintern spüren. Es war wie ein Tanz, dem ich folgte. Entspannt prustete das Pferd unter mir ein paarmal.
Langsam nahm ich die Zügel auf, spürte, wie Fly sich im Rücken verkürzte und die Hinterhand vermehrt das Gewicht in der Bewegung auf sich nahm. Ich schaltete die Geräusche um mich herum ab, nahm die anderen Reiter auf dem Platz nur noch als Schemen wahr, die meinen Weg kreuzten. Ich tauchte noch tiefer ein in Fly, brachte unsere Körper in Einklang. Spürte, wie sich der Rhythmus unseres Atems und des Herzschlags in unterschiedlichem Tempo anpasste. Ich lächelte, in diesem Moment hier lag mein ganzes Glück.
Wir wechselten in den Trab. Seine Beine flogen mit Schwung nach vorn. Das Pferd liebte die Show. Sein Hals wölbte sich stolz, und ich konnte die Blicke der Menschen auf dem Abreitplatz erneut auf uns spüren. Vor allem die von David Livingston. Ja, mein Lieber, du hast dich zu früh gefreut, dachte ich grimmig, wir werden es dir schwermachen, denn wir wollen gewinnen. Federnd drehten wir unsere Runden. Flying Highs Kraft war unglaublich, und das nach drei Wettbewerben und den ersten zwei Umläufen. Er war das jüngste Pferd im Starterfeld, dennoch zeigte er eine Ausdauer, hinter der sich die anderen verstecken konnten. Bei seiner ganzen Ausbildung war ich darauf konzentriert gewesen, dass ich seine Kondition und Muskulatur aufbaute. Genauso hatte die Gymnastizierung einen großen Teil eingenommen, ich hatte sie mit allen möglichen Elementen aus anderen Reitweisen angereichert. Ich wollte, dass er die Belastung von den vielen Turnieren in so jungen Jahren ohne Schaden überstehen sollte.
Als ich in den Galopp wechselte, geschah das in einer fließenden gemeinsamen Bewegung. Vor uns lag eine Erfolg versprechende Laufbahn im internationalen Sport. Schon jetzt waren wir im deutschen Kader der Springreiter für die Weltmeisterschaft. Ich hob mein Gesäß aus dem Sattel, verlängerte die Zügel und klopfte mit beiden Händen den Hals meines Pferdes.
„Vera!“ Die Stimme meines Vaters riss mich aus meinen Träumen. „Ihr seid aufgerufen worden.“
Auf der kurzen Strecke vom Abreitplatz ins Hauptstadion ging ich im Geist den Parcours, der vor uns lag, durch. Die Strecke zwischen dem dritten Hindernis, einem Steilsprung, und dem Vierten, einem Weitsprung, war die längste Distanz. Hier würden die Pferde mit großen Galoppaden im Vorteil sein. Zu viel Geschwindigkeit barg die Gefahr, dass der Reiter das Pferd nicht mehr rechtzeitig für den Sprung in die Hand bekam. Dennoch musste ich es an dieser Stelle riskieren. Der Gong ertönte, wir überquerten die Startlinie, ab jetzt lief die Zeit. Jetzt gab es kein Stadion mehr, keine Richter, keine Zuschauer. Es gab nur noch mich, Fly und die Hindernisse.
„Erste Starterin im Stechen ist Vera Kamphoven auf Flying High, ein achtjähriger Hengst, der hier in Aachen bereits gezeigt hat, dass er Potential besitzt. Vera Kamphoven geht das Stechen zügig an. Die kompakte Bauweise des Pferdes kommt ihr bei den engen Wendungen entgegen. Sie ist schnell unterwegs, bisher keine Fehler. Hält sie das Tempo durch, wird es für die anderen Teilnehmer schwer.“
Auf der langen Strecke zwischen dem dritten und vierten Hindernis gab ich Fly die Zügel. Er machte sich lang und flach und legte die Ohren an. Eng schmiegte ich meinen Körper an seinen. Die Luft über uns zischte, es war absolut still im Stadion, die Spannung der Zuschauer war förmlich zum Greifen. Ich lächelte. Mir war klar, dass viele dachten, ich könnte Flying High aus dem Tempo nicht mehr kontrolliert zum nächsten Sprung bringen. Doch es reichte schon, dass ich den Oberkörper anhob, mein Gewicht wieder in den Sattel verlagerte und die Zügel leicht annahm. Sofort verkürzten sich seine Galoppsprünge. Seine Ohren richteten sich aufmerksam zu dem nahenden Hindernis. Den Weitsprung schafften wir locker, die nächste Kurve nahm ich zu eng. Fly glich es aus und sprang mit viel Kraft ab. Ich hörte das Touchieren der Stange nicht, aber das Stöhnen der Zuschauermenge und dann das Aufatmen, als die Stange liegen blieb. Ein grimmiges Lächeln huschte mir über das Gesicht. Ja, ich würde siegen. Den Doppelsprung visierte ich wieder mit mehr Luft an, ich wollte nicht durch meinen Leichtsinn unseren Sieg riskieren. Ich reduzierte mein Tempo und konzentrierte mich auf das Hindernis mit seinen blauweißen Stangen, das vor uns lag. Erst der Weitsprung, dann der Hochsprung. Im Kopf zählte ich die Galoppsprünge.
Eine unregelmäßige Bewegung von Fly brachte mich aus dem Konzept. Ich fühlte ein Zögern, ein Abbremsen, meine Waden drückten gegen seine Flanken, bevor ich weiter darüber nachdenken konnte. Wir mussten abspringen. Gehorsam folgte das Pferd meinem Kommando. Blitzartig zuckten zwei Bilder durch meinen Kopf. Papa, wie er im Stall das Vorderbein mit dem losen Hufeisen in seiner Hand hielt. Thomas, der in seiner weißen Turnierreiterhose neben Flying High stand und aufmerksam die Arbeit des Hufschmieds beaufsichtigte. An diesem letzten Bild war alles falsch. Thomas hatte noch nie Fly gehalten, und Ahnung von der Arbeit eines Hufschmieds besaß er genauso wenig. Jetzt war es zu spät. Egal, weshalb Flying High vor dem Absprung gezögert hatte, seine Vorderhand hob sich bereits in die Luft, mein Kopf lag flach an seinem Hals, der feuchte Dampf aus seinem Fell legte sich auf meine Wange. Die Haare seiner Mähne wehten mir in die Augen. Reflexartig schlossen sich meine Lider, der Rest lag jetzt nur bei ihm.
Ein beklemmendes Gefühl machte sich in meinem Innersten breit. Mit der Kraft seiner Hinterhand katapultierte er uns in die Höhe, bevor er seine Beine eng an seinen Bauch zog. Für einen kurzen Moment schwebten wir frei in der Luft, dann wirkte die Schwerkraft, und wir senkten uns Richtung Boden. Ich verlagerte das Gewicht meines Körpers nach hinten. Fly streckte seine Vorderbeine aus, um den Sprung sicher abzufedern. Seine rechte Vorderhand berührte die Erde, die linke folgte. Er rutschte weg, verlor den Halt und stolperte. Ein Ruck ging durch seinen Körper. Ich konnte die unerwartete Bewegung nicht abfangen. Die Zügel glitten mir durch die Hände, ich versuchte mich mit den Fingern in seiner Mähne zu verkrallen, aber der Schwung war zu groß, er schleuderte mich über seinen Kopf hinweg nach vorne. Panisch sah ich die gelbschwarzen Stangen des zweiten Hindernisses viel zu schnell auf mich zukommen. Schützend zog ich instinktiv meine Hände vor das Gesicht, rollte mich ein, um die Wucht des Aufpralls abzufedern, für mehr blieb mir keine Zeit. Als ich auf die Stangen prallte, loderte der Schmerz wie ein flammendes Feuer durch meinen Körper. Ein greller Schrei drang an mein Ohr. Dann hörte ich das Knacken, als ob man ein Streichholz achtlos mit seinen Fingern zerbricht. Ich schloss die Augen, fühlte, wie mein Kopf gegen einen Widerstand geschleudert wurde, spürte, wie das Material des Helms der Wucht des Aufpralls nachgab und zersplitterte. Einfach liegen bleiben, mich bloß nicht bewegen, schoss es mir durch den Kopf, gelähmt von den Schmerzen in meinem Körper. Mir wurde schwarz vor Augen, doch die Bewusstlosigkeit wich der nackten Überlebensangst, als der Pferdekörper meiner Sturzbahn folgte und mich unter sich begrub. Keuchend schnappte ich nach Luft, meine Lungen fühlten sich wie zerquetscht an. Heiße Feuchtigkeit verband sich mit meinem eigenen Schweiß. Schaum flog mir ins Gesicht. In meinem Gehirn spulte sich der Film meines Lebens ab. Einzelne Szenen traten schärfer hervor. Meine Mutter, wie sich mich in die Arme nahm, mir tröstend über das Haar strich, nachdem ich mir das Knie beim Fahrradfahren aufgeschlagen hatte. Mein Vater, auf dessen Schoß ich saß, eingekuschelt an seiner Brust, die mich beschützte und wärmte. Fly, der im Gras lag, die Beine unter seinen Körper und sich die Sonne auf sein Fell scheinen ließ, während ich ihn als Rückenstütze zum Lesen benutzte. Thomas, der sich über mich beugte und küsste. Sein feuchter Körper, der sich an meinen schmiegte. Hennig, der mich in seine Arme zog und dessen Herz ich klopfen hören konnte. Ich wollte nicht sterben. Ich schluchzte auf, drückte Fly mit den Händen weg. Dann fühlte ich, wie sich Fly aufzurappeln versuchte. Hufe trampelten auf mein Bein. Ein weiteres Keuchen rang sich aus meiner gepeinigten Brust, zu einem Schrei waren meine Lungen nicht mehr in der Lage. Mit den Händen zog ich mich weg und gewann Abstand von der Gefahrenzone. Um mich herum lagen Stangen, Ständer, Büsche und lila zertrampelte Blumen. Alle Gegenstände zeichneten sich in den scharfen Linien des Flutlichts ab. Ich nahm wahr, wie Fly erneut zusammenbrach und gleich noch einen Versuch startete, um wieder auf die Beine zu kommen. Doch weder das eine Vorderbein noch sein Hinterbein konnten den schweren Körper mehr tragen.
Als ich aufschrie, wusste ich nicht mehr, ob es meine Schmerzen waren oder seine, die durch mich hindurchloderten. Ich versuchte aufzustehen, brach aber zusammen, meine Beine wollten mich genauso wenig tragen. Mit letzter Kraft zog ich mich zu meinem Pferd, das inzwischen still am Boden lag. Er versuchte nicht mehr aufzustehen, er hatte aufgehört zu kämpfen. Seine Augen starrten mich angstvoll an. Ich konnte das Weiße darin sehen. Ich streckte die Hand aus, berührte seine weichen Nüstern. An meine Nase drang ein metallischer Geruch. Ich sah das Blut an meinen Händen, dort, wo sie seine Nüstern berührt hatten. Entsetzt starrte ich darauf, Salz brannte auf der Haut meines Gesichts. Die Angst aus seinem Auge wich, das Weiß verschwand, ich konnte seine Iris wieder sehen. Mein Blick bohrte sich in sein Auge. Ich tauchte ein in die tiefe Schwärze seiner Pupillen.
Menschen erschienen in meinem Gesichtsfeld, doch die Stimmen drangen nicht mehr zu mir, als wäre ich taub geworden. Hände zerrten an mir, neue Schmerzen zuckten durch meinen Körper, ich stöhnte auf, krallte meine Finger in die Mähne von Fly, niemals würde ich ihn verlassen. Meine Augen waren unverwandt auf seine gerichtet. Verzweifelt versuchte ich ihn festzuhalten mit diesem Blick, doch dann sah ich, wie das Licht darin zerbrach, ich wurde aus der Tiefe hochgespült in das kalte, nackte Licht der Scheinwerfer. Gleichzeitig konnte ich wieder hören.
„Vera, um Gottes willen. Machen Sie doch etwas, wo bleiben die Sanitäter! Vera, Kind, hörst du mich?“ Sanft strich eine raue Hand über meine Wange.
„Stefan lebt sie noch? Sag doch was, Stefan.“
Aus meiner Brust kam ein Schluchzen. Die Augen von Fly trübten sich, ein letzter warmer Hauch aus seinen Nüstern streifte meine Hand. Kälte machte sich in mir breit. Ruhig lag sein Körper auf dem Boden. Ich schrie auf, griff mit meiner zweiten Hand in seine Mähne, zerrte an ihm, versuchte ihn zu wecken, aber er rührte sich nicht mehr. Sein Kreislauf war zusammengebrochen, das Herz stehen geblieben. Es hatte der Anstrengung, der Panik, den Verletzungen nicht standgehalten. Dunkelheit griff nach mir. Meine Finger lösten sich aus der Mähne, ich verlor meinen Halt. Jemand befestigte etwas um meinen Hals. Feuchtigkeit tropfte auf mein Gesicht, vermischte sich mit der Nässe, die sich dort bereits befand.
„Sie müssen uns Platz machen, sonst können wir nicht helfen.“
Ich hörte auf, mich zu wehren. Die Dunkelheit um mich herum verdichtet sich, hüllte mich ein, nahm mir den körperlichen Schmerz. Dankbar ließ ich mich in sie hineingleiten, es gab nichts mehr, was ich ihr noch entgegensetzen wollte.
3
Kapitel
Ich wälzte mich im Bett hin und her. Es war kurz vor fünf. In meinem Kopf kreisten die Gedanken. Ich wusste, es war zwecklos, ich würde nicht mehr einschlafen können. Das erste Licht der Morgendämmerung tauchte das Zimmer meiner Kindheit in helle und dunkle Schatten. Fast zwei Jahre war es her, dass ich hier meine letzte Nacht verbracht hatte. Damals war mir klar geworden, dass ich es nicht einen Tag länger auf dem Hof ertragen würde. Mein Körper mochte wieder in Ordnung sein, mein Herz war es nicht. Und jetzt lag ich wieder hier in meinem Zimmer. Eigentlich war mir alles vertraut, zugleich fühlte sich alles fremd an.
Ich war nicht mehr der Mensch, der ich früher gewesen war. Ich hatte mich verändert. Die letzten Jahre waren keine glücklichen Jahre gewesen. Aber ich hatte wieder gelernt zu leben, oder zumindest so etwas Ähnliches. Immerhin war ich jeden Tag aufgestanden, hatte gegessen, getrunken und war abends ins Bett gegangen. In der Anfangszeit meines Erwachens im Krankenhaus waren mir solche alltäglichen Dinge schwergefallen. Ich konnte stundenlang auf einen Flecken an der Wand starren oder mitten in der Bewegung innehalten, wenn ich aß. Genauso brachte ich die Zeit durcheinander. Manchmal wusste ich nicht, ob es abends oder morgens war. Von den Wochentagen ganz zu schweigen.
Die Krankenschwestern waren erstaunlich geduldig mit mir gewesen, wie meine Eltern. Nach und nach hatte sich mein Zeitgefühl gebessert. Ich nahm wieder Anteil an dem, was um mich herum passierte. Als ich erfuhr, dass ich nach Hause durfte, überkam mich neuerliche Panik, ich fiel zurück in meine Starre. Mir wurde klar, dass ich nicht zurückgehen konnte. Ich versuchte, es meinen Eltern zu erklären, aber angesichts der Freude in ihren Augen blieben mir die Worte im Hals stecken. Tapfer fuhr ich also mit ihnen nach Hause. Mama plapperte unaufhörlich, während mich Papa schweigsam beobachtete. Ich versuchte, ihrem Wortschwall zu folgen und meine Angst in den Griff zu bekommen. Was mir nicht gelang. Zu Hause brach Papa allein zu seinem Rundgang auf, Mama blieb bei mir. Aber ich flüchtete mich in mein Zimmer, wo ich mich auf mein Bett setzte und in der Dunkelheit auf meine Hände starrte, die zitternd in meinem Schoß lagen.
In der Nacht beschloss ich zu gehen. Die Sachen, die ich mitnahm, passten in einen Rucksack. Leise schlich ich mich aus dem Haus, denn mir war klar, dass mich meine Eltern in keinem Fall gehen lassen würden. Sie hatten ihr Leben für mich verändert und sie litten darunter, das sah ich ihnen an. Ohne Ziel brach ich blindlings auf, stiefelte erst durch den Wald, bis ich zur Straße kam, dann lief ich in den Ort. Ratlos setzte ich mich in die Bushaltestelle, ich hatte keine Ahnung, wohin ich gehen sollte. In den ersten Bus, der an der Haltestelle hielt, stieg ich ein. Er brachte mich in die nächste Stadt, die leer war. Ich lief durch die Straßen. An dem Fenster eines Reisebüros blieb ich stehen. Ein Ticker mit Last-Minute-Angeboten zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich rief mir ein Taxi und ließ mich zum Flughafen bringen. Ohne Reisepass könne ich mich nur innerhalb der EU bewegen, erklärte mir ein junges Mädchen am Schalter des Reisbüros. Ein paar Stunden später saß ich in einem Flieger nach Kreta. Es war der erste Flug in meinem Leben, und das Einzige, was ich von Kreta wusste, war, dass es eine griechische Insel war.
In der Ankunftshalle überfiel mich eine Panikattacke, ich begann zu hyperventilieren. Dazu die laut krachenden Durchsagen in einer Sprache, die ich nicht kannte. Selbst die englischen Durchsagen konnte ich nicht verstehen. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich gehen sollte. Was suchte ich hier? War ich wahnsinnig geworden? Zwei Jungs mit Rucksack, Rasterlocken und abenteuerlichem Outfit nahmen sich meiner an, bevor ich zusammenklappte. So ging es los.
Und so lernte ich Griechenland kennen, fuhr von Insel zu Insel und kam mit einer ganz neuen Lebensweise in Berührung. Nichtstun, Genießen, anderes Essen, andere Sprachen, andere Mentalitäten, und ich lernte viele neue Menschen kennen. Ich ließ mich weiter treiben nach Schweden, Norwegen, Finnland, Italien, Portugal und Spanien. Für einen kurzen Moment faszinierte mich die jeweilige Lebensart der Menschen, meistens noch mehr die Landschaft, dann holte mich mein eigenes Leben wieder ein und ich spürte den Drang weiterzuziehen. Auf Fuerteventura ging mir das Geld aus. Der Zufall wollte, dass die Schwester meiner Pensionswirtin in einem Hotel arbeitete, das gerade nach einer deutschsprachigen Kellnerin suchte. Nach zwei Tagen zur Probe durfte ich bleiben. Wieder zu arbeiten war jetzt eine neue Erfahrung für mich. Meine jahrelang geschulte Beobachtungsgabe von körperlichen Signalen und mein Mitmachen bei den Festen der Sanders halfen mir bei dem neuen Job. Und wenn ich auch weit davon weg war zu sagen, dass ich mich wohlfühlte, so hatte mein Leben wieder einen Rhythmus gefunden.
Ich ließ meinen Blick durch mein Zimmer schweifen. Ich kannte jedes Möbelstück, jedes Bild, jedes Buch. Mein Blick fiel auf die Wand mit dem fehlenden Bild. Papa oder Mama hatte es damals vorsorglich entfernt, als ich nach dem Unfall nach Hause gekommen war. Als ob es nur die Bilder an den Wänden gewesen wären. Was war mit all den Bildern, die tief in mir vergraben lagen? Ich schloss die Augen und riss sie gleich wieder auf, aus Angst, etwas zu sehen, das ich nicht aushalten konnte. Ich stöhnte. Wie sollte ich Ruhe finden, hier an dem Ort, an dem alles Vergangenheit war. Vor lauter Anspannung verkrampften sich meine Muskeln, und ich sprang auf. Wie immer war es die linke Wade, ein Stöhnen kam mir über die Lippen. Ich streckte und verkürzte den Muskel, bis ich merkte, wie sich der Krampf löste. Das konnte ja heiter werden. Ich schüttelte mich, wie ein Pferd, das sich im Dreck gewälzt hatte und nun den Staub loswerden wollte.
Jetzt war ich vollkommen wach. Entnervt zog ich ein Longshirt, eine blaue Bluse und meine neuen Jeans an. Leise schlich ich mich die Treppe runter in die Küche. Wie früher stand eine Thermoskanne mit heißem Tee auf der Anrichte. Sie war für die Menschen, die vor dem Frühstück in die Kälte mussten, um die Pferde zu füttern. Eine Angewohnheit von meinen Eltern, die sich scheinbar nicht geändert hatte. Geändert hatte sich nur, dass ich die Kanne nicht mehr nutzte, und auch mein Vater würde sie heute nicht benötigen. Ich schluckte. Ich spürte die Tränen in meinen Augen. Flenn jetzt bloß nicht rum, sagte ich zu mir und biss die Zähne zusammen. Ich starrte auf die Uhr an der Wand. Begann langsam mit dem Zählen. Löste die Kiefernmuskeln, konzentrierte mich auf meinen Atem, den ich angehalten hatte. Es wirkte. Nach ein paar Zügen wurde ich wieder ruhiger. Langes Üben war nötig gewesen, bis ich diese Technik beherrscht hatte.
Ich holte mir eine Tasse aus dem Schrank und schenkte mir Tee ein. Meine Finger umklammerten das heiße Getränk. Ich senkte mit geschlossenen Augen den Kopf über den duftenden Dampf. Mama hatte eine Kräutermischung gemacht, die nach Minze, Kamille und Zitronengras roch. Ich setzte mich nicht, sondern blieb lieber stehen, sodass ich dem Fenster den Rücken zukehren konnte. Ich wollte nicht sehen, wie die Sonne hinter den Hügeln über den Bäumen aufstieg und ihre ersten Strahlen auf den Stall mit den Paddocks schickte.
Ich war so sehr mit dem an nichts Denken beschäftigt, dass ich Mama erst bemerkte, als sie in der Tür stand. Ihre Haare waren zerzaust, ihr schmaler, zarter Körper steckte noch im Schlafanzug, über den sie einen Bademantel gezogen hatte. Ihre Augen waren verquollen und ihr Gesicht zerknittert. Schon gestern, als sie mich vom Flughafen abgeholt hatte, hatte ich ihr angesehen, wie sehr ihre sonst so feste Welt ins Wanken geraten war. Heute Morgen erschreckte sie mich mit ihrem zerbrechlichen Aussehen so sehr, dass ich fast die Tasse fallen ließ. Ich stellte den Becher ab, ging zu ihr und schloss sie in meine Arme. Marianne reicht mir bis zur Schulter, und als ich die Arme um sie schlang, schien es mir, als würde sie darin versinken. Für einen Moment lehnte sie den Kopf an meine Schulter und blieb ganz ruhig, dann schob Marianne mich sanft beiseite. Sie holte ein Taschentuch aus dem Bademantel, putzte sich die Nase und wischte die Tränen weg.
„Jetzt wird mit dem Heulen aufgehört“, sagte sie mehr zu sich selbst als zu mir. Sie versuchte ein Lächeln, dass ihr Gesicht zu einer Grimasse machte.
„Von mir aus kannst du ruhig heulen. Papa hat echtes Glück gehabt, dass ihn da draußen jemand gefunden hat.“
„Glück? Ihn da im Krankenhaus zu sehen, an all den Geräten, wie ein Toter.“ Mama brach ab, hantierte mit der Kaffeemaschine. Ich schluckte und spürte eine neue Angst in mir hochkriechen. Mein starker Vater, den ich nie in meinem Leben krank gesehen hatte. Unser Fels in der Brandung, unerbittlich stark, egal, welcher Sturm um ihn toste. Stefan Kamphoven hielt allem stand. Nur nicht seinem eigenen Körper. Der hatte ihn in die Knie gezwungen. Wieder eine Realität, der ich mich stellen musste. Alles war vergänglich, alles änderte sich. Paul, der Nachbar, hatte Papa gesehen, wie er beim Mulchen den Traktor abstellte. Er war rüber gegangen, weil er sowieso noch etwas mit ihm besprechen wollte. Als er beim Traktor ankam, war Papa schneeweiß im Gesicht. Paul hatte sofort mit seinem Handy den Notruf angewählt. Danach schwang er sich auf den Traktor und fuhr zurück auf den Hof. Kurz darauf war bereits der Notarztwagen da gewesen. Nur ein wenig später, und Papa hätte einen Herzinfarkt gehabt. So die Schilderung von Mama, als ich sie zwei Stunden später am Telefon erwischte. Ich weiß nicht, warum ich gerade an diesem Nachmittag das Bedürfnis verspürt hatte, zu Hause anzurufen.
Der Kaffee war fertig, und Mama schenkten sich einen Becher ein mit einem ordentlichen Schuss Milch. Sie setzte sich an den Küchentisch, sodass sie aus dem Fenster blicken konnte. Die Augen waren nach draußen gerichtet, aber sie schienen nichts zusehen. Das kannte ich nur zu gut. Vorsichtig setzte ich mich ihr gegenüber. Ich wollte sie nicht stören, sondern warten, bis sie so weit war. Gestern Abend hatten wir nicht mehr viel miteinander gesprochen. Ich war erst gegen Mitternacht gelandet. Mir steckte ein Tag Arbeit in den Knochen, die hastige Kündigung, die Organisation meiner Heimreise, zwei Telefongespräche mit Mama und ein Rückflug von sechs Stunden. Im Auto war ich dann bereits zum ersten Mal eingeschlafen.
In ihre Augen kehrte Leben zurück, sie starrte in ihren Kaffeebecher. „Wie lange kannst du bleiben?“
„Solange ihr mich braucht.“
„Was ist mit deinem Job?“
„Ich habe gekündigt.“
Mama schaut von dem Becher auf und sah mir direkt in die Augen. Schnell senkte ich den Blick, ich wollte die Frage darin nicht sehen und noch weniger die darin lauernde Hoffnung. Fast einen Monat hatte ich damals gebraucht, nachdem ich in der Nacht-und-Nebel-Aktion abgehauen war, bis ich es gewagt hatte, die Telefonnummer meiner Eltern zu wählen. Anfangs hatte ich jeden Tag eine kurze Postkarte geschickt: „Mir geht es gut, macht euch keine Sorgen.“ So ähnlich lauteten die Inhalte. Irgendwann verlängerten sich die Zeitabschnitte, und ich stellte mir vor, dass meine Eltern ihr normales Leben wieder aufgenommen hatten.
„Vera bist du es?“ Das waren die ersten ängstlichen Worte gewesen, die mir damals entgegengeschallt waren, kaum dass das erste Läuten verklungen war. „Hallo, Mama.“ Ein Aufschluchzen, das Weiterreichen des Hörers an meinen Vater, der sich kurz räusperte. „Hallo, Vera, schön, dass du dich meldest. Wo bist du gerade?“ Mit belanglosen Worten hatten Papa und ich uns über das erste Gespräch gerettet, und diese Taktik behielten wir bei. Es half mir, meine Verbindung zu meinen Eltern aufrechtzuerhalten, ohne dass ich zu sehr an dem rührte, was mir so wehtat. Ich hatte meinen Anker im Leben verloren. Mein Ziel war so klar gewesen, mein Leben sicher und behütet, niemals wäre ich auf die Idee gekommen, dass es anders sein könnte. Jetzt erschien mir nichts mehr im Leben als sicher. Alles war zerbrechlich, konnte kaputt gehen und mich verletzen. Der einzige Schutz bestand darin, an nichts sein Herz zu hängen. Und wenn es so war, dass ich das Gefühl hatte, ich gewöhnte mich an etwas, ließ einen Ort, einen Menschen zu nah an mich heran, dann packte ich meine Koffer und ging weg.
Gestern hatte ich nicht einen Augenblick gezögert, alles hinzuwerfen, meine Eltern brauchten mich. Meine Mutter brauchte mich. Keinen Gedanken verschwendete ich daran, was es für mich oder für meine Eltern bedeuten würde, wenn ich wieder in ihr Leben trat. Erst gestern auf dem Flughafen, als Mama zögernd auf mich zugelaufen war, unsicher, ob sie mich in die Arme nehmen sollte oder nicht, war mir klar geworden, was auf mich zukam. Seit ich aus dem Abgrund gekrabbelt war, hatte ich keinen Blick mehr zurückgeworfen. Jetzt saß ich hier vor meiner Mutter und wusste nicht, ob es der alte Abgrund war, der auf mich lauerte, oder ein neuer. Schließlich hob ich die Augen und sah Mama an, deren Gesicht verschlossen war.
„Mama, ich bin hier und ich werde euch helfen, soweit es in meinen Kräften steht. Das heißt aber nicht, dass ich zurückkomme“, fügte ich hinzu. Meine Stimme klang erstaunlich ruhig und kraftvoll, obwohl ich innerlich zitterte. „Wichtig ist, dass Papa wieder auf die Beine kommt.“ Damit ich wieder gehen kann, setzte ich im Gedanken dazu. Mama ließ ihren Becher los und ergriff meine Hand.
„Danke, dass du gekommen bist.“ Ihre Augen füllten sich mit Tränen. „Ich weiß, dass es nicht leicht für dich ist.“
Ich schluckte hart und nickte. Die Verantwortung lag bei mir. Ich musste stark sein und meiner Mutter Halt geben, so wie es mein Vater immer getan hatte.
Mama war in ihrem kleinen Fiat zu den Sanders hinübergefahren. Gestern hatte ihr das Krankenhaus mitgeteilt, dass wir frühestens am Nachmittag gegen vier Uhr zu Besuch kommen durften. Bis dahin wollten sie einige Untersuchungen bei Papa vornehmen.
Unruhig lief ich im Wohnzimmer auf und ab. Die Tasche und der Rucksack mit meinen Habseligkeiten waren im Schrank verstaut. Ich hatte geduscht. Die Küche war sauber, die Wäsche wie immer längst gebügelt – es gab nichts, absolut gar nichts, was ich im Haus noch hätte machen können.
Erhol dich, ruh dich aus, waren Mamas Worte gewesen, als sie zu ihrer Arbeit ins Gutshaus verschwand. Sie hatte gut reden. Wie sollte ich nur die Zeit totschlagen bis vier Uhr?
Aus lauter Verzweiflung schaltete ich den Fernseher ein. Ich wusste schon gar nicht mehr, wann ich zuletzt so ein Teil bedient hatte. Leider benötigte das Programm keinerlei Gehirnkapazität, sodass es mich von meinen Gedanken nicht ablenkte. Ich schaltete das Gerät gleich wieder aus. Und so tigerte ich von Neuem durch das Haus. Vor der Tür zum Büro meines Vaters blieb ich stehen. Er hatte mir alles über Pferde beigebracht, aber Buchführung, Lohnabrechnung oder gar Arbeit am Computer waren ihm ein Gräuel. Sobald ich so weit gewesen war, dass ich diese Aufgaben übernehmen konnte, war er nur noch zum Kaffeetrinken ins Büro gekommen. Ich fragte mich, wie es hinter der Tür wohl aussehen mochte, jetzt, nachdem er zwei Jahre lang alles hatte alleine machen müssen. Aber ich brachte nicht den Mut auf, es herauszufinden. Denn das würde für mich auch die Frage aufwerfen, die ich mir stellte, seit ich von Papas Herzinfarkt wusste. War es womöglich meine Schuld, dass es dazu gekommen war? Hatten der Unfall und meine Flucht von zu Hause eine Rolle gespielt?
Ich lief zurück ins Wohnzimmer und blieb diesmal vor dem Bücherregal stehen. Wahllos zog ich ein Buch heraus, Handbuch für Pferde. Schnell schob ich es wieder ins Regal zurück. Weidewirtschaft. Auch nicht besser. Ich wechselte die Regalseite. Der Pferdeflüsterer. Verdammt, gab es in diesem Haus kein Buch, das nichts mit Pferden zu tun hatte?
Unruhig streifte mein Blick durch den Raum, blieb am Fenster hängen. Ich sah hinaus auf die Wiesen, die unser Haus umgaben. Da war der landwirtschaftliche Weg, der in den Wald führte und sich dort gabelte. Einer der Wege führte weiter zum Anwesen der Sanders, der andere endete bei unserem Nachbarn Paul, einem Bauern, der Rinder züchtete und mit dem wir gemeinsam im Wechsel die Weiden bewirtschafteten. Die Sonne sandte ihre Strahlen durch die Wolkendecke. In der Nacht war es kalt gewesen, die Spitzen der Gräser waren in eine feine Eisschicht eingehüllt. Wo die Sonnenstrahlen auf die Halme trafen, schmolz das Eis zu Wassertropfen, die sich langsam einen Weg nach unten bahnten. Ich lehnte meine Stirn gegen die kühle Glasscheibe. Alles war so vertraut, ich kannte jeden Pfosten, jeden Busch, jeden Baum, jeden Weg, der sich durch den Wald schlängelte. Selbst die Pfade, die sich das Wild durch die Bäume suchte, kannte ich in- und auswendig. Mit geschlossenen Augen hätte ich aus dem Haus gehen können und hätte den Weg zu den Sanders gefunden. Ich würde den Personaleingang nehmen, durch die Küche gehen, in das kleine Büro meiner Mutter, wo sie arbeitete. So nahe war sie und doch meilenweit entfernt für mich. Gehörte ich überhaupt noch hier her?
Das alles war mal mein Leben gewesen. Mir wurde klar, dass es keinen Ort auf der Welt gab, der die gleiche Bedeutung für mich besaß und mir ein ähnliches Gefühl gab. Ich löste mich von dem Fenster, drehte mich um, und meine Augen fielen auf das Bild von uns Kindern. Ich in der Mitte, rechts Thomas und links Henning. Mama hatte damals den Auftrag von Julia Sander erhalten, mit den beiden Jungs zu einem Fotografen zu fahren. Erst waren die beiden einzeln fotografiert worden, dann zusammen. Auch von mir machte der Fotograf ein Bild, und dann wollte er eines von allen Geschwistern machen. Statt den Mann über den Irrtum aufzuklären, ließ Mama ihn gewähren, und so war das Bild entstanden. Thomas’ Haare, kurz geschnitten, ordentlich und glatt. Henning, dessen Haare nach den ersten Fotos wieder wirr abstanden. Beide blond mit dunkelbraunen Augen, dazwischen ein braunhaariges Mädchen mit grünen Augen und schulterlangen Haaren, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Henning einen Kopf größer, Thomas genauso groß wie ich. Wir alle lachten in die Kamera. Meine Arme lagen um den Hals der Jungs. Wie alt war ich da gewesen? Fünf oder sechs? In diesen Jahren waren wir viel zusammen gewesen und die beiden hatten oft bei uns übernachtet.
Es war die Phase gewesen, in der Erich Sander sein Auslandsgeschäft aufbaute und dauernd unterwegs war. Julia Sander begleitete ihren Mann. Ich verstand nicht viel von dem, was Erich Sander machte. Er hatte das Unternehmen komplett aus dem Boden gestampft und zu dem gemacht, was es heute war. Begonnen als ein kleiner Betrieb, der sich mit Elektrotechnik beschäftigte, war die Firma „Elektronische Automatisierungssysteme Sander“, kurz EKTASYS, inzwischen ein mittelständisches Familienunternehmen mit Joint Ventures, Niederlassungen und Beteiligungen in vielen Ländern. Das Entscheidende waren wohl die vielen Patente, wie mir Henning mal erklärt hatte. In Deutschland fanden die Entwicklung neuer Technologien und die Produktion von speziellen Bauteilen statt; alles andere war inzwischen ausgelagert oder sogar ganz an Partnerunternehmen vergeben. Ein lukratives Geschäft, das auf dem feinen Gespür für technologische Entwicklungen aufgebaut war, welches Erich Sander auszeichnete.
Julia Sander kam aus einer wohlhabenden alten Unternehmerfamilie. Erich hatte sie bei einer dreitägigen Verbandsveranstaltung in Paris kennengelernt. Sie hatte ihren Vater begleitet, da ihre Mutter erkrankt war. Julia war eine Frau, genau, wie er sie gesucht hatte. Attraktiv, mit Stil und vor allem mit besten Beziehungen zu allen möglichen Unternehmerfamilien, zu denen Erich Sander als neureicher Emporkömmling keinen Zugang besaß. Julia war sein Schlüssel zu dieser Welt. Wenn Erich Sander sich ein Ziel setzte, erreichte er es. Nach drei Tagen erlag Julia seinem Charme, den er genauso geschickt einsetzen konnte wie sein ältester Sohn Henning.
Ich wusste nicht, ob die Sanders eine glückliche Ehe führten oder sich liebten. Für Erich existierte nur sein Unternehmen, alles andere hat sich dem unterzuordnen, auch seine Frau und seine Familie. Ich konnte mich nicht erinnern, jemals gesehen zu haben, wie Erich seine Frau küsste, streichelte oder ihr irgendeine andere Geste der Zuneigung zeigte. Genauso wenig hatte ich es jemals gesehen, dass er seine Jungs in den Arm nahm.
In meiner Familie war das anders. Meine Eltern überschütteten mich mit Zärtlichkeit. Jeden Abend bekam ich einen Gutenachtkuss von Papa und Mama. Sie nahmen mich in die Arme, wenn ich Trost brauchte. Konnte ich nachts nicht schlafen, kroch ich in ihr Bett. Von beiden Seiten behütet, konnte es kein Monster aus meinen Träumen mit meinen Eltern aufnehmen. Wäre es nach ihnen gegangen, hätte es nicht nur mich in ihrem Leben gegeben, doch durch eine Komplikation bei meiner Geburt konnte Mama keine Kinder mehr bekommen. Vielleicht war das der Grund, weshalb sie die beiden Jungs der Sanders als ihre Kinder ansah. Sie bekamen ähnlich viel Zuneigung von meinen Eltern wie ich.
Meine Eltern hatten ein Ritual. Jeden Abend machten sie einen Spaziergang. Papa, weil er kontrollieren wollte, ob bei den Pferden alles in Ordnung war, Mama, weil sie es genoss, diese Zeit ganz mit ihm alleine zu haben. Händchen haltend wie Teenager zogen sie los, und ich wusste, dass sie diese Zeit nutzen, um sich über alles auszutauschen, was für meine Ohren nicht bestimmt war. Meine Eltern küssten sich häufig, egal ob ich dabei war oder nicht. Mama und Papa hatten sich auf einem Springturnier kennengelernt. Papa war Rittmeister auf dem Nordrhein Westfälischem Staatsgestüt in Warendorf gewesen. Mama war auf dem Turnier für das Catering zuständig. Papa brauchte fast ein halbes Jahr, bis sich Mama das erste Mal mit ihm verabredete. Er war weder ein Draufgänger, noch besonders gut mit Worten. Seine Kraft lag in seiner Stille, sie zog mich magisch an. Bei ihm fühlte ich mich immer sicher, geborgen und verstanden. Bis zu dem Unfall.
Der Hof war das Erbe von Erichs Vater. Seine Geschwister und er wollten das Land mit dem Hof verkaufen, denn keiner hatte Interesse an der Pferdezucht, die ihr Vater eher erfolglos betrieben hatte. Erich nahm die Sache in die Hand und zeigte einem Interessenten den Hof. Nach dem Rundgang entschied er, den Hof selber zu behalten und seine Geschwister auszubezahlen. Er hatte ein neues Ziel anvisiert: Er wollte zeigen, dass auch ein Sander erfolgreich in der Pferdezucht sein konnte, wenn man es nur richtig anpackte. Dafür brauchte er einen Verwalter mit einem guten Gespür für Pferde. Seinen Mann fand er bei der Hengstparade von Warendorf, die jedes Jahr stattfand und die er zu diesem Zweck mit Julia besuchte. Und so kam es, dass er seine neue Vision in Stefans Hände legte.
Erich ließ ihn die ersten Zuchtstuten kaufen und einen Hengst. Für Papa ging damit ein Traum in Erfüllung, er konnte nun seine Vorstellungen umsetzen und war dennoch nicht dem Risiko ausgesetzt, das ihn bis dahin vor einer Selbstständigkeit abgeschreckt hatte. Eine weitere Eigenschaft, die Erich Sander auszeichnete, bestand darin, das Potenzial in einem Menschen zu sehen. Dennoch war ich mir sicher, dass Papas Erfolge selbst ihn überraschten. Die Pferdezucht brachte Erich erneut in einen Kreis von Menschen, zu denen er bislang keinen Zugang gehabt hatte. Menschen, mit denen sich vor allem Julia Sander gerne umgab, da hier echter Adel vertreten war. Aus den Erfolgen mit den Pferden sowie den daraus resultierenden neuen Kontakten bezog Erich neues Geschäftspotenzial für sein Unternehmen.
Die Wochenendbeziehung, die aus dem neuen Job meines Vaters resultierte, behagte meinen Eltern nicht. Die Lösung kam, als das Anwesen in der Nähe des Hofs zum Verkauf stand. Julia hatte sich in dieses Anwesen verliebt. Für sie stellt es den idealen Ort da, um ihre Kinder, von dem das Erste bereits unterwegs war, großzuziehen. Außerdem bot es ein perfektes Ambiente für die gesellschaftlichen Feste, die die Sanders für ihre neue Umgebung ausrichteten. Daher erfüllte ihr Erich gerne den Wunsch, obwohl es für ihn bedeutete, dass er in Zukunft eine dreiviertel Stunde in seine Firma fahren musste. Das Haus war groß, der Garten noch viel größer, also brauchte Julia eine Hauswirtschafterin. Papa schlug Mama vor, sich auf diese Stelle zu bewerben. Mama behauptete immer, das wäre Papas seltsame Art gewesen, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Julia mochte Mama und stellte sie ein. Dann waren erst Henning und Thomas auf die Welt gekommen, und zuletzt ich.
Anfangs nahm Mama mich zu ihrer Arbeit mit, später waren wir Kinder meistens auf dem Hof. Dort durften wir toben, spielen, laut sein und uns nach Herzenslust dreckig machen. Wir waren die einzigen Kinder im Umkreis, und keiner brachte uns in einen Kindergarten. Das änderte sich erst, als Henning eingeschult wurde. Ich verzog das Gesicht, als ich an mein erstes Jahr in der Schule dachte, denn mir war die Umstellung besonders schwergefallen. Zum Glück gab es Henning und vor allem Thomas, die mir halfen, mich einzugewöhnen. Wirklich einsam fühlte ich mich, als beide auf das städtische Gymnasium wechselten. Meine Noten reichten nur für die Hauptschule.
Nach und nach nahmen die Pferde in meinem Leben einen immer größeren Platz ein. Das füllte die Lücke aus, die durch das Auseinanderdriften unseres Dreiergestirns entstanden war. Papa hatte uns allen das Reiten beigebracht. Henning fühlte sich wohler auf einem Traktor oder noch besser, wenn es galt, diese Geräte zu reparieren. Für Thomas war Reiten endlich mal etwas, wo er besser war als sein Bruder. Einen Teil seiner Motivation bezog er daraus, einen anderen Teil aus dem Interesse, das Erich an seinen Reitkünsten fand. Sein Vater förderte dieses Hobby in jeder Hinsicht. Ich hingegen fand Pferde faszinierend. Ihre Schönheit, die Stärke, die Bewegungen, die Art, wie sie im Herdenverband agierten. Die Tatsache, dass sie bereit waren, einen Menschen zu tragen, hatte es mir ganz besonders angetan. Manche Reiter denken, dass Pferde zu dumm seien, sich ihrer Kraft gar nicht bewusst wären oder einfach dominiert werden mochten. Ich betrachtete es hingegen als ein Geschenk, eine Art Ehre, dass sie mich trugen.
Meine Gedanken brachten mich in eine Richtung, über die ich nicht weiter nachdenken wollte. Fröstelnd schlang ich die Arme um mich und wandte dem Bild den Rücken zu, das so viele Erinnerungen in mir geweckt hatte.
4
Kapitel
Die Klingel befreite mich von meinen Gedanken. Froh um die Störung ging ich zur Haustür und blieb davor stehen. Was sollte ich machen, wenn es jemand vom Stall war?
Ungeduldig klingelte es zweimal hintereinander. Ich wappnete mich innerlich und machte die Tür auf. Vor mir stand Henning. Mit strubbeligen, von der Sonne ausgebleichten blonden Haaren, ein breites Grinsen im Gesicht, das um seine braunen Augen herum in lauter Fältchen endete. Er war die zwei Stufen vor der Haustür bereits wieder hinuntergegangen, sodass ich auf ihn herabsehen musste.
„Henning?“, rief ich überrascht aus.
„Ich denke, so heiße ich“, antwortete er grinsend.
„Aber was machst du hier? Ich meine, ich dachte du wärst in Kanada?“
„Tja, so kann man sich täuschen, nicht wahr.“ Er ließ seine Augen über mich wandern. „Du hast zugenommen. Und kräftiger siehst du auch aus. Schön.“
Ich sah mich an. Ja, er hatte recht, das letzte Mal hatten wir uns gesehen, als ich noch in der Reha gewesen war. Meine körperliche Verfassung war erbärmlich gewesen und es hatte nichts auf der Welt gegeben, was mich in jenen ersten Tagen hätte motivieren können, daran etwas zu ändern. Bis Henning irgendwann aufgetaucht war und mir die Leviten gelesen hatte. Er wurde in den nächsten Wochen mein schlimmster Folterknecht. Und so sehr ich ihn dafür hasste, so schmerzlich hatte ich ihn vermisst, als er einige Zeit später wieder nach Kanada gegangen war. Doch auch von dort aus hatte er weiterhin jeden Tag angerufen und meine Fortschritte kontrolliert. Wenn ich seine Anrufe ignorierte, fragte er bei meinen Eltern nach. Woraufhin Papa meistens kurze Zeit später besorgt auftauchte. Also gewöhnte ich mir an, Hennings Kontrollwut mit Spott zu begegnen. Dann war ich abgehauen.
Das schlechte Gewissen, das ich zwei Jahre lang keinen Versuch gemacht hatte, mich bei ihm zu melden, verunsicherte mich. Es war gemein gewesen von mir, nachdem er mir so sehr geholfen hatte, die Schlimmste zeit meines Lebens zu überstehen. Mein erster Impuls, ihn zu umarmen, schlug um, und ich hielt mich verlegen an der Haustür fest. Ich war mir nicht sicher, wie sehr ich ihn mit meiner Ignoranz verletzt hatte.
„Wir haben uns lange nicht mehr gesehen“, stellte er immer noch grinsend fest. Er streckte die Arme aus. „Komm her, ich beiß dich nicht.“
Ich überwand die zwei Stufen. Lachend zog er mich in seine Arme. Ich schloss die Augen, meine Nase atmete tief den Geruch seines Dufts nach Sandelholz ein. Seine Umarmung weckte in mir das Gefühl von Wärme und Geborgenheit. Schnell befreite ich mich aus seinen Armen und boxte ihn kameradschaftlich gegen die Brust. Er sah mir forschend in die Augen, dann zupfte er an meiner Bluse.
„So kann ich dich nicht mitnehmen. Hast du nicht noch ein paar alte Jeans und ein Sweatshirt?“
„Wieso mitnehmen? Wohin willst du mich mitnehmen?“ Misstrauisch sah ich ihn an. Mein ganzes Leben mit ihm hatte mich gelehrt, dass ich mit Ideen von Henning vorsichtig umgehen musste.
„Ich dachte, du hättest vielleicht Lust, mit mir die Zäune von der Talwiese zu reparieren, anstatt hier faul herumzulungern und die Zeit totzuschlagen.“
„Seit wann kümmerst du dich um Zäune, anstatt im Büro die Sekretärinnen rumzukommandieren?“
Henning fing an zu lachen.
„Wieso nicht? Wer soll sich sonst darum kümmern?“ Darauf antwortete ich lieber nicht. Ich hatte keine Lust auf eine Diskussion über Thomas, der mir eher zum Thema Stall, Pferde, Wiesen einfiel.
„Wie lange brauchst du zum Umziehen? Wir müssen los.“
Ich benötigte für die Entscheidung nur wenige Augenblicke. Es war allemal besser, Henning bei den Zäunen zu helfen, als hier weiter herumzuhängen. Bei der Talwiese bestand keine Gefahr, dass wir auf die Pferde stießen, die Wiese war von Wasseradern durchzogen. Wir nutzten sie nur im Hochsommer für die Mutterstuten mit ihren Fohlen, und jetzt war Frühjahr.
„Drei Minuten.“
Ich nahm zwei Stufen auf einmal, riss den Kleiderschrank auf und holte eine alte Jeans, ein T-Shirt und ein Sweatshirt heraus. Dann überfielen mich wieder Zweifel. War es wirklich so eine gute Idee, Zäune zu bauen? Würde es mich nicht noch mehr in meine Vergangenheit stoßen, wenn ich Dinge tat, die früher tagtäglich zu meinem Leben gehörten? Und was, wenn wir auf dem Weg doch ein Pferd sahen, oder, noch schlimmer, jemand auf einem Pferd an der Wiese vorbeigeritten kam? Ich setzte mich auf mein Bett, ein wenig schwindelig von meinen Gedanken. Ein scharfer Pfiff ertönte von unten. „Hey, du lahme Ente. Muss ich hochkommen und dir beim Anziehen helfen?“
Mir wurde klar, dass ich aus der Nummer nicht so einfach wieder rauskommen würde. Ich band mein Haar zu einem Pferdschwanz und schnappte mir meine alte Baseballkappe.
„Das waren mindestens zehn Minuten“, stellte Henning mit Blick auf seine Uhr streng fest.
Ich musste grinsen und boxte ihn auf den Arm. Überrascht runzelte ich die Augenbrauen und drückte mit den Fingern auf seine Oberarmmuskeln. „Hey, was ist das?“
Henning löste meine Finger von seinem Arm. „Spürst du das nicht? Echte Muskeln.“
„Wow.“ Anerkennend nickte ich mit dem Kopf. „Und wie bekommt man an die, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt?“
„Jedenfalls nicht, indem man Sekretärinnen herumkommandiert, die ich im Übrigen nicht habe. Heutzutage gibt es dafür Assistenten.“ Er kniff verschwörerisch ein Auge zu. „Los jetzt, wir haben schon lang genug rumgetröllert.“
Sein Spruch mit den Assistenten brachte mich auf einen beunruhigenden Gedanken. War es wirklich ratsam, mit einem Büromenschen Zäune zu bauen? Von der Kraft her traute ich es mir zu, ein paar Pfosten in den Boden zu hauen. Mit dem Traktor konnten wir aber nicht auf die Wiese fahren, sonst würden wir die Grasnarbe zerstören. Und aufgrund meiner Armverletzung von dem Unfall besaß ich nicht mehr die gleiche Ausdauer wie früher. Vielleicht wäre es besser, jemand anderes mitzunehmen, der diesen Job normalerweise machte. Schließlich hatten mich die Sanders ersetzen müssen, und irgendjemand würde den Hof ja verwalten, jetzt, wo Papa im Krankenhaus lag.
„Weißt du was, ich bring dich zurück nach Hause, dann kannst du ins Büro fahren. Hat Papa noch jemanden auf dem Hof, der mir beim Zaun helfen kann?“
„Ja, mich. Hast du damit ein Problem?“ Abschätzig musterte er mein Gesicht, wobei er wohl das große Fragezeichen darin sah. Ein spitzbübisches Lächeln huschte über seine Lippen. „Du glaubst, ich kann das nicht“, stellte er fest. Dann lachte er laut, als er noch mehr Skepsis auf meinem Gesicht entdeckte. Er drehte sich um und stieg ins Auto. Ich blieb unschlüssig stehen. Henning ließ den Motor an und öffnete das Fenster der Beifahrertür. „Kommst du jetzt oder nicht?“
Ich kletterte in den Geländewagen, der bereits mit Eichenpfählen beladen war. Mein Blick fiel auf den leeren Reitplatz. Schnell zog ich mir die Kappe ins Gesicht. Henning fuhr los.
„Seit wann bist du aus Kanada zurück?“, unterbrach ich die Stille. Ich betrachtet sein Profil von der Seite, während er sich auf den Feldweg konzentrierte. Sein Gesicht war von der Sonne deutlich gefärbt. Was darauf schließen ließ, dass er tatsächlich nicht ständig im Büro saß. Oder er kam gerade aus dem Urlaub. Um seine Augen waren feine weiße Striche. Ich fragte mich, ob er noch immer so gerne und oft lachte. Sein Lachen war immer ansteckend gewesen. Als Kinder hatten wir viel miteinander gelacht.
„Oh, ich bin öfter hier. Im Grunde genommen bin ich die halbe Zeit in Kanada und die übrige Zeit in Deutschland. Thomas kümmert sich um unsere ausländischen Niederlassungen.“
„Thomas arbeitet in der Firma?“, fragte ich erstaunt. „Hat er dann noch genug Zeit für das Training?“
„Er hat einen Trainer.“ Er warf mir einen schnellen Blick zu. Ich wich ihm aus, Henning sollte meine Unsicherheit nicht sehen. Mir war selber nicht klar, welche Gefühle ich Thomas gegenüber hegte. Im Grunde genommen hatte er die ganzen letzten Jahre keine Rolle mehr gespielt. Zumal ich bereits vor dem Unfall beschlossen hatte, dass er in mein Leben nicht passte. Oder kam meine Unsicherheit eher von dem Gedanken, dass es einen Trainer auf dem Hof gab? Jemand, der meine Arbeit machte? Ich musterte die Büsche am Wegesrand. Bereits auf meinem Heimflug war mir klar geworden, dass das hier nicht einfach werden würde.
„Keine Angst, die Wiesen sind alle leer. Die Pferde sind im Stall“, sagte Henning mit ruhiger Stimme. Er schien meine Gedanken zu lesen.
„Hast du Stefan gestern Abend noch gesehen?“, fragte er in das Schweigen hinein, das sich erneut zwischen uns ausbreitete.
Ich schüttelte den Kopf. „Nein. Ich bin erst gegen Mitternacht gelandet. Mama und ich dürfen am Nachmittag zu ihm, weil sie heute Morgen einige Untersuchungen vornehmen möchten.“
„Wann wollt ihr los?“
„Mama meinte, sie wäre gegen sechzehn Uhr zurück.“
„Alles klar, bis dahin müssten wir fertig sein.“
Ich sah aus dem Fenster und hing meinen Gedanken nach. Die Wiesen, an denen wir vorbeikamen, sahen verwahrlost aus, und die Zäune machten einen brüchigen Eindruck. Ich runzelte die Stirn. Es war ungewöhnlich für meinen Vater, dass er die Dinge so verkommen ließ. In meiner Zeit, wo ich auf dem Hof arbeitete, hatte er mich oft genug bis an den Rand der Erschöpfung getrieben. Die Wiesen mulchen, abäppeln, Bänder spannen, Zaunpfosten ausbessern, Bodenproben nehmen, entsprechend der Ergebnisse düngen, Bereiche komplett neu einsäen, das alles war nur ein Teil meiner Aufgaben gewesen. Dazu war die Buchführung gekommen, Statistiken, Turnieranmeldungen, die Papiere der Pferde, Versicherungen, Urkunden, Einkäufe, Inventarlisten, Materialcheck und Investitionspläne. Und dann natürlich die Arbeit mit den Pferden. Futterpläne, Trainingspläne, Boxen misten, striegeln, Hufe pflegen, Zähne raspeln, Stall fegen, Geschirre und Sättel putzen, fetten, Pferde longieren, die Freiarbeit und das Reiten. Ich liebte den Winter, da blieb immer genug Zeit für die Pferde. Ansonsten hatten meine Arbeitstage sehr oft länger als zwölf Stunden gedauert. Etwas, das mich nie gestört hatte, denn ich liebte meine Arbeit.
Je weiter wir fuhren, desto mehr drängte sich mir der Zustand der Wiesen auf. Gab es denn niemanden außer Papa, der sich darum kümmerte?
„Das sieht hier ganz schön wild aus“, wandte ich mich an Henning.
„Du meinst die Wiesen?“
„Ja. Wen um alles in der Welt hat Papa denn für mich eingestellt?“
Henning sah kurz zu mir rüber.
„Niemand.“
„Das verstehe ich nicht.“
„Was verstehst du daran nicht, Vera?“
„Na, irgendjemand muss ihm doch bei den landwirtschaftlichen Arbeiten, bei den Pferden und dem ganzen Bürokram helfen. Das alles kann Papa nicht alleine gemacht haben.“
Wir waren an der Wiese angekommen, Henning bremste den Wagen ab. Er drehte sich zu mir um.
„Für die Pferde hat Thomas einen Trainer eingestellt, wie ich vorhin bereits erwähnte. Ich glaube, es ist der sechste oder siebte, denn keiner hält es besonders lange mit Stefan aus. Bei den Wiesen hilft ihm manchmal Paul, wenn er nicht gerade auf seinen eigenen genug zu tun hat, oder ich, wenn ich hier bin und Zeit erübrigen kann. Momentan gibt es eine Auszubildende, die den Stall macht und bei den Pferden hilft, das war’s.“
„Was willst du mir damit sagen?“
„Gar nichts, Vera. Ich habe dir lediglich deine Frage beantwortet.“ Seine Stimme klang ärgerlich und ein wenig frustriert. Ich verkniff mir weitere Fragen. Sein kleiner Vortrag verletzte mich, aber ich wusste nicht, weshalb. Klar, er hatte nur meine Frage beantwortet. Doch hintergründig machte er mir einen Vorwurf, das spürte ich. Oder lag es an meinem schlechten Gewissen, das sich meldete? Hatte Papa niemand eingestellt, weil er auf meine Rückkehr hoffte? Ich schob meine Unterlippe vor. Ich war gegangen, ja. Ich hatte nie darüber nachgedacht, ob das Konsequenzen für meine Eltern und speziell für Papa mit sich brachte. Doch war es nicht ganz normal, dass die Kinder irgendwann ihr Elternhaus verließen, und gab es nicht genügend Leute, die sich über so einen Job freuten?
„Bist du sauer?“
Ich schüttelte den Kopf, antwortete aber lieber nicht.
„Ist es gefährlich, dir einen Holzhammer in die Hand zu geben?“
Ich zog eine Grimasse. „Vielleicht. Einige Gäste in dem Hotel, wo ich zuletzt gearbeitet habe, beschwerten sich über den Service. Stell dir vor, am nächsten Tag waren sie verschwunden.“
„Hui, wie gruselig.“ Wir lachten beide und stiegen aus dem Auto. Ich sah mich um. Es gab einiges, was erneuert werden musste. Henning warf mir ein paar Handschuhe zu.
„Fünf Stück brauchen wir hier“, er öffnete die Klappe von der Ladefläche und zog bereits den ersten Pfahl herunter, bevor ich die Handschuhe überstreifen konnte. Die Pfähle waren schwer. Soweit es ging, fuhr Henning zu den Stellen, wo wir die Pfähle brauchten. Einige mussten wir über die Wiese tragen. Bereits beim Verteilen der Pfosten kam ich ins Schwitzen. Es war lange her, dass meine Arme solch eine Arbeit verrichtet hatten. Ich biss die Zähne zusammen.
Ich wollte nicht, dass Henning mich für ein Weichei hielt, dafür erinnerte ich mich noch zu genau an sein „Coaching“ in der Reha. Memme, dachte ich grimmig, was war ich doch für eine Memme geworden. Ich begann, Löcher in die Erde zu bohren, und überließ das restliche Verteilen der Pfosten Henning. Als Nächstes hielt ich die Pfosten, während Henning sie mit einem Holzhammer in den Boden trieb. Mit gleichmäßigen Schlägen verschwanden die Spitzen in der Erde. An mehreren Stellen schraubten wir diagonale Latten zwischen die Pfosten, sodass Dreiecke entstanden. Das stabilisierte den Zaun, danach konnten wir den Stromdraht anbringen.
Die Arbeit brachte mich mehr und mehr ins Schwitzen. Ich zog mein Sweatshirt aus, und Henning folgte meinem Beispiel. Beim Schwingen des Hammers konnte ich dem Muskelspiel von seinen Oberarmen folgen, was mich aus dem Konzept brachte.
„Was ist? Bist du k.o.?“
„Nein.“ Ich grinste und wischte mir den Schweiß von der Stirn. Dann klopfte ich probehalber auf seinen Bauch. „Ist der Bauch auch so fest?“
„Konzentrier dich lieber auf deine Arbeit“, knurrte er, „ich will heute damit fertig werden.“
Nach zwei Stunden war ich erschöpft. Ich spürte jeden einzelnen Muskel in meinem Körper. Vor allem im Nacken. Ich dehnte mich, Henning setzte die Flasche Wasser ab. „Brauchst du eine Pause? Ich kann auch erst mal alleine weitermachen.“
„Nein. Ist nur ungewohnt“, versuchte ich meinen Zustand herunterzuspielen.
„Tja, wer hätte gedacht, dass Vera Kamphoven mal schneller schlapp ist als ich.“ Er wusste genau, wo er mich packen konnte.
„Wer als Erster an der Eiche ist“, rief ich und sprintete bereits los. Ich gab alles, damit ich den kleinen Vorsprung für die zehn Meter bis zum Baum halten konnte. Ich kam als Erste an und warf mich in den Schatten. Wenigstens für einen kurzen Augenblick wollte ich doch eine Pause rausschinden. Henning ließ sich neben mich fallen.
„Aber schneller bin ich immer noch.“
„Nur weil du mich überrascht hast.“ Hennings Atem ging ruhig und gleichmäßig. Ich legte mich auf die Seite, stützte meinen Kopf auf die Hand und betrachtete ihn nachdenklich.
„Du hast mich gewinnen lassen.“
Er drehte den Kopf und grinste mich an. „Ich wollte dein Weltbild nicht völlig ins Wanken bringen.“
„Hast du in Kanada richtig gearbeitet, oder gehst du ins Fitness-Studio?“ Meine Augen glitten über seinen Körper
„Glaubst du, ein Unternehmen zu leiten wäre keine Arbeit?“
„Doch, natürlich. Aber anders. Du weißt, was ich meine.“
„Ja, weiß ich.“
„Und?“, fragte ich neugierig, als er weiter schwieg.
„Fitness-Studio, Laufen und die Arbeit hier.“
Ich legte mich wieder zurück ins Gras. „Ich stelle fest, ihr Männer heutzutage seid ganz schön eitel.“
Er setzte sich auf, musterte meinen Körper, kniff mir in meinen Oberarm und in meine Taille. „Du könntest auch mal wieder mehr machen.“
Ich schlug seine Hand weg. „Lass das. Ich liebe meinen Speck. Außerdem bin ich nicht so eitel wie du.“
Henning schwieg. Ich betrachtete die Sonnenstrahlen, die durch die Blätter auf meine Handfläche trafen. Der Wind strich durch die Äste und ließ die Schatten auf meinen Armen tanzen. Henning stand auf, stellte sich über mich und reichte mir die Hand.
„Auf, du faules Stück. Genug herumgelungert.“
Ich ließ mich von ihm hochziehen. Aus meinen Haaren lösten sich Strähnen, die mich schon vorhin bei der Arbeit gestört hatten. Ich gab Henning die Kappe und band mir den Pferdeschwanz neu. „Na, doch eitel?“, feixte er.
Ich nahm die Kappe aus seiner Hand und schlug ihm damit auf den Kopf. „Ganz bestimmt nicht, und schon gar nicht bei dir. Schließlich kennst du mich schon in Windeln.“
„Ja, stimmt. Da warst du aber noch süß und nicht so frech.“
„Quatschkopf. Los, lass uns weitermachen.“
Pfosten um Pfosten schlugen wir in den Boden. Henning zog das Tempo an, und mir fiel es zunehmend schwerer mitzuhalten. Mittags hatten wir mehr als die Hälfte geschafft. Mein Magen knurrte laut, da ich morgens nur Obst gegessen hatte. Mir fehlten die Kohlenhydrate.
„Okay, ich hab verstanden. Wir machen Pause“, gab Henning das ersehnte Pausensignal, als mein Magen ein weiteres tiefes Grollen hören ließ. Während ich zu dem Baum trottete, holte Henning einen Korb aus dem Auto. Ich sah gleich, dass Mama den Korb gepackt hatte. Es lag eine karierte Decke dabei, und es gab Stoffservietten, Porzellanteller und ein richtiges Besteck. Das eingepackte Essen bestand aus Möhren, Tomaten, Gurken, Broten, dick mit Butter, Wurst und Salat belegt, es gab kleine Schnitzel, Äpfel und vier Stücke Marmorkuchen. Eine Thermoskanne mit Kaffee fehlte ebenso wenig wie zwei Flaschen Apfelschorle. Hungrig stürzte ich mich auf das Essen. Ich überließ Henning die Schnitzel, dafür machte ich mich über meinen geliebten Marmorkuchen her, den ich schon so lange nicht mehr gegessen hatte. Beim ersten Bissen schloss ich die Augen. Die feine Säure, gepaart mit dem bitteren Kakao und dem süßen Zucker. Niemand bekam das so hin wie Mama. Der Geschmack des Kuchens weckte tausend Erinnerungen an Kindergeburtstage, Reitturniere und gemeinsame Wochenenden.
„Hey, lass mir auch noch was von dem Kuchen.“ Schnell griff Henning nach den letzten beiden Stücken.
„Du hast die ganzen Schnitzel gehabt“, knurrte ich.
„Und du wirst zu dick, wenn du zu viel davon isst.“
„Blödsinn.“ Ich schnappte mir noch ein Stück aus seinen Händen. Er stopfte sich mit zwei übertrieben großen Bissen den Kuchen in den Mund. Was für eine Verschwendung. „Du bist wirklich ganz schön kindisch heute“, stellte ich fest.
Er zuckte mit den Achseln. „Nein, nur hungrig. Sei froh, dass ich mein Essen mit dir geteilt habe.“
Er hatte Recht, wieso sollte Mama auch Essen für mich einpacken, schließlich arbeitete ich nicht mehr auf dem Hof. Das hatte ich völlig vergessen. Henning rollte seinen Pullover in den Nacken.
„Was hast du vor?“
„Halbe Stunde Pause.“ Seine Augen waren bereits zu. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Ich packte die Sachen in den Korb, aß noch zwei Karotten und suchte mir ein gemütliches Plätzchen halb im Schatten, halb in der Sonne.
Ich griff mir an die Nase, irgendetwas kitzelte mich. Es verschwand, tauchte dann aber wieder an der Wange auf. Ich öffnete die Augen, bereit, jedes Ungeziefer zu vertreiben, das es wagte, meine Mittagsruhe zu stören. Das Ungeziefer war verdammt groß. Vor mir saß Henning im Schneidersitz, einen langen Halm in der Hand. Mir lag eine böse Bemerkung auf den Lippen, als ich hinter ihm den Himmel sah. Die Sonne stand bereits tief im Westen.
Ich fuhr erschrocken hoch. „Oh nein, wie viel Uhr ist es?“
„Keine Angst, es ist noch früh genug.“
Ich sprang mit einem Satz auf. „Mensch, warum hast du mich nicht geweckt! Wir wollten doch den Zaun noch fertig machen.“
„Du hast so schön geschlafen. Fest wie ein kleines Baby. Bis auf das Schnarchen.“
„Kannst du mal aufhören, mich zu ärgern?“, fuhr ich ihn an.
„Klar.“ Er stand auf. „Alles, was du möchtest.“ Es verunsicherte mich, wie er da vor mir stand, die Hände ausgebreitet. Ich ging einen Schritt zurück, drehte mich um. Mein Gehirn war vom Schlafen noch auf langsamen Modus gestellt. Henning stellte sich hinter mich und zeigte mit der Hand über meine Schulter auf den Zaun. Er war fertig.
„Hab ohne dich weitergemacht. Was nicht heißen soll, dass wir morgen nichts zu tun hätten. Oder wolltest du dich doch lieber in einem Sonnenstuhl auf die Terrasse setzen, weil du die körperliche Arbeit nicht mehr gewohnt bis?“
Mein Gefühl schwankte zwischen Beleidigtsein und Ignorieren. Nach seiner seltsamen Antwort von davor entschied ich mich fürs Ignorieren. In keinem Fall würde ich klein beigeben. Obwohl mir sehr bewusst war, dass er mich mit dem Spielchen genau dorthin brachte, wo er mich haben wollte.
Wir gingen zum Auto zurück. Ich zog die Handschuhe aus und warf sie ihm zu: „Morgen, gleiche Zeit, gleicher Ort.“ Ich sah mich um und korrigierte mich. „Neuer Ort. Wollen mal sehen, wie lange du durchhältst.“
Henning grinste breit. Wir verstauten alles im Auto, stiegen ein und fuhren zurück.
5
Kapitel
Ich schloss die Haustür auf.
„Mama?“
Keine Antwort. Ich sah in der Küche nach. Kein Zettel, nichts. Ich ging die Treppe hoch, aber auch hier war sie nicht. Etwas ratlos stand ich im Flur, dann stieg mir mein eigener Geruch in die Nase. Ich hatte kräftig geschwitzt. Bis ich geduscht war, würde Mama schon auftauchen. Zwanzig Minuten später stand ich fertig für das Krankenhaus in der Küche, ratlos. Von Mama noch immer keine Spur. Ich sah auf die Uhr, schon halb fünf. Sollte ich bei den Sanders anrufen? Mein Blick schweifte von der Uhr zum Telefon und wieder zurück. Nein, zehn Minuten würde ich noch warten. Die Minuten verstrichen. Zögernd näherte ich mich dem Telefon.
Es klingelte an der Tür, bevor ich das Telefon abheben konnte. Hatte Mama etwa ihre Schlüssel vergessen? Es klingelte erneut, und ich ging an die Tür.
„Hey.“ Verwundert starrte ich Henning an. Frisch geduscht, in schwarzer Hose, weißem Hemd und einem grünen Pullover stand er da und lachte mich fröhlich an.
„Was ist los?“
„Junge Frauen sollte man nicht alleine lassen.“ Anscheinend sah ich genauso verständnislos aus, wie ich mich fühlte. Sein Grinsen wurde stärker, dann versuchte er ernsthaft auszusehen. „Deine Mama ist vor zwei Stunden ins Krankenhaus gefahren.“ Er zog sein Handy aus der Tasche. „Sie hat versucht, mich zu erreichen, aber ich hatte vergessen, dass wir bei der Wiese in einem Funkloch sind. Und da sie sich nicht sicher war, ob du überhaupt bei mir bist, ist sie schon losgefahren.“
Der Boden wankte vor meinen Augen, meine Knie sackten ein. Er ist tot, schoss es mir durch den Kopf. Henning fing mich auf.
„Hey, langsam. Was denkst du? Dass ich grinsend vor dir stehe, wenn etwas Schlimmes passiert wäre?“
Er half mir vorsichtig, auf der Treppe niederzusitzen. Ich schüttelte den Kopf. Henning legte den Arm um mich, und das war zu viel für mich. Die Tränen kullerten aus meinen Augen, ich kam mir ziemlich blöd vor. Ich heulte seinen schönen Pullover nass, und er ließ mich einfach. Irgendwann zog er ein Taschentuch aus der Hosentasche und reichte es mir. Ich schniefte es voll.
„Besser?“
Ich versuchte zu lächeln, doch mir gelang nur eine Grimasse.
„Ein bisschen viel für dich“, stellte er fest.
„Es geht schon wieder. Nur...“, ich setzte mich gerade, sah hoch und schaute genau auf den Reitplatz. Jemand sprang mit einem Pferd über ein Hindernis. Das Pferd war gut, richtig gut, wie ich sofort erkannte. Mir stockte zum zweiten Mal das Herz. Ich wandte meinen Blick schnell Henning zu. Mit einer Armbewegung umfasste ich alles rund um mich herum. „Hier zu sein fällt mir schwerer, als ich gedacht habe. Und dann liegt auch noch Papa im Krankenhaus.“
Er nickte.
„Weshalb ist Mama denn jetzt ins Krankenhaus gefahren?“
„Die Ergebnisse von der Untersuchung sind da, und der behandelnde Arzt wollte mit Marianne das weitere Vorgehen besprechen.“
Das war längst nicht so beruhigend, wie ich es erhofft hatte.
„Möchtest du ins Krankenhaus? Ich muss noch ins Büro. Ich könnte dich mitnehmen.“
Ich nickte. „Das wäre total nett von dir.“
Eine dreiviertel Stunde später war ich im Krankenhaus. Henning hatte mich bis zur Intensivstation begleitet und sich dann verabschiedet. Ich klingelte an der Tür und wartete mit klopfendem Herzen.
Der Vorraum war sehr hell. Eine Sitzgarnitur mit einladenden Stühlen, auf dem Tisch lagen Zettel, mit denen die Angehörigen über das Verhalten auf einer Intensivstation informiert wurden. An den Wänden hingen schöne Bilder. Trotzdem empfand ich den Raum als beklemmend. Es knackte in der Sprechanlage.
„Ja, bitte?“
Ich musste mich räuspern. „Vera Kamphoven. Ich glaube, mein Vater, Stefan Kamphoven, liegt bei Ihnen.“ Es knackte erneut, und für den Bruchteil einer Sekunde hoffte ich, dass die Stimme mir sagen würde, dass das nicht der Fall sei.
„Warten Sie bitte, jemand holt Sie gleich ab.“
Es verstrichen zehn Minuten, bis sich eine Art metallene Schiebetür öffnete. Eine ältere Frau in einem Schwesternkleid kam heraus, auf ihrer Brust ein Schild: Schwester Brigitte. Sie lächelte mich freundlich an.
„Kommen Sie, Frau Kamphoven.“ Ich folgte ihrer Aufforderung. Sie deutete nach links. „Bitte waschen Sie sich die Hände und desinfizieren Sie sich danach. Wir möchten ja die Patienten nicht unnötig mit Keimen belasten.“ Ich nickte stumm, und meine Beklemmung wuchs. Das alles erinnerte mich an eine Zeit, wo ich selbst auf so einer Station gelegen hatte.
Die Zimmertüren standen offen. Ich vermied den Blick in die belegten Zimmer und konzentrierte mich auf den Gang. Dann blieb sie vor einem Raum stehen.
„Ihre Mutter ist gerade bei dem Stationsarzt, aber ich denke, sie wird auch gleich kommen.“ Dann ließ sie mich alleine.
Ich sah in den Raum und hielt mich mit der Hand am Türrahmen fest. Mein Vater wendete den Kopf, ganz langsam. Seine Augen waren halb geschlossen. Als sein Blick mich traf, öffneten sie sich ganz. Große helle, unglaublich blaue Augen. Ich schluckte und war froh, dass ich mich bei Henning ausgeheult hatte, spätestens jetzt wäre ich sonst zusammengeklappt. Das Gesicht glättete sich für einen kurzen Augenblick, die Mundwinkel gingen nach oben. Schnell machte ich die zwei Schritte bis zum Bett, setzte mich auf den Rand und ergriff seine Hand.
„Hallo, Papa“, flüsterte ich, „was machst du denn für Sachen.“
„Quatsch mach ich.“ Seine Stimme knisterte und klang brüchig. „Ich hab Durst.“ Mein Blick schweifte durch das Zimmer. Ich konnte keinen Becher entdecken.
„Ich frage schnell die Schwester.“
Unmerklich drückte er meine Hand. „Nein, bleib. Dass du hier bist, ist so schön.“ Seine Augen schlossen sich. Der Atem ging flach und schwer. Um uns herum malten Computer Kurven auf Monitore. Eine Zahl blinkte wild. Panik ergriff mich, dann sah ich, dass eine Klammer mit einem Kabel auf der Decke lag. Ich wusste von meiner eigenen Zeit auf der Intensivstation, dass diese Klammer auf irgendeinen Finger musste, doch auf welchen?
Schwester Brigitte kam herein. Sie befestigte die Klammer wieder am Mittelfinger, dann reichte sie mir eine schmale Packung. „Wenn er Durst hat, können Sie ihm das Stäbchen geben.“
„Kann er denn kein Wasser haben?“ Ich flüsterte unwillkürlich.
„Nein. Er soll um sieben Uhr in den OP.“
„Es wird operiert?“
Sie nickte. Es piepte auf dem Flur. „Ihre Mutter wird Ihnen das gleich erklären.“ Sie verschwand.
Ich streichelte meinen Vater, küsste ihm die Stirn. Er machte die Augen auf.
„Hmh, da ist meine Tochter nach so langer Zeit bei mir, und was mache ich dummer Kerl. Schlafen. Erzähl mir was, Vera“, bat er mich.
Mein Kopf war vollkommen leer, mir fiel nichts ein. Krampfhaft suchte ich nach irgendeiner Geschichte.
„Ich hab heute mit Henning den Zaun auf der Talwiese in Ordnung gebracht.“ Es war das Einzige, was mir spontan in den Sinn gekommen war. Stefan hob seinen Kopf leicht, drehte ihn ganz zu mir, legte ihn wieder ab und sah mich mit seinen blauen Augen an.
„Du hast den Zaun gemacht?“
„Ja.“ Ich erzählte ihm, wie viele Pfosten wir gebraucht hatten und dass ich es Henning überlassen musste, sie in den Boden zu schlagen, weil ich zu schlapp gewesen war. Er hörte mir aufmerksam zu.
„Und das hat dir nichts ausgemacht?“, fragte er, als ich fertig war. Ich sah ihn an. Hatte es mir etwas ausgemacht? Nein. Im Grunde genommen war es ein schöner Tag gewesen. Bevor ich ihm eine Antwort geben konnte, kam Mama ins Zimmer. Sie ging zu Stefan und gab ihm einen Kuss auf die Stirn, genau wie ich es gemacht hatte. Dann ging sie auf seine andere Seite. Mir nickte sie nur kurz zu.
„Ich hab jetzt alles unterschrieben. Du wirst gleich operiert. Der Arzt macht einen kompetenten Eindruck. Er sagt, es wäre alles Routine, wir bräuchten uns keine Sorgen zu machen.“ Ich sah ihr an, dass das Gegenteil der Fall war. Auch Papa konnte es sehen.
„Was haben sie denn vor?“
„Sie können keine Stands machen, weil wohl die Arterien zu dicht sind, also bekommst du jetzt drei Bypässe verpasst.“
Meine Mutter fing an zu weinen, was mich völlig überforderte. Mein Papa drückte wieder meine Hand. „Kümmere dich um deine Mama.“ Ich stand auf, ging zu Marianne rüber und nahm sie in den Arm. Sie wehrte sich nicht. Ich streichelte ihren Rücken, schließlich fasste sie sich.
„Tut mir leid. Ich wollte nicht rumheulen.“
Ich setzte mich wieder zu Papa und nahm seine Hand. Sein Herzschlag, der sich prompt erhöht hatte, als Mama weinte, beruhigte sich wieder. Mama setzte sich auf die andere Bettkante und versuchte tapfer ein Lächeln. Die Zeit verstrich, wir schwiegen. Jeder hing seinen Gedanken nach, aber keiner wagte etwas zu sagen. Was geschah bei einer Bypass-Operation? Ich hatte nicht den blassesten Schimmer, nur der Begriff war mir geläufig. Offensichtlich wusste meine Mutter besser Bescheid, denn die Falten gruben sich von Minute zu Minute tiefer in ihr Gesicht. Wieder drückte Papa meine Hand. Er nickte mir zu, er hatte eine Entscheidung getroffen.
„Ich glaube, ihr geht jetzt besser, dann kann ich mich noch ein bisschen ausruhen vor dem großen Ereignis.“ In seinen Augen sah ich die Angst.
„Bist du sicher?“
„Ja.“
Mama stand erleichtert auf. Sie küsste Papa auf seine Wangen und ganz sacht auf den Mund. „Wir sehen uns morgen.“ Stefan nickte stumm. Ich sah ihn forschend an.
„Geh mit Mama, das ist in Ordnung.“
Wir verließen beide schweigend die Station, nachdem wir uns ein weiteres Mal die Hände gewaschen und desinfiziert hatten. Unten im Foyer hielt Mama an.
„Ich glaube, ich brauche jetzt erst mal einen Kaffee oder etwas Stärkeres.“ Wir gingen in das Krankenhausbistro, das erstaunlicherweise noch aufhatte. Ich nahm einen Espresso, Mama einen Cappuccino. Marianne rührte in ihrer Tasse.
„Was macht man bei einer Bypassoperation?“
Sie sah auf und seufzte tief.
„Sie schneiden ihm den Brustkorb auf, nehmen Adern aus den Beinen, holen das Herz heraus, legen mit den Adern irgendwie neue Zugänge in die oder an die Arterien. So ungefähr.“
„Das hört sich ganz schön wild an.“
„Angeblich alles Routine.“
Schweigend hingen wir unseren Gedanken nach. Ich verspürte das Bedürfnis, wieder zu Papa zu gehen. Mich an sein Bett zu setzen und seine Hand zu halten, bis sie ihn holten. Was, wenn er das alles nicht überlebt? Alles, was Mama gesagt hatte, löste furchtbare Vorstellungen bei mir aus. Während Mama es auf einmal sehr eilig hatte, fiel mir der Gedanken, Papa alleine zu lassen, bis man ihn für die Operation holen würde, immer schwerer. Wir waren gerade am Ausgang angelangt, als eine Stimme uns hinterherrief.
„Frau Kamphoven!“ Gleichzeitig drehten Mama und ich uns um. Schwester Brigitte kam mit eiligen Schritten den Gang herunter. Sie sah unsere besorgten Blicke.
„Nein, nein. Es ist so weit alles in Ordnung.“ Sie stockte. „Nur, könnten Sie vielleicht noch etwas bleiben? Das mit der OP verzögert sich, und Ihr Mann“, sie sah kurz zu mir, „Ihr Vater scheint mir etwas nervös zu sein.“
Mamas Hände krampften sich um ihre Handtasche. Ich legte meine Hand beschützend auf ihre Schulter.
„Mama, ist es in Ordnung, wenn ich bleibe? Kommst du allein klar?“
Ihr Gesicht entspannte sich. „Würdest du das machen? Ich glaube, ich schaffe das heute einfach nicht mehr.“ Sie schluckte.
„Klar, Mama. Mach dir keine Gedanken. Ich mache mir nur Sorgen um dich.“
„Das brauchst du nicht. Ich sehe mir gleich ein schönen Film oder zwei oder drei an und warte, bis das Krankenhaus sich meldet.“ Sie wandte sich zu Schwester Brigitte. „Sie sagen mir doch heute noch Bescheid, oder?“
„Natürlich. Ich werde es meiner Kollegin ausrichten, die dann Dienst hat.“
„Aber wie kommst du nach Hause, Vera?“
„Kein Problem, ich nehme den Bus oder ein Taxi.“
„Bist du sicher?“ Ich wusste, dass die Frage nur noch rhetorisch war. Ich küsste Mama rechts und links, drückte sie noch einmal und ging dann mit Schwester Brigitte wieder auf die Intensivstation.
„Ihre Eltern hängen sehr aneinander.“
„Ja, sie schafft es einfach nicht, ihn so hilflos zu sehen. Das macht sie fertig.“
„Ich bin froh, dass Sie alleine dableiben. Er war sehr ruhig vorhin, als Sie da waren.“
„Aber Sie waren doch gar nicht im Raum.“
„Nein, aber ich habe die Computerauswertungen gesehen.“
Vor dem Raum verabschiedete sie sich von mir. Ich ging hinein und setzte mich an den Bettrand. Papa schlief, doch sein Atem ging sehr unruhig. Seine Hände waren faltig und abgearbeitet. Die Haut schimmert bläulich. Die Brust hob und senkte sich schwerfällig. Ich betrachtete sein Gesicht, das im Schlaf knochig wirkte. Wann war mein Vater so alt geworden, fragte ich mich verwundert. In meinen Erinnerungen war er immer stark gewesen. Streng, aber voller Liebe für mich. War ich es gewesen, die mit meinem Fortgang das alles verursacht hatte? Ich streichelte meinen Vater. Fly war nicht nur mein Traum gewesen. Auch Stefan hatte auf den Turnieren jede Minute mitgezittert. Und dann hatte er die Entscheidung getroffen, ein weiteres Pferd aus dem gleichen Hengst zu ziehen, wieder mit Nobless als Mutter. Duke, wieder ein Hengst, er musste jetzt etwa sieben Jahre alt sein.
„Weißt du, Papa, wenn du erst mal wieder gesund bist, dann werde ich noch ein Weilchen bleiben, das verspreche ich dir.“
Er öffnete die Augen.
„Vera?“
„Ja, Papa. Ich bin hier.“
„Marianne?“
„Sie ist nach Haus gefahren. Aber du kannst mir glauben, sie denkt jede Sekunde an dich.“
„Ich weiß, das macht mir ja so viel Kummer. Sie ist nicht so stark wie wir. Erzähl mir was“, forderte er mich nach einer Weile auf, „das vertreibt mir die Angst vor diesem blöden Eingriff.“
„Wovon soll ich dir erzählen?“
„Na, zum Beispiel, was du die letzten Jahre getrieben hast.“
Während ich seine Hand streichelte, erzählte ich ihm von mir. Schilderte ihm die Länder und Orte, wo ich gewesen war. Beschrieb das Essen, die Natur, andere Kulturen und berichtete über meine Jobs in den verschiedenen Hotels. Er hörte mir aufmerksam zu. Manchmal döste er ein, doch immer wieder wachte er auf.
„Weißt du eigentlich, dass Mama und ich immer mal vorhatten, eine Weltreise zu machen?“, warf er in einer Pause ein.
Ich sah ihn erstaunt an und schüttelte den Kopf. „Du und Mama? Ihr wart doch noch nie im Urlaub.“
Er lachte und bekam ein Hustenanfall. „Stimmt. Trotzdem kann man doch Träumen, nicht wahr.“
Es klopfte am Türrahmen.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783739489391
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (März)
- Schlagworte
- Liebesroman für Erwachsene Deutschland Liebesroman für Jugendliche Pferde Pferderoman Familiengeschichte Reitsport Kinderbuch Jugendbuch