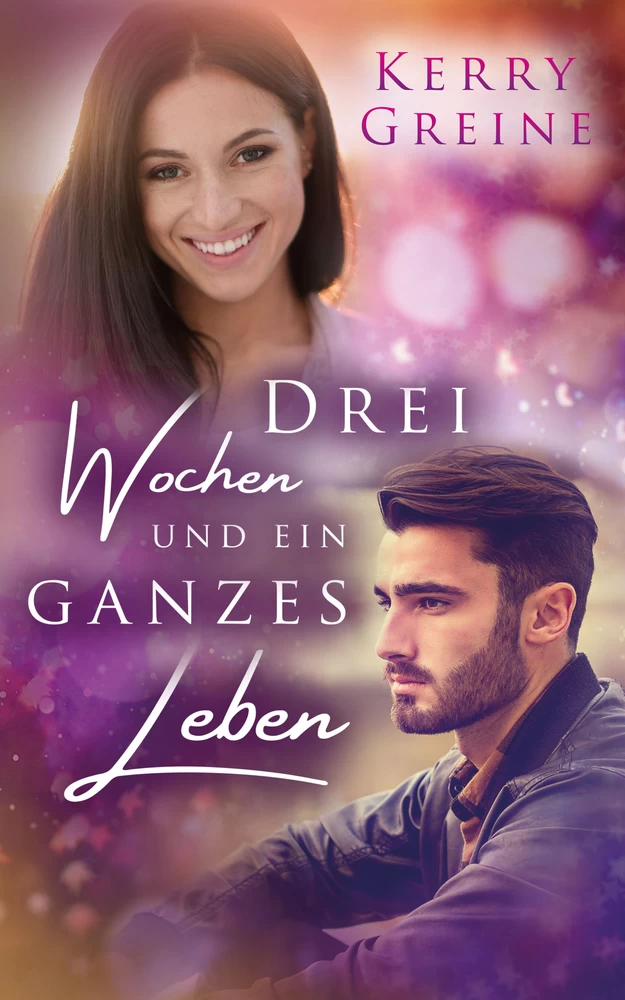Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Samstag, den 10. Juni
~*~ Hamburg ~*~
„Und du bist dir ganz sicher, dass du das machen willst?“ Besorgt wanderte der Blick meiner Mutter zwischen mir und meinem überdimensionalen Trekkingrucksack hin und her. Ihre Augen schwammen in Tränen, doch sie kämpfte sichtbar dagegen an. Verständnisvoll lächelnd nahm ich sie in den Arm und drückte sie an mich. Ich wusste, wie schwer es ihr fiel, mich gehen zu lassen. Das war mir bereits klar, bevor ich diese Reise geplant hatte. Ich war ihr Baby, ihr Nesthäkchen, ihr Augapfel. Die letzten 25 Jahre war es ihre Aufgabe gewesen, mich vor allem, was mir schaden konnte, zu beschützen – und das hatte sie getan.
Zwar war sie dabei regelmäßig über das Ziel hinausgeschossen und hatte mir oft genug die Luft zum Atmen genommen, aber ich wusste immer, sie tat es aus Liebe zu mir.
„Ja, Mamma, ich bin mir ganz sicher! Und es sind ja nur ein paar Wochen. Ich habe es dir doch erklärt: Ich möchte auf den Spuren meiner Vorfahren wandeln und das Land kennenlernen, aus dem ich eigentlich stamme.“
„Deine Großeltern haben Sizilien nie wirklich verlassen. Da gibt es nicht sonderlich viele Spuren deiner Vorfahren, auf denen du wandeln kannst“, mischte mein Vater sich mürrisch ein und schüttelte genervt den Kopf. Während meine Mutter Probleme damit hatte, mich allein losziehen zu lassen, vertrat mein Vater die Meinung, es wäre rausgeworfene Zeit. Er konnte nicht nachvollziehen, warum ich – eine Tochter aus gutem Hause – freiwillig fast vier Wochen mit dem Rucksack durch Italien touren wollte. Ein Urlaub nach seinem Geschmack wäre es gewesen, mit dem Flugzeug erster Klasse zu fliegen und dann in Fünf-Sterne-Hotels zu wohnen.
Aber das war es nicht, was ich wollte. Ich wollte keine Upper-Class-Reise, ich wollte die Freiheit spüren, wollte Land und Leute kennenlernen, anstatt klimatisierter Hotels und viel zu teurem Essen. Ich brauchte keinen Prunk, keinen Glitzer und Glamour. Ich wollte das wahre Leben entdecken. Das Leben außerhalb der Mauern unserer Hamburger Villa und der besseren Gesellschaft. Doch das war ein Punkt, den mein Vater nie verstehen würde. Wir waren einfach zu unterschiedlich.
„Babbo, bitte!“ Flehend sah ich zu meinem Vater auf, der missmutig die Arme vor der Brust verschränkt hatte. Ich mochte mich nicht noch mit ihm streiten, ich wollte nicht, dass wir so auseinandergingen. „Gib mir diese vier Wochen. Sie gehen ganz schnell vorbei und danach bin ich komplett für deine Kanzlei da.“ Beim Gedanken daran lief mir ein unangenehmer Schauer über den Rücken. Es fühlte sich an, als wäre mein Leben nach diesen vier Wochen vorbei. Denn wenn ich wieder zu Hause war, musste ich in der Anwaltskanzlei meines Vaters antreten. Mein Jurastudium war abgeschlossen, die letzten Prüfungen lagen gerade hinter mir, bald ging der Ernst des Lebens los. Doch während meine Kommilitonen es gar nicht abwarten konnten, endlich loszulegen, bildete sich in meinem Magen ein unangenehmer Kloß.
Als ich Jolas alten Golf die lange Einfahrt zur Villa meiner Eltern hochkommen sah, wandte ich mich erneut meiner Mutter zu, die noch immer gegen die Tränen kämpfte.
„Vier Wochen, Mamma! Die vergehen ganz schnell, versprochen! Und wir werden zwischendurch telefonieren. Du wirst kaum merken, dass ich weg bin.“
Nun löste sich die erste Träne aus ihrem Augenwinkel. Schniefend wischte sie sie weg und schloss mich fest in die Arme. „Du bist einfach mein Baby, Sienna. Und du wirst es immer bleiben. Deine Geschwister sind schon so erwachsen, aber du … Jetzt verlässt auch du das heimische Nest und das …“ Sie brach ab und atmete tief durch, um sich wieder zu sammeln. Dann löste sie sich von mir und nahm meine Hände zwischen ihre. „Hier, falls du irgendetwas brauchst. Aber verrat es nicht deinem Vater“, sagte sie verschwörerisch, und ich spürte, wie sie mir ein Bündel Geldscheine in die Hand schob, während sie meinem Vater einen verstohlenen Blick zuwarf. Er bekam nicht mit, worüber wir sprachen, da er gerade Jola begrüßte, die aus dem Auto stieg.
„Mamma, ich habe genug Geld! Wirklich! Ich brauche es nicht!“, protestierte ich und versuchte, ihr das Geldbündel wiederzugeben, doch sie wiegelte ab.
„Sieh es als Notgroschen. Falls irgendetwas ist. Du weißt nie, was geschieht.“
Seufzend steckte ich das Geld ein und bedankte mich bei meiner Mutter. Ich wusste, sie meinte es nur gut, aber ich hätte ihr Geld wirklich nicht gebraucht – und eigentlich wollte ich es auch nicht.
Diese Reise war mein Wunsch. Sie war mein Ausbruch aus diesem goldenen Käfig, der mein Leben in den letzten fünfundzwanzig Jahren gewesen war. Sie sollte nicht dafür bezahlen, ich wollte es allein schaffen.
„Wollen wir dann los? Nicht dass der Zug noch ohne dich fährt.“ Jola riss mich aus meinen Gedanken. Ein Blick auf die Uhr an meinem Handgelenk verriet mir, dass wir uns sputen mussten, wenn ich meinen Zug rechtzeitig erreichen wollte.
Schnell verabschiedete ich mich von meinen Eltern und hievte den schweren Trekkingrucksack in Jolas Kofferraum.
„Ich melde mich, wenn ich in Basel bin!“ Ich winkte den beiden noch einmal zu und stieg in den Wagen. Als wir die lange Auffahrt hinunterfuhren, konnte ich im Rückspiegel sehen, wie meine Mamma sich an Babbo schmiegte. In diesem Moment musste auch ich gegen einen Kloß in meinem Hals ankämpfen.
„Und du bist dir wirklich sicher, dass du mich nicht mitnehmen willst?“, fragte Jola, während sie durch Hamburgs Straßen fuhr, und schubste mich leicht mit dem Ellenbogen an.
„Ja, bin ich! Diese Reise ist nur für mich allein.“
„Aber du weißt, dass wir zu zweit eine Menge Spaß haben würden, oder? Wir würden Italien und vor allem die italienische Männerwelt mal so richtig aufmischen“, sagte sie kichernd.
„Das werden wir auch, Süße. Aber die Männerwelt muss warten, bis wir auf Sizilien sind.“
„Du bist gerade wirklich auf dem Selbstfindungstrip, oder?“
Ich zuckte mit den Schultern und sah aus dem Fenster. Ein letztes Mal nahm ich meine Heimatstadt bewusst wahr, bevor ich für die nächsten Wochen verschwand und die Welt außerhalb der High Society, weitab von schicken Hotels, Nobelrestaurants und First-Class-Flügen kennenlernte.
„Selbstfindungstrip? Ich weiß nicht … Ich würde es eher als Abenteuer bezeichnen.“ Wir hatten bereits unzählige Male darüber gesprochen, und ich hatte Jola immer wieder erklärt, was mich antrieb.
„Das weiß ich doch, Süße! Und ich finde es toll, dass du es machst. Ich bin nur ein bisschen neidisch, weil du megacoole Orte sehen und wahnsinnig viel erleben wirst. Ich meine … Mailand! Was kannst du da shoppen!“
Kichernd schüttelte ich den Kopf. „Ich fahre doch nicht zum Einkaufen dahin. Außerdem ist Mailand längst nicht mehr so spannend, wenn man schon diverse Male da war. Ich will das Land kennenlernen und die Leute. Ich will mir selbst beweisen, dass ich auf eigenen Füßen stehen kann, ohne dass Mamma und Babbo einspringen, wenn es mal schwierig wird. Abgesehen davon … Hast du dir mal meinen Rucksack angeschaut? Der ist so knallvoll, da passt nicht mal mehr ein Paar Socken rein. Shoppen ist also nicht.“
Am Hauptbahnhof angekommen, parkte Jola ihren alten Golf frech in einer Parkverbotszone.
„Willst du hier so stehen bleiben?“, fragte ich und deutete auf das Schild, das unübersehbar direkt vor uns hing.
„Klar! Ist ja grad keine Parklücke frei, und du glaubst doch nicht, dass ich dich allein zum Bahnsteig gehen lasse. Wenn meine beste Freundin zu so einem Abenteuer aufbricht, werde ich sie zumindest vernünftig am Zug verabschieden.“
„Und wenn du zurückkommst, ist dein Auto abgeschleppt“, gab ich zu bedenken, aber Jola lachte nur und stieg aus. Nach einem letzten Blick auf das Parkverbotsschild folgte ich ihr. Als ich am Kofferraum ankam, hievte sie gerade meinen Rucksack heraus.
„Boah, was hast du da drin?“, fragte sie ächzend und stellt ihn auf den Boden. „Hast du zur Sicherheit noch ein paar Backsteine mitgenommen? Damit du was zum Werfen hast, falls dich jemand belästigt?“
Ich schüttelte den Kopf und schnallte mir das schwere Teil auf den Rücken. Jola hatte recht. Wenn ich nicht wüsste, was ich alles eingepackt hatte, würde ich auch auf Backsteine tippen.
Als wir am richtigen Bahnsteig ankamen, war ich vollkommen aus der Puste. Mein T-Shirt und die Jeansjacke klebten unangenehm feucht an meinem Rücken. Schnell befreite ich mich von dem Ungetüm auf meinen Schultern und ließ den Rucksack auf den Boden fallen. Wenn ich daran dachte, dass ich das Teil die nächsten Wochen würde schleppen müssen, wurde mir ein wenig mulmig. Natürlich hatte ich das Gewicht des Trekkingrucksacks beim Packen getestet, doch ihn einmal kurz hochzunehmen und wieder abzustellen war etwas ganz anderes, als ihn über Hunderte Meter zu tragen. Na super! Das konnte ja heiter werden. Ich sah mich schon ächzend vor Schmerzen und Muskelkater irgendwo am Straßenrand liegen. Schnell schüttelte ich den Kopf, um diese Bilder aus meinem Kopf zu vertreiben.
„Und du bist sicher, dass du nichts vergessen hast?“, fragte Jola und stupste meinen zwischen uns stehenden Rucksack mit der Schuhspitze an.
„Selbst wenn, wäre es jetzt wohl ein bisschen zu spät“, erwiderte ich. „Aber nein, ich denke, ich hab alles.“ In diesem Moment wurde ich von einem einfahrenden Zug unterbrochen, der lautstark an uns vorbeiratterte und mit quietschenden Bremsen zum Stehen kam.
„Auf geht’s!“, sagte Jola und trat vor mich. Sie legte ihre Hände auf meine Schultern und drückte leicht zu, bevor sie mich in ihre Arme zog. „Ich wünsche dir ganz viel Spaß und tolle Erfahrungen. Genieß dieses Abenteuer – aber lass die Finger von der Männerwelt. Vergiss nicht, die erobern wir gemeinsam, wenn wir uns auf Sizilien treffen. Ich freu mich schon! Am liebsten würde ich gleich anfangen zu packen.“
„Na, das wäre wohl ein wenig früh“, erwiderte ich feixend. „Du musst noch ein bisschen warten. Aber ich freue mich drauf, dich in drei Wochen am Flughafen in Empfang zu nehmen. Und bis dahin … wird sicher alles gut gehen. Ich hab dich lieb, Süße!“ Ich gab Jola noch einen Kuss auf die Wange, dann stemmte ich den Rucksack erneut auf meinen Rücken und stieg in den ICE, der mich zu meiner ersten Station nach Basel bringen würde.
Nachdem ich das richtige Abteil gefunden hatte, richtete ich mich für die nächsten Stunden häuslich ein. Bisher hatte ich noch keinen Mitfahrer, daher konnte ich mich ein wenig ausbreiten.
Jola hatte den Bahnsteig schon verlassen. Wahrscheinlich hatte sie doch Sorge, dass ihr Auto abgeschleppt werden könnte. Als der Zug den Bahnhof verließ, lehnte ich mich entspannt zurück und schloss die Augen.
Das Bild meiner Mamma erschien in meinem Kopf. Wie traurig sie auf der Auffahrt gestanden und dem Wagen hinterhergeschaut hatte. Wie sie sich dort an meinen Vater gelehnt hatte, wirkte sie so klein und zart. Ich wusste, es tat ihr weh, mich gehen zu lassen. Doch sie wusste, sie hatte keine Chance, mich zu halten.
Ich erinnerte mich, wie meine Eltern reagiert hatten, als ich ihnen vor ein paar Wochen von meinen Reiseplänen erzählte. Meine Mutter war in Tränen ausgebrochen und wollte sich gar nicht mehr beruhigen. Immer wieder betonte sie, wie gefährlich es doch wäre, als Frau allein zu reisen. Sie zählte auf, was alles passieren konnte, und versuchte, mich umzustimmen.
Mein Vater hingegen hatte ganz anders reagiert. Als Familienoberhaupt hatte er nur grimmig die Arme vor der Brust verschränkt, den Kopf geschüttelt und gesagt: „Nein!“
Nur dieses eine Wort. „Nein!“
Jedes Mal, wenn ich versucht hatte, ihm zu erklären, dass ich trotzdem fahren würde, dass ich bereits gebucht hatte, kam es wieder: „Nein!“
Für ihn gab es keinerlei Diskussion. Er sagte kategorisch nein und ich hatte zu spuren. So war es immer gewesen. Doch ab sofort nicht mehr!
Ein paar Tage lang ging es so. Meine Mamma versuchte, mich mit Horrorstorys, die sie irgendwo gelesen hatte, umzustimmen. Sie erzählte mir von ausgeraubten Touristinnen. Von in der Bahn geklautem Gepäck. Von Vergewaltigungen. Von Messerstechereien. Von im Schlaf Ermordeten in irgendwelchen Hostels.
All das waren Sachen, die ich nicht hören wollte. Sosehr ich Mamma verstand, ich wollte mir von ihr keine Angst machen lassen.
Von meinem Vater hingegen kam auch in den Tagen danach nur dieses eine Wort, wenn ich versuchte, auf meine Reise zu sprechen zu kommen. Nein!
Irgendwann fragte ich ihn, ob er eigentlich wüsste, dass ich fünfundzwanzig Jahre alt sei und somit durchaus in der Lage und gesetzlich befugt, solche Entscheidungen selbst zu treffen.
„Meine Tochter wird nicht wie ein Hippie mit Bus und Bahn quer durch Italien reisen!“, war seine Antwort. Damit ließ er mich stehen. Er hatte seinen Standpunkt wieder einmal klargemacht.
Zwei Tage später lenkte er unverhofft ein. Was ihn dazu getrieben hatte, verstand ich bis heute nicht. Er vertrat zwar noch immer die Meinung, dass es rausgeworfene Zeit wäre, aber es kam nicht mehr das kategorische „Nein“ von ihm. Er schien sich damit abzufinden, da er sowieso nichts dagegen machen konnte, dass ich fuhr. Ich war überrascht, weil er meine Entscheidung auf einmal akzeptierte, und freute mich, dass ich es geschafft hatte, mich gegen meinen Vater zu behaupten. Das war in meinem Leben eher selten der Fall gewesen. Meist gab er Anweisungen, und die Familie hatte Folge zu leisten, ohne aufzumucken. So war es auch mit meinem Studium. Von klein auf war klar, dass ich Jura studieren und ebenso wie meine drei älteren Geschwister in die Kanzlei meines Vaters einsteigen würde. Ich konnte nicht einmal sagen, ob ich diesen Beruf für mich selbst gewählt hätte, wenn es meine Entscheidung gewesen wäre. Da es allerdings nicht meine Entscheidung war, hatte ich nie weiter darüber nachgedacht, was ich vielleicht lieber studiert hätte. Ich wollte mich nicht damit befassen, weil ich keine Sehnsucht, keinen Wunsch wecken wollte, der unerfüllbar bleiben würde.
„Hier noch Kaffee? Etwas Kaltes? Ein Schokoriegel?“ Ich öffnete die Augen, als eine männliche Stimme an mein Ohr drang. In der Tür zum Abteil stand ein Mann mit einem Servierwagen aus dem Bordrestaurant. Kaffee war jetzt gar keine so schlechte Idee.
„Haben Sie auch Cappuccino?“, fragte ich und der junge Mann schüttelte bedauernd den Kopf. „Nein, tut mir leid. Cappuccino gibt es nur im Bordrestaurant. Ich habe bloß normalen Filterkaffee.“ Entschuldigend deutete er auf die große Thermoskanne.
„Okay, dann hole ich mir dort einen. Vielen Dank.“ Während ich in meinem Rucksack nach meinem Portemonnaie kramte, schloss er die Tür und zog weiter. Als ich es gefunden hatte und den Kopf wieder hob, sah ich, wie jemand in mein Abteil hineinschaute. Die Hände rechts und links an das Gesicht gelegt, starrte er durch die Scheibe, bis er merkte, dass ich ihn entdeckt hatte. Es ging so schnell, ich konnte das Gesicht nicht klar erkennen, denn im selben Moment zog derjenige hektisch den Kopf ein und eilte weiter. Eigentlich war gar nichts dabei. Vermutlich war es nur ein anderer Fahrgast, der seinen Platz gesucht hatte. Dennoch kam mir die Situation merkwürdig vor. Ich konnte nicht sagen warum, es war nur ein Bauchgefühl. Aber leider ein ungutes …
„Was war das denn?“, fragte ich mich leise. Dann schüttelte ich über mich selbst den Kopf. „Hat der Typ sich gerade wirklich benommen, als hätte ich ihn bei etwas ertappt? Oder werde ich jetzt schon paranoid nach den ganzen Horrorstorys, die Mamma mir erzählt hat?“ Auf einmal traute ich mich nicht, mein Gepäck allein im Abteil zu lassen, während ich ins Bordrestaurant ging. Seufzend steckte ich mein Portemonnaie wieder weg und holte eine Wasserflasche heraus, die ich von zu Hause mitgebracht hatte. Hätte ich doch bloß einen normalen Kaffee von dem jungen Mann und seinem Servierwagen genommen. Jetzt musste ich leider auf den kleinen Koffeinschub verzichten.
Samstag, den 10. Juni
~*~ Basel ~*~
Bis Karlsruhe hatte ich das Abteil für mich allein. Ich hätte gedacht, dass es nicht lange dauern würde, bis ich Gesellschaft bekam. Doch die seit Hamburg zugestiegenen Fahrgäste hatten entweder alle reservierte Plätze in anderen Abteilen oder ließen sich von meinem riesigen Trekkingrucksack abschrecken, der zwischen den Sitzen auf dem Boden stand. Ich hatte es nicht geschafft, ihn über meinen Kopf auf die Gepäckablage zu wuchten, und ihn daher kurzerhand stehen lassen.
Allmählich wurde ich unruhig. Seit mittlerweile fast fünf Stunden saß ich nun im Zug und ein gewisses menschliches Bedürfnis drückte mich. Doch noch immer spukten die Geschichten meiner Mutter von beraubten Fahrgästen und geklautem Gepäck durch meinen Kopf, daher traute ich mich nicht, meinen Rucksack ganz allein im Abteil zu lassen. Nicht einmal, um kurz auf der Toilette zu verschwinden.
Kaum setzte sich der ICE in Karlsruhe wieder in Bewegung, öffnete sich die Tür zum Abteil und eine Frau, nur wenig älter als ich, mit einem ungefähr fünfjährigen Mädchen an der Hand, schaute mich lächelnd an.
„Ist hier noch was frei?“, fragte sie.
Erfreut, endlich Gesellschaft zu bekommen – und dann anscheinend auch noch angenehme –, nickte ich. „Ja, klar! Kommen Sie rein. Ich hoffe, das geht so mit dem Rucksack, ich kriege ihn nicht da hoch.“ Ich deutete auf die Gepäckablage, aber die Frau schüttelte nur den Kopf.
„Ach Quatsch! Das passt schon. Nicht wahr, Michelle?“, fragte sie das kleine Mädchen, das sich schüchtern hinter ihr versteckte und mir nur verstohlene Blicke zuwarf.
Glücklicherweise reisten die beiden mit leichtem Gepäck und hatten nur einen kleinen Koffer, den wir gemeinsam in die Gepäckablage verfrachteten. Als die Frau neben der kleinen Michelle Platz genommen hatte, nutzte ich sofort die Gelegenheit – wer wusste schon, wann die zwei wieder aussteigen würden.
„Sagen Sie, würden Sie kurz auf mein Gepäck aufpassen? Ich will nur schnell auf die Toilette und mir einen Kaffee im Restaurant holen.“
Strahlend lächelte die Frau mich an. „Natürlich! Oder, Michelle? Wir passen gut auf.“
Das Mädchen nickte zaghaft und zeigte ein leichtes Lächeln.
„Das ist so lieb von dir, Michelle! Du bist sicher gut im Aufpassen, du bist ja schon groß“, wandte ich mich nun direkt an die Kleine.
Auf einmal ruckte ihr Kopf hoch und sie schaute mich aus großen Augen an. Dann breitete sich ein stolzes Strahlen auf ihrem Gesicht aus. „Mach ich gern!“, sagte sie, und ich sah ihr an, wie sehr sie sich freute, dass ich ihr diese Aufgabe zutraute.
„Möchten Sie vielleicht auch einen Kaffee? Oder etwas anderes? Wenn ich schon im Bordrestaurant bin.“
„O ja, ein Cappuccino wäre toll!“
Nachdem ich zugesichert hatte, der Frau einen Cappuccino mitzubringen, verschwand ich endlich in Richtung der Toiletten. Es wurde wirklich höchste Zeit!
Eine Viertelstunde später kehrte ich deutlich erleichtert mit zwei Cappuccini und einem Schokoriegel für die Kleine in unser Abteil zurück.
„Ich hab gut aufgepasst auf deinen Koffer!“, berichtete Michelle, kaum dass ich die Tür hinter mir geschlossen hatte.
„Ehrlich? Das ist toll! Ich wusste, du bist genau die Richtige zum Aufpassen. Dafür habe ich dir auch etwas mitgebracht.“
Nachdem ich Michelle ihren Schokoriegel und der Frau den Kaffee gegeben hatte, nahm ich Platz und holte meinen E-Reader aus dem Rucksack. Als ich mich in die Geschichte um einen Rockstar vertiefte und mit der schwer verliebten Protagonistin des Romans mitlitt, bemerkte ich aus den Augenwinkeln, dass Michelle mich kaum aus den Augen ließ, während sie ihren Schokoriegel verputzte. Immer wieder legte sie den Kopf ein wenig schief und musterte mich von oben bis unten. Ich wusste nicht, warum ich sie derart ansprach. Lag es an der Schokolade, die ich ihr mitgebracht hatte? Oder daran, dass ich gesagt hatte, sie sei bereits groß? Ich hatte keine Ahnung. Zwar mochte ich Kinder sehr, hatte aber bisher kaum Erfahrung oder Berührungspunkte mit den Kleinen gehabt. Während meine Klassenkameradinnen sich das Taschengeld mit Babysitten aufgebessert hatten, hatte ich so etwas nicht nötig gehabt.
Eine halbe Stunde später war ich schlauer.
„Mama, weißt du was?“, brüllflüsterte Michelle unüberhörbar. „Die Frau sieht aus wie Schneewittchen.“
Ich musste ein lautes Prusten unterdrücken, als ich die Worte der Kleinen hörte und aufschaute.
„Entschuldigen Sie bitte.“ Der Mutter waren die Worte ihrer Tochter sichtlich unangenehm. „Schneewittchen ist ihr Lieblingsmärchen. Das musste ich ihr schon Hunderte Male vorlesen“, erklärte sie. „Und mit den langen schwarzen Haaren und den blauen Augen dazu …“
Ich lächelte der Mutter beruhigend zu, dann wandte ich mich an Michelle, ohne auf die Entschuldigung einzugehen. „Vielen Dank, kleine Maus. Ich freue mich sehr, dass du denkst, ich sehe aus wie Schneewittchen. Ich finde nämlich, Schneewittchen ist wunderschön. Viel schöner als Rapunzel oder so. Von daher war das ein ganz schön tolles Kompliment.“
Michelle strahlte mich an. „Hast du denn auch sieben Zwerge zu Hause?“
Jetzt konnte ich nicht mehr und lachte schallend los. „Nein, leider nicht. Aber ich bin ja auch nicht das echte Schneewittchen.“
Das leuchtete ihr wohl ein, zumindest gab sie sich mit meiner Antwort zufrieden, und ich kehrte zu meiner Rockstar-Geschichte zurück.
In Freiburg verabschiedeten sich Michelle und ihre Mutter und stiegen aus. Doch ihre Plätze blieben nicht leer. Der ICE hatte den Bahnhof noch nicht einmal verlassen, als eine Gruppe junger Männer das Abteil betraten und sich auf die freien Sitze fallen ließen. Es dauerte nicht lange und der Dunst von Alkohol gepaart mit einer ordentlichen Portion ungewaschener Männerkörper lag in der Luft. Wie ich den hin und her fliegenden Wortfetzen entnehmen konnte, kamen die Typen gerade von einer Männertour und hatten wohl die letzte Nacht durchgefeiert. Und genau so rochen sie auch!
Mein Rucksack bekam von den Kerlen mehr als einen Tritt ab, und so sah ich mich irgendwann gezwungen, sie anzusprechen.
„Soll ich ihn hochstellen auf das Gepäckfach? Vielleicht würde einer von Ihnen mit anfassen?“, fragte ich bittend und ließ meinen Blick durch die Runde schweifen. Die Typen schauten sich nur an, doch eine Antwort bekam ich nicht. Stattdessen zog einer von ihnen zwei alte Colaflaschen, in denen sich nun vermutlich selbst gemischter Alkohol befand, aus den Innentaschen seiner Jacke. Unter lautem Gegröle wurden die Flaschen mit dem giftgrünen Inhalt geöffnet und von einem zum anderen weitergegeben. Kurz überlegte ich, ob sie mich einfach nur nicht verstanden hatten, doch sie sprachen untereinander Deutsch mit Schweizer Dialekt, daher ging ich davon aus, dass sie nur keine Lust gehabt hatten, zu antworten.
Nach ein paar Minuten wurde mir von dem Dunst, der in der Luft hing, ein wenig übel, und ich hatte den Drang, aus dem Abteil zu fliehen, damit dieser Gestank nicht bis in die letzte Falte meiner Klamotten kroch. Ich griff nach dem kleinen Flyer der Bahn, in dem die einzelnen Haltestellen und Ankunftszeiten des Zuges aufgeführt waren, und schaute, wie lange ich noch zu fahren hatte.
Erleichtert stellte ich fest, dass die nächste Station nicht nur bereits Basel war, sondern wir den Badischen Bahnhof in knapp zehn Minuten erreichen würden. Die kurze Zeit konnte ich auch stehen, beschloss ich und packte meine Sachen zusammen.
„Darf ich bitte mal durch?“, fragte ich und hievte den Rucksack auf meine Schulter. Einer der Kerle hatte zwar die Güte, mich nach meinen Worten kurz anzusehen, machte aber keinerlei Anstalten, seine Füße ein Stück beiseite zu nehmen, um mich durchzulassen. Genervt seufzend versuchte ich, mir einen Weg aus dem Abteil zu bahnen, ohne jemandem meinen Rucksack ins Gesicht zu hauen oder auf fremden Füßen herumzutrampeln.
Als ich es endlich geschafft hatte, das Abteil zu verlassen, und auf dem Gang stand, war ich schweißgebadet. Vielleicht hätte ich meine Jeansjacke erst im Bahnhof anziehen sollen, im Zug war es viel zu warm dafür. Aber gut, die paar Minuten würde ich es wohl aushalten.
Mit nur vier Minuten Verspätung erreichte der ICE den Badischen Bahnhof Basel. Nachdem ich mich durch die Menschenmassen aus dem Bahnhofsgebäude gekämpft hatte, ließ ich meinen Blick schweifen. Ein Stück weiter links sah ich Straßenbahnschienen und eine Haltestelle, doch das kleine Hotel, das ich für die nächsten zwei Nächte gebucht hatte, war laut Wegbeschreibung keine zehn Minuten zu Fuß vom Bahnhof entfernt. Für die Strecke musste ich die Tram nicht nutzen, nach der langen Zeit in der Bahn würde mir ein kurzer Spaziergang trotz des schweren Rucksacks guttun. Bereits zu Hause in Hamburg hatte ich die Wegbeschreibung des Hotels vom Bahnhof zu ihnen ausgedruckt, da ich hier in der Schweiz nicht auf Google Maps zugreifen wollte. Die Roaminggebühren wären vermutlich unglaublich teuer und schließlich sollte es ein Low-Budget-Urlaub werden.
Gut gelaunt machte ich mich auf den Weg und ging die Straße in die angegebene Richtung hinunter. Als ich einen Wegweiser zum Tierpark entdeckte, stutzte ich kurz und sah auf die Wegbeschreibung. Laut dem, was ich las, sollte er auf den Zoo hindeuten. Aber das war wohl dasselbe.
Noch einmal schaute ich auf den Wegweiser, dann auf meine Beschreibung. Nein, irgendetwas konnte nicht stimmen, denn der Tierpark lag in der falschen Richtung. Er hätte auf der anderen Seite sein müssen. Nicht dort entlang. Ratlos sah ich mich um. Ich war keine fünf Minuten gegangen und hatte bereits das ungute Gefühl, mich verlaufen zu haben.
Auf dem kleinen Ausschnitt eines Stadtplans, der neben der Wegbeschreibung auf meinem Ausdruck zu erkennen war, waren die Straßennamen so winzig, dass ich die Augen zusammenkneifen musste, um überhaupt etwas lesen zu können. Dennoch wurde mir recht schnell klar, dass sich diese Straßen nicht in meiner Nähe befanden.
Ein paar Minuten irrte ich herum und schaute, ob ich eine der angegebenen Straßennamen irgendwo entdeckte, dann gab ich auf. Nun musste wohl doch Google Maps herhalten.
„Na toll, Sienna! Du bist erst ein paar Stunden unterwegs und schon hast du völlig die Orientierung verloren“, murmelte ich leise vor mich hin, während ich das GPS meines Handys einschaltete und mein Ziel eingab. Erschrocken schnappte ich nach Luft, als die App mir das Ergebnis präsentierte. Fünfunddreißig Minuten zu Fuß von meinem jetzigen Standort aus!
Angeblich lag das Hotel doch nur zehn Minuten vom Bahnhof. Hatte ich mich tatsächlich derart verlaufen?
„Okay, ein bisschen Bewegung tut mir nach der langen Zugfahrt wahrscheinlich ganz gut“, redete ich mir selbst gut zu und rückte den schweren Rucksack auf meinen Schultern zurecht. Dann machte ich mich auf den Weg.
Je näher ich meinem angeblichen Ziel kam, desto unsicherer wurde ich. Hatte ich wirklich die richtige Adresse des Hotels eingegeben? Als ich an eine Brücke kam, über die ich den Rhein überqueren sollte, löschte ich meine Eingabe und tippte den Straßennamen neu ein. Das Ergebnis war dasselbe. Google Maps war sich sicher. Ich sollte den Rhein überqueren.
Einen Moment lang schaute ich mich unschlüssig um. Der Bahnhof, an dem ich ausgestiegen war, lag weit hinter mir, es konnte also eigentlich nicht sein. Eigentlich … Dennoch blieb die App stur. Rüber über den Rhein!
Das Einfachste wäre gewesen, mir ein Taxi zu nehmen und mich hinfahren zu lassen. Leider konnte ich weit und breit keines entdecken. Noch fünfzehn Minuten behauptete die App. Die Hälfte hatte ich hinter mir, da würde ich den Rest auch schaffen. Und wenn an meinem Ziel nicht das richtige Hotel lag, konnte ich mir von dort aus immer noch ein Taxi gönnen, beschloss ich.
Mit neuem Elan nahm ich den letzten Teil der Strecke in Angriff.
Von außen betrachtet wirkte das kleine Hotel nicht sonderlich einladend. Das Gebäude war alt und heruntergekommen, die Fassade hätte dringend einen neuen Anstrich benötigt. Von dem Schild, das über der Eingangstür hing, blätterte bereits die Farbe ab, wodurch es kaum noch lesbar war. Basler Perle entzifferte ich. Ja, das war das Hotel, in dem ich die nächsten zwei Nächte wohnen würde, bevor meine Reise weiterging. Wie auch immer sie dazu kamen, einen Fußweg von zehn Minuten zum Bahnhof zu avisieren, dies hier war tatsächlich das Hotel, das ich bereits in Hamburg gebucht hatte. Ein wenig machte sich die Enttäuschung in mir breit. Was auf der Internetseite und den dortigen Fotos heimelig gewirkt hatte, sah in der Realität eher Furcht einflößend aus.
Nach über einer halben Stunde mit dem schweren Rucksack auf dem Rücken tat mir jeder Knochen im Leib weh. Meine Beine brannten und meine Schultern und mein Nacken waren taub vor Schmerzen. Noch dazu war ich klatschnass geschwitzt, hatte einen Bärenhunger und musste dringend auf die Toilette. Meine Füße schmerzten so, dass ich glaubte, nie wieder laufen zu wollen. In diesem Zustand war es mir egal, wie das Hotel wirkte. Trotz des unschönen Erscheinungsbildes war ich einfach froh, hier zu sein. Ich wollte nur noch den Rucksack loswerden, eine Dusche nehmen, etwas essen und dann durchschlafen bis morgen früh. „Hoffentlich gibt es eine warme Mahlzeit im Hotelrestaurant“, murmelte ich, als ich in die kleine Lobby trat.
Überrascht blieb ich direkt hinter der Eingangstür stehen. So vernachlässigt das Äußere auch war, was das Innere des Hotels anging, hatten die Fotos im Internet nicht übertrieben.
Alles wirkte gemütlich und aufgeräumt. Kleine, mit dunkelrotem Samt bezogene Sessel standen linker Hand um ein paar niedrige, weiß lackierte Tische gruppiert. Die hellen Wände ließen den Eingangsbereich freundlich und einladend wirken. Große Zimmerpalmen in weißen Kübeln gaben den Sitzecken Gemütlichkeit und ein Gefühl der Abgeschiedenheit.
Vor mir, auf der gegenüberliegenden Seite der Lobby, befand sich eine breite Treppe, die ins Obergeschoss führte, wo vermutlich die Zimmer lagen.
Rechts von mir entdeckte ich einen Empfangstresen, der ebenso weiß lackiert war wie die kleinen Tische und hinter dem mich eine rüstige ältere Dame mit einem grauen Kurzhaarschnitt erwartete. Das Namensschild, das an ihrer schneeweißen Bluse steckte, verriet mir, dass sie Frau Weber hieß.
„Hallo! Sie müssen Frau Medina sein“, begrüßte sie mich bereits, während ich näher trat.
Am Tresen angekommen, hievte ich ächzend den schweren Rucksack von meinen Schultern und ließ ihn neben mich auf den Boden fallen.
„Ja, richtig. Sienna Medina“, bestätigte ich und wunderte mich kurz, dass sie bereits wusste, wer ich war. Aber gut, dieses Hotel hatte vielleicht zwanzig Zimmer, wahrscheinlich reisten nicht so viele Gäste am Tag an oder ab.
„Ach Gott, Herzchen, wie sehen Sie denn aus?“ Die Empfangsdame musterte mich erschrocken. Ich musste wirklich ein Bild des Jammers abgeben, wenn ich nur halb so aussah, wie ich mich gerade fühlte.
„Ich bin zu Fuß vom Bahnhof hergekommen“, erwiderte ich und versuchte, meinem Gegenüber ein Lächeln zu schenken. So kaputt, wie ich war, verrutschte es vermutlich eher zu einer Art gequälten Grimasse.
„Ach, sind Sie mit der Bahn aus Hamburg angereist?“, fragte Frau Weber, während sie mir den Anmeldebogen über den Tresen schob.
Ich nickte und fing an, meine Daten einzutragen. „Ja, richtig. Und bis ich dann erst zum Hotel gefunden hatte …“
„War es für Sie schwierig zu finden? Mein Mann ist ja immer der Meinung, diese Wegbeschreibung auf unserer Internetseite wäre vollkommen überflüssig. Aber er ist auch in Basel aufgewachsen. Für mich war es am Anfang nicht so leicht, mich hier zurechtzufinden. Deshalb habe ich darauf bestanden, den Weg vom Bahnhof hierher zu erklären.“
„Ja, die Wegbeschreibung hatte ich mir extra ausgedruckt, aber ich muss irgendwo falsch gelaufen sein. Zumindest hat es mich ziemlich verwirrt, als ich auf einmal auf die andere Rheinseite musste.“ Ich unterschrieb den Anmeldebogen und schob ihn über den Tresen zurück.
Frau Weber machte keine Anstalten, den Zettel an sich zu nehmen, und schaute mich nur verwirrt an. „Über den Rhein? Aber vom Bahnhof hierher … Sie müssen doch nicht …“ Auf einmal wurden ihre Augen riesengroß, ihr Mund öffnete sich und sie suchte sichtlich nach Worten. Es dauerte einen Moment, dann sagte sie: „Herzchen, kann es sein, dass Sie am Badischen Bahnhof ausgestiegen sind?“
Jetzt war es an mir, verwirrt zu schauen. „Ja, natürlich. Das ist doch der Baseler Bahnhof. Wo denn sonst?“ Ich verstand nicht, was Frau Weber damit meinte.
Auf einmal zuckten ihre Mundwinkel, als versuchte sie krampfhaft, ein Lachen zu unterdrücken. „Es gibt in Basel zwei Bahnhöfe, an denen der ICE hält. Sie sind am ersten ausgestiegen, von da aus laufen Sie zu Fuß sicher dreißig oder vierzig Minuten. Der andere Bahnhof, Basel SBB, ist hier die Straße runter, dort hinten um die Ecke und da können Sie ihn schon sehen.“
Nein! Das konnte nicht sein! Ich war nicht an der falschen Station ausgestiegen! Schnell zog ich mein Ticket aus dem Rucksack, um nachzuschauen – und ließ mich im nächsten Moment genervt ächzend gegen den Empfangstresen sinken. „Das gibt es doch gar nicht! Wie kann man denn so dämlich sein? Da steht es ganz klar und deutlich. Sie haben recht, ich bin tatsächlich eine Station zu früh ausgestiegen.“
„Kein Wunder, dass Sie so kaputt sind!“ Frau Weber ließ ihren Blick über meine sicher völlig derangierte Erscheinung gleiten. „Na, dann wollen wir doch mal zusehen, dass Sie wieder fit werden. Ich bringe Sie auf Ihr Zimmer, da können Sie sich ganz in Ruhe frisch machen. Und wenn Sie Hunger haben, das Restaurant ist bereits geöffnet.“ Sie griff an das große Brett hinter sich, wo die Zimmerschlüssel aufgereiht an der Wand hingen, und nahm einen davon vom Haken. Dann kam sie um den Tresen herum und ging voraus. Schnell schnappte ich mir meinen Rucksack und folgte ihr in Richtung der Treppe, während sie weitersprach: „Dort drüben, bei den Sitzgruppen, finden Sie das Restaurant. Mein Mann ist ein ganz hervorragender Koch. Wir führen das Hotel gemeinsam. Ich mache den Empfang und das Büro und er ist der Koch. Unsere Tochter hilft ab und an aus, wenn sie neben dem Studium noch Zeit hat, und wir haben natürlich auch ein paar Angestellte. Doch das meiste machen wir selbst. So ein Hotel … das war schon als Kind mein Traum. Ein eigenes kleines Hotel. Allerdings hatte ich mir damals nicht vorgestellt, es in der Schweiz aufzumachen. Aber gut, was tut man nicht alles für die Liebe.“ Mittlerweile waren wir im Obergeschoss angekommen, wo sie vor der Tür mit der Nummer 17 stehen blieb.
„Hier wären wir! Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt bei uns, und wenn Sie Fragen haben, finden Sie mich an der Rezeption.“ Sie stieß die Zimmertür auf und machte eine einladende Handbewegung. Dann drückte sie mir den Schlüssel in die Hand und ließ mich allein.
Das Zimmer war sauber und gemütlich eingerichtet. Als mein Blick auf das Bett fiel, konnte ich kaum noch widerstehen. Am liebsten hätte ich mich sofort in die weichen Kissen sinken lassen und meine Augen geschlossen. Den ganzen Tag im Zug zu sitzen und das Rattern zu spüren, hatte mich schon geschlaucht. Doch der Fußmarsch mit dem schweren Rucksack auf den Schultern hatte mir auch die letzte Kraft geraubt. Ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten und wollte in diesem Moment nur meinen schmerzhaft verspannten Rücken ausruhen und schlafen.
Sonntag, den 11. Juni
~*~ Basel ~*~
„Guten Morgen, Frau Medina! Haben Sie gut geschlafen?“ Frau Weber tauchte neben meinem Tisch auf, als ich am nächsten Tag beim Frühstück im Hotelrestaurant saß, und lächelte mich strahlend an. Ich fand es noch immer toll, dass sie sich die Namen der Gäste – oder zumindest meinen Namen – merken konnte. So fühlte man sich gleich ein wenig heimisch und auf jeden Fall willkommen.
„Guten Morgen! Ja, ich habe großartig geschlafen, vielen Dank. Das Zimmer ist wirklich schön und das Bett sehr bequem“, antwortete ich und legte mein Besteck aus der Hand.
„Haben Sie heute schon etwas geplant? Was wollen Sie sich anschauen?“, fragte Frau Weber und deutete auf die Zettel neben meinem Teller. Vor mir auf dem Tisch lagen ein paar Ausdrucke, die ich von zu Hause mitgebracht hatte. Eine Liste mit Sehenswürdigkeiten, die Basel zu bieten hatte. Doch ich konnte mich nicht entscheiden, was ich heute machen wollte.
„Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht so genau.“ Unsicher schob ich die Ausdrucke hin und her. Was wollte ich? Sightseeing auf eigene Faust? Eine Stadtrundfahrt? Ich hatte keine Ahnung.
„Falls Sie noch ein paar Tipps brauchen, melden Sie sich bei mir. Ich helfe gern, wenn ich kann. Ich habe auch Stadtpläne an der Rezeption, für den Fall, dass Sie einen haben möchten …“ Verschmitzt lächelte Frau Weber mich an. Ich verstand ihre Anspielung auf meine gestrige Aktion mit dem falschen Bahnhof nur zu gut und grinste ein wenig verschämt. „Ja, ein Stadtplan ist vielleicht keine schlechte Idee.“
„Kommen Sie einfach am Empfang vorbei, bevor Sie losgehen, dann gebe ich Ihnen einen. Und jetzt genießen Sie Ihr Frühstück. Ich hoffe, es ist alles zu Ihrer Zufriedenheit?“
„Oh, auf jeden Fall. Vielen Dank, es ist alles sehr lecker! Einen lieben Gruß an Ihren Mann, er ist wirklich ein ganz ausgezeichneter Koch!“
Frau Weber strahlte bei meinem Kompliment für ihren Mann. „Ich werde es ihm ausrichten. Da wird er sich freuen. Wir sehen uns dann später. Einen guten Appetit weiterhin.“ Damit steuerte Frau Weber den nächsten Tisch an, an dem ein älteres Pärchen saß, und ich widmete mich wieder meinem Rührei.
Während ich mein Frühstück beendete, konnte ich beobachten, wie die Hotelinhaberin von Tisch zu Tisch ging und mit jedem ihrer Gäste ein paar freundliche Worte wechselte.
Mit meinen Eltern war ich bisher immer nur in großen, teuren Hotelketten abgestiegen. Dort war alles deutlich anonymer als in einem solch kleinen Hotel. Ich kannte es nicht, dass der Inhaber selbst derart bemüht um das Wohl seiner Gäste war, aber es gefiel mir ausgesprochen gut. Ich fühlte mich hier wohl und konnte mir gar nicht vorstellen, bereits morgen wieder abzureisen. Doch dann ging meine Fahrt weiter nach Mailand.
Als ich gestern Abend in meinem Zimmer vor dem Spiegel stand, hatte ich mich richtig erschrocken. Meine Haare standen wirr und verzottelt in alle Richtungen, mein Make-up existierte nicht mehr und verschwitzt, wie ich war, klebten meine Klamotten an mir. Ich sah aus, als wäre ich fünf Tage lang ohne Wasser und Nahrung durch einen Dschungel geirrt – und nicht nur mit der Bahn von Hamburg nach Basel gefahren. Kein Wunder, dass Frau Weber bei meinem Anblick so besorgt reagiert hatte.
Nach einer ausgiebigen Dusche hatte ich mich wieder halbwegs wie ein Mensch gefühlt und nach einem reichhaltigen Abendessen im Restaurant des Hotels war ich beinahe wie neu. Bis auf meine schmerzenden Schultern, die sich durch die Last des Rucksacks vollkommen verspannt hatten. Was hätte ich alles für eine Massage gegeben!
In der letzten Nacht hatte ich geschlafen wie ein Stein und war dadurch heute Morgen wie durch ein Wunder fast wieder die Alte. Zwar waren mir meine Schultern wegen der ungewohnten Last noch immer ziemlich böse, doch ansonsten fühlte ich mich fit und freute mich, ein wenig von Basel kennenzulernen. Auch wenn ich mich nicht entscheiden konnte, wohin das Sightseeing mich führen würde. Wollte ich den wunderschönen sommerlichen Tag wirklich in einem Museum zwischen angestaubten Exponaten verbringen? Hatte ich Lust, mir in einer kalten Kirche Deckenmalereien anzuschauen? Wollte ich die Besonderheiten der Architektur irgendwelcher alten Gebäude bestaunen?
Nein! Wenn ich ehrlich war, war das so ziemlich das Letzte, worauf ich jetzt Lust hatte. In den letzten Jahren hatte ich viel zu viele Museen besucht, zu viel historisches Sightseeing gemacht, wenn ich mit meinen Eltern verreist war. Dieser Urlaub hier sollte nur meiner werden, und dazu gehörte auch, dass ich ausschließlich Sachen machte, auf die ich gerade Lust hatte. Das war schließlich einer der Gründe, warum ich nicht gewollt hatte, dass Jola mich begleitete. Ich mochte mich in den nächsten drei Wochen nicht nach jemand anderem als ganz allein nach mir selbst richten.
„Ah, da sind Sie ja. Haben Sie sich entschieden, was Sie heute Schönes machen wollen? Geht es ins Kunstmuseum? Oder mögen Sie lieber die Kathedrale besichtigen? Der Basler Münster ist wirklich beeindruckend! Oder wenn Sie an Büchern interessiert sind – die Papiermühle kann ich Ihnen nur empfehlen! Das ist ausgesprochen spannend, zu sehen, wie Papier hergestellt wird. Und dann diese Buchdruckkunst und das Binden – einfach toll!“ Frau Weber war voll in ihrem Element. Ich merkte deutlich, dass sie ihren Gästen regelmäßig Tipps gab, was sie hier in der Stadt unternehmen konnten. Sie war mit Feuereifer dabei und ließ sich erst stoppen, als ich sie unterbrach.
„Ich glaube, ich würde gern in den Zoo.“ Ganz spontan hatte ich mich aus dem Bauch heraus entschieden. Ich hatte in meinem Leben unzählige verschiedene Museen besucht, in den teuersten Restaurants gegessen, in den nobelsten Hotels übernachtet, doch ich konnte mich nicht daran erinnern, mit meinen Eltern jemals einen Zoo angeschaut zu haben.
Natürlich, mit der Schulklasse waren wir in Hagenbecks Tierpark gewesen und ein paar meiner Freundinnen hatten dort auch ihren Kindergeburtstag gefeiert, ich kannte also einen Zoo. Doch es war nie ein Familienausflug gewesen.
Irritiert stockte Frau Weber ihre begeisterten Ausführungen und schaute mich mit offenem Mund an. „In den Zoo?“, hakte sie nach, als sie ihre Stimme wiedergefunden hatte.
„Ja, richtig, der Zoo ist doch da beim Bahnhof in der Nähe, oder? Wo ich gestern fälschlicherweise ausgestiegen bin.“
Frau Webers Mundwinkel zuckten, dann schüttelte sie grinsend den Kopf.
„Nein, der Zoo ist hier bei diesem Bahnhof. Am anderen Bahnhof ist der Tierpark“, erklärte sie.
„Das ist aber auch verwirrend! Eine Stadt mit zwei großen Bahnhöfen und an beiden davon liegt ein Zoo in der Nähe.“
„Nein, ein Zoo und ein Tierpark“, verbesserte mich Frau Weber nachsichtig lächelnd. „Aber ich weiß, wie Sie sich fühlen. Mir ging es damals ähnlich, als ich hergezogen bin. Ich hatte auch Schwierigkeiten, mich zurechtzufinden, dabei ist Berlin viel größer und unübersichtlicher als Basel. Über zwanzig Jahre ist das her und bis heute verlaufe ich mich in der Stadt. Wenn Sie in den Zoo möchten, schauen Sie, der Weg ist ganz leicht.“ Sie faltete einen kleinen Stadtplan auseinander, der vor ihr auf dem Empfangstresen bereitgelegen hatte, und griff nach einem Stift. „Hier sind wir und hier …“ Sie machte ein Kreuzchen an der Stelle, wo sich das Hotel befand, und zeichnete den Weg ein. „Hier ist schon der Zoo. Sehen Sie. Nur ein paar Minuten zu Fuß – und Sie müssen auch nicht den Rhein überqueren.“ Bei ihrer erneuten Anspielung auf meine Aktion von gestern zwinkerte Frau Weber mir spöttisch zu. Okay, das hatte ich verdient. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, und wäre ich im Zug nicht derart entnervt von der saufenden Herrentruppe gewesen, wäre mir das sicher nicht passiert.
„Na gut, das sieht wirklich einfach zu finden aus, das sollte wohl selbst ich schaffen!“, ging ich auf ihr Geplänkel ein. „Vielen Dank! Dann mache ich mich mal auf den Weg.“ Ich steckte den Stadtplan in die kleine Handtasche, die ich über der Schulter hängen hatte, und trat aus dem Hotel auf die Straße.
Obwohl es gerade erst kurz nach zehn Uhr war, verbreitete die Sonne bereits eine angenehm sommerliche Wärme. Langsam machte ich mich auf den Weg in Richtung Zoo. Ich genoss es, in meinem eigenen Tempo zu laufen, an einem blühenden Busch stehen zu bleiben und eine kleine Biene zu beobachten. Ich genoss es, mit niemandem sprechen zu müssen, die Geräusche der Stadt zu hören und durch nichts abgelenkt zu sein. Ich war mit mir allein und das machte mich glücklich. Ich hatte das Gefühl, noch nie in meinem Leben wirklich allein gewesen zu sein. Es war neu, aber es fühlte sich gut an.
Langsam schlenderte ich durch den Zoo, blieb an den Gehegen der Tiere stehen und nahm mir Zeit, ihnen zuzusehen. Besonders die Schimpansen hatten es mir angetan. Bestimmt eine Stunde beobachtete ich, wie sie so menschenähnlich und doch ganz anders agierten. Wie sie über Netze und Seile kletterten, wie sie sich gegenseitig Nähe gaben und miteinander kuschelten, wie sie spielten und tobten, als wären sie kleine Kinder. Ich konnte mich gar nicht daran sattsehen.
Am frühen Nachmittag holte ich mir an einem der Kioske ein Softeis und setzte mich damit auf eine Bank in die Sonne. Tief sog ich die Luft in meine Lungen, nahm diese Duftmischung aus Natur und Tieren ganz bewusst wahr und spürte, wie entspannt ich innerlich war. Ja, so hatte ich mir meinen Urlaub vorgestellt. Um mich herum herrschte Ruhe – obwohl Sonntag und noch dazu traumhaftes Wetter war, waren nicht sonderlich viele Menschen im Zoo unterwegs. Ein paar Touristen konnte ich ausmachen. Sie verrieten sich durch die allzeit bereiten Handys und Fotokameras, die jeden Schritt aufnahmen. Ein paar Gehege weiter sah ich eine Gruppe Kinder, die von ein paar Erwachsenen begleitet wurden. Vielleicht eine Geburtstagfeier? Ich beobachtete die Kinder, lauschte ihren begeisterten Rufen, ihrem ausgelassenen Lachen und fühlte mich rundum zufrieden und glücklich. Das Leben konnte so leicht sein, so wundervoll auch ohne teure Hotels und High-Society-Gehabe.
Nachdem ich mein Eis aufgegessen hatte, schloss ich die Augen und hielt meine Nase in die Sonne. Einen Moment wollte ich noch sitzen bleiben, bevor ich meine Runde fortsetzte. Als ich sie wieder öffnete, fiel mein Blick auf einen Mann, der mir heute beim Elefantengehege schon einmal aufgefallen war. Nicht, dass ich großartig auf andere Besucher des Zoos geachtet hatte – dafür gab es viel zu viel zu sehen und die Tiere waren deutlich interessanter! Er war mir aufgefallen, weil er sich – im Gegensatz zu den restlichen Besuchern – nicht sonderlich für die Elefanten zu interessieren schien. Seinen Blick auf uns Menschen gerichtet, die vor der Absperrung standen, hielt er sich ein wenig abseits der Masse. Jetzt erkannte ich ihn wieder, da er ein auffälliges Sweatshirt mit dem Zeichen der Rolling Stones trug. Der offene, knallrote Mund mit der herausgestreckten Zunge fiel einfach auf. Noch dazu war er für diese sommerlichen Temperaturen deutlich zu warm angezogen. Ich konnte nicht viel von ihm erkennen, da ich gegen die Sonne schauen musste, außerdem verdeckte ein Basecap seine Haare und eine große Ray-Ban-Fliegerbrille das halbe Gesicht. Doch wie bereits vorhin schien er kein Interesse an den Tieren zu haben.
Als er bemerkte, dass ich ihn beobachtete, drehte er sich abrupt weg und ging davon. Merkwürdiger Kerl … Ich dachte nicht weiter darüber nach und setzte meinen Rundgang durch den Zoo fort.
Es war bereits später Nachmittag, als ich den Zoo verließ. Das Wetter war traumhaft, und ich wollte noch nicht ins Hotel zurückkehren, daher wanderte ich ein wenig ziellos durch Basels Straßen. Diesmal hatte ich keine Angst, mich zu verlaufen, Frau Webers Stadtplan, auf dem das Hotel eingezeichnet war, befand sich schließlich sicher verwahrt in meiner Handtasche.
Als ich auf einer der Brücken den Rhein überquerte, um in den anderen Teil der Stadt zu kommen, fiel mein Blick auf ein flaches Holzboot, das in einiger Entfernung gerade über den Fluss fuhr. Neugierig trat ich an die Brüstung und schaute genauer hin. Dies musste eine der Rheinfähren sein. Bei den Tipps für Sehenswürdigkeiten waren diese Fähren dabei gewesen. Der Beschreibung nach waren sie etwas ganz Besonderes. Allein durch die Wasserkraft des Flusses, nur gelenkt von einem Steuermann, überquerten die kleinen Boote an einem Stahlseil den mächtigen Strom.
Ich legte meine Hand über die Augen, um im Sonnenlicht die Anlegestelle am Ufer ausmachen zu können. Das wäre doch ein schöner Abschluss für den heutigen Tag. Zu Fuß über den Rhein und mit einer der Fähren wieder zurück. Ja, das war ein guter Plan!
Eine halbe Stunde später hatte ich die Anlegestelle gefunden und saß auf dem flachen Fährboot. Von Nahem war die Fähre viel kleiner, als ich gedacht hatte. Vielleicht fünfzehn Leute passten auf die beiden gegenüberliegenden, längs des Rumpfes angebrachten Holzbänke. Außer mir befanden sich nur noch vier Pärchen auf dem Boot, auch hier merkte man, dass keine Ferienzeit war. Im Hochsommer musste man bestimmt anstehen und lange warten, um eine Fahrt zu machen.
Ruhig und beschaulich glitt die Fähre über das Wasser. Das leise Plätschern der Wellen, die gegen den Bug schlugen, wirkte beruhigend. Als waschechte Hamburgerin war ich natürlich seefest, aber der kaum spürbare Wellengang hätte wahrscheinlich niemanden seekrank gemacht.
Während der Fahrt erzählte der Steuermann lustige Anekdoten und Geschichten aus der Stadt. Entspannt lehnte ich mich zurück und genoss die kühle Brise, die über das Wasser streifte. So vermaledeit mein Urlaub gestern auch angefangen hatte, jetzt wurde er immer besser. So konnte es weitergehen!
„Ach, hallo, Frau Medina. Da sind Sie ja wieder. Hatten Sie einen schönen Tag?“ Frau Weber eilte strahlend durch die kleine Lobby des Hotels auf mich zu. Heute Abend besetzte eine junge Frau, die ich bisher nicht gesehen hatte, die Rezeption. War das die Tochter der Eheleute?
Dennoch war Frau Weber hier und begrüßte mich persönlich. Ein weiteres Zeichen dafür, dass sie ihr kleines Hotel wirklich mit Leib und Seele liebte. Dieses Wissen hinterließ ein warmes Gefühl in meinem Bauch, und ich hoffte, auch auf dem Rest meiner Reise eine solche Gastfreundschaft in den Hotels zu spüren.
„Ja, der Zoo ist wirklich toll!“ Ich erzählte der Hotelbesitzerin, was ich den Tag über erlebt hatte.
„Das freut mich sehr! Da sind Sie jetzt sicher hungrig. Oder haben Sie unterwegs etwas gegessen? Mein Mann hat heute einen ganz wunderbaren Schweinebraten gemacht. Nach dem Rezept meiner Oma.“ Fröhlich zwinkerte Frau Weber mir zu. „Ist zwar nicht direkt Schweizer Küche, aber dieser Braten ist einfach so lecker! Mit Rahmwirsing und Kartoffeln – wirklich ein Gedicht!“ Ein schwärmerischer Ausdruck legte sich auf ihr Gesicht.
Wie auf Befehl fing mein Magen an zu knurren. Seit dem Softeis im Zoo hatte ich tatsächlich nichts mehr zu mir genommen.
„Das klingt köstlich! Ich springe nur eben unter die Dusche und mache mich ein wenig frisch.“
Eine Stunde später lehnte ich mich vollgefuttert gegen die Rückenlehne meines Stuhls und schaute zu Frau Weber auf, die meinen leeren Teller abräumte.
„Das war so lecker! Sagen Sie Ihrem Mann bitte ganz liebe Grüße, er ist ein unglaublich guter Koch!“ Ich wusste, wovon ich sprach. Immerhin hatte ich mit meinen Eltern in mehr als nur einem Sternerestaurant gespeist, und Herr Weber konnte es meiner Meinung nach locker mit all diesen neumodischen und hippen Edelköchen aufnehmen. Morgen früh würde ich abreisen, doch ich wusste bereits jetzt, ich würde das Essen von Herrn Weber und die Herzlichkeit von Frau Weber vermissen.
So vernachlässigt dieses kleine Hotel auch von außen auf den ersten Blick gewirkt hatte, die Basler Perle war wirklich eine Perle, die ich mir auf jeden Fall merken und wohin ich nur zu gern wiederkehren würde.
Montag, den 12. Juni
~*~ Mailand ~*~
Der Abschied von Frau Weber heute Morgen war mir fast ein wenig schwergefallen. Die zwei Tage, die ich in der Basler Perle verbracht hatte, waren so schön gewesen, dass ich mich kaum trennen mochte. Herr Weber hatte mir für die Fahrt ein Carepaket mit Sandwiches, Obst und einem kleinen Salat zusammengestellt. Zwar hatte ich im Hotel ausgiebig gefrühstückt, aber laut seiner Frau hatte er sich so über meine Komplimente zu seinem Essen gefreut, dass er mir etwas Gutes tun wollte. Das war eine solch liebe Geste, dass ich mir fest vornahm, Basel und dieses kleine Hotel noch einmal zu besuchen.
Gestern Abend nach dem Essen hatte ich im Restaurant, das gleichzeitig als Hotelbar diente, noch ein Glas Wein getrunken. Einige andere Gäste saßen ebenso wie ich in den Loungesesseln und ließen den Tag gemütlich ausklingen. Nachdem Herr Weber die Küche geschlossen hatte, ging er mit seiner Frau von Tisch zu Tisch und wechselte mit den Gästen ein paar Worte. Ich bekam mit, wie er sich mit einem älteren Herrn unterhielt, der anscheinend ein Stammgast war. Der Mann lobte die renovierte Lobby, und Herr Weber erzählte ihm, dass als Nächstes die Außenfassade drankommen würde. Dann wäre die Basler Perle wirklich eine Perle – von innen wie von außen.
Mit einem Hauch von schlechtem Gewissen erinnerte ich mich an meine Ankunft, an den unschönen ersten Eindruck, den ich gehabt hatte. Dabei war es eigentlich nur verständlich. Ein solch kleines Hotel konnte man nicht mit den großen Ketten vergleichen. Schönheitsreparaturen und Renovierungen mussten vermutlich erst eingenommen und angespart werden, bevor man investieren konnte. Dieses Hotel war nicht verwahrlost – im Gegenteil! Sobald man es betreten hatte, spürte man in jedem Detail, wie sehr es von seinen Besitzern geliebt wurde.
Der zweite Streckenabschnitt meiner Reise verlief deutlich entspannter als der erste Teil. Was nicht nur daran lag, dass die Fahrt von Basel nach Mailand mit der Bahn bloß vier Stunden dauerte und somit deutlich kürzer als die erste Etappe war, sondern auch, dass ich sie in netter Gesellschaft verbrachte.
Zusammen mit mir reisten zwei junge Männer und eine Frau im Abteil, die ebenso wie ich nach Mailand wollten, und wir unterhielten uns über unsere Reisepläne. Die drei waren aufgeregt, es war ihr erster Besuch dort, und als sie mitbekamen, dass ich Mailand bereits kannte, baten sie mich um Tipps, was man unbedingt gesehen haben musste.
In Mailand angekommen, fühlte ich mich gleich ein bisschen heimisch. Na gut, vielleicht nicht wirklich heimisch, doch zumindest nicht ganz so fremd und verloren wie vor zwei Tagen in Basel. Ich verlief mich auch nicht auf dem Weg zu meiner Pension.
Diesmal hatte ich kein Hotel im Voraus gebucht, da ich mich nicht festlegen wollte, wie lange ich an welchem Ort bleiben würde. Ich hatte nur eine Liste mit kleinen Pensionen, die sich halbwegs in der Innenstadt befanden und preislich im günstigeren Segment lagen.
Als Erstes steuerte ich eine Pension in einer schmalen Seitenstraße fast mitten im Zentrum an. Bereits von Weitem erkannte ich den hell verputzten Bau, an dem sich Efeu rechts und links der Eingangstür emporrankte. Je näher ich kam, desto besser gefiel es mir. Es wirkte einladend und freundlich und lag tatsächlich fußläufig zu den schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ich hoffte, dass es nicht ausgebucht war und ich so spontan ein Zimmer bekommen konnte. Zum einen, weil es mir wirklich gut gefiel, zum anderen aber auch, weil sich meine Lust, noch weiter durch die Stadt zu laufen und nach einer Unterkunft zu suchen, sehr in Grenzen hielt.
Es war früher Nachmittag und die Sonne brannte heiß vom strahlend blauen Himmel. Bevor ich mich mit dem schweren Rucksack wieder völlig verausgabte und komplett durchgeschwitzt war, wollte ich ihn loswerden und dann zu Fuß die Stadt erkunden.
Ich hatte Glück und bekam tatsächlich ein Zimmer in der Pension. Es war klein und schlicht eingerichtet. Ein eigenes Bad gab es nicht, nur ein Gemeinschaftsbad auf dem Flur, doch es war sauber. Das war für mich das Wichtigste. Ich hatte vorher gewusst, dass ich auf dieser Reise Abstriche zu meinem sonstigen Standard würde machen müssen. Nein, mehr noch, ich hatte genau diese Abstriche gewollt! Von daher empfand ich es nicht als störend, mir mit anderen Gästen ein Bad teilen zu müssen.
Nachdem ich meine Sachen verstaut und mich ein wenig frisch gemacht hatte, machte ich mich auf den Weg. Ich schlenderte durch Mailands Straßen und ließ mir die Sonne auf die Schultern scheinen. Glücklicherweise hatte ich in der Pension daran gedacht, mich einzucremen, ansonsten hätte ich sicher innerhalb kürzester Zeit einen ordentlichen Sonnenbrand.
Dieses Mal nahm ich die Stadt ganz anders wahr, als ich es bei meinen bisherigen Besuchen getan hatte. Das letzte Mal war vor ungefähr vier Jahren gewesen, doch die Erinnerungen, die ich mit mir herumtrug, die mir am deutlichsten waren, waren älter. Sie stammten aus meinen Kindertagen, von den ersten Reisen in diese schöne Stadt. Ich erkannte die teuren Restaurants, in denen ich bereits als Kind gegessen hatte. Die Straßen, durch die wir in klimatisierten Wagen gefahren waren.
Als ich an einen Platz kam, auf dem ich einen flachen runden Brunnen mit in der Mitte erhöhtem Aufbau erkannte, wusste ich genau, wo ich war. Dies war der Fontana di Piazza Castello. Hochzeitstorte wurde er auch genannt, weil der innere Aufbau des Brunnens ein wenig wie eine Torte aussah, die von einem flachen Wasserbecken umgeben war.
Ich erinnerte mich an einen Tag in Mailand, an einen wahnsinnig heißen Nachmittag mit meinen Eltern auf diesem Platz. Ich hatte so sehr geschwitzt und wollte nichts sehnlicher, als mein blödes Sommerkleidchen auszuziehen und in das kühle Wasser des Brunnens zu steigen. Mir war schon ganz schwummerig und ich hatte nur noch diesen einen Gedanken.
Während mein Vater den Reiseführer spielte und dem Rest der Familie irgendetwas für mich völlig Uninteressantes über den Brunnen erzählte, ging ich immer näher heran und setzte mich, wie so viele andere Besucher des Platzes, auf den Rand.
Nur die Finger! Das kühle Nass an meinen Händen spüren. Mich vielleicht ein wenig besprenkeln, damit es nicht mehr so unerträglich heiß war. Damit ich nicht mehr das Gefühl hatte, zu verglühen.
Meine Eltern und meine Geschwister waren vergessen, ich sah nur noch das Wasser, hörte das Plätschern und sehnte mich nach der kleinen Abkühlung.
„Sienna! Was fällt dir ein! Nimm sofort deine Hände aus dem Dreckwasser!“ Mit hochrotem Kopf war mein Vater vor mir aufgetaucht, hatte unsanft nach meinem Arm gegriffen und mich hinter sich her zurück zum Rest der Familie geschleift. Er war so wütend wie selten zuvor gewesen, doch in diesem Moment war es mir egal. Die Hitze nahm mir die Luft zum Atmen, mein Kopf tat weh, und ich hatte das Gefühl, es nicht länger auszuhalten.
„Ich will ins Wasser! Bitte, Babbo! Lass mich ins Wasser. Nur mit den Händen!“, hatte ich ihn angefleht, doch er hatte mich nicht weiter beachtet. Ich hatte keine Chance gehabt, ich musste ohne das kühlende Nass weitergehen und mir die Stadt anschauen.
An diesem Abend war ich krank. Ich mochte nichts essen, mir war übel, mein Kopf schmerzte unglaublich und mein Körper glühte wie im Fieber.
An diesem Tag hatte ich mir meinen ersten und einzigen Sonnenstich geholt. Bis heute erinnerte ich mich genau daran, wie schlecht es mir damals ging. Wahrscheinlich hätte der Sonnenstich auch nicht durch eine kurze Abkühlung in dem Brunnen verhindert werden können, doch ich war ein kleines Mädchen gewesen, das sich an diesem Nachmittag von seinem Vater verlassen gefühlt hatte.
Kopfschüttelnd versuchte ich, die Erinnerung an jenen Tag zu vertreiben. Ich war erwachsen, mittlerweile durfte ich tun und lassen, was ich wollte, und niemand konnte es mir verbieten. Lächelnd ließ ich meinen Blick über den Brunnen schweifen. Wie schon damals saßen auch heute Besucher des Platzes auf dem Rand und streckten ihre Hände ins Wasser. Mit schnellen Schritten überquerte ich den Platz und setzte mich auf den Brunnenrand. Im Becken sprudelten viele kleinere Fontänen, und der Wind trug feine Wassertröpfchen wie einen Sprühregen zu mir, die ein kühles Gefühl auf der Haut hinterließen.
Ich senkte meine Hand, bis meine Fingerspitzen die Wasseroberfläche berührten. Dann tauchten sie langsam ins kühle Nass. Ich ließ meine gespreitzen Finger im Wasser hin und her gleiten und genoss das Gefühl. Als Kind hatte ich hier nicht planschen dürfen, doch heute konnte es mir niemand verbieten. Ja, Babbo war weit weg und ich mittlerweile erwachsen. Heute würde ich keinen Sonnenstich bekommen.
Dass der letzte Gedanke albern war, wusste ich selbst. Dennoch ließ er mich lächeln.
Ich schlenderte weiter durch die Mailänder Innenstadt, bis ich an der Scala ankam. Dieses weltberühmte Opernhaus, in dem schon die größten Künstler der Welt aufgetreten waren. Selbstverständlich hatte ein Besuch der Scala auf unseren Reisen dazugehört, doch auch daran waren meine Erinnerungen nicht unbedingt schön.
„Sienna, sitz still!“, war wohl der am häufigsten gehörte Satz des Abends gewesen. Ich war vielleicht zehn Jahre alt, als wir uns irgendeine Oper oder Operette angesehen hatten. Ich wusste nicht mehr, was aufgeführt worden war, aber dafür erinnerte ich mich nur zu genau an andere Details des Abends. Ich spürte bis heute die Haarnadeln, die auf meiner Kopfhaut ziepten, weil meine Mutter mir meine langen schwarzen Haare zu einer aufwendigen Frisur geflochten und hochgesteckt hatte. Die Spitze meines Abendkleides kratzte auf meiner Haut wie ein alter Wollpulli, die feine Strumpfhose hatte bereits bei unserer Ankunft in der Scala eine Laufmasche gehabt, und ich bekam mehr als nur einen Klaps auf die Finger, weil ich daran herumpulte. Aber sie nervte mich nun einmal! Genau wie das Kleid und die Frisur.
Ich saß in der Loge, die mein Vater extra für uns reserviert hatte, und wollte nur weg. Die Musik klang für mich furchtbar schrill. Am liebsten hätte ich mir die Ohren zugehalten, doch das war natürlich nicht erlaubt. Unendlich lang dauernde Stunden musste ich ausharren in diesem kratzigen Kleid mit der nervigen Laufmasche und den ziependen Haarnadeln, die in meine Kopfhaut stachen. Ich wollte und konnte nicht stillsitzen, egal, wie oft meine Eltern es von mir verlangten.
„Sienna, sitz still!“
Auch jetzt, im warmen Sonnenschein mit Blick auf die Mailänder Scala, klangen diese Worte in mir nach, als würde ich sie in diesem Moment erneut hören. Selbst heute lief es mir kalt den Rücken hinunter, wenn ich an diesen Abend zurückdachte. An diesem Tag hatte ich mir geschworen, niemals wieder eine Oper – oder Operette – zu besuchen. Na gut, ganz so extrem war meine Meinung dazu mittlerweile nicht mehr. Vielleicht würde ich es noch einmal mit dieser Art Musik versuchen – zumindest lehnte ich es nicht mehr kategorisch ab.
Ja, ich war erwachsen geworden. Heutzutage fand ich Abendkleider nicht mehr ganz so furchtbar. Es war zwar nicht meine bevorzugte Kleidung, aber ab und an machte ich mich gern schick. Allerdings freute ich mich jedes Mal, nach einigen Stunden wieder aus diesen Klamotten rauszukommen.
Dennoch hatte ich nicht nur schlechte Erinnerungen an Mailand. Es hatte auch schöne Momente und faszinierende Eindrücke gegeben. Nachdem ich einen letzten Blick auf das imposante Gebäude der Scala geworfen hatte, machte ich mich wieder auf den Weg. Der heutige Nachmittag fühlte sich an wie eine Reise in meine Vergangenheit, doch ich wollte nicht nur die negativen Erlebnisse dieser Stadt ausmergeln und durch neue Erinnerungen ersetzen, ich wollte auch die schönen Momente zurückholen. Daher steuerte ich als Nächstes den Mailänder Dom an, der sich unweit der Scala befand.
Wie jedes Mal, wenn ich davor stand, stockte mir ein bisschen der Atem. Es gab nicht viele Kirchen, die mich derart beeindruckt hatten. Obwohl ich sie mochte, sie mir immer gern anschaute, diese besondere Stille und Stimmung in mich aufnahm und die wunderschönen und so unterschiedlichen Verzierungen betrachtete, gab es nur wenige, die mir wirklich den Atem raubten mit ihrer Schönheit.
Na klar, der Hamburger Michel war eine davon! Es war die erste Kirche, die ich mich erinnern konnte, besucht zu haben, und noch dazu war sie ein Wahrzeichen meiner Heimatstadt. Der Kölner Dom und auch die Segrada Familia in Barcelona waren zwei weitere, wunderschöne Kirchen, die ich mir immer und immer wieder anschauen konnte. Ja, und dann war da der Mailänder Dom.
Staunend und mit großen Augen wie ein Kind stand ich davor und sah an der Fassade hinauf. Betrachtete die Dekors und versuchte, Details zu entdecken. Es war wie ein riesengroßes Wimmelbild. So viele Kleinigkeiten, die man erst bemerkte, wenn man sich wirklich darauf einließ, wenn man sich die Zeit nahm und ganz genau hinschaute. Auch hier hatte mein Vater in meiner Kindheit den Reiseführer für uns gespielt und uns Details über den Bau der Kirche erzählt. Wahrscheinlich hatte er sie irgendwo gelesen, zumindest konnte ich mir nicht vorstellen, dass er auswendig wusste, wann die Seitenwände des Kirchenschiffs erbaut worden waren. Diese ganzen Jahreszahlen waren es aber nicht, weshalb ich Babbo in diesem Moment gebannt zuhörte. Er war es, der mir half, immer wieder neue Details und Kleinigkeiten zu entdecken. Ja, dank ihm kam ich mir wirklich wie eine Entdeckerin vor. So despotisch und herrisch mein Vater sein konnte, wenn es um unseren gesellschaftlichen Stand und das Auftreten seiner Familie ging, in anderen Momenten war er einfach ein liebender Vater, der seiner kleinen Tochter die Welt erklärte.
Ein warmes Gefühl hatte sich in meinem Bauch breitgemacht, als ich den Dom hinter mir ließ. Ich hatte nicht den Drang, hineinzugehen und ihn mir noch einmal von innen anzuschauen. Ich wollte die wunderschönen Erinnerungen, die ich bereits hatte, nicht mit neuen überschreiben. Ich war zufrieden, so wie es war.
Außerdem taten mir nach dieser Sightseeingtour ein wenig die Füße weh und ich sehnte mich nach einem Sitzplatz im Schatten, einem kalten Getränk und einem Abendessen.
In einer Seitenstraße unweit meines Hotels entdeckte ich ein kleines Lokal, in dem hauptsächlich Einheimische zu verkehren schienen. Zumindest war die einzige Sprache, die ich wahrnahm, italienisch, und die Art, wie die Leute sich von Tisch zu Tisch Sätze zuwarfen und miteinander lachten, zeigte mir, dass sie sich kannten.
Eines hatte ich auf den vielen Reisen der letzten fünfundzwanzig Jahre gelernt: Wenn du gut und nicht zu teuer essen möchtest, gehe dorthin, wo die Einheimischen verkehren. Das war ein festes Gesetz, an das meine Eltern sich immer, egal, wo wir waren, hielten. Natürlich haben wir in den teuren Restaurants der Touristenhochburgen gespeist, in den In-Lokalen, die man besucht haben musste. Genauso oft verbrachten wir unsere Abende allerdings in abgeschiedenen Restaurants unter Einheimischen.
Die Entscheidung, in diesem kleinen Lokal zwischen den Einheimischen meinen Tag ausklingen zu lassen, war genau richtig. Ich verstand zwar nicht einmal die Hälfte von dem, was der Kellner und die anderen Gäste mir erzählten, aber das musste ich gar nicht. Das Essen schmeckte großartig, die Stimmung war ausgelassen und fröhlich und ich wurde sofort miteinbezogen.
Als eine Gruppe Italiener sah, dass ich allein an meinem Tisch saß, kam eine der Frauen und lud mich zu ihnen ein. Mehrere Weinflaschen wurden im Laufe des Abends gemeinsam geleert, und soweit ich es mitbekam, waren wirklich hauptsächlich Mailänder anwesend. Wir unterhielten uns mit Händen und Füßen, und ich fühlte, wie willkommen ich in der Runde war. Als ich gefragt wurde, woher ich stammte, und erzählte, dass ich aus Hamburg kam, verfielen sie ins Schwärmen. Ich musste ein wenig schmunzeln. So wie wir Deutschen Mailand als eine traumhafte Stadt ansahen, die jedes Jahr von Hunderttausenden besucht wurde, so erging es den Italienern anscheinend mit Hamburg. Sie schwärmten vom Michel, dem Hafen und dem wunderschönen Rathaus. Sie waren begeistert von der Elbe und der Alster und wollten am liebsten sofort hinfahren.
Obwohl wir uns so gut verstanden, war ich doch ein wenig traurig, dass ich fast kein Italienisch sprach. Mein Vater war gebürtiger Italiener, auch wenn er bereits zum Studium nach Deutschland gekommen und in Hamburg geblieben war. Er konnte es natürlich fließend, hatte aber durch die viele Arbeit in seiner Kanzlei leider nicht die Möglichkeit und die Zeit gehabt, uns Kindern die Sprache beizubringen.
Dennoch verbrachte ich einen unglaublich lustigen Abend, an dem ich dazu noch viele Tipps für meine weitere Reise bekam.
Als ich um kurz vor Mitternacht in die kleine Pension zurückkehrte, war ich todmüde und wollte nur ins Bett. Morgen ging die Reise weiter. Da ich Mailand bereits kannte, hatte ich nur diesen einen Tag und die eine Nacht geplant. Kurz überlegte ich, ob ich meinen Aufenthalt nicht doch verlängern sollte. Ich war vollkommen frei, hatte gerade deshalb keine weiteren Hotels gebucht, damit ich in besonders schönen Städten einen Tag länger verbringen konnte. Andererseits lockte es mich aber, mehr von diesem wundervollen Land kennenzulernen. Als nächsten Stopp hatte ich Verona im Visier, und ich war neugierig darauf, was die Stadt zu bieten hatte, denn im Gegensatz zu Mailand kannte ich sie bisher noch nicht.
Freitag, den 16. Juni
~*~ Venedig ~*~
Ich stand auf der weltbekannten Piazza San Marco im Schatten des Glockenturms und ließ meinen Blick über die Massen von Touristen schweifen. Hunderte von Tauben bevölkerten diesen Platz, und ich staunte, wie frech und furchtlos die Vögel waren. Sie ließen sich nicht nur in der Nähe der Menschen nieder, sie kamen direkt auf die Hand geflogen. Wahrscheinlich waren sie auf der Suche nach Futter, denn obwohl das Füttern der Tauben in Venedig verboten war, hielten sich die Leute natürlich nicht daran. Die Tauben zu füttern schien zu Venedig zu gehören wie die Gondeln, die durch die Kanäle fuhren.
Heute war mein erster Tag in Venedig, ich war erst gestern Abend mit dem Schiff vom Festland angekommen. In den letzten Tagen hatte ich Verona unsicher gemacht. Die Stadt hatte mich so beeindruckt und gefesselt, dass ich mir einen Tag länger Zeit genommen hatte, sie zu erkunden, als ich ursprünglich gedacht hatte. Aber das machte nichts, solche spontanen Änderungen hatte ich von vornherein eingeplant. Zwei komplette Tage hatte ich in Verona mit Sightseeing verbracht. Mit meinem Reiseführer in der Hand und ein paar Tipps der Leute, die ich an meinem Abend in Mailand kennengelernt hatte, war ich durch die Stadt gelaufen. Hätte ich eins dieser neumodischen Fitnessarmbänder mit Schrittzähler getragen, hätte ich vermutlich alle Rekorde gebrochen. Direkt nach dem Frühstück war ich aufgebrochen und erst spätabends in das kleine Hotel, in dem ich wohnte, zurückgekehrt.
Allerdings wollte ich auch nicht mehr Zeit als nötig dort verbringen. Zwar war mein Zimmer sauber, aber dafür die Wände dünn wie Papier. Ich hörte jedes Wort, das im Zimmer neben mir gesprochen wurde, und durfte miterleben, wie das Pärchen über mir das Bett zum Wackeln gebracht hatte. Irgendwo im Hotel musste auch jemand mit Säugling gewohnt haben – zumindest schrie ein Baby die halbe Nacht durch und hielt mich damit wach.
Alles in allem war der Aufenthalt dort nicht sonderlich angenehm, daher versuchte ich, mich tagsüber so auszupowern, um die Geräuschkulisse nachts zu überschlafen. Leider hatte es nicht wirklich gut geklappt, sodass mich jetzt der Schlafmangel der letzten Tage einholte und ich mich am liebsten mitten auf dem Platz lang ausgestreckt und geschlafen hätte. Da das natürlich nicht möglich war, musste ein Kaffee herhalten, daher steuerte ich eins der Cafés an, die in den Säulengängen, die den Platz an zwei Seiten säumten, untergebracht waren.
Seufzend ließ ich mich auf einen freien Stuhl im Schatten nieder.
Nicht nur die schlaflosen Nächte in Verona forderten ihren Tribut. Nach fast einer Woche, die ich mittlerweile unterwegs war, hatte ich das Gefühl, mein kompletter Körper schrie geradezu nach einer Pause. Meine Füße zierten mehrere schmerzhafte Blasen vom vielen Herumlaufen, meine Schultern und mein Rücken beschwerten sich über die Last des Trekkingrucksacks, ich hatte Muskelkater in den Beinen und ich war müde.
Was hatte ich mir nur dabei gedacht, eine solche Reise zu planen? Im Moment hatte ich genug von Sightseeing und sehnte mich nach einem entspannten Tag am Strand.
Die Füße weit von mir gestreckt, hing ich in dem Stuhl und nippte an meinem Latte macchiato, während ich die Leute um mich herum beobachtete.
Mein Blick fiel auf einen Mann, der ganz allein an einer der Säulen lehnte und auf seinem Handy herumtippte. Ich wusste nicht, was mich an ihm ansprach, aber irgendetwas zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Als würde ich ihn kennen. Ja, das war es. Er erinnerte mich an jemanden – ich wusste nur nicht an wen. Ich war mir ziemlich sicher, ihn noch nie gesehen zu haben, und doch … das Gefühl blieb. Glücklicherweise war er so sehr mit seinem Handy beschäftigt, dass er nicht mitbekam, dass ich ihn eingehend musterte.
Viel konnte ich auf die Entfernung nicht erkennen, dafür stand er zu weit weg. Außerdem trug er eine große, verspiegelte Sonnenbrille, die das halbe Gesicht verdeckte. Ich sah nur dunkelbraune, ein wenig zerzauste Haare, eine gerade Nase und volle Lippen. Er war groß, bestimmt an die einsneunzig, und sportlich. Sein schwarzes T-Shirt spannte leicht um den trainierten Bizeps und die breite Brust. Ja, sehr ansehnlich! Wenn der Kerl von Nahem genauso gut aussah wie von Weitem, war er definitiv was fürs Auge.
Ich erschrak, als er plötzlich den Kopf hob und genau in meine Richtung schaute. Ich fühlte mich ertappt und spürte, wie mir die Hitze in die Wangen schoss. Abrupt senkte ich meinen Blick auf meine Handtasche und fing an, darin herumzukramen.
Als ich dabei mein Handy in die Finger bekam, erkannte ich, dass eine WhatsApp eingegangen war. Jola hatte mir geschrieben. Während ich das Handy entsperrte, um ihre Nachricht zu öffnen, ließ ich meinen Blick unauffällig in die Richtung wandern, wo der Typ eben gestanden hatte. Doch sein Platz an der Säule war verlassen, keine Spur mehr von ihm. Ich war ein wenig enttäuscht, ich hätte ihn gern noch länger heimlich beobachtet.
Stattdessen kümmerte ich mich um meine beste Freundin. Ein schlechtes Gewissen überkam mich, als mir einfiel, dass ich mich seit Mailand nicht mehr bei ihr gemeldet hatte. Wie zu erwarten, klang Jolas Nachricht ein bisschen besorgt.
Hey Schnecke. Lebst du noch? Oder wurdest du von einem italienischen Gigolo entführt und zu seiner Lustsklavin gemacht?
So lustig sich ihre Nachricht auf den ersten Blick auch las – ich kannte Jola gut genug, um zu wissen, dass sie sich Sorgen um mich machte. Schnell rief ich sie an.
„Hey, du lebst!“, begrüßte Jola mich überschwänglich.
„Na klar! Ich lass mich ja nicht einfach so zur Lustsklavin machen. Kennst mich doch!“, antwortete ich lachend.
„Da hast du auch wieder recht. Wie konnte ich nur auf so eine Idee kommen? So wählerisch, wie du bei Männern bist, was für eine absurde Idee.“
„Hey, ich bin nicht wählerisch. Ich weiß nur, was ich will. Und was ich nicht will …“, stellte ich kichernd klar.
„Und wo genau ist der Unterschied zu dem, was ich gesagt habe?“, hakte Jola ironisch nach. „Ehrlich, Schnecke, du solltest deine Erwartungen an die Kerle mal ein wenig runterschrauben. Manchmal muss frau einfach ihre Bedürfnisse befriedigen, auch wenn es nicht der Traumprinz bis an dein Lebensende ist.“ Bei Jolas Worten erschien ungewollt das Bild dieses Typen vor meinem inneren Auge. Okay, ja, ich verstand, was sie mir sagen wollte. Rein optisch gesehen, würde ich jemanden wie ihn nicht von meiner Bettkante schubsen. Suchend glitt mein Blick über den Platz, ob ich ihn in der Menge noch irgendwo entdeckte. Natürlich nicht – wie auch, dafür waren viel zu viele Leute unterwegs und er bereits seit ein paar Minuten verschwunden. Sicher war er längst bei der nächsten Sehenswürdigkeit angekommen.
„So, jetzt erzähl aber mal, wie ist dein Urlaub? So abenteuerlich, wie du es dir vorgestellt hast? Oder bereust du schon, mich nicht mitgenommen zu haben, weil es dir fehlt, mit jemandem zu sprechen?“
„Ganz ehrlich … Ich genieße die Stille. Am Anfang war das zwar ungewohnt, aber jetzt … Es ist toll, mal allein zu sein und mit niemandem reden zu müssen. Und ansonsten – der Urlaub ist großartig und aufregend und ja, auch ziemlich abenteuerlich.“ Begeistert erzählte ich Jola, was ich in den letzten Tagen bereits alles gesehen hatte.
„O Mann, wenn ich das so höre, bin ich doch ganz froh, dass ich nicht dabei bin. Für mich klingt das eher nach Stress als nach Urlaub. Mal abgesehen von dem Tag in Basel mit Zoo und Fähre … Hast du echt nur Sightseeing gemacht? Nicht mal einen Tag Pause dazwischen, an dem du einfach nur faul warst?“
„Es macht Spaß, mir alles anzusehen“, verteidigte ich mich und hörte, wie Jola leise schnaubte.
„Ernsthaft? Seit Jahren höre ich nach jedem Urlaub mit deinen Eltern, dass ihr wieder nur unterwegs wart, dass du ja nichts gegen Sightseeing hast, aber auch gern mal einen Tag faul verbringen möchtest. Und nun? Dein erster alleiniger Urlaub, dein persönliches Abenteuer, dein Roadtrip – und was machst du? Ziehst genauso ein Programm durch wie deine Eltern.“
Jetzt, wo Jola es so deutlich aussprach, stellte ich fest, dass sie recht hatte. Noch in Basel hatte ich mich für den Zoo entschieden, weil ich eben genau das nicht wollte – nur Sehenswürdigkeiten abklappern, wie ich es von meinen Eltern kannte. Ich wollte Land und Leute kennenlernen – nicht wie ein Touri-Schaf der restlichen Touri-Herde hinterherlaufen. In Mailand hatte ich mein Vorhaben schon halbwegs aufgegeben, als ich die Plätze meiner Kindheit aufgesucht hatte, doch ab Verona war es komplett in Vergessenheit geraten. Und zu welchem Preis? Ich fühlte mich wirklich nicht mehr entspannt und im Urlaubsmodus. Ich fühlte mich gestresst, war müde und hatte Muskelkater und Blasen an den Füßen.
„Morgen mache ich einen Strandtag!“
„Guter Plan! So gehört sich das, Schnecke.“ Ich merkte erst, dass ich meine Gedanken laut ausgesprochen hatte, als Jola darauf reagierte. „Genieß deinen Urlaub und hetze nicht nur von Kirche zu Kirche. Das Wetter ist doch bestimmt großartig, oder?“
„Mhm, ja. Um die 26 Grad und keine Wolke am Himmel“, murmelte ich in Gedanken versunken und überlegte gleichzeitig, wo es hier wohl einen Strand geben könnte. Venedig lag zwar mitten im Meer, aber von Strand war dennoch weit und breit nichts zu sehen. Dafür musste ich vermutlich zurück aufs Festland.
„Dann entspann dich! Immerhin will ich nicht, dass du völlig fertig bist, wenn ich ankomme. Wir wollen doch Sizilien und die sizilianische Männerwelt unsicher machen.“ Jola lachte und ich stimmte in ihr Lachen mit ein.
„Das werden wir! Aber so was von. Vielleicht hast du gar nicht so unrecht. Vielleicht sollte ich mich auch, was die Männerwelt angeht, mal auf ein Abenteuer einlassen.“
„Richtig so! Das ist es, was ich hören will. Hab Spaß und melde dich mal!“
Nachdem ich Jola versprochen hatte, nicht wieder für Tage unterzutauchen, legte ich auf. Ich winkte den Kellner heran, um meinen Latte macchiato zu bezahlen, dann machte ich mich hochmotiviert auf den Weg. Wenn ich morgen einen faulen Strandtag einschob, konnte ich heute auch noch das volle Sightseeingprogramm durchziehen. Die Rialto-Brücke wartete auf mich!
Vollkommen verschwitzt und mit gefühlten fünf neuen Blasen an den Füßen kehrte ich abends in das kleine Hotel zurück, in das ich gestern eingecheckt hatte. Nach einer ausgiebigen Dusche und Wundversorgung meiner Füße ließ ich mich rücklings auf das wacklige Bett fallen und öffnete den Internetbrowser meines Handys. Eine Stunde lang versuchte ich herauszufinden, wo es in der Nähe von Venedig einen Strand gab. Gar nicht so einfach, wie ich bald feststellen musste. Der einzige erreichbare Strand schien der Lido de Venezia zu sein – eine vorgelagerte Insel, die die Lagune, in der Venedig lag, zum offenen Meer hin abgrenzte.
Okay, warum nicht. Die Fahrzeit dorthin hielt sich in Grenzen, daher wollte ich es versuchen. Mit der Hoffnung, dass es dort nicht nur hoteleigene, sondern auch öffentliche Strände gab, schlief ich an diesem Abend ein.
Ich war im Himmel! Ja, definitiv! Ich war gestorben und befand mich im Himmel. Genau so musste es sich anfühlen. Für ein irdisches Leben war dieser Tag einfach zu perfekt.
Gleich nach dem Frühstück hatte ich meine Badesachen eingepackt und war mit dem Schiff von Venedig zum Lido de Venezia gefahren. Dort angekommen stellte es sich als gar nicht so schwierig heraus, den Strand zu finden. Okay, die Insel war lang, aber dafür sehr schmal. Man musste also nur ein paar Minuten gehen, schon hatte man den Strand und das Meer erreicht.
Genießerisch rekelte ich mich auf meiner Sonnenliege und rollte mich auf den Rücken, dann setzte ich mich auf. Ich griff nach meiner Wasserflasche und ließ meinen Blick über den Strand gleiten. Ja, perfekt! Die Sonne brannte vom Himmel, doch heute störte es mich nicht. Ich lag unter dem Sonnenschirm, und sollte es zu heiß werden, brauchte ich nur ein paar Meter über den Strand zu gehen, dann hatte ich das kühle Meer erreicht und konnte mich in den Wellen treiben lassen. Lächelnd griff ich nach meinem Handy und machte ein Foto. Mein nackter Fuß am Ende der Liege war zu erkennen, der Rest des Bildes zeigte meine derzeitige Aussicht über den Strand, das Meer und ein paar andere Urlauber. Schnell schickte ich dieses Foto an Jola und wartete gespannt auf eine Reaktion.
Ich war sehr dankbar, dass man seit gestern innerhalb der EU keine Roaming-Gebühren mehr zahlen musste, so konnte ich ab sofort nach Herzenslust Fotos und WhatsApp-Nachrichten verschicken.
Wie erwartet, dauerte es nicht lange, da piepte mein Handy. Damit hatte ich gerechnet, immerhin ging Jola nirgendwo ohne ihr Telefon hin. Nicht mal auf die Toilette! Oft genug zog ich sie damit auf, dass das Ding an ihrer Hand festgewachsen schien.
Boah! Wie fies bist du denn? Ich will da jetzt hin!, schrieb Jola geziert mit diversen verschiedenen Emojis. Ich hatte ihr noch nicht mal geantwortet, da kam bereits eine zweite Nachricht hinterher:
Nette Aussicht hast du da – und damit meine ich nicht das Meer, sondern den Typen!
Im ersten Moment wusste ich nicht, was meine Freundin meinte, bis ich mir mein Bild noch einmal genauer anschaute. Nein, das konnte nicht sein! Oder doch? War es etwa … Hektisch schaute ich mich am Strand um, ob ich den Mann, den ich versehentlich auf Foto gebannt hatte, irgendwo entdeckte. Wenn mich nicht alles täuschte, war es derselbe, den ich gestern an der Säule lehnend auf dem Markusplatz beobachtet hatte. Der Typ, der mehr als nur ein wenig ansehnlich war. Der, von dem ich auf den ersten Blick bereits festgestellt hatte, dass er durchaus meinem Geschmack und meinem Beuteschema entsprach.
Aber das konnte nicht sein! Wie groß war bitte die Wahrscheinlichkeit, dass er genau wie ich gestern Venedig anschaute und heute einen Strandtag auf der Insel einlegte? Ohne sonderlich weitreichende Kenntnisse der Mathematik zu haben, würde ich behaupten, dass die Chance gegen null ging.
Auch zehn Minuten später konnte ich den Mann, den ich fotografiert hatte, nirgends entdecken. Nachdem ich mit Jola nebenbei noch ein paar Nachrichten geschrieben und sie ein wenig neidisch gemacht hatte, gab ich meine Suche nach dem Unbekannten auf und ging ins Meer. Die Augen geschlossen, rollte ich mich auf den Rücken und ließ mich im kühlen Wasser treiben. Ja, das war Urlaub! Ich spürte regelrecht, wie die Müdigkeit, die mich gestern so gelähmt hatte, von mir wich, wie die totale Entspannung wieder einsetzte und meine Kraft zurückkehrte. Dieser Strandtag tat so gut, dass ich mich darauf freute, meine Reise morgen fortzuführen. Die nächste Station sollte eigentlich Ravenna sein, vielleicht würde ich allerdings auch direkt nach Ancona weiterfahren. Das wollte ich morgen früh spontan entscheiden. Heute war genießen angesagt!
Sonntag, den 18. Juni
~*~ Ancona ~*~
„Verflixt noch mal, wo ist sie denn nur? Ich hatte sie doch …“ Das Telefon zwischen meine Schulter und das Ohr geklemmt, kramte ich in meinem großen Rucksack.
„Was suchst du denn?“, fragte Jola am anderen Ende der Leitung.
„Meine Sonnenbrille. Ich könnte schwören, ich habe sie gerade noch gehabt. Aber jetzt finde ich sie nicht mehr.“ In meiner Verzweiflung fing ich an, den frisch gepackten Rucksack wieder auszuräumen. „Eben war sie doch … Und dann …“ Ich überlegte, versuchte die letzten Minuten zu rekonstruieren, um herauszufinden, wo ich sie gelassen hatte.
„In den Haaren!“, kam es trocken von meiner Freundin.
Verwirrt hielt ich inne.
„Was?“, hakte ich nach und hörte, wie Jola kicherte.
„Du hast sie dir bestimmt in die Haare gesteckt. Das machst du immer und dann suchst du sie.“
Eine Sekunde lang schloss ich genervt die Augen, während ich mir in die Haare griff. Natürlich! Ich war aber auch ein Idiot. Jola hatte recht – sie kannte mich einfach. Ich hatte die Sonnenbrille tatsächlich in die Haare geschoben, als ich das Telefonat angenommen hatte.
„Du bist ein Schatz, Jola. Weißt du das eigentlich?“
Wieder kicherte meine beste Freundin. „Na klar! Was würdest du nur ohne mich machen? Ich weiß gar nicht, wie du deine Reise allein meisterst.“ Ich stimmte in ihr Lachen ein und ließ mich auf die Fensterbank des Pensionszimmers sinken. Die Sonnenbrille auf der Nase schaute ich hinaus in das gleißende Sonnenlicht. Obwohl der Tag sich langsam dem Ende neigte, strahlte sie noch immer und verbreitete eine brütende Hitze in Ancona.
Auf der Straße, die vor der Pension entlangführte, war kaum etwas los. Die meisten Leute suchten den Schatten oder hielten sich gleich drinnen auf, um den Temperaturen ein wenig zu entgehen. Nur ein paar eiserne Touristen mit hochroten Köpfen und Fotoapparaten und Straßenkarten in den Händen waren unterwegs. Mein Blick fiel auf die kleine Grünanlage auf der anderen Seite der Straße. Unter ein paar Bäumen standen Bänke und ein Springbrunnen plätscherte vor sich hin. Ein Ort, der zum Verweilen, zu einer Pause vom Sightseeing einlud. Ein kleiner Junge planschte mit den Händen im Wasser und quiekte vor Freude so laut, dass man fast glaubte, ihn bis in mein Zimmer hören zu können. Natürlich bildete ich es mir nur ein, doch er hatte einfach so sichtlich viel Spaß.
„Wo geht’s denn als Nächstes hin?“, fragte Jola. „Oder bleibst du noch einen Tag?“
„Nein, morgen fahre ich weiter nach Terni und danach Richtung Rom. Da möchte ich ja ein paar Tage mehr verbringen und sonst bin ich nicht rechtzeitig …“ Ich stockte. Noch immer war mein Blick aus dem Fenster auf die Grünanlage gerichtet. Nein, das konnte nicht sein! Ich musste es mir einbilden – ganz sicher!
„Hey, Sienna. Alles gut, Schnecke?“ Jolas Stimme riss mich aus meinen Betrachtungen.
„Mhm, ja … Irgendwie …“ Ich atmete tief durch, dann sprach ich weiter: „Erklär mich für bescheuert, aber ich glaube, der Typ von dem Foto neulich steht hier auf der anderen Straßenseite und beobachtet meine Pension.“ Ich wusste selbst, es war total albern, er konnte es nicht sein. Aber dennoch …
„Welcher Typ von welchem Foto? Sienna, du hast mir in der letzten Woche ungefähr fünfzig Bilder geschickt. Ich kann dir leider nicht folgen.“
„Als ich in Venedig am Strand lag. Der Kerl, den ich aus Versehen mit auf dem Bild hatte. Ich glaube, er verfolgt mich.“ Ohne den Mann aus den Augen zu lassen, rutschte ich von der Fensterbank und machte einen Schritt zur Seite. Er sollte mich nicht sehen, falls er zufällig hochschaute. Wahrscheinlich übertrieb ich gerade maßlos und es war gar nicht derselbe Mann. Wahrscheinlich wurde ich nach den ganzen Horrorgeschichten meiner Mamma über allein reisende Frauen ein wenig paranoid, aber dennoch – sicher war sicher!
„Jetzt weiß ich, wen du meinst! Ach, von dem würde ich mich auch gern verfolgen lassen. Der war echt heiß!“ Jola gab eine Art genießerisches Schnurren von sich.
„Das ist nicht witzig! Ich meine, das kann doch nicht sein! Erst in Venedig, dann am Strand und jetzt hier in Ancona?“ Ich atmete tief durch und versuchte, den Mann auf die Entfernung ein wenig besser zu erkennen. Er stand im Schatten unter einem Baum und nippte immer wieder an einer Wasserflasche. Sein Gesicht konnte ich nicht deutlich sehen, ich wusste nicht mal, wie ich zu der Überzeugung kam, aber ich war mir dennoch sicher – er war es.
„Entspann dich, Sienna. Wahrscheinlich macht er eine Italienrundreise – genau wie du. Oder glaubst du, du bist die Einzige, die auf so eine Idee kommt?“
„Nein, natürlich nicht. Aber dass wir immer am selben Tag in derselben Stadt sind? Und uns über den Weg laufen? Ich meine, ich entscheide oft erst am Abend vorher, ob ich noch bleibe oder weiterfahre.“ Allmählich machte sich Angst in mir breit, mein Herz schlug mir bis zum Hals, wenn ich nur daran dachte, dass ich womöglich verfolgt wurde. Andererseits war mir klar, was für ein Quatsch das war. Wer sollte mich schon verfolgen und vor allem – warum? Nein, Jola hatte bestimmt recht und es war tatsächlich Zufall. Ja, er war nur ein anderer Tourist, der zufällig dieselbe Route nahm wie ich. So war es ganz sicher! Und wenn ich es mir nur lang genug einredete, würde ich mir selbst auch irgendwann glauben.
„Weißt du was, wenn du dir solche Sorgen machst, dann geh zu ihm und sprich ihn drauf an. Frag ihn doch einfach!“
Ich konnte Jolas unbedarftes Schulterzucken regelrecht vor mir sehen. Für meine beste Freundin wäre das kein Problem. Die war mit einer solch großen Klappe und einer Menge Selbstbewusstsein ausgestattet, dass sie keinerlei Scheu besaß, fremde Menschen einfach so anzusprechen. Ich war da anders. In diesem Fall verließ mich mein südländisches Temperament. Was sollte ich auch sagen? „Hey, du! Verfolgst du mich?“
Ich wüsste nicht mal, in welcher Sprache ich ihn ansprechen sollte – immerhin hatte ich keine Ahnung, wo er herkam.