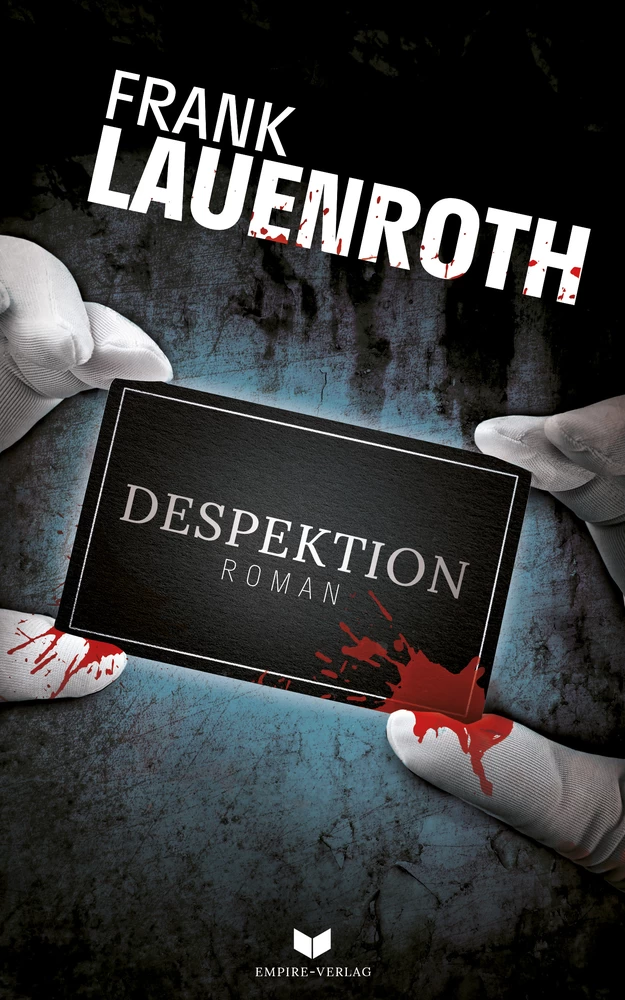Zusammenfassung
Eine experimentelle Behandlungsmethode verspricht Erfolg: Ein künstliches geckoähnliches Wesen wird fortan mit ihm in Symbiose leben, auf seiner Haut, unter seinen Shirts. Der Biss des Wesens injiziert ihm die Medizin, im Gegenzug ernährt sich das Wesen von seinem Blut.
Fast hätte er die Erbschaftsklausel vergessen, dem ,Simon-Club‘ beitreten zu müssen. Doch je tiefer er in die Spiele des Clubs involviert wird, desto deutlicher werden auch die Schatten seiner Vergangenheit und der Triebfeder hinter allem: Despektion!
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 -
Leuchtend hell hängt der Vollmond über New York City. Ein seltenes Schauspiel, denn normalerweise verhüllt der Smog den klaren Himmel. Doch an einem kalten Winterabend wie diesem geschieht hin und wieder ein kleines Wunder, und der Blick vom Grund der Fifth Avenue hinauf zu den Sternen ist unverschleiert. Trevor Man ist auf dem Weg nach oben. Allerdings nur zur Aussichtsplattform des Empire State Building. Und selbst das nicht aus eigenem Antrieb. Er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Aber wie heißt es so schön? Versprochen ist versprochen. Und immerhin war es der letzte Wunsch seiner Mutter. Als sie vor fünf Tagen starb, da hatte er an ihrem Bett gestanden, hatte ihre Hand gehalten und sah sie ins Jenseits gleiten. Zwei Jahre hatte er sie davor nicht gesehen. Als sie sich damals trennten, geschah es im Zorn.
Für einen Moment denkt Trevor zurück und ihm ist heute wie damals unverständlich, warum seine Mutter aus ihm unbedingt ein Vorbild für die Gesellschaft machen wollte. Im Leben hatte sie sich klare, für ihn kaum nachvollziehbare Grundsätze auferlegt. Sie führte ihm gegenüber ein hartes Regiment und stellte Regeln auf, an die andere Eltern nicht einmal gedacht hätten. So nötigte sie ihn, sich täglich zwei Mal komplett zu waschen. Morgens, damit ihn die ‚Gesellschaft’ gut riechen konnte, und abends, damit die Bettwäsche nicht ständig gewechselt werden musste. Kaum einer von Trevors Freunden konnte Ähnliches berichten. Und das war nur ein Beispiel. Ihre Ansichten wurden nach dem Tod seines Vaters nur noch schlimmer, geradezu unerträglich. Sein Beruf war nicht gut genug, sein Lebensstil nicht, seine Freundinnen … Sein Job als Journalist hatte in ihren Augen kaum etwas Edles, Gewinnendes. Sein Loft erschien ihr protzig, und zu guter Letzt hatte sie sich für ihren Sohn eine ‚stete’ Partnerin gewünscht.
Obwohl seine Mutter und er in Brooklyn wohnten, waren sie sich die besagten zwei Jahre aus dem Weg gegangen, und das Treffen an ihrem Krankenhausbett wurde ein trauriges Wiedersehen. Sie saßen sich eine lange Weile stumm gegenüber, ehe er sich vorsichtig nach ihrem Zustand erkundigte. Als sie von der Möglichkeit eines nahen Todes sprach, hatte Trevor sie belächelt ‒ selbst als sie ihm den Schlüssel zu ihrer Wohnung gab. Sie nahm ihm das Versprechen ab, dass er ihre Asche vom höchsten Punkt der Stadt aus verstreuen würde. Sie, die doch immer so betont rechtschaffen war, erlegte ihm bewusst auf, etwas Verbotenes zu tun!
Trevor steigt um in den Fahrstuhl zur Aussichtsplattform. Sein Atem geht schneller. Bis er das 101. Stockwerk erreichen wird, sind es nur noch Sekunden. Dann wird er hinaustreten müssen, die Urne aus seinem Rucksack nehmen und etwas tun, was ihn bei seiner Entdeckung seinen Ruf und damit seinen Job kosten könnte. Als Filmkritiker beim New York Guardian sind seine Kolumnen zumindest berüchtigt. Das macht ihn noch nicht zu einer Berühmtheit, aber wenn er sich hier erwischen ließe, dann würde er selbst die Headline des Guardian füllen. Sein Rauswurf wäre unvermeidbar. Keine Reisen mehr zu den Filmfestspielen von Cannes und Venedig. Sein Loft wäre unbezahlbar, ganz zu schweigen von seinen Medikamenten. Ein fast schon zu großes Risiko.
Die Fahrstuhltür öffnet sich. Zwei Schritte, und Trevor steht im Innenraum der Aussichtsplattform. Nur ein Bediensteter des Empire sitzt hinter einem Tresen. Er trägt die gleiche dunkelblaue Uniform wie seine Kollegen in der Lobby – einfarbig, mit einem in Brusthöhe aufgenähten Logo des Gebäudes. Trevor würdigt den Sicherheitsbeamten keines weiteren Blickes und geht durch die Tür, die ihn vom Abendhimmel über Manhattan trennt. Endlich befindet er sich auf der Plattform. Sein Atem geht stoßweise. Er weiß, dass das nicht gut ist. Normalerweise hat er sein Leben so eingerichtet, dass Anstrengung und Aufregung jeglicher Art ausgeschlossen sind. Bekäme er hier oben einen asthmatischen Anfall, würde das seine ungeliebte Aufgabe nur erschweren. Er sieht sich um, und die Plattform zeigt das erhoffte Bild. Trevor hatte den Zeitpunkt seiner New-York-Besteigung bewusst gewählt. Seit Schlaflos in Seattle weiß jeder, der den Film gesehen hat, dass kurz vor Schließung des Gebäudes kaum noch Besucher die Aussicht genießen wollen. Das stimmt natürlich nicht immer, aber an kalten Winterabenden und noch dazu an Werktagen ist die Chance auf Privatsphäre hier, in rund 400 Metern Höhe, ziemlich groß.
Er nimmt seinen Rucksack vom Rücken und greift zuerst zu dem kleineren Mitbringsel: dem Inhalator. Seit er dieses Gerät einmal aus seiner Jackentasche verloren hatte, trägt er den Inhalator immer im Rucksack bei sich. Der Rucksack selbst ist klein und handlich, bietet aber dennoch genügend Platz für die Dinge, die ein Reporter des Guardian im Alltag benötigt, und für einen Inhalator. Zwei kurze Atemzüge ‒ und das Kortison-Präparat bringt wieder Ruhe in seinen kranken Körper.
Immer wieder hatte er sich gefragt, welche Art der Krankheit wohl das kleinere Übel wäre. Die allergische Form hätte er wahrscheinlich leichter in den Griff bekommen. Beim Anstrengungsasthma ist Trevor jedoch ein Leben lang zur Passivität verurteilt. Ein Tanz auf dem Drahtseil, denn jede Anstrengung kann einen Anfall hervorrufen. Und jeder Anfall kann bei der Schwere seiner Erkrankung das Ende bedeuten.
Vielleicht war das ja der Plan seiner Mutter? Nein, damit würde er ihr Unrecht tun. Natürlich weiß er, dass sie immer nur sein Bestes wollte. Nur die Wahl ihrer Mittel war unglücklich. Immer wieder musste er herunterleiern, welche Gabel für den Salat war, welches Messer für den Fisch, welcher Löffel für das Eis. Dabei gab es nur selten Eis im Hause Man. Er verflucht sie im Stillen. Trevor ist Filmkritiker, er arbeitet fast ausschließlich zuhause, geht jeder Form von Anstrengung aus dem Weg, und nun soll er, vom Kopf der Stadt aus, die Asche seiner Mutter in alle Winde verstreuen! Trevor greift wieder in den Rucksack und fördert die Urne zutage: »Danke, Ma!«
Auch kann er beim besten Willen nicht nachvollziehen, warum sie nicht neben seinem Vater beerdigt werden wollte. Zwar hatte er ihr diese Frage noch gestellt, doch war sie ihm in der letzten Minute vor ihrem Tod ausgewichen. »Du wirst es verstehen. Bald wirst du es verstehen …«
Von diesem ‚bald’ scheint er eine Unendlichkeit entfernt zu sein. Trevor geht in die vom Lifteingang am weitesten entfernte Ecke und prüft, ob er tatsächlich allein ist. Kein Mensch weit und breit. Vollmondnacht über Manhattan, so wie seine Mutter es wollte. Er geht an die Brüstung und öffnet die Urne. Über ihm ragt das Gitter einen halben Meter weit nach innen. Auf Augenhöhe jedoch wirkt es nur wie ein überdimensionaler Maschendrahtzaun. Er schiebt die Urne durch das Absperrgitter direkt vor ihm. Die Urne passt gerade so hindurch, und für einen Moment hält er sie einfach nur mit seinen beiden ausgestreckten Armen über der Stadt. Dann dreht Trevor sie um. Ohne Schweigeminute, ohne Pathos. Der Wind greift hinein und stürzt die feinen Aschepartikel hinab in die Schluchten aus Stein und Glas, reißt sie wenige Meter von ihm entfernt nach oben und dann fort aus seinem Blick. Binnen weniger Sekunden ist die Urne nahezu geleert, und die restliche Asche verkommt zu einem herausrieselnden Rinnsal.
Mühsam fingert Trevor die leere Urne durch das Gitter zurück und schließt sie eilig. Da hört er Schritte. Der Schreck treibt seinen Puls sofort hoch. Hastig stopft er das Gefäß in seinen Rucksack. Sein Oberkörper krampft sich zusammen, und ein erster Hustenreiz überwältigt ihn, zwingt ihn auf die Knie.
»Sir, wir schließen gleich. Kann ich Ihnen helfen?«
Trevor bemüht sich aufzusehen. Er kann aber nur die blaue Uniform erkennen. Es ist der Mann, der im Innenraum saß. Natürlich muss er nun die letzten Besucher einsammeln. Trevor winkt ab, versucht dabei seinen Rucksack zu nehmen und gleichzeitig aufzustehen. Ein zweiter Hustenreiz drängt nach oben.
»Kommen Sie, ich helfe Ihnen.«
Der Mann stützt ihn und geleitet ihn zum Fahrstuhl.
Trevor flucht lautlos. Er muss lediglich die Ruhe bewahren. Es besteht kein Grund zur Aufregung. Es ist vorbei. Er hat es überstanden. Sein Kopf versteht das. Sein Körper aber spricht eine andere Sprache. Kochende Lava scheint durch seine Bronchien zu fließen. Mit zitternden Fingern zieht er den Inhalator erneut aus dem Rucksack und nimmt einen tiefen Zug. Fast augenblicklich wird es besser. Er fühlt sich nicht, als könne er Bäume ausreißen, aber die Angst weicht, und gleichzeitig kehrt die Kraft zurück.
Der Bedienstete des Hauses ist mit ihm heruntergefahren. Die Fahrstuhltür öffnet sich. Umsteigen in den zweiten Lift. Der bringt ihn zwar noch nicht hinunter zur Lobby, aber es ist die erste Etappe. Der Transport im Empire ist in verschiedene Ebenen eingeteilt. Trevor wird nochmals umsteigen müssen. Aber es ist fast überstanden … Sirenen! Verdammt, was ist das für ein Lärm?
»Feueralarm, Sir! Wenn Sie mir bitte folgen wollen!« Der Mann in Uniform öffnet die Tür zum Treppenhaus und macht eine einladende Geste.
Trevor rührt sich nicht vom Fleck. Er steht rund drei Meter von der Tür entfernt und sucht verzweifelt nach einem Ausweg. Natürlich fahren die Fahrstühle bei einem Feueralarm nicht mehr. Aber es sind noch mehr als achtzig Stockwerke bis unten! Irgendwo dazwischen lauert das Feuer. Unwahrscheinlich, dass es über ihnen brennt. Achtzig Stockwerke! Das kann seinen Tod bedeuten.
»Kommen Sie, Mister! Das klingt schlimmer, als es tatsächlich ist. Von oben bis unten sind es nur 1860 Stufen. Beim jährlichen Run-Up brauchen die Besten nur neun Minuten! Aufwärts wohlgemerkt!«
Trevor macht einen Schritt auf die Tür zu, dann noch einen und dann beginnt er, im Treppenhaus abwärts zu laufen. Er versucht, es ohne Hast anzugehen. Das ist alles andere als leicht. Irgendwo vor ihm wartet der Feuertod. Ein Stockwerk nach dem anderen bringt er mutig hinter sich. Es geht besser als erwartet, aber Trevor weiß, dass er nicht übermütig werden darf. Bei seiner Statur könnte man vermuten, er wäre ein Sportler. Aber das ist nur vom täglichen Hanteltraining, immer knapp unter dem Limit. Zehn Etagen hat er geschafft, und der Uniformierte ist dicht hinter ihm. Sprachfetzen dringen an Trevors Ohr. Offensichtlich versucht der Mann, die Lobby per Handy zu erreichen. Immer noch dröhnt das Sirenengeheul durchs Treppenhaus, hallt wider und scheint nur noch lauter zu werden. Zwölf Stockwerke. Trevor zählt mit, um den Fortschritt zu spüren, und gleichzeitig, um einschätzen zu können, wann es Zeit für ein paar Züge aus dem Inhalator ist. Er kennt seinen Körper sehr gut und er weiß, wie weit er gehen kann. Trevor hat sich wieder im Griff. Noch eine Etage, dann wird er anhalten und inhalieren. Im Laufen zieht er den Rucksack von der Schulter, und obwohl er weiterhin die Treppe hinunter läuft, sucht seine rechte Hand bereits nach dem Leben verheißenden Gerät.
Schon hat er es gefunden und zieht es heraus, als der Sicherheitsbeamte neben ihm auftaucht und ihm unter den Arm greifen will. Der Inhalator entschwindet erst seinem Griff und dann seinem Blick. Trevor glaubt noch kurz das Aufschlagen des Gerätes auf dem Stein der Treppe zu vernehmen. Schon ist nur noch der Klang der Sirene zu hören und begräbt jedes andere Geräusch. Sofort ist wieder die Panik da. Und die bringt die Schmerzen mit sich. Sie schnüren seinen Oberkörper zusammen, Hitze greift nach seiner Lunge, und der vertraute Husten zwingt ihn erneut in die Knie. Jetzt fühlt er jedes der dreizehn Stockwerke in den Beinen. Erschöpfung überfällt ihn. Kaum nimmt er wahr, dass der Alarm verklungen ist und der Uniformträger ihm etwas sagen will.
»Sir, das war nur ein Fehlalarm. Wir können mit dem Fahrstuhl nach unten fahren. Sir? Fehlt Ihnen etwas?«
Trevor klammert sich am Treppengeländer fest. Er versucht, sein Gegenüber zu fixieren. Mit letzter Kraft und zwischen zwei Hustenanfällen bringt er hervor: »Asthma … Krankenhaus …«
Dann wird er ohnmächtig.
- 2 -
Wie Trevor später bemerken sollte, sprach es sich in der Nachbarschaft sehr schnell herum, wenn eine neue Familie in der Montague Street einzog. Kaum waren sie vorgefahren, bildete sich auch schon eine Traube von Kindern um ihren Wagen. Doch auch einige Erwachsene blieben neugierig stehen. Die männlichen Anwesenden starrten wie gebannt auf die Figur seiner Mutter, die von ihrem hellgelben Lieblingskleid betont wurde. Trevor wusste, dass sie schön war. Vielleicht nicht im klassischen Sinne, aber sie hatte dieses besondere Etwas, das Männer verstummen ließ und die Mimik der Frauen feindseliger formte. Trevor kam mehr nach seiner Mutter als nach seinem Vater. Er war schon im Knabenalter hübsch anzuschauen, und meist waren es die Mütter seiner Klassenkameraden, die versessen auf ihn waren. Und die hatten auch Töchter! Es war für ihn immer einfach gewesen, eine Freundin zu haben. Die Mädchen rissen sich geradezu um ihn. Das war auf dem Land so, warum sollte es in der Stadt also anders sein?
Trevors Mutter achtete bei ihrer Ankunft nicht auf die Menschen um sich herum. Sie sah das Haus, die Straße, sie war einfach nur daheim. Daheim in Brooklyn! Trevor wurde natürlich beäugt, vorsichtig, argwöhnisch, offen neugierig. Eines ahnte er, ohne es zum damaligen Zeitpunkt wirklich zu wissen: Als Kind in einer komplett neuen Umgebung wird das Leben kein Zuckerschlecken. Die Mädchen werden ihn lieben. Ein Grund für die Jungs, ihn zu hassen.
Ihre Wohnung lag im ersten Stock und war für damalige Verhältnisse gut geschnitten. Sechzig Quadratmeter hatten sie auf dem Land nicht zur Verfügung gehabt. Dafür war dort der ganze Rest viel größer gewesen. In den ersten Wochen fehlten ihm besonders die Weiten von Hammonton, dem kleinen Ort in New Jersey, wo sie ihr Häuschen gehabt hatten. Zum Ausgleich drückte er sich nun mit Klassenkameraden am East River herum und blickte auf die altehrwürdige Brooklyn Bridge. Damals waren die Achtziger gerade erst ein Jahr alt, und es war zwanzig Jahre her, dass Ebbets Field eingerissen worden war. Seine Mutter hatte ihm oft erzählt, dass es nicht mehr dasselbe war, seit das Baseballstadion an der Flatbush Avenue nicht mehr da war. Überhaupt hatte sie, als sie noch auf dem Land wohnten, viel von der großen Stadt gesprochen. Trevor kannte alle Einzelheiten der Brooklyner Geschichte, kannte sogar die Historie der Brooklyn Dodgers, dem Baseballteam, das seinen Namen einer ehemaligen Straßenbahn verdankte. Er wusste aus den Erzählungen seiner Mutter, dass das Stadion 1960 abgerissen worden war, zwei Jahre, nachdem die Dodgers ihr letztes Spiel darin bestritten hatten. Die New York Mets waren ein ärmlicher Ersatz für das Selbstbewusstsein eines Stadtteils, der, für sich gesehen, die viertgrößte Stadt der Vereinigten Staaten sein könnte. In den Geschichten seiner Mutter klang immer eine unverkennbare Baseball-Begeisterung mit. Ihre Stimme wurde weich, und ihre bestimmende Art verschwand in diesen wenigen Momenten fast vollends.
1966 hatte seine Mutter die Stadt verlassen und war zu ihrer großen Liebe, seinem Vater, aufs Land gezogen. Seine Eltern hatten sich nicht lange gekannt, als sie heirateten. 1968 kam Trevor zur Welt. Später irgendwann fanden seine Eltern heraus, dass auf seiner Geburtsurkunde fälschlicherweise 1966 eingetragen war. Weder seine Mutter noch sein Vater wussten, wie es dazu gekommen war. Was seine Mutter jedoch nicht davon abhielt, diese Tatsache auszunutzen. Bevor sie aus der Provinz New Jerseys in den Moloch New York umzogen, vereinbarten sie gemeinsam einen Plan. Trevor war für seine dreizehn Jahre groß gewachsen. Und schlau war er auch. Warum sollte er nicht zwei Jahre überspringen und in eine höhere Klasse umgeschult werden? Er würde so früher einen Beruf ergreifen können, früher einen Führerschein besitzen können …
Trevor war, wider Erwarten seiner Eltern, von diesen Möglichkeiten begeistert. Weniger allerdings von solch uninteressanten Dingen wie Beruf und Führerschein, vielmehr erkannte er sofort seine Chancen bei den Mädchen. Alle, die normalerweise zwei Klassen über ihm wären, waren fortan für ihn erreichbar. Trevor war frühreif, und er wusste es: Fünfzehnjährige Mädchen, die bereits deutliche Rundungen zeigten, rückten nun in den Bereich seiner Möglichkeiten. Er brauchte nur seinen Charme spielen zu lassen …
Aber noch eine andere Hoffnung war für Trevor Grund genug, bei diesem kleinen Betrug mitzumachen: Er würde zwei Jahre früher das Elternhaus verlassen können. Als pubertierender Jugendlicher konnte er den ewigen Kommando-Ton seiner Mutter nur schwer ertragen. Er solle sich so benehmen und dies und das tun, er müsse noch viel lernen, sonst würde er nie ein Gentleman werden! Einer Dame den Stuhl anbieten, vor einer Frau die Treppe hinunter gehen … Aber eben auch den Tisch abräumen und abwischen, immer wieder und immer fort. Er wünschte sich nichts sehnlicher, als endlich erwachsen zu werden.
So sorgte ein Schreibfehler oder eine Unebenheit im Papier seiner Geburtsurkunde dafür, dass Trevor bereits im Jahr 1981 für die New Yorker und für alle Welt fünfzehn Jahre alt war.
Dessen ungeachtet mochte er die Stadt nicht. Sie war ihm zu laut und zu schnell. Die Ruhe und Beschaulichkeit der Provinz wurden in den Straßen New Yorks durch Stress und Hektik ersetzt. Die Montague Street war nicht der absolute Knotenpunkt Brooklyns, dennoch ging tagtäglich einiges an Verkehr an ihrem Haus vorbei. Trevor konnte noch Wochen nach dem Einzug nicht richtig einschlafen. Wenn er morgens erwachte, fühlte er sich wie gerädert. Dennoch konnte er eines dieser Stadt nicht absprechen: Brooklyn Heights war im Sommer immer besonders schön. Dann, an sonnigen Abenden, schlich er sich mit dem einen oder anderen Mädchen zur Riverfront Promenade. Während sie sich von dem Blick auf Lower Manhattan ablenken ließen, konnte er sich den einen oder anderen Kuss erschleichen. Zumindest anfangs waren es nur Küsse …
Schon früh wusste Trevor, was die Mädchen beeindruckte. Er kannte ihre Wünsche, auch wenn er sie nicht immer nachvollziehen konnte. Manche träumten von Sonnenuntergängen, andere von kleinen Geschenken, wieder andere von nächtelangen Gesprächen. Trevor wusste meist, welches Mädchen welchem Typ entsprach. Es festigte nicht seinen Stand bei den anderen Jungs, immer mit den Mädchen ‚herumzumachen’. Wäre er nicht so ein guter Sportler gewesen, keiner der anderen hätte sich auch nur eine Minute mit ihm abgegeben. Da er jedoch ein Baseballtalent war, wurde er immer zuerst in die Mannschaften gewählt, und manche der anderen Jungs suchten sogar seine Nähe. Daraus entstanden zwar nie echte Freundschaften, aber er wurde zumindest respektiert. Trevor fand sich mit den Regeln ab, die ihm das Leben in Brooklyn diktierte. Die Lektionen der Straße waren spannender als die der Schule. Dort ging es für ihn rapide bergab. Die erlogenen zwei Jahre waren bei aller Klugheit und Cleverness einfach zu viel für ihn. Zwar mühte er sich redlich, Versäumtes in nachmittäglichen Extrastunden nachzuholen, doch die Lücken, die er so schloss, rissen zwangsläufig andere auf. Das ‚Mehr’ an Lernstoff ließ sich einfach nicht in ein dreizehnjähriges Gehirn stopfen. Es war ein Teufelskreis, der sich erst durch einen Zufall schließen sollte.
Auf seinen Exkursionen durch die nähere Umgebung kam er meist an einem Haus in der Clinton Street vorbei, das etwas weiter von der Straße entfernt stand. Hinter Zaun und Hecke konnte Trevor das Gebäude dennoch gut erkennen. Aus dieser Entfernung zeigte es sich in einem überaus passablen Zustand. Lange hatte Trevor es der Kirche St. Ann and the Holy Trinity zugeordnet, die direkt an das Grundstück grenzte. Raum ist ein Luxus, den man in New York nur selten vorfindet. Wahrscheinlich aus diesem Grund bildeten für ihn das Haus und die Kirche eine Einheit.
Es war diese Fehlannahme, die Trevor auf der Suche nach einem zu hoch geworfenen Baseball seinen Fanghandschuh einem Schulkameraden geben ließ, um selbst über den Zaun zu steigen. Die Suche nach dem Ball verzögerte sich, da direkt vor dem Haus ein Steingarten angelegt war, und die hellen Steine den gleichfalls hellen Ball bestens verbargen. Vielleicht waren drei oder vier Minuten vergangen, als eine Tür geöffnet wurde und eine Frau, ungefähr so alt wie seine Mutter, aus dem Haus trat. Ihre gesamte Erscheinung zeugte von Geld und Klasse, jedoch von einem nicht: von gottesgläubigem Auftreten. Sie trug eine Art Seidenmantel, karminrot mit goldenen Taschenaufsätzen. Am Hals war er nur nachlässig geschlossen und offenbarte mehr weibliche Haut, als ein Junge seines Alters ohne Hormonschübe überstehen konnte.
Trevor wusste nicht zu sagen, ob es an dem aufreizenden Äußeren dieser Frau oder an der in diesem Moment stattfindenden Erleuchtung lag, dass dieses Haus rein gar nichts mit der Kirche nebenan zu tun hatte. Er errötete. Zum ersten Mal in seinem Leben war er sprachlos angesichts eines Wesens des anderen Geschlechts. Und vielleicht war es genau dieser Umstand, der die Frau amüsierte und zugleich ihre Neugier weckte. Trevor sah sie mit großen Jungenaugen an, als sie ihn ins Haus bat. Er war viel zu frappiert, um irgendetwas zu erwidern. Sein Verstand flehte nach Flucht, doch seine Füße trugen ihn an ihr vorbei ins Haus. Die Tür schloss sich fast lautlos hinter ihm. Das weibliche Wesen schob ihn sanft vor sich her und dirigierte ihn auf die Veranda der Hausrückseite. Sie waren allein.
»Nun, junger Mann, willst du mir vielleicht zuerst deinen Namen verraten?«
Er brachte ein ‚Trevor’ heraus und stand wie festgenagelt auf dem Holzboden der Veranda. Den Swimmingpool, der sich etwas unterhalb dieser Veranda befand, wagte er nur im Augenwinkel zu betrachten.
»Gut, Trevor, das ist immerhin ein Anfang. Möchtest du vielleicht etwas trinken?«
Er nickte schüchtern und sah sich vorsichtig um. Die Frau läutete eine kleine Glocke, die sich auf dem Tisch vor ihr befand. Trevor wunderte sich, dass es so etwas noch gab, als auch schon ein Diener in einem dunkelgrauen Einreiher durch die Tür trat und sich mit einem »Mylady?« nach dem Wunsch der Frau erkundigte.
»Für mich einen Bourbon on the rocks und für den jungen Herrn einen Eistee.«
Mit dem ‚jungen Herrn’ musste sie ihn gemeint haben. Ein Eistee war in einem heißen Sommer in Brooklyn immer die richtige Wahl. Von einem Bourbon konnte er das noch nicht wissen. Die Frau nahm Platz und bedeutete ihm mit einer einladenden Geste es ihr gleichzutun.
Trevor setzte sich hin und achtete peinlich genau darauf, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Jahrelang hatte seine Mutter ihm eingebläut, wie er sich in Gesellschaft benehmen müsse. Nur hatte er nicht erwartet, von diesen guten Manieren jemals Gebrauch machen zu müssen. Fast war er dankbar, als der Eistee kam und er sich daran festhalten konnte. Schluck für Schluck fühlte er sich besser, und mit jeder ihrer Fragen schwand seine Angst ein kleines bisschen mehr. Er erzählte ihr von seinem Leben, seinen Eltern und dass sie erst kürzlich nach Brooklyn gezogen waren. Sie hieß Sandra McGuinness, und ihrem Mann gehörte das größte Whiskeyunternehmen im Osten der Vereinigten Staaten. Auch hatten sie einen Sohn, Barnaby, der sogar ungefähr in Trevors Alter war. Trevor mochte ihr Lachen und ihre großen, grünen Augen. Sie hatte helle Haut und dunkle, schulterlange Haare. Ihre gar nicht so großen Brüste bewegten sich in ihrem gewagten Dekolleté auffällig auf und ab. Es war ihm fast eine Qual, nicht ständig dorthin zu sehen. Der Baseball im Vorgarten war genauso vergessen wie seine anfängliche Scheu. Die Stunden flogen nur so dahin. Es wunderte ihn nicht einmal, als sie ihn für den nächsten Tag wieder einlud. Dennoch schien er ein überraschtes Gesicht gemacht zu haben, denn sogleich kommentierte sie ihre Einladung:
»Keine Angst. Meinen Mann wirst du auch morgen nicht zu Gesicht bekommen. Er bleibt meist lange im Büro. Aber Barnaby wird hier sein. Und vielleicht werdet ihr ja Freunde …«
Sie brachte ihn zur Tür, und er fragte nicht einmal nach dem Baseball. Er war ihm nicht wirklich wichtig, und außerdem hatte er so vor den anderen Jungs einen Grund, am morgigen Tag wieder hier zu klingeln. Trevor war sich sicher, dass er das Angebot von Mrs. McGuinness nicht ausschlagen konnte, unabhängig davon, ob er diesen Barnaby mögen würde oder nicht. Er war in eine andere Welt eingetaucht, und ihm gefiel diese Welt. Unnötig zu gestehen, dass ihm auch Mrs. McGuinness gefiel. Trevor befürchtete, dass er in der kommenden Nacht erneut unruhig schlafen würde.
- 3 -
Als er wieder zu sich kommt, beugt sich eine Ärztin über ihn. »Willkommen zurück. Wie fühlen Sie sich?«
Trevor erkennt im Liegen, dass er sich noch in der Lobby des Empire State Building befindet. Über ihm thront das riesige Reliefbild des Hauses. Er ist also nicht im Krankenhaus aufgewacht. Gut! Der Ruf der Ärztin holt ihn in die Wirklichkeit zurück.
»Mister! Wie geht es Ihnen?«
Trevor schaut sie mit großen Augen an.
Ein Assistent nimmt ihm den Blutdruck. Der antwortet an seiner Stelle. »Seine Werte sind wieder normal.«
Trevor versucht sich aufzusetzen. »Ich fühle mich gut … Danke.« Seine Worte klingen allerdings wie ein Krächzen. Das erschreckt ihn nicht. Eigentlich ist es an der Tagesordnung. Wenn er viel hustet, dann leiden auch seine Stimmbänder darunter. Einer Ärztin werden solche Symptome bekannt sein. Dennoch legt sich ihre Stirn in Falten.
»Hören Sie: Ich würde Sie gern ins County zur Beobachtung einweisen. Ihr Peak-Flow-Wert war verdammt hoch. Wir mussten Ihnen eine ordentliche Ladung Kortison verpassen.«
Trevor winkt ab. »Ich will nicht unvernünftig erscheinen, aber das war eine Ausnahmesituation. Wenn Sie mir einen neuen Inhalator mit DNCG mitgeben können, werde ich noch hundert Jahre alt.«
Wahrscheinlich hat die Ärztin noch andere Termine, einen neuen Notruf oder sie kennt einfach diejenigen, die nicht mit sich reden lassen. Wortlos dreht sie sich um, greift in ihre Tasche und drückt ihm einen Plastikinhalator der unteren Preisklasse in die Hand. »Mister, Sie wissen, dass DNCG nur entzündungshemmend wirkt?«
Trevor nickt. »Nur bis ich zuhause bin. Da bin ich bestens versorgt.«
Der Assistent nimmt ihm die Manschette vom Arm und verstaut alles in seinem Arztkoffer. Die Ärztin reicht Trevor die Hand und hilft ihm hoch. In diesem Moment erkennt er, dass in dieser Uniform eine Frau steckt, und eine schöne noch dazu. Dennoch lässt er ihre Hand sofort wieder los.
Sie sieht ihn immer noch mit skeptischem Blick an. »Es ist Ihre Entscheidung, aber Sie sollten etwas tun. Es gibt neue Methoden.«
Trevor gelobt Besserung und fingert dabei eine seiner Visitenkarten aus der Jackentasche. »Sie werden mir Ihre nicht geben. Also gebe ich Ihnen meine.«
Ihr Blick verändert sich von skeptisch zu teilnahmslos. »Ich mache keine Hausbesuche.«
Trevor setzt sein Gewinnerlächeln auf und streckt ihr immer noch sein Kärtchen entgegen.
Sie betrachtet ihn betont mitleidig. »Sie haben zu viel Emergency Room gesehen. Geben Sie ihm die Karte.« Damit schaut sie in Richtung ihres Assistenten, dreht sich um und geht.
Ihr Helfer macht zwei Schritte auf ihn zu und nimmt ihm die Karte ab. »Du hattest keine Chance, Mann.« Dann nimmt er seinen Arztkoffer und begibt sich ebenfalls zum Ausgang.
»Ich bin freitags immer im Duplexx …« Trevors Ruf verhallt scheinbar ungehört. Die Ärztin und ihr Helfer haben die Lobby verlassen.
Dafür tritt sofort der Uniformträger wieder in seinen Sichtkreis.
»Wieder obenauf, Mister Man?«
Trevor sieht ihn misstrauisch an. Dazu muss er den Kopf etwas heben, denn der Andere überragt ihn um gut zwanzig Zentimeter.
»Woher kennen Sie meinen Namen?«
»Ich nahm mir die Freiheit, Sie auf einen Allergieausweis zu untersuchen, während ich auf den Rettungswagen wartete. Wissen Sie, Sie sind nicht mein erster Bewusstloser, und aus Erfahrung weiß ich, dass jede Sekunde zählen kann.«
Trevor schaut zu dem Hünen auf und ergreift seine Hand. Er bedankt sich und zückt mit der anderen Hand seine Brieftasche. »Ich weiß nicht, was für Ihre Hilfe angemessen ist …«
Sein Gegenüber macht eine abwehrende Geste. »Nicht doch. Geben Sie mir kein Geld. Tun Sie etwas Gutes für jemanden anderen, und wir sind quitt.«
Trevor lässt seine Brieftasche wieder zurück gleiten. Verwundert sieht er den Uniformierten an. Dann nickt er und lächelt zugleich. »Okay. Sie haben recht. Dennoch: tausend Dank!« Er drückt ihm die Hand erneut und macht sich dann auf den Weg hinaus zur Fifth Avenue. Der Mann bleibt zurück und wendet sich wieder den Aufzügen zu.
Es hat zu schneien begonnen. Nicht sehr stark, aber die Luft hat sich verändert und ist Balsam für Trevors Bronchien. Vorsichtig atmet er ein und langsam wieder aus. Dann geht er die wenigen Meter zur Straße, um nach einem Taxi zu winken. Immer noch muss er an den Sicherheitsmann denken und dass dieser sein monetäres Angebot abgelehnt hat. Was für ein Idiot! Aber Trevor soll es recht sein. Er hätte tatsächlich nicht gewusst, was er ihm hätte geben sollen. Glücklicherweise ist sein Anfall von Dankbarkeit wieder vorüber. Leben gerettet, Job gerettet, Geld …
Trevor greift sofort zur Brieftasche, denn ein böser Verdacht keimt in ihm auf. Hastig sieht er nach seinen Kreditkarten, seinem Bargeld, durchsucht alle Fächer. Aber so unerwartet es für ihn ist, es ist alles da, wo es sein sollte. Verwundert dreht er sich noch einmal zum Eingang um.
Inzwischen hat ein Yellow Cab direkt vor ihm gehalten. Trevor steigt ein und gibt dem Fahrer, einem der vielen Inder in New York, sein Fahrziel bekannt. Er will zurück nach Brooklyn, einfach nur heim. Das Taxi biegt von der 34sten Straße gen Süden auf die Fifth Avenue ab und fährt ihn zurück in seine kleine Festung. Trevor dreht sich noch einmal um und gestattet sich einen Blick zum höchsten Bauwerk der Stadt, dessen Spitze heute und an den folgenden zwei Tagen in Rot und Gold beleuchtet wird. Trevor hatte darüber im Guardian gelesen: Lunares Neujahr oder so. Er weiß nicht wirklich, was das bedeutet, und eigentlich ist es ihm auch egal, aber das Empire State Building sieht wunderschön in diesen Farben aus. Dazu der leichte Schneefall. Der Vollmond ist mit in seinem Blickfeld, und alles zusammen würde ein wunderbares Postkartenmotiv abgeben. Fast hat er vergessen, warum er dort oben gewesen war. Er wendet den Blick von der Skyline ab und schaut auf den Rucksack. Der liegt neben ihm auf dem Rücksitz des Taxis. Trevor lächelt. Der Fahrer ist derweilen an der Ecke 23ste Straße und biegt auf den Broadway ab. Wahrscheinlich will er via Canal Street über die Manhattan Bridge. Trevor ist es recht. Er fühlt sich wieder gut. Nur einen Moment denkt er noch an die Asche seiner Mutter irgendwo weit hinter ihm. Wie auch immer: Es ist getan, aus, vorbei.
»Danke, Ma! Hätte nicht viel gefehlt, und ich wäre dir gefolgt.«
- 4 -
Als der Mann mit dem schwarzen Stock die Halle betritt, wird es sofort still. Er ist an die fünfzig Jahre alt, hat graumeliertes Haar und einen aufrechten Gang. Das linke Bein zieht er geringfügig nach. Trotz seiner offensichtlichen Behinderung entspricht seine ganze Erscheinung eher der eines Herrschers denn der eines Dieners. Aber Alfred van Houten ist heute lediglich Dienstleistender. Seine Auftraggeber schätzen seine Menschenkenntnis und seinen Blick für Talente.
Die Bewerber, die an diesem Morgen zu Dutzenden in dem alten Lagerhaus in der Bronx erschienen sind, wissen das freilich nicht. Es gab keine Anzeige in der Zeitung, keinen Aushang in einem der vielen Arbeitsämter der Stadt. Es existieren Jobs, die ausschließlich von teuren Agenturen vermittelt werden. Wer seinen Namen in den Datenbanken dieser Agenturen hat, ist für das Besondere auserkoren: Spezialisten, Menschen für außergewöhnliche Aufgaben. Van Houten ließ gezielt einen Namen im Zusammenhang mit den gesuchten Jobs in den Agenturen verbreiten: McGuinness. Kaum ein Name – außer vielleicht der von Donald Trump – hat diesen Klang in New York City. So konnte Alfred sicher sein, dass sich die Besten bewerben würden. Und nun stehen sie mit ihm in dieser Halle in der Bronx und scheuen nicht einmal die Kälte. Minus zehn Grad draußen, nur unwesentlich wärmer im Innern.
Alfred van Houten stellt sich auf eine Holzkiste und schaut auf die Schar der Anwesenden hinunter. Es sind ungeduldige Gesichter. Das ist bereits der erste Test, denn es gibt immer einige, denen es nicht gefällt aufsehen zu müssen. Sie werden als Erste das Schweigen brechen. Van Houten lässt seinen Blick langsam kreisen und wartet.
»Na, alter Mann. Wird das heute noch was?«
Der ‚alte Mann’ tut nichts dergleichen. Von links hinten gibt es eine weitere Unmutsbekundung. Auch die rechte Seite wacht lautstark auf. Zwei schwarzhäutige Riesen stacheln sich gegenseitig an. Es mag an der Kälte liegen oder an der Wahl des Treffpunkts. Die meisten Anwesenden werden düstere Fabrikhallen wie diese noch nie von innen gesehen haben. Doch auch das ist Teil des Tests.
Van Houten hebt seinen Stock und unterbricht die beiden Hünen. »Sie können gehen!« Damit wandert der Stock in Richtung des ersten Unruhestifters. »Ebenso Sie … und Sie dahinten. Danke für Ihr Interesse.«
Seine Stimme ist dabei stark, seine Aussprache deutlich, seine Betonung teilnahmslos. Alfred van Houten weiß zu demotivieren.
Die, die bis zu diesem Moment die Ruhe bewahrt haben, schauen sich nach denen um, die wie geprügelte Hunde die Halle verlassen. Alfred kennt sein Geschäft. Er würde wissen, wann sich die Mehrheit gegen ihn wendet, wann er das Weite suchen müsste. Aber hier wird es nicht soweit kommen. Das kann er bereits jetzt absehen. Heute wird er sein Spiel spielen, seine Tests durchführen, und an deren Ende wird er fünf tüchtige und loyale Mitstreiter gefunden haben.
Einem nach dem anderen stellt er Fragen, fordert ihre Papiere ein, sieht sie in aller Ruhe durch und legt sie auf drei unterschiedliche Stapel auf einer zweiten, größeren Holzkiste neben ihm. Den Cleveren unter den Bewerbern wird ziemlich schnell aufgehen, dass der kleinste der drei Stapel auch der verheißungsvollste ist. Alfred van Houten lässt sich Zeit. Obwohl er weiß, dass der Job, für den er Leute sucht, auch körperlich einiges abverlangen wird, schließt er weibliche Bewerber nicht von vornherein aus. Seine Erfahrung hat ihn gelehrt, Willen und Ausdauer nicht mit Kraft zu verwechseln.
»Ihr Name?«
»Cindy Bernett, Sir!« Die Antwort kommt sicher und betont aus dem Mund der jungen Frau. Ihre Jacke hat sie abgelegt und trägt lediglich ein Neckholder als Oberteil. Ihre mittellangen, blonden Haare hat sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Ihre Schultern und Arme zeigen Anzeichen von Muskelaufbau. Es ist nicht zu viel, um den weiblichen Reiz zu verlieren, gleichzeitig aber genug, um Sportlichkeit zu beweisen. Ihre Bewerbungsmappe weist sie als Allroundtalent aus. Sie war bereits Feuerwehrfrau, Rettungsschwimmerin und Fallschirmtrainerin. Außerdem hat sie einen Motorradführerschein. Ideale Voraussetzungen für die Aufgabe, die sie erwarten wird. Ihre Unterlagen landen ohne Überlegung auf dem kleinen Stapel. Es entlockt ihr ein Lächeln. Sie tritt in die Gruppe zurück und zieht ihre Jacke wieder über.
»Der Nächste!«
Van Houten hat bereits an die dreißig Bewerber kategorisiert. Zwei Stunden sind vergangen, und ausnahmslos alle Wartenden scheinen zu frieren. Zwei der Stapel nehmen stetig zu. Der mittlere Haufen bleibt flach. Nur drei sind bislang in der engeren Wahl, zwei Männer und eine Frau. Außer Miss Bernett sind das Norman Doherty, ein ehemaliger G. I., sowie Raymond Fitch, ein Alleskönner, der zuvor als Holzfäller und Pilot gearbeitet hat. Ein erlesener Kreis, denkt Alfred van Houten. Noch zwei Personen, dann ist sein Team komplett.
»Mein Name ist Sharon Quaid.«
»Sie waren aktive Turnerin?«
»Nationalmannschaft, Sir!«
Van Houten mustert sie von oben bis unten. Bei Turnerinnen hat er sich immer kleine Mädchen vorgestellt. Dies hier ist eine Frau. Mit allem Drum und Dran. »Begeistern Sie mich mit einer Probe Ihres Könnens.« Van Houten steht immer noch auf der Kiste, die sich fast in der Mitte des Raumes befindet.
Sharon tritt ungefähr zwanzig Schritte zurück. Ansatzlos macht sie vier, fünf lange Schritte auf ihn zu, beginnt dann mit Flick-Flacks und hebt zwei Meter vor ihm ab, um im hohen Bogen über ihn zu springen und sanft hinter ihm zu landen. Das sorgt sogar für verhaltenen Applaus vonseiten der Mitbewerber.
Alfred war mit seinen Augen ihrem Können gefolgt. Auch er klatscht langsam in die Hände. »Beeindruckend! In Ihren Unterlagen steht, dass Sie danach zum Personenschutz gegangen sind. Hat unser Land nicht etwas Besseres für verdiente Sportler zu bieten?«
»Da reicht es leider nur für die Freak-Show hinter den Mikrofonen. Das wollte ich mir ersparen.«
Van Houten nickt. In seinen Ohren war das genau die richtige Antwort. Er nimmt ihre Mappe und legt sie auf den mittleren Stapel. In einem Anflug von Risikobereitschaft bricht er die Auswahl ab, obwohl er noch eine Person benötigt. Er vertraut auf seinen Instinkt, dass er die fünfte Person dennoch finden wird.
»Danke, ich brauchte vier Personen … ich habe vier! Miss Quaid, Miss Bernett, Mister Fitch und Mister Doherty bleiben bitte noch hier. Der Rest von Ihnen kann gehen. Ich danke Ihnen!«
Mit leisem Gemurmel trollt sich die Masse. Fast alle fügen sich in ihr Schicksal. Nur ein Mann bleibt außer den Genannten in der Halle stehen.
Alfred schaut auf. »Mister?«
Ohne ein Wort zieht der Angesprochene ein Messer, holt aus und wirft es ungefähr in die Richtung von Alfred. Aber eben nur ungefähr. Das Messer steckt im Holz der Kiste, auf der die drei Stapel liegen, und hat eine große Spinne auf ihrem Weg nach oben aufgespießt. »Ich hätte gedacht, es ist zu kalt für Spinnen.«Der Unbekannte geht zur Kiste und zieht sein Messer wieder heraus. Die Spinne schüttelt er zu Boden, um sie mit dem Fuß wegzukicken.
»Nicht schlecht, Mister …?«
»Gore. Devlin Gore. Zu Ihren Diensten.«
»Sie sind geschickt, Mister Gore. Aber es hätte mich mehr beeindruckt, wenn Sie auf meinen Stock geworfen hätten.«
Devlin Gore sieht van Houten kurz in die Augen, bevor er ihm antwortet. »Ich glaube nicht, dass Sie das beeindruckt hätte. Der Stock ist aus Metall und nicht aus Mahagoni, wie man vielleicht vermuten mag.«
Alfred muss lächeln. »Darf ich Ihre Mappe sehen?«
Der Ältere streckt dem Jüngeren die Hand entgegen, und Gore legt seine Unterlagen hinein. Van Houten blättert eine Weile darin, blickt abwechselnd auf die Seiten und dann wieder auf Devlin Gore. Der hat sein Messer wieder eingesteckt. »Mister Gore. Sie waren früher beim Zirkus?«
»Und in der Army. Spezialeinheit.«
Das klingt ein wenig prahlerisch, doch van Houten steigt von seiner Kiste, nimmt Gores Mappe und legt sie ebenfalls auf den mittleren Haufen. Zu den anderen vier. Als hätte er es geahnt. »Willkommen im Team, Mister Gore.«
Danach gibt van Houten den fünf Wartenden bekannt, wann und wo er sie zuerst benötigen wird. Ihre Ausrüstung wird gestellt, er nimmt lediglich ihre Größen auf.
»Sie werden ein kurzes Training absolvieren. Ich will mich von Ihrem tatsächlichen Zustand überzeugen. Aber Sie sollen auch als Team fungieren, also werden Sie zuerst einander kennenlernen.«
Damit nimmt er den kleinen Mappenstapel. Er weist auf die anderen beiden und schaut zu Devlin. »Bringen Sie die bitte zum ersten Termin mit.« Dann greift er nach seinem Stock und bewegt sich, wieder leicht humpelnd, zum hinteren Ende der Halle, öffnet die Tür und verlässt den Ort der Zusammenkunft. Die fünf Erwählten bleiben zurück. Gore sammelt die Mappen von der Kiste in seine Tasche und scheint sichtlich zufrieden.
»Das scheint mir ein Grund zum Feiern. Wer hat Lust?«
»Wenn du etwas weißt, was nicht unbedingt in diesem Stadtteil liegt …« Raymond Fitch fühlt sich offensichtlich unwohl in der Bronx.
»Angst?«
»Vorsicht. Ich für meinen Teil will den Job auch antreten. Es war schwer genug, ihn zu bekommen.«
Devlin lächelt ihn spöttisch an. Die anderen wenden sich derweil ab. Nur Cindy sieht ihm tief in die Augen. »Du scheinst Gefallen an dieser Ecke zu haben. Aber ich befürchte, dass du hier allein feiern wirst.«
Devlin Gore merkt, dass nicht jeder seine Coolness besitzt. »Okay, war ein dummer Scherz. Lasst uns woanders hingehen. Mir ist jede Bar recht. Meinetwegen auch in Harlem …«
Keiner lacht. Dann gehen sie aber doch gemeinsam aus der Halle und verabreden sich in einer Bar in Little Italy. Sie sind auf verschiedenen Wegen hergekommen, mit der Bahn oder mit dem Wagen. Cindy nimmt Sharon mit, Devlin gibt den Fahrer für Norman und Raymond. So können sie wenig später doch noch ihren kleinen Triumph mit Pizza und Wein feiern.
Erst sehr viel später an diesem Abend steht eine der zuletzt in der Lagerhalle verbliebenen sechs Personen vor dem Spiegel im Bad ihres Apartments und ballt die Fäuste. Neben dem Spiegel hängt ein nahezu verblichenes Schwarz-Weiß-Foto. Leise murmelt die Person etwas vor sich hin, auf das Bild zu, langsam lauter werdend, sich gebetsartig wiederholend. Die Person spricht von den Jahren, die sie investieren musste, um Fähigkeiten zu trainieren, die sie in die Dateien der Agenturen gebracht hat, Jahre auf der Suche nach dem richtigen Moment, an sie alle gleichzeitig heranzukommen, ihr Vertrauen zu gewinnen und sie die Rache spüren zu lassen.
»Das war der erste Schritt, nur der erste Schritt. Ich bin ihnen ganz nah, und sie werden dafür bluten, alle sechs … Und nicht einer wird entkommen!«
- 5 -
»Was meinen Sie, Cynthia? Worüber lohnen sich Filme? Was sind Ihrer Meinung nach die größten Motivationen?«
Trevors Dienstagabendklasse hüllt sich in Schweigen. Vielleicht hat er die Frage nicht eindeutig genug formuliert. Das ist einer jener Momente, die er an seinem Zweitberuf hasst. Er stellt etwas dar, das seiner Meinung nach offensichtlich ist, und niemand erkennt es.
»Die Liebe?« Cynthias Antwort kommt zögerlich. Dabei ist sie keineswegs unsicher. Mit einem Augenaufschlag, für den andere Männer durch die Hölle gehen würden, versucht sie verlorenen Boden wieder gut zu machen.
Trevor indes ist von solchen Versuchen, die nicht an seinen Verstand appellieren, nur wenig angetan. Zu viele hübsche junge Frauen sind in seinen Kursen gewesen. Mit zu vielen ist er hinterher ausgegangen und morgens gemeinsam aufgewacht. »Immerhin haben Sie sich dazu entschließen können, uns die romantischste aller Motivationen als Antwort zu geben. Danke, Cynthia.«
Ein kurzer Blick in die Runde überzeugt Trevor davon, dass keine anderen Antworten folgen werden. Also beginnt er selbst, die Wahrheiten preiszugeben. »Das Leben, vielmehr das Überleben, können wir getrost als eine sehr starke Motivation betrachten. Besitz, genauer gesagt, die Gier danach, wohl auch. Und, wie bereits erwähnt, die Liebe. Wahrscheinlich exakt in dieser Reihenfolge. Was vielleicht nicht romantisch ist, aber bestimmt realistisch.«
Auch Trevors derzeitige Klasse besteht überwiegend aus jungen Frauen, einige davon ziemlich gut aussehend. Die wenigen Männer wirken fehl am Platz. Ohne sie könnte man meinen, eine Cheerleadergruppe vorzufinden. Leider spiegelt sich das auch im Leistungsdurchschnitt wider. ‚Kinofilme am Scheideweg’ hat er seinen Kurs genannt. Es geht ihm um den Zweifel an amerikanischen Blockbuster-Produktionen im neuen Jahrtausend. Genau wie in seinen Kolumnen beim Guardian geht er mit Multimillionen-Dollar-Produktionen besonders kritisch ins Gericht, während er kleinen, ambitionierten Filmen die eine oder andere Schwäche nachsieht. Der Leserschaft scheint es zu gefallen, denn seine Kolumnen haben einen festen Platz im Aufbau der Zeitung. Dennoch zahlt ihm der Guardian nicht genug. Zumindest nicht genug, um seinen früheren Lebensstil mit in die neue Situation seiner Krankheit hinüberzuretten. Vor zwei Jahren hatte er ein Loft bezogen. 150 Quadratmeter, Riesen-Bad, Riesen-Bar, Riesen-Bett. Und die für ihn fast unvermeidliche Riesen-Leinwand samt High-End-Beamer. Alles nicht ganz billig. Als sich die Kosten für seine Medikamente potenzierten, stand er vor der Wahl, das Loft aufzugeben oder einen zweiten Job anzunehmen. Eine Zeit lang hatte er sich als Helfer in einem Krankenhaus versucht. Auch bei Burger King hatte er es immerhin einen Monat ausgehalten. Doch das kam weder seiner Krankheit noch seinem Anspruch an Arbeit entgegen.
»Mister Man? Ist nicht die Arterhaltung die stärkste aller Motivationen? Und brauchen wir nicht dafür die Fortpflanzung und dazu wiederum die Liebe?« Greta ist ein kluges Kind. Sie ist clever, sie suggeriert die Antwort und sie ist einfallsreich im Bett.
»Fast perfekt hergeleitet. Dennoch muss ich korrigieren. Arterhaltung – ja. Fortpflanzung – ja. Aber benötigen wir dafür wirklich die Liebe?« Trevor lässt seine Worte einige Sekunden auf seine Klasse wirken. Allzu oft entwickelt sich eine Unterrichtsstunde vom cineastischen Aspekt hin zum philosophischen. Das Kino und das Leben …
Die Klingel ertönt. Es ist halb neun, und sein Job ist für heute getan. Glücklicherweise ist dieser Kurs für ihn ein Heimspiel. Kino ist sein Leben seit seiner Kindheit. Hier bewegt er sich auf wohlbekanntem Terrain. Keine Chance für einen Anfall. Zumindest selten.
In dem Moment, da er den Raum abschließen will, bemerkt er, dass Greta auf ihn gewartet hat. Sie steht neben der Tür, bietet ihm ihr Profil im faden Licht der Flurlampe. Er dreht den Schlüssel im Schloss und stellt sich neben sie.
»Trevor, gehen wir noch etwas essen? Oder hast du eine bessere Idee?«
Greta. Sie erinnert ihn tatsächlich an die Göttliche. Ihr Aussehen ist zeitlos, ähnlich der Schönheit der Garbo. Es wird sie jedoch nicht vor dem Schicksal bewahren, das früher oder später all seine Freundinnen ereilt. »Essen klingt prima.«
Das ist gegen ihre Erwartung, aber sie lässt ihn gewähren. Sie gehen in ein nahegelegenes Restaurant, bestellen nur eine kleine Portion, dazu für sie einen Wein und für ihn den fast schon obligatorischen Whiskey.
Trevor spult, kaum dass die Getränke auf dem Tisch vor ihnen stehen, seinen Abschiedsvers herunter. Er ergreift ihre Hand auf dem Tisch. »Es klingt jetzt bestimmt hart für dich, aber ich habe kein Interesse an der Fortführung unserer Beziehung.«
Ihre Hand entwindet sich der seinen. Greta, die schöne, schlaue Frau ist sprachlos. Es trifft sie unerwartet. Und die Wahl seiner Worte tut ein Übriges. Aber sie kann die Tränen unterdrücken. Kein Schluchzen, kein Flennen. Nach zehn Sekunden, in denen sie sich gesammelt hat, blickt sie ihm wieder direkt in die Augen. »Du sagst mir doch hoffentlich, warum!« Damit lehnt sie sich zurück und verschränkt die Arme.
»Es liegt nicht an dir. Es ist mein Fehler. Frauen sind für mich immer nur in den ersten Tagen spannend, wenn die Frau neu für mich ist, wenn ich sie erforschen kann, ihre Vorlieben, ihre Sehnsüchte. Aber wenn die Blume sich mir geöffnet hat und ich in ihr Inneres blicke, dann verblasst meine Faszination. Ich kann nichts dagegen …«
»Nachdem du mich gefickt hast, kannst du dich davonmachen? Wie wäre es mal mit Klartext, Mister Man?«
»So sage ich es nicht, weil es so nicht stimmt. Auch wenn wir bis zum heutigen Tage nicht miteinander geschlafen hätten, würde ich dir das sagen müssen.«
»Wenn du vorher schon weißt, dass du es nicht mehr als drei Wochen mit mir aushältst, wäre es dann nicht nett, ja sogar höflich mir gegenüber, wenn du es erst gar nicht zu einer Beziehung kommen ließest?«
»Ich habe immer die Hoffnung, dass die Eine kommt, die mich kuriert.«
Greta muss lachen, aber es ist Sarkasmus. »Das hat schon Tony Curtis in Manche mögen’s heiß zu Marilyn Monroe gesagt. Das ist Jahrzehnte her und ein Klassiker. Du wirst mich doch nicht tatsächlich für so dumm halten, dir diesen Schwachsinn abzukaufen?«
Hatte er aber. Trevor sieht sich zur Änderung seiner Strategie gezwungen. »Du hast recht. Entschuldige. Statt Ausreden zu suchen sollte ich dir lieber reinen Wein einschenken … Es gibt eine andere Frau!« Das ist natürlich gelogen. Trevor sieht jedoch ein, dass die Wahrheit momentan unglaubwürdig ist. Eine gute Lüge hingegen würde Wunder bewirken.
Greta steht auf, schüttet ihm den Inhalt ihres Glases ins Gesicht und verlässt mit eiligen Schritten das Lokal.
Trevor streicht sich den Wein aus den Augen und muss leise lächeln. »Warum nicht gleich so?« murmelt er vor sich hin. Er führt sein Whiskeyglas zur Nase und atmet tief den Duft des Gentleman Jack ein, einen Tennessee Whiskey mit satter Süße.
Und er beglückwünscht sich zu einem erfolgreichen Abend.
- 6 -
Es ist der Tag der Testamentseröffnung. Für viele ein Grund, in der Nacht zuvor kein Auge schließen zu können. Trevor ist nur mäßig aufgeregt. Da sein Vater vor drei Jahren bei einem Autounfall verstarb, war Trevor auch bei der Eröffnung zugegen, und das Gehörte übertraf nicht das Erwartete. Heute, da ist er überzeugt, wird es ihm ähnlich ergehen. Bereits die Wahl des Notars hier in Brooklyn ist bezeichnend. Große Dinge spielen sich in Manhattan ab. Brooklyn Heights ist schön zum Leben, aber nicht um zu erben. Und dies hier ist kein imposanter Palast aus Glas und Beton, wie er auf der anderen Seite des East-River zu finden wäre, nur ein für diese Gegend typischer Backsteinbau. Trevor steht vor der Tür des Notars mit trockenen Händen. Es ist fünf Minuten vor elf Uhr. Pünktlichkeit ist eine der Tugenden, die ihm seine Mutter beigebracht hatte. Immerhin eine der nützlichen.
»Mister Man, nehme ich an.«
Trevor hatte weder geklingelt noch geklopft, als sich die Tür öffnet. Der Herr, der ihm im grauen Anzug gegenüber steht und ungefähr in Trevors Alter sein mochte, erscheint ihm auf den ersten Blick vertrauenswürdig. Während sich der Notar als Gordon Banks vorstellt, bittet er Trevor ins Haus. Er gibt ihm seine Visitenkarte, dirigiert ihn durch einen kurzen Flur zum Büro und bietet ihm einen Platz vor dem Schreibtisch an. »Sie sind sicherlich sehr gespannt, Mister Man?«
Trevor lächelt den Notar mit einer Mischung aus Langeweile und Höflichkeit an. »Ich hege keine zu großen Erwartungen, Mister Banks.«
»Das unterscheidet Sie von ungefähr neunzig Prozent meiner Klienten.« Der Notar lächelt eigenartig in sich hinein und beginnt, mit einem Brieföffner einen großen weißen Umschlag zu öffnen. Aus diesem zieht er ein Sammelsurium an Blättern heraus, die ihm sofort zu entgleiten drohen. Nur mit Mühe kann er die Papiere unter Kontrolle bringen. »Dabei habe ich sie selbst eingetütet«, bemüht sich Banks eifrig zu versichern.
Gelangweilt schaut Trevor auf die Visitenkarte, die Banks als Notar und Anwalt ausweist. Die dort aufgedruckte Adresse ist jedoch eine andere. Erstaunt schaut er auf. »McGuinness-Tower?«
Banks kommt aus scheinbar weit entfernten Gedanken zurück. »Oh – ja, meine Hauptadresse. Macht mehr her, wenn Sie verstehen. Manhattan zieht nun mal. Brooklyn Heights ist lediglich mein kleines Rückzugsgebiet.« Dabei lächelt er mit Verschwörermiene. Gleichzeitig macht er sich wieder an die Papiere. Die dabei erhobene rechte Hand lässt Trevor leicht erahnen, dass dies noch etwas Zeit beanspruchen wird. Genug jedenfalls, um sich im Zimmer umzusehen.
Banks sitzt mit dem Rücken zum Fenster. Vor ihm befindet sich ein riesiger, alter Schreibtisch aus dunklem Holz. Aus dem gleichen Material scheint auch das massive Bücherregal an der linken Wand zu bestehen. Selbst die Bücher im Regal sehen alt und teuer aus. An der rechten Wand befindet sich eine Anrichte, auf der ein Faxgerät steht. Trevors Blick findet zum Notar zurück. Der hat es derweil geschafft, alle Zettel, fein säuberlich getrennt, nebeneinander auf dem Schreibtisch zu positionieren. Banks nimmt einen davon heraus und fingert eine zerbrechlich anmutende, ungerahmte Brille aus seiner oberen Anzugtasche. Nachdem diese auf seiner Nase platziert ist, schaut er Trevor noch einmal in die Augen und beginnt zu lesen.
»Mein Letzter Wille. Von Emily Man. Bei klarem Verstand und unter Beisein meines Notars Gordon Banks vermache ich all mein Hab und Gut meinem einzigen Sohn Trevor.«
Der Notar schaut Beifall heischend vom Papier auf und blickt kurz auf den Erben. Trevor bemüht sich, einen nicht allzu gelangweilten Eindruck zu hinterlassen und nickt Gordon Banks aufmunternd zu. Der fährt fort. Sein Gesicht strahlt eine Euphorie aus, die Trevor bei einem Mann seines Berufes nicht erwartet hätte. Seine Mimik scheint geradezu nach Fanfaren zu rufen.
»Der Einfachheit halber beschränke ich mich nun auf einige wenige Fakten. Mrs. Emily Man hat nach eigenem Bekunden vier Dinge in ihrem Leben richtig gemacht. Sie hat den liebevollsten Mann der Welt geheiratet, einen Sohn geboren, auf den sie immer stolz war, auch wenn sie es manchmal nicht zeigen konnte, und sie hat zwei Mal von einem nicht geringen Lottogewinn Anteile an aufstrebenden Unternehmen erstanden, die Jahre später zu weltweiten Marktführern werden sollten: Apple und Intel. Und jetzt, Mr. Man, halten Sie sich bitte fest: Ihre Mutter vermacht Ihnen ein Gesamtvermögen von …« Banks macht eine Pause, als könne er tatsächlich in der Ferne einen Fanfarenstoß vernehmen. »… zweiundvierzig Millionen Dollar!«
Der Notar strahlt wie ein Pfefferkuchenpferd, während die Zahlen an Trevors Ohren vorbeirauschen, zurückkommen, sich in sein Gehirn brennen. Trevors Mund steht weit offen. Er sitzt für Sekunden regungslos. Banks nutzt die entstandene Pause, um Trevor ein Glas Wasser einzugießen. Er ist noch nicht mit dem Öffnen der Flasche fertig, als Trevor einen Anfall bekommt. Trevors Herz rast, seine Atmung geht schneller, und er weiß, dass er schleunigst seinen Inhalator benutzen muss. Um den Schreibtisch herum kommt Gordon Banks gelaufen, in dem verzweifelten Versuch irgendwie zu helfen. Derweil hat Trevor den Inhalator an seine Lippen geführt und atmet den ersten Zug ein. Er wünscht, das Mittel würde seine berstenden Lungenflügel schneller erreichen. Sekunden werden ihm zu Stunden. Mittlerweile versucht er sich an der Lehne des Sessels festzuhalten. Sein Husten schüttelt ihn stärker als im Empire State Building. Aber er fühlt durch den Schmerz hindurch, dass das Mittel bereits seine Wirkung entfaltet. Mit dieser Erkenntnis wird er ruhiger und entkrampft sich. Banks steht neben ihm, unbeholfen und scheinbar selbst einer Ohnmacht nahe. Zumindest hat sein Gesicht jegliche Farbe verloren. Aber Trevor hat sich wieder etwas erholt. So begibt sich Banks steifen Schrittes zurück hinter seinen Schreibtisch und lässt sich in seinen Sessel fallen. Trevor hat ein zweites Mal inhaliert und atmet ruhig und tief ein. Sich in seinem Sessel aufsetzend richtet er sein Augenmerk wieder auf den Notar.
»Ist das alles?«
Banks schaut ihn mit großen Augen an. »Ist Ihnen das etwa nicht genug?«
Trevor braucht eine Sekunde, um zu erkennen, dass seine Frage missverstanden wurde. »Nein, das meine ich nicht. Ist das alles, was meine Mutter mir geschrieben hat?«
»Das ist alles.«
»Kein persönlicher Brief, den sie an mich weiterleiten sollen?«
Banks hebt die Schultern fast entschuldigend. »Tut mir leid. Das ist alles. Ihre Frau Mutter hat mir kein separates Schriftstück anvertraut.«
Trevor zeigt auf den Tisch, auf dem diverse Papiere liegen. »Und das hier? Sie haben diese Papiere zusammen mit dem Testament aus einem Umschlag gezogen!«
»Oh, das sind Beglaubigungen, Bestätigungen und so weiter. Dieser Papierkram ist üblich. Jeder will eine Kopie heutzutage. Unter einigen von diesen Dokumenten benötige ich noch Ihre Unterschrift – falls Sie die Erbschaft antreten möchten.«
Trevor schaut ihn erstaunt an. »Wieso sollte ich nicht? Zweiundvierzig Millionen werde ich wohl kaum ausschlagen, oder ist da ein Haken?«
Banks hebt sofort die Hände zu einer beschwichtigenden Geste.
»Keinesfalls! Da ist kein Haken. Aber ich muss Sie das fragen. Das ist wie bei einer polizeilichen Festnahme. Ich muss Sie über alle Eventualitäten aufklären, Ihnen sozusagen Ihre Rechte verlesen. Das Gesetz verlangt es so.«
Für einen Moment sah Trevor den Reichtum schon wieder aus seinem Leben verschwinden, bevor er auch nur die kleinste Auswirkung zeigen konnte. Außer seinem eine Minute zurückliegenden Anfall. Fast scheint es so, als würde seine Mutter sein Leben selbst aus dem Jenseits noch erschweren. Andererseits hatte sie in ihrem Letzten Willen geschrieben, dass sie immer stolz auf ihn gewesen war. Und 42 Millionen Dollar! Wie konnte sie dies nur über die Jahre vor ihm und seinem Vater verheimlichen? Und vor allen Dingen: warum? Sie hatten beileibe kein schlechtes Leben in Brooklyn gehabt! Der Tisch war immer gut gedeckt gewesen, und es hatte ihnen kaum an etwas gemangelt. Aber was hätte das für ein Leben mit dem Geld sein können! Wollte seine Mutter vielleicht, dass er es aus eigener Kraft zu etwas brachte? Geld verdirbt den Charakter, heißt es. Und seine Mutter hatte immer den größten Wert darauf gelegt, dass er die Regeln des Lebens beherrschte. Sie hatte immer versucht, ihn zu einem guten Menschen zu erziehen. Wäre das Geld diesem Plan im Wege gewesen? Trevor konnte sich das wohl vorstellen. Nur sah es ihr so gar nicht ähnlich, dass sie ihm keinen persönlichen Brief hinterlassen hatte. Keine Botschaft wie: ‚Tue Gutes mit dem Geld.‘ Oder: ‚Sei von nun an vorsichtig in der Wahl Deiner Freunde.‘ Das hätte er erwartet. Im Leben hatte sie eine Unzahl an Ratschlägen für ihn parat gehabt, wieso sollte das im Tod anders sein? Die Stimme des Notars reißt ihn aus seinen Gedanken.
»Mister Man? Ich benötige jetzt noch einige Unterschriften von Ihnen. Dass Sie das Erbe antreten, und dass die Konten Ihrer Mutter fortan unter Ihrem Namen geführt werden. Bestätigungen, Beglaubigungen und so weiter. Ich war bereits so frei, die nötigen Vorbereitungen zu treffen.« Über den Tisch streckt Banks ihm seinen Füllfederhalter entgegen. Dann steht er auf und dreht einige der Papiere auf dem Schreibtisch Trevor entgegen.
Der versucht, erst den Sessel etwas dichter an den Tisch heranzuziehen, gibt dieses Unterfangen aber ziemlich schnell auf und tritt an den Schreibtisch heran. Jedes einzelne der ihm von Banks gereichten Schriftstücke überfliegt er, um dann zu unterschreiben.
»Was ist das hier, Mister Banks?« Trevor hält das Papier hoch, welches ihm der Notar zuletzt gegeben hatte.
»Darf ich noch mal sehen? Oh – ja, das ist lediglich die Bestätigung, dass Sie die Anteile Ihrer Frau Mutter übernehmen. Die Verwaltung liegt in den Händen eines Konsortiums. Diese Damen und Herren verlangen das natürlich. Bei solch immensen Summen kann man schließlich nicht vorsichtig genug sein.«
Trevor nimmt das Papier wieder zurück und macht sich daran, es wie die vorherigen zu unterzeichnen.
Währenddessen bereitet Gordon Banks das nächste Schriftstück vor und schiebt es zu Trevor hinüber.
»Eine Club-Mitgliedschaft?« Trevor hält das Blatt von sich weg, als müsste er mit seinem eigenen Blut unterschreiben.
»Ach ja, der Club. Mitglieder des Konsortiums sind in diesem Club. Sie bewegen sich von nun an in anderen Kreisen, Mr. Man. So etwas wird nicht nur von Ihnen erwartet, es wird geradezu von Ihnen verlangt.«
»Und wenn ich nicht will?«
»Dann gibt es keine Erbschaft.«
Trevor schüttelt den Kopf, als könne er es nicht glauben. »Bitte? Meine Mutter würde einiges von mir verlangen, jedoch nicht, dass ich in einem dekadenten Club Mitglied werde.«
Banks lächelt ihn gelassen an. »Das kommt nicht von Ihrer Mutter. Das sind Regeln, denen auch sie sich zuvor beugen musste. Das Konsortium sorgt zwar dafür, dass sich Ihre Gewinne mehren, im Gegenzug will es aber auch eine gewisse Kontrolle. Solch ein Club gehört dazu. Kommen Sie, Mr. Man. Zwei Mal im Monat gehen Sie in ein luxuriöses Haus, rauchen Zigarren, trinken Whiskey, diskutieren ein wenig über Politik und spielen ein oder zwei Partien Karten. Zuerst wird es Sie nicht umbringen und später werden Sie es wahrscheinlich sogar mögen.«
Trevor legt das Blatt wieder auf den Tisch, schaut noch einmal auf die Rückseite, sieht das berühmt-berüchtigte Kleingedruckte und unterschreibt auf der Vorderseite. Schon will seine Hand nach dem nächsten Schriftstück greifen, als er bemerkt, dass Banks ihm kein weiteres reicht. »Das war’s?«
»Das war es in der Tat. Hier sind Ihre Unterlagen. Erbschaftsurkunde und Beglaubigung. Die Bank ist die First National. Das ist die Bestätigung Ihrer Erbschaft. Die Bank wird Ihnen daraufhin weitere Unterlagen und natürlich Ihre neuen Kreditkarten aushändigen. Was nutzt die schönste Million, wenn man nicht liquide ist?« Banks lacht herzlich über seinen Witz. Trevor wartet geduldig.
Der Notar räuspert sich und schaut suchend über seinen Tisch. »Das ist alles. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und selbst wenn … Wir sind ja quasi Nachbarn. Werden Sie weiterhin hier wohnen?«
Darüber hatte sich Trevor noch gar keine Gedanken gemacht. Er liebt sein Loft. Warum sollte er von hier fortziehen? »Ich glaube, ich bleibe hier.«
Banks gratuliert ihm zu dieser Entscheidung und geleitet ihn zur Tür. Als diese längst geöffnet ist und die Hände bereits geschüttelt sind, fällt dem Notar noch etwas ein. »Sie bekommen doch noch etwas. Warten Sie!« Damit verschwindet er abermals in seinem Büro, um Trevor Sekunden später, mit einem kleinen Kärtchen wedelnd, entgegen zu eilen. »Nicht das Wichtigste, aber notwendig: Ihr Club-Ausweis!«
Trevor nimmt die kleine silberfarbene Plastikkarte, auf der lediglich der dunkelblaue Buchstabe ‚S’ steht. Weiter unten ist sein Name eingeprägt. Keine Mitgliedsnummer, das ist auch schon alles. Auf der Rückseite ist ein Hologramm mit einer sich scheinbar bewegenden Weltkugel. »Und das ‚S’ steht für …?«
»Der Club nennt sich Simon-Club. Fragen Sie mich aber bitte nicht, warum.«
»Ich muss nirgendwo unterschreiben?«
»Haben Sie bereits. Auf der Karte müssen Sie es nicht. Es gibt ohnehin nur ein paar davon.«
Trevor zuckt mit den Schultern und steckt die Karte in seine Jackentasche. Er bedankt und verabschiedet sich. Doch im Gehen fällt ihm noch etwas ein. »Mr. Banks. Dieser Club … Bekomme ich kein Willkommensgeschenk?«
Der Notar begegnet ihm mit einem verschmitzten Lächeln. »Ich glaube, das haben Sie bereits: Zweiundvierzig Millionen Dollar!«
- 7 -
Damals war Trevor natürlich zurück zu dem Haus in die Clinton Street gekommen.
Die Rufe der Jungs interessierten ihn nicht. ‚Offiziell’ hatte er ja die Ausrede, erneut nach dem Ball suchen zu müssen. Auch hatte er keine besondere Lust, um diese Zeit schon zuhause zu sein. Seine Mutter würde ihm nur wieder Vorträge halten und ihn in der Küche helfen lassen. Vielleicht hätte er den Tisch wischen müssen. Eine Tortur in seinen Augen, denn seine Mutter war scheinbar nie zufrieden und er konnte ihre Stimme schon jetzt hören, wie sie sagte: »Der Tisch ist noch schmutzig!«
Lag es vielleicht daran, dass sein Vater den Tisch selbst gebaut hatte, mit ausklappbaren Verlängerungen an den Querseiten? Damals stellte die Möglichkeit, den Tisch zu vergrößern, einen gewissen Luxus dar. Und in dem Tisch manifestierte seine Mutter das Glück ihrer Ehe und ihrer Familie. Auch das wurde Trevor erst viel später klar.
An jenem Tag war sein Interesse auf etwas gänzlich anderes gerichtet. Er kletterte auch dieses Mal wieder über Zaun und Hecke und tat so, als müsse er sich anschleichen. Die Suche nach dem Ball deutete Trevor nur an. Nach zwei Minuten öffnete sich die Haustür einen Spalt breit. Kaum erkennbar stand Mrs. McGuinness im Halbdunkel des Hausinneren, jedoch konnte er den weißen Ball in ihrer Hand erkennen. Die Jungs, die mit ihm den Heimweg von der Schule geteilt hatten, waren längst verschwunden. Er konnte also ohne Verlust an Ansehen wieder durch die Tür ins Innere des McGuinness-Domizils treten. Auch dieses Mal schlug sein Herz schneller. Zu gerne hätte er Sandra McGuinness angesehen. Nur ging sie, wie am Tag zuvor, hinter ihm. Er übte sich in Geduld, wusste, dass er dazu noch Gelegenheit bekommen würde. Wieder führte sie ihn auf die Veranda.
Der Diener stand schon bereit. »Das Gleiche wie immer, junger Herr?«
Trevor nickte nur. Er fühlte sich auf eine unerklärliche Art eingeschüchtert. Dies war eindeutig kein Heimspiel.
»Du bist ein wenig zu früh, Trevor.« Die Hausherrin hatte wieder ein Kleid gewählt, welches für Wochen Knabenträume anheizen würde. Wahrscheinlich spielte sie nur mit ihm. Sicherlich gefiel sie sich in der Rolle, ihn verwirren zu können. Vielleicht erregte es sie sogar. Zu jenem Zeitpunkt dachte Trevor nicht darüber nach. Später jedoch sollte er sich noch Gedanken darüber machen.
»Barnaby hat gerade seine Geografiestunde. Solange können wir ja noch bei einem Eistee plaudern.«
Die Getränke kamen, und tatsächlich standen diesmal zwei Eisteegläser auf dem Tablett des Dieners.
»Barnaby … Ihr Sohn bekommt Privatunterricht?« Privatlehrer waren nicht wirklich etwas Unbekanntes für Trevor. Aber einen echten Privatlehrer hatte Trevor noch nie zu Gesicht bekommen. Nach kurzem Überlegen entschied er, den Lehrer zu fragen, ob er nicht auch ihn unterrichten könne. Zwar wusste er von seinem Vater, dass diese Art von Lehrern sehr teuer war, aber er wollte es zumindest versucht haben. Sogleich teilte er seine Überlegung Mrs. McGuinness mit.
»Du weißt, dass Privatlehrer sehr teuer sind?«
Trevor nicke. Und er überraschte sie mit dem Vorschlag, dass er für das benötigte Geld arbeiten könnte. Vielleicht lag es an der Naivität, mit der Trevor seine Aussagen formulierte, vielleicht hatte Sandra McGuinness nur einfach einen Narren an diesem hübschen Jungen gefressen oder sie war sich der Isolation ihres Sohnes schmerzlich bewusst.
Zumindest schlug sie Trevor vor, er solle sich doch erst einmal mit Barnaby über den Lehrer unterhalten. »Barnaby kann dir sicherlich genug darüber erzählen, und vielleicht bist du danach gar nicht mehr daran interessiert, Privatunterricht zu bekommen.«
Trevor konnte sich das nicht vorstellen. Schließlich war sein eigener Stand in der Schule nicht gerade unkompliziert.
»Barnaby, mein Junge, komm bitte herunter und begrüße unseren Gast.«
Trevor drehte sich um und sah den Jungen durch das Glas der Verandatür auf der Treppe stehen und zu ihm herüber schauen. Schritt für Schritt ging Barnaby die Treppe herunter und kam langsam auf ihn zu. Trevor erhob sich von seinem Stuhl, blieb aber stehen, wo er war. Dafür ging Barnabys Mutter auf ihren Sohn zu und zog ihn ins Licht.
»Barnaby, das ist Trevor. Trevor – Barnaby.«
Die Jungs gaben sich die Hand, wie bei einem öffentlichen Empfang. In ihrer Steifheit waren sie sich gleich, doch sonst konnten sie unterschiedlicher nicht sein. Trevor hatte eine Jeanshose an, die nur oberschenkellang war. Darunter ragten typische Jungenknie hervor, bedeckt vom Schorf überstandener Zwei-Punkt-Landungen. Sein T-Shirt war zwar sauber, aber die rote Farbe längst verwaschen. Barnaby hingegen trug eine Anzughose, ein frisch gebügeltes, weißes Hemd und eine dunkelrote Fliege. Er betrachtete den Eindringling von oben bis unten.
»Komm mit!« Das klang wie ein Befehl, und Trevors erster Impuls war, diesem Schnösel zu widersprechen. Nur mühsam gelang es ihm, sich zurückzuhalten. So ging er, scheinbar folgsam, hinter Barnaby die Treppe hinauf. Er drehte sich auf halber Höhe nochmals zu Sandra McGuinness um und sah, dass sie ihnen hinterher schaute.
Oben angekommen führte Barnaby ihn in sein Zimmer. Für ein Kinderzimmer war es ungewöhnlich aufgeräumt, aber Trevor nahm an, dass es wohl auch dafür in diesem Haus Bedienstete gäbe. Vor dem Fenster stand ein Teleskop, aber Trevor war klar, dass sie dafür auf die Dunkelheit warten müssten. Schweigend blickten sie sich um. Nichts schien als Spielzeug zu taugen.
Nach einer Weile baute sich Barnaby genau vor Trevor auf – die Jungen waren ungefähr gleich groß – und wies mit dem Finger auf die Zimmertür. »Ich habe eine geniale Idee.«
Damit ging er vor, öffnete die Tür, durch die sie bereits das Zimmer betreten hatten, und begaben sich wieder ins Erdgeschoss. Barnaby ging zügig voran und nach wenigen Metern durch den dunklen Flur öffnete er eine Tür zu einem ebenfalls dunklen Raum. Nachdem Trevor durch den schmalen Spalt, den Barnaby die Tür geöffnet hatte, ins Innere geschlüpft war, hatte McGuinness jun. die Tür bereits wieder geschlossen. Es war stockfinster.
»Toll. Ich kann die Hand nicht vor den Augen sehen.« Trevor war einesteils gespannt, andererseits gelangweilt. Zumindest war er nicht ängstlich.
»Warte ab. Es geht gleich los.« Dann fluchte Barnaby leise, weil er über irgendetwas gestolpert war.
Schließlich begann es zu rattern, und ein Licht zeigte sich rechts von Trevor. Sekundenbruchteile später entstand an der Wand links von ihm ein Bild, ein sich bewegendes Bild. Dann hörte er das Klappern einer Filmspule in einem Vorführgerät. und in diesem Moment erkannte Trevor, dass er in einem Privatkino stand. Die McGuinness hatten einen eigenen Kinosaal! Im Licht des Films, Trevor hatte keine Ahnung, welcher es war, konnte er Barnaby erkennen, das Vorführgerät und einige Stuhlreihen, offensichtlich wie in einem echten Kino mit rotem Samt bezogen. Die Seitenwände waren mit Tüchern verhangen, und der Ton lief, wenn auch leise, aber absolut synchron zum Bild. Später sollte Trevor erfahren, welcher Film es war, den er damals als ersten im Haus der McGuinness gesehen hatte. Es war Einer flog übers Kuckucksnest mit Jack Nicholson, und er sollte ihn wenig später ganz sehen dürfen.
»Barnaby! Habe ich dir nicht verboten, alleine den Filmvorführer zu geben?« Es war eine dunkle Stimme, die urplötzlich in Trevors Rücken erklang. Sie konnte nur von Mister McGuinness stammen. Das Licht im Zimmer wurde eingeschaltet, und die beiden Jungen blinzelten gegen die plötzliche Helligkeit an. Barnaby versuchte erst gar nicht, sich zu entschuldigen. Er schaltete das Vorführgerät aus und ging mit Trotz im Blick an seinem Vater vorbei.
Der wandte sich mit einem Lächeln dem im Raum verbliebenen und sich total fehl am Platz fühlenden Jungen zu. »Du musst Trevor sein. Sandra hat mir von dir erzählt.«
Trevor wurde gleich ein kleines Stück größer. Zu der Erscheinung von Mister McGuinness fehlte ihm allerdings ein ganzes Stück. Jonathan McGuinness mochte fast zwei Meter groß sein, trug seinen Anzug fast wie eine Uniform und hatte graue, kurze Haare. Er trug keine Brille, hatte keinen Bart und roch nach teurem After Shave.
»Wie gefällt es dir hier?« Diese Frage zielte nicht auf Barnaby ab, sondern auf das Anwesen, auf die Besitztümer.
»Ich bin fasziniert von Ihrem Cinematografen. Ich habe noch nie zuvor einen gesehen.«
»Ich bin auch sehr stolz darauf. Möchtest du uns einmal besuchen, wenn wir einen Filmabend machen?«
»Sehr gern, Mister McGuinness.« Trevor konnte seiner Stimme die nötige Begeisterung verleihen. Und so durfte er wiederkommen. Und Barnaby würde sich an ihn gewöhnen müssen … Ob er wollte oder nicht.
- 8 -
Jazz Richards drückt den Telefonhörer wieder in die Gabel. Es ist ein altes Telefon mit Wählrad. Das Klicken der Kontakte unter dem Hörer ist deutlich hörbar. Jazz sitzt auf dem Fensterbrett und weint. Ihre Tränen sind dick und sammeln sich erst in ihren Augenwinkeln, ehe sie rasch über ihre Wangen hinunterrollen und irgendwo im dicken Stoff des orangefarbenen T-Shirts verschwinden, dort nur einen dunklen Fleck hinterlassend. »Das kann er doch nicht machen!«, flüstert sie vor sich hin. Dabei schüttelt sie langsam den Kopf und presst die Augenlider so fest aufeinander, dass die nächste Träne ohne Umweg über ihre Wange heruntertropft. Irgendwann, nach langen Minuten, schaut sie aus dem Fenster. Draußen scheint die Sonne. Es ist ein kalter, aber schöner Winter. Jazz geht in die Mitte des Raumes und bleibt dort unentschlossen stehen. Sie sieht sich kurz um, nimmt das Kissen von der Couch und wirft es voller Wut gegen die Wand. Im Herabfallen stößt es die Vase auf dem Sideboard um, und das Wasser ergießt sich über das Parkett. Die gelben Rosen fallen auf das Sideboard und auf den Boden. Mit einem Satz ist Jazz an der Wand und kann zumindest die Vase vor dem kompletten Absturz bewahren. »Das ist alles seine Schuld!« Mit leisem Fluchen macht sie sich daran, die Wasserlache aufzuwischen, bevor diese auf dem Parkett größeres Unheil anrichten kann.
Ihre Wohnung, die sie sich mit Fiona Singleton teilt, ist sechzig Quadratmeter groß und könnte früher ein Atelier gewesen sein. Das Licht, das durch die riesigen Wandfenster fällt, wäre ideal für einen Maler. Jazz malt selbst leidenschaftlich gern. Eigentlich ist sie Schauspielerin. Gäbe es Fiona nicht, wäre Jazz längst auf halbem Weg nach Hollywood. Doch wenn sie ginge, würde er seine Warnung wahr machen, und Fiona würde ihren Job verlieren ‒ ihren innig geliebten, fürchterlichen Job.
Da kommt Fiona heim. Jazz hört den Schlüssel im Schloss. Achtzehn Stunden waren es wieder. Achtzehn Stunden voller Einsatz als Notärztin. Sie wird müde sein und sie wird allein sein wollen. Jazz kennt das. Sie wischt sich die verbliebenen Tränen aus dem Gesicht und geht ihr entgegen.
»Hallo!«
Jazz schiebt ihren Kopf um die Ecke, in den Flur hinein. Fiona zieht sich gerade ihre Schuhe aus. Ihre Tasche hat sie gegen alle Gepflogenheit achtlos auf den Boden fallen lassen. Einige Dinge fallen heraus, bleiben daneben auf dem Parkett liegen.
»War dein Dienst anstrengend?«
»Sehe ich so müde aus?«
Jazz schüttelt den Kopf. »Deine Tasche. Du hast sie nicht weggelegt.«
Fiona blickt auf und nickt anerkennend mit dem Kopf. »Du kennst mich zu gut.«
Jazz erwidert nichts. Sie dreht sich zurück ins Wohnzimmer und lässt sich mit geschlossenen Augen an der Wand entlang zu Boden gleiten. Als sie sitzt, zieht sie die Füße zu sich heran und umschließt ihre Knie mit ihren Armen. »Willst du gleich schlafen gehen?« Mittlerweile kann Jazz ermessen, wie sehr die Stunden als Notärztin erschöpfen können. Ihre Frage kommt nicht von ungefähr.
»Besser nicht. Ich habe morgen Nacht wieder Bereitschaft. Ein paar Stunden sollte ich noch wach bleiben.« Damit geht Fiona an Jazz vorbei zur Stereo-Anlage.
Während Fiona eine CD aussucht, rafft sich Jazz auf und will deren Handtasche wieder einräumen. Dafür kniet sie sich im Flur vor das kleine Chaos und beginnt, die herausgefallenen Dinge zurück in die Tasche zu stecken: Fionas Portmonee, den Glücksstein, den Jazz ihr einmal geschenkt hatte, und eine Visitenkarte. Aus dem Wohnzimmer klingt der nimmermüde Elton John herüber. Jazz dreht die Visitenkarte um und liest die Zeilen:
Trevor Man
NEW YORK GUARDIAN
Kulturredaktion
Darunter steht noch eine Telefonnummer.
Trevor Man … Das ist er! Jazz drückt die Karte an ihre Brust. Was für ein Zufall! Jazz ist sich klar, dass sie unglaubliches Glück hat. Mit der Karte in der Hand geht sie zum Zeitungsstapel in der Küche und sucht den Guardian vom letzten Wochenende. Sie schlägt, ihrer Ahnung folgend, die letzte Seite auf und sucht nach dem Namen unter der Filmkolumne: Trevor Man.
Mit Karte und Zeitung eilt sie zurück ins Wohnzimmer, wo Fiona es sich auf der Couch bequem gemacht hat. Mit geschlossenen Augen lauscht sie Goodbye, Yellow Brick Road.
»Du kennst Trevor Man?« Jazz hält Fiona Karte und Zeitung entgegen.
Die schlägt die Augen auf und blickt Jazz zunächst unwissend an. Als sie jedoch die Visitenkarte erkennt, nickt sie. »Ich durfte ihn vor ein paar Tagen behandeln. Er hatte mir gleich seine Karte aufgedrängt.«
Jazz scheint die Kinnlade herunterzufallen. »Hallo? Trevor Man ist einer der besten Kolumnisten in Sachen Film. Der kennt Produzenten und Regisseure wahrscheinlich beim Vornamen. Du erinnerst dich, dass ich Schauspielerin bin? Wann wolltest du mir denn die gute Nachricht mitteilen?«
Fiona ist müde und ihr steht der Sinn nicht nach Streit. »… zu deinem Geburtstag.«
»Der ist im August!«
»Ich hatte die Karte nur vergessen. Wie du weißt, habe ich reichlich Stress. Entschuldige.«
Jazz setzt sich zu Fiona auf die Couch. Für einen Moment sagen sie nichts. Nur Elton John hat die Straße der gelben Steine verlassen und singt nun den Crocodile Rock.
»Ich vergebe dir.« Jazz lehnt sich an Fionas Oberkörper. Vorsichtig hakt sie nach. »Hat er sonst noch was gesagt? Was wollte er von dir? Wirst du ihn wiedersehen?«
»Ich bin nicht an Mister Man interessiert, also wird es kein Wiedersehen geben. Du kannst ihn aber gerne anrufen. Die Nummer steht ja wohl drauf.«
Jazz dreht die Karte zwischen ihren Fingern. »Ja … stimmt. Und er hat nichts weiter gesagt?«
»Doch, dass er freitags immer im Duplexx wäre.« Dabei beißt sich Fiona auf die Lippen. Heute ist Freitag und Jazz’ Reaktion kann sie leicht vorhersehen.
»Also heute! Trevor Man ist im Duplexx. Da waren wir schon lange nicht mehr!«
Fiona Singleton zögert. »Zur Washington Avenue? Dann lieber Elton John …«
Aber Jazz lässt keinen Widerspruch gelten. »Du bist das Bindeglied. Dich kennt er. Außerdem weiß ich nicht einmal, wie er aussieht.«
Fiona hebt abwehrend ihre Hände. »Okay, okay, ich komme mit.«
Das ist der offizielle Startschuss. Jazz drückt Fiona einen Kuss auf die Wange. Die verdreht ihre Augen zur Zimmerdecke. Sie weiß, dass Jazz’ Naivität manchmal entwaffnend sein kann. Und sie weiß gleichzeitig, dass sie auf Jazz aufpassen muss. In gewissen Grenzen natürlich. Schließlich ist Jazz schon groß, zumindest ein großes Kind.
»Sieht er gut aus?«, fragt Jazz, bereits auf dem Weg in ihr Zimmer, um sich umzuziehen.
Fiona antwortet erst laut, dann aber mit jedem Wort leiser werdend: »Du wirst ihn mögen. Er ist eine echte Rakete.« Sie rappelt sich hoch, geht ihrerseits in ihr Zimmer und tut es Jazz gleich. Währenddessen besingt Elton John den Rocket Man.
- 9 -
Eigentlich müsste Trevor zur Samstagsausgabe mit einer neuen Kolumne aufwarten. Das ist leicht – normalerweise. Kaum etwas bietet so viele Schlagzeilen wie das Filmbusiness. Ein bisschen Klatsch und Tratsch, alle zwei Wochen potentielle Blockbuster, Produktionsnotizen, Probevorführungen … Und wenn ihm gar nichts mehr einfällt, kann er immer noch über Independentmovies oder europäische Filme berichten. Trevor gesteht sich ein, über die Jahre des Erfolgs satt und müde geworden zu sein. Doch wenn auch nur noch eine Spur eines Journalisten in ihm steckt, dann muss er …
Sein Laptop ist eingeschaltet, das Textprogramm erwartet seine Eingabe mit einem blinkenden Cursor. Aber Trevor hat heute ein Motivationsproblem. In seinem Kopf dreht sich immer noch alles nur um eines: Geld.
Er war sofort bei der First National und ließ die Konten auf seinen Namen umschreiben. Für Sofortverfügungen hat er sogar ein Konto in der Höhe von zwei Millionen Dollar. Zwei Millionen! Trevor erinnert sich an jedes Detail.
Der Inhaber der First National, ein gewisser Gary Nance, hat Trevor persönlich alles erklärt und ihn geradezu rührend umsorgt.
Mit den Worten »Und hiermit übergebe ich Ihnen Ihre American Express Centurion Card mit exklusivem Sicherheitschip«, hat er Trevor abschließend zum Öffnen seiner Brieftasche verleitet. Dabei fällt Nances Blick auf die silberne Plastikkarte. Das blaue ‚S’ ist unübersehbar. »Sie haben auch eine Simon-Card?«, fragt er. Seine Überraschung ist ihm deutlich anzumerken.
»Sagten Sie: Auch?«
Gary Nance zieht seinerseits die Brieftasche aus der Innentasche des Jacketts. Er präsentiert Trevor seine Karte. Der nimmt sie ungläubig in seine Hand und schaut die Rückseite in der Hoffnung auf irgendeinen Hinweis an, gibt sie aber Nance zurück. »Jetzt glaube ich zumindest an die Exklusivität des Clubs.«
»Ja …«, erwidert Nance zögerlich.
Trevor bekommt einen Haufen Bargeld, und sie verabschieden sich mit einem kräftigen Händedruck.
Und nun steht Trevor wieder am Fenster seines Lofts und schaut hinauf zum Winterhimmel. »Oh, Ma, was für ein Haufen Geld!« So langsam beginnt er, sich um sich selbst zu sorgen. Es mag an der Situation liegen, am Tod seiner Eltern, am unerwarteten Geldsegen … Immer häufiger führt er Selbstgespräche. Die Zwiesprache mit seiner verstorbenen Mutter ist nur vorgeschoben. Aber ist er einsam? Trevor schüttelt den Kopf, als wolle er imaginäre Fliegen verscheuchen. Er geht vom Fenster zurück zum Tisch, missachtet das Textprogramm und klappt den Laptop zu. Er schließt den Kragen seines Hemdes. Wirft sich im Hinausgehen den Mantel über und spricht einmal mehr zu sich: »Showtime!«
Das Duplexx ist Disco und Bar in einem. Die angesagtesten DJ’s der Stadt reißen sich darum, hier auflegen zu dürfen. Freitags gibt es House und Classics. Nach Trevors Dafürhalten ist es der einzige Tag, der einen Besuch lohnt. Als Dauergast und lokale Bekanntheit gelangt er immer schnell und ohne anstehen zu müssen ins Innere. Sein Handy klingelt. Die Rufnummernanzeige verrät die Guardian-Redaktion als Anrufer.
»Heute nicht!«, sagt Trevor, schaltet das Handy aus und steckt es wieder ein. Das Duplexx empfängt ihn wie immer mit dämmrigem Rotlicht und vielen Menschen von unterschiedlichstem Alter und Herkunft. Die Bässe dringen in seinen Bauch. Irgendwo hinter dem künstlichen Nebel befindet sich die Tanzfläche. Von diesem Nebel wird er sich fernhalten. Zwar wird sein Asthma durch Aufregung oder Anstrengung verursacht, doch der Nebel wäre ein Katalysator, der einen Anfall fördern würde. Immerhin ist das Duplexx seit jeher eine Nichtraucherbar. Für ihn ist es ein Grund mehr, hierher zu kommen.
Die Uhr zeigt Mitternacht. Fast kommt ihm dieser Abend wie einer seiner vielen Abende hier vor. Da fällt ihm seine Erbschaft wieder ein. Für einen winzigen Moment ist er versucht, eine Saalrunde auszugeben. Aber das würde Fragen nach sich ziehen und Neider anlocken. Also lässt er diesen Gedanken wie eine heiße Kartoffel wieder fallen. Gleichzeitig richtet Trevor seinen Blick auf zwei Schönheiten, die an einem Tisch unweit der Bar sitzen und ziemlich gelangweilt wirken. Selbst ohne weißen Kittel erkennt er in der Frau die Ärztin, die ihn in der Lobby des Empire State Building behandelt hatte. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, begibt er sich an ihren Tisch. »Meine Lebensretterin! Guten Abend, die Damen.«
Die Ärztin, eine schlanke Brünette mit deutlichem Hang zu engen Kleidern, blickt ihn kurz an, um dann ihrer Platznachbarin kurz etwas ins Ohr zu sagen. Diese, kurzhaarig, blond und überaus wohlproportioniert, hebt daraufhin den Blick zu Trevor, und ihre Augen sind von einem faszinierten Leuchten erfüllt.
»Mister Man, setzen Sie sich zu uns. Geht es Ihnen wieder besser?« Die Ärztin bietet ihm einen Platz ihnen gegenüber am Tisch an.
Trevor nimmt dankend an. »Ich bin beeindruckt. Sie haben sich meinen Namen gemerkt.«
Sie lächelt ihn gelassen an. »Das ist ein Teil meines Jobs. Aber entschuldigen Sie … Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Das ist Jazz Richards, meine Mitbewohnerin, und mein Name ist Fiona Singleton.«
Trevor hebt sein Hinterteil und deutet eine Verbeugung an. Und das gegenüber beiden Frauen, so wie er es von seiner Mutter gelernt hatte. Oft sind es die kleinen Dinge, die zählen. Frauen achten darauf, Fiona Singleton garantiert auch. Gleichzeitig nutzt er aber auch diese Situation, um etwas näher an Fiona heran und damit um den halben Tisch herum zu rutschen. Gleichzeitig winkt er eine der Bedienungen heran und bestellt großzügig Drinks für die Frauen und sich.
Er beginnt, sich mit beiden zu unterhalten. Schnell stellt er fest, dass seine Aussagen Fiona nicht beeindrucken. Jazz folgt seinen Worten indes mit leuchtenden Augen. Sie sprechen über dieses und jenes und vor allen Dingen über Filme. Und Trevor beginnt zu philosophieren. »Seien wir ehrlich. Der deutsche Film ist mit dem Zweiten Weltkrieg vergangen. Zwar gab es noch Marlene Dietrich, aber auch sie musste mehr als einen Grund haben, aus Deutschland wegzugehen. Zumindest sehen wir Amerikaner es gerne so.«
Fiona zeigt ihm die kalte Schulter, schaut offenbar gelangweilt zum Nebel hinüber.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752135749
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (März)
- Schlagworte
- Rache New York Rachespiel James Bond USA Genexperiment Krankheit Oberschurke Frauenheld Asthma Krimi Noir