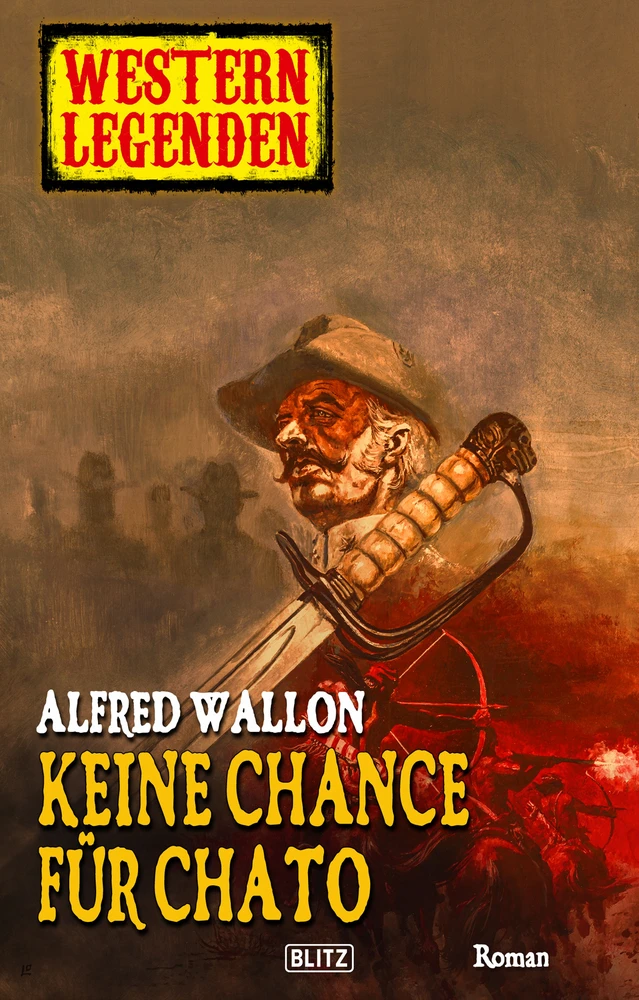Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
27. April 1886
Santa Cruz-Tal
Im Grenzland zwischen Arizona und Mexiko
Sie kamen lautlos. Gedrungene Gestalten huschten durch die Nacht und näherten sich der kleinen Ranch, deren Bewohner schliefen. Es waren die Stunden zwischen Mitternacht und Morgengrauen, in denen der Schlaf des Menschen am tiefsten und die Träume am intensivsten sind.
Geronimo und seine zwanzig Krieger hatten keine Träume mehr. Sie wollten nur noch kämpfen, um zu überleben. Sie wollten den Weißaugen zeigen, dass sie selbst vor einer deutlichen Übermacht von Blaurock-Soldaten niemals aufgeben würden. Das wüstenähnliche Land war ihre Heimat, und sie kannten hier jeden Fußbreit Boden. Sie wussten um geheime Verstecke in dieser Region, die ein Weißer niemals finden würde.
Geronimo lächelte kaltherzig, als er sah, wie Nachite sich mit sechs weiteren Kriegern rasch dem Haupthaus der abgelegenen Ranch näherte. Er wusste, dass er sich jederzeit auf den erfahrenen Krieger verlassen konnte, und gab nun fünf anderen Kriegern einen kurzen, aber eindeutigen Wink, sich an das Nebengebäude heranzuschleichen und dann genauso hart und kompromisslos zuzuschlagen, wie er und die übrigen Apachen es geplant hatten. Immer wieder schaute Geronimo wachsam nach allen Seiten, als ob er befürchtete, dass buchstäblich im letzten Augenblick eine unergründliche Laune des Schicksals eingreifen und die Apachen daran hindern würde, das zu tun, was sie tun mussten.
Geronimo kannte die Weißen nicht, die hier abseits der bekannten Routen und Städte eine Ranch errichtet hatten. Es interessierte ihn auch nicht. Er wusste nur, dass er und seine Krieger ein Zeichen für die Blaurock-Soldaten setzen wollten. Damit Bear Coat Miles erfuhr, dass Geronimo sich auch nicht vor tausend Soldaten fürchtete, die sich auf die Fährte der Apachen gesetzt hatten, um sie ein für alle Mal auszuschalten.
Natürlich wusste Geronimo, dass General Nelson A. Miles ein gefährlicher Mann war, und dass er hart und kompromisslos gegen seine Feinde vorging. Trotzdem war es ihm bisher nicht gelungen, die restlichen freien Apachen einzukreisen, gefangen zu nehmen und zu bestrafen. Geronimo und seine Krieger waren bisher immer schneller gewesen und hatten sich über die Grenze nach Mexiko zurückgezogen.
Obwohl die Apachen auch von mexikanischen Soldaten gejagt wurden, hatten Geronimo, seine zwanzig Krieger sowie dreizehn Frauen und sechs Kinder immer in der unzugänglichen Region der einsamen Sierra Madre untertauchen können. Sie waren zurückgekommen, um zu rauben, zu plündern und zu töten!
Geronimo zuckte zusammen, als er plötzlich hörte, wie drüben unweit des Hauses ein Hund zu bellen begann. Unterschiedliche Gedanken gingen ihm in Bruchteilen von Sekunden durch den Kopf. Die Späher hatten den Hund übersehen und ihm gestern nichts davon berichtet. Hätte Geronimo davon gewusst, dann wäre das Tier sein erstes Opfer geworden. Das Bellen wurde lauter, brach dann aber mit einem kurzen Jaulen ab. Geronimo atmete auf. Nachite oder einer der übrigen Krieger, die sich von der anderen Seite an das Haupthaus herangeschlichen hatten, war im richtigen Augenblick zur Stelle gewesen. Der Hund schwieg für immer!
Geronimo erkannte einen hellen Schimmer in einem der Fenster des Hauses. Die Bewohner mussten durch das Bellen des Hundes aus dem Schlaf gerissen worden sein. Jemand wollte offenbar nach dem Rechten sehen. Geronimo sah zu dem angrenzenden Gebäude, in dem die fünf Männer schliefen, die für den weißen Farmer arbeiteten. Auch dort waren Geräusche zu hören. Nur wenige Sekunden später öffnete sich die Tür und ein Mann trat ins Freie, der herzhaft gähnte und mit müden Augen hinaus in die Nacht blickte. Im selben Moment fiel ein Schuss. Der Mann wurde vom Aufschlag der Kugel zurückgestoßen. Er ruderte mit den Armen und schrie. Gleichzeitig stürmten fünf Krieger auf das Nebengebäude zu und sprangen über den sterbenden Mann hinweg.
„Tötet sie alle!“, schrie Geronimo seinen Kriegern zu. Dies war das Zeichen zum Angriff.
*
Carol Buchanan wurde aus dem Schlaf gerissen, als sie den Hund bellen hörte. „Tom“, murmelte sie leise und rüttelte an der Schulter ihres Mannes. „Du musst aufstehen und hinausgehen. Da ist irgendetwas. Rusty bellt.“
Tom Buchanan rieb sich die Augen. Er fluchte leise, als ihm bewusst wurde, was Carol gesagt hatte. Er hatte nichts gehört. Gar nichts. Er hatte tief und fest geschlafen. Doch der Rest an Müdigkeit war verflogen, als der Hund erneut bellte und plötzlich mit einem kurzen Jaulen verstummte. Tom Buchanan zog sich an, während seine Frau die Petroleumlampe entzündete.
„Geh zu Audrey und kümmere dich um sie!“, zischte der Mann seiner Frau zu. „Schließ die Tür hinter dir zu! Hast du verstanden?“
Carol Buchanan lebte lange genug in dieser einsamen Gegend, um zu wissen, was diese Worte bedeuteten. Die letzten Wochen und Monate war alles ruhig geblieben, doch die Menschen, die auf der Box-B-Ranch lebten, hatten ihre eigenen Erfahrungen gemacht und kannten die Risiken. Vor allem, wenn es Geronimo und seine Apachenbande betraf, die zum wiederholten Mal das Reservat in San Carlos verlassen hatten und seitdem im Grenzland von Arizona und Mexiko umherzogen. Seit einem knappen Vierteljahr war endlich Ruhe eingekehrt, es hatte keine Überfälle mehr auf dieser Seite der Grenze gegeben. Doch wenn es drüben in Mexiko Ärger mit Geronimos Apachen gab, dann drangen die Nachrichten entweder nur sehr spät oder gar nicht bis in diesen Teil des Landes vor.
Plötzlich war das Splittern von Glas in einem der angrenzenden Räume, dort, wo Audrey schlief, zu hören. Es folgte ein ängstlicher Schrei und ein dumpfes Poltern. Tom Buchanan zuckte zusammen, als er draußen Schüsse und Schreie vernahm. Für einen winzigen Augenblick wusste er nicht, was er tun sollte. Und genau diese Sekunden wurde ihm und seiner Familie zum Verhängnis.
„Audrey!“, rief die besorgte Mutter und wollte loslaufen.
Doch ihr Mann packte sie hart am rechten Oberarm und hielt sie zurück. „Bleib hier! Nimm den Revolver und achte auf die Tür. Hast du verstanden?“
Seine Frau erwiderte etwas, doch das nahm er kaum noch wahr. Seine Sorgen galten im Moment nur den Dingen, die sich im Nachbarraum abspielten. Erneut hörte er einen Hilfeschrei seiner Tochter. Die Panik in ihm wuchs. Er wusste auch, dass er von seinen fünf Cowboys keine Hilfe erwarten konnte, denn diese kämpften ebenfalls um ihr Leben. Weitere Schüsse, die er von draußen hörte, signalisierten ihm deutlich, in welcher Gefahr sich die Bewohner der Ranch befanden.
Mit vorgehaltener Waffe riss Tom Buchanan die Tür zu Audreys Zimmer auf und sah, wie ein stämmiger Apache über der auf dem Boden liegenden Audrey kniete und ihr einen Faustschlag versetzte, der das sechszehnjährige Mädchen erneut aufschreien und um Hilfe rufen ließ. Buchanan zielte auf den Rücken des Apachen, der zu einem weiteren Schlag ausgeholt hatte, während hinter seinem Rücken eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde und Apachen ins Haus eindrangen. Er hörte seine Frau schreien, konzentrierte sich aber darauf, Audrey zu helfen. Der Gedanke, dass dieser elende Bastard seiner Tochter etwas Schlimmes antun konnte, wenn er nicht eingriff, überlagerte alles andere.
Den zweiten Apachen sah er viel zu spät. Es war nur ein Schatten jenseits seines Blickfeldes, der ihn plötzlich in dem Moment ansprang, als Buchanan abdrückte. Die Kugel bohrte sich in die Holzwand des Hauses und stoppte den Apachen nicht, der Audrey Gewalt antun wollte.
Auf einmal spürte er einen heißen Stich in seinem Magen, der sich Sekunden später in einen schrecklichen Schmerz verwandelte.
Der Apache stieß einen Triumphschrei aus, als er das blutige Messer aus Tom Buchanans Bauch riss und ihm einen Tritt versetzte, der den Rancher taumeln und schließlich zusammenbrechen ließ. Das Gewehr hatte er fallen gelassen, weil es auf einmal so schwer geworden war, dass er es nicht mehr hatte festhalten können. Hart schlug er auf dem Boden auf, während sich der wahnsinnige Schmerz im Magen langsam auf den gesamten Oberkörper ausbreitete und ihn kaum noch einen klaren Gedanken fassen ließ. Den Siegestaumel der Apachenkrieger, die in der Zwischenzeit das Bunkhouse gestürmt und seine Männer überrumpelt hatten, nahm er nur aus weiter Ferne wahr. Er sah nur, dass der Apache Audrey an ihren Haaren riss und sie hinter sich her schleifte. Tom Buchanans Gedanken überschlugen sich. Er wollte sich hochstemmen und den Apachen daran hindern, seine Tochter mitzunehmen. Aber dann sah er das Blut, das aus seinem Körper lief und bereits eine unübersehbare Lache auf dem rissigen Holzfußboden gebildet hatte. Ich sterbe!, dachte er voller Panik. Um Gottes willen, was ist mit Carol? Ich muss ihr doch helfen, sonst …
Von einem Atemzug zum anderen wurde alles dunkel um ihn. Und aus dieser Finsternis erwachte er niemals wieder.
*
„Tom!“, schrie Carol Buchanan außer sich vor Entsetzen, als sie den Schuss und das dumpfe Poltern im Nachbarraum hörte. Sie ahnte, dass etwas Folgenschweres geschehen war, konnte aber nicht nachsehen. Denn genau in diesem Augenblick wurde die Tür eingetreten, und zwei Apachenkrieger stürmten herein, während ein dritter die Scheibe des Fensters einschlug und mit seinem Gewehr auf die Frau zielte, die angesichts dieser massiven Bedrohung zur Salzsäule erstarrte und nicht mehr wusste, was sie tun sollte.
Der Apache, der Audrey an den Haaren gepackt hatte, trieb das Mädchen in den größeren Raum und hielt ihr sein Messer an die Kehle. Sein Blick war eindeutig, auch wenn er kein einziges Wort zu ihr sprach. Aber in seinen dunklen Augen spiegelte sich eine unverhüllte Drohung wider.
Carol Buchanan zitterte am ganzen Leib und war blass. Feine Schweißperlen hatten sich auf ihrer Stirn gebildet, als sie die Blicke der Krieger auf sich gerichtet fühlte und ahnte, was ihr nun gleich widerfahren würde. Aber noch war es nicht so weit. Ein Apache betrat das Ranchhaus, den die anderen Krieger abwartend anschauten. Dass er der Anführer dieser Mörderbande war, erkannte Carol Buchanan sofort.
„Ich bin Goyathlay“, sagte er mit dunkler Stimme und strengem Blick zu ihr, während außerhalb des Hauses die letzten Schüsse verstummten und die Krieger den Sieg auf ihre Weise feierten. „Die Weißaugen nennen mich Geronimo.“
Als Carol Buchanan diesen Namen hörte, schnürte ihr die Angst fast die Kehle zu. Ihr Herzschlag beschleunigte sich, und ihre Beine begannen zu zittern. Ähnlich erging es ihrer Tochter Audrey, die wieder zu wimmern begann. Aber nur für einen kurzen Moment. Dann versetzte ihr der Apache, der sie fest im Griff hielt, eine schallende Ohrfeige, die das Mädchen sofort wieder verstummen ließ. Sie weinte lautlos, und das war mehr, als eine Mutter wie Carol Buchanan ertragen konnte.
„Was wollt ihr hier? Warum habt ihr uns angegriffen?“, wagte Carol Buchanan den Anführer der Apachen zu fragen. „Wir haben euch nichts getan!“
„Dein Volk hat genügend Verbrechen an unseren Stämmen begangen“, sagte Geronimo und blickte voller Verachtung und Hass auf die Frau. „Es wird Zeit, dass auch ihr dafür büßt. Du wirst es am eigenen Leib erfahren. Wir brennen alles nieder, und das Mädchen nehmen wir mit.“
„Nein“, stammelte Carol Buchanan. „Nicht Audrey! Sie ist alles, was ich noch habe …“
Geronimo winkte ab und gab zwei seiner Krieger ein Zeichen. Die packten daraufhin die schockierte Frau und brachten sie hinaus ins Freie. Ebenso Audrey, die noch nicht einmal von ihrem Vater Abschied nehmen konnte.
Hinter den Hügeln zeichneten sich die ersten hellen Schimmer der Morgenröte ab, während die Krieger auf Geronimos Geheiß mit der Plünderung des Ranchhauses begannen und alles mitnahmen, was ihnen irgendwie von Wert erschien. Das galt auch für das Bunkhouse, in dem die fünf Cowboys gelebt hatten. Alle waren tot. Ihre blutigen Leichen verursachten einen Brechreiz in Carol Buchanans Kehle, als die beiden Krieger sie hinüber zum Stall zerrten. Sie versuchte sich zu wehren und wollte sich noch einmal umdrehen und nach ihrer Tochter Audrey sehen. Aber die Apachen verhinderten dies und stießen sie grob nach vorn.
Carol Buchanan stolperte und fiel unweit des Stalltores hart zu Boden. Draußen erklang eine laute befehlsgewohnte Stimme in einer Sprache, die Carol Buchanan nicht verstand. Laute Schreie und wildes Gelächter wechselten sich immer wieder ab, während die beiden Krieger, die sie zum Stall gezerrt hatten, grinsten. Was sie mit ihr vorhatten, konnte man an ihren gierigen Blicken deutlich erkennen.
Als der erste Krieger sich über sie beugte und das dünne Nachthemd zerriss, schrie die Frau ihre Hilflosigkeit laut heraus. Aber niemand hörte ihr Flehen.
*
„Rauch. Das bedeutet nichts Gutes“, sagte Tyler Banks mit nachdenklichem Blick und schaute zu dem Chiricahua-Scout, der sein Pferd neben ihm gezügelt hatte. Chatos Miene war ausdruckslos. Was er in Wirklichkeit dachte, das wusste nur er.
Die beiden Scouts waren die Vorhut eines größeren Trupps unter dem Kommando von Captain H. W. Lawton, der schon seit mehreren Wochen das Grenzland durchkämmte, auf der Suche nach Geronimo und seinen flüchtigen Apachenkriegern. Aber bisher hatte man weder Spuren noch sonstige Hinweise gefunden, wo sich die Indianer verborgen hielten. Das Land war weit, einsam und von schroffen, teilweise unzugänglichen Gebirgszügen umgeben. Selbst ein größerer Soldatentrupp würde dort nur schwer vorwärtskommen und einen eventuellen Hinterhalt erst dann bemerken, wenn es schon zu spät war.
Zwischenzeitlich waren auch Martine und Ke-e-te-na näher gekommen, zwei loyale Chiricahua-Scouts, die schon unter General Crook gedient hatten. General Nelson A. Miles hatte den größten Teil von Al Siebers Apachenscouts übernommen, weil sie bisher gute Dienste geleistet und auch ganz offen gegen ihr Volk gekämpft hatten.
Eine Blaurock-Uniform zu tragen war keine Schande, wenn man dadurch das eigene Überleben sichern konnte. Denn das Leben in der San Carlos Apache Reservation war hart und unerbittlich. Die Lebensmittelrationen wurden immer knapper, und die Apachen starben durch Entbehrung und Erschöpfung. Deshalb hatten sich viele Krieger dazu entschlossen, die Seiten zu wechseln und die Uniform der Soldaten zu tragen, damit sie wenigstens auf diese Weise ihre Familien ernähren konnten. Dass sie trotzdem nur Mittel zum Zweck waren, würden die meisten von ihnen erst viel später begreifen.
„Dort ist eine Ranch“, sagte Martine, als er die schwarze Rauchwolke am Horizont sah. „Ich war schon einmal dort.“
„Berichte Captain Lawton, dass wir losgeritten sind, um dort nach dem Rechten zu sehen“, entschied Tyler Banks nach kurzem Überlegen.
„Der Rauch bedeutet nicht, dass es keine Gefahr mehr gibt“, meinte Ke-e-te-na zögerlich. „Was ist, wenn Geronimos Krieger nur darauf warten, dass wir näher kommen?“
„Solch ein riskantes Spiel wird dieser alte Halunke nicht wagen“, erwiderte Banks abwinkend. „Der weiß doch ganz genau, dass General Miles 5.000 Soldaten und 500 Indianerscouts aufgeboten hat, um ihn zur Strecke zu bringen. Da wird er kein unnötiges Risiko wagen.“
„Er hat ein Zeichen gesetzt“, ergriff nun Chato das Wort. „Er will uns damit sagen, dass er sich nicht vor uns fürchtet. Auch wenn auf der anderen Seite der Grenze ebenfalls Soldaten darauf warten, ihn zu töten.“
„Du kennst ihn am besten, Chato“, seufzte Banks. „Du warst bei ihm, als er mit Nana und Ulzana das Reservat verlassen hat.“
„Er wird kämpfen bis zuletzt“, sagte Chato und ging dabei nicht auf die letzte Bemerkung ein. „Und es ist ihm egal, ob es 1.000 oder 5.000 Soldaten sind. Ich glaube, dass der Rauch uns nur etwas zeigen will, was wir nicht mehr retten können.“
„Wahrscheinlich“, murmelte Tyler Banks und trieb sein Pferd an. Ke-e-te-na und Chato folgten ihm wenige Augenblicke später, während Martine sein Pferd an den Zügeln herumriss und zurück zu Captain Lawtons Truppe ritt, die sich knapp fünf Meilen weiter nordöstlich befand und dort nach Spuren suchte.
Banks beobachtete die dunkle Rauchwolke und sah auch die kreisenden Vögel am Himmel, als er und die beiden Apachenscouts sich der abgelegenen Ranch näherten. Dichter schwarzer Rauch stieg in den stahlblauen Mittagshimmel empor. Banks, Chato und Ke-e-te-na blickten von einer Anhöhe hinunter ins Tal und erkannten das Bild einer vollkommenen Zerstörung.
Das Ranchhaus war bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die verkohlten Holzreste qualmten noch, ebenso die des angrenzenden Stalles. Die Scheune brannte ebenfalls noch, aber dieses Feuer würde niemand mehr löschen können, denn in dem Augenblick, als Tyler Banks mit den beiden Apachen auf den Ranchhof geritten kam, stürzte eine Scheunenwand ein und begrub alles, was sich darin noch befinden mochte. Funken und schwarzer Qualm stiegen auf und legten sich beißend auf die Atemwege der Männer.
Die Tiere wurden nervös und scheuten vor der Hitze. Banks und die Apachen waren gezwungen, sich ein Stück zurückzuziehen, denn die Hitze setzte ihnen unerträglich zu. Chato war indessen abgestiegen, drückte wortlos die Zügel Ke-e-te-na in die Hand und begab sich mit dem Gewehr in der Hand hinüber zu dem Corral, wo zwei tote Pferde lagen. Der Gestank von Tod und Blut war überall zu spüren.
Banks Züge wurden angespannter, als er in unmittelbarer Nähe des verkohlten Bunkhouse einige reglose Körper liegen sah. Es waren drei Männer, und sie trugen kaum etwas am Leibe. Der Überfall musste sie so plötzlich aus dem Schlaf gerissen haben, dass sie keine Zeit mehr hatten, sich gegen den Apachenangriff zur Wehr zu setzen. Sie waren einfach abgeschlachtet worden, und Geronimos Krieger hatten dabei ganze Arbeit geleistet.
Die Hitze war noch so stark, dass Banks sich dem Ranchhaus nicht nähern konnte. Aber egal, wer sich im Innern noch aufgehalten haben mochte, lebte bestimmt nicht mehr. Denn die alles verzehrenden Flammen hatten das vernichtet, was die Apachen nicht mitgenommen hatten.
„Banks!“
Chatos Ruf riss den Scout aus seinen Gedanken. Er wandte sich um und sah Chato bei den herausgerissenen Corralstangen stehen. Chato hatte die linke Hand erhoben und winkte ihm zu, rasch näher zu kommen. Währenddessen beobachtete Ke-e-te-na das Umfeld der Ranch. Seine Miene wirkte sehr angespannt, und es bedurfte keiner großen Fantasie, um sofort zu erkennen, wie unwohl sich der Chiricahua in diesem Augenblick fühlte. Er hatte Angst davor, Geronimo und seinen Kriegern in die Hände zu fallen. Denn er wusste, was dann mit ihm geschehen würde. Er hatte sein Volk verraten und trug die Uniform der Blaurock-Soldaten!
Chato zeigte auf ein Gebüsch neben dem Corral und eilte voraus. Dort angekommen beugte er sich über eine Gestalt.
Banks fluchte, als er erkannte, dass es eine Frau war. Sie trug nur noch Fetzen am Leib, und ihr Gesicht war schlimm zugerichtet. Sie hatte eine stark blutende Wunde im Oberkörper, und ihr Blick war eine Mischung aus Angst und Verwirrung, als sie zunächst Chato sah.
„Nein …“, murmelte sie und versuchte sich erneut zu wehren, da sie annahm, dass sich ihr Martyrium fortsetzen würde. Erst als Banks in ihr Blickfeld kam, schien die Angst zu weichen.
„Die Apachen sind weg“, sagte Tyler Banks, während er neben ihr kniete und einen besorgten Blick auf die Wunde richtete. Es sah nicht gut aus. Es grenzte schon fast an ein Wunder, dass die Frau überhaupt noch am Leben war.
„Mein Mann …“, stammelte die Frau und versuchte hinüber zu dem verkohlten Ranchhaus zu schauen. Aber sie konnte nur kurz den Kopf heben, dann fiel sie ermattet wieder zurück. „Was ist mit ihm? Ist er …?“
„Ich fürchte ja, Ma’am“, erwiderte Banks. „Hier lebt niemand mehr.“
„Audrey“, murmelte die Frau. „Sie haben … meine Tochter Audrey mitgenommen. Was werden … sie ihr antun?“
„Was genau ist geschehen?“, fiel ihr Banks ins Wort, weil er erkannte, dass der schwer verletzten Frau nicht mehr viel Zeit blieb. „Erzählen Sie es. Jede Einzelheit kann wichtig sein.“
„Geronimo“, keuchte die Frau. „Ich habe … diesen Teufel gesehen. Er nannte mir … seinen Namen, bevor mich diese Schweine …“
Ein Hustenanfall unterbrach kurz die Schilderung der Frau. Blut trat dabei über ihre Lippen. Sie wusste genau, dass sie nicht länger am Leben bleiben würde. Deshalb schaute sie Tyler Banks flehend an. „Sie müssen … Audrey suchen, Mister“, murmelte sie mit immer schwächer werdender Stimme. „Versprechen Sie mir das. Sie darf … nicht von den Apachen …“
Ihre Augen weiteten sich, während sie mit der rechten Hand nach Banks Arm griff. Dann fiel sie zurück und atmete nicht mehr. Die Angst um ihre Tochter hatte noch im Tode Spuren in ihrem misshandelten Gesicht hinterlassen.
Banks fluchte leise, als er sich erhob und Chato dabei anschaute. „Was glaubst du, was Geronimo mit dem Mädchen macht?“
„Die Antwort kennst du, Banks“, sagte der Chiricahua-Scout. „Er wird das Mädchen einem seiner Krieger geben. Und wenn sie ihm nicht gehorcht, dann lebt sie nicht lange. Willst du das Mädchen befreien?“
„Ja“, antwortete Banks auf die Frage und erntete dafür nur ein Kopfschütteln Chatos. Ganz zu schweigen vom wütenden Blick Ke-e-te-nas, dem der Vorschlag des weißen Scouts ganz und gar nicht behagte.
„Wir sollten besser warten, bis die anderen Soldaten hier sind“, fügte Chato hinzu. „Wir drei können gegen Geronimo und seine Krieger gar nichts ausrichten, auch wenn dich der Gedanke beunruhigt, was mit dem Mädchen ist. Wenn sie am Leben bleiben will, dann tut sie besser das, was man ihr befiehlt.“
Im ersten Augenblick lag Tyler Banks eine heftige Erwiderung auf der Zunge. Aber dann überlegte er es sich im letzten Moment doch noch anders und schluckte seinen Zorn herunter. Seufzend erhob er sich und blickte noch einmal auf die tote Frau. Sie und ihre Familie hatten einen hohen Preis dafür bezahlen müssen, dass sie so weit abseits von Tucson oder Tombstone in der Abgeschiedenheit dieser kargen und öden Landschaft lebten, nur um Rinder oder Pferde zu züchten und davon zu leben. Das Schicksal hatte jedoch eine andere Entscheidung getroffen.
„Der Captain und seine Leute kommen!“, rief Ke-e-te-na mit sichtlicher Erleichterung und zeigte mit seinem Gewehr in die betreffende Richtung.
Banks erhob sich und zog seinen Hut etwas tiefer in die Stirn, weil er genau in die grelle Mittagssonne blickte. Dann erkannte er die Staubwolke, aus der sich die Konturen der ersten blau uniformierten Reiter abzeichneten. Martine, der zweite Chiricahua-Scout, hatte rasch gehandelt und Captain Lawtons Soldaten auf dem schnellsten Wege hierhergeführt.
Lawton war ein erfahrener Soldat. Deshalb schickte er sofort jeweils vier Soldaten los, die das umliegende Gelände im Blickfeld behalten sollten, während er ebenfalls weitere sechs Männer als Wachposten abstellte. Er wusste genau, was er tat, und Banks respektierte dieses umsichtige Verhalten.
Captain Lawton zählte nicht zu den unerfahrenen Offizieren, die man ins Grenzland schickte, um sich dort zu bewähren. Er hatte schon unter General Crook einige Jahre gedient und gegen die Apachen mehrmals gekämpft. Deshalb hatte ihn General Miles auch mit dieser Mission betraut und ihn eine Truppe aufstellen lassen, die nur ein Ziel vor Augen hatte – Geronimo zu finden und zu besiegen.
„Die Apachen haben ganze Arbeit geleistet, Captain“, sagte Tyler Banks. „Alle sind tot … bis auf die Tochter der Rancherfamilie …“
Er schilderte dem Offizier kurz, was er von der Frau erfahren hatte. Lawtons Stirn zog sich in Falten, als er das hörte. Ihm war klar, dass das Mädchen nicht ihrem Schicksal überlassen werden durfte, auch wenn dies ein erhöhtes Risiko für ihn und seine Soldaten bedeutete. Unter Umständen hatte Geronimo diese Entführung bewusst vorgenommen, um die verhassten Blaurock-Soldaten in einen Hinterhalt zu locken.
Captain Lawton hörte schweigend zu. Er schien einen kurzen Moment nachzudenken und traf eine Entscheidung.
„Wir verfolgen sie“, sagte er. „Das ist eine Spur, zum ersten Mal seit Wochen. Wir müssen Geronimos Mörderbande erwischen. Und diesmal werden sie uns nicht entkommen. Das schwöre ich!“
Die Wut darüber, dass es dem Captain und seinen Soldaten trotz aller bisherigen Bemühungen nicht gelungen war, Geronimos Versteck ausfindig zu machen, spiegelte sich in seinen Gesichtszügen wider.
„Reiten Sie mit Chato voraus, Mister Banks“, befahl Lawton. „Suchen Sie nach weiteren Spuren, aber riskieren Sie nichts. Sobald Sie etwas bemerken, kommen Sie sofort wieder zurück. Erst dann wird entschieden, was zu tun ist.“
„Natürlich, Sir“, meinte Tyler Banks daraufhin. Er wollte ohnehin nicht dabei sein, wenn die Soldaten die Toten unter die Erde brachten. Deshalb war er erleichtert darüber, mit Chato diese Stätte des Todes endlich verlassen zu können.
Kapitel 2
Audrey Buchanans Gedanken ließen sie fast verrückt werden. Immer wieder schaute sie verzweifelt zum Horizont, während die schrecklichen Bilder der niedergebrannten Ranch vor ihrem geistigen Auge auftauchten. Das Letzte, was sie von ihrer Mutter gehört hatte, waren die schrecklichen Schreie aus der Scheune. Aber in diesem Augenblick hatte sie einer der Krieger einfach gepackt, auf ein Pferd gesetzt, ihr die Beine unter dem Bauch des Tieres gefesselt und sie mit Lederriemen so fest gebunden, dass sie ihre Fingerspitzen nicht mehr spürte. Das Gefühl einer ständigen Taubheit breitete sich immer weiter aus, aber ihre flehenden Bitten blieben ungehört. Die Krieger lachten und amüsierten sich über ihre Hilflosigkeit.
Audrey hatte wieder zu weinen begonnen. Ihr Schluchzen war jedoch in dem Moment verstummt, als Geronimo zu ihr geritten kam und sie drohend anschaute. Es hatte keiner weiteren Worte bedurft, um Audrey klarzumachen, dass ihr weiteres Schicksal an einem sehr dünnen Faden hing. Es lag einzig und allein an ihr, was sie daraus machte. Das hatte sie verstanden.
Die Apachenkrieger ritten weiter in die Wüste hinein. Audrey hatte bemerkt, dass drei Krieger zurückgeblieben waren. Zuerst hatte sie gar nicht verstanden, was die Krieger beabsichtigten, aber dann war ihr aufgefallen, dass selbst dieses Vorhaben dazu diente, um die Suche der Verfolger zu erschweren.
Mithilfe einiger Büsche, welche die Krieger an den Schweifen ihrer Pferde mit Lederriemen festgebunden hatten, gelang es ihnen, die Hufabdrücke zu verwischen, sodass es den Verfolgern schwerfallen würde, ihnen zu folgen.
Sie würden ohnehin bald felsiges Gelände erreichen, und dann würde es noch problematischer für die Verfolger werden.
Audreys Hoffnung auf baldige Hilfe sank auf ein Minimum herab, als sie beobachtete, wie geschickt die Apachen dabei vorgingen. Sie hatte aus verschiedenen Erzählungen und Berichten gehört, dass die Apachen die eigentlichen Herren dieser kargen Region gewesen waren, bevor die ersten Weißen mit dem Errichten von Ansiedlungen und dem Bau von Poststraßen begonnen hatten. Kurz darauf begannen die ersten Auseinandersetzungen, und der Kampf auf beiden Seiten war so unerbittlich geworden, dass die Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden schließlich in weite Ferne rückte.
Dem Chiricahua-Häuptling Cochise war es schließlich gelungen, einen Waffenstillstand und anschließenden Frieden mit den Weißen auszuhandeln, aber das lag schon lange zurück, und Cochise lebte nicht mehr. Er war 1874 in den Dragoon Mountains gestorben, und zu diesem Zeitpunkt war Audrey gerade mal zwei Jahre alt gewesen. Cochise kannte sie nur durch die Erzählungen ihrer Eltern.
Audreys Gedanken kehrten schließlich wieder in die Wirklichkeit zurück, als der Durst so groß wurde, dass sie einen der neben ihr reitenden Apachen um etwas zu trinken bat. Der aber grinste nur verächtlich. Es blieb Audrey nichts anderes übrig als so lange durchzuhalten, bis die Sonne so weit nach Westen gerückt war, dass sich die Apachen dazu entschlossen, zwischen einer Gruppe von schützenden Felsen ein Lager zu errichten.
Jemand löste Audrey die Fußfesseln. Aber nur so lange, bis sie vom Pferd gehoben wurde und auf dem Boden stand. Der Krieger zwang sie, niederzuknien, und dann fesselte er ihre Füße sofort wieder. Audrey konnte nur ganz kleine Schritte gehen, und deshalb stolperte sie, als der Apache sie grob mit sich riss. Sicher wäre sie gestürzt, wenn der Krieger das nicht im letzten Moment verhindert hätte. Er packte sie und deutete ihr mit einer unmissverständlichen Geste an, sich hinzusetzen und sich nicht von der Stelle zu rühren.
Audrey tat, was man ihr befohlen hatte und blickte sich ängstlich um. Die Apachen ließen sich nieder, aßen und tranken und taten so, als gäbe es überhaupt keine Gefahr, mit der sie rechnen mussten – und das, obwohl zu beiden Seiten der Grenze Hunderte von Soldaten, Freiwilligen und Spähern schon längst auf ihrer Fährte waren.
Sie zuckte zusammen, als sie Geronimos Blicke bemerkte. Der Anführer der Apachen, den die Weißen mit einem Teufel verglichen, erhob sich und trat zu ihr. In der Hand hielt er einen Beutel aus Leder. Er schaute sie wortlos an, während er den Verschluss öffnete und ihr den Beutel an den Mund hielt.
Audrey schluckte gierig das lauwarme Wasser, das ihr Geronimo zu trinken gab. Dieses belebende Gefühl hielt nur wenige Sekunden an, da er den Beutel sofort wieder verschloss.
„Das muss reichen“, sagte er.
„Danke“, murmelte Audrey und konnte den stechenden Blick des Apachen nur kurze Zeit ertragen. Deshalb wich sie ihm aus.
„Du wirst das Leben bald vergessen, das du gekannt hast“, sagte Geronimo. „Bald wirst du eine von uns sein und unserem Volk neues Leben schenken.“
Deutlicher hätte er das, was Audrey erwartete, nicht sagen können. Das Mädchen wurde blass, und die Angst vor einem schrecklichen Leben, das für sie keines war, nahm immer mehr zu. Erneut zeichneten sich Tränen in ihren Augenwinkeln ab. In diesem Moment zog Geronimo sein Messer und hielt ihr die scharfe Klinge direkt vor das Gesicht. Da wusste Audrey, dass es besser war, keine Emotionen mehr zu zeigen, denn dies wurde von den Apachen als Schwäche ausgelegt. Und wer schwach war, der bekam in diesem unbarmherzigen Land keine Überlebenschance.
Auch wenn Audrey Buchanan erst 16 Jahre alt war, so begriff sie auf diese Weise, wie es wirklich um sie stand. Und der Gedanke, überleben zu wollen, überlagerte die Trauer und den Schmerz des Verlustes ihrer Eltern.
Sie sah, wie sich Geronimo von ihr abwandte und zu den anderen Kriegern ging. Er sagte etwas zu ihnen, schaute dabei zu Audrey, und die Apachen lachten. Audrey wusste nicht, um was es genau ging, aber dass man über sie spottete, hatte sie verstanden. Je länger sie darüber nachdachte, wie groß eigentlich die Chancen waren, wieder in die ihr bekannte Zivilisation zurückzukehren, umso rascher wurde ihr klar, dass dies nur noch ein Wunder bewirken konnte.
*
Tyler Banks wischte sich mit der linken Hand den Schweiß von der Stirn und setzte den breitkrempigen Hut auf. Die Sonne brannte vom Himmel und ließ das Land, das sich vor seinen und Chatos Blicken ausbreitete, vor Hitze erstarren. Kein Lüftchen regte sich, und die geringste Bewegung sorgte dafür, dass Banks erneut zu schwitzen begann.
Er hatte Durst, aber er musste mit seinem Wasservorrat sorgsam umgehen. Denn eins hatte er in den Jahren gelernt, seit er unter General Crook und General Miles als Scout diente, Wasser war ein kostbares Gut in dieser Region. Es konnte Leben retten, wenn es benötigt wurde, und man konnte sterben, wenn die Wasservorräte zu Ende gingen und eine Quelle weit entfernt war. Die Apachen kannten solche Orte, an denen man Wasser finden konnte. Deshalb hatten sie in dieser Wildnis auch überleben können.
Banks öffnete seine Canteen, nahm einen kleinen Schluck und spülte seine Mundhöhle aus, bevor er es schließlich schluckte. Das Wasser schmeckte abgestanden, aber es war immer noch besser, als gar nichts zu trinken.
Chato war dagegen viel gelassener und ruhiger als Banks. Er ignorierte die drückende Hitze, als würde sie gar nicht existieren, und senkte immer wieder seine Blicke auf den steinigen Boden. Vor einer halben Stunde noch waren die Spuren viel besser und deutlicher zu erkennen gewesen. Es war schwer, die Fährte zu erkennen. Man konnte nur noch mutmaßen, ob Geronimo und seine Krieger auch weiterhin dieser Richtung in die Berge folgten.
„Sie haben ihre Spuren verwischt“, meinte Chato und zeigte auf einen der hier wachsenden Kreosotbüsche. „Geronimo weiß, was er tut. Weiter oben in den Felsen gibt es zahlreiche Wege, die sie einschlagen können und von dort oben jeden Verfolger beobachten.“
„Was sollen wir tun?“, fragte ihn Banks. „Wenn wir jetzt zu Captain Lawton zurückkehren und ihm berichten, dass wir Geronimos Fährte verloren haben, dann wird er toben.“
„Wütend zu sein ist immer noch besser als zu sterben“, kommentierte Chato Banks Ängste in seiner lakonischen Art. „Ich kenne die Berge sehr gut, Banks. Eine ganze Armee von Blauröcken wird einen Kampf gegen Geronimo dort nicht gewinnen können. Ich glaube, sie ziehen sich nach Mexiko zurück und warten dort ab, bis alles wieder ruhig geworden ist.“
„Und du glaubst, dass dieser Überfall auf die Ranch nur aus einer Laune heraus erfolgte?“
Tyler Banks blieb skeptisch. Aber Chatos anschließende Antwort brachte ihn noch mehr ins Grübeln.
„Geronimo will euch allen zeigen, dass er jederzeit wieder Weißaugen töten kann, wenn er es will, Banks. Er fühlt sich sicher in den Bergen. Und die Mexikaner fürchten ihn noch mehr als deine Leute.“
„Aber irgendwann wird er einen Fehler machen, Chato“, behauptete Banks. „Der Ring aus unserer Armee und mexikanischen Soldaten wird sich immer enger um ihn schließen, und eines Tages kann er nicht mehr flüchten, sondern muss sich ergeben.“
„Das kann noch Wochen dauern“, sagte Chato. „Und in dieser Zeit wird er weiter rauben und töten.“
„Ist er so verbittert?“
„Du weißt doch, was mit seiner ganzen Familie geschehen ist, als er noch jung war“, erwiderte Chato und erinnerte den Scout an den feigen Mord an Geronimos Verwandten. Diese damaligen Ereignisse hatten den Apachen geprägt und den Hass auf die Weißaugen zu seinem ständigen Begleiter gemacht. „Er wird sich nicht mehr ändern, Banks. Er geht den Weg eines Kriegers … bis zum Ende. Cochise wollte zum Schluss den Frieden, weil er keine andere Chance mehr hatte. Aber Geronimo kennt nur diesen einen Weg.“
„Dieser Weg führt ihn nur in den Tod“, sagte Banks und ritt weiter, während er sich noch einmal kurz zu Chato umdrehte. „Und das weiß dieser Kerl ganz genau. Er sollte viel lieber an die Frauen und Kinder denken, die bei ihm und seinen Kriegern sind. Das hat dich doch letztendlich auch dazu bewogen, aufzugeben …“
„Ich wäre bei Geronimo geblieben“, sagte Chato. „Aber ich habe daran gedacht, dass unser Volk überleben muss. In Frieden und ohne Krieg. Noch glaube ich daran. Wenn ich nicht mehr daran glaube, dann werde ich aus San Carlos weggehen.“
„Ich verstehe dich gut, Chato.“
„Würdest du mich aufhalten?“
Banks zögerte mit einer Antwort. Das sagte Chato genug.
„Lass uns nicht weiter über Dinge reden, von denen wir nichts wissen“, schlug Banks schließlich vor. „Captain Lawton hat uns einen Auftrag erteilt, und nur das zählt jetzt.“
Chato schwieg.
*
Kurz vor Sonnenaufgang kam einer der Späher zurück ins Lager und weckte Geronimo. Was er zu berichten hatte, waren keine guten Nachrichten.
„Viele Reiter!“, stieß der Apache hervor. „Sie kommen von Süden.“
„Sind es mexikanische Soldaten?“, fragte Geronimo sofort.
„Ich glaube nicht“, sagte der Krieger. „Sie sind noch zu weit entfernt, als dass ich Genaues erkennen konnte. Aber sie reiten genau auf die Berge zu. In ein oder zwei Stunden werden sie hier sein.“
„Führe mich dorthin, wo du die Reiter gesehen hast“, verlangte Geronimo.
Der Apache nickte, ging zurück zu seinem Pferd und wartete, bis sich auch Geronimo auf den Rücken seines Tieres geschwungen hatte. Der Späher ritt voraus, und Geronimo folgte ihm.
Eine knappe halbe Stunde später erreichten sie ein hoch gelegenes Felsplateau, von wo aus man einen guten Überblick über das Tal hatte.
Geronimo sah die Staubwolke im Süden – und die Reiter. Sie trugen zwar große breitkrempige Hüte, aber keine Uniformen. Also waren es mexikanische Zivilisten, aber keine Soldaten. Das ließ Geronimo hoffen. Innerhalb weniger Sekunden legte er sich einen Plan zurecht, während er den Reitertrupp weiter beobachtete und dabei zählte, um wie viele Gegner es sich überhaupt handelte. Er kam auf 70 Reiter, alle waren bewaffnet.
„Wir werden sie aufhalten“, sagte Geronimo. „Sollen sie ruhig glauben, dass sie uns besiegen können.“
„Wo werden wir sie angreifen?“, fragte der Krieger, dem man die Vorfreude über einen bald beginnenden Kampf schon ansehen konnte.
„Dort wo sich unser Lager befindet“, antwortete Geronimo. „Man findet es erst, wenn man schon fast dort ist. Und viele Felsen verbergen es vor den Blicken unserer Gegner. Der Weg weiter unterhalb ist steil. Die Mexikaner werden nur langsam vorankommen. Dort werden wir auf sie warten.“
„Sie werden alle sterben“, sagte der Krieger und sah, wie ihm Geronimo mit einem kurzen Wink andeutete, dass es an der Zeit war, sich zurückzuziehen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Kurze Zeit später erreichten sie das Lager, und Geronimo unterrichtete seine Kriegern über seinen Plan.
Es gab keinen unter den Apachen, der diesen Entschluss nicht mit großer Genugtuung aufnahm. Denn gerade die Mexikaner hatten den verschiedenen Apachenvölkern in der Vergangenheit schwer zugesetzt und sogar Skalpjäger losgeschickt. Geronimo hatte nicht vergessen, was für ein Unrecht in all den Jahren seinem Volk zugefügt worden war. Nun bot sich endlich wieder eine Gelegenheit, um sich für diese blutigen Morde zu rächen!
Er teilte die Krieger ein und ließ sie verschiedene Positionen unweit des Felseneinschnittes einnehmen, an dem der Weg bergauf entlangführte. Einer der Apachen ging auf Geronimos Befehl zu dem Mädchen und knebelte es. Audrey sollte keine Gelegenheit haben, um Hilfe rufen zu können. Denn die Mexikaner sollten ahnungslos in die Falle tappen.
*
Sie wusste, dass etwas nicht stimmte, und konnte sich nicht erklären, warum das so war. Audrey bemerkte nur, dass Geronimo und seine Apachenkrieger auf einmal eine eigenartige Hektik an den Tag legten. Aber erst als einer der grinsenden Indianer ihr einen Knebel verpasste, ahnte sie, dass man sie daran hindern wollte, mit einem lauten Hilfeschrei auf sich aufmerksam zu machen.
Der Apache ging sehr grob mit ihr um und amüsierte sich über ihre augenblickliche Hilflosigkeit. Er vergewisserte sich noch ein letztes Mal, dass die Fesseln des Mädchens auch fest saßen, dann nahm er ebenfalls sein Gewehr und postierte sich gut 10 Yards von Audrey entfernt etwas oberhalb hinter einem Felsen. Auch er schien von Geronimo genaue Anweisungen bekommen zu haben – und das verhieß nichts Gutes.
Dutzende von Gedanken gingen ihr durch den Kopf, während sie in der Ferne das Donnern von Hufschlägen hörte. Es mussten viele Reiter sein, und sie näherten sich der Stelle, wo sich die Apachen verborgen hielten.
Die Soldaten können doch nicht einfach in eine Falle reiten, dachte Audrey verzweifelt. Sie müssen Späher losschicken, die das Gelände erkunden, um sich vor unliebsamen Überraschungen zu schützen …
Die Aufregung und die Sorge um das, was sicher geschehen würde, quälten sie. Aber was hätte sie denn tun sollen, um das zu verhindern? Sie konnte sich ja selbst kaum vom Fleck rühren, und warnen konnte sie die Reiter auch nicht. So blieb ihr nichts anderes übrig, als darauf zu hoffen, dass die Falle doch nicht zuschnappen würde.
Aber diese Hoffnung war vergebens. Nur wenige Augenblicke später fielen die ersten Schüsse, und die triumphierenden Schreie der Apachen ließen keinen Zweifel daran, dass Geronimos Plan funktioniert hatte. Einige der Krieger bekamen Feuerschutz von ihren Gefährten und stürzten sich todesmutig in das Kampfgetümmel, von dem Audrey von ihrer Position aus kaum etwas mitbekam. Sie sah nur eine Staubwolke jenseits der Felsen, hörte schmerzerfüllte Schreie und weitere Schüsse.
Kurz darauf galoppierte ein Pferd nur wenige Yards unterhalb der Felsen vorbei. Der Reiter schwankte stark im Sattel und schien verletzt zu sein. Als Audrey erkannte, dass es sich bei dem Mann nicht um einen Amerikaner, sondern um einen Mexikaner handelte, sah sie, wie dieser das Gleichgewicht verlor und vom Pferd fiel. Er prallte hart auf dem steinigen Boden auf und blieb benommen liegen.
Als er sich wieder aufrappeln und rasch Deckung suchen wollte, erwischte ihn der Apache, der Audrey bewachte, mit einem gezielten Schuss. Die Kugel traf den Mexikaner in die Brust und stieß ihn zurück. Danach rührte er sich nicht mehr.
Ein weiterer Mexikaner kam den Weg entlanggeritten und suchte sein Heil in der Flucht. Im Gegensatz zu seinem Kameraden hatte er den ersten Schusswechsel überlebt und suchte nur noch nach einer Chance, sein eigenes Leben zu retten. Seine Companeros dagegen wurden von allen Seiten attackiert. Die lauten Todesschreie signalisierten ihm, dass er noch längst nicht außer Gefahr war.
Wahrscheinlich hielt in diesen entscheidenden Sekunden ein Schutzengel seine unsichtbare Hand über ihn und rettete ihn vor dem Tod. Denn er bemerkte rechtzeitig die Gestalt des Apachen, der sich hinter dem Felsen erhob und mit dem Gewehr genau in seine Richtung zielte. Geistesgegenwärtig duckte sich der Mexikaner im Sattel und entging dadurch so der ersten Kugel, die ihm der Krieger verpassen wollte.
Zu einem zweiten Schuss kam der Apache nicht mehr, denn der Mexikaner war im entscheidenden Moment schneller als sein Gegner. Er traf den Krieger und sah ihn wanken. Das reichte für ihn aus, um seine Flucht ungehindert fortsetzen zu können. Die gefesselte Audrey nahm er in diesen Sekunden nicht wahr. Sein eigenes Leben war ihm mehr wert als alles andere.
Grenzenlose Wut ergriff Audrey bei dem Gedanken, dass der Mexikaner zwar einen der Apachen getötet hatte, ihr aber dennoch nicht half. Vielleicht hatte er sie wirklich nicht bemerkt, aber selbst, wenn dies der Fall gewesen wäre, blieb die Ungewissheit darüber, wie sich der Mann wirklich verhalten hätte.
Audrey hörte die Schüsse und die triumphierenden Kriegsschreie der Apachen, auf einmal begriff sie, welche Chance ihr das Schicksal zugespielt hatte.
Der indianische Wachposten lag nur wenige Yards von Audrey entfernt, er rührte sich nicht mehr. Audrey versuchte aufzustehen, so gut es die Fesseln zuließen. Sie konnte nur ganz kleine Schritte machen, um die Stelle, wo der tote Krieger lag, zu erreichen. Sein Gesicht war im Tode erstarrt, aber Audreys Interesse galt nur dem Messer, das der Apache bei sich trug.
Sie wusste, dass ihr nicht viel Zeit blieb, deshalb beeilte sie sich. Sie kniete neben dem toten Apachen nieder und versuchte, mit ihren auf den Rücken gefesselten Händen, das Messer zu ertasten, das der Krieger am Ledergürtel bei sich trug. Schweiß trat ihr auf die Stirn, als es ihr nicht gleich beim ersten Versuch gelang. Trotzdem gab sie nicht auf und machte weiter.
Die Angst vor ihrem weiteren Schicksal verlieh ihr zusätzliche Kräfte. Schließlich umfasste sie das Messer mit beiden Händen und versuchte es so zu drehen, dass die Klinge nach oben gerichtet war. Damit bemühte sie sich, die Lederriemen durchzuschneiden. Das war alles andere als eine leichte Aufgabe. Tränen der Wut liefen ihr die Wangen herunter, als die scharfe Klinge ihre Haut verletzte und Blut hervortrat, aber das Leder war immer noch gespannt und ihre Bemühungen schienen von keinem Erfolg gekrönt zu sein.
Ausgerechnet in diesem Moment wurde ihr bewusst, dass das Gewehrfeuer nachgelassen hatte. Der Kampf näherte sich dem Ende, und die Apachen schienen die Sieger zu sein. Sie stellte sich vor, was dies für sie bedeutete und strengte sich noch einmal an. Den brennenden Schmerz der blutenden Wunde ignorierte sie und bewegte die Messerklinge weiter auf und ab. Eine Ewigkeit schien es zu dauern, bis sie endlich einen Ruck spürte und der Lederriemen nachgab.
In Windeseile löste sie ihre Fußfesseln und stieß einen Freudenschrei aus, da sie sich befreien konnte. Keiner der Apachenkrieger war in der Nähe gewesen, um sie daran zu hindern.
Nur weg von hier, dachte Audrey und erhob sich rasch. Sie rannte einfach los und verschwand zwischen den Felsen. Dahinter befand sich unübersichtliches Gelände – und ein Weg, der in einen Canyon mündete.
Ihr Überlebensinstinkt steuerte ihr weiteres Denken und Handeln, während die Schüsse hinter ihr gänzlich verstummten. Da wusste sie, dass ihr nur noch wenig Zeit blieb, um ein Versteck in diesem Felsenlabyrinth zu finden. Wenn die Apachen sie vorher zu fassen bekamen, dann bedeutete dies ihr Ende. Denn Geronimo würde sie hart dafür bestrafen, dass sie geflohen war.
Audrey hastete weiter und blickte kurz hinter sich. Es schien noch keiner der Apachen ihre Flucht bemerkt zu haben. Doch das konnte sich sehr schnell ändern. Noch bevor sie diesen Gedanken zu Ende gebracht hatte, erklang ein wütender Schrei, und ein Schuss fiel. Audrey lief so schnell sie konnte weiter und erreichte binnen kürzester Zeit die schützenden Felsen. Gehetzt blickte sie um sich und suchte nach einem geeigneten Versteck. Das war eine fast unlösbare Aufgabe, denn sie wusste ja mittlerweile, dass die Apachen Meister darin waren, Spuren zu verwischen – aber auch wiederzufinden.
Das Herz schlug ihr fast bis zum Hals, als sie sich einem Geröllhang näherte. Sie blickte sich noch einmal um, konnte aber keinen Apachen erkennen. Audrey entdeckte einen kleinen Einschnitt im Fels, der als Zugang in eine Höhle führte. Das war die Chance, auf die Audrey gewartet hatte, und es war die einzige, die ihr noch blieb, um ihren Verfolgern letztendlich zu entkommen.
Sie zwängte sich durch den Eingang, blieb still liegen und wartete ab, was weiter geschah. Sie bewegte sich kaum und atmete ganz flach. Aus lauter Angst, dass man sie doch noch hören konnte, falls sich einer ihrer Verfolger ganz in der Nähe befand.
Audreys Hände zitterten, als sie außerhalb der Höhle wütende Stimmen hörte. Die darauf folgenden Geräusche konnte sie nicht klar identifizieren. Zumindest erschien es ihr, als ob sich die Apachen nicht in unmittelbarer Nähe ihres Verstecks aufhielten. Aber selbst das war keine Garantie dafür, dass Audrey in ihrem Versteck auch weiterhin sicher sein konnte, um nicht entdeckt zu werden.
Audrey glaubte, die Stimme Geronimos zu hören, der seinen Kriegern die Anweisung gab, die nähere Umgebung ganz genau abzusuchen. Audrey presste sich gegen die raue Felswand und faltete ihre Hände zu einem stillen Gebet, in der Hoffnung nicht entdeckt zu werden. Aber selbst dieses Hoffen hätte wahrscheinlich nichts genützt. In diesen wenigen, aber entscheidenden Minuten stand dem Mädchen das Glück zur Seite. Dies lag nicht daran, dass die Apachen ihre Spur nicht entdeckten, sondern daran, dass Dinge eingetreten waren, mit denen niemand gerechnet hatte. Das wusste Audrey jedoch nicht. Sie hörte nur, dass die Stimmen der Apachen leiser wurden, und schloss daraus, dass sich die Krieger aus dem Canyon zurückzogen.
Trotzdem blieb Audrey noch in der kleinen Höhle und rührte sich nicht von der Stelle. Weil sie Angst hatte, dass dies vielleicht nur ein Trick der Apachen war, damit sie in letzter Minute doch noch einen Fehler beging und durch Leichtsinnigkeit ihr Versteck verriet.
Nein, dachte Audrey. Ich bleibe hier. Egal wie lange es noch dauern mag. Aber sie werden mich nicht finden. Ich muss abwarten, bis es dunkel wird …
Allmählich löste sich die innere Anspannung, und dem Mädchen wurde bewusst, wie knapp sie einem schlimmen Schicksal hatte entrinnen können. Als sie jedoch wieder die grausamen Bilder des Überfalls in ihrer Erinnerung aufrief, weinte sie leise.
*
Tyler Banks sah die kreisenden Vögel in der flimmernden Hitze des Nachmittags. Er schaute zu Chato. Der Blick des Chiricahua war eindeutig. Auch er hatte begriffen, was dieses Zeichen bedeutete. Die Wüstenvögel waren immer dann zur Stelle, wenn kurz vorher der Tod zugeschlagen hatte.
„Wir sollten abwarten, bis Captain Lawton und seine Soldaten hier sind“, meinte Chato, nachdem er sein Pferd gezügelt hatte und sorgsam das nähere Umfeld der Scouts beobachtete. Banks wusste, dass Chato gute Augen hatte und Dinge registrierte, die manchmal von entscheidender Bedeutung sein konnten.
„Glaubst du nicht, wir sollten besser …?“
„Dafür ist es zu spät, Banks“, unterbrach ihn Chato. „Die Geier kommen erst dann, wenn sich kein Leben mehr am Boden regt.“
„Eine Ranch existiert da draußen aber nicht“, grübelte Banks. „Trotzdem muss es einen Kampf gegeben haben.“ Er kratzte sich nervös über das stoppelige Kinn. „Die Grenze ist nicht weit. Vielleicht hat es einen Zusammenstoß mit mexikanischen Soldaten gegeben und …“
In diesem Augenblick fiel ein Schuss. Die Kugel pfiff an Chatos Kopf haarscharf vorbei. Geistesgegenwärtig riss Chato sein Pferd herum und duckte sich im Sattel, während Banks seinen Revolver aus dem Holster riss und sich erschrocken umblickte. Wieder schoss jemand – aber immer auf Chato, der ebenfalls das Feuer erwiderte, nachdem er hastig abstiegen war und das Pferd verstört davongaloppierte.
Chato schaute zu Banks und zeigte mit seiner Waffe in die Richtung, aus der die beiden Schüsse gekommen waren. Banks reagierte sofort und dirigierte sein Pferd hinter einige Büsche. Er stieg ab, band die Zügel des Tieres an einem Strauch fest und näherte sich der Stelle, wo sich der unbekannte Heckenschütze befinden musste.
Mit vorgehaltener Waffe näherte er sich vorsichtig dem Gegner, während er noch kurz hinüber zu Chato schaute. Aber der Chiricahua war schon nicht mehr zu sehen. Er war ebenfalls im Begriff, sich an den Gegner heranzuschleichen. Und wenn ein Apache das tat, dann geschah dies blitzschnell.
Banks versuchte, sich so leise wie möglich zu verhalten. Noch immer war nichts von dem unbekannten Schützen zu sehen. Es herrschte mittlerweile eine fast gespenstische Stille, weil keine weiteren Schüsse mehr fielen. Der Mann wartete ab, bis Chato oder Banks einen Fehler machten. Aber das würde nicht geschehen. Der Scout und der Chiricahua wussten genau, wie sie sich in solch einer Situation zu verhalten hatten.
Banks war nur noch knapp 10 Yards von der Stelle entfernt, wo er den Schützen vermutete. Er hielt kurz inne und lauschte nach verdächtigen Geräuschen. Vielleicht hatte der Kerl ja zwischenzeitlich auch seine Position verändert. Man musste mit allem rechnen. Aber nur wenige Sekunden später wusste er, dass dem nicht so war. Ein weiterer Schuss fiel, gefolgt von einem wütenden Schrei und einem dumpfen Klatschen. Dann war alles still.
„Du kannst kommen, Banks!“, hörte er zu seiner Erleichterung Chatos kehlige Stimme. „Die Gefahr ist vorbei!“
Banks erhob sich aus den Büschen und eilte auf die Stelle zu, wo er Chatos Ruf vernommen hatte. Er ließ seinen Revolver jedoch erst sinken, als er Chato erblickte, der mit dem Gewehr auf einen Mexikaner zielte, der mit dem Rücken an einen Felsen gelehnt saß und die rechte Hand auf seine Brust presste. Das Hemd war an dieser Stelle vom Blut gerötet, und sein Gesicht schweißüberströmt.
„Ich habe nicht auf ihn geschossen, Banks“, sagte Chato, als er den Blick des Scouts bemerkte. „Jemand anderes hat das getan.“
„Apachen?“
„Fragen wir ihn“, sagte Chato. „Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit, um zu sprechen …“
Banks ging auf den schwer verletzten Mexikaner zu und beugte sich über ihn. Er bemerkte, wie der Mann immer wieder verängstigt in Chatos Richtung blickte.
„Chato gehört zu Captain Lawtons Armeescouts! Genau wie ich“, redete Banks auf den Mexikaner ein. „Was ist passiert?“
„Es geschah … alles so plötzlich“, murmelte der Mexikaner und verzog das Gesicht, als ihn eine erneute Schmerzwelle überkam. „Wir gerieten … in einen Hinterhalt und …“
„Geronimo?“, unterbrach ihn Banks.
„Si“, antwortete der Mann. „Sie lauerten uns … auf. Wir hatten keine … Chance. Obwohl wir 70 Mann … stark waren. Wir hätten sie … niemals über die Grenze verfolgen … dürfen. Ich konnte … entkommen, aber dann …“
Er wollte noch mehr sagen, aber in diesem Moment bäumte er sich auf, griff mit der rechten Hand nach Banks und wollte sich an ihm festhalten. Dies dauerte aber nur wenige Sekunden, dann ließ ihn der Mexikaner wieder los und fiel zurück. Er war tot.
Banks fluchte und erhob sich wieder. „Du hast es gehört“, sagte er. „Wir könnten ihn noch einholen, wenn wir uns beeilen.“
„Aber nicht wir beide“, antwortete Chato abwinkend. „Du hast mitbekommen, was der Mexikaner gesagt hat. Selbst 70 Mann waren nicht genug, um Geronimo zu besiegen. Dabei hat er nur 20 Krieger bei sich. Warte hier auf den Blaurock-Captain.“
„Chato! Du bist verrückt!“, rief ihm Banks hinterher. „Verdammt, jetzt warte doch!“
„Vergiss nicht, dass ich einmal zu Geronimo gehörte“, antwortete Chato, ohne sich dabei umzudrehen. „Ich weiß genau, was ich tue.“
*
Er hatte nicht lange gebraucht, um sein Pferd wieder einzufangen. Er ritt in die Richtung, in welcher einige Vögel immer noch am Himmel kreisten. Ein paar Geier warteten nicht mehr ab, sondern taten das, was ihre Aufgabe war, den Kreislauf von Leben und Tod auf ihre Weise abzuschließen.
Chato wusste das, bevor er die Stelle zwischen den Felsen erreichte. Er hatte auch keine Angst, dass Geronimos Krieger noch hier irgendwo lauerten. Dann hätten sich die Geier vermutlich ganz anders verhalten und die Flucht ergriffen. Die Anwesenheit von Menschen würde sie ganz sicher längst alarmiert haben.
Der Chiricahua-Scout bemerkte es, als er die ersten Toten auf dem steinigen Boden entdeckte. Einige Aasvögel hockten schon in unmittelbarer Nähe, und der mutigste von ihnen schlug mit den Flügeln, bevor er sich auf eine der Leichen setzte und mit dem scharfen Schnabel nach unten stieß. Er kam jedoch nicht dazu, sein grausiges Werk zu beginnen, denn in diesem Moment entdeckte der Geier den Apachen. Er krächzte wütend und blickte in dessen Richtung. Sekunden später erhob er sich wieder in die Lüfte, und die meisten seiner gefiederten Artgenossen folgten ihm.
Chato achtete nur kurz darauf, denn sein eigentliches Interesse galt dem, was hier vor nicht allzu langer Zeit stattgefunden hatte. Er sah vier tote Mexikaner und entdeckte weitere Leichen, als er auf die Felsen zuritt. Einer der Toten war ein Apache. Als Chato sein Pferd zügelte und auf den Krieger schaute, erkannte er ihn wieder. Sein Name war Mateo. Chato hatte ihn einmal sehr gut gekannt und mit ihm zusammen gegen die Mexikaner gekämpft – bevor er sich dazu entschlossen hatte, die Seiten zu wechseln und den blauen Rock der weißen Soldaten zu tragen.
Seine Gedanken kehrten wieder in die Wirklichkeit zurück, während er aus dem Sattel stieg und das nervöse Tier ein Stück von den Toten wegführte. Das Pferd scheute angesichts des Blutgeruchs. Chato band die Zügel an einem verdorrten Strauch fest, nahm das Gewehr und beschloss, das umliegende Gelände zu erkunden. Aber er entdeckte nichts, was ihn zur Vorsicht mahnte, denn die Spuren waren eindeutig. Die Mexikaner waren von der Grenze gekommen, weil sie die Fährte Geronimos und die seiner Krieger hartnäckig verfolgten. Sie hatten wohl gehofft, ihn endlich einholen und überrumpeln zu können. Aber das Schicksal hatte anders entschieden.
Chato schaute hinüber zu den Felsen. Seine Blicke ruhten auf dem rotbraunen Gestein, und er entdeckte den Weg, der dorthin führte. Er sah aber keine Hufspuren oder sonstige Hinweise, die darauf schließen ließen, dass Geronimo und seine Krieger diesen Weg genommen hatten. Stattdessen fand er Fußspuren an einer Stelle, wo sich kein Geröll befand, sondern staubiger Boden.
Sofort ging er zurück zu seinem Pferd und wollte gerade aufsitzen, als er Hufschläge in der Ferne hörte. Er schaute sich um und erkannte einen Trupp blau uniformierter Reiter, an dessen Spitze Captain Lawton und Tyler Banks ritten. Chatos Anspannung legte sich, aber trotzdem war noch eine unerklärliche Unruhe in ihm, die ihn nachdenklich machte. Denn er hatte längst erkannt, dass diese Fußspur hinüber zum Canyon führte. Er wartete ab, bis die Soldaten den Ort des Todes erreicht hatten.
Chato beobachtete mit stoischer Miene die entsetzten Blicke des Captains und seiner Soldaten, als sie die toten Mexikaner sahen. Er selbst verhielt sich ruhig und abwartend, obwohl er sehr gut wusste, dass ein Teil des Zorns sich auch gegen ihn richtete, weil er ein Apache war und vor nicht allzu langer Zeit noch mit Geronimo geritten war.
In Momenten wie diesen spürte Chato die große Kluft, die ihn von allen anderen trennte. Da half auch nicht die blaue Uniformjacke, die er trug. Aber mit diesen Dingen mussten alle Apachenscouts klarkommen. Ob es ihnen nun gefiel oder nicht.
„Hast du Spuren gefunden?“
Captain Lawtons Stimme klang kalt und abweisend, als er das Wort an Chato richtete.
„Ja“, erwiderte Chato und ließ sich nicht anmerken, was er in Wirklichkeit dachte. „Aber keine Apachenspuren. Es sind die eines Weißen, sie führen in diese Richtung …“
Er zeigte dabei mit dem Lauf seines Gewehrs hinüber zum Canyon, während Tyler Banks inzwischen abgesessen war und ebenfalls die Spur untersuchte, von der Chato erzählt hatte.
„Das ist ein kleiner Fußabdruck, Captain“, wandte er sich anschließend an Lawton. „Könnte von einer Frau oder einem Kind stammen. Vielleicht Audrey Buchanan?“
„Kennen Sie den Canyon, Mister Banks?“, fragte Lawton. „Vielleicht ist es eine weitere Falle der Apachen und …“
„Geronimo und seine Krieger sind nicht mehr hier“, kam Chato dem weißen Scout zuvor. „Ihre Fährte führt wieder nach Süden. Sie haben denjenigen nicht gefunden, der diese Spur hinterlassen hat. Banks, komm mit, ich glaube, ich weiß, wo wir suchen müssen.“
Er stieg in den Sattel seines Pferdes und gab ihm die Zügel frei. Banks schaute kurz hinüber zu Captain Lawton. Als dieser nickte, saß Banks ebenfalls rasch auf und folgte dem Chiricahua-Scout. Der Captain und die übrigen Soldaten schlossen sich ihnen in einem Abstand von knapp 110 Yards an. Martine und Ke-e-te-na bildeten die Flanken und hielten ebenfalls Ausschau nach verborgenen Feinden. Aber sie mussten kurze Zeit später ebenfalls feststellen, dass Chato die Wahrheit gesagt hatte.
Chato ritt voran und erreichte Augenblicke später den Canyon. Er beobachtete die schroffen Felsenhänge, die mit Geröll übersät waren, und hielt einen Augenblick inne.
„Was ist?“, fragte ihn Banks, weil er natürlich nicht wusste, was Chato beabsichtigte.
„Komm mit und sei leise“, forderte ihn Chato auf. „Geh du voran, bis dort oben zum Ende des Geröllhanges. Siehst du den Einschnitt dort?“
„Ja“, bestätigte dies Banks. „Und was ist damit?“
„Dort hat sich gerade etwas bewegt“, antwortete Chato. „Dort will jemand nicht gesehen werden. Jemand, der Angst hat.“
„Glaubst du, dass es das Mädchen ist?“
„Ich weiß es nicht, aber wir werden es gleich herausgefunden haben“, meinte Chato. „Wenn es so ist, dann muss ihr ein Weißer sagen, dass ihr keine Gefahr mehr droht. Das ist jetzt deine Aufgabe, Banks.“
Dieser nickte und ging voran. Das Geröll rutschte unter seinen Stiefeln weg, während er nach oben stieg.
„Audrey, du musst keine Angst haben!“, rief er so laut, dass dies das Mädchen eigentlich hören musste, falls es sich wirklich dort oben aufhielt. „Es wird alles gut. Chato hier arbeitet für die Armee. Du kannst herauskommen. Niemand wird dir etwas tun!“
Sekundenlang herrschte eine quälende Stille. Dann hörte Banks eine zitternde Stimme.
„Der Indianer soll weggehen!“
Chatos Miene verdüsterte sich bei diesen Worten. Banks schaute ihn an und bat ihn mit einer kurzen Geste, zurück zu seinem Pferd zu gehen. Er selbst setzte seinen Weg über den steinigen Pfad nach oben fort.
Banks entdeckte den Felseneinschnitt und den Zugang zur Höhle erst, als er schon fast davor stand. Da wusste er, dass er nicht mehr lange zu suchen brauchte. Um das Mädchen nicht unnötig zu beunruhigen, blieb er erst einmal stehen.
„Ich bin Tyler Banks, Audrey!“, rief er. „Ich bin Scout in General Miles Truppe. Du kannst herauskommen“, wiederholte er ruhig.
„Wo ist der Apache?“
„Weiter unten am Fuß der Geröllhalde, Audrey“, antwortete Banks. „Du musst keine Angst vor ihm haben. Er ist ein verlässlicher Scout, er würde dir niemals ein Leid zufügen.“
Die Sekunden, bis das Mädchen wieder antwortete, verstrichen quälend langsam.
„Versprechen Sie mir, dass er mir wirklich nichts tut?“
„Hoch und heilig, Audrey. Komm jetzt, wir bringen dich weg von hier.“
Endlich zeigte sich Audrey Buchanan im Eingang der Höhle. Sie trug immer noch das Nachthemd, es befand sich in einem schlimmen Zustand, war verdreckt und an einigen Stellen zerrissen. Das Mädchen selbst war blass im Gesicht, und in ihren Augen flackerte es nervös, als sie zu Banks schaute.
„Sind die Apachen weg?“
„Ich denke ja, Audrey“, versuchte Banks das Mädchen zu beruhigen. „Am Anfang des Canyons warten Captain Lawton und seine Truppe auf uns. Geronimo und seine Bande werden es sich dreimal überlegen, uns anzugreifen.“
„Ein Teufel ist das“, murmelte Audrey, ließ sich in Tyler Banks Arme fallen und schluchzte herzzerreißend. Im ersten Augenblick wusste Banks gar nicht, was er tun sollte, weil er mit solchen Situationen nicht gut umgehen konnte. Aber dann machte er instinktiv genau das Richtige, drückte das Mädchen an sich und redete beruhigend auf Audrey ein.
„Meine Mutter …“, stammelte Audrey unter Tränen. „Sie ist auch tot … nicht wahr?“ Als Banks mit einer Antwort zögerte, seufzte sie. „Ich habe es geahnt. Diese elenden Bestien. Geronimo ist kein Mensch, sondern ein Ungeheuer. Wie konnten die Apachen nur so grausam sein? Wir haben ihnen doch gar nichts getan und …“ Wieder musste sie weinen, um ihre Trauer zu bewältigen.
„Du kommst erst mal zurück ins Fort, Audrey“, meinte Banks. „Dort wird man sich um dich kümmern. Auf die Ranch kannst du nicht mehr zurück. Da ist nichts mehr.“
„Meine Eltern, Mister Banks … hat man sie … ich meine …?“
„Sie wurden anständig begraben, wenn du das wissen willst“, antwortete der Scout. „Das ist das Mindeste, was wir tun konnten. Das gilt auch für die Cowboys. Von ihnen lebt auch niemand mehr.“
„Es ging alles so schnell“, sagte Audrey. „Wir hatten gar keine Chance, uns zu wehren.“
Sie hatte eigentlich noch mehr sagen wollen, aber in diesem Augenblick wurde ihr bewusst, dass Chato nur noch wenige Schritte von ihr entfernt stand. Sein Blick war neutral, und er verzog keine Miene, als Banks das Mädchen in den Sattel seines Pferdes hob und hinter Audrey aufsaß.
„Reiten wir zurück, Chato“, sagte er zu dem Chiricahua. „Hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Oder hast du noch andere Spuren gefunden?“
„Nur bis zu dieser Stelle“, erwiderte dieser. „Geronimo hat die Blaurock-Soldaten kommen sehen. Deshalb haben er und seine Krieger diesen Ort verlassen. Sonst würde das Mädchen jetzt nicht mehr leben.“
Audrey zuckte zusammen, als sie Chatos Worte vernahm. Aber sie wusste auch, dass Chato die Wahrheit gesprochen hatte und dass sie nur knapp dem Tod entronnen war.
Kapitel 3
1. Juni 1886
Fort Apache
„Mir gefällt das nicht“, sagte Chato und blickte aus dem Fenster der Baracke hinaus. „Es laufen zu viele Soldaten mit Gewehren herum. Schau es dir an, Banks, dann wirst du verstehen, was ich meine.“
Tyler Banks murmelte etwas Unverständliches vor sich hin. Er stellte die Whiskeyflasche neben seine Pritsche und erhob sich seufzend. Eigentlich hatte er es sich gemütlich machen und während der Mittagshitze wenigstens zwei Stunden schlafen wollen.
Draußen war es noch schlimmer als in einem Backofen. Die Sonne brannte erbarmungslos vom stahlblauen Himmel herunter und war eine Qual für Mensch und Tier. Erst recht für die Gruppe von 20 Mescaleros und Chiricahua, die von einem Soldatentrupp nach Fort Apache eskortiert worden waren und in der Mitte des Innenhofes regungslos ausharrten.
Banks ging ebenfalls zum Fenster und schaute hinaus. Es stimmte, was Chato gesagt hatte. Die Soldaten hielten ihre Gewehre in den Händen und hatten sich in einem weiten Kreis um die Gruppe der erschöpften Mescaleros und Chiricahua postiert.
„Was das wohl zu bedeuten hat?“, brummte Banks, der sich ebenso wenig einen Reim auf die ganze Sache machen konnte wie Chato.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783957194022
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (Januar)
- Schlagworte
- Western Abenteuer Indianer Wilder Westen Roman