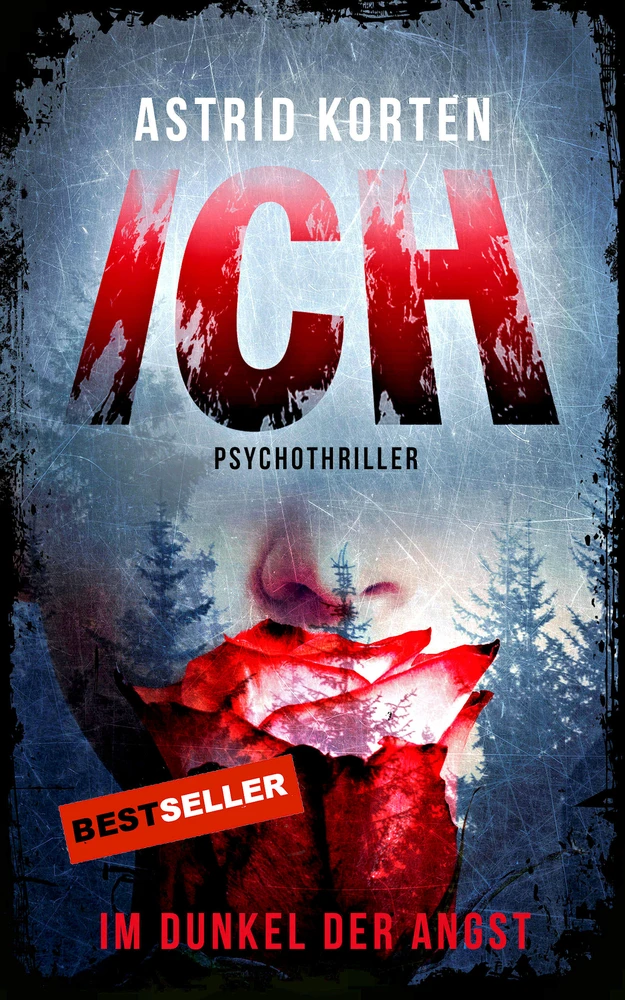Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Astrid Korten
ICH
Im Dunkel der Angst
Psychothriller
Wer bist du?
Ich streiche um dein Haus.
Ich beobachte dich.
Ich habe dich im Visier. Immer.
Und niemand weiß, wer ich bin.
Über das Buch
ICH weiß, wie die Hölle aussieht.
ICH bin eine Überlebende.
ICH habe beschlossen, dir und anderen dieselbe Erfahrung zukommen zu lassen …
Willkommen im Dunkel der Angst.
Nach dem Selbstmord der Schülerin Greta wollen die ehemalige Lehrerin Pia und ihre Schwester Hannah, Ehefrau und Mutter, in Warnberg neu beginnen. Die Geschwister tragen beide eine schwere Schuld auf ihren Schultern. Doch die Vergangenheit holt sie unerbittlich ein. Eines Tages erhalten sie eine Nachricht: Willkommen im Dunkel der Angst.
Bald kehren nicht nur Winterstürme, Nebel und Misstrauen, ins idyllische Warnberg ein, sondern auch das Grauen, das die Geschwister immer stärker bedroht, bis sie um ihr Leben fürchten müssen.
Bildgewaltiger, raffinierter und nervenzerreißender Psychothriller um Mobbing und großer Schuld, mit großer Intensität erzählt. (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)
Aus Gretas Tagebuch
Du warst schon immer da,
ich kannte Dich,
aber ich war vorsichtig,
und Du hast Dich abgewendet,
nur zum Schein.
Es ist ein altes Thema,
aber neu für mich.
Ich habe Dich nie als Freund betrachtet,
mit Freunden redet und lacht man,
mit Freunden teilt man alles,
was zu teilen fällt.
Aber seit Kurzem möchte ich Dich sehen,
ich möchte mit dir reden,
sehne mich nach Dir.
Du lädst mich ein.
Und wohin das führen wird,
weißt auch Du.
Ich will mit Dir tanzen,
wenn ich meine Furcht überwinde,
meinen Zweifel zerstreuen kann,
dann komme ich,
und schließe für immer Freundschaft.
Astrid Korten
ICH
Im Dunkel der Angst
Psychothriller
Wer bist du?
Ich streiche um dein Haus.
Ich beobachte dich.
Ich habe dich im Visier. Immer.
Und niemand weiß, wer ich bin.
Über das Buch
ICH weiß, wie die Hölle aussieht.
ICH bin eine Überlebende.
ICH habe beschlossen, dir und anderen dieselbe Erfahrung zukommen zu lassen …
Willkommen im Dunkel der Angst.
Nach dem Selbstmord der Schülerin Greta wollen die ehemalige Lehrerin Pia und ihre Schwester Hannah, Ehefrau und Mutter, in Warnberg neu beginnen. Die Geschwister tragen beide eine schwere Schuld auf ihren Schultern. Doch die Vergangenheit holt sie unerbittlich ein. Eines Tages erhalten sie eine Nachricht: Willkommen im Dunkel der Angst.
Bald kehren nicht nur Winterstürme, Nebel und Misstrauen, ins idyllische Warnberg ein, sondern auch das Grauen, das die Geschwister immer stärker bedroht, bis sie um ihr Leben fürchten müssen.
Bildgewaltiger, raffinierter und nervenzerreißender Psychothriller um Mobbing und großer Schuld, mit großer Intensität erzählt. (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)
Aus Gretas Tagebuch
Du warst schon immer da,
ich kannte Dich,
aber ich war vorsichtig,
und Du hast Dich abgewendet,
nur zum Schein.
Es ist ein altes Thema,
aber neu für mich.
Ich habe Dich nie als Freund betrachtet,
mit Freunden redet und lacht man,
mit Freunden teilt man alles,
was zu teilen fällt.
Aber seit Kurzem möchte ich Dich sehen,
ich möchte mit dir reden,
sehne mich nach Dir.
Du lädst mich ein.
Und wohin das führen wird,
weißt auch Du.
Ich will mit Dir tanzen,
wenn ich meine Furcht überwinde,
meinen Zweifel zerstreuen kann,
dann komme ich,
und schließe für immer Freundschaft.
Prolog
Hannah - März 2019
Ich hatte das schon einmal gemacht. Ich konnte das.
David strich mir über den unteren Rücken, Pia hielt meine Hand, Moritz machte mit dem iPhone Videoclips.
Sie alle waren so verdammt ruhelos in diesem Zimmer.
Und es war zu heiß.
Moritz zoomte mich heran.
Ich riss ein.
Niemand in diesem Zimmer unternahm etwas.
Ich wollte ihre Gesichter zerschlagen, sie bis zur Unkenntlichkeit zerschmettern.
Ich hasste sie alle!
Meine geröteten Augen schossen kometenhaft nach innen, mein Unterleib zog sich krampfartig zusammen.
Hecheln!
Wo blieb diese gottverdammte Betäubungsspritze?
„Du machst das sehr gut“, sagte David und tätschelte meinen Arm.
Pia sah Moritz erfreut an und drückte mir zuversichtlich die Hand.
Hätte ich noch einen Funken Kontrolle über den Arm, hätte ich Moritz das iPhone aus den Händen geschlagen.
Es war mir auch völlig klar, dass meine Schwester nicht einfach so da stand, mit diesem glückseligen Lächeln im Gesicht, dieser Geburt so viel Aufmerksamkeit schenkte und nebenbei auch noch alles andere im Auge behielt.
Meine Schwester …
Diese fade, hormongeschädigte Schullehrerin in ihrer Fitnesskluft. Sie hatte keine Ahnung, was ich in Wahrheit von ihr hielt. Warum ließ mich diese verfilzte Jungfer diesen Schmerz durchleben? Ich könnte ihr mit dem Skalpell die Kehle durchtrennen. Ein Moment der Unachtsamkeit und dann …?
Ich hätte Pia damals erledigen sollen, als wir noch Kinder waren. Niemand bezweifelte, dass meine kleine Schwester, die früher mal als eitel und nicht allzu klug galt, ihr Haar in der Wanne föhnen wollte, woraufhin ihr der Haartrockner aus der Hand glitt, direkt in den duftenden Schaum … hätte ich ihn nicht aufgefangen. Die meisten Unfälle passierten im Haus, das wusste jeder.
Ich hatte keine andere Wahl, als sie auszuhalten. Ich fand nur, dass ich es schon viel zu lang getan hatte.
Erst das Baby und dann würde ich weitersehen.
Eine Wehe brachte wieder Ordnung in mein abscheuliches Gedankenchaos.
Oh, mein Gott, ich hielt diese Schmerzen nicht mehr aus, war gefangen in einem Körper, der von innen auseinandergerissen wurde – ein Szenario, das meine Mutter stets das Schönste, was einer Frau passieren kann, nannte.
Warum bekam ich keine Epiduralanästhesie?
Verdammt, Pia! Ich habe dir als Kind das Leben gerettet!
„Noch einmal kräftig pressen! Komm schon, Hannah, du kannst das!“, sagte die Hebamme.
„Ich kann nicht mehr“, wimmerte ich mit einer Stimme, die mir fremd war. Warum erlöste David mich nicht von dieser Qual? Oder diese beschissene Hebamme, die kein Erbarmen mit mir hatte. Warum gab sie mir keine Betäubung?
„Sehr gut, mein Schatz“, sagte David.
„Pfff, pfff, pfff.“ Seltsame Laute aus dem Mund meiner Schwester. In diesem Moment hasste ich Pia.
Sterne tanzten vor meinen Augen.
„Pressen! Noch einmal pressen!“, rief die Hebamme.
Zorn loderte in mir, der Drache spuckte das Feuer des Hasses auf die Personen in diesem Raum.
David lief zu Höchstform auf. „Du machst das fantastisch, Schatz.“
Ich wollte, dass sein Mund keine Worte mehr preisgab.
Meine Hände umklammerten etwas oder jemanden, es war mir egal.
Ich wollte nur, dass es aufhörte …
TEIL 1
Denn ich fürchtete einen Schrecken, und er traf mich,
und wovor mir bangte, das kam über mich.
Ich hatte nicht Rast noch Ruh, noch Frieden – da kam eine Peinigung.
Das Buch Hiob, 3:25/26
Kapitel 1
ICH
Das eigene Kind zu Grabe zu tragen, ist das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann.
Halt! Das stimmt nicht, es trotzt jeder Zuversicht, jedem Vertrauen, es bringt etwas in dir zum Stillstand, tötet etwas in dir, das nie wieder zum Leben erwachen kann. Aber es bringt auch neue Gefühle hervor: Hass, Wut, Angst, Rache.
Ich bin auf dem Waldfriedhof Pullach, wo zwanzig Meter von mir entfernt Trauernde dicht beieinander um ein offenes Grab stehen. So viele sind gekommen, viel mehr als die Eltern erwartet hatten. Vorher haben sie das Mädchen in der Kapelle aufgebahrt. Ich habe es vermieden, Mias Sarg anzusehen, als die Trauergäste in die kühle Kapelle einzogen. Ebenso bin ich den Eltern ausgewichen, die von Blumen und Trauerenden umgeben im vorderen Teil des Raumes stehen. Sie wollten gewiss in aller Stille vor der Beerdigung Abschied von ihrem kleinen Engel nehmen, und Mia vor den Blicken der anderen beschützen. Aber leider verlangen Mitleid und Neugierde beim Tod eines Kindes stets ihren Tribut.
Alle haben Mia gesehen, sich von der Vierjährigen verabschiedet. „Sie hat so friedlich ausgesehen“, haben sie geflüstert.
Friedlich bedeutet tot. Friedlich, aber tot! Der Tod ist aber nicht friedlich, er ist grausam, wie auch Gott es sein kann.
Ein kleiner Trost, wird ein Freund der Familie sagen.
Ich verabscheue diese Worte. Bla, bla, bla. Es gibt keinen Trost. Ein Freund sollte das wissen.
Mias Mutter ist um Jahre gealtert. Sie steht dicht neben ihrem Mann unmittelbar vor dem Grab.
Er sollte sie in die Arme nehmen, sie stützen und ihr Trost spenden, denke ich. Aber er kann es vielleicht nicht.
Die weiße Kiste ist so klein. Es spielt keine Rolle, das Kind wird nicht mehr wachsen. Es bleibt für immer ein kleines Mädchen von vier Jahren. Ich vermute, Mias Mutter weiß nicht, wie sie zu dem frisch ausgehobenen Grab gelangt ist. Die Trauerfeier ist größtenteils an ihr vorübergegangen. Sie hat kaum etwas von ihr mitbekommen. Immer wieder spürt sie ihren Verlust mit seinem immensen Schmerz. Ich weiß nur allzugut über diese Dinge Bescheid.
Mias Vater hält eine weiße Rose in der Hand. Neben dem offenen Grab liegt ein kleiner Haufen Erde, darin steckt eine Schaufel. Jemand stellt einen Korb mit Rosen dazu.
Mias Mutter nimmt eine Blume und bemerkt, dass sie bereits eine in ihrer Hand hält. Zu viele Menschen versammeln sich um das Grab des Mädchens, um ihm adieu zu sagen. Sie bringen kein Verständnis dafür auf, dass das Zu-Grabe-Tragen eines Kindes eine sehr intime Angelegenheit ist.
Ich blicke zum Himmel. Wolken greifen ineinander, verflechten sich, streben wieder auseinander und wechseln ständig ihre Farbe – von Schwarz zu Purpur, dann gefedert, dann wieder schwarz. Allmählich überqueren sie den Friedhof, und ich sehe, dass sie ein feines Regennetz unter sich ausbreiten. Sie sind nicht mehr weit von dir und mir entfernt. Es ist seltsam, aber mit dem Tod eines Kindes gerät die Luft stets in Bewegung, zuerst nur stoßweise, sodass die Mäntel und Jacken der Trauergäste sich abwechselnd blähen und dann wieder schlaff herabhängen wie in diesem Moment. Es muss wohl daran liegen, dass dies ein Tag der Dunkelheit ist, ein Tag, an dem ein Kind begraben wird, ein Tag, an dem die Schatten länger werden, ein Tag, an dem das Licht verzweifelt gegen die aufkommende Finsternis kämpft, für mich ein Tag, an dem ich vor einem Jahr das Gute gegen das Böse ausgetauscht habe.
Ich merke, dass Mias Mutter allein sein will mit ihrem Kind. Sie wirft einen raschen, überstürzten Blick auf das Gesicht ihres Mannes, als der kleine weiße Sarg per Knopfdruck mechanisch in das Grab hinunterfährt. Sie wirft eine Rose in die Tiefe, dann einen Teddy. Kurz darauf bedeckt eine Handvoll Erde Sarg und Bär, der vielleicht einmal das Lieblingsschmusetier des Kindes gewesen war. Der Silberschleier hat den Friedhof zu drei viertel überquert. Er gleicht jetzt einer riesigen, herumwabernden, bleifarbenen Decke. Der Vater umfasst sanft den Arm der Mutter.
Einige Trauergäste lassen Kuscheltiere auf den weißen Sarg fallen, dann beugen sie sich vor und greifen die feuchte Erde, mit bloßen Händen, statt mit der Schaufel. Eine schöne Geste. Dumpfe Schläge stören die Ruhe des kleinen Mädchens dort unten wie die Geräusche des aufkommenden Sturms.
Plopp – plopp – plopp …
Niemand, der dies je gehört hat, wird es wieder vergessen.
Ein frischer Wind setzt jetzt ein, der den Schweiß auf meinem Körper trocknet und mich gleich darauf leicht frösteln lässt. Im nächsten Moment sehe ich den Silberschleier über den Friedhof wirbeln. Er verhüllt die Grabsteine in Sekundenschnelle und kommt direkt auf die Trauernden zu. Der Nebel, der urplötzlich beinahe über die Erde schwebt, ist wie ein Schleier der Trauer, eine Decke aus Tränen.
Aber die Mutter kann nicht weinen. Ihr Schmerz ist so viel größer als jede Trauer, erstickt jede Träne im Keim. Da ist nichts, nur Leere. Wenn sie jetzt stürzt, wird die Erde auch sie in ein gähnendes schwarzes Loch ziehen – wie ihr Kind. Die Menschen werden hinuntersehen und begreifen, dass da unten von der Mutter nichts mehr übrig ist. Keine Haut. Keine Organe. Kein Skelett, nicht mal ein winziger Knochen. Nichts. Das Knirschen des Kieses kündigt das Ende der Beerdigung an. Die Menschen lassen sie endlich allein.
„Ich kann sie nicht mehr sehen“, sagt die Mutter mit erstickter Stimme. „Der Nebel muss verschwinden. Bitte, vertreibe den Nebel.“ Die letzten Worte hallen über die Grabsteine und verweilen dort stumm.
Ich lasse meinen Blick über die Menschen schweifen, die sich abseits von dem offenen Grab versammelt hatten. Mitten unter ihnen erkenne ich plötzlich eine Frau mit versteinerter Miene, deren Körper bei jedem Wort des Pfarrers zusammenzuckt.
Ich fahre erschrocken zusammen, bin wie hypnotisiert, kann mich von dem Anblick nicht losreißen. Ich schließe kurz die Augen und habe eine schreckliche Vision. Ein greller Blitz zuckt auf und erlöst mich von dem Schrecken.
Hannah Franke! Wie kann sie es wagen, Mias Beerdigung mit ihrer Anwesenheit zu beschmutzen? Neben Hannah steht Pia, ihre Schwester, die jetzt auf das Grab zugeht und Stiefmütterchen hineinwirft. Auch so ein Früchtchen.
Hannah presst von Kummer überwältigt die Hände vors Gesicht. Ich verachtete sie für ihre Unbeherrschtheit und dafür, dass sie damit Aufmerksamkeit auf sich zieht, die sie nicht verdient.
Als die Geschwister sich entfernen, blicke ich in Hannahs Gesicht. Ein flüchtiges Lächeln umspielt ihre Lippen. So eine Heuchlerin.
Dann kommt der Moment, an dem alles zu Ende ist. Schwarze Krähen kreisen über dem Grab. „Genug getrauert“, kreischen sie. „Geht nach Hause!“
Ich bin nicht zufällig hier. Ich stehe hinter einer Hecke an einem anderen Grab. Hier gibt es keine frische, feuchte Erde, kein offenes gähnendes Loch. Hier liegt die Trauer tief unten begraben, aber nicht so tief, dass sie nicht mehr spürbar ist.
Die Leute behaupten gelegentlich, dass der Schmerz sich abnutzt. Aber wer das sagt, hat kein Kind geboren und es zu Grabe getragen, ein Kind, das nicht hätte sterben müssen. Wie meine Tochter Greta. Jeden Tag höre ich ihre sanfte Stimme.
Ich will nicht in den weißen Sarg.
Ich will nicht unter die Erde.
Mir ist kalt.
Hier ist es unheimlich und dunkel.
Mami, kannst du mich bitte von hier fortbringen?
Niemand hat mir gesagt, wo ihre Seele hingeflogen ist.
„Greta ist tot.“
Drei Worte hatten meine Welt vor fast zwei Jahren einstürzen lassen. Drei Worte, die der ermittelnde Beamte zu mir sagte, nachdem Jonas und ich ihn und seinen Kollegen ins Haus gebeten hatten. „Es tut uns sehr leid, wir haben ihre Tochter gefunden. Greta ist tot.“
Ich hätte besser auf sie achtgeben, sie besser beschützen müssen.
Meine Wut auf die Schuldigen ist unerträglich. Ich kann sie nicht mehr ignorieren. Sie ist zu einem Berg herangewachsen, bis zu den dunklen Wolken, die im Moment über die Grabstätten hinwegziehen und sich weigern, den Friedhof mit ihren Tränen zu überschütten.
Plötzlich dreht Hannah sich um und blickt in meine Richtung. Ihrer Schwester Pia würdigt sie keines Blicks. Hannah kann mich hinter der Hecke nicht sehen. Ich vermute, dass sie sich völlig ungeschützt fühlt, dass immer stärker die Angst in ihr hochkriecht, weil sie das Gefühl hat, dass sie beobachtet wird.
Soll sie sich doch in die Hosen machen.
Als Hannah durch das Friedhofsportal geht, dreht sich noch einmal um und sieht in meine Richtung.
In der Ferne höre ich ein gewaltiges Krachen. Dann tritt Stille ein.
Mein Liebling. Wenn mich jetzt irgendeine Form der Bewusstlosigkeit ereilen könnte, ich wäre vollendet, vollkommen.
Ich stecke das Unkraut in eine schwarze Plastiktüte und durchziehe die blauen Bodendecker ordentlich mit Erde. Meine Tochter liebte die Farbe blau.
Ich weiß, wie die Hölle aussieht.
Ich bin eine Überlebende.
Ich bin die Mutter eines Kindes, das zu Tode gequält wurde.
Ich werde anderen dieselbe Erfahrung zukommen lassen. Wenn ich mit den Schuldigen fertig, bin, werden alle wissen, was sie meinem Kind angetan haben.
Sie sollen stürzen wie Bäume im Sturm.
Sie sollen leiden im Dunkel der Angst.
Kapitel 2
ICH
Als ich in die Knie gehe und ein verlorenes braunes Blatt entferne, wirft die Sonne einen Lichtstrahl über die blauen Bodendecker. Ich schaue nach oben, sehe, dass sich der Nebel lichtet.
Mein Blick schweift über den weißen Stein, auf dem ihr Name steht: GRETA.
Während meiner Schwangerschaft habe ich den Namen in einem Zeitungsartikel entdeckt. Er bedeutet Perle, und genau das war mein Mädchen: eine Perle aus der Tiefe des Meeres, wunderschön und humorvoll, klar, ein Wunder. Meine kleine Greta war ein Wunder. Als ich von der Schwangerschaft erfuhr, wusste ich, dass mein Kind diesen Namen bekommen würde, sollte es ein Mädchen werden. Über den Namen für einen Jungen habe ich mir nie Gedanken gemacht.
Auf dem Grabstein sind Gretas Namen, ihr Geburtsdatum und ihr Todesdatum eingraviert. Keine Floskeln, dass sie geliebt oder wie sehr sie vermisst wird. Diejenigen, die ihr Alter von erst zwölf Jahren errechnen, werden solche Details nicht brauchen, und diejenigen, die sie brauchen, sollten sich dem Grab besser nicht nähern.
Die Sonne wird stärker. In der Ferne nähert sich eine Trauerprozession. Ich erkenne einen großen Sarg, der auf sechs Schultern ruht. Heute wird kein Kind beerdigt. Die Prozession biegt in einen Seitenweg und verschwindet aus meinem Blickfeld. Irgendwo bellt ein Hund.
Ob es gut wäre, wieder einen Hund zu haben?
Der Nebel ist verschwunden, und ich kann jetzt das Grab des Kindes sehen, das seit gestern hier liegt. War es eine Totgeburt oder schon ein paar Tage alt gewesen? Zwischen den Blumen ist eine blaue Schleife. Ein Junge also.
Ich habe Greta zwölf Jahre lang gekannt. Ich kannte ihr Lachen, jede ihrer Bewegungen, wusste, wie ihre Stimme klang. Ich habe Videoclips von ihr, sodass ich mein Kind stets hören und sehen kann. Das ist mehr, als die Mutter des toten Jungen vermutlich je haben wird. Aber es ist nicht genug. Der Verlust schmerzt nicht nur, er berührt auch ständig meine Seele. Dennoch wird erwartet, dass ich die scharfen Kanten der Trauer verloren, und ebenfalls dem Verlust einen Ruheplatz gegeben habe.
Vor nicht allzu langer Zeit erzählte mir eine ehemalige Freundin, die ich zufällig im Shoppingcenter traf, dass ein normal denkender Mensch eine begrenzte Zeitspanne für Trauer hat. Ich habe mich schnell von ihr verabschiedet, weil ich ihr ansonsten einen gewaltigen Tritt gegen ihr Schienbein verpasst hätte.
In drei Wochen ist es zwei Jahre her, dass Greta nicht von der Schule nach Hause kam. Später stellte sich heraus, dass sie zum wiederholten Mal, wie auch an diesem Tag, erst gar nicht dort erschienen war. Niemand hat mich angerufen, um zu fragen, wo Greta blieb. Niemand hat den Alarm ausgelöst.
In der Schule war jeder der Ansicht gewesen, dass ich vergessen hatte, Greta krank zu melden. Wenn auch das wenig überzeugt. Das ist für mich nur schwer zu verstehen, aber es ist auch schwer zu vereiteln.
Der erste Satz in Gretas Tagebuch lautet: Wenn ich nie wieder auftauchen würde, würde es niemand bemerken.
Ich schon, mein Mädchen, ich schon.
Nach fast zwei Jahren des Verzichts und des Aufstehens ist die Zeit gekommen, den Tod meines Kindes zu rächen. Natürlich möchte ich mich lieber an jene Leute wenden, die durch ihre Gleichgültigkeit, ihre Unachtsamkeit und vor allem durch ihr Desinteresse den Weg für Gretas verzweifelte Tat geebnet hatten. Aber das ist nicht möglich, ohne selbst zur Hauptverdächtigen zu werden. Als ich der Lehrerin begegnete, die Greta in ihrem Tagebuch so oft erwähnt hat, konnte ich meinen Hass fast schmecken. Ich kann meine Abneigung gegen diesen trägen, schmallippigen Tölpel immer noch nicht verbergen. Die Frau weicht meinem Blick aus, wenn wir uns im Ort begegnen.
Aber es gibt andere Leute in dieser Schule. Es ist mir egal, wer sie sind oder ob und welche Position sie dort bekleiden. Es geht um ihre Beziehung zu dieser Schule. Wenn unter diesen Leuten eine ist, oder zumindest eine da war, als mein Kind sich das Leben nahm, werde ich sie zu meiner Zielscheibe machen.
Ich befasse mich nicht mit Ursache und Folgen, frage mich nicht, ob mein Plan gut durchdacht ist. Meine Entscheidung steht fest, ich regle die Dinge auf meine Art und Weise. Das heißt insbesondere: allein. Ich muss mein Spiel intelligent spielen, im Verborgenen handeln, darf keinen Verdacht erregen. Ich will nicht das Risiko eingehen, nie wieder das Grab meines Kindes besuchen zu können, sobald der Nebel kommt und es nach mir ruft.
Kapitel 3
ICH
Die Bilder vom Friedhof haben mich die ganze Nacht über gequält. Aber es sind nicht nur die Bilder, sondern auch die Geräusche. Ich habe fortdauernd die Stimme der untröstlichen Mutter gehört, ihre Verzweiflung gespürt und ihren Zorn bis in die Fingerspitzen. Vielleicht bin ich deshalb in der Nacht mehrmals aufgestanden und habe den Vorhang ein wenig beiseitegeschoben und in den Nebel gestarrt, der einfach nicht weichen wollte.
Das Rauschen der Bäume ist verebbt. Das Dunkel ist dem Tageslicht gewichen, aber der Nebel ist immer noch da. Es hat den Anschein, als wäre mir diese aufdringliche, finstere graue Masse gefolgt. Sie umhüllt den Tag, nimmt mir die Sicht. Der Gedanke weckt meinen Unmut. Ich kann die Häuser der Nachbarn auf der anderen Straßenseite kaum sehen.
Es war auch neblig an jenem Tag, an dem Greta aufgefunden wurde. Ihr Leben war irgendwo in den dicken, nassen Schleiern und dem Schnee verschwunden. Sie wäre erst viel später entdeckt worden, hätte der Labrador der Nachbarn sie nicht gewittert. Und sie wäre früher entdeckt worden, wenn dieser Hund nicht ein paar Tage in einer Tierklinik verbracht hätte.
Sie wäre, sie wäre …
Ich muss damit aufhören.
Neun Uhr. In den Nachrichten ist von einer Gruppe radikalisierter junger Männer die Rede, die in München verhaftet wurden. Vermutlich konnte so ein terroristischer Anschlag verhindert werden; eine Protestaktion wird vorbereitet, weil die Menschen die Regierungspolitik der Bundesregierung ablehnen; im Norden des Landes hat sich ein Familiendrama abgespielt: Ein Mann tötete seine Ehefrau und deren Eltern und wurde zur Fahndung ausgeschrieben.
Der Nebel muss verschwinden!
Die Sichtweite beträgt höchstens fünf Meter, dennoch trete ich fest in die Pedale. Vielleicht kollidiere ich jeden Augenblick mit einem Fahrzeug, vielleicht fahre ich einen Fußgänger an, der einen Zebrastreifen überqueren will, vielleicht werde ich bei einer Kreuzung ausgebremst. Das alles spielt keine Rolle. Ich beschäftige mich schon lange nicht mehr mit Risiken oder den Gefahren. Nur mein Ziel ist wichtig, das will ich erreichen und das wird auch geschehen.
Ich habe Gretas Grab seit ein paar Monaten nicht mehr täglich besucht. Heute muss ich zu ihr. Mein Mädchen ruft nach mir. Der Grund dafür ist dieser Nebel. Greta will beruhigt werden, und ich bin die Einzige, die das kann und die das darf.
Der Tod hat uns nur physisch getrennt, in Gedanken bleibe ich mit Greta stets verbunden. Wir hatten bereits eine enge Bindung, als Greta in meinem Körper heranwuchs, und von dem Moment an, als die Hebamme das kleine Wesen auf meinem Bauch legte und Greta mich ansah, wusste ich, dass meine Tochter mich erkannte. Die Nabelschnur wurde durchtrennt.
„Sie haben ein wunderschönes Mädchen zur Welt gebracht“, sagte die Hebamme. Ich wollte ihr danken, aber kein Wort kam über meine Lippen, angesichts dessen, was ich in den Augen meines Kindes las. Da war mehr als das gegenseitige Staunen, mehr als unser beidseitiges Kennenlernen. Es war diese Gewissheit, dass nichts auf der Welt uns jemals auseinanderbringen würde. Ich war nie wieder von etwas anderem so überzeugt. Dennoch verpasste ich Gretas Kampf.
Das werde ich mir niemals verzeihen.
Ich habe die Geschwister seit geraumer Zeit im Visier, um meiner Wut ein Ventil zu geben. Sie ahnen nichts von meinen Plänen. Es gibt einen besonderen Grund, warum ich sie als Opfer gewählt habe, diese beiden, Hannah Franke und Pia Bachmann.
Kapitel 4
ICH
Heute bin ich Hannah Bachmann zum ersten Mal im Fitnessclub begegnet.
Wenn ich sie so auf dem Laufband betrachte, sehe ich ihr nicht an, dass sie bereits eine zweifache Mutter ist. Sie wirkt noch so jung, so unschuldig. Es liegt vor allem daran, wie sie einen mit ihren schönen Augen so unschuldig ansieht. Arglos, wie ein Kind mit einem grundsoliden Vertrauen in das Gute.
Ich stelle mir gerne vor, dass sie diese Überzeugung aus den Märchen erhalten hat, die ihre Eltern ihr vorgelesen haben. Jahr für Jahr, jeden Abend vor dem Schlafengehen. Eine hohe Stimme für Rotkäppchen, eine tiefe Stimme für den Wolf. Nicht herumirren, sondern brav auf dem Pfad der Tugend bleiben! Und am Ende wird alles gut. Immer.
Die Einflüsterung, woran du in deiner Jugend fast erstickst, bleibt. Ewig.
Hannah wuchs in einem sicheren, klaren Umfeld auf und hat bis vor einigen Monaten keine Grenzen überschritten. Das Bedürfnis hatte sie nicht – sie ist so eine Frau, man sieht es an allem.
Sie hat einen schönen Körper, unter diesem Hemd. Die Sporthose strafft sich eng um ihr Gesäß. Etwas zu eng, vielleicht, über dem Bund ein kleiner Rand aus Bauchfett. Die meisten Männer würden sie ein wenig mollig nennen, aber für mich ist nichts falsch an dem Fleisch auf ihren Oberschenkeln, dass sie versucht, krampfhaft abzutrainieren.
Sie schenkt jedem, mit dem sie Augenkontakt hat, ein breites Lächeln. Dabei wischt sie sich ihr blondes Haar aus dem Gesicht und hebt ihre Schultern ein wenig an. Doch manchmal fällt sie in sich zusammen. Macht sich klein - unterwürfig.
Sie lächelt mich an. Sie ist neu in der Stadt, in unserem Viertel, und braucht Freunde.
Ich halte das Laufband an, stehe still, bin fasziniert von den Schweißtropfen, die auf ihrer Oberlippe glitzern. Ihre vollen Lippen sind ständig in Bewegung. Während sie mit mir spricht, sehe ich ihre Zunge hin und her blitzen. Sie hält eine Wasserflasche an ihren Mund und wirft den Kopf nach hinten. Ihr Hals ist freigelegt, ihre Speiseröhre zieht sich rhythmisch zusammen. Sie trinkt gierig. Glitzernde Wassertropfen gleiten entlang des Mundwinkels zu ihrem Hals und erlöschen auf der erhitzten Haut zwischen ihren Brüsten. Es kommt mir vor, als ob sie mir ihren Hals anbietet, wie eine Beute, die sich ergibt – dann wischt sie sich den Mund mit dem Handrücken ab.
Meine Wut drängt sich bis in die Zehenspitzen. Sie lässt sich kaum noch unterdrücken.
Ich schaue mich um. Niemand bemerkt uns.
„Puh“, keucht Hannah. Mit dem Daumen verschließt sie die Flasche. „Training abgeschlossen?“
Ich nicke.
Ihre Naivität grenzt an Rücksichtslosigkeit. Für Hannah bin ich nur eine Person, die freundlich zu ihr ist. Auch jetzt, da ich meine Augen offen über ihren Körper schweifen lasse, bleibt sie freundlich.
Sie reicht mir die Hand. „Ich bin Hannah. Hannah Bachmann“, sagt sie.
Ich weiß, Hannah. Ich hasse ihren Namen. „Ein schöner Name.“
„Danke.“ Wieder dieses Lächeln.
Sie hat eine schöne Stimme. Ein wenig heiser.
Ich frage mich, wie sie klingt, wenn Hannah sich die Seele aus dem Leib geschrien hat und apathisch vor mir auf dem Boden liegt. Wenn ich ihr Fleisch vor mir aufklaffen sehe und das Bewusstsein für die Schrecken, die auf sie warten, auf ihrem tränenreichen Gesicht zu erkennen sind.
Ich werde bald wissen, wie das ist.
Schon bald.
Kapitel 5
Hannah
Mein Kopf fühlte sich an, wie mit Watte gefüllt. Hinter den Lidern wirbelten seltsame Traumbilder.
Ein weißer, unscheinbarer Nebel zog sich wie aus dem nichts über den Friedhof. Vor dem Grab glaubte ich fast, den Atem des Mädchens zu hören. Mein Herz pochte wild. Tote Augen starrten mich aus der Dunkelheit an. Das Kind lächelte und winkte mir zu. Seine Lippen bewegten sich, sagten „Komm, Hannah, leg dich zu mir.“
Die Worte flogen davon, während der Wind mit seinem blonden Haar spielte, mit dem leichten Stoff seines Kleidchens.
Plötzlich verschwand das Grab im Nebel und ein Schrei durchbrach die Stille der Nacht. Ein klapperndes Geräusch übertönte ein dumpfes Wimmern.
Wieder ein Schrei. Im Halbdunkel sah ich Mias aufgerissene Augen, meine Hände lagen auf ihrer Brust.
„Nein!“ Eine fremde Stimme. Immer und immer wieder rief sie Mias Namen.
„Lass das Kind endlich los“, schrie eine Frau, das bleiche Gesicht zum Himmel erhoben. Sie stieß mich weg und zeigte auf das Kind. „Mia ist tot!“
Wieder auf dem Friedhof blickte ich in dunkle Augen, dann blendete mich ein Licht. Der Himmel stürzte ein.
Ich wimmerte im Traum, im Dunkel der Angst.
Und wachte auf, saß kerzengerade in meinem Bett.
Angstschweiß.
Der Raum, er war mir fremd, ich erkannte seine Umrisse nicht. Die stahlblauen Vorhänge. Die Tür an der falschen Seite des Zimmers. Der Wecker stand nicht an seinem festen Platz. Die Uhrzeit: 3:33 Uhr.
Wieder 3:33 Uhr.
Immerfort 3:33 Uhr.
Eine Dreizinkenuhrzeit, die ihre Krallen in die Nacht pfählte. Ein fahler Mond zeigte sich am Himmel und schickte sein eisiges Licht durch die Wolkenschleier in mein Schlafzimmer. In der Luft schwebten unzählige Wassertröpfchen und reflektierten das Licht.
Ich schloss meine Augen und hörte ihre Stimme. Sie hob und senkte sich in einer Satanslitanei, manchmal erklang lachen, manchmal schluchzen. Alles strebte dem Höhepunkt zu, den ich noch nicht kannte. Ich wagte nicht, zu schlafen, aus Angst vor den Träumen, die wiederkommen würden. Die Nacht war wieder voll gräulicher Geräusche. Es schien, als ob Mia mich rief.
Meine Lippen waren zu einem stillen Schrei geöffnet. Mein Herz pochte wild unter dem Brustkorb. Ein Schaudern schoss durch meine Adern wie ein Düsenjäger, der die Schallmauer durchbrach. Peng!
Rosafarbene Ringelsöckchen.
Nicht daran denken. Nicht an Hello-Kitty-Söckchen denken!
Die Erinnerung kehrte zurück. Dies war mein neues Schlafzimmer.
Ich bin zu Hause, einfach nur zu Hause.
Neben mir kam David schlaftrunken hoch.
„Entschuldige, ich wollte dich nicht aufwecken“, sagte ich leise.
Mein Nachthemd klebte am Rücken, mein Mund war trocken und schmeckte nach Eisen. Ich hatte mir in die Wange gebissen. Rasch nahm ich einen Schluck Wasser aus dem Glas, das stets auf dem Nachttisch stand, ein Blisterstreifen Schlaftabletten lag unberührt daneben, wie einst zu Hause – einst bedeutete in meinem ehemaligen, vertrauten Haus.
„Oh, okay, okay.“ David strich mir mit einer Mischung aus Ärger und Mitleid über den Rücken. Ich kannte den Grund: die nicht eingenommenen Schlaftabletten.
„Versuch bitte, wieder einzuschlafen, Hannah. Es war nur ein Albtraum“, sagte er.
Ich nickte, sank wieder in die Kissen. Sicher … Es war ein Albtraum, der die Erinnerungen an den verheerenden Vormittag wachrief …
30. November 2017
Ich trat auf die Bremse, die mir nicht gehorchen wollte. Meine Hände umklammerten das Lenkrad so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten. Der Wagen drehte sich in einem Meer aus Eis und Schnee, drehte sich schneller und schneller. Meine Atmung versagte. Überall wirbelte der Schnee.
Ich wusste sofort, dass ich mit meinem Auto etwas erfasst hatte.
Nein … Das kann nicht sein … Es darf nicht sein.
Ich wollte nicht glauben, was mein Verstand längst begriffen hatte und erstarrte. Das Blut in meinen Adern wurde zu Eis. Der Verstand eilte meinem davonsausenden Körper in Zeitlupe hinterher. Ich sah meine Hände am Lenkrad, hörte das Geräusch der Bremsen und einen Schrei. Mein Schrei. Ich spürte die Hitze der Klimaanlage, das Gleiten des Wagens auf spiegelglatter Fahrbahn. Die Welt drehte sich in dem weißen wirbelnden Schnee, dort, wo er sich rot färbte.
Eine unsichtbare Hülle aus Eis umschloss meine Seele und machte mich unantastbar, ich war nur eine Zuschauerin, die nach Belieben eingreifen konnte, die auf den Fahrersitz fassungslos zusah – unter der eisigen Hülle des Bewusstseins, an die Zeit gekettet.
Plötzlich blieb der Wagen stehen.
Ich tauchte auf, sah Menschen auf mich zukommen. Ich musste – ja, was musste ich nur tun?
Aussteigen, das Kind retten, die Zeit zurückdrehen, alles rückgängig machen, was du angerichtet hast … – nur nicht nachdenken, dachte ich.
Mit Füßen, die nicht mir gehörten, lief ich über die Straße. Schritt für Schritt kam ich einer Frau näher, die hysterisch „Nein“ schrie. Neben ihr lag ein kleines Mädchen auf dem Rücken im Schnee, die Arme in einem seltsamen Winkel von sich gestreckt. Zöpfe, Haarspangen, flauschige Ohrenschützer.
Ich kniete nieder, legte meine Hände auf den kleinen Brustkorb des Kindes.
Herzmassage. Hundertmal pro Minute. Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
„Sechzehn, siebzehn, achtzehn …“
Neunundneunzig, einhundert.
Mund-zu-Mund-Beatmung. Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
Warum half mir niemand?
Ich blickte auf den Boden, dann hoch auf die Tausenden Schneeflocken, die vom Himmel rieselten. Aus dieser Perspektive waren sie graubraun. Dunkel und bedrohlich, schmutzig, unfreundlich. Unten angekommen, bildeten sie indes eine weiße Decke, die sich über den kleinen Körper des Mädchens legte.
Ein Schuh lag am Straßenrand. Ich blickte auf die kleinen Füße. Das Mädchen trug rosafarbene Ringelsöckchen. Hello-Kitty-Söckchen. Sie saugten die Feuchtigkeit auf und färbten sich langsam rosa-violett.
„Hören Sie endlich auf!“, schrie jemand. „Mia ist tot!“
Ich blickte in das Gesicht des Mädchens. Seine Hautfarbe wurde zu Schnee. Und mein Herz zu Eis.
Muster bildeten sich und verschwanden wieder, so monoton, dass ich irgendwann das Denken einstellte. Ich befand mich in eine Art Dämmerzustand, als könnte ich darin alles vergessen. Der Krankenwagen kam. Schmerz hämmerte hinter meinen Schläfen. Ich riss mich von meinen Gedanken los. Sanitäter legten das Kind auf eine Trage, hoben es hoch. Schlossen die Türen.
Jemand legte mir eine Decke um die Schultern. „Wie geht es Ihnen? Verstehen Sie mich? Wissen Sie, wo Sie sind? Können Sie mir Ihren Namen nennen?“
Ich saß auf dem Bürgersteig. Meine Seele lag unter dem Eis. Die Schneeflocken, die früher rein und klar waren, vom schönsten, jungfräulichsten Weiß, wirbelten in diesem Moment als dunkle Punkte bedrohlich vom Himmel.
Tränen liefen mir über die Wangen. Ich weinte mit dem Himmel, mit dem Schnee, während in meinem Kopf die Beobachterin nur zusah und sich benahm, als wäre sie das Opfer. Sie, anstelle des kleinen Mädchens, dessen Schuh noch am Straßenrand lag. Die Rettungssanitäter hatten ihn vergessen. Ich musste sie darauf hinweisen. Das Mädchen konnte doch nicht mit nur einem Schuh …
„Hallo? Hören Sie mich?“, rief ich und blickte einen der Sanitäter an. „Das Mädchen … Sie wird doch wieder …?“ Meine Stimme klang fremd. Im beiden Ohren war ein ständiges Pfeifen. „Im Krankenhaus wird ihr doch geholfen? Dort haben Sie Geräte und Ärzte und können sie operieren …?“
Seine Mitternachtsaugen funkelten.
Dann nur noch Schwärze.
Ich hatte vor drei Monaten, außer einem schweren Schock, keine Verletzungen davongetragen. Dennoch hatte ich eine Woche später dem Leben den Rücken gekehrt und aufgehört in der Realität zu leben. Hatte nichts mehr gegessen. Unter dem Eis war man nicht hungrig.
Ich hatte Mia getötet und sie tötete mich. In dieser Nacht vernahm ich bereits ihre seltsame Stimme, süß, samtweich, sahnig, als bat sie mich um ein Bonbon.
Ich bin jetzt dein einziges kleines Mädchen. Ihr Flüstern ließ mich erschaudern.
Schau, wie du aussiehst.
„Es ist doch erst vier Monate her“, antwortete ich immer wieder.
Weißt du denn, was genau passiert ist?
Ich schämte mich, war kleiner als je zuvor.
Es wird alles gut.
Die Stimme hatte gelogen.
Als die Kleidung um meinem Körper schlackerte und ich David von der Stimme erzählte, schickte er mich zu einem Psychiater. Dr. Lange – ein massiger Körper, Glatze, kugelrundes Gesicht, freundliche braune Augen – half mir. Eines Tages legte er seine Hand auf meine und die Eisblase bekam einen Riss. Da konnte ich endlich die Worte aussprechen: „Ich habe ein kleines Mädchen getötet.“
„Wie war der Name des Kindes, Hannah?“
„Mia. Ihr Name war Mia.“
Er lächelte. „Sehr gut, Hannah. Sie haben heute zum ersten Mal den Namen des Unfallopfers genannt.“
Unfallopfer?
„Aber woher nehme ich den Mut, weiterzuleben, Dr. Lange?“, fragte ich.
„Kleine Schritte“, hatte der Psychiater geantwortet. „Schon der kleinste Schritt ist ein Schritt nach vorn.“
Ich nickte.
Danach begann mein Körper wieder feinste Anpassungen vorzunehmen, glich jede Veränderung meines Geistes in Geschwindigkeit und Richtung aus, wenn Erinnerungen an den Tod des Mädchens wie Blitze aufzuckten. Und wenn sich mein Gehirn aus der frostiger Umklammerung von Schnee und Eis befreite, gab es jedes Mal das Gefühl einer süßen, verschwommenen Erlösung.
Einmal hatte ich David gefragt, ob er dieses Gefühl kannte,
ob er wusste, was ich meinte, aber er warf mir nur einen eigenartigen, besorgten Blick zu.
Nicht so Dr. Lange. Mein Psychiater hatte mich vollkommen verstanden und betonte auch immer, dass ich künftig behutsamer mit mir umgehen sollte.
Kapitel 6
Hannah
Halb sieben. Der Beginn eines neuen, strahlenden Tages in der brandneuen, paradiesischen Villa in Pullach. Ich wachte mit einem rauschhaften Hochgefühl auf und war voller guter Vorsätze. Im Badezimmer fegte ich mit einem Schwung den Inhalt des Medikamentenschränkchens in den Abfalleimer. „Ab sofort keine Schlaftabletten mehr.“ Ich fühlte mich heute Morgen klar und frisch wie ein sprudelnder Wasserfall.
Viertel vor sieben. Zeit fürs Frühstück. Die Küche roch nach Erbrochenem. Ich nahm Aufnehmer und Eimer aus dem Dielenschrank unter der Treppe und füllte den Eimer mit Essigwasser, und seufzte. Windsors Erbrochenem war im Laufe der Nacht durch die Fußbodenheizung auf den Fliesen eingetrocknet. Dem Hund ging es nicht gut.
Das Essigwasser brannte in meinen Nasenhöhlen. Trotz meines Hochgefühls fragte ich mich, warum ich gleichzeitig dieses seltsame Gefühl hatte, mein Leben könnte entgleisen. Ob mein Körper und mein Geist den Tod des kleinen Mädchens noch immer nicht verkraftet hatten? Meine Familie hatte mir danach ihre Fürsorge geschenkt; eine Zeit der Zärtlichkeit, in der die Angst sich verflüchtigte. Das Vergessen schützt meine Seele, behauptete mein Psychiater stets. Aber war das so? Es gab immer wieder mal Momente, da hörte ich ein Kinderlachen, eine niedliche Stimme, nur konnte ich nicht hören, was das Mädchen sagte, da war nur das Sausen in meinen Ohren. Seine Stimme hatte sich mit den Stimmen meiner eigenen Kinder zu einem schauerlichen Kreischen vermischt, das nachts jeden Gedanken an Schlaf ausschloss.
Ich durfte die Vergangenheit nicht an mich herankommen lassen, und insbesondere David nicht mit meinen Ängsten belasten – meinen Mann mit dem energischen, scharf geschnittenen Gesicht, den intelligenten dunkelbraunen Augen; David, der Geist und Körper immer unter Kontrolle hatte.
Langsam kehrte meine gute Laune zurück. Viertel vor acht. Kaffee kochen, Orangen pressen, den Tisch decken. Das Brot in den Korb legen. Durchatmen.
Hugo und Sofia kamen in ihren Schlafanzügen die Treppe herunter. Ich schenkte ihnen mein schönstes mütterliches Lächeln.
„Hey, ihr Rabauken, wie wär’s mit einem guten Morgen, Mama?“
Keine Antwort. Stattdessen griffen die Kinder in den Brotkorb und stritten um das Nutella-Glas.
Ich warf ihnen einen warnenden Blick zu. „Wartet bitte, bis Papa da ist.“
Hugo steckte seinen Löffel ins Glas und Sekunden später die Schokoladenpaste in den Mund. Dann wollte er sein Frühstücksei in Scheiben geschnitten und Sofia keine Krusten an ihrer Brotschnitte.
David betrat die Küche, die Morgenzeitung unter dem Arm. Statt des perfekt geschnittenen Designeranzugs mit dünnen Nadelstreifen, den ich für ihn zurechtgelegt hatte, trug er eine Cordhose und einen Pullover.
„Guten Morgen, mein Schatz.“ Sein Körper hing entspannt in diesem Outfit, das ich so sehr verabscheute. Wie oft hatte ich diese Cordhose der Mülltonne überlassen wollen und mich letzten Endes doch nicht getraut. Mein Verstand unterdrückte auch heute eine bissige Bemerkung.
David schlug die Zeitung auf und streckte seine Hand mit der Kaffeetasse aus.
Ich schenkte ihm ein.
Innerhalb von zehn Minuten verwandelten die Kinder den Frühstückstisch in ein Schlachtfeld. Überall lagen Brotkrümel verteilt und die Schlafanzüge waren mit Nutella bekleckst. Hugo kippte ein Glas Orangensaft um. Der Saft verteilte sich über die Tischdecke und tropfte auf den Küchenboden.
Lustlos köpfte ich ein Ei. Eine gute Hausfrau pellte ein Ei, hätte ihre Mutter in einem solchen Moment gesagt. Ich war traurig. Wegen des Eis. Wegen des Umzugs. Wegen Pia. Wegen allem. Der Tag hatte kaum begonnen, und schon war ich wieder müde. Ich ignorierte die tobenden Kinder und fragte mich, warum ein Tag nicht mal so verlaufen konnte, wie ich ihn mir wünschte. David versteckte sein Gesicht hinter der Zeitung.
In dem Moment fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Mir wurde schmerzlich bewusst, dass ich begann, das Leben meiner Mutter zu führen, die nur darauf bedacht gewesen war, die Fassade zu wahren. Ich seufzte.
Meine aufsteigende Wut schäumte innerlich über, wie die Milch auf dem Herd. Ein zweites Glas mit Orangensaft kippte um. Auf dem Herd kochte die Milch weiter über.
Die Kinder starrten mich mit großen Augen an. Hugo hielt seine Hand vor den Mund und grinste. „O Mama.“
„Nur noch ein paar Monate“, murmelte ich und atmete tief ein. „Dann beginnt der Frühling. Dann kann ich die Terrassentüren wieder weit öffnen.“
David schüttelte kaum sichtbar den Kopf. „Bravo, Süße. Es ist Anfang Februar.“ David rollte mit den Augen, als sei er meiner überdrüssig. „Gott sei Dank. Kinder, dann gibt es statt Haferschleim, frisch gemähtes Gras zum Frühstück.“
Mein Mann meinte aber genau das Gegenteil von dem, was er sagte. Es lief wieder gut zwischen uns.
„Papa muss zur Arbeit. Heute bringe ich euch in die Schule.“
Ich sah mich in meiner Küche um. Sie war anfangs mein Reich gewesen, doch jetzt gab es hier rein gar nichts. Mein neues Leben und meine Träume lagen im Abfluss.
Die Angst im Dunkel war am Ziel.
Der Schweiß lief in kleinen Bächen über meinen Rücken. Mias Stimme meldete sich in meinem Kopf. Subtil, demütigend.
Seht mal, wie unfähig eure Mutter ist. Es schmerzte und zerriss mein Herz. Mein Leben fühlte sich an, wie Fahren auf einem Fahrrad, bei dem der Rahmen am Reifen schleifte.
„Mami, wenn Windsor krank ist, kann ich auch einen Tag zu Hause bleiben.“ Mein Sohn steckte seinen Finger in den Mund und dann in die Schokoflocken.
„Und die Sportstunde wegen eines kranken Labradors verpassen? Wenn ich du wäre, würde ich gerade für den Sport enorme Lust verspüren.“
Hugo war sechs, aber so hartnäckig wie ein erwachsener Mann. Ihm war nicht nach Schule. Er mochte seine neue Schule nicht.
Ich auch nicht.
Nach dem Frühstück fuhr ich Hugo zur Schule. Die Fahrt begann bereits nach einigen Minuten unwirkliche Züge anzunehmen, denn immer dann, wenn ich in den Rückspiegel blickte, sah ich in die Augen der kleinen Mia. Seltsamerweise kam es mir manchmal so vor, als sei Mia ein Mädchen gewesen, das ich noch von Hugos ehemalige Schule her kannte, aber das konnte nicht sein.
In seiner Klasse angekommen, weigerte sich Hugo, meine Hand loszulassen. Ich verstand meinen Sohn, aber es ging nun mal nicht anders. Die Wahl einer Schule ließ immer nur eine begrenzte Entscheidungsfähigkeit zu.
„Ich möchte mit dir und Sofia nach Hause gehen, Mama“, nörgelte Hugo.
Sofia zog ungeduldig an meiner Hand.
„Schatz, das ist nicht möglich. Komm schon, die Lehrerin ist sehr nett. Und da ist doch auch noch dein neuer Freund?“ Ich winkte Benny zu.
Hugo sah mich flehend an. Ich drückte ihm schnell einen Kuss auf die Stirn.
Idealerweise hätte ich meine Kinder an einen Ort gebracht, an dem sie niemand finden konnte. Beispielsweise Monkey Island. Eine Insel im Pazifischen Ozean, die zwar auf der Landkarte eingezeichnet war, wo aber nie ein Schiff anlegte, weil die Insel in Wahrheit nicht existierte. Wenn wir dort wären, würden wir auch nicht existieren. Es gäbe uns nicht, wir konnten nie gefunden werden.
Im Klassenzimmer herrschte Tumult. Aufgeregt schleppten die Kinder ihre Stühle in die Mitte. Die Lehrerin grüßte uns mit einem obligatorischen „Guten Morgen“ und „Such dir schnell einen Platz, Hugo!“
Benny setzte sich neben ihm.
„Das ist aber lieb von ihm“, flüstere ich Hugo ins Ohr.
„Unser Hund ist krank. Windsor hat sich übergeben“, sagte Hugo.
„Oh“, erwidert Benny ernst. „Wir haben einen Zwerghamster. Er heißt Fred.“
Ich atmete erleichtert auf, endlich konnte ich die Schule verlassen. Hugo hatte seinen Platz gefunden. Ich nahm Sofias Hand und ging mit ihr den Flur entlang, vorbei an der Schulhofmafia. Die Mütter standen in Gruppen verteilt und tuschelten miteinander. Ich spürte ihre Blicke. In ihren Gesichtern stand blanke Neugierde. Den Bewegungen ihrer Lippen nach sah es wie „das ist sie“ aus. Jeder hier wusste, wer ich war.
„H … Hannah …? Ich bin dein einziges Kind.“
Hatte ich gerade meinen Namen gehört? Niemand hatte in meine Richtung gesehen. In Wahrheit sahen alle auffallend zur Seite.
Ich hob Sofia hoch und drückte sie fest an mich. „Komm, Süße. Wir fahren nach Hause und sehen nach Windsor.“
Die Mütter haben nicht nur eine vage Ahnung. Sie wissen, wer Hannah Franke ist und sie wissen, was ich getan habe. Da war es wieder, dieses eisige Gefühl, das mich durchflutete. Die Augen der Mütter drängten mich vorwärts, auf den schnellsten Weg in mein neues Zuhause: ein Klotz, kalt, schwarz und hart.
Nichts war mehr wie früher.
Kapitel 7
Hannah
Sie hatten mich gewarnt – meine Schwester Pia, meine Freundin Bea, sogar Dr. Lange, mein warmherziger Psychiater –, dass Umziehen so eine Sache wäre. Als ich das letzte Mal bei ihm war, hatte ich es nicht geschafft, mir irgendetwas von der Seele zu reden. Aber vermutlich hätte ich es ohnehin nicht gekonnt. Manche Dinge waren so verdammt schwer auszusprechen.
„Geh ein wenig vorsichtiger mit deiner Energie um“, sagten sie. „Unterschätze das nicht, okay?“
Nun, in Wahrheit lief es gut. Was war denn so schwierig am Auspacken von Umzugskartons? Konnten das nicht selbst die Dümmsten dieser Welt? Es war nur eine Frage der Ausdauer. Nur nicht ausflippen, wenn wieder jemand etwas brauchte, von dem ich vergessen hatte, in welchem Karton es war.
„Es ist normal, dass du solche Dinge vergisst!“, sagte dann stets meine Schwester.
Solche Sätze weckten in mir Mordgelüste wie auch Pias Lieblingswort: Umzugsstress.
Ich schaltete das Radio ein, brachte Sofia ins Bett und ging zum Briefkasten. Der Briefträger winkte mir aus der Ferne zu. Oben auf dem Poststapel lag eine Einladung zu einer Kindergeburtstagsparty von Vera, einem Mädchen aus Hugos früherer Klasse.
Ich lächelte und drehte die Karte um. Hello-Kitty mit einer Geburtstagstorte in den Händen. Kommst du auch zu meiner Party?
Mit einem Schlag war ich wieder dort, zurück im Schnee, unter dem Eis. Zurück auf einer spiegelglatten Straße.
30. November 2017. Vor drei Monaten.
Meine Hände zitterten. Die Erinnerung kam wie eine Hitzewelle: brennend, versengend und schmerzlich zugleich, ein Moment, wie ich ihn nicht oft erlebte und der eine Intensität ausdrückte, die mich an einer gewaltigen Explosion erinnerte …
30. November 2017
Der Vormittag war wieder einmal weiß überladen. Es schneite seit Wochen. Fernsehen und Radio berichteten vom Klimawandel. Es war mir egal. Ich wollte nur, dass der Schnee verschwand, dass das Eis schmolz.
Jeden Morgen schaufelte David die Garageneinfahrt frei, Hugo hinterließ mit den Stiefeln Pfützen im Flur, und Windsor stolperte mit seinen Pfoten, die ich zum Schutz mit Vaseline eingerieben hatte, stets dazwischen.
Meine Augen schmerzten von dem blendenden Weiß des Schnees und die Kälte war ätzend langweilig, wie sonst die Monate zwischen den Weihnachts- und Osterferien.
Nachdem ich Hugo in die Schule gebracht hatte, fuhr ich mit dem Wagen ins Einkaufszentrum. Ich hatte mir ein neues Paar Stiefel verdient, passend zum braunen Wintermantel, den ich in der Boutique meiner Freundin Bea gekauft hatte. Im Radio dröhnte Herbert Grönemeyer sein „Ich lieb mich durch“. Ich drehte die Musik laut auf, sang mit. Über mir drifteten die Wolken auseinander. Dann war sie endlich da, die Sonne. Ihre Strahlen waren so greifbar wie die aus Hugos Bilderbüchern. Sie sprenkelten den Schnee mit glitzernden Pailletten.
Ich kniff die Augen zusammen, bildete mir ein, die Wärme käme nicht mehr aus der Klimaanlage, der Schnee wurde zu Sand. Ich dachte an den Bikini im Schrank und an die Sommerferien am Strand. Die Wärme, meine Familie, das Glück war so spürbar, selbst der Winter wurde eines Tages zu Ende gehen.
In meiner Tasche erinnerte mich das Handy an einen Termin. Pia Ultraschall-Untersuchung. Ob die Hormontherapie erfolgreich war?
Mit einer Hand am Lenkrad wählte ich mit der anderen Pias Rufnummer. „Und?“
„Hey.“ Ein viel zu kurzes, viel zu trauriges hey.
Ich wollte es nicht wirklich wissen. „Was ist los, Pia?“
„Es ist nicht mehr da!“
Ich hörte meine Schwester schluchzen und schluckte. „Ich bin mit dem Wagen unterwegs. Hast du einen Moment, Pia? Dann nehme ich dich ans Ohr.“
Das darf nicht wahr sein. Das Leben konnte nicht so unfair sein. Jugendliche, geistig Behinderte und Menschen, die ihre Kinder in vielerlei Hinsicht misshandelten, bekamen die Babys förmlich in den Schoß geworfen. Warum nicht Pia? Meine Schwester, die so eine gute Mutter sein würde. Die es so sehr verdient und so hart dafür gekämpft hatte.
Ich legte mein Handy auf den Beifahrersitz, öffnete das Handschuhfach und suchte in dem ganzen Müll nach dem Handykabel mit den Ohrstöpseln. Genervt zog ich an das Kabel und alles donnerte auf den Boden.
„Ich komme zu dir, Pia“, rief ich in Richtung Handy. Warum hatte ich auch vergessen, sie heute Morgen anzurufen? Verdammt.
Meine zusammengekniffenen Augen auf die Straße gerichtet, lehnte ich mich über die Beifahrerseite, um die Ohrstöpsel vom Boden aufzuheben. Der Radiosender spielte jetzt Eric Claptons Tears in heaven. Eiskristalle leuchteten von allen Seiten. Ich hörte meine Schwester weinen. Pias Trauer flog zu mir, die Welt erstarrte, obwohl die Temperatur bereits weit unter dem Gefrierpunkt lag.
Ein Mädchen lief zwischen zwei Fahrzeugen auf die Straße.
Etwas flog an der Windschutzscheibe vorbei.
Plopp.
Ein Straßenbuckel.
Mein Fuß reagierte blitzschnell, rutschte aber von der Bremse.
Die Panik lähmte mich. Ich hatte die Kontrolle über mein Fahrzeug verloren und befürchtete vor Angst bewusstlos zu werden. Ich musste mich nur auf eins konzentrieren: linker Fuß, rechter Fuß.
Und ich sah …
Blut.
Rosafarbene Hello Kitty-Söckchen.
Meine Seele tauchte ab. Lag unter dem Eis.
Kapitel 8
Hannah
Wir wohnten jetzt fast zwei Wochen in Warnberg. David hatte die Villa gefunden und die Umbauarbeiten beaufsichtigt. Ich hatte endlich den offenen Kamin bekommen, von dem ich so lange geträumt hatte, Sofia ihr pinkfarbene Prinzessinnenzimmer und in Hugos Piratenzimmer stand ein Bett in Form eines Schiffes.
Mein Mann hatte auch den Umzug organisiert und die Umzugskartons gepackt. Selbst die Idee umzuziehen, stammte ursprünglich von ihm. Er kümmerte sich um mich, war in hohem Maße fürsorglich. Pia und meine Freundin Bea hatten recht. Mit einem solchen Ehemann konnte ich mich glücklich schätzen.
Ich ballte meine Fäuste und schlug in mein Kopfkissen. Ich musste nur die richtige Schlafposition finden, ich hatte zu lange auf dem rechten Ohr gelegen. Vermutlich war das die Ursache für meinen Albtraum. Sicher … Ich ignorierte die klamme Bettdecke und versuchte, mich auf das gleichmäßige Atmen von David zu konzentrieren. Einatmen, Ausatmen. Ruhig, langsam, regelmäßig. Ruhe.
Mein neues Leben. Das Leben der Hannah Franke, Ehefrau von David Franke, dem erfolgreichen Unternehmer der Franke GmbH, Mutter der vierjährigen Sofia und des sechsjährigen Hugo. Warnberg verkörperte all das, womit München nicht aufwarten konnte: soziale Kontrolle, frische Luft im Grünwalder Forst oder Forstenrieder Park, Mütter mit Kindern in den Straßen mit den prächtigen Häusern und Villen statt herumlungernder Junkies, eine Zukunft statt einer Erinnerung wie ein schwelendes Feuer. Zu viert wollten wir hier neu beginnen. Ich hatte große Lust dazu verspürt und das Gefühl, dass es mir hier gelingen könnte.
Mein Bein berührte Davids Körper. Ich wollte für meinen Ehemann wieder die Frau sein, die er verdiente, und die Mutter, die ich wahrhaftig war. Mit jedem Umzugskarton, den ich leerte, fühlte ich die Traurigkeit in mir schwinden. Ich fand langsam wieder zu mir, kehrte zu meiner Familie zurück. Ich spürte es förmlich! Ich hatte einen liebenswerten Mann, zwei wunderbare Kinder, ein großartiges Haus. Einen verwirrten Labrador.
Vielleicht würde ich obendrein noch einmal in meinem Beruf als Architektin arbeiten. Alles zu seiner Zeit. Ja, vielleicht war das eine gute Idee. Ablenkung, wieder etwas für die Gesellschaft bedeuten. Und das Mädchen Mia vergessen.
Halb fünf. Alles zu seiner Zeit. Zuerst musste ich sicherstellen, dass das Leben von hier seine Runden drehte.
Hugo wollte den Turm von Pisa in die Schule mitnehmen. Und sein Auto, weil es ebenfalls neu war. Der Mittwoch war Spielzeugtag und der Maßstab, an dem der Status für den Rest der Woche von den Kindern bestimmt wurde, aber vor allem von den Müttern. Meine Hoffnung sank, als ich Marie mit einem Albinohasen in den Armen vor dem Klassenzimmer entdeckte. Ihre Mutter strahlte neben einem riesigen Käfig. „Vielleicht ist es kein richtiges Spielzeug, aber knuffig ist der Hase schon“, sagte sie und grinste.
Für wen?, fragte ich mich. Ich glaubte, ein seltsames Geräusch zu hören – ein Aufheulen, wie von einem verwundeten Tier, so herzzerreißend und eindringlich, dass es fast brutal klang.
Als ich mich umdrehte, sah ich Hugo, sein Gesicht weiß wie Papier vor schierer Fassungslosigkeit, seine großen Augen rund und traurig. Ich hatte es kommen sehen und hätte ihm etwas Auffälligeres mitgeben sollen. Das giftgrüne Küken, das quietschend herumhüpfte oder das einziehbare Star-Wars-Lichtschwert. All die Dinge, die noch irgendwo in einem Umzugskarton lagen. Ich musste härter an mir arbeiten, eine humorvollere Mutter sein und mein Bestes geben. Hugo hatte heute keine Chance, sich im Klassenzimmer zu profilieren.
Mein Sohn biss sich auf die Lippe, und ich gab mich fröhlich. „Komm Hugo, schau mal was für ein süßes kleines Kaninchen. Aber dein Turm von Pisa ist auch ein großartiges Spiel für alle.“
Er nickte tief gehend und verlassen. Schon so erwachsen. Mit seinen langen Beinen und langen Armen ging er resigniert zu seinem Platz. Ob er wollte oder nicht, er war Teil dieser Klasse.
Zu allem Überfluss wollte Sofia das Kaninchen unbedingt streicheln. Zu viele Kinder hatten sich um Marie versammelt, aber vor allem war da der Blick von Maries Mutter, die mich auf Distanz hielt. Ich war nicht willkommen. Sofia war nicht willkommen. Könnte ich meine Kinder nur vor der Wahrheit beschützen, meine Arme wie Flügel ausbreiten und um sie legen, immer für sie da sein.
Die zweite Glocke läutete, die Lehrerin schloss die Tür. Hugo klammerte, die anderen Mütter starrten uns an.
„Alles wird alles gut, Liebling“, flüsterte ich. „Komm schon, die Lehrerin möchte anfangen.“
„Ich will nicht“, schluchzte Hugo und ließ den Turm von Pisa auf den Boden fallen. „Hier ist es blöd. Ich will wieder auf meine alte Schule gehen!“
„Liebling, ich hole dich doch heute Nachmittag wieder ab.“ Ich bückte mich und hob die Teile des zerbrochenen Turms auf.
„Hugo, kommst du?“, rief die Lehrerin. „Hast du Maries Kaninchen schon gestreichelt?“
Die falschen Worte zur falschen Zeit, dachte ich. Die Frau schaute über Hugo freundlich auf mich herab. Es waren die Blicke der anderen Mütter, die mich noch weiter nach unten drückten.
Jemand schob ein Teil des Spielzeugs in meine Richtung. Ich sah nicht hoch, sondern gab mein Bestes, um die hässlichen roten Narben auf meinen Armen zu verbergen.
„Ich werde deiner Mama helfen, Hugo“, sagte Benjamins Mutter und streichelte Hugo über sein blondes Haar. „Geh schnell hinein, sonst ist Benjamin so allein.“
Ich sah meinen Sohn an, sah einen letzten Ausdruck der Trauer in ihm. Einen Moment lang standen wir alle stumm da, dann nahm Hugo die Hand der Lehrerin und ging mit ihr ins Klassenzimmer.
Mein Junge ist mutig. Viel mutiger als ich es bin.
Benjamins Mutter reichte mir die Hand. „Hallo, ich bin Emma Schwarz.“
„Hannah Franke. Hugos Mutter.“
„Ach tatsächlich?“, sagte Emma Schwarz mit einem breiten frechen Lächeln.
Als wir zusammen das Schulgebäude verließen, konnte ich das Getratsche der Mütter hinter sich hören. „… Hannah … Du weißt doch sicher, wer das ist?“
Oder bildete ich mir das nur ein?
„Gefällt es Ihnen in Warnberg?“, erkundigte sich Emma auf dem Schulhof. Ich schob Sofias Dreirad.
„Ja, viel Grün, kein Lärm, gute Schule.“
„Hm …“ Emma blieb stehen. „Ich dachte, ich würde sterben, als wir in diesen Ort umgezogen sind. Es ist diese Stille, die alles aufsaugt. Keine Straßenbahnen, kaum Menschen, kein Lärm. Die Welt macht hier ständig ein Nickerchen.“ Sie zeigte in der Ferne auf einen Radfahrer. „Man sieht höchstens mal einen verirrten Fahrradfahrer.“
Wir gingen weiter, überquerten die Straße. „Ich habe das Haus von meiner Tante geerbt“, fuhr Emma fort. „Das kam mir nach meiner Scheidung sehr gelegen. Man gewöhnt sich an diese Stille. Irgendwann werden Sie sie zu schätzen wissen.“
„Glauben Sie, Frau Schwarz?“
„Nennen Sie mich doch bitte Emma.“
Wie nett, dachte ich und lächelte. „Gern.“
„Du kommst auch aus der Großstadt, Hannah?“
Ich nickte. „Mein Ruf ist mir wohl schon vorausgeeilt? “
„Aber sicher. Und wenn du mehr über dich erfahren möchtest, dann frag die Kassiererin im Supermarkt. Apropos Klatsch, wollen wir mal eine Tasse Kaffee zusammen trinken? Ich wohne drei Straßen hinter dir.“
„Sehr gern.“
Siehst du, Hannah, du bist hier eine Berühmtheit. Soweit mein Neuanfang.
„Ich würde mich freuen. Bis dann.“ Emma klackte auf ihren hohen Absätzen davon.
Ich erinnerte mich an einen Rat von Dr. Lange. „Lassen Sie sich nicht aus der Fassung bringen, Hannah!“
Für einen Moment, ganz kurz, sehnte ich mich nach seiner sicheren Praxis und seinem väterlichen Blick.
Die Stille war in das große Haus zurückgekehrt. Sofia machte endlich ihren Mittagsschlaf. Ich hatte der Kleinen einen vorsichtigen Kuss auf die Stirn gehaucht, das Zimmer verlassen und lautlos die Tür hinter mir zugezogen.
Im Schlafzimmer zog ich die Vorhänge zu und legte mich aufs Bett. Ich starrte an die Decke. Da, da kam sie wieder, diese undefinierbare Angst. Meine Kopfhaut zog sich schmerzhaft zusammen. Ich hielt den Atem an. Hatte ich wirklich etwas gehört? Ich machte das Licht an, sagte mir, dass ich unter Schlafmangel litt, und knipste das Licht wieder aus. Gewiss hatte ich mir das Geräusch nur eingebildet. Ich schloss die Augen, aber es gelang mir nicht, meine Gedanken zum Stillstand zu bringen.
Ich habe ein Kind umgebracht.
Ich horchte in mich hinein, suchte vergebens nach dem friedlichen Gefühl von heute Morgen, der den alten bösen Traum vertrieben hatte. In mir rührte sich etwas, etwas Unaufhaltsames, wie ein Tier mit spitzen Zähnen, das erstmals nach einem langen Winterschlaf den Bau verließ.
Die Vorahnung von etwas Schlimmen.
Kapitel 9
Hannah
Ich betrachtete die mitgebrachten Freilandrosen, die perfekt zu der geballten Farbenpracht des Wohnraums passten. Ich hatte die neugewonnene Freundin richtig eingeschätzt.
Emmas Haus war ein Nest aus zusammengewürfelten Gegenständen, die nicht zusammengehörten und dennoch wunderbar miteinander harmonierten. Ein orangefarbenes Sofa, bordeauxfarbene Vorhänge, lila- und rosafarbene Kissen, blau und grün gestrichene Wände und schöne alte Jugendstilschränke. Spielzeug und Kinderzeichnungen lagen überall verteilt. Die Diele war mit einem unfertigen Mosaik gefliest – „bis ich meine Inspiration wiederfinde“, erklärte Emma mit einem Lächeln. Sie schaute entspannt dem Spiel der Kinder zu.
Hugo und Benny führten Krieg mit T-Rex, einem Dinosaurier, und Sofia machte in ihrer mitgebrachten Puppenküche Pfannkuchen mit bunten Schokopastillen.
„Erzähl mal!“ Emma setzte sich im Schneidersitz auf die Couch und blickte mich ruhig und selbstbewusst an. Herausfordernd. Als wollte sie sagen: „Okay, du bist dran.“
In meinem Unterbewusstsein regte sich etwas. „Nächste Woche sind wir sieben Jahre verheiratet.“
„Chapeau. Dann hast du mir etwas voraus. Ich wurde kurz nach Bennys Geburt geschieden.“
„Hm … Hat er dich in einer so schwierigen Zeit allein gelassen? Traurig. Man kann sich so einem Übeltäter ein Stück weit in den Weg zu stellen, aber wie in jeder Beziehung kennt der Anfang das Ende nicht, und das Gute kann sich das Böse nicht vorstellen. “
„Hannah! Es war nicht seine Schuld.“, antwortete Emma und streckte sich aus. „Schau, ein Körper wie dieser braucht Streicheleinheiten. Mein Mann hat mich nach der Geburt von Benjamin nicht mehr berührt. Das ist alles, und es hat nichts mit Gut oder Böse zu tun.“ Sie seufzte tief. „Die Geburt ist ein Angriff auf die Weiblichkeit, du wirst auseinandergerissen. Aber den ganzen Tag kotzen und sabbern unsere süßen Kleinen uns voll, schreien und quengeln, und du bist damit beschäftigt, die Windeln zu wechseln und darauf zu achten, dass das Baby nur nichts in den Mund steckt. Holst Perlen aus den Öhrchen. Das alles gehört dazu. Versteh mich bitte nicht falsch, ich bin sehr gern Mutter, aber ich möchte nicht nur Mutter sein, sondern auch ich sein. Ich habe einen Anspruch auf einen Ausgleich. Wenn du mal einen Abend für dich und David hast, wird dein Mann dich wie ein wüster Wikinger bespringen.“
Ich nickte, es entging mir nicht, dass Emma in mir eine Gleichgesinnte suchte. Ich konnte in diesem Viertel, in dieser Straße, eine echte Freundin gebrauchen, die so erfrischend war, und vor Energie sprühte wie Emma. Aber auch ihre Art, mit den Kindern umzugehen, zeigte Emmas warmherzigen Charakter.
„Ich hatte eine Affäre“, fuhr Emma fort. „Bevor ich mit Benny schwanger wurde. Mein Mann fand es heraus, aber er blieb während der Schwangerschaft bei mir, obwohl schon seit einigen Jahren die Liebe zwischen uns im Abfluss lag.“ Sie warf einen Blick auf die Kinder. „Es ist nicht einfach, eine alleinerziehende Mutter zu sein, aber ich bin frei, muss keine Liebe heucheln, wo keine ist. Wenn Benny größer wird, werde ich das Leben in vollen Zügen genießen. Mütter, achtet auf eure Söhne, Emma kommt! Ich werde voll krass analog snashen!“
Ich hob die Augenbrauen. „Was ist das?“
„Aber Hannah, auf welchem Planeten bist du denn zu Hause! Snashen, abhotten, vierlagig tanzen, analogen.“
„Noch nie gehört.“
„Egal. Wenn ich die Worte benutze, fühle ich mich lebendig. Nun zu dir. Über dich kursieren die wildesten Geschichten.“
Ich zuckte zusammen, mir wurde heiß und kalt. Niemand hatte mich jemals so direkt auf den Unfall angesprochen.
„Oh, es tut mir leid, ist es dir unangenehm, darüber zu sprechen?“ Emma sprang auf, ihr Blick huschte durch das Wohnzimmer bis zum Käfig, in dem der Hamster in seiner Laufmühle schlief. „Hast du auch Haustiere?“
Ich war mir sicher, dass Emma mich mit Windsor schon einmal auf dem Schulhof gesehen hatte. „Es ist in Ordnung. Ich werde es dir sagen.“ Emma hatte einen Anspruch auf Offenheit. Das war es doch, was Freunde taten? Einander Dinge erzählen. „Ich habe ein Mädchen überfahren. Es war vier Jahre alt, so alt wie Sofia.“
Emma schwieg und lehnte sich zurück.
„Deshalb sind wir auch hierher gezogen“, fuhr ich fort. „Wir wohnten damals ganz in der Nähe der Unfallstelle. Ich fuhr auf dem Heimweg von der Schule, vom Einkauf oder was auch immer, stets über diese Straße, wo es passierte, und … Nun, David hat alles arrangiert. Er dachte, dass wir umziehen sollten, weil ich irgendwann das Haus nicht mehr verlassen wollte. Damals liefen die Dinge wirklich nicht mehr gut zwischen uns und … egal, jetzt sind wir hier.“
„Mama?“ Sofia unterbrach breit lächelnd unser Gespräch. „Möchtest du einen Pfannkuchen mit Smarties oder Pizza?“ Die Kleine drückte mir eine Plastik-Pizza-Ecke in die Hand. So süß und unschuldig. Sie spürte meine Traurigkeit, da sie mir spontan einen Kuss auf die Wange drückte. Nass und unkontrolliert. Ich wollte Sofia auf der Stelle hochheben und nach Hause gehen, mich mit ihr unter der Bettdecke verstecken und uns beide vor der Außenwelt abschirmen. Aber nein, die alte Hannah hätte das getan, nicht ich, die neue Hannah. Dennoch klang es nicht zuversichtlich, als ich sagte: „Wir machen hier einen Neuanfang.“
Emma fuhr sich durch das lange blonde Haar. „Möchtest du eine Tasse Tee?“ Ohne auf eine Antwort zu warten, drehte sie sich um und ging in die Küche.
Das musste selbst für Emma zu viel sein. Als eine Mutter war ich womöglich ihr fleischgewordener Albtraum. Ich starrte die Wand an und wartete. Mein Körper zitterte.
„Wenn du möchtest, dass ich gehe …“, stammelte ich, als Emma mit zwei Tassen Tee aus der Küche kam.
„Weshalb?“
Ich zuckte mit den Schultern. „Ich möchte eine solche Frau nicht auf meiner Couch haben.“
„Du musst nicht vor mir davonlaufen, Hannah.“ Emma setzte sich und nahm meine Hand. „Du hast es doch nicht getan, weil du Lust dazu hattest. Niemand tötet grundlos einen Menschen, geschweige ein Kind?“
„Natürlich nicht.“
„Hör zu, du solltest dich nicht um all diese anderen Mütter kümmern. Jeder hat in dieser feinen Straße irgendein Problem – vom prügelnden Ehemann bis hin zum Alkoholiker findest du hinter deren Fassaden alles. Und du hast etwas getan, das öffentlich gemacht wurde, das für jeden zugänglich ist. Darauf müssen diese Mütter eingehen, das lenkt sie wunderbar von den eigenen Problemen ab. Alles klar?“
Ich nickte und biss imaginär in Sofias Pizzaecke. „Zu niemanden ein Wort, Emma!“
Emma nickte zustimmend „Natürlich nicht. Und hast du nun Haustiere oder nicht?“
Kapitel 10
ICH
Bis spät in die Nacht sitzt Hannah auf ihrem Balkon. Den Kopf nach vorn gebeugt, ihr blasses Gesicht erhellt durch das Display ihres Smartphones. Dieses Mal kein vages Lächeln und keine Mimik, nichts, was darauf hindeutet, dass sie mit jemandem spricht; Hannah Bachmann grübelt. Sie sieht ein wenig besorgt aus.
Ich kichere. Sie hat auch allen Grund.
Mein Fernglas zeigt mir ein scharfes Bild bis zu einer Entfernung von einhundertdreißig Metern. Ich kann jedes Muskelzucken sehen, jeden Atemzug wahrnehmen, als säße ich ihr gegenüber.
Im Laufe des Abends sehe ich, wie die Lichter im Haus nacheinander erlöschen David muss morgen zur Arbeit, Hugo in die Schule. Hannah geht gegen Mitternacht ins Bett, aber anscheinend kann sie nicht schlafen. Gelegentlich leuchtet das Fenster ihres Schlafzimmers, wie eine blaue Plakatwand in der dunklen Fassade, auf. Ist sie nervös, ein wenig aufgeregt? Letzteres ist sicherlich etwas, das uns verbindet.
Ich möchte durch die Vorhänge schauen. Was macht sie? Trägt sie einen Pyjama? Oder nichts? Sicher kein Supermarkthöschen – fünf zum Preis von vier? Zu billig für diese Frau. Nicht aus rosafarbener oder weißer Baumwolle, mit einem naiven gepunkteten Muster und einer nutzlosen Schleife, wie meine.
Ich spüre den Zorn, der durch meinen Körper zieht. Ich habe ein totes Mädchen vor meinem inneren Auge – Mia, vier Jahre – während sie jetzt vielleicht vor dem Spiegel steht und sich bewundert in ihrer schwarzen Spitzenunterwäsche, in ihrem protzigen Badezimmer, in ihrem Luxushaus. Ein Prahlbunker par excellence, den ich verabscheue.
Dieser verdammte Vorhang.
Ich schaue entlang der Fassade nach oben. In der Perdition-Road achtet man aufeinander. Deshalb haben viele Anwohner keine Alarmanlage installiert, und keine komplizierten Schlösser. Wenn es sein muss, kann ich innerhalb von fünfzehn Minuten neben Hannahs Bett stehen und ihr den schönen Hals aufschlitzen.
Nein. Jetzt noch nicht.
Ich muss einen klaren Kopf behalten.
Kapitel 11
ICH
Wenn ich an Pia denke, macht sich etwas in meinem Kopf selbstständig. So, als würde in meinem Gehirn eine Murmel herumkullern. Ich versuche sie nicht zu lange herumrollen zu lassen, denn jeder Treffer löst einen üblen Gedanken aus. Szenarien, was ich alles mit den Menschen in unserem Viertel anstellen könnte.
Tagsüber ist es nicht so schlimm, da habe ich sie alle im Visier, nur am Abend oder in der Nacht, schweifen meine Gedanken zu ihnen ab, sodass die kleine Kugel durch meine Gedanken flitzt und eine mörderische Hitze in meinem Kopf verursacht.
Um das tun zu können, was ich tun will, habe ich eine Regel, von der ich nie abweiche: mich anpassen wie ein Chamäleon. Ich trage keine auffällige Kleidung, keine auffällige Frisur, gebe mich nicht zu klug, spreche stets mit ruhiger Stimme, verschmelze mit der Umgebung, um im Hintergrund fortzufahren. Bei Bedarf werde ich zu einer Tapete, bei der sich später niemand an die Farbe oder an das Motiv erinnern kann.
Es hilft, freundlich und höflich zu sein und Interesse vorzutäuschen. So werden die Leute mich unterschätzen. Sie sehen nur eine harmlose, sympathische Person, damit du deine Pläne in die Tat umsetzen kannst.
So mache ich das seit Monaten. Mit Erfolg. Niemand hegt auch nur den leisesten Verdacht. Selbst die Kassiererin im Supermarkt ahnt nicht, dass sie benutzt wird. Dass sie seit Gretas Tod alle für mich nur Spielzeug sind. Ihre Gedanken, ihre Worte, ihre Träume, ihr Leben – reine Unterhaltung und nur Mittel zum Zweck sind.
Ich habe Pia vor meinem inneren Auge, in einem Raum, dunkel und feucht. Schimmel an den Wänden. In der Mitte eine vergilbte Matratze. Darauf liegt Pia – in einem Kleid aus weißer Spitze. Die Augen geschlossen. Ihre Beine sind wie die Arme an Ringe im Beton gefesselt. Einen Meter vor der Matratze ist eine Leinwand aufgebaut.
Ich betrete den Raum, bin gekleidet wie ein Dirigent. Mit meinem Geigenbogen fahre ich über ihren Körper und lasse eine blonde Haarlocke durch meine Finger gleiten. Keine Reaktion.
Ich greife nach meiner Geige.
Hinter mir leuchtet eine Videokamera auf. Der Film läuft ab.
Pia sieht auf der Leinwand wie die Schüler über ein Mädchen lachen, wie ein Mädchen sich erhängt, wie ein Mädchen sich ertränkt, wie ein Mädchen sich die Pulsadern in der Badewanne aufschlitzt, wie ihre Mutter sie findet, wie andere Mädchen im Schulhof tuscheln und auf eine Lehrerin zeigen.
Ich schnappe nach Luft, halte kurz inne und krümme mich, als der Schmerz der Wut mich durchzuckt.
Fang endlich an!, fordert meine innere Stimme mich auf.
Ich folge ihrer Anweisung und lege die Geige unter meinem Kinn.
„Du musst dich nicht fürchten“, flüstere ich. „Gott ist überall …“
Knorkators Böse ertönt aus meiner Geige.
Auch in der Hölle, kichert meine innere Stimme.
Ich lasse in Gedanken den Bogen voller Wut über die Geigensaiten gleiten.
Showtime!
Das Spiel kann beginnen.
Kapitel 12
Pia
„Es fällt mir schwer, aber ich sage es trotzdem, Pia.“ Charlottes Hals war mit roten Malen übersät. „Es ist Sonntag, und du hängst die Wäsche draußen auf. Das stört Theo.“
„Wieso?“, hakte Pia nach.
„Sonntag“, wiederholte Charlotte. „Der Tag des Herrn, weißt du. Ein Ruhetag! Theo hat das vom Elternhaus mitbekommen.“
Pia rollte mit den Augen. „Und dann schickt dein Mann dich, um mir das zu sagen?“
Charlotte musste den Spott in ihrer Stimme vernommen haben. „Wir wollen keinen Streit, Pia. Aber wir leben nun mal in einem kleinen Ort, in dem die Menschen Rücksicht aufeinander nehmen.“
„Gut, wir auch nicht“, antwortete Pia. „Das Wetter ist schön, und wenn Gott gewollt hätte, dass ich am Samstag die Wäsche aufhänge, hätte es gestern nicht geregnet.“ Das ist daneben, dachte Pia. Aber sie hatte plötzlich eine unbändige Lust, sich danebenzubenehmen. „In einer Stunde kann ich die Wäsche wieder von der Leine nehmen, Charlotte. Sag Theo, dass er bis dahin einfach nicht nach draußen schauen oder sich vor ein anderes Fenster setzen soll!“
„Blöde Kuh“, zischte Charlotte, drehte sich um und eilte davon.
Charlottes Ehemann Theo war von Anfang an sehr freundlich und zugänglich gewesen. Er hatte ihnen beim Einzug ins neue Haus Kaffee und Apfeltaschen gebracht, als sie und Moritz gerade die Wände des Wohnzimmers tünchten.
„Selbst gemacht“, prahlte er. „Ich bin der Konditor in der Familie.“ Er reichte ihnen die Hand. „Meine Frau heißt Charlotte, und ich bin Theo Steiner.“
Pia hatte beschlossen, ihn nicht zu mögen.
Nachdem das letzte Wäschestück auf der Leine hing, ging Pia ins Haus und setzte sich an den Küchentisch. Es war ein ruhiger Ort, und sie brauchte Ruhe. Sie war zu wütend, zu angespannt und vor allem zu besorgt. Sie wollte keinen Streit, sie brauchte Kraft für die Hormonbehandlung. Die Decapeptyl-Spritze lag auf der Arbeitsplatte und hatte die Raumtemperatur erreicht. Als sie sie vor einer Viertelstunde aus dem Kühlschrank genommen hatte, war ihr Blick auf die Teedose gefallen, die sie dort hingestellt hatte, weil sie mit ihren Gedanken woanders gewesen war. Bei einem Baby.
In den vergangenen drei Wochen hatte sie sich den Wirkstoff zur Vorbereitung auf eine künstliche Befruchtung jeden Abend injiziert. Sie zitterte bei der Erinnerung an ihren mit Einstichen übersäten Bauch und ihre durch Stress verkrampften Schultern. Seit Wochen kämpfte sie gegen Müdigkeit, Stimmungsschwankungen und Heulattacken, Hysterie, Libidoverlust, Hitzewallungen, Knochenschmerzen oder Atemnot wie vorhin im Garten. Und all das ohne Garantie, dass es diesmal funktionieren würde. Warum nicht ein Baby zeugen, wie ihre Eltern sie gezeugt hatten? Voller Leidenschaft und Liebe, keuchend im Ehebett, auf dem Küchentisch oder Parkettboden.
Pia holte tief Luft. Wo blieb Moritz nur? Er wollte David nur Werkzeug für die Küche vorbeibringen, die einen neuen Fliesenboden bekommen sollte. Das musste doch keine drei Stunden dauern? Ob die beiden sich in der Kneipe ein Bier genehmigten?
Im Garten der Nachbarn hörte Pia laute Stimmen.
„Wenn diese Schlampe das nicht begreift, sorge ich dafür, dass sie es versteht!“, rief Theo.
„Das wagst du nicht“, erwiderte Charlotte.
„Oh, du glaubst, dass ich ihr meine Meinung nicht auf meine Art und Weise zeigen kann? Die Schlampe sollte besser vorsichtig sein!“
Stille.
Während sie eindöste, dachte sie an Theo, der kein netter, freundlicher Nachbar war, sondern das Böse, das in jede Ritze ihres Hauses eindringen konnte.
Kapitel 13
Pia
Sie hatte die E-Mail nicht erwähnt. Anscheinend war es immer noch nicht vorbei. Vielleicht war es auch nie vorbei, weil niemand ihr, seit dem Freitod der Schülerin, einen Vorwurf gemacht hatte. Nichts war schlimmer als ein Kind, das in der Kälte, zwischen Schnee und Eis, sterben wollte. Was hatte sie nur übersehen?
Moritz riet ihr, sich keine Gedanken über den lächerlichen Vorfall zu machen. „Der durchgeknallte Apfeltaschenbäcker hat einen übertriebenen Geltungsdrang. Das soll uns egal sein. Wir kümmern uns um wichtigere Dinge wie unsere Babyproduktion“, sagte er und nahm sie in den Arm. „Es ist zu banal, um auch nur ein Wort darüber zu verlieren. Nachbarn, die sich ärgern, dass du deine Wäsche am heiligen Sonntag draußen aufhängst?“
Sie nickte. „Hier leben viele religiöse Menschen, Moritz. Sie besuchen jeden Sonntag die Kirche, und es gibt viele in diesem Ort, die sich dort ehrenamtlich engagieren.“
Moritz reagierte allergisch auf alles, was mit Glauben zu tun hatte - die logische Folge seiner indoktrinierenden protestantischen Erziehung. Er sagte oft, dass sie sich mit ihrer atheistischen Mutter und mit einer Kindheit ohne dogmatischen Ideen und religiösen Zwang glücklich schätzen konnte.
„Übrigens haben David und Hannah uns zum Grillen eingeladen.“
„Heute? Um wie viel Uhr?“
„Gegen sechs. Ich habe zugesagt.“
„Ich habe überhaupt keine Lust auf verbranntes Fleisch“, nörgelte Pia.
„Es gibt auch leckere Salate. Oder befürchtest du etwa, dass der bescheuerte Nachbar hier etwas anstellen könnte, wenn wir nicht da sind? Mach dir keine Gedanken, Liebling. Theo Steiner ist ein eher unterentwickelter Besitzer einer Pommes-Bude, der das Leben nur mit einer großen Klappe meistert. Er ist bekannt wie ein bunter Hund und wird nur toleriert, weil er den Sportverein sponsert. Ich habe das von Anke Kuhn, die zwei Straßen weiter in dem weißen Haus am Anfang der Straße wohnt. Sie behauptet, dass es in Warnberg durchaus von Vorteil sein kann, wenn man einen der Vereine sponsert. Sie ist Psychiaterin und hat im Ort eine Praxis. Anscheinend gibt es hier einige Irre.“
„Ob es eine gute Idee war, dieses Haus zu kaufen“, fragte Pia irritiert.
Moritz zog sie fest an sich. „Es war die beste Idee, die wir je hatten. Hier bist du in der Nähe deiner Schwester und kannst in Ruhe schwanger werden. Wir wollten immer ein Haus kaufen. Dass David nach Hannahs Unfall dieselbe Idee hatte, war eine glückliche Fügung. Es ist schön, die beiden in unserer Nähe zu haben, und ich denke, sie empfinden ähnlich. Und jetzt machst du dich hübsch. Das wird bestimmt ein netter Abend mit Hannah und David.“
Pia fand keine Erwiderung. Und überhaupt, was nutzte es, sich darüber Gedanken zu machen. Manchmal war das Leben eine einzige Kulisse.
Weil sie Hannahs Ideale nicht mehr teilte.
Ihre Vorstellungen.
Sie teilte nur ihre Wut.
Ihren Hass.
Kapitel 14
Hannah
Meine Schwester wirkte völlig niedergeschlagen.
„Ich bin sicher, du wirst es diesmal schaffen, Pia. Nach Hugos Geburt dachte ich, ich würde nie wieder ein Kind zur Welt bringen. Aber irgendwann vergisst man den Schmerz“, sagte ich aufmunternd und strich ihr durch das kurze Haar.
„Ich erinnere mich, dass du das mal gesagt hast. Zwei Jahre später hast du neben mir auf dieser Couch gesessen, mit Sofia in deinen Armen.“
Sie klang neidisch, oder täuschte ich mich.
Den Schmerz hatte ich nicht vergessen, aber ich war jetzt eine Mutter. Ich hatte Leben geschenkt und damit auch mir selbst ein neues Leben. Ein Teil von mir war in meinen Kindern. Die Geburt war das erste Opfer in einer langen Reihe von Opfern, die ich instinktiv für meine Kinder gebracht hatte. Vom ersten Schrei an war ich nicht mehr nur Hannah Franke, sondern Hugos und Sofias Mutter. Ich hatte für beide meinen Schlaf, meinen schlanken, zierlichen Körper, meine schönen Kleider und meine Unbekümmertheit aufgegeben und es keine Sekunde lang bereut.
Pia hatte mittlerweile mit ihrer dritten Hormonbehandlung begonnen und hoffte weiter. Ich warf einen Blick auf ihre Hände, während meine Schwester ihren Tee trank. Ihre Nägel waren so abgenagt, dass das rohe Fleisch darunter zu sehen war. Pia fraß sich buchstäblich selbst auf. Es erinnerte mich an Bingo, den Wellensittich, der sich eines Tages aus Verzweiflung von seinem Federkostüm befreite und drei Tage später nackt und tot in seinem Käfig lag.
„Ab nächste Woche muss ich mir wieder ein neues Präparat injizieren.“ Pia zeigte auf ihren Bauch. „Er sieht im Moment nicht besonders hübsch aus. Die Injektionen verursachen üble Hämatome.“
Ich hatte Mitleid mit ihr, Pia war zu schmal, ihre Haut zu zart, fast durchscheinend und ich wusste, dass sie oft an Hitzewallungen und Sehstörungen litt, und Schwindelattacken hatte. Diese verdammten Hormone. Ich legte meine Hand auf Pias Arm und wollte sie trösten, doch Pia entzog sich mir, als könnte sie meine Berührung nicht ertragen.
„Wie geht es dir, Hannah? Kommst du ohne den Psychiater klar?“
„Alles ist gut. Keine zittrigen Hände, keine Panikattacken. Ich hatte Schüttelanfälle wie ein Parkinson-Patient in einem fortgeschrittenen Stadium. Aber dank der Pillen von Dr. Lange kann ich wieder durchschlafen.“
Pia nickte. „Ich finde es gut, dass wir von München hierher gezogen sind. Weg von dieser Stadt, wo alles passiert …“ Sie nahm einen Schluck Tee.
Wir können nicht darüber reden, dachte ich. Nicht über meine Schwester, nicht über mich, nicht über das Mädchen, das ich überfahren hatte, nicht über unsere Beziehung zueinander. Ich wusste, dass Pia mir viele Dinge übel nahm. Große Dinge. Unausgesprochene Dinge. Dinge, die ich nicht mehr ausbalancieren konnte: Dass ich die nettesten Freunde, mühelos das Abitur bestanden und den Universitätsabschluss gemeistert hatte, in einem größeren Haus lebte als Pia, während meine Schwester sich alles schwer erarbeiten musste. Pia nahm es mir sogar übel, dass ich zwei gesunde Kinder hatte, während sie selbst keine bekommen konnte.
Pia sah zur Seite, schien nachzudenken.
Zitternd folgte ich ihrem Blick in der Spiegelung des Küchenfensters. Ich war völlig machtlos und schluchzte innerlich. Die große Schwester, die der kleinen nicht helfen konnte. Früher hätte ich mich mit Liebe und ohne zu zögern das stumpfe Küchenmesser in den Bauch gerammt, wenn es Pia helfen würde.
Plötzlich hatte ich es satt, mir Sorgen um sie zu machen. Vielleicht lag es an meinem Schlafmangel der letzten Tage, der mich so unendlich müde machte. Vielleicht war es Pia.
Ich spürte ständig ihre Wut und unternahm nichts dagegen. Gebrochene Menschen protestierten nicht.
Kapitel 15
Hannah
Ich zog die Beine hoch und schlug die Arme um meine Knie. Windsor legte seinen Kopf an meine Knöchel. Ich war froh, den Labrador neben mir zu haben. Er war mein treuester Freund, er würde mich nie verlassen.
Was machte ich eigentlich hier? In dieser Küche, in diesem Haus, in diesem Gott verlassenen Warnberg. Ich schüttelte den Kopf, kannte die Antwort auf diese Frage besser als jeder andere. Selbst wenn ich auf die andere Seite der Welt ziehen würde, ich konnte nicht vor mir fliehen. Diese Straße, dieser Ort waren in mir, sie waren längst kein geografischer Punkt mehr, auf die man in Google Maps verweisen konnte.
Ich wurde von einem heftigen Zittern ergriffen und konnte es nur geschehen lassen. Meine Schuld wog schwer. Ich durfte das kleine Mädchen nicht vergessen.
Mia …
Mia – so klein – in einen Kindersarg, tief unter der kalten Erde begraben, auf einem Friedhof, der jetzt einsam, dunkel und verlassen war. Wo Tiere herumstreunten, wo Ratten Nahrung suchten, während meine Kinder herumtollten und lachten, jeden Tag so lebhaft waren und jetzt sicher in ihren Betten lagen. Das Licht im Flur blieb stets für sie an. Hugo und Sofia hatten im Dunkeln Angst.
Mia hatte nie wieder Angst.
Im Wohnzimmer lachten die Männer laut, zu laut. Ich hatte neben meiner Schwester und meinem Schwager Emma und Benjamin eingeladen. Sie war die Entertainerin des Abends. Es war wunderbar, sie und ihren kleinen Sohn hier zu haben. Ihre ansteckende Fröhlichkeit verschleierte die Unfähigkeit der anderen, den Abend entspannt zu überstehen.
„Ich hätte gerne noch ein oder zwei weitere Kinder gehabt“, sagte Emma, als David das Thema Kinder ansprach. „Ich bin ein Einzelkind, daher.“
David hob sein Glas und zwinkerte ihr zu. „Das ist immer noch möglich.“
„Kinder hat man nicht, Kinder bekommt man!“ Pias eisige Stimme ließ mich erschaudern.
Emma zuckte zusammen. „Tut mir leid, ich wollte nicht … ich hatte vergessen, dass du …“
Moritz legte den Arm auf Pias Arm. „Kein Problem.“
„Vielleicht bekommst du Zwillinge, Pia. Ich meine, das hört man so oft nach einer Hormontherapie. Die Wahrscheinlichkeit soll sehr hoch sein.“ Ein sanftes Lächeln huschte über Emmas Gesicht.
Moritz räusperte sich. „Das wäre schön, Pia, dann hätten wir mit einer Entbindung alles überstanden.“
„Wir?“ Pia warf Moritz einen vernichtenden Blick zu.
„Nun, ein Kind wäre aber sicher auch großartig“, murmelte Emma und nahm einen großen Schluck von ihrem Wein. „Was für mich gilt, muss nicht für jemand anderen gelten.“
„Noch ein Glas Wein, Emma?“ Davids zweiter Versuch, aber das Eis wollte nicht mehr schmelzen.
Ich sah meine Tochter an, die lustlos mit ihrer Gabel über den Teller schabte. „Sofia, komm, iss bitte noch ein bisschen“, forderte ich sie auf, „sonst gibt es kein Eis zum Nachtisch.“
„Das gilt auch für dich, Benny.“ Emma wich einer weiteren Diskussion aus. „Du hast nur einen Bissen genommen und Hannah hat so lecker für uns gekocht.“
Benny sah seine Mutter herausfordernd an. „Ich will einen Bruder! Eine Schwester ist blöd.“ Er kreuzte seine dünnen Arme übereinander. „Mädchen sind doof. Mit ihnen kann ich nicht Fußball spielen.“
„Benny, es reicht!“
Hugo kicherte.
Übermütig geworden durch die Aufmerksamkeit aller, legte Benny die flache Hand auf seinen Teller und fegte die Lasagne auf die Tischdecke.
„Was machst du denn da?“ Emmas Stimme überschlug sich. „Benjamin, was soll das?!“
Benjamin grinste. In diesem Moment war er der Star des Abends.
„Ab in die Diele! Hol deine Jacke! Ich toleriere dieses Verhalten nicht. Du hast eine Minute, um dich anzuziehen.“
Mit hochrotem Kopf ging Emma in die Küche und nahm ein Küchentuch von der Papierrolle. „Es tut mir schrecklich leid, Hannah. Diese Flecken gehen nie wieder raus.“ Still stand sie da, erwartete, dass einer von den anderen etwas von sich gab. „Siehst du, Pia“, sagte sie lächelnd, „bist du dir sicher, dass du das willst? So lustig sind sie nun auch nicht immer, diese Kinder.“
„Bitte?“, schnaubte Pia und verkrampft ihre Schultern. Ihr Hände waren zu Fäusten geballt, sodass die Knöchel weiß hervortraten. „Du scheinst jedenfalls nicht zu wissen, wie man Kinder erzieht!“
Emma zog entgeistert ihre Augenbrauen hoch. „Dann sollten wir das wohl besser dich fragen?“
Pia sprang auf. „Ihr alle, ihr seid solche Heuchler! Ja! Alle zusammen! Ein Kind? Oh ja, warum nicht? Getrennt wie unsere Emma, die sich einfach einen neuen Kerl nimmt, mit dem sie ins Bett steigen kann. Beine breit für den Neuen! Während unsere Hannah mal eben ein Kind tötet!“
„Pia!“ Moritz sah seine Frau bestürzt an. Der Vorwurf in seiner Stimme war nicht zu überhören.
„Was denn? Hannah überfährt Kinder und ich kann keine bekommen! Glaubst du, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun? Schon mal von Karma gehört?“ Pia sah in meinen Augen jetzt widerlich aus, unappetitlich und schmutzig.
„Du hast deine Wut an uns ausgelassen, Pia, du hast uns den ganzen Abend wie wehrlose Tiere mit deiner üblen Laune gequält und Hannah und Emma mit deinen Unverschämtheiten tief verletzt. Du zerstörst so, was wir aufgebaut haben und was mir wichtig ist. Ist dir das eigentlich klar? Was ist denn heute los mit dir? Verdammt, du leistest saubere Arbeit!“
Schweigen. Eisige Stille.
So hatte ich Moritz noch nie erlebt. Ich schloss die Augen, damit ich Pias Gesicht nicht sehen musste. Ich zitterte und spürte sie wieder: Schmutzige Schneeflocken wirbelten in meinen Kragen, Kälte kroch entlang des Halses über meine Wirbelsäule.
„Ach, ihr könnt mich mal“, brauste Pia weiter. „Jeder hier in diesem Raum hält seine Hand über den Kopf des anderen. Jeder sieht es, aber niemand sagt es!“
Ich wollte wissen, was Pia damit meinte, aber meine Worte waren verloren. Mir war heiß und kalt zugleich. Das Zittern spürte ich bis in die Fingerspitzen.
„Ich meine, dass du verrückt bist, Hannah“, fuhr Pia fort. „Dass ich bei Gott nicht verstehe, dass dein Psychiater dich aus der Therapie entlassen hat. Siehst du es denn nicht, diese Spur der Zerstörung, die du stets zurücklässt? Ein Neuanfang in diesem Haus? Ein neues Theaterstück, meinst du wohl!“
Die Wut übermannte mich. Mühsam stand ich auf und schlug Pia mit meiner letzten Kraft ins Gesicht. „Verschwinde“, zischte ich.
„Hannah, bitte …“ Moritz sah hilflos von mir zu Pia.
Meine Schwester stürzte aus dem Wohnzimmer. Moritz folgte ihr.
Die Haustür fiel laut ins Schloss.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783739445144
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2019 (März)
- Schlagworte
- Mord Rache Schuldgefühle Schuld Psychothriller Geschwister Thriller Hass Mobbing