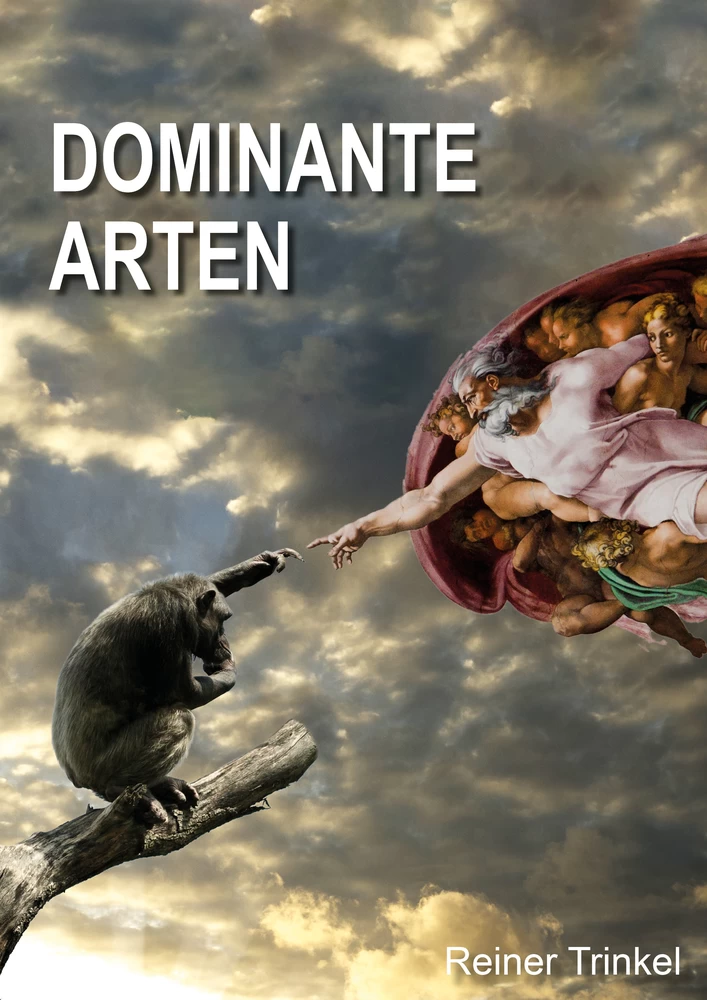Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
KROHNMÜHLE
Als Karl den Balkon betrat, brandete Jubel auf. Jubel aus hunderttausend Kehlen, begleitet vom begeisterten Schwenken der Fahnen. Karl lächelte. Seine riesige, diamantbesetzte Goldkrone glänzte im strahlenden Sonnenlicht mit seiner dicken Nase um die Wette. Lachend blinzelte er in den Himmel, aus dem die erste Formation seiner 2000 Kampfjets herandonnerte. Im Hintergrund setzte sich die Militärparade in Bewegung. Bald würden 20.000 Elitesoldaten und 50 Panzerbataillone salutierend an ihm vorbeimarschieren. Karl der Große, wie man ihn inzwischen nannte, war dort angekommen, wo er schon immer hinwollte. Das Volk lag ihm zu Füßen, niemand konnte es mehr wagen, ihm seine Macht streitig zu machen. Als die Jets über seinen Kopf hinwegdonnerten, fühlte er sich von einer Woge des Glücks erfasst. Der Lärm allerdings war so markerschütternd, dass er ihn aus seinen Träumen riss.
Dr. Karl Petersen erwachte, ein wenig traurig über das abrupte Ende seines wunderschönen Traums. Noch ganz benommen, fühlte er Wehmut im Herzen. Es war so schön gewesen dort oben auf dem Balkon. Im Halbschlaf empfand er die Rückkehr in die Wirklichkeit als Verlust. So gern hätte er noch seine Macht genossen. Er drehte sich um und zog die Daunendecke über den Kopf, entschlossen wieder einzuschlafen, auf die Fortsetzung des Imperator-Traums hoffend. Ich, Karl der Große, König und Gott. Plötzlich wurde ihm die Unsinnigkeit dieser Bilder bewusst. Er schrak auf, schüttelte sich und war schlagartig wach. Brrr, warum musste man immer so einen Quatsch träumen? Seit zwei Wochen ging das nun so. Kaum eingeschlafen, begann sein Hirn ein wildes Eigenleben zu führen. Die Eigenwilligkeit seines Denkorgans erboste ihn. Im Grunde, überlegte er, ist man diesem Eiweißklumpen hilflos ausgeliefert. Er sah auf die Uhr. Kurz vor fünf. Entschlossen, wieder einzuschlafen, machte ihm sein Hirn erneut einen Strich durch die Rechnung und er begann sich stattdessen zu ärgern. Immer deutlicher wurde er sich seiner Hilflosigkeit gegenüber dem eigenen Nervensystem bewusst. Wenn es ihm gefällt, uns in Angst und Schrecken zu versetzen, ist man machtlos dagegen, erkannte er. Eine Erkenntnis, die ihn in Wallung brachte. Dieses elende Gehirn! Es macht was es will, es denkt was es will, es träumt was es will. In Wahrheit sind wir das Opfer unseres eigenen Hirns! Verrückte biochemische Prozesse, von denen man nicht die geringste Ahnung hat, entscheiden darüber, ob man depressiv, größenwahnsinnig oder Massenmörder wird. Oder ein normales Leben führen kann. Oder irres Zeug träumt. Ob man Penner oder König wird. Karl der Große! Sehr verlockend, natürlich! Unbeschränkte Macht. Den ganzen Laden ausmisten. Das wär´ mal was! Aber leider nur ein Traum. Warum nur waren diese Träume in letzter Zeit so merkwürdig klar und realistisch, als schienen sie Teil einer Geschichte zu sein, die noch nicht zu Ende ist? Als ob ihm jemand etwas mitteilen wollte. Außerdem bescherten sie ihm das ungute Gefühl, dass bald etwas Entscheidendes passieren würde. Angespannt lauschte er den Atemzügen seines Hundes, der friedlich am Fußende des Bettes schlummerte. Gottseidank, beruhigte sich Dr. Petersen, war er mit einem nüchternen und sachlichen Verstand gesegnet. Vernünftig genug, um den verwirrenden Einflüsterungen anarchistischer Hirnströme zu widerstehen. Als Jurist, Anwalt und Vorstand einer einflussreichen Kanzlei verfügte er über herausragende analytische Fähigkeiten - zumindest, soweit es seine Mitmenschen betraf. Bei sich selbst sah die Sache etwas anders aus. Selbstkritik gehörte nicht zu seinen Stärken. Gegenüber allen anderen jedoch hatte er im Laufe seiner Praxis ein ausgesprochenes Misstrauen entwickelt. Den Menschen im Allgemeinen und seinen Mandanten im Besonderen traute er jede nur erdenkliche Schlechtigkeit zu.
Das Geräusch, das ihm allmählich ins Bewusstsein drang, brachte ihn auf andere Gedanken. Vielleicht hatte er es schon länger gehört, aber nicht so recht wahrhaben wollen. Ein kaum hörbares Grummeln und Schaben, wie bei einem weit entfernten Gewitter, glaubte er wahrzunehmen. Gleich darauf wurde ihm klar, dass er die Entfernung etwas überschätzt hatte. Weit entfernt - das war wohl nur ein frommer Wunsch. Er musste sich eingestehen, dass die Ursache des Geräuschs im Gegenteil ziemlich nah war. Jemand machte sich an seiner Schlafzimmertür zu schaffen. Das Klacken einer sich öffnenden Tür ist ein Laut, den man morgens um 5 Uhr früh nicht hören will, vor allem wenn man noch im Bett liegt und allein zu Hause ist. Das Gefühl nahenden Unheils hatte also nicht getrogen. Und tatsächlich: Jemand betrat sein Schlafzimmer. Schemenhaft nahm Dr. Petersen eine schlanke Gestalt wahr, die sich nun ungeniert Zutritt in sein Allerheiligstes verschaffte. Nach dem ersten Schrecken kehrte jedoch sogleich sein unerschütterlicher Kampfesmut zurück. Oha, den Vogel da würde er Mores lehren! Dank der schlechten Meinung über seine Mitmenschen war Petersen selbstverständlich auf einen solchen Fall vorbereitet. Geistesgegenwärtig zog er seine Mauser-Pistole aus dem Spalt zwischen Matratze und Bettgestell und schrie
Halt! Stehenbleiben oder ich schieße!
Es gelang ihm dabei das Kunststück, gleichzeitig den Lichtschalter zu betätigen. Petersens Pistole zielte auf einen schlaksigen, jungenhaften Mann. Er hatte ein feines, humorvolles Gesicht mit klugen Augen, aus denen der Schalk blitzte. Er sah aus wie ein Mensch, mit dem man befreundet sein möchte. Zu einem zartgrünen Poloshirt trug er hellbeige Feincordhosen. Da war nichts, was einem Angst machen konnte. Allerdings schien einiges an ihm aus den Fugen geraten zu sein. Ein Auge stand tiefer als das andere. Auch die Arme waren ungleich lang und ein Fuß unverhältnismäßig groß. Vor allem sein Hals schien unnatürlich in die Länge gezogen und stand merkwürdig schief. Trotz dieser Missbildungen erinnerte er Petersen an einen ehemaligen Mandanten, der allerdings schon über ein Jahr tot war. Tapfer zielte er weiter mit seiner Pistole auf den Eindringling und schnarrte:
Wenn Sie nicht gleich die Pfoten hochnehmen, drück ich ab!
Freundlich lächelnd erwiderte sein ungebetener Gast:
Aber nicht doch, Karl! Wenn Du auf mich schießt, würde das rein gar nichts bewirken, aber deine teuren Fenster und Möbel könnten Schaden nehmen.
Mit diesen Worten stand er auch schon an Petersens Bett und streckte die Hand nach der Pistole aus. Höflich fragte er:
Darf ich?
Petersen starrte ihn mit offenem Mund an, unfähig zu einer Reaktion. Widerstandslos ließ er sich die Pistole aus der Hand nehmen. Der Fremde hielt sie sich an den Kopf und drückte ab. Ein ohrenbetäubender Knall. Die Kugel durchschlug seinen Schädel und verschwand, Kalk aufstäubend, in der gegenüberliegenden Wand. Aufmunternd sah er Petersen an.
Schau, das macht mir gar nichts. Wollen wir in die Küche gehen, einen Kaffee trinken?
Behänder, als man es seiner kurzbeinigen Gestalt zugetraut hätte, sprang Petersen aus dem Bett. Wild gestikulierend schrie er:
Platzpatronen! Platzpatronen! Sie haben die Munition ausgetauscht!
Er stieß den Eindringling beiseite und stürzte zu dem Loch in der Wand. Ungläubig entdeckte er ein deformiertes Projektil, das unter dem Kalkputz im Mauerstein stak. In diesem Moment erst registrierte er, dass beim Versuch, den Fremden zur Seite zu schieben, seine Hand einfach durch dessen Körper hindurch geglitten war. So, als hätte er eine Nebelwand beiseiteschieben wollen. Dr. Petersens Beine versagten und er ließ sich auf den Bettrand plumpsen. Fassungslos beäugte er sein Gegenüber.
Was sind Sie?
In munterem Ton erwiderte der Fremde:
Schwer zu sagen. Vielleicht ein Gespenst? Ein Außerirdischer? Komm, lass uns runtergehen.
Durch den Knall der Pistole war der Hund hochgeschreckt. Schwanzwedelnd stand er nun am Bett und sah seinen Herrn ratlos an. Den Eindringling schien er weiterhin nicht zu bemerken. Warum tat der blöde Köter nichts, wenn man ihn mal brauchte? Benommen stand Petersen auf, zog seinen Bademantel an und folgte dem Phantom in die Küche. Der Hund trabte müde hinterher. Noch mehr als der wirkungslose Schuss in den Kopf erregte die Reaktion des Hundes bei Petersen den Verdacht, dass er es hier nicht mit einem Wesen aus Fleisch und Blut zu tun hatte. Und mit jeder Treppenstufe, die er hinabstieg, wurde ihm die Ungeheuerlichkeit dieser Vermutung klarer. An wen erinnerte er ihn nur?
Der Eindringling schien sich gut auszukennen. Am Fußende der Treppe fand er auf Anhieb den Schalter für die Flurbeleuchtung. Ihr heller Schein traf ihn von vorne und die Lichtstrahlen gingen teilweise durch ihn hindurch, wie zuvor die Pistolenkugel und Petersens Hand.
In der Eingangshalle, auf dem Weg zur Küche, blieb sein Besucher vor einer Wandnische stehen und betrachtete die Marmorplatte, die dort eingelassen war. Der in kunstvollen Lettern eingemeißelte und mit Gold unterlegte Text schien ihn zu interessieren. Er las:
In diesem Haus verbrachte
Johann Wolfgang von Goethe
im Oktober 1792
drei Tage und zwei Nächte
Klaus August Krohn,
Müller dahier
im Jahr des Herrn 1805
Die Gedenktafel gehörte zu den zahlreichen Besonderheiten im Anwesen des Dr. Petersen, die seine Gäste pflichtschuldigst zu bewundern hatten.
Das Wesen wandte sich zu Petersen, deutete auf die Tafel und bemerkte mit einer gewissen Genugtuung:
Du konntest nie herausfinden, warum Goethe hier war.
Petersen zuckte zusammen. Sollte ihm das jetzt peinlich sein? Und woher hatte der Kerl überhaupt Kenntnis von dieser Wissenslücke? Verärgert knurrte er:
Das weiß niemand. Es gibt keine Unterlagen darüber.
Der Fremde drehte sich um, ging zur Küche und sagte:
Wenigstens hast du in dieser Frage gründlich recherchiert. Und dabei einiges über Goethe gelernt. Wir werden es noch brauchen können.
Petersen ließ zwei Tassen Kaffee aus der Maschine laufen. Im warmen Schein der Küchenlampe sah der Eindringling nicht mehr durchscheinend, sondern wieder ganz normal aus. Auf den ersten Blick hätte man einen gemütlichen Plausch am Küchentisch vermuten können. Der Raum, in dem sie saßen, hatte schon immer als Küche gedient und befand sich noch weitgehend im Originalzustand. Der mächtige, holzbefeuerte Küchenherd und die geräumige Spüle aus Sandstein stammten, wie der gesamte Mühlenbesitz, aus dem 18. Jahrhundert und bildeten weitere Höhepunkte in Petersens historischem Panoptikum.
Sein Besucher trank andächtig seinen Kaffee. Fassungslos registrierte Petersen, wie jeder Schluck durch ihn hindurchrann und in der Polsterung des klassizistischen Küchenstuhls versickerte. Das war zu viel. Gespenst hin oder her, bei seinen Möbeln hörte der Spaß auf.
Was machen Sie da? Sie verschandeln ja das ganze Mobiliar!
Der Fremde sah sich überrascht um, bis er den Kaffeefleck auf seinem Stuhl bemerkte.
Oh, wie dumm von mir. Aber das kann passieren, wenn man als Projektion unterwegs ist.
Wenn man als was unterwegs ist?
Als Projektion. Damit du mich sehen kannst, habe ich die Gestalt einer dir bekannten Person angenommen. Was du siehst, bin nicht ich, sondern eine Projektion aus deiner Erinnerung.
Petersen ging ein Licht auf. Endlich wusste er, an wen ihn sein Besucher erinnerte.
Sie sehen aus wie Würtz!
Stimmt.
Wieso sehen Sie aus wie Würtz, verdammt noch mal? Würtz ist tot!
Richtig. Aber du mochtest Würtz. Mehr als deine anderen Mandanten. Ich dachte, du würdest dich freuen, ihn wiederzusehen.
Ruhe bewahren. Petersen kniff sich in den Oberschenkel, bis es weh tat. Aua! Keine Frage: Er war wach und bei Verstand. Was war das, was da vor ihm saß? Würtz als Untoter? Sein Geist, der nicht sterben konnte? Eigentlich sah er nicht wirklich aus wie Würtz. Eher wie eine misslungene Darstellung von ihm, wie aus einer schlechten Photoshop-Bearbeitung. Aber wie er nun das Bild des Verstorbenen aus seiner Erinnerung holte, sich an den echten Würtz zu erinnern versuchte, bemerke er, wie die Figur ihm gegenüber, die sich selbst als Projektion bezeichnete, dem tatsächlichen Theo Würtz immer ähnlicher wurde. Die Augen bewegten sich langsam auf gleiche Höhe, Arme und Füße glichen sich an, das Gesicht entknitterte sich, wurde glatt und ebenmäßig. Fasziniert beobachtete Petersen die Annäherung der Projektion ans Original. Allmählich stellte sich auch dieser spezielle Schalk in den Augenwinkeln ein, der Würtz zur Marke Würtz gemacht hatte. Fertig. Jetzt saß der Untote Würtz ihm so jung und schön wie zu seinen besten Zeiten gegenüber. Auch seine helle jungenhafte Stimme klang wieder so klar wie früher und ähnelte nicht mehr einer synthetischen Kopie wie zu Anfang. Die Klamotten saßen nun ebenfalls perfekt. Bonbonfarbenes Poloshirt, hellbeige Feincordhosen. So war er immer im Studio rumgelaufen. Sogar die Sprache! Wortwahl, Duktus, der höflich-ironische Tonfall, so hatte Würtz geredet. Nur der Hals blieb übermäßig lang und schief. Petersen glaubte nicht an Gespenster. Petersen glaubte an nichts. Schon gar nicht an Untote.
Jetzt mal Tacheles, mein Freund. Was geht hier vor sich? Was wird hier gespielt?
Rein rational konnte sich Petersen hervorragend in andere Menschen hineinversetzen. Die meisten durchschaute er sofort, erkannte kleinste Unsicherheiten, registrierte jeden Anflug von Wut oder Verlegenheit und entlarvte umgehend jede Lügerei. Seine eigene Gefühlsskala allerdings erschien etwas begrenzt. Seine einzige tiefere Gefühlsregung war Zorn. Der äußerte sich in berserkerhaften Wutanfällen, die er aus dem Nichts entwickeln konnte, wenn ihm irgendwas gegen den Strich ging. Er galt als ausgesprochener Choleriker. Selbst vor Gericht konnte er sich zuweilen nicht zusammenreißen. Seine Ausbrüche waren legendär. Dafür fehlten ihm eine ganze Reihe anderer Gefühle, zum Beispiel Angst. Wo andere ängstlich wurden, vielleicht weil eine Situation sie überforderte, geriet Petersen lediglich in Rage. So auch jetzt. Dieses Phänomen an seinem Küchentisch versuchte, wie Würtz auszusehen. Wollte ihm am Ende weismachen, Würtz zu sein. Völlig unmöglich. Sollte Theo Würtz etwa, obschon längst gestorben und begraben, plötzlich frisch und munter als Ding aus einer anderen Welt wiederauferstanden sein? Blödsinn!
Die Würtz-Kopie sagte:
Ding aus einer anderen Welt? Kompliment, du bist der Wahrheit schon recht nahe!
Petersen erstarrte.
Was? Was war das? Können Sie meine Gedanken lesen? Und behaupten Sie etwa, ein Außerirdischer zu sein?
Das war zu viel. Ein Außerirdischer! Was wurde hier gespielt? Mit der Faust hieb Petersen auf den Tisch, dass der Hund darunter hervorschoss wie ein Stöpsel aus der Flasche. Er brüllte:
Sie sagen mir jetzt auf der Stelle, was hier los ist! Wieso zum Teufel sehen Sie aus wie Würtz? Würtz ist tot, kapiert? Als seine Freundin morgens die Rollläden hochzog, fand sie ihn. Da hing er. Am Nussbaum. Vorm Schlafzimmerfenster. Ich war auf seiner Beerdigung! Wie kommen Sie dazu, wie Würtz auszusehen?
Sein Besucher reagierte mit freundlicher Ironie, genau wie Würtz es getan hätte.
Tut mir leid, dass du dich mit meiner Wiedergeburt etwas schwertust. In deinem Kopf jedenfalls bin ich noch immer erfreulich präsent.
Was haben Sie in meinem Kopf zu schaffen?
Na, da wir Partner sein werden, musste ich ja mal nachschauen, was darin so vorgeht. Und Theo Würtz ist die Person, mit der du dich nach wie vor beschäftigst. Alle anderen nimmst du ja nicht für voll.
Petersen kratzte sich am Kopf. Beides stimmte. Wie sollte man all diese Idioten auch ernst nehmen? Theo war tatsächlich eine Ausnahme gewesen. Der sagte nun:
Übrigens: Auch mich hast du nicht wirklich ernst genommen. Andernfalls wäre ich wahrscheinlich noch am Leben.
Das war sein wunder Punkt. War Würtz zurückgekommen, um sich an ihm zu rächen? Verlangte er eine Art Wiedergutmachung? Petersen erhob sich. Er brauchte dringend was zu trinken.
Dr. Karl Petersen, von seinen Juristenkollegen kurz DKP genannt, hätte sich selbst, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, für einen absolut rationalen Menschen gehalten. Er verabscheute alles Esoterische, alles Übersinnliche und ließ nichts gelten, was naturwissenschaftlich nicht glasklar bewiesen war. Schon harmlose Spielarten alternativer Medizin nahm er gnadenlos aufs Korn. Besonders hasste er Spiritualität, egal in welcher Form. Auch die christliche Glaubenslehre war für ihn nur Aberglaube, so wie er überhaupt jede Art von Religiosität kategorisch ablehnte. Die Weltreligionen seien letztendlich nur der missglückte Versuch, den Tod zu überlisten, lautetet sein Credo. Ein Satz, den er bei jeder Gelegenheit verkündete, am liebsten aber in Anwesenheit von Kirchenvertretern. Generell war es nicht möglich, mit ihm über Glaubensfragen zu diskutieren. Wenn man es dennoch versuchte, bekam man den Spruch zu hören: Wer glaubt, weiß bloß zu wenig.
Er selbst glaubte an nichts, außer an die Macht des Geldes. Und davon hatte er reichlich. Geld verachtete er zwar auch und schmiss es bei Bedarf bedenkenlos zum Fenster raus, aber er brauchte es nun mal, um sein historisches Mühlenanwesen, seinen edel bestückten Weinkeller und einen Fuhrpark voller Luxussportwagen zu finanzieren. Vor allem aber brauchte er es zur Pflege seines Egos. Petersen war unbestreitbar intelligent - aber trotz Intelligenz und umfassender Bildung ein aufgeblasener Wichtigtuer, der vor allem eines wollte: bewundert werden. Als Kind war er einen Kopf kleiner als die meistens anderen Jungs seiner Klasse gewesen. Seitdem hasste er es, zu anderen aufsehen zu müssen. Um seine Minderwertigkeitskomplexe zu kompensieren, begann er damals Sport zu treiben. Im Geräteturnen fand sich auch rasch eine Sportart, die seinen körperlichen Voraussetzungen in idealer Weise entsprach. Insbesondere an den Ringen leistete er Großartiges und brachte es bis zum Landesmeister. Auch heute, mit 52 Jahren, mit Stirnglatze und Spitzbauch, ahnte man noch die Kraft, die in dem kurzbeinigen, breiten Körper, den knotigen Unterarmen und den derben Händen steckte. Da er keine Gelegenheit ausließ, den anderen zu zeigen, was für ein toller Kerl er sei, hielt sich seine Beliebtheit in seinem Bekanntenkreis in Grenzen. Dennoch suchten viele seine Nähe, weil sie ihn unterhaltsam fanden. Nicht nur wegen seines legendären Weinkellers, sondern auch wegen seiner frechen Sprüche, seiner verschrobenen Originalität und manche auch wegen seiner gewöhnungsbedürftigen Ansichten, die er keineswegs für sich behielt. Petersen konnte die meisten anderen Menschen nicht ausstehen. Außerdem gab es seiner Meinung nach viel zu viele davon. Vor allem zu viele bösartige, die man auch noch viel zu nachsichtig behandelte. Die Abschaffung der Todesstrafe hielt er für einen unverzeihlichen Fehler. Außerdem plädierte er für die Wiedereinführung der Prügelstrafe an Schulen. Überhaupt hielt er Prügel- und ähnliche Strafen für eine prima Sache und zur Resozialisierung von Straftätern wesentlich besser geeignet als teure und personalintensive Gefängnisaufenthalte. Trotz seiner teils menschenverachtenden Einstellungen konnte er gegenüber Leuten, die er mochte, großzügig und hilfsbereit sein. Doch davon gab es nicht viele.
Petersen galt als Staranwalt. Seine Kanzlei war stets zur Stelle, wenn es spektakuläre Fälle zu verhandeln gab. Promischeidungen, Vorbereitung von Sammelklagen gegen die Industrie oder Abwehr von Sammelklagen als Industrieberater - Petersen stand bereit, wenn die Streitsummen groß oder die Streitenden berühmt waren.
Vor zwei Jahren hatte er die Interessen des Meteorologen Theo Würtz vertreten, der mit seinem Arbeitgeber, einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, im Clinch lag. Wetterfachmann Würtz hatte es dank seines Showtalents zu Kult- und Promistatus gebracht. Der Sender hatte seinen Vertrag fristlos gekündigt, weil Würtz das Prager Klimaabkommen aufs Korn genommen und es als die "Prager Klimaschwindel" bezeichnet hatte. Petersen hatte ihn gleich gemocht. Er hielt ihn zwar für einen Spinner, aber so leidenschaftlich für das Gute streitend, so idealistisch wie Würtz, so war er früher selbst mal gewesen. Doch das war lange her. Inzwischen war er klüger.
Theos Prozess mit der Sendeanstalt fand entsprechende mediale Beachtung und es wurde mehrfach auf den Titelseiten der Boulevardzeitungen über ihn berichtet. Während des Prozesses, den Würtz schließlich gewann, bildete sich sein Anwalt Petersen seinerseits zum Klimaexperten heran. Er gab zahlreiche Interviews, in denen er überaus wortgewandt und kompetent den Standpunkt seines Mandanten verteidigte.
Gleich nach Verkündung des Urteils erhielt Petersen die Einladung zu einer der populärsten Talkshows des Landes. Ein schwarzer Tag für die Moderatorin. Angestachelt von der Aussicht auf millionenfache Bewunderung, lief Petersen zu Höchstform auf. Er polterte und pöbelte gegen alles und jedes, beleidigte den ebenfalls anwesenden Umweltminister als opportunistischen Nichtstuer und verteidigte wortgewaltig die Ansichten seines Mandanten Theo Würtz.
Ein weiterer Teilnehmer der Talkrunde war der Journalist Ivan Nagel. Er hatte ausspioniert, dass Petersen in seinem Fuhrpark Autos mit einer Gesamtleistung von 3416 PS versammelt hatte. Darauf angesprochen, hakte die Moderatorin Evelin Sauer nach. Ziemlich entnervt von Petersens Tiraden, sah sie endlich die Möglichkeit zur Revanche.
Herr Petersen, in der Vergangenheit sind Sie nicht gerade als Klimaschützer aufgefallen. Ganz im Gegenteil. Herr Nagel behauptete gerade, dass sich jede Menge spritfressende Oldtimer von Porsche und Ferrari in Ihrem Besitz befinden. Wie verträgt sich denn das mit Ihrem Engagement für den Klimaschutz?
Welchem Engagement für den Klimaschutz?
Na, ich bitte Sie! Seit einer Stunde verteidigen Sie vehement die Ansichten Ihres Mandanten, der ja einer der größten Streiter für das Klima ist und der nun frustriert behauptet, dass Klimaschutz wegen der Korruptheit der politischen Klasse generell nicht möglich sei. Und Sie selbst pflegen einen Fuhrpark mit automobilen Dinosauriern, von denen kein Einziger deutsche Innenstädte mehr befahren sollte. Sehen Sie da keinen Widerspruch?
Entschuldigung, aber wo ist denn da ein Widerspruch? Theo Würtz hat völlig recht, wenn er sagt, die Anstrengungen zum Klimaschutz seien für die Katz, weil Klimaschutz nämlich per se und generell im Widerspruch zu sämtlichen nationalen Wachstumszielen steht. In diesem Punkt bin ich ganz seiner Meinung.
Petersen sah herausfordern in die Runde und nahm in aller Ruhe ein Schlückchen Wasser. Dann ließ er die Katze aus dem Sack.
Im Übrigen aber halte ich Herrn Würtz für einen esoterischen Spinner. Ein Phantast, der leider die rhetorischen Möglichkeiten besitzt, Leute verrückt zu machen. Der Klimawandel ist in vollem Gange. Und wir Menschen haben nicht die geringste Chance, daran etwas zu ändern. Was übrigens auch unnötig ist. Die Welt hat schon Schlimmeres überstanden. Folglich ist es auch egal, ob ich 50 oder 5000 PS in meiner Garage habe.
Am nächsten Tag hing Würtz tot im Baum.
Ob ihm dieses Statement den Rest gegeben hatte? Dass ihn sein Anwalt, seine letzte Vertrauensperson, in aller Öffentlichkeit als esoterischen Spinner bezeichnet, und alles, woran er glaubte, als idealistisches Geschwafel diffamiert hatte? Würtz war während des Prozesses immer mehr vom Opfer zum Täter geworden. Zu Anfang war er noch der Held gewesen, der den Widerspruch der chinesischen Führung zwischen ehrgeizigem Klimaschutz und rücksichtlosem Infrastrukturausbau öffentlich machte. Doch dann hatte ihn seine Bühnenpartnerin vor laufender Kamera, mit erstickter Stimme und Tränen in den schönen Augen, sexueller Übergriffe während ihres gemeinsamen Aufenthalts in Prag bezichtigt. Bald fand sich eine weitere junge Dame, die Würtz in einem Interview perverse sexuelle Vorlieben unterstellte. Dank Petersen gewann Würtz zwar seinen Prozess gegen den Sender und erstritt eine hohe Abfindung. Sein Image als junger Klima-Sunnyboy war aber dahin.
Ungeachtet seiner fragwürdigen Rolle bei Theos Ableben erschien bald darauf Petersens erstes Buch, in dem er lauthals über die Verlogenheit von Politik, Medien und Klimaforschern herzog. Es trug den Titel
"In Memoriam - Theo Würtz und sein sinnloser Kampf für das Weltklima".
Petersen listete darin minutiös den wirtschaftlichen und technologischen Nachholbedarf der Entwicklungsländer gegenüber den Industrienationen auf. Daraus leitete er die These ab, dass wegen dieses Nachholbedarfs ein wirksamer globaler Klimaschutz schlichtweg unmöglich sei. In gewissen Kreisen wurde das Buch zwar ein Erfolg und anfänglich auch ernsthaft diskutiert, wegen seiner pessimistischen und konservativen Einstellung dann aber regelrecht verrissen. Der technische Fortschritt sei völlig unter den Tisch gefallen, hieß es. Gerade durch ihn, z.B. durch die Elektromobilität, habe man allen Grund zur Hoffnung. Schließlich bezichtigte ihn ein bekannter Literatur-Kritiker, er wolle mit dem reißerischen Titel das Drama um den unglücklichen Würtz zu Geld machen. Erst habe er ihn in den Selbstmord getrieben und nun wolle er das auch noch schamlos vermarkten.
Eine Kampagne gegen Petersen begann, die ihre Wirkung zwar nicht verfehlte, aber die Öffentlichkeit stark polarisierte. Während die linksliberale Meinungselite ihn schmähte, bildete sich eine Petersen-Anhängerschaft heraus aus Neo-Liberalen, Konservativen, rechten Verschwörungstheoretikern und Leuten, die sich mit Regenschirmen aus Aluminium vor Chemtrails schützten. Also hauptsächlich Menschen, die Petersen selbst für ausgemachte Spinner hielt. Was ihn jedoch nicht weiter störte. Im Gegenteil. Petersen wurde politisch. Seine Popularität in diesen Kreisen nutzte er zur Gründung einer neuen Partei. Er nannte sie die "Partei des gesunden Menschenverstandes", kurz PGS.
Für seine neue Rolle als Demagoge brachte er einige wichtige Voraussetzungen mit. Petersens Gesicht besaß einen hohen Wiedererkennungswert. Unter buschigen Augenbrauen warfen große blaue Glubschaugen durchdringende Blicke auf sein Gegenüber. Seine dicke Knollennase stak zwischen roten Apfelbäckchen, darunter ein dicklippiger Genießermund, und noch eine Etage tiefer ragte nußknackerhaft eine markante Kinnpartie hervor. Nein, Petersens mächtiger Dickschädel war alles andere als schön. Aber man vergaß ihn nicht. Ebenso wenig seine Stimme; ein gewaltig dröhnendes, sonores Organ, geschult in unzähligen Gerichtsverhandlungen, mit dem sich Petersen eindrucksvoll Gehör zu verschaffen wusste. Seine Sprechweise war absolut sauber und akzentuiert, reinstes Hochdeutsch - oder wahlweise Oxford-Englisch - und bis in den letzten Winkel eines Raums verständlich. Dieses besondere Zusammenspiel von Selbstbewusstsein, robuster Physiognomie und Stimmgewalt verliehen Petersens Auftritten Überzeugungskraft.
Andererseits hielt er von Diplomatie, Political Correctness, dem politikertypischen Anbiedern an Zielgruppenmeinungen oder Populismus nach links und rechts rein gar nichts. Er sagte, was ihm passte, Punkt. Folglich nahmen ihn als Politiker nur wenige ernst. Und nun auch noch das: Dr. Karl Petersen, Gründer der Partei des gesunden Menschenverstandes, in Kontakt mit einem Untoten.
Im Kühlschrank fand sich eine Flasche mit eiskaltem Pinot Blanc. Das beruhigte ihn etwas. Er setzte sich, trank ein Glas Wein und begann nachzudenken. Was waren die Fakten? Als sicher konnte gelten, dass er nicht träumte, sondern wach und bei klarem Verstand war. Daher konnten Halluzinationen ausgeschlossen werden. Was im Umkehrschluss die reale Existenz dieses Phänomens bedeutete. Eines Phänomens, das aussah wie ein ihm bekannter Mensch, aber nicht aus Fleisch und Blut bestand, sondern - aus was? Aus Licht? Man konnte es nicht mal anfassen, so wenig wie Nebel. Das Phänomen stand folglich im krassen Widerspruch zu den Regeln der Physik. Was konnte er tun, welche Handlungsmöglichkeiten hatte er? Die Polizei rufen? Sein Besucher würde sich beim Eintreffen der Beamten vermutlich in Luft auflösen. Er könnte sich aber beispielsweise ins Auto setzen und einfach wegfahren, unter Menschen gehen. Zum Beispiel ins Krankenhaus und sich mal ordentlich durchchecken lassen. Vielleicht hatte er ja doch einen Sprung in der Schüssel. Wie würde die Erscheinung darauf reagieren? Suchend sah er sich nach einem Autoschlüssel um. Er würde den 911er Turbo nehmen. Mal sehen, ob die Würtz-Kopie da mithalten konnte. Doch als seien seine Gedanken ein offenes Buch, meldete sich die Würtz-Kopie sogleich zu Wort.
Karl, vergiss es. Du kommst keinen Meter weit, wenn ich das nicht will.
Petersen beschloss, das vertrauliche Du seines Gastes zu übernehmen.
Dann sag mir gefälligst, wer oder was du bist und was du von mir willst.
Das ist nicht einfach zu beantworten. Ich bin tatsächlich dein ehemaliger Mandant Theo Würtz. Zumindest die eine Hälfte, der sichtbare Teil von mir, ist Theo Würtz. Du bist übrigens der Einzige, der sie sehen kann. Für alle anderen bin ich unsichtbar.
Was soll das heißen?
Was soll was heißen?
Die eine Hälfte! Was ist mit der anderen Hälfte?
Die andere Hälfte ist ein Oxygod.
Ein was?
Na ja, milde ausgedrückt, eine extraterrestrische Lebensform.
Red´ kein Scheiß.
Theo zupfte ein Fädchen aus seinem pastellfarbenen Pullunder, schnippte die blonden Haare aus der Stirn und sagte hintergründig grinsend:
Mach´ ich nicht, Ehrenwort.
Petersen kam die Galle hoch. Da war sie wieder, diese typische Würtz-Attitüde, dieses Ironische, bei dem man nie wusste, woran man bei ihm war. Keine Frage: Theo war, wie auch immer, irgendwie auferstanden. Das musste man einfach akzeptieren. So, wie er seit jeher leibte und lebte, genau so saß er hier an seinem Küchentisch und machte das, was er schon immer mit Vorliebe in seinem Haus getan hatte. Nämlich irgendwelche Schweinereien veranstalten. Halbvolle Flaschen mit sündhaft teurem Burgunder umwerfen, in die Rabatten pinkeln, den Lack seines 300er SL Baujahr 1954 im Vorbeilaufen mit dem Aktenkoffer zerkratzen, und jetzt den Louis-Quinze-Stuhl mit Kaffee versauen. Alles stimmte mit seinem Bild von Theo Würtz überein. Selbst sein verzogener Hals sah genauso aus wie auf den Fotos, die man von seiner Leiche gemacht hatte. Was blieb ihm übrig? Er musste mitspielen, die Sache ernst nehmen. Auch wenn das Phänomen zur einen Hälfte aus Nebel und zur anderen Hälfte aus Oxygod bestand. Aber was zum Teufel war ein Oxygod? Petersen, den abgebrühten Profi, konnte, von seinen cholerischen Ausfällen abgesehen, so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Wenn es ernst wurde, arbeitete sein Verstand glasklar. Seine bemerkenswerte Auffassungsgabe half ihm, selbst in dieser irren Situation den Überblick zu behalten. Er schlug den Kumpelton an, mit dem er in der Vergangenheit am besten mit Theo klargekommen war.
Okay, Amigo, jetzt mal Klartext. Du bist irgendwie wieder lebendig geworden. Kann ja mal passieren. Vor zweitausend Jahren hatten wir das angeblich auch schon mal. Aber was willst du von mir? Und was zum Kuckuck ist ein Oxygod? Deine bessere Hälfte?
Theo musste unwillkürlich lachen. Dieser Petersen war schon ´ne Nummer. Er würde es fertigbringen, bei seiner eigenen Beerdigung den Pfarrer zu beleidigen.
Das mit den Oxygods klären wir später. Aber was ich von dir will, ist ganz einfach. Ich werde dein Partner sein.
Wie bitte? Mein Partner willst du sein? Super! Vielleicht als Kanzlei-Zombie, der im Besenschrank hockt und die Mandanten erschreckt?
Theo schlug sich auf die Schenkel vor Vergnügen. Seit mindestens zwei Jahren hatte er sich nicht mehr so gut amüsiert. Petersen war ein Wahnsinniger. Aber so langsam mussten sie zur Sache kommen. Er zwang sich sich, ernst zu klingen:
Also, Karl, ich muss wohl etwas ausholen. Ich vertrete die Interessen einer Spezies, die, einfach ausgedrückt, vom Sammeln von Sauerstoff lebt.
Vom Sammeln von Sauerstoff?
Ja. Schon seit ewigen Zeiten durchstreifen die Oxygods das Universum auf der Suche nach Sauerstoff.
Petersen starrte ihn mit runden Augen an.
Die Oxygods. Aha. Schau an. Sauerstoff sammeln sie also. So ähnlich wie Bienen, vermutlich.
Genau. Nur eben Sauerstoff statt Blütennektar.
Macht Sinn. Sauerstoff statt Blütennektar! Super. Vermutlich bist du tot noch verrückter als lebendig.
Keineswegs, Kallemann.
Kallemann! Während der Prozesstage gegen die ARD, die Karl und Theo gerne in Petersens Weinkeller ausklingen ließen, wurde spätestens nach der zweiten Flasche Burgunder Dr. Petersen zu Kallemann. Jetzt nannte ihn dieses Was-auch-immer so. Petersen bekam Gänsehaut. Er fühlte, die Sache begann ernst zu werden. Dem entsprach nun auch Theos Tonfall.
Schließ die Augen, Karl. Wir gehen auf Reisen.
Wohin?
Nach Oxygard, der Heimat der Oxygods.
Petersen sah ihn misstrauisch an.
Wo liegt das?
Normalerweise exakt im Mittelpunkt des Universums. Aber diese Reise würdest du nicht überleben. Deshalb machen wir´s uns einfacher und gehen woanders hin.
Also ehrlich, Theo, in den Mittelpunkt des Universums wollte ich immer schon mal. Schade, dass wieder nichts draus wird. Und wohin geht´s stattdessen? Ins Kino?
Genau. Ins Kino. Ins Kopfkino, genauer gesagt.
Ah ja. Ins Kopf-Kino. Eintritt ist frei?
Klar, Kallemann. Ist ganz einfach und völlig umsonst. Schließ bitte die Augen. Und dann schau in dein Hirn.
Schizophrenie? Er hatte gehört, dass Schizophrene in ihrem Kopf Stimmen hören. War er doch verrückt geworden? Bei klarstem Verstand? Nicht auszuschließen. Dem menschlichen Gehirn war nicht zu trauen! Er versuchte trotzdem den Anweisungen Theos zu folgen, indem er die Augäpfel so weit wie möglich nach oben drehte. Etwas Unglaubliches geschah. Auf einmal konnte er seine Augen nicht nur komplett und schmerzlos senkrecht stellen, sondern sogar noch weiter, um fast 180° nach innen kugeln. Der schwarzgelbe Schleier der Augenlieder, die das Licht verdunkelt hatten, verschwand. Unfassbar! Plötzlich konnte er sein eigenes Gehirn betrachten. Sein Blick stieß langsam durch weiß und rot pulsierende Eiweißwolken, tiefer und tiefer in seine Gehirnwindungen vor. Er kam auf eine Art Straße aus gut durchbluteter Gehirnmasse, die vor einer rosa schimmernden Höhle endete. Darin saß, oh Wunder, niemand anders als Theo Würtz. Saß auf einem Thron aus Petersens Hirneiweiß, die Beine in lässiger Eleganz übereinandergeschlagen. Würde das jetzt so bleiben bis an sein Lebensende? Ewiges Mahnmal eines schlechten Gewissens? Aufmunternd lächelte das Mahnmal ihn an.
Gut gemacht. Du wirst den Weg zu mir mit der Zeit immer schneller finden.
Entspannt lehnte er sich zurück, strich die blonden Haare aus der Stirn und begann.
Zuerst muss ich mal was vorausschicken. Das hier wird unsere zukünftige Kommunikationsform sein. Ich in deinem Kopf. Wenn du mich sehen willst oder Ansprache brauchst, verdrehst du einfach die Augen und schaust nach innen. Ab und zu werde ich deine stickige Birne zwar verlassen, aber wenn du mich brauchst, werde ich da sein. Meistens, zumindest.
Und was ist der Zweck der Übung? Oder anders gefragt: Was stellst du dir unter Partnerschaft vor? Und vor allem, wie lange soll dieser Spuk noch dauern?
Das ist letztendlich eine Frage deiner Überzeugungskraft. Je größer sie ist, um so schneller geht´s. Im Ernstfall dauert es zehn Jahre. Bis dahin muss, egal wie, 35/60 implementiert sein. Wenn wir Glück haben, packen wir es in acht bis zehn Jahren. Wenn nicht, gehen hier die Lichter aus.
Was soll das heißen? Welche Lichter gehen aus?
Alle. Wenn wir 35/60 in zehn Jahren nicht umgesetzt haben, holen sie den Sauerstoff aus der Erdatmosphäre. Sauerstoff-Extraktion nennen sie das. Und das war´s dann.
Mal langsam, Theo. Was soll das denn? Sauerstoff-Extraktion! Du hast sie wohl nicht alle! Was soll die Scheiße?
Petersen war seine Verunsicherung nun deutlich anzumerken. Wenn er unsicher wurde, was gottlob selten geschah, verfiel er gerne in Fäkalsprache. Wer wollte es ihm in diesem Fall verdenken? In sein eigenes Hirn schauen und dort einem Toten zu lauschen, der den Weltuntergang ankündigt, das erfordert starke Nerven. Theo wies mit dem Arm vage in eine ungewisse Ferne.
Wir machen nun wie versprochen eine kleine innere Reise nach Oxygard. Danach wirst du alles verstehen, auch was unsere Partnerschaft betrifft. Aber zuerst noch eine Frage: Weißt du, was der Name Theo bedeutet?
Nein, aber vermutlich nichts Gutes.
Theo ist „Der von Gott Gesandte“. Und jetzt lass´ uns aufbrechen.
Petersens Hirnmasse, die eben noch wie eine Höhlenwand den Eiweißthron des Gottgesandten umschlossen hatte, verschwand und gab den Blick frei in ein blaues, unendlich scheinendes Firmament. Die Reise begann.
KROHNMÜHLE II
Petersen saß wieder in seiner Küche und hielt mit beiden Händen die massive Eichenplatte seines Küchentischs umklammert. Seine Armbanduhr zeigte 7 Uhr 35. Ihm gegenüber, mit triumphierendem Grinsen, Theo Würtz, dem es in Petersens Oberstübchen wohl zu einsam geworden war. Der Anwalt schwitzte, sein glatzköpfiger Quadratschädel glänzte in hellem Rot. In ungewohnter Bescheidenheit gab er zu, soeben ein beeindruckendes Erlebnis gehabt zu haben. Beeindruckender als alles, was er je erlebt hatte. Aber, fügte er, nun wieder ganz Jurist hinzu, da sich das alles doch wohl nur in seinem Kopf abgespielt habe, verlange er nun einen endgültigen, physischen Beweis. Theo oder Theo der ZWEITE oder wer auch immer solle sich gefälligst was einfallen lassen.
Theo überlegte nicht lange:
Oxygods können Sauerstoff-Atome bewegen und ihren Aggregatzustand verändern. Das funktioniert auch bei menschlichen Köpern. Selbst bei deinem. Denn jedes einzelne deiner Körpermoleküle ist in irgendeiner Form mit Sauerstoffatomen verbunden. Das heißt, ich kann deinen Körper nach Belieben bewegen. Ich werde dich nun ganz oben auf deinen antiken, zwei Meter zwanzig hohen Geschirrschrank setzen, auf den du aus eigener Kraft niemals hinaufkämst - schon weil der Abstand zur Decke für deine Wampe zu schmal ist. Steck dein Handy ein. Wenn du oben bist, machst du zum Beweis ein Selfie von dir. Dann hol ich dich wieder runter.
Hast noch alle Tassen im …. aarghh!
Noch bevor er den Satz beenden konnte, steckte er in den maximal 40 Zentimetern fest, die den Abstand zwischen dem staubigen Oberteil seines Biedermeier-Küchenschranks und der Zimmerdecke markierten. Müsste mal wieder Staub gewischt werden, bemerkte er. Aber hier kam tatsächlich niemand hin. Ächzend zog er das Handy aus der Hosentasche, streckt mühsam den Arm aus und machte ein Selfie. Ein kurzer Blick auf das Display bestätigte ihm die Peinlichkeit seiner Lage. Das durfte niemand zu Gesicht kriegen. Sofort löschte er das Foto und stöhnte:
Okay, du hast gewonnen. Lass mich runter.
Kaum saß er wieder am Tisch, begann er zu lamentieren:
Und? Wie soll das nun weitergehen mit unserer Beziehung? Werde ich jetzt zu deiner Marionette?
Theo tippte sich an die Stirn.
So ein Quatsch! Alles hängt von deiner Überzeugungskraft ab. Du sollst der mächtigste Mensch der Welt werden. Als Marionette wärst du dafür völlig unbrauchbar. Du wirst das im Wesentlichen allein hinkriegen. Ich vertraue ganz deinem krankhaften Ehrgeiz und deiner Geltungssucht. Das sind die wichtigsten Voraussetzungen, um ein Dämon zu werden.
Krankhafter Ehrgeiz und Geltungssucht! So ein Idiot! Aber ganz im Innersten wusste er, dass Theo recht hatte. Sein Traum von heute früh fiel ihm wieder ein. Karl der Große! Es war schon befremdlich, wie sehr er das genossen hatte. Mit hängenden Schultern schlurfte er zum Kühlschrank und holte die Flasche Pinot Blanc wieder hervor. Beim Einschenken verkündete er, plötzlich überraschend gutgelaunt:
Weißt du was? Das geht mir alles ein bißchen fix. Ich werde mich jetzt volllaufen lassen.
Diese Ankündigung löste bei Theo ungewollt ein freudiges Prickeln aus. Der großzügige Umgang mit kostspieligen Getränken und die Neigung zu opulenten Menüs gehörten zu den wenigen Eigenschaften, die Theo bei seinem ehemaligen Anwalt geschätzt hatte. Dennoch erwiderte er entschlossen:
Das werde ich unter Garantie zu verhindern wissen.
Aha! Und wie, wenn man fragen darf?
Wenn Alkohol wirken soll, ist immer auch Sauerstoff im Spiel. Vergiss das nicht. Die für deine Rauschzustände zuständigen Molekülketten werden so reagieren, wie ich es für angemessen halte. Und ich werde nicht zulassen, dass du dummes Zeug laberst, wenn Brukenthaler anruft.
Umso besser. Wenn es nicht wirkt, kann ich ja saufen, soviel ich will. Aber wer zum Teufel ist Brukenthaler?
Abbas Brukenthaler. Den Namen hast du bestimmt schon mal gehört.
Wie? Der UN-Generalsekretär?
Wer sonst?
Also der ruft mich an? Heute noch?
Ja. Wird nicht mehr lange dauern!
Und wann?
Wenn ich dich endlich auf Spur gebracht habe.
Was soll das nun wieder heißen?
Dir fehlen noch die theoretischen Grundlagen für deinen Job. Das Bewusstsein, um es genau zu sagen. Momentan bist du ein Egomane ohne Liebe zur Großen Symbiose, der großartigen Natur dieses Planeten. Für deine Porschesammlung würdest du den gesamten tropischen Regenwald opfern. Ein Hedonist reinsten Wassers. Das müssen wir wieder rückgängig machen. Du warst ja schließlich mal anders.
Das hatte gesessen. Ein unerwarteter Tiefschlag. Petersen musste tief Luft holen. Gab es etwas, was dieser Teufel nicht über ihn wusste? Okay, es hatte komische Phasen in seinem Leben gegeben. Eine Zeitlang war er mal ein idealistischer Trottel gewesen mit sozialistischen Flausen im Kopf und ohne Geld in der Tasche. Darauf spielte Theo offenbar an. Wütend entgegnete Petersen:
Okay, ich hatte mal dafür plädiert, dass die Reichen ihr Geld an die Armen verschenken sollen. Aber nur, weil ich keines hatte. Willst du, dass ich wieder solchen Schwachsinn predige?
Nichts läge mir ferner. Aber die Tatsache, dass du auch anders kannst, dass du mal sowas wie Herz gezeigt hast, macht die Sache einfacher. Du sollst dich zwar zum dämonischen Weltherrscher entwickeln, aber ein Guter muss es werden, der für die Belange der Großen Symbiose streitet. Der 35/60 installiert. Damit dir das gelingt, musst du wissen, was 35/60 mit der Bedürfnisspirale zu tun hat. Und mit dem Modell von Wille und Möglichkeit. Und sogar mit der Goethe-Gedenktafel in deinem Flur. Vor allem aber musst du die Motive des ZWEITEN zur Rettung dieses Planeten verstehen lernen. Und dafür werden wir jetzt eine kleine Reise in die Steinzeit unternehmen.
Petersen schenkte sich wortlos ein weiteres Glas Wein ein. Dann sagte er mit gefährlich ruhiger Stimme:
Jetzt pass mal auf. Es ist gleich halb neun. Wegen dir bin ich seit fünf Uhr auf den Beinen. Ich muss mich ständig aufregen und habe noch nicht mal gefrühstückt. Dabei frühstücke ich gern. Nämlich grundsätzlich drei Spiegeleier mit Speck und anschließend drei Quittengeleebrote. Hast du irgendwas davon bemerkt? Nein. Ich auch nicht. Du wirst mich jetzt erst mal frühstücken lassen, bevor du mich in irgendwelche Steinzeit-Abenteuer verwickelst.
Theo lachte.
Jederzeit, gerne doch. Ich liebe den Geschmack von Eiern mit Speck! Ich würde auch sofort in deinen Kopf verschwinden, damit ich daran teilhaben kann. Das Problem ist nur: Du hast überhaupt keinen Hunger!
Petersen stutzte. Verdammt. Der Kerl hatte recht. Wieso hatte er keinen Hunger?
Wieso habe ich keinen Hunger? Das ist deine Schuld!
Wieso ist es meine Schuld, wenn du keinen Hunger hast? Du unterhältst dich mit einem Toten und hast gerade den Mittelpunkt des Universums bereist. Seit zwei Stunden weißt du, dass du auserkoren bist, die Welt zu retten und witterst die Chance auf unbegrenzte Macht. Wie kann man da Hunger haben? Du hast überhaupt keine Zeit für Hunger und außerdem bist du ohnehin zu fett.
Das saß. Petersen sah etwas betreten drein. Schließlich knurrte er:
Und? Wie komme ich jetzt schnellstmöglich in die Steinzeit? Soll ich den Ferrari nehmen?
Du sollst aus dem Fenster schauen. Das geht fixer.
KROHNMÜHLE III
Die Krohnmühle lag am Ende eines engen Tals, das der Eisbach vor Jahrtausenden in den lehmigen Löß des Nordpfälzer Hügellandes geschnitten hatte. Als Petersen das Anwesen vor über 20 Jahren kaufte, lag das Dorf noch ein gutes Stück entfernt. Die Mühlengebäude standen inmitten von Wiesen mit alten Obstbäumen, kleinen Baumgruppen und den Gemüsegärtchen der weniger begüterten Dorfbewohner, die hinter ihren Häuschen nicht genug Gartenland zur Verfügung hatten. Linker Hand, zwischen Dorf und Mühle, erhob sich ein Hügel, dessen Spitze ein lichter Birkenhain krönte. Das Eistal ging an genau dieser Stelle in die Rheinebene über. Links und rechts vom Bach und der parallellaufenden Landstraße schlängelten sich schmale Feldwege die Weinberge hinauf. Ganz oben, wo die Hänge in ein fruchtbares Hochplateau übergingen, kamen die Kalkfelsen eines ehemaligen Meeresriffs zum Vorschein. Auf dem Magerrasen wuchsen seltene Orchideen und in den Höhlen des Kalkriffs nisteten Fledermäuse und Uhus. Archäologischen Untersuchungen hatten ergeben, dass die Höhlen zu Ende der letzten Eiszeit von Steinzeitmenschen bewohnt waren. Die Kuppe oberhalb der Höhlenfelsen bot einen phantastischen Ausblick über die Rheinebene bis zum Odenwald. Zu Füßen der Kuppe erstreckte sich ein endloses Meer aus Reben, Hecken, kleinen Wiesen und Wäldchen.
Petersen hatte die Mühle damals bei einer Oldtimer-Rallye entdeckt. Sie war völlig heruntergekommen. Eine Erbengemeinschaft aus geldgierigen Jungproleten und senilen Tattergreisen konnte sich über ihre weitere Verwendung nicht einigen. Petersen gelang es, dem zerstrittenen Haufen das Anwesen, das sich noch weitgehend im Originalzustand um 1900 befand, mittels heilloser Versprechen und juristischer Finten abzuschwatzen. Letztendlich hatte der Kaufpreis deutlich unter Wert gelegen. Es brauchte allerdings drei Jahre intensiver Renovierungsarbeit und einen finanziellen Einsatz von zwei Millionen Euro, bis das Anwesen endlich seinen Vorstellungen entsprach. Acht schöne Jahre durfte sich Petersen an seiner Mühle und ihrer einmaligen Lage zwischen Obstgärten, Wiesen und Weinbergen freuen. Was immer einen Top-Juristen wie ihn, mit Kanzleien in Mannheim, Berlin und Frankfurt dazu trieb, sein Domizil in der Pfälzischen Provinz aufzuschlagen und sein Heil zwischen Weinstöcken und Gemüsegärtchen zu suchen - er hatte anscheinend genau hier seine Erfüllung gefunden. Vielleicht hing es ja mit seiner Großmutter zusammen, die zeitlebens ihrem Gut in Ostpreußen nachgetrauert hatte. Ein Ort, wo man sich in gesunder Natur weitgehend selbst versorgt, wo alles seinen Platz, seine Ordnung und seine Richtigkeit gehabt hatte. Vielleicht musste er ihr, die schon lange tot war, immer noch beweisen, dass er, genau wie einst der Großvater, der richtige Herr für ein solches Gut gewesen wäre. Vielleicht hatte sie ihm mit ihren endlosen, verklärenden Erzählungen auch einfach nur die Idee einer idealen Existenz ins Herz gepflanzt. Wie auch immer, wenn Petersen am Wochenende aus der City zurückkehrte, begann hier das wahre Leben für ihn. Raus aus dem Anzug, rein in die Arbeitshose. In einem Schrank hatte er einen alten grauen Kittel gefunden, mit dem wohl noch der letzte Müller unterwegs gewesen war und der ihm wie angegossen passte. Dieser Kittel wurde sein Markenzeichen. In ihm inspizierte er den Weinkeller, wienerte die Oldtimer, säuberte den Hühnerstall und schnitt die Obstbäume. Eine Frau Petersen gab es hingegen nicht. Dem alten Hagestolz und eingefleischten Junggesellen erschien die Vorstellung unerträglich, mit einer anderen Person seine Räumlichkeiten teilen zu müssen. Und mit solch komplizierten Persönlichkeiten wie Frauen schon gar nicht. Ihm reichte, dass zweimal pro Woche ein Putzgeschwader, bestehend aus zwei älteren Schwestern hier eintrudelte, die unaufhörlich miteinander schnatterten. Zum Glück auf portugiesisch, so dass er nicht mitbekam, was sie über ihn zu lästern hatten.
Die Wende in seinem Paradies kam, als der Gemeinderat die Ausweisung eines Neubaugebietes unterhalb und den Bau einer größeren Kläranlage oberhalb der Krohnmühle beschloss. Jetzt rächte sich, dass Petersen alle Angebote der Gemeinde zur Mitarbeit ausgeschlagen hatte. Sogar Bürgermeister hätte er werden können. Selbstverständlich hatte er solche Anträge stets hohnlachend abgelehnt. Die Mitglieder des Gemeinderats waren in seinen Augen nichts als gemeingefährliche Trottel, die hauptsächlich damit beschäftigt waren, das historische Ortsbild ihrer Gemeinde zu verschandeln. Bis er endlich Wind von dem Bauvorhaben bekam, war es für Gegenmaßnahmen zu spät.
Die Krohnmühle war als Dreiseitenhof angelegt. Die offene Seite wies zum Dorf hin. Im linken und rechten Flügel befanden sich Wirtschaftsgebäude: ehemalige Viehställe, der Weinkeller und der Kornspeicher. Das weitläufige hintere Querhaus mit dem Mühlrad, den Transmissionen und dem Mahlwerk, hatte schon immer auch als Wohnhaus gedient. Die historische Mühlanlage konnte Petersen weitgehend erhalten. Den Wohntrakt ließ er jedoch komplett umgestalten. Ans Wohnzimmer war nun eine großzügige Terrasse angebaut mit einer riesigen Freitreppe aus gelbem Sandstein, die direkt in den Garten führte. Rechts von der Treppe glitzerte der teilweise überdachte Pool. Die Wohnküche, in der sich Petersen seit heute früh um fünf mit einem Untoten plagte, lag zur offenen Hofseite. Früher hatte man vom Küchenfenster aus einen weiten Blick über die Obstwiesen und Gärten auf den alten Kirchturm des Winzerdorfes gehabt. Heute fiel der Blick direkt auf das Neubaugebiet mit seinen sterilen Energiesparfassaden und seinen toten, zehnfach verglasten Fensterhöhlen. Die Vorgärten der Neubauhäuser bestanden aus Geröll, in die künstlich anmutende Koniferen-Gebilde gerammt waren. Ein Anblick, den Petersen nur mit Mühe ertragen konnte. Bei Westwind quälte ihn der Gestank der neuen Kläranlage, die man hundert Meter vor seiner Gartenmauer in die Auwiesen zementiert hatte. Sie bestand aus drei kreisrunden Klärsilos und einem bunkerähnlichen Betonwürfel für die Technik. Die Anlage sicherte ein verzinkter Stahlzaun, der jeder Haftanstalt Ehre gemacht hätte. Doch damit nicht genug. Auf der Anhöhe oberhalb des Tals surrten seit zwei Jahren vier Windräder vor sich hin, denen vermutlich die Fledermäuse und der Uhu von den Höhlen gegenüber zum Opfer gefallen waren. Und oben auf dem sanften Rebenhügel, ehedem gekrönt vom lichten Birkenhain, hatte der tüchtigste Jungwinzer des Ortes eine schneeweiße, neokubistische Vinothek errichtet, die mit einem riesigen Bullauge wie ein Zyklop in die Rheinebene glotzte. Der Architekt schien den Wein des Jungwinzers nicht vertragen zu haben. Eine andere Erklärung für diese architektonische Scheußlichkeit war für Petersen nicht vorstellbar.
Die baulichen Entwicklungen der Neuzeit in seiner unmittelbaren Nähe lösten erhebliche Frustrationen bei ihm aus, welche die ohnehin latent vorhandene Verachtung für seine Mitmenschen noch verstärkte. Womöglich versuchte er diese als persönliche Niederlage empfundenen Ereignisse mit noch mehr Erfolg in seinem Beruf und seinen politischen Ambitionen zu kompensieren. Jedenfalls hatten ihm die fremden Bautätigeiten den Spaß an seinem Kleinod gründlich verleidet und damit wohl auch zu der Grundmürrischkeit beigetragen, die nun Teil seines Wesens war.
Zehn Uhr. Die Oktobersonne schien in einem warmen Licht. Theo hatte ihn aufgefordert, aus dem Fenster zu sehen. Es gab aber kein Fenster mehr. Nicht mal eine Hauswand, geschweige denn ein Haus. Petersen fühlte wie seine Beine nachgaben. Er sank langsam zu Boden. Aber er landete nicht auf dem glatt polierten Eichenparkett, sondern in weichem Gras. Langsam, mit wackligen Knien erhob er sich. Das Neubaugebiet - weg. Die Windräder und die Vinothek - verschwunden. Anstelle des Dorfes lag eine sumpfige, mit Büschen, niedrigen Sträuchern und Wollgras bewachsene Ebene vor ihm. Mitten darin erhob sich der ehemalige Rebenhügel, auf dem eben nochdie Vinothek gestanden hatte. Jetzt war er mit saftigem Gras und kleinen Baumgruppen bewachsen.
Langsam ging Petersen darauf zu.
EISTAL
Die sechs Personen auf der Hügelkuppe sahen anders aus als heutige Menschen. Ihre Bekleidung war spärlich, die Bewegungen rasch und geschmeidig. Einer war nackt und von Kopf bis Fuß mit Brombeersaft gefärbt, andere mit zottigen Fellstücken bekleidet. Die meisten waren von gedrungener Gestalt, dabei sehnig und muskulös. Es waren fünf Männer und eine Frau.
Als sie Petersen bemerkten, winkte einer der Männer und rief etwas, das wie „Hasenbart“ klang. Petersen wusste, er war gemeint und erklomm den Hügel. Keinen von ihnen hatte er je zuvor gesehen. Aber wie selbstverständlich schien er zu ihnen zu gehören. Als wäre es die normalste der Sache der Welt, gesellte er sich dazu. Sie nahmen weiter keine Notiz mehr von ihm. Ihr Interesse galt den Pferdeäpfeln, die sie im Gras entdeckt hatten. Die Frau bohrte Petersen den Finger in die Seite, wühlte kichernd in dem Haufen und stieß kehlige Laute aus. Die Worte konnte er keiner ihm bekannten Sprache zuordnen. Trotzdem verstand er sie, als sei es seine Muttersprache. Er schüttelte den Kopf und antwortete, das Pferd sei ihm nicht begegnet. Sie lachte. Petersen fühlte eine merkwürdige Vertrautheit und kannte auf einmal ihren Namen: Honighand.
Wie war er plötzlich zum Teil dieser Gruppe geworden, als hätte er sein ganzes Leben hier verbracht? Wieso sah er plötzlich aus wie sie? Wieso hatte er so riesige, vernarbte Hände und nichts am Leib außer zwei Hasenfellen? Egal. Das hier ist dein Stamm. Deine Familie. Deine Geschichte. Schon immer. Jetzt bist du zurückgekehrt. Du gehörst wieder dazu. Frag nicht warum. Akzeptiere es einfach.
Die Haare der Frau waren zu kleinen Zöpfen geflochten, die über ihre bloßen Brüste fielen. Um den Bauch trug sie ein Rehfell, dessen Haarseite nach innen zeigte. Sie war jung und lebhaft.
Der Brombeerfarbene schien der Älteste zu sein. Sein Name war Olk. Als einziger trug er keinen Bart. Aus seinen geschwärzten Wangen schloss Hasenbart, ehemals Petersen, dass Olk ihn kurz zuvor abgebrannt hatte.
Olk führte das Wort und interpretierte Lage und Form der Pferdeäpfel. Die drei anderen Männer hörten gebannt zu oder gaben kurze Kommentare. Der Fünfte hielt sich abseits und beobachtete mit demonstrativem Desinteresse das Grasland in der Ebene.
Langaufgeschossen, dabei blasser und schmaler als die anderen, ging etwas Einschüchterndes von ihm aus. Er war noch sehr jung, doch sein ganzes Wesen schien Unterordnung und Respekt zu fordern. Sein kantiges, vom ersten Bartflaum bedecktes Kinn wirkte im Widerspruch zu seinem weichen Mädchenmund verwirrend und auch die stechend blauen Augen waren alles andere als beruhigend. Als sich ihre Blicke trafen, fühlte sich Hasenbart wie eingesogen in die blaue Iris, als würde er in einem Quelltopf versinken. Bestimmt eine Minute starrten sie sich an und danach wussten sie, dass sie aus einem Holz geschnitzt waren, aber niemals Freunde werden konnten. Und das nicht nur, weil 20.000 Jahre zwischen ihnen lagen.
Sein Name war Schnakenbein, und Hasenbart schien ihn von Kindesbeinen an zu kennen. So wusste er auch, dass es Schnakenbein nach den Gesetzen der Natur nicht hätte geben dürfen.
Schnakenbein war zu früh zur Welt gekommen. Ein schwächliches Kind mit viel zu dünnen Beinchen - Schnakenbeinen. Außerdem war er zu einer Zeit geboren worden, als der Stamm durch Unachtsamkeit sein Feuer eingebüßt hatte. Ohne Feuer hätte eine Winterkind-Frühgeburt niemals überleben können. Dass er dennoch lebte, verdankte er einer Serie kleiner Wunder. Das erste Wunder zeigte sich in Form eines Blitzes, der einen Tag nach seiner Geburt aus der einzigen Wolke an einem ansonsten strahlend blauen Spätherbst-Himmel fuhr. Dass nämlicher Blitz die kleine Birke oberhalb der Winterschlafhöhle traf und wie eine Fackel auflodern ließ, war das zweite Wunder. Die Laune des Himmels brachte den Stamm endlich wieder in den Besitz von Feuer - in letzter Minute vor Einbruch des Winters, nach Wochen der Finsternis und lustlosem Kauen auf rohen Fleischbrocken.
Der Blitz war Schnakenbeins Rettung. Die Älteren hatten ihn zuvor wegen seiner Schwächlichkeit sogleich ertränken wollen. Auf Jahre hinaus würde er nur eine Last sein. Doch sein vermutlich leiblicher Vater, Olk der Tigerrufer, der wie brünstige Tigerkatzen schreien konnte, widersetzte sich. So kam es, dass Hara Fenchelsamenfinger, Schnakenbeins Mutter, sich zwar widerwillig, aber dennoch mit der gebotenen Sorgfalt und der Hilfe des wärmenden Feuers um den Kleinen kümmerte.
Aus Schnakenbein wurde ein besonderes Kind. Er sang den ganzen Tag und steckte voller Ideen und Flausen. Abends brachte er alle zum Lachen mit erfundenen Worten. Er erfand Begriffe für Dinge, die noch keinen Namen hatten, z.B. für die Himmelsrichtungen und für besondere Steine, Bäume und Tiere. Außerdem konnte er Tiere und Menschen imitieren. Er war quirlig, lebhaft und ständig fiel ihm etwas ein. Immer wollte er was ausprobieren, stellte alles Bewährte in Frage und was man ihm verbot, tat er heimlich. Sein besonderes Interesse galt dem Feuer. Wenn irgendwo ein Feuer brannte, zog es ihn magisch an und je älter er wurde, umso besessener wurde er von der Idee, selbst Feuer machen zu können.
Hinzu kam, dass er reden konnte wie ein Buch. Mit der Zeit machte er sich zum Wortführer der Jungen im Stamm. Doch viele Ältere begannen misstrauisch zu werden. Denn unübersehbar kamen auch seine schlechten Eigenschaften zum Vorschein. Stolz war er und eitel, dabei leicht zu kränken. Wenn ihn jemand geärgert hatte, konnte er nachtragend und sehr gehässig werden - ein Verhalten, das man so nicht kannte. Eines Tages wurde er von Honighand dabei beobachtet, wie er mit sich selbst sprach. Schnakenbein saß auf einem bemoosten Felsblock, der von Wasser umspült im Bett des Eisbachs lag, und unterhielt sich angeregt mit - niemandem. Er stellte Fragen, deren Antwort man nicht hörte, und beantwortete mit ruhiger Stimme unhörbare Fragen. Dabei sollen seine Augen weit geöffnet, aber nur das Weiße zu sehen gewesen sein, schwor Honighand.
Als er ins Lager zurückkehrte, stellte man ihn zur Rede und wollte wissen, mit wem er gesprochen habe. Doch er lächelte nur das großspurige neue Lächeln, das nur er lächeln konnte und meinte verächtlich, es wäre seine Sache, mit wem er spräche. Bald könne er Feuer machen und dann würden sie schon sehen, wie stark er sei.
Zum Zeitpunkt dieses Vorfalls war das Verhältnis zwischen Schnakenbein und Dickfaust schon zerrüttet. Dickfaust, ein ruhiger und besonnener Mann, besaß Autorität. Wenn es in dem Stamm einen Chef gab, so war er es. Gab es ein Problem, scharten sich alle um ihn und hörten seinen Rat. Und bevor die Jagd begann, war er es, der die Männer zusammenrief. Wenn sein Ruf ertönte, versammelten sie sich im Kreis. Mit geschlossenen Augen begannen sie zu tanzen und sich zu berühren. Dann sang man den Namen dessen, den man glaubte gerade angefasst zu haben und rühmte dessen Vorzüge und Heldentaten. Kaum einer irrte sich jemals, und trotz geschlossener Augen wusste jeder, wessen Arm, Hand oder Haare er gerade gepackt hatte. Das Erjagen schneller Beutetiere setzte das blinde Verständnis der Jäger untereinander voraus. Bei der Jagd wusste jeder, was er zu tun hatte und jeder ahnte, was der andere gerade tat. Das Gespür für die Reaktion des Anderen war die Voraussetzung für den Jagderfolg. Nach dem Jägertanz rühmten sie die Tiere, die sie jagen wollten. Ehrfürchtig imitierten sie ihre Bewegungen, ihr Drohgebrüll und ihre Angstschreie. Sie rühmten ihre Kraft und Schnelligkeit, baten sie um Gnade vor der Gewalt ihrer Zähne, Krallen, Hörner und Hufe. Danach erst gingen sie zur Jagd.
Mit der Geschlechtsreife wurden die Jungen zu Männern, und nachdem sie zum ersten Mal einer Frau beigewohnt hatten, durften sie am Jägertanz teilnehmen. Alle Jungen fieberten diesem Tag entgegen. Alle - außer Schnakenbein. Die Zeremonie bedeutete ihm nichts. Viel lieber zog er alleine los und vertraute statt auf den Instinkt der Gruppe seinen neuen Waffen: Pfeil und Bogen waren sein neues Steckenpferd. Monatelang widmete er sich der Verbesserung der Technik und der Übung des Schusses. Wenn er Beute machte, sollte der Ruhm ihm alleine zufallen.
Dickfaust waren Schnakenbeins Alleingänge ein Dorn im Auge. Er verachtete das Rumhantieren mit Pfeil und Bogen, die er für lächerliche Waffen hielt - gerade gut genug für die Jagd auf Vögel - und hielt auch Schnakenbeins ständige Suche nach Neuem, nach Veränderung des Bestehenden für gefährlich - gefährlich für den Geist des Stamms, für das intuitive Verständnis und das blinde Vertrauen untereinander. Denn schon begannen einige der Jungen, Schnakenbeins Firlefanz nachzuahmen und ihn zu bewundern. Und es war Einiges, was es an Schnakenbein zu bewundern gab. Wenn er wollte, konnte er alle zum Lachen bringen. Oder zum Weinen. Viele waren Wachs in seinen Händen. Er konnte reden, beschwören, mitreißen - oder kränken. Weil er wegen seines schwächlichen Körpers den direkten Kampf mit Beutetieren scheute, erfand er neue Waffen. Waffen, die aus der Distanz töten sollten. Und er versprach ihnen das ewige Feuer. Selbst wollte er es machen können, aus Steinen. Hatte man je so was gehört? Nein, Schnakenbein war anders. Nie fühlte er wie sie. Er passte nicht zu ihnen.
Sein größter Bewunderer war Regenbogen. Regenbogen war ein Künstler. Er konnte Tigerkatzen malen, so dass man erschrak, wenn man die Bilder sah. Er wurde zu Schnakenbeins treuestem Freund und Vasallen. Eines Tages beobachtete er Schnakenbein dabei, wie er am unteren Ende eines Pfeils drei in der Mitte gespaltene Vogelfedern anbrachte. Nachdem ihm dies gelungen war und Schnakenbein einen Probeschuss machte, sah Regenbogen, dass der neue Pfeil viel besser flog. Er fragte Schnakenbein, was ihn auf diese Idee gebracht habe. Schnakenbein antwortete, in seinem Kopf befinde sich ein unsichtbarer, ungeheuer starker Freund, mit dem nur er reden könne und der sich ihm zugewandt habe, weil er etwas Besonderes sei. Er, Schnakenbein, sei deshalb der künftige Führer des Stamms. Er sei zum Führer geboren und der Freund in seinem Kopf werde ihm dabei helfen. Regenbogen erzählte den anderen von Schnakenbeins Behauptung. Eine solche Anmaßung hatte es zuvor noch nie gegeben. Einmal mehr erregte Schnakenbein damit den Zorn Dickfausts und der Älteren des Stamms. Der Konflikt zwischen den beiden spitzte sich zu und sollte den Untergang der Farbhaare zur Folge haben.
Ob das Feuer damals, in den Monaten vor Schnakenbeins Geburt, tatsächlich versehentlich erloschen oder, wie Olk behauptete, von den Farbhaaren gestohlen worden war, blieb lange strittig. Sörk Winterblume, die an jenem Spätsommertag die Feuerwacht gehabt hatte, schwor Stein und Bein, dass sie vor dem Pilzesuchen die Feuerstelle gut abgedeckt habe und nur wenig Sonnenweg fortgeblieben sei. Es hätte also bei ihrer Rückkehr noch ausreichend Glut vorhanden sein müssen. Am gleichen Tag war zu allem Unglück der Feuertopf, den die Männer bei der Jagd mit sich führten, beim Überqueren einer Furt ins Wasser gefallen und sie mussten mitansehen, wie ihre letzte Glutreserve zischend in den Fluten des Eisbachs versank.
Erst gegen Abend wurde das ganze Ausmaß des Dilemmas deutlich. Zum ersten Mal seit Jahren gab es kein Feuer, zu dem man sich vor der abendlichen Kühle hätte flüchten können. Zum ersten Mal seit Jahren mussten Wurzelmus und zähes Wadenfleisch wieder roh gegessen werden. Da meinten einige, am Lager der Farbhaare Rauch gesehen zu haben. Das sommerliche Laubhüttenlager der Farbhaare lag zwar in einiger Entfernung, aber noch gut sichtbar in der weiten Ebene des Großen Flusses.
Bei Sonnenaufgang machte sich eine kleine Abordnung der Menschen auf den Weg dorthin. Als sie ankamen, war das Lager aber bereits verlassen und sie fanden nur noch kalte Asche.
So wie die Menschen, experimentierten auch die Farbhaare mit dem Feuer. Aber sie hatten Mühe, es über einen längeren Zeitraum in Gang zu halten. Vielleicht legten die Farbhaare auch weniger Wert auf Feuer als die Menschen. Es war ihnen im Grunde immer fremd und unheimlich geblieben. Die Wärme der letzten Jahre tat ihr Übriges. Die Farbhaare waren es gewohnt, viel kältere als die derzeit herrschenden Temperaturen ohne Feuer zu überstehen. Die Wärme bereitete ihnen im Gegenteil mehr Probleme als es zuvor die Kälte getan hatte. Die Farbhaare waren auf die Jagd großer, furchtloser Tiere wie Mammut und Nashorn spezialisiert. Tiere, die nicht wegliefen, sondern stehen blieben und sich dem Kampf stellten. Solche Tiere aber gab es immer weniger. Ihr Bestand litt unter den Sümpfen, die sich nun überall ausbreiteten. Riesige Schmelzwassermoraste entstanden aus dem Nichts und unterbrachen ihre angestammten Wanderrouten. Bedeckt mit trügerischen Pflanzenteppichen, versanken darin ihre massigen Körper. Zahllose Nashörner, Mammuts und Riesenhirsche gingen elend zugrunde. Auf den verbliebenen trockenen Flecken wurde bald das Futter knapp. Dort wimmelte es überdies von Raubtieren, die sich über die Jungtiere hermachten. Die Jagd auf die schnellen, leichtfüßigen Rudeltiere, die Pferde und Antilopen, wie sie die Menschen jagten und die nun in Massen auftraten, hatten die Farbhaare nie richtig gelernt.
Statt wie in der Vergangenheit mit mächtigen Fleischportionen zu prahlen, mussten die Farbhaare nun öfter nach Wurzeln graben und Beeren sammeln. Neuerdings hatten die Menschen oft die fettere Beute und die Farbhaare mussten neidisch zu ihnen herüberblinzeln, wenn sie sich triumphierend mit dem dampfenden Blut und warmen Fett der Pferde und Rentiere beschmierten, die sie selbst nur selten erlegen konnten.
An seine erste Begegnung mit den Farbhaaren erinnerte sich Hasenbart, der schon längst ein ganzes Steinzeit-Leben an Erinnerungen in sich trug, dennoch mit einem Gefühl der Bewunderung. Die Menschen hatten ihr Sommerlager am Hochufer des Großen Flusses aufgeschlagen, der gemächlich zwischen den Abend- und Morgenbergen dahinfloss. Jetzt im Frühjahr wand er sich grün und klar durch eine endlos weite, mit dichten Gras- und Blumenteppichen bewachsene Ebene. Es wimmelte von Wisenten, Hirschen, Rentieren und anderen Huftieren, die zwischen Büschen, Birken- und Weidenwäldchen weideten. Von allen Seiten gluckerten und flossen Bäche und Flüsse heran, um sich mit dem mäandernden und ständig sein Bett wechselnden Hauptstrom zu vereinigen. Wegen dessen Unberechenbarkeit hatten die Menschen ihre Hütten nicht in die üppig bewachsene Flussniederung gebaut, sondern oberhalb des kleinen sandigen Tals, aus dem der Eisbach kommend in den Großen Fluss mündet.
Schnakenbein und Hasenbart hatten ihren achten Winter überstanden. Mit den anderen stiegen sie in die Ebene hinab. Die Sonne schien schon recht warm. Die Luft war so erfüllt vom Gesang, dem Gekreisch und Gekrächz Myriaden liebestoller Vögel, dass die Menschen ihr eigenes Wort nicht verstehen konnten. Die Kinder wurden zum Eiersuchen losgeschickt, während die Frauen Sauerampfer und Bärlauch pflückten oder Lauchzwiebeln ausgruben. Nur ein einzelner Mann blieb bei der Gruppe. Olk war im letzten Winter von einer Tigerkatze angegriffen worden. Das hatte ihn seine halbe Wade gekostet. Für die Jagd war er nicht mehr schnell genug.
Zum Schutz vor den vielen Raubtieren hatte man ein Feuer entfacht. Anschließend steckte Olk mit qualmenden Holzstücken das Terrain ab, in dem man sich nun einigermaßen gefahrlos bewegen konnte. Für Wölfe und Bären war der Geruch des Feuers gleichbedeutend mit Steppenbrand, so dass sie respektvollen Abstand zu dem Lager hielten.
Dann passierten zwei Dinge gleichzeitig. Vom Hochufer rutschte mit lautem Gepolter eine Herde Wisente in die Grasebene. Ihr Zug über den Abhang dauerte eine ganze Weile. Die Ausgelassenheit, mit der sie sich über das saftige Gras hermachten und die wilden Bocksprünge der Kälber fesselten Hasenbarts Aufmerksamkeit. Das zweite Ereignis bemerkte er erst, als es schon mitten unter ihnen war. Eine schwere Hand berührte seine Schulter. Zugleich hörte er eine der Mütter aufgeregt rufen und die eiligen Schritte Olks. Hasenbart fuhr herum und schaute in das Gesicht eines fremden, gelbhaarigen Wesens. Im Vergleich zu einem Bären hatte es mehr Ähnlichkeit mit den Menschen, schien aber nicht von ihrer Art zu sein.
Tatsächlich ähnelte seine Behaarung eher einem Bären. Doch zwischen seinen Beinen schlenkerte, ähnlich wie bei Menschen-Männern, ein kurzes, dickes Glied - allerdings überwuchert von einem Wust blonder Wolle.
- Aachah!
sagte er und musterte Hasenbart aus blauen Augen, die unter mächtigen Stirnwülsten und wild wuchernden Augenbrauen hervorblitzten.
Brust, Schultern, Beine und sogar den Handrücken des Mannes bedeckte ein dichter Flaum aus blondem wolligem Kraushaar. Er war nicht sehr groß, aber breit und stämmig gebaut. Auch seine behaarten Füße waren derb und groß, die Fußgelenke dick wie Baumstämme. In seinem Mund stak eine imposante Reihe braun verfärbter Zähne. Jetzt hob er seine Pranke und fasste Hasenbart ins Haar. Ängstlich hüpfte der einen Schritt zurück, was den Mann zu einem gutmütigen Lachen veranlasste. Inzwischen war Olk angekommen. Die Frauen und die anderen Kinder scharten sich um ihn. Bald sahen sie aus dem Blumen- und Gräserdickicht noch weitere solcher Wesen auftauchen. Es wurden immer mehr und rasch hatten sie, angelockt vom Rauch des Feuers, die Menschen regelrecht umzingelt.
Der Feuerstelle galt ihr Interesse. Es mochten wohl zwei Dutzend, vorwiegend Männer, aber auch drei Frauen und zwei Kinder gewesen sein, die sich nun langsam und ehrfürchtig den Flammen näherten. Jeweils zwei Männer trugen lange Holzstangen auf der Schulter, an denen gewaltige, mit Mammutfell bedeckte Fleischstücke hingen. Trotz der allgemeinen Aufregung lief Hasenbart das Wasser im Mund zusammen und auch die anderen bekamen große Augen. Bei näherem Hinsehen bemerkten die Frauen, dass die Holzstangen armdicke Speere waren. Keiner ihrer Männer hätte solche Lasten tragen, geschweige denn mit solchen Speeren hantieren können. Aber um ein Mammut zu erlegen, brauchte man wohl solche Waffen. Olk war inzwischen zu einem Mann mit flammend rotem, von grauen Strähnen durchzogenem Haar getreten. Vermutlich war er das Oberhaupt der Gruppe. Es gab noch andere mit roten Haaren, in allen Schattierungen von Orange bis Braun, doch die meisten waren hell- oder dunkelblond. Olk hob beide Hände zum Zeichen, dass er unbewaffnet war. Obwohl er den Rothaarigen um einen halben Kopf überragte, wirkte er merkwürdig unscheinbar neben dem ungeschlachten Klotz. Der Chef sagte ebenfalls „Aachah“. Dann klaubte er seinen Penis aus einem Dickicht roter Wolle und pisste Olk auf die Füße. Der ließ den warmen Strahl ungerührt über sich ergehen. Er kannte das Ritual bereits. Nun begannen auch die anderen Farbhaare den Menschen auf Waden, Knie und Füße zu pinkeln. Der dampfend warme Urin war durchaus angenehm. Die Farbhaare sahen Olk erwartungsvoll an, und so urinierte auch er auf die Füße des Häuptlings. Die Frauen beider Gruppen sahen zu und kicherten. Die Farbhaar-Frauen hatten dicke behaarte Hintern und auch ihre Brüste waren behaart. Allerdings schien ihre Wolle weicher und feiner als die der Männer zu sein. Auch Hasenbart wollte nun einen der blonden Farbhaare bepinkeln. Doch so sehr er an seinem Kinderpimmelchen zerrte und zog, vor Aufregung gab es keinen Tropfen von sich. Die Frauen lachten noch mehr und beschämt setzte er sich abseits ins Gras. Nun versammelten sich die Farbhaare neugierig um die Feuerstelle und schnupperten den Rauch. Sofort war Honighand zur Stelle. Sie war die jüngste Schwester von Schnakenbeins Mutter, nur unwesentlich älter als er, und hatte sich trotzdem schon durch ihren sachkundigen Umgang mit dem Feuer hervorgetan. Sie fachte die Glut neu an und zeigte voller Stolz, wie sie die Flammen zum Lodern und die Funken zum Stieben bringen konnte. Die Farbhaare waren beeindruckt. Honighand zeigte erst auf ein großes Stück Fleisch, dann auf das Feuer, rieb sich dazu den Bauch und leckte die Lippen. Die jüngere der Farbhaar-Frauen verstand sofort, holte das Fleisch und gab es Honighand. Die Männer schauten misstrauisch zu. Bei dem Stück handelte es sich um den oberen Teil des Vorderbeins. Es hatte etwa die Größe von Hasenbart. Es war schlecht enthäutet und überall klebten Haare und Fellreste. Honighand warf das ganze Stück ohne Federlesens direkt ins Feuer. Das missfiel den Männern. Sie grunzten ärgerlich, riefen hoo-hoo, aber griffen nicht ein. Honighand drehte und wendete das Fleisch in der Glut. Eine dichte Rauchwolke stieg auf und es stank nach verbrannter Haut und Haaren. Schnell aber war der unangenehme Geruch verflogen. Fett begann zu brutzeln und bald duftete es verführerisch.
Honighand raste wie ein wildes Ferkel umher, suchte Zweige zusammen, brach Äste und Zweige mit frischem Laub ab und riss Gras und Kräuter aus. Damit bedeckte sie das Fleisch. Andere Kinder halfen ihr dabei und rasch quoll dichter Qualm aus dem Haufen. Die Farbhaare standen mit gerunzelter Stirn stumm davor und bewegten sich nur, wenn ihnen der Rauch zu nahe kam. Niemand sprach. Die einzigen Geräusche waren das Zischen des Fetts, das Fauchen der feuchten Zweige und das Gezwitscher der Vögel. Hasenbart saß immer noch im Gras und beobachtete die Szenerie. Ein so großes Stück würde lange braten müssen. Und so lange es garte, würde keiner der Erwachsenen seinen Platz verlassen, sondern lieber gebannt ins Feuer starren.
Eines der Farbhaar-Kinder hatte wohl genug vom Mammutbraten und kam Hasenbart besuchen. Es war ein Junge, etwas jünger als er, dick und kugelrund wie ein junger Dachs vorm Winterschlaf. Er baute sich vor Hasenbart auf und lächelte schelmisch. Seine blitzblauen Augen glubschten herausfordernd unter den Augenwülsten hervor. Das dralle Kerlchen war ganz von feinen, seidigen Haaren bedeckt, goldfarben und weich wie das Fell eines Hermelins. Sein unbehaartes Gesicht zeigte eine überraschend helle Haut. Hasenbart konnte nicht anders, er musste diesen goldenen Pelz streicheln, der sich stramm und glatt über das feste Bäuchlein spannte. Der Kleine gluckste vor Vergnügen, dann ließ er sich auf allen Vieren nieder und umkreiste Hasenbart in vollem Galopp, wobei er heulende und bellende Laute ausstieß, die dem Geheul von Wolfswelpen ähnelten. Hasenbart haschte nach ihm, bekam ihn zu fassen und beide kugelten sich lachend im Gras.
Irgendwie erklomm der kleine Farbhaar Hasenbarts Rücken. Von oben zog er an seinen Haaren, was ihn einen Moment zwang, den Kopf zu heben und geradeaus zu schauen. Sein Blick fiel direkt in die grünen Augen eines leibhaftigen Wolfes. Hasenbart erstarrte. Er schrie und deutete auf das nur wenige Schritte entfernt liegende Tier. Der Wolf legte die Ohren an, verzog die Augen zu einem schmalen Schlitz und zog leicht die Oberlippe hoch, so dass seine Eckzähne sichtbar wurden. Eine Warnung, den Mund zu halten? Hasenbart verstummte. Die Erwachsenen hatten sich derweil nicht stören lassen und wären wohl auch zu spät gekommen, wenn der Wolf angegriffen hätte. Doch der tat nichts dergleichen. Stattdessen stellte er die Ohren auf und betrachtete Hasenbart aufmerksam mit schief gelegtem Kopf. Eine sonderbare Geste, die Hasenbart beruhigte. Noch nie war er einem Wolf so nah gekommen. Überrascht stellte er fest, wie gut man in dem Gesicht des Raubtiers lesen konnte. Nun hatte auch der kleine Farbhaar den Wolf bemerkt. Er krabbelte von Hasenbarts Rücken und ging direkt auf ihn zu. Dabei rief er laut „chow, chow“ und lachte. Der Wolf erhob sich schwerfällig, drehte sich um und trottete, die Nase am Boden, mit angelegten Ohren und gesträubtem Rückenfell davon, wobei er sich mehrmals knurrend umdrehte. Hasenbart sah ihm nach und bemerkte weitere Wölfe, ein kleines Rudel, etwa acht oder neun Stück. Er rief nach Olk und machte ihn auf die Tiere aufmerksam.
Wenn Menschen auf die Jagd gingen, tauchten meist auch Wölfe auf. Doch selten kamen sie einer größeren Menschengruppe so nah. Die Wölfe zögerten nicht, sich ein Kind zu schnappen, das sich verlaufen hatte, oder auch, in Zeiten der Not, einen einsamen Jäger anzugreifen. Die Menschen machten zwar keine Jagd auf sie - was ohnehin zu mühsam gewesen wäre - erschlugen sie aber unverzüglich, sobald sie eines Welpen oder eines verletzten Wolfs habhaft werden konnten.
Humpelnd eilte Olk herbei. Im Laufen klaubte er Steine auf und warf sie nach den Wölfen. Das brachte ihm jedoch wütende Rufe einiger Farbhaare ein. War es möglich, dass die Farbhaare die Wölfe vor Olk in Schutz nehmen wollten? Doch es kam noch schlimmer. Einer der Farbhaare warf ihnen Brocken aus dem inzwischen von Fliegen umschwirrten Fleischhaufen hin. Olk glaubte zu träumen. Wölfe füttern? Wo gab´s denn so was? Etwas verunsichert kehrten er und Hasenbart zum Feuer zurück.
Wieder geschah einige Zeit nichts, aber die Stimmung war durch das Theater mit den Wölfen etwas angespannt. Die Farbhaare schienen auch allmählich hungrig zu werden. Ungeduld machte sich breit. Sie waren es nicht gewohnt, lange auf Essen zu warten, das man sich doch ganz einfach, so wie es war, in den Mund stecken konnte. Plötzlich brach unter dem Wolfsrudel ein Höllenspektakel los. Zwischen ihr Heulen und Jaulen mischte sich tiefes Gebrüll. Und tatsächlich: Angelockt vom Duft des Fleischhaufens, hatte sich ein Bär genähert. Als ginge es um ihre eigene Beute, wurde er von den Wölfen sofort wütend attackiert. Der Chef der Farbhaare knurrte verärgert. Er ergriff einen Knüppel und eilte den Wölfen zu Hilfe. Doch plötzlich, auf halbem Weg, sprang ihn aus dem hohen Gras heraus und wohl ebenfalls vom Fleischgeruch angezogen, eine Tigerkatze an und warf ihn zu Boden. Honighand reagierte sofort. Während die Anderen noch aufgeregt schrien, zog sie einen brennenden Ast aus dem Feuer und rannte zu den beiden sich wälzenden Körpern. Honighand war auf vielleicht zehn Schritte herangekommen, als sie von der Tigerkatze bemerkt wurde. Diese fauchte und machte sich aus dem Staub. Der Rothaarige erhob sich schwankend, stützte sich auf Honighand und wurde von ihr zum Feuer geführt. Er hatte einen blutenden Riss in der Schulter und eine Bisswunde im Genick, doch er tat, als würde er es nicht bemerken. Eine der Farbhaar-Frauen stopfte sich den Mund mit Pfefferminzblättern voll, zerkaute sie und schmierte den Brei auf die Wunden. Die Menschen kamen heran, besahen sich die Verletzungen und rochen an dem Rothaarigen, um den scharfen Tigerkatzenduft zu schnuppern. Der Chef der Farbhaare ließ es sich grummelnd gefallen. Dann holte Honighand, die Heldin des Tages, das Mammutbein aus dem Feuer. Menschen und Farbhaare schmausten gemeinsam. Über das Essen lernte man sich zu verständigen und stellte eine erstaunliche Gemeinsamkeit fest: Das Lachen. Es war nicht nur das Lachen an sich, sondern auch, dass man über das Gleiche lachen konnte.
Als das Fleisch aufgegessen war, brachen die Farbhaare auf und gingen ihres Weges. Fast war es, als hätten sich Freunde gefunden - nicht ganz von gleicher Art, aber dennoch ähnlicher als all die anderen Arten ihrer Welt.
Bald darauf setzte ein gewaltiger Regen ein, der nicht enden wollte. Die Feuer erloschen und die Menschen verließen das Lager Richtung Abendberge, um dort Schutz zu suchen. Nach mehrtägiger Wanderschaft fanden sie, dem Lauf des Eisbachs folgend, in den Kalksteinfelsen oberhalb der Flussaue eine trockene und geräumige Höhle. Die Höhle lag am Eingang einer breiten Schlucht, die in einer weitläufigen Hügellandschaft endete. Nördlich der Höhle erstreckte sich eine fruchtbare Hochebene bis zum Donnersberg. Hier wimmelte es von Tieren und überall wuchsen Fenchel und andere nahrhafte Pflanzen. Auf der gegenüberliegenden Talseite befand sich ein weiterer Höhlenkomplex. Dort lebte seit letztem Winter eine Gruppe von Farbhaaren, die in der weiten Ebene des Großen Flusses jagte. Da der Tisch für Mensch und Farbhaare noch ausreichend gedeckt war, pflegte man einen eher friedlichen Umgang miteinander. Das sollte sich ändern, als Schnakenbein ins Jünglingsalter kam.
Im außergewöhnlich heißen und trockenen Sommer von Schnakenbeins 16. Jahr trocknete die Quelle unterhalb der Höhle aus. Schnakenbein und Regenbogen gingen mit ihren Körben aus lehmverschmiertem Weidengeflecht zum Eisbach, um Wasser zu holen. Wegen der unhandlichen Gefäße ließen sie Speere und Keulen zuhause und nahmen als Waffe nur ein Beil mit. Auch der Eisbach führte kein fließendes Wasser mehr. Das kostbare Nass war nur noch in einigen wenigen Höhlungen im Bachbett zu finden. Die beiden füllten ihre Wasserkörbe und machten sich auf den Heimweg. Plötzlich begegneten ihnen zwei etwa gleichaltrige Farbhaare, ein Mädchen und ein Junge. Das Mädchen betrachtete kichernd die hageren, braunen Körper der beiden jungen Menschen, die in ihrer nackten Haarlosigkeit ihr Interesse erregte. Der männliche Farbhaar interessierte sich mehr für die Wasserkörbe. Die Farbhaare kannten so etwas nicht und hatten daher bei Trockenheit größere Probleme mit der Wasserversorgung als die Menschen. Mit eindeutigen Gesten verlangte der Farbhaar die Herausgabe der Körbe.
Schnakenbein verweigerte dies vehement, trommelte sich auf die Brust und imitierte den Gang eines Bären, um den Farbhaar einzuschüchtern. Doch der zeigte sich unbeeindruckt. Nun drohte ihm Schnakenbein mit dem Beil, doch der Farbhaar schlug es ihm mit einer blitzschnellen Bewegung aus der Hand. Regenbogen sprang ihm auf den Rücken, der Farbhaar schüttelte ihn jedoch mühelos ab. Dann packte er ihn an den Armen und schleuderte ihn ins Bachbett. Benommen blieb Regenbogen liegen. Schnakenbein seinerseits wurde von dem Farbhaarmädchen festgehalten. Das Mädchen hielt ihn von hinten in eiserner Umklammerung, schnüffelte in seinem Haar und kicherte aufgeregt. Ihr Begleiter hatte sich inzwischen die beiden randvollen Wasserkörbe genommen und trug sie davon, als seien sie mit Eiderdaunen gefüllt. Das Mädchen hielt Schnakenbein weiter umklammert, es gelang ihm nicht, sich von ihr zu lösen. Erst als der männliche Farbhaar nach ihr rief, gab sie ihn frei. Regenbogen hatte dem Ganzen hilflos zugeschaut. Gedemütigt schlichen die beiden zurück ins Lager. Schnakenbein bebte vor Zorn. Unterwegs erfand er ein neues Wort: Rache. Zuhause erklärte er mit dramatischen Gesten dem Stamm das neue Wort und forderte auf zum Krieg gegen die Farbhaare. Einige junge Heißsporne konnte er begeistern. Doch Dickfaust machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Farbhaare seien zwar nicht mehr so stark wie früher, doch nach wie vor gefährliche Gegner. Wegen der beiden Wasserkörbe und der Dummheit zweier junger Laffen lohne sich kein Kampf, der Verletzte und Tote zur Folge haben könne. Schnakenbein wütete, drohte, brüllte und spuckte vor Empörung. Zornbebend verließ er das Lager mit unbekanntem Ziel. Am frühen Nachmittag machte sich Regenbogen auf die Suche nach Schnakenbein. Er wusste, wie gefährlich sein Freund in diesem Zustand werden konnte. Aber er fürchtete auch die Reaktion der Älteren. Würde es Schnakenbein nicht gelingen, sich in den Stamm zu integrieren, so wäre es bald um ihn geschehen. Sonderlinge wie ihn konnte man sich auf Dauer nicht leisten.
Regenbogen fand Schnakenbein schließlich hinter einem Felsvorsprung liegend, das Lager der Farbhaare beobachtend. Regenbogen hielt überrascht inne, als er Schnakenbein mit jemandem sprechen hörte. Doch mit wem? Es war niemand anderes zu sehen und auch nur Schnakenbeins Stimme war zu hören. Es klang eher wie ein leises Gemurmel als ein Gespräch. Trotzdem konnte Regenbogen einiges verstehen:
Birkenpech draufschmieren und in Feuer tauchen, meinst du? Ja, das könnte gehen, ho, ho ...
.....
Wieso nicht? Ich suche den Weg über die Merteshöhe ...
Regenbogen schlich sich noch näher heran. Was sollte das bedeuten? Redete Schnakenbein wieder mit sich selbst? Regenbogen ging vorsichtig um Schnakenbein herum, bis er ihm ins Gesicht schauen konnte. Er wich entsetzt zurück. Von Schnakenbeins Augen war nur noch das Weiße zu sehen. Statt Iris und Pupillen zwei tote weiße Kugeln, wie riesige Hagelkörner. Dazu das merkwürdig sachliche Gemurmel. Regenbogen schrie ihn an:
- Was machst du da?
Wie auf Kommando kugelten Schnakenbeins Augen zurück in ihre normale Position. Jetzt funkelten Iris und Pupille Regenbogen gefährlich an.
Geh weg!
Erst sag´, was du da machst.
Ich rede mit meinem Freund.
Wo ist er?
In meinem Kopf.
In deinem Kopf?
Ja. Und jetzt weg von mir oder ich steche dich!
Regenbogen machte zwei Schritte rückwärts, weil Schnakenbein aufsprang und nach seinem Speer griff. Regenbogen musterte ihn einen Moment verstört, dann drehte er sich um und ging.
Gegen Abend kehrte Schnakenbein zurück als sei nichts geschehen. Äußerlich ruhig, nahm er Pfeil und Bogen und füllte einen Flechtkorb mit glühenden Holzstücken. Daraufhin verschwand er erneut. Dickfaust sah ihm misstrauisch nach, stellte aber keine Fragen.
In der Nacht brannte die Höhle der Farbhaare aus. Sie hatten zum Schutz vor Bären und Tigerkatzen einen großen Dornenhaufen vor dem Eingang ihrer Schlafhöhle aufgehäuft, der nur einen winzigen Durchgang hatte und nachts bewacht wurde. Schnakenbein war es gelungen, mit einem brennenden Pfeil in das zundertrockene Geäst zu schießen und ein Flammeninferno auszulösen. Alle in der Höhle befindlichen Farbhaare verbrannten oder erstickten. Lediglich zwei Frauen konnten überleben. Sie hatten die Nacht wegen der Hitze auf einem Baum in der Nähe der Höhle verbracht. Eine von ihnen war das Mädchen, das am Morgen Schnakenbein festgehalten hatte. Triumphierend führte er sie als Beute heim ins Lager.
Nun war das Maß voll. Es kam zum offenen Streit. Die meisten hatten genug von Schnakenbeins Neigung, ständig Unfrieden zu stiften. Dickfaust und Olk beschlossen, ihn am nächsten Tag zu töten. Doch Schnakenbeins unsichtbarer Freund verriet den Plan. In der Nacht verließen Schnakenbein und Regenbogen zusammen mit den beiden Farbhaar-Frauen die Menschen und brachen auf Richtung Donnersberg.
Dort entstand bald darauf ein neues kriegerisches Geschlecht, das die Kunst des Feuermachens beherrschte und viele Menschen aus Dickfausts Stamm mit Pfeil und Bogen tötete.
Farbhaare sahen die Menschen danach nie wieder.
KROHNMÜHLE IV
Petersen, eben noch Hasenbart, saß wieder an seinem Küchentisch. Er hatte den Kopf in die Hände gestützt, durch seine kurzen dicken Finger tropften Tränen. Petersen weinte. Seit seinem neunten Lebensjahr hatte er nicht mehr geweint. In seiner Familie tat man das nicht. Nicht mehr mit zehn. Und jetzt saß er da, mit über fünfzig, und heulte Rotz und Wasser. Weil er seine Welt verloren hatte. Weil er soeben, in wenigen Stunden, ein Leben gelebt hatte, das so tausendmal aufregender, so tausendmal mehr sein Leben gewesen war, als es sein jetziges jemals hätte sein können. Dieser verdammte Theo. Warum hatte er ihm diese Welt gezeigt? Wie konnte er es wagen, ihn wieder zurück zu schicken in die trostlose Banalität der modernen Zivilisation, ihm zu nehmen, was ihn so erfüllt hatte? Wo trieb sich der Kerl nur rum?
Wo bist du, verdammt? Komm her! Ich will zurück zu meinem Stamm! Ich habe hier nichts mehr verloren! Wo bist du?
Keine Antwort.
Die letzten Meter auf dem Rückweg aus der Steinzeit hatten ihn schier getötet. Als er durch das Gras- und Blumenmeer vom Hügel herabgestiegen und sich mit jedem Schritt wieder seiner Juristen-Existenz genähert hatte, als er von Hasenbart wieder zu Petersen wurde, brach ihm schier das Herz. Die letzten 100 Meter, wo eben noch der Sumpf geblüht, die Wisente widergekäut und die Frösche gequakt hatten, führten bereits durch das Neubaugebiet. Oben surrten die Windräder und in der Vinothek klapperte der Catering-Service mit Gläsern, Tellern und Rechauds. Er fühlte, wie die Steinzeit-Kraft aus seinem Körper verschwand, wie die Zipperlein der Zivilisation zurückkehrten und sich nach und nach wieder moderne Mattigkeit in Muskeln und Gelenken ausbreitete.
Er hatte sich durch die kiesbestreute Einfahrt geschleppt, war vorbei an der Oldtimer-Garage und dem Weinkeller die Sandsteintreppe hochgewankt und hatte sich schließlich ächzend auf den erstbesten Küchenstuhl fallen lassen. Das alles hier, dieser ganze Luxus, all diese Symbole des Wohlstands, das war nicht mehr seine Welt. Seine Welt lag 60 Meter oberhalb, im Kalksteinriff, wo er eben noch mit dreißig anderen im warmen Dunst der Höhle gelegen hatte, Körper an Körper, atmend, furzend, kopulierend, warm und jeder jedem so nah. Wo jeder Tag aufregend und gefährlich, wo jeder Tag Lust und Abenteuer und jeder Einzelne von ihnen selbstverständlicher Teil einer berauschend schönen Welt gewesen war. Wo ihn das Leben mit den dreißig anderen so innig verwoben hatte, dass man gar nicht anders konnte als zusammen kämpfen, fressen, singen, tanzen, weinen und lachen.
So, nun saß er also wieder an seinem sauber geölten Eichenholztisch. Dieser Oxygod, der ZWEITE, dieser Teufel, hatte seinen Teil dazu beigetragen, jene Welt zu zerstören, dessen war sich Petersen nun sicher. Er hatte Schnakenbein das Leben gerettet und sich so an der Natur versündigt. Deshalb sein schlechtes Gewissen, deshalb seine lächerlichen Versuche, die Menschheit zu retten. Die 35/60-Formel. So ein Schwachsinn. Der ZWEITE selbst hatte es verbockt, hatte eingegriffen in den Lauf der Naturgesetze. Schnakenbein war nichts anderes als eine gefährliche Mutation gewesen, die ohne seine Hilfe niemals hätte überleben können - und dürfen. Aus purer Eitelkeit hatte der ZWEITE ein Monster mit Hyperintelligenz protegiert, das wer weiß wie oft seine kranken Gene fortgepflanzt hatte. Jetzt also sollten mit seiner, mit Petersens Hilfe die Dinge wieder ins Lot gebracht werden.
Theo, wo bist du verdammt nochmal? Hallo?
Alles ok, Kallemann?
Petersen Augäpfel kugelten nach innen, als er Theos Stimme direkt aus seinem Kopf vernahm.
Ah, hier steckst du. Der ZWEITE hat Mist gebaut damals, stimmt´s?
Könnte man vermuten.
Wie viele Menschen gab es damals im heutigen Europa?
Man schätzt, zwischen zehn- und zwanzigtausend.
Ich habe mal gehört, dass sämtliche Europäer von sechs Müttern abstammen.
Kann sein, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, worauf du hinauswillst.
Schnakenbein könnte zehn Millionen Nachkommen haben.
Aus heutiger Sicht, ja.
Dickfaust war gerade dabei, die Dinge ins Lot zu bringen. Wäre die Welt heute eine andere, wenn der ZWEITE sich damals rausgehalten hätte? Hätten wir heute weniger Raubtiere in unseren Reihen? Wäre vielleicht auch ich weniger arrogant und anmaßend?
Hätte, wäre, wenn. Das ist alles höchst spekulativ. Entscheidend ist, dass du durch deine Stippvisite ins Paläolithikum offenbar was gelernt hast.
Da muss ich dir recht geben. Willst du wissen, wie meine wichtigste Erkenntnis lautet?
Ich bin gespannt.
Mit der flachen Hand schlug Petersen auf den Tisch, um seine wichtigste Erkenntnis noch bedeutender zu machen und schnauzte:
Eigentum ist die Wurzel des Bösen. Alles sollte allen gehören.
Oha, was sind das denn für neue Töne? Warst du nicht vor deinem Ausflug noch davon überzeugt, dass deine sozialistische Phase ein einziger Irrtum gewesen sei?
Mag sein. Aber in unserem Stamm hat es funktioniert. Alles gehörte allen, alle hatten gleich viel. Natürlich gab es eine Hierarchie. Dickfausts und Olks Worte zählten mehr als meine oder Regenbogens. Doch es war keine Hierarchie, die auf Besitz gründete, sondern auf natürlicher Autorität. Und vor allem auf einer Autorität, die sich nicht bereichern wollte. Wir teilten alles, auch in Notzeiten. Und die Starken teilten mit den Schwachen. Dadurch konnte jeder bleiben, wie und was er war. Niemand musste sich verstellen, niemand musste besser als der andere sein, jeder konnte ganz und gar er selbst sein. Ein wundervolles Lebensgefühl, wenn du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe es sehr gut.
Fast flehentlich jammerte Petersen:
Ja und, warum hat sich das geändert? Warum sind wir alle so bekloppt geworden?
Dieser Prozess, mein Freund, der Prozess der Bekloppt-Werdung, wenn du so willst, begann mit einer anderen Werdung: der Sesshaft-Werdung. Und die führte die Menschen direkt in die Fänge der Bedürfnisspirale.
Bedürfnisspirale. Aha. Scheint irgendwie dein Ding zu sein.
Am besten, wir fangen ganz am Anfang an. Du weißt inzwischen, worum es geht. Wir müssen den Oxygods beweisen, keine Dominante Art zu sein. Um aber über Dominante Arten reden zu können, musst du zunächst einige Zusammenhänge begreifen, vor allem, was unser Zusammenleben mit anderen Arten angeht.
Was heißt Zusammenleben mit anderen Arten? Meinst du Haustiere?
Theo stöhnte und schlug sich an die Stirn:
Haustiere! Es geht hier um das gesamte ökologische System dieses Planeten. Es ist eine Art Netz. Dieses Netz funktioniert nach dem Prinzip der Symbiose. Alles hängt von allem ab, jede Art ist in irgendeiner Weise auf andere Arten angewiesen. Alexander von Humboldt hat das schon vor über 200 Jahren erkannt. Auch der Mensch ist letztendlich auf dieses Netz angewiesen. Das Netz funktioniert aber nur, wenn es nicht zerrissen wird. Wenn keine zu großen Löcher herausgeschnitten werden. Werden zu viele Stränge zerschnitten, kann das Netz auf einen Schlag zerreißen und das gesamte Ökosystem stirbt.
Zerreißen und Stränge zerschneiden heißt wohl, andere Arten auszurotten?
Exakt. Die Oxygods nennen das Zusammenleben individueller Arten auf einem Planeten Große Symbiose. Die seit Jahrmillionen funktionierende Große Symbiose der Erde hat unzählige Individuen in hunderttausenden von Arten hervorgebracht. Viele dieser Arten - und das ist wiederum für die Oxygods das Phänomen - haben den Großteil des irdischen Sauerstoffs selbst erschaffen. Ein Teil der Arten produziert den Sauerstoff für die anderen und diese wiederum Kohlendioxyd und Stickstoff für die Sauerstoffproduzenten. Das ist der Grund für die außergewöhnliche Vitalität der Flora und Fauna dieses Planeten. Auch wenn dir diese Erkenntnis banal erscheinen sollte: Aus Sicht der Oxygods ist es ein Wunder.
Das ist nach Meinung von Fachleuten weniger ein Wunder, als vielmehr das Werk der Evolution.
Wie konnte man nur so bockig sein? Theo merkte, dass er etwas ausholen musste.
Die Evolution ist das Eine. Warum gibt es sie überhaupt? Genau genommen ist die Unvollkommenheit der DNA dran schuld. Die DNA der irdischen Lebewesen ist anfällig für Mutationen. Innerhalb der DNA passieren ständig winzige Veränderungen. Wäre die DNA für alle Zeit festgeschrieben, gäbe es auch keine Evolution. Andererseits gäbe es ohne Evolution auch keine Arten. Wir stünden immer noch am Anfang, in der Ursuppe primitivster Einzeller. Veränderungen in der DNA folgen dem Zufallsprinzip, nach der Methode von Versuch und Irrtum. Die Irrtümer verschwinden auf Nimmerwiedersehen. Ist eine genetische Variante aber erfolgreich, wird sie sich langfristig durchsetzen. Sie wird die Art verändern - unter Umständen so weit, dass daraus eine neue Art entsteht. Entscheidend bei diesem Prozess ist vor allem ihre Dauer. Die Evolution lässt sich Zeit. Viel Zeit. So viel Zeit, dass sich andere Arten auf Veränderungen einstellen können. Im Laufe von Äonen wuchsen Tyrannosaurus Rex die fürchterlichsten Krallen und Zähne. Doch konnte er sich damit die Erde untertan machen? Fehlanzeige. Dass T. Rex nicht überhandnahm, lag womöglich an kleinen rattenähnlichen Säugetieren, die im Lauf der Jahrtausende lernten, seine Eier zu fressen. Durch die extreme Dauer der Veränderungsprozesse werden alle Arten für die anderen berechenbar. Die Mitglieder der Großen Symbiose haben Zeit, die Schwächen jeder Art zuerkennen und dafür zu sorgen, dass keine Art überhandnimmt. Darauf beruht der Erfolg der Evolution auf diesem Planeten. Genügend Zeit zur Anpassung zu haben, sorgt für Balance, Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Seit tausenden von Jahren kann sich die Blumenblüte auf das Erscheinen der Biene verlassen, die sie befruchtet. Die Biene kann sich auf den Nektar verlassen, den die Blüte ihr spendet. In Europa, einer Region mit Jahreszeiten, wäre es logisch, dass im Frühling die Pflanzen Nektar bilden, befruchtet werden und im Herbst ihre Samen verstreuen. Nach dieser Logik hätten die Bienen also nur wenige Monate Zeit, um Futtervorräte für das gesamte Jahr anzulegen. In der unlogischen Realität jedoch blühen einige Pflanzen bis in den Herbst. Sie nutzen eine kleine monopolistische Lücke, in der sie der ungeteilten Aufmerksamkeit der Insekten sicher sein können und ganz gewiss befruchtet werden. Die Bienen finden dadurch bis zum Herbst genügend Futter. Das Verhalten der Pflanzen orientiert sich also an den Bedürfnissen der Bestäuber. Der unabänderliche Lebenszyklus einer Art und ihr unabänderliches Verhalten macht sie für andere Arten berechenbar. Die Co-Existenz von Löwe und Antilope ist dafür der beste Beweis. Das stets gleiche Jagdverhalten des Löwen - er benutzt ja weder Fallen noch künstliche Waffen – macht den Löwen berechenbar und ermöglichte es der Antilope, ein darauf angepasstes Fluchtverhalten zu entwickeln. Dies ist erfolgreich genug, um den Antilopen das Überleben zu ermöglichen. Und doch so schlecht, dass der Löwe nicht verhungern muss. Damit ist die Existenz beider Arten gesichert. Falls der Löwe auf die Idee käme, raffiniertere Jagdmethoden anzuwenden, würde er die Antilopen womöglich ausrotten und sich so seiner eigenen Existenzgrundlage berauben.
Ganz anders der Mensch. Um seine genetischen Mängel - die kleinen Zähne, die fehlenden Krallen und schwachen Muskeln - auszugleichen, ersann er künstliche Waffen. Und zwar in solcher Geschwindigkeit, dass kein Tier Zeit hatte, sich darauf einzustellen. Erinnere dich: Schnakenbein brauchte nur ein halbes Jahr, um die Flugeigenschaft seiner Pfeile zu perfektionieren. Welches Tier hätte dem was entgegen zu setzen? Vögel brauchten dafür Jahrmillionen. Bald konnten es auch die größten Raubtiere nicht mehr mit den Menschen und ihren Waffen aufnehmen. Dadurch fehlte das Regulativ, das seine Ausbreitung begrenzen konnte. Und so wurde er letztendlich zur dominierenden Art des Planeten.
Petersen hatte die ganze Zeit brav zugehört. Jetzt brummte er missmutig:
Du meinst also, wir sind zu schlau für diese Welt? Und nutzen unsere Schläue zu rücksichtslos aus? Woraus die Oxygods das Recht ableiten, sich unseren Sauerstoff unter den Nagel zu reißen?
Abrupt erhob er sich und verschwand in der Speisekammer. Mit einer Dose Leberwurst, einem Laib Brot und einer Flasche Riesling bewaffnet kehrte er zurück. Mittagszeit. Sein Appetit war zurückgekehrt, der Ausflug in die Steinzeit hatte ihn hungrig gemacht. Schweigend begann er zu essen. Theo, weiterhin in Petersens Gehirnwindungen lagernd und deren Gedankengänge verfolgend, schwieg ebenfalls und durfte erstmals seit zwei Jahren wieder die perfekte Harmonie von Leberwurst und trockenem Riesling mitgenießen. Dazwischen zerbiss sein Wirt scharfe, extra saure Gurken, was Theos besonderen Beifall fand. Nachdem er sechs Scheiben Schwarzbrot und den kompletten Inhalt der Leberwurstdose vertilgt hatte, wischte sich Petersen den Mund und knurrte:
Ich sag dir jetzt mal, was schuld an dieser Misere ist. Wir haben nämlich unsere Instinkte verloren. Und durch den Verstand ersetzt. Wie kam es dazu? Was ist da passiert? Und wann? In unserem Stamm hatten wir sie noch. Wir hatten Respekt vor der Natur, lebten auf Augenhöhe mit ihr. Wir wussten instinktiv, was sich gehörte, wo unsere Grenzen waren. Einmal trieben wir versehentlich eine Herde Wildpferde in einen Sumpf, wo sie jämmerlich ertranken. Wir haben wochenlang um sie getrauert und Totenwache gehalten. Nur Schnakenbein nicht. Der lachte und stimmte ein Triumphgeheul an. Wir hätten ihn gleich mit ersäufen sollen.
Theo bemerkte mit Genugtuung den Wandel in Petersen Weltanschauung. Die Idee des ZWEITEN, ihn zu Schnakenbein in die Steinzeit zu schicken, war aufgegangen. Er meinte etwas provokant:
Vorhin wolltest du wissen, wie und wann der Prozess der „Beklopptwerdung“ begann, wie du es nanntest. Wie wir zum Fremdkörper in der großen Symbiose wurden. Ich sagte es schon: Alles begann mit der Sesshaftigkeit. Mit ihr setzte der Wandel vom steinzeitlichen Gruppenwesen zum modernen Individuum ein. Und wie du richtig bemerkt hast, verloren wir bei der Gelegenheit auch unsere Natur-Instinkte, die uns 100.000 Jahre lang das Überleben in der Steinzeit ermöglicht hatten. In der Sesshaftigkeit begannen wir, uns von der Natur zu entfremden. Doch dieser Entfremdungsprozess verlangte nach Ersatzbefriedigungen, nach neuen Reizen und nach künstlichen Dingen. Die Bedürfnisspirale kam in Gang. Je mehr wir uns der Natur entfremden, umso stärker wird ihr Einfluss. Mit jeder Generation ein Stückchen mehr.
Petersen dachte an die jungen Anwälte in seiner Kanzlei und seufzte:
Leider nur zu wahr …
Theo unterbrach Petersens trübsinnige Gerdanken über die Jugend von heute und brachte ihn zum eigentlichen Thema zurück.
Dein Lamentieren bringt uns nicht weiter. Wir brauchen Lösungen für diese Probleme: Wege aus der Bedürfnisspirale, Verständnis und Respekt für andere Arten. Dafür musst du grundsätzliche Zusammenhänge über die Art Mensch verstehen. Und diesbezüglich warst du zwischen dem dritten und dem vierten Leberwurstbrot auf einem gutenWeg.
Hä? Was meinst du?
Zwischen dem dritten und dem vierten Leberwurstbrot ist dir plötzlich aufgefallen, wie ähnlich sich im Grunde die Mitglieder deines Stamms waren. Jedenfalls viel ähnlicher und homogener als die heutigen Menschen.
Stimmt. Was zum Beispiel die Intelligenz betrifft, lagen wir alle, von Schnakenbein mal abgesehen, auf einem ziemlich ähnlichen Niveau. Schnakenbein war der einzige Ausreißer nach oben. Es gab andererseits keine wirklichen Blödmänner. Wir verstanden uns blind, konnten die Gedanken der andern fühlen. Auch bei der Jagd gab es ein solch blindes Verständnis. Wie in einem Wolfsrudel wusste jeder, wie der Andere sich verhalten würde. Wenn es Streit gab, wurden Rituale eingehalten, die jeder kannte und jeder akzeptierte. Sonst hätte es unausgesetzt Mord und Totschlag gegeben. Der einzige, der sich nicht dran hielt, war natürlich Schnakenbein.
Herausfordernd fragte Theo:
Und, was schließt du daraus?
Unsere Gruppe musste notgedrungen so homogen sein. Die Homogenität sicherte unser Überleben in der freien Natur. Ist ja auch völlig logisch. Menschen mit zu großen Abweichungen vom, sagen wir mal, optimal angepassten Standardtyp, hätten keine Überlebenschance gehabt. Schon rein körperlich nicht. Der Standard-Typ musste ein Mindestmaß an Fitness und Körperkraft aufweisen. Seine Sinne mussten funktionieren. Er musste die Reaktion seiner Jagdgenossen richtig einschätzen, ja, sie vorhersehen können. Auch die intellektuellen Fähigkeiten mussten ein Mindestlevel erreichen. Aber wie man an Schnakenbein sieht, konnte offensichtlich auch zu viel Intelligenz die Überlebenschancen verringern. Intelligenzbestien wie er brachten nur Unruhe in die Gruppe. Und so wäre er über kurz oder lang - ohne den Beistand gewisser Außerirdischer - wohl einfach eliminiert worden.
Dem konnte Theo nur zustimmen:
Richtig. Es spielte letztendlich keine Rolle, ob die Abweichung von der Gruppenhomogenität durch zu viel oder zu wenig Intelligenz verursacht wurde. Das ist auch leicht nachvollziehbar. Individuen, die den anderen intellektuell extrem überlegen sind, lassen sich nur schwer in die Gruppe integrieren. Wenn bei allen anderen der IQ zwischen 80 und 100 liegt, so wird es der Einzelne mit einem IQ von 150 genauso schwer haben wie derjenige, der auf lediglich 50 Punkte kommt.
Petersen dachte einen Moment angestrengt nach.
Aber wie sieht der Umkehrschluss aus? Warum verloren die Gruppen in der Sesshaftigkeit diese Homogenität? Warum wurden die Menschen immer unterschiedlicher?
Durch den technischen Fortschritt. Damit gelang es uns, den Einfluss der Evolution auszuschalten. Du konntest es ja miterleben: Als Jäger und Sammler wart ihr noch Teil der großen Symbiose, auf Augenhöhe mit den anderen großen Raubtieren. Der Gebrauch des Feuers steigerte die Überlegenheit der Menschen zwar enorm, dennoch gab es in technologischer Hinsicht zunächst kaum Fortschritte. Ganz allmählich, in winzigen, Jahrtausende dauernden Schritten, verbesserten sich die Fähigkeiten zur Herstellung von Kleidung, zur Vorratshaltung und zur Waffentechnik. Distanzwaffen wie Speere oder Pfeil und Bogen verringerten die Gefahr sich zu verletzen und erhöhten die Überlebenswahrscheinlichkeit bei der Jagd auf große wehrhafte Säuger. Die Zahl der Menschen nahm dadurch überproportional zu, während sich die Anzahl der Beutetiere sukzessive verringerte. Irgendwann konnte die natürliche Reproduktionsrate der Beutetiere die durch Menschenhand verursachten Verluste nicht mehr ausgleichen. Die nach heutigen Maßstäben unvorstellbare Fülle von Tieren begann vor etwa 10.000 Jahren in den Gebieten mit höherer Bevölkerungsdichte deutlich abzunehmen. Um satt zu werden, musste der Mensch seine Ernährung zunehmend mit pflanzlicher Nahrung ergänzen. Notgedrungen begann er sich mit Ackerbau und Viehzucht zu beschäftigen. Dies machte ihn zugleich unabhängiger von den Launen der Natur. Allerdings war dazu ein spezielles Wissen nötig. Ackerbau, Viehzucht, Vorratshaltung - all dies erforderte komplizierte Techniken, langfristige Planung, das Verständnis für Pflanzenwachstum, Wissen über Saatgut-Selektion, Zuchtverfahren, Aussaat, Bodenbearbeitung, Erntetechnik, Konservierungsmethoden. Auch die Haltung von Tieren verlangte nach einem Spezialwissen, das es nie zuvor gegeben hatte und das nun in wenigen Jahrtausenden entwickelt werden musste. Die Umwälzungen in den Gesellschaften waren gigantisch. Durch die Sesshaftigkeit, durch Ackerbau und Viehzucht, gab es mehr Nahrung, Kleidung und Wärme. Dank der Fortentwicklung der Vorratshaltung führten selbst Notzeiten wie Dürrekatastrophen und Kälteeinbrüche zu keiner wesentlichen Ausdünnung der Populationen mehr. Bei den Nomadenvölkern, den Jägern und Sammlern, wirkten solche Mangelperioden noch als natürliche Ausleseprozesse, in deren Verlauf, wie bei allen anderen Arten, die Schwächeren auf der Stecke blieben. Mit der Sesshaftigkeit veränderte sich diese Situation grundlegend. Nun hatten auch die körperlich oder geistig Schwachen, hatten problematische Persönlichkeiten, zum Beispiel sozial nicht integrierbare Gruppenmitglieder, hatten Egoisten, Psychopathen, Narzissten und Maniker wesentlich bessere Überlebens- und Fortpflanzungschancen als zuvor und …
Petersen unterbrach:
Oha! Weißt du auch, was der Kern dieser These ist?
Bin gespannt auf deine Interpretation.
Das würde nämlich bedeuten, dass seit der Sesshaftwerdung der eine Teil der Menschen immer dümmer und der andere immer klüger wurde.
Theo grinste:
Typisch Petersen. Dümmer und klüger! Gleich wieder alles zuspitzen. Drücken wir es anders aus: Erfolgreich und weniger erfolgreich. Tatsache ist: Mit Beginn der Sesshaftwerdung begannen sich die Gruppen zu schichten. Es kam zur Bildung von Hierarchien. Die Gesellschaften begannen sich aufzuspalten in Herren und Knechte, in Eliten und Prekariate, in Adlige und Leibeigene, in Kapitalisten und Proletarier, in arm und reich. Solche Zustände hatte es in der Steinzeit nicht gegeben. Erst mit der Sesshaftigkeit entstanden die enormen sozialen Unterschiede zwischen den Menschen. Der Verlust an Homogenität führte letztendlich zu den hierarchischen Strukturen, die bis zum heutigen Tag unser Leben bestimmen. Alle Versuche, sie zu überwinden, sind bislang grandios gescheitert.
Und was schließt du daraus?
Die Hierarchien sind die wichtigste Ursache für das menschliche Bedürfnis nach Wachstum. Der Wille des Einzelnen zum Aufstieg auf die nächst höhere Hierarchie-Ebene ist der Motor der Bedürfnisspirale. Die Bedürfnisspirale wiederum ist ein typisches Kennzeichen Dominanter Arten. Wenn eine Gesellschaft sich in der Bedürfnisspirale befindet, werden ihre Mitglieder zu Sklaven des Fortschritts. Wer sich dem technischen Fortschritt verweigert, verliert umgehend den Anschluss an die Gruppe und ist folglich gezwungen, ständig die neuesten technischen Errungenschaften zu erwerben.
Da ist was dran. Vor vielen Jahren, als dieser ganze IT-Kram noch relativ neu war, hatte ich mal so eine Art Trotzphase, in der ich versuchte, ohne Handy und Internet auszukommen.
Und?
Ging nicht. Ich hätte die ganze Kanzlei dichtmachen müssen.
Daran siehst du: In der Bedürfnisspirale befindet sich der Einzelne praktisch permanent in einer Konkurrenzsituation. Wer nicht mitmacht, wird abgehängt. Und das Schlimme: Es gibt kein Zurück. Denn zum Wesen der Bedürfnisspirale gehört der Verlust des früheren Wissens und damit immer auch der Verlust von Autarkie. Zwanzig Jahre nach Erfindung der Zündhölzer wusste kein Mensch mehr, wie man mit Feuerstein und Zunderschwamm Feuer macht. Beides gab uns die Natur umsonst. Die Zündhölzer musste man bezahlen. Trotzdem haben sie den Zunderschwamm verdrängt. Einfach, weil sie bequemer sind. Und wer kann heute noch aus einem Stück Stahl einen Nagel schmieden? Durch die Bedürfnisspirale entsteht einerseits eine enorme Abhängigkeit der Individuen vom technischen Fortschritt, und gleichzeitig die Pflicht, sich ihm zu unterwerfen. Wir liefern uns ihm aus, indem wir seinen Verlockungen erliegen und finden dann nicht mehr den Weg zurück.
Und das alles soll schon vor 5000 Jahren begonnen haben?
Selbstverständlich. Es scheint uns lange her, ist aber in der menschlichen Entwicklung nur ein Wimpernschlag. Das Eigentum, der Besitz von Land und Gütern, der irre Reichtum des Einen und die blanke Not des Anderen, das alles sind Folgen der Sesshaftigkeit. Besitz und Eigentum machen die sozialen Unterschiede zwischen den Menschen, die zuvor weitgehend gleich gewesen waren, plötzlich sichtbar. Persönlicher Besitz, der zum Teil auch bewusst und mit Stolz zur Schau gestellt wird, führt zu einer Art Wettbewerb. Der Einzelne sah sich plötzlich gezwungen, ebenfalls Besitz anzuhäufen. Nur dadurch konnte er seinen Platz behaupten oder vielleicht sogar verbessern – es blieb nur die Wahl zwischen wachsen oder sich zu unterwerfen. Der Wunsch zu wachsen ist allerdings je nach Fähigkeit und Intelligenz von sehr unterschiedlichem Erfolg gekrönt. Dem einen gelingt es, der andere scheitert, und schon entsteht eine Hierarchie. Interessanterweise hat man die Gefahren, die von der Sesshaftigkeit und vom Eigentum ausgehen, schon recht früh erkannt. Es steht beispielsweise in der Bibel.
Petersen, der gerade die letzte Gurke aus dem Glas angelte, verschluckte sich beinahe.
Die Bibel? Wie kommst du jetzt auf die Bibel?
Ich kann dir ihre Lektüre nur empfehlen. Die Bibel ist ein Zeitzeugnis, das unter anderem den Weg der Hirten- und Nomadenvölker des Nahen Ostens in die Sesshaftigkeit beschreibt.
Jesus, jetzt wird´s abenteuerlich.
Keineswegs. Denk nur mal an die Zehn Gebote. Die Gebote 7 - 10 lauten:
7. Du sollst nicht stehlen.
8. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.
10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh
noch alles, was dein Nächster hat.
Man glaubte zu hören, wie Petersens Gedanken ratterten. Schließlich fiel ihm dazu nur ein, dass dies doch eigentlich sehr vernünftig klänge. Theo lachte:
Merkst du was? Vor zehn Minuten hast du noch die Existenz von Eigentum beklagt. An der Steinzeit gefiel dir, dass es keines gab. Aber genau darum geht es hier: Um die Regelung von Besitzverhältnissen und wie man sich in sesshaften Gruppen zu benehmen hat. Zu Beginn der Sesshaftigkeit herrschte noch ein aus der Nomadenkultur übernommener "Ur-Kommunismus" innerhalb der Gruppen und Stämme. Das Land wurde gemeinsam bearbeitet, die Ernte - wie zuvor die Jagdbeute - gemeinsam verzehrt. Ein solches Verhalten kann man bei indigenen Völkern bis in unsere Zeit beobachten. Es gibt dort keinen Begriff von Besitz und Eigentum, wie wir ihn kennen. Die Idee von Eigentum entstand erst in der Sesshaftigkeit. Jeder musste plötzlich besser sein als der Andere. Aus Nachbarn wurden Konkurrenten. Konkurrenten um Land, um Vieh und Besitz. Die Vorratshaltung, die Herstellung von Werkzeugen, Schmuck, Kultgegenständen und nicht zuletzt die Domestizierung von Haustieren wurden im Lauf der Zeit immer mehr perfektioniert. Produktion und Züchtung verlangten dabei zunehmend Spezialwissen. Wer es besaß, konnte sich innerhalb seiner Gruppe Vorteile verschaffen. Die Bereitschaft, sein persönliches Wissen der Gruppe unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, sank in dem Maß, wie der Wert der mit diesem Wissen hergestellten Güter wuchs. Dies schuf Probleme, wie sie zuvor bei den Jägern und Sammlern noch weitgehend unbekannt waren.
Aha! Der "Fluch des Wissens", sozusagen. Wo habe ich das schon mal gehört?
Das weiß ich nicht, trifft aber den Kern. „Fluch des Wissens“. Auch dieses Thema wird erstmals in der Bibel verarbeitet. Du kennst die Schöpfungs-Geschichte? Adam, Eva, das Paradies? Das biblische Paradies könnte man als die Zeit vor der Sesshaftwerdung interpretieren. Dieser Zustand endet, als Eva vom Baum der Erkenntnis nascht, dem Symbol des Wissens.
Mit Religion hatte Petersen nichts am Hut. Theos Bibel-Zitiererei verdroß ihn zusehends:
Mein lieber Mann. Was für Theorien! Eva und Adam. Das sind doch alles Ammenmärchen!
Aber trotzdem naheliegend. Im Nahen Osten kam es damals wie heute zu Dürreperioden mit großen Verlusten an Vieh und Korn. Jetzt war spezielles Wissen gefragt. Wer etwa über Konservierungsmethoden Bescheid wusste und sich ausreichend Vorräte angelegt hatte, war in Notzeiten klar im Vorteil. Und er war vor allem nicht mehr ohne Weiteres bereit, sein Wissen und seine Vorräte der gesamten Gruppe zur Verfügung zu stellen. Er bevorzugte eher die Gruppenmitglieder, die mit ihm „gleichen Blutes“ waren; die ihm halfen, die eigenen Vorräte vor dem Zugriff der anderen Gruppenmitglieder zu verteidigen. Bei der Abkehr von der Gruppe und der Hinwendung zu Familie und Sippe spielten solche Sicherheitsaspekte eine wichtige Rolle. Je mehr Land und Vieh ein Familienverband besaß, umso größer waren seine Überlebenschancen in Notzeiten. Sowohl durch die zunehmende Gruppengröße als auch die Zersplitterung in Familien-Verbände verringerte sich der innere Zusammenhalt der Gruppe. Zugleich verlor sie ihre Homogenität. Die Stammesmitglieder entfremdeten sich immer weiter und ordneten sich neu zu Familien und blutsverwandten Sippen. Auch dies beflügelte den Willen zu persönlichem Wachstum. Geheimes Wissen, geheime Erkenntnisse, die der Wissende für sich behielt und mit dessen Hilfe er sich und seiner Familie Vorteile verschaffte, all dies spaltete die zuvor noch homogenen Gruppen. Das individuell erworbene, streng gehütete Wissen bildete die Machtbasis der Wissenden. Und weil man es den anderen vorenthielt, kam es zu Neid und Zwietracht. Klar, dass die vormals paradiesischen Zustände damit ihr Ende fanden.
Petersen musste zugeben, dass da was dran sein könnte.
Hmm. Klingt nicht unlogisch. Solidarische Jäger- und Sammler-Gemeinschaften mutieren in der Sesshaftigkeit zu egoistischen Familienclans, die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Dabei gewinnen diejenigen die Oberhand, deren Durchsetzungskraft am größten ist.
Genau erkannt. Nun beginnt eine rasante Entwicklung. Die Konkurrenz innerhalb der Gruppe stachelt an. Besser sein wollen, besser sein können, motiviert zur Leistung. Anders als zuvor, wird persönliche Leistung nun belohnt. Ihr sichtbares Zeichen ist der Besitz, der Zuwachs an Eigentum. Mehr Leistung schlägt sich nieder in mehr Land, mehr Vieh. Doch auch Land ist begrenzt. Aber die Gruppen wachsen weiter. Es kommt zu Gewalt, zu ständigen Reibereien und schließlich zählt nur noch das Recht des Stärkeren. Um diese Situation zu meistern, wurde die Idee des Einen Gottes geboren. Denn nur der Monotheismus, der Glaube an eine einzige, allmächtige, ungeheure Autorität ist in der Lage, das Faustrecht zu beenden. Nur sie kann eine den Erfordernissen der Sesshaftigkeit angemessene Rechtsgrundlage schaffen. Und nur mit der Autorität des Einen Gottes ließen sich beispielsweise die 10 Geboten durchsetzen.
Das gefiel Petersen schon besser:
Aha. Du gibst zu, dass der Eine Gott nur eine Erfindung von uns Menschen ist, um Ordnung in das menschliche Zusammenleben zu kriegen. Soweit klar. Aber warum scheiterte letztendlich auch der Eine Gott? Warum ging das schief? Es vergeht ja seither kein Tag mehr ohne Krieg, ohne Mord und Totschlag.
Weil der Eine Gott eben nur eine Erfindung ist, eine Wunschvorstellung, derer sich jeder bedienen konnte und die jeder anflehte, um ihm bei der Durchsetzung seiner persönlichen Interessen beizustehen - auch wenn diese Interessen das genaue Gegenteil von dem sind, was die Gegenseite will. Außerdem vergiss nicht: Wir sind Raubtiere! Wie soll mit Gottes Hilfe Frieden entstehen, wenn sich jeder bei der Durchsetzung seiner Raubtier-Interessen auf den gleichen Gott beruft?
Theos Zweifel an menschengemachten Göttern mochten ja zutreffen, aber Petersen wusste sehr wohl, dass der Glaube Berge versetzen kann. Insofern war deren Rolle nicht zu unterschätzen. Er versuchte die Debatte wieder zum Ursprung zu bringen:
Also, was ich verstanden habe ist, dass die Menschen unterschiedlich sind und daher in Hierarchien leben. Es gibt Starke und Schwache, Dumme und Schlaue. Diese natürlichen Unterschieden würden durch den technische Fortschritt noch verstärkt, sagst du. Aber ist es nicht gerade der technische Fortschritt, der einen Sozialstaat erst möglich macht und für sowas wie ausgleichende Gerechtigkeit sorgt?
Du hast insofern recht, als der technische Fortschritt zumindest in den Industrienationen für eine Art Massenwohlstand sorgt. Außerdem schützen die Rechtssysteme in den Demokratien die Schwachen vor der Willkür der Starken. Aber das ändert nichts daran, dass die Vermögensunterschiede heute so groß sind wie noch in der Menschheitsgeschichte. In den USA, in Russland, aber auch in Deutschland besitzen ein Prozent der Bevölkerung mehr Vermögen als alle anderen 99 Prozent zusammen.
Und wie kommt das?
Machen wir mal einen Sprung in die Zeit, als die Menschen die Metallverhüttung erfanden. Metall in reiner, gediegener Form gibt es an der Erdoberfläche so gut wie nicht. Was es gibt, sind sogenannte Erze, also Gesteine, in denen Metalloxide und Metallpartikel in konzentrierter Form auftreten. Doch der Weg vom Erz zu gebrauchsfähigen Werkzeugen und Waffen ist lang und hart. Die Produktion von Kupfer, Zinn und Bronze war für die damaligen Menschen ein ungeheuer komplizierter Prozess. Der beste Beweis für seine Komplexität ist die Tatsache, dass, obwohl seit 3.000 Jahren praktiziert, die Metallgewinnung bis in die Neuzeit im größten Teil der bewohnten Erde noch gänzlich unbekannt war. Nicht mal die Inkas kannten ihn. Wer diesen Prozess beherrschte und kontrollierte, gewann eine erhebliche Macht. Der Beginn des Metallzeitalters verstärkte die Entstehung von Herrschafts- und Elitensystemen in den sesshaften Gesellschaften zusätzlich. Die Elitenbildung verlief dadurch so rasant, dass bereits wenige tausend Jahre nach Ende der Steinzeit ein geknechtetes Volk seinen Führern Pyramiden baute. Denn mit dem Metallzeitalter begann auch das Zeitalter der Super-Hirne.
Petersen glaubte sich verhört zu haben:
Super-Hirne? Was hat die Bronzezeit mit Superhirnen zu tun? Willst du behaupten, dass es bei den Menschen in der Steinzeit keine überragende Intelligenz gegeben hätte, dass sie dümmer gewesen wären als die Sesshaften? Das ist Quatsch, ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass ...
Ich weiß, was du gesehen hast. Du hast wundervolle, hochintelligente Menschen kennen gelernt. Und mit Schnakenbein sogar einen, der das Zeug zum Superhirn hatte. Doch was machte ihn dazu? Zum Superhirn wurde er erst durch die Kombination seiner persönlichen Intelligenz mit Besessenheit und Machthunger. Ohne seine Gier nach Macht wäre er einfach nur intelligent gewesen. Der Unterschied zwischen einem genialen Konstrukteur und einem Superhirn ist der Wille zur Macht. Der superintelligente Konstrukteur konstruiert um der Konstruktion willen. Das Superhirn konstruiert um der Macht willen, die er sich mit Hilfe der Konstruktion aneignen kann.
Und das heißt?
Das heißt, dass von jeder neuen technologischen Ära vor allem die Superhirne profitieren. Die Anstöße, die ersten Ideen, stammen oft von genialen Denkern oder Tüftlern, denen es um die Sache geht. Doch sobald durch die Konstruktion ein Weg zur Macht erkennbar wird, übernehmen die Superhirne den Prozess.
Petersen tippte sich an die Stirn und schnaubte:
Wieder so eine steile These. Nenn´ mal Beispiele.
So viele du willst. Die Dampfmaschine war eine dieser Konstruktionen. Erfunden hat sie 1712 der englische Schmied und Eisenwarenhändler Thomas Newcomen. Reich wurde damit aber nicht er, sondern die Bergwerk- und Fabrikbesitzer. Mit Newcomens Erfindung begann der Siegeszug des modernen Kapitalismus. Und mit ihrer Hilfe gelang es den Fabrikherren, dem Adel seine Macht zu rauben. Oder das Schwarzpulver. Erfunden wurde es angeblich in China. Doch als Treibladung für Kanonen, zur Eroberung von Burgen und Städten, haben es machthungrige deutsche und französische Kriegsherren benutzt - und damit sowohl den Rittern den Garaus gemachte als auch das Mittelalter beendet. Im 20. Jahrhundert kam die Atombombe. Ihr Prinzip erfunden hat der deutsche Physiker Otto Hahn. Zur Superwaffe wurde sie aber erst durch das Superhirn Robert Oppenheimer, dem es gelang, im sogenannten Manhatten-Projekt die besten Wissenschaftler Amerikas in der Wüste New Mexicos zu versammeln. Seine Entwicklung machten die USA zur größten Macht seit dem Römischen Reich. Und nun die digitale Revolution. Sie ist als Spielwiese der Superhirne das Paradebeispiel schlechthin. Eine Handvoll IT-Entwickler sind heute die reichsten Menschen auf dem Erdball. Entscheidend ist: je komplexer die Konstruktion, je mehr Möglichkeiten sie bietet, und je weniger Menschen um ihr innerstes Geheimnis wissen, umso größer wird die Macht der Superhirne.
Obwohl er all das nachvollziehen konnte, kam Petersen ins Grübeln. Klar, wer das Mischungsverhältnis des Schwarzpulvers kannte und oder den Algorithmus der Quellcodes, besaß Macht. Aber profitierten denn letztendlich nicht alle von diesen technischen Quantensprüngen? Theo erkannte Petersens Zweifel und erwiderte:
Hier geht es nicht ums Profitieren, sondern um die Ursachen der Bedürfnisspirale. Und die Unterschiedlichkeit der Menschen. Jeder von uns ist anders. Das ist für viele schwer akzeptabel, aber nun mal nicht zu leugnen. Von weitem betrachtet sind wir uns ja recht ähnlich. Einige sind größer, andere kleiner, einige dünner, andere dicker, manche klüger und raffinierter, andere träger oder ängstlicher. Aber rechtfertigt das die ungeheuren Unterschiede im Eigentum? Worauf beruhen die grotesken Unterschiede im persönlichen Erfolg? Was macht den Unterschied zwischen dem Chef eines Konzerns und dessen Pförtner? Woher kommt der irrwitzige Reichtum Weniger und die grausame Armut Vieler? Worauf gründet die ungeheure Macht einiger Demagogen und die Ohnmacht des Normalbürgers? Da müssen andere Mechanismen wirken. Schließlich kann in unserer Zeit ein einzelner, anfänglich ganz normaler Mensch in seiner Bedeutung derartig wachsen, dass er zum Schluss den Einsatz von Atomwaffen befehlen darf. Wie also kann es dazu kommen? Wie entsteht er, dieser große Führer, der so viel Einfluss hat?
Genau. An dieser Frage hat sich schon so mancher die Zähne ausgebissen.
Die Antwort ist erschreckend einfach, um nicht zu sagen lapidar. Um solche Macht anzuhäufen, braucht es neben besonderen intellektuellen, rhetorischen und sonstigen Möglichkeiten vor allem eines: Einen ungeheuren Willen. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen Wachstumsmöglichkeiten und ihres Einflusses auf die Gesellschaft beruhen letztendlich nur auf diesen zwei Faktoren: Der Willensstärke und den Möglichkeiten, diesen Willen zu verwirklichen. Auf einen Nenner gebracht:
Persönliche Macht ist das Produkt aus Wille und Möglichkeit.
Wow, dachte Petersen. Das klingt ja fast nach einer mathematischen Gleichung: Macht = Wille x Möglichkeit. Laut sagte er:
Interessant, wie einfach du die Dinge siehst.
Theo erwiderte gelassen:
Ob das so einfach ist, wird sich noch herausstellen. Wir können die Sauerstoff-Extraktion verhindern, wenn es uns gelingt, mit den Menschen einen Vertrag über die Formel 35/60 zu schließen. Voraussetzungen ist, dass sie die Ursachen der Bedürfnisspirale und ihr Zusammenwirken mit dem Modell von Wille und Möglichkeit begreifen. Und der Erste, der es begreifen muss, bist du.
Und? Glaubst du, ich bin zu blöd dafür?
Keineswegs. Aber zum besseren Verständnis werden wir einen weiteren Ausflug unternehmen.
Aha! Ein neues Abenteuer. Und wohin soll´s diesmal gehen? Zur Abwechslung mal in die Zukunft?
Nein. Ich kann dir nur die Vergangenheit zeigen, das, was der ZWEITE selbst gesehen und gehört hat. Du wirst jetzt erfahren, wie Johann Wolfgang von Goethe vor 200 Jahren, ohne die geringste Ahnung davon zu haben, die Welt zu rettete.
COMO
In seinem Hotelzimmer erwachte der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Noch etwas benommen lauschte er dem Gekrächz der Raben und schnupperte den Duft des Kastanienholzrauchs, der aus dem Schornstein eines Tessiner Bauernhäuschens oberhalb der feudalen Hotelanlage quoll, sich nun in Richtung Seeufer senkte und als winzige Duftpartikel durch die geöffneten Fenster seiner Suite strömte.
In der Ferne läutete eine Kirchenglocke mit dünnen, verhallenden Schlägen.
Es war ein Sonntag im Oktober, 7 Uhr morgens, und über dem graublauen Wasser des Comer Sees lichtete sich der Nebel. Ein sonniger Herbsttag kündigte sich an.
Abbas Brukenthaler, einziger Sohn einer ägyptischen Journalistin und eines Schweizer Ingenieurs, wohnhaft in New York, seit acht Jahren UN-Generalsekretär, war soeben mit dem Wissen erwacht, dass eine außerirdische Lebensform auf der Erde eingetroffen sei.
Was ist der Unterschied zwischen Wissen, Gewissheit und Vermutung? Diese Frage beschäftigte ihn. Kann eine Vermutung zur Gewissheit werden? Und Gewissheit zu Wissen? Wirkliches Wissen ist letzten Endes die Gewissheit über unumstößliche Tatsachen. War das, was ihm heute Nacht zur Gewissheit wurde, eine Tatsache oder beruhte die Gewissheit auf einer Einbildung, vielleicht nur einem Traum?
Je länger er darüber nachdachte, umso mehr klarte sein Gedächtnis auf. Eine Weile noch fuhren seine Gedanken Karussell. Dann wusste er, dass sein neues, in dieser Nacht aus dem Nichts entstandenes Wissen nicht auf Einbildung und schlechten Träumen beruhte, sondern eine Tatsache war. Eine ungeheuerliche, unfassbare Tatsache, aber dennoch wahr. So real wie der Tisch vor seinem Bett, so wirklich wie die Berge hinterm See. Und dennoch unmöglich.
Es hatte keine Hinweise gegeben. Keine verdächtigen Radiosignale, keine auffälligen elektromagnetischen Wellen, schon gar keine unbekannten Flugobjekte. Sämtliche Überwachungseinrichtungen, die nur für diesen einen Tag erdacht worden waren und seither diesem Tag entgegenfieberten, hatten keinerlei Auffälligkeiten registriert.
Was da heute Nacht Kontakt zu ihm aufgenommen hatte, war nicht von dieser Welt. Es hatte kein Gesicht, keine Gestalt, keine Stimme. Trotzdem hatte es sich mitteilen können. Deutlich erinnerte er sich an eine Telefonnummer und einen Namen. Karl Petersen. Ohne den Herrn zu kennen, verband sich mit dem Namen das Gefühl von ... Panik? Als er sich das Kommende vorstellte, begann sein Herz zu rasen. Er wusste, dass er diese Nummer anrufen musste.
Und er wusste, dass es ernst werden würde, sollte tatsächlich ein Karl Petersen abnehmen. So ernst wie noch nie in seiner bisherigen Laufbahn. Er sprang aus dem Bett und begann unruhig auf und ab zu gehen. Als ob der übliche Wahnsinn, der ihm morgen ganz offiziell bevorstand, nicht alleine schon genügt hätte. Morgen früh würde er sich, unter strengster Geheimhaltung, zu einem Vier-Augen-Gespräch mit Ayatollah Hamsani treffen. Brukenthaler hatte das Treffen auf Druck des US-Präsidenten und des israelischen Geheimdienstes vereinbaren müssen. Er selbst wäre der Begegnung, die auf neutralem Boden in St. Moritz bei seinem Freund Ronald Severin stattfinden sollte, liebend gerne aus dem Weg gegangen. Falls sie publik wurde, und davon war auszugehen, würde er, vor allem wenn er ein positives Ergebnis im Sinne der USA erreichen sollte, in der arabischen Welt als Handlanger des Westens gebrandmarkt werden. Seine Stellung als neutrale Instanz würde schwer beschädigt. Andererseits stellte das Treiben des Ayatollah nicht nur für Israel, sondern für den gesamten Nahen Osten eine Gefahr dar.
In den acht Jahren seiner Amtszeit hatte sich Abbas Brukentaler als Generalsekretär der Vereinten Nationen einen untadeligen Ruf erworben. Ein Mann des Ausgleichs in einer Welt im Umbruch.
Die Arbeit des UN-Generalsekretärs war noch nie ein Zuckerschlecken gewesen. Doch nur wenige seiner Vorgänger hatten vor solchen Herausforderungen gestanden wie Abbas Brukentaler: Klimawandel, Globalisierung, Kampf um Rohstoffe, religiöser Terror, atomare Aufrüstung der Schwellenländer, größenwahnsinnige Potentaten und ständige Kriege in Afrika und Asien. Das war sein Alltag.
Nun sollte er herausfinden, unter welchen Bedingungen der Ayatollah zu Zugeständnissen bereit wäre. Die Führungen der USA und Israels, die zu diesem Schritt gedrängt hatten, warteten mit Spannung auf die Ergebnisse. Ergebnisse, die für den Weltfrieden von höchster Bedeutung waren. Doch was war das alles gegenüber der neuesten Hiobsbotschaft, mit der er heute Nacht konfrontiert worden war? Was waren die Pläne Hamsanis gegen die Ankunft einer fremden Macht, die der Macht von Atombomben womöglich tausendfach überlegen war?
Brukentaler ging ins Bad, duschte kalt und zog seinen Morgenmantel an. Kaltes Wasser übte eine beruhigende Wirkung auf ihn aus. Die Panikattacke ging, wie sie gekommen war. Jetzt erst mal systematisch an die Sache rangehen. Wer war Petersen?
Sollte er einen Recherche-Eilauftrag an sein Büro schicken? Um diese Zeit? Er wählte die Handynummer von Bea. Nach dem ersten Klingelton legte er wieder auf. Bea war seine engste Vertraute und Mitarbeiterin, Stellvertreterin und rechte Hand in Personalunion. Was sollte er ihr sagen? Außerirdische seien gelandet, er wüsste es ganz sicher, weil er es geträumt hatte? Aber irgendwas musste er tun. Unruhig ging er im Zimmer umher. Die Telefonnummer fiel ihm wieder ein. Eine Handynummer mit deutscher Vorwahl. Ob er einfach mal ...? Unsinn. Nichts überstürzen. Mal sehen, was er selbst herausfinden konnte. Er schaltete seinen Laptop an und gab Dr. Karl Petersen ein. Es erschien die Homepage einer Kanzlei, Petersen & Partner, sowie seitenweise Berichte über seine Aktivitäten. Spektakuläre Prozesse. Skandalöse Fernsehauftritte. Vorsitzender der Partei des gesunden Menschverstands. Jede Menge Hasskommentare. Brukenthaler rümpfte die Nase. Ganz schlecht, wenn er mit so einer Person in Verbindung gebracht wurde. Das passte doch alles nicht zusammen. Wie konnte es sein, dass eine extraterrestrische Intelligenz ihn aufforderte, mit so jemandem in Verbindung zu treten? Dann stieß er auf Petersens Buch: Theo Würtz und sein sinnloser Kampf für das Weltklima. Ein Buch über die Unmöglichkeit, den Klimawandel zu stoppen. Begründet nicht etwa durch technologische, sondern soziale Hindernisse. Keine einzige klimaschützende Maßnahme sei politisch durchsetzbar, wenn sie den Konsum einschränke und Verzicht fordere, lautete seine These.
Interessant. So etwas Ähnliches hatte Brukenthaler insgeheim auch schon gedacht.
Er las weiter und gelangte zu einem Kommentar Petersens zum eigenen Buch:
„Es ist wohl unstrittig, dass der Lebensstandard in den westlichen Industrienationen der Orientierungsmaßstab sämtlicher Menschen auf diesem Erdball ist. Dieser für uns selbstverständliche Standard bedeutet: Nahezu jeder hat ein Auto, eine Waschmaschine, einen Kühlschrank, Zentralheizung und/oder Klimaanlage, fließend warmes und kaltes Wasser, funktionierende Abwasser- und Müllentsorgung, medizinische Versorgung, Altersversorgung und Fleisch auf dem Teller, so oft man mag. All dies sind große Errungenschaften, die das Leben sicher, bequem und komfortabel machen. Warum nun sollte den einen versagt bleiben, was den anderen selbstverständlich ist? Durch die globalen Informationsnetze werden die Bilder des westlichen Lebensstils in jeden Winkel der Welt verbreitet. Folglich wird dieser Lebensstandard angestrebt und langfristig erreicht werden müssen - ob in Indien, China, Afrika, Südamerika oder sonst wo. Der Bestand an PKW - derzeit etwa 1,4 Milliarden - wird sich in wenigen Jahren verdoppeln. Das Gleiche gilt für Waschmaschinen, Kühlschränke und Klimaanlagen. Allein für die Abwasserentsorgung wird man Unmengen zusätzliches Frischwasser brauchen, für den Anbau von Futterpflanzen und für die Tiermast ebenso. Es muss zusätzliches Acker- und Weideland geschaffen werden auf Naturflächen, die bisher CO2 gespeichert haben. Für die Produktion all dieser Waren wird man Rohstoffe und Energie benötigen. Stahl, Aluminium, Kunststoff - alles energieintensive Wirtschaftszweige. Glaubt jemand ernsthaft, all die Milliarden zusätzlicher Autos, Kühlschränke, Waschmaschinen und Klimaanlagen könne man mit Sonnen- und Windenergie produzieren und betreiben? Die einzige Alternative wäre, Einschränkungen zu verordnen. Doch jeden, der ein solches Ansinnen vorbringt, wird die Wut des Volkes treffen. Kein Politiker, der gewählt werden will, kann es wagen, einen solchen Vorschlag zu machen. Es gibt also nur zwei Möglichkeiten: Entweder drei Viertel der Weltbevölkerung in Armut halten und für das andere Viertel schuften lassen, so wie bisher, oder überall auf der Welt neue Atom,-Öl-, Kohle- und Gaskraftwerke zu bauen; mehr Flächen der Natur zu entnehmen und die Rohstoffquellen noch stärker als bisher auszubeuten. Daran wird auch der Einstieg in Elektromobilität und erneuerbare Energien nichts ändern. Die Angleichung der Lebensstandards wird aber dem Klima und der Umwelt nicht nützen, sondern schaden. Die Welt hat also nur eine Wahl: Zwischen Gerechtigkeit und Wohlstand einerseits und Klimaschutz anderseits. Beides zusammen kann es nicht geben. Genau das ist meine Meinung, und wer eine andere Lösung hat, soll sie auf den Tisch legen.
Na ja, so ganz von der Hand zu weisen war das wohl nicht. Was hatte es mit der Ankunft einer fremden Macht zu tun? Brukenthaler zog sein Tarn-Outfit an. Schlabbriger Jogginganzug, Stirnband, riesige Spiegelsonnenbrille. So würde ihn niemand erkennen. Er musste raus aus dem Hotel. Einfach mal allein joggen gehen. Einfach den Wahnsinn dieser Welt mal kurz hinter sich lassen.
LONDON, PARIS, WEIMAR
Während in Como ein zutiefst verunsicherter UN-Generalsekretär seine Joggingrunde drehte, entführte Theo der ZWEITE seinen Gastgeber in die Zeit Goethes und der Aufklärung. Mit geschlossenen Augen lauschte Petersen der Stimme seines neuen Partners - einer Stimme, die nicht nur eine Geschichte erzählte, sondern zugleich auch die passenden Bilder in Petersens Kopf entstehen ließ.
Es war ein warmer Mittwochmorgen im Jahr 1762, als der ZWEITE in London eintraf. Er hatte einige Jahre damit verbracht, die größten und wichtigsten Siedlungszentren der Menschen zu inspizieren. Doch hier in London schien er den aktuellen Hexenkessel menschlicher Expansionsgelüste und die zentrale Schwungmasse künftiger Entwicklungen aufgespürt zu haben. Von dieser Stadt ging eine ungeheure Energie aus, und wenn er wissen wollte, wie es mit der Menschheit in absehbarer Zeit weitergehen sollte - hier würden die wichtigsten Bewegungen angestoßen werden.
Nun funktionieren die Sinnesorgane von Oxygods anders als unsere.
Ihre Wahrnehmung speist sich aus Schwingungen, Wellen, Rückkopplungen und Temperaturunterschieden. Sehen, riechen, schmecken, tasten, hören und empfinden wie ein Mensch konnte der ZWEITE erst, wenn er in dessen Kopf eingedrungen war. Und darin war er seit dem Besuch von Schnakenbeins Hirn und seit seiner Ankunft auf der Erde im Jahr 1758 ein wahrer Meister geworden. Die Unterscheidung der unterschiedlichen Arten dieses Planeten gelang ihm inzwischen in Sekunden. Lebewesen zeigen ein gänzlich anderes Schwingungsspektrum als tote Gegenstände, Menschen wiederum ein anderes als Hunde, Kühe, Hummeln oder Blumen. War ein Objekt erst mal als Mensch identifiziert, drang der ZWEITE nach Belieben über Mund, Augen oder Ohren in das Hirn. Dort verschmolz er förmlich mit der Hirnmasse und verfügte ab sofort über die ganze Palette menschlicher Sinneswahrnehmungen. Er konnte darüber hinaus sämtliche Empfindungen, Gefühle und Reaktionsmuster erspüren. Die emotionale Gefühlsskala seines Wirtes gegenüber anderen Menschen bekam er unmittelbar mit, auch wenn sich zum Beispiel während eines Gesprächs die Einstellungen und emotionalen Beziehungen zum Gesprächspartner ändern sollten. Wiedersehensfreude, Ärger, Zorn, Angst, Mordlust - nichts blieb ihm verborgen. Auch die politische Einstellung oder individuelle Reaktionen auf Bilder, Texte und Worte fand er schnell heraus. Wann sein Wirt lachen, wann er ärgerlich werden würde - nach spätestens 48 Stunden Kopfpräsenz konnte der ZWEITE die Reaktionen sicher vorhersagen. Vier, fünf Tage genügten, um sämtliche in diesem Kopf gespeicherten Erinnerungen zu erkunden. Die Bilder und Gefühle eines ganzen Lebens - nach kurzer Zeit hatte er sie entschlüsselt. Er kannte nun den Charakter und die Persönlichkeit der Zielperson. Er wusste alles über ihre Fähigkeiten und den Status innerhalb ihres sozialen Umfeldes. Doch er war noch weit davon entfernt, mit der Zielperson in direkten Kontakt treten zu können. Dazu musste er sich eine eigene Persönlichkeit zulegen, das eigene Bild eines Menschen kreieren, gewissermaßen selbst zum Menschen werden. Nur so war es möglich, das Vertrauen der Zielperson zu gewinnen und in eine fruchtbare Kommunikationsform einzusteigen. Doch diesen Aufwand und die damit verbundenen Risiken wollte er unbedingt vermeiden. Schnakenbein war ihm eine Lehre gewesen. Zunächst galt es herauszufinden, wie die Menschen tickten, was sie dachten und fühlten. Besonders interessant erschien ihm vor allem ihr Verhältnis zur Großen Symbiose. Welche Gefühle hatten sie gegenüber anderen Arten? Gab es überhaupt ein Bewusstsein von deren Bedeutung für das eigene Leben oder war man bereits so weit entfremdet, die Natur als reinen Selbstbedienungsladen zu betrachten? Bevor er sich nicht ein umfassendes Bild vom Wesen des Menschen gemacht hatte, genügte ihm die Rolle des stillen Beobachters. Der ZWEITE befand sich nun in der Analysephase und an eine Kontaktaufnahme wie vor 20.000 Jahren war vorerst nicht zu denken.
Als erstes Anschauungsobjekt an diesem sonnigen Spätsommermorgen erwählte er einen Dachdecker, der sich auf der Spitze eines Londoner Kirchturms mit abgefallenen Schieferschindeln plagte. Der ZWEITE kam von oben, aus dem Himmel, und der Dachdecker war zu diesem Zeitpunkt der höchstgelegene Mensch Londons. Und folglich der Erste, dem er begegnete. Der ZWEITE zögerte nicht lange. Dieser Mensch, der Erstbeste den er traf, erschien ihm so gut wie jeder andere. Zügig fuhr er ihm durch die Nase hindurch, entlang des Nasenbeins direkt in den Front-Cortex. Der Dachdecker schüttelte kurz den Kopf, schneuzte sich durch die Finger und hämmerte weiter. Der ZWEITE musste sich nun als erstes mit der Sprache des Mannes vertraut machen. Menschen dachten in Worten und nachdem er den speziellen Londoner Slang verstehen konnte, machte er sich ein Bild von den Erinnerungen des Mannes. Hier, so vermutete er, würde er Informationen über dessen Stellung in der Londoner Gesellschaft finden.
Informationen über den sozialen Status seines Untersuchungsobjekts erschienen ihm wichtig. Nach allem, was man bisher herausgefunden hatte, lebten die Menschen in hierarchischen Strukturen. Da galt es herauszufinden, welche Position der Mann in dieser Stadt einnahm. War er einer der Führer der Londoner? In menschlichen Gemeinschaften gab es wohl immer einige wenige Führungspersönlichkeiten und viele Untergeordnete. Interessanterweise schien aber der Einfluss von Einzelpersonen auf das Gruppengeschehen nichts mit der Gruppengröße zu tun zu haben. Sollte sich die Anzahl der Führungspersönlichkeiten nicht proportional zur Anzahl der Gruppenmitglieder verhalten? Diese Gleichung erschien logisch, war aber wohl nicht die Regel. Auch in sehr großen Gruppen konnte wohl ein Einzelner sehr großen Einfluss gewinnen.
Einen wichtigen Hinweis dazu hatte ihm der DRITTE gegeben. Bei der Beobachtung von Hannibals Feldzug über die Alpen war ihm aufgefallen, dass die wichtigen Entscheidungen immer nur einer traf. Dieses Phänomen hatte er als den „Einen Kopf“ bezeichnet. Ein interessanter Aspekt. Wenn es in London genauso wäre und auch hier nur ein einziger Kopf das Sagen hätte, würde das die Sache vielleicht einfacher machen. Falls das zuträfe, würde womöglich auch die aggressive Expansion Mittel- und Westeuropas von nur einem Kopf gesteuert. Dann aber würde der Platz dieses Kopfes mit hoher Wahrscheinlichkeit hier in London sein. Also galt es diesen Kopf nun zu finden.
Inzwischen hatte der ZWEITE den Namen des Dachdeckers herausgefunden. John Mitchell hieß er. John schien momentan sehr zufrieden mit sich zu sein. Der ZWEITE las seine Gedanken mit.
Ist doch tausendmal besser hier als auf so `nem verdammten Schiff!“
Das dachte John gerade, während er die letzte Schieferplatte festnagelte. Er war früher Schiffszimmermann gewesen und an diesem strahlenden Sommermorgen, in der milden Brise hoch über den Dächern von London, fielen ihm wieder die schrecklichen Bilder von nächtlichen Stürmen und splitternden Masten ein: riesige Stämme ehemaliger Weißtannen, geborsten im Orkan, die am nächsten Tag notdürftig geflickt werden mussten - bei immer noch stürmischer See, hoch oben in den Rahen baumelnd, hin und hergeworfen von tosenden Wellen. Nee, brummte er, das brauchen wir nich´ mehr. Er schichtete die restlichen Schieferplatten hinter ein Mäuerchen - fürs nächste Mal - band sich sein Werkzeug um und machte sich an den Abstieg. Im dunklen Turmaustritt angekommen, verschlechterte sich seine Laune. Der verfluchte Kirchenbaumeister würde gleich abkassieren kommen, vermutete er, obwohl er, John, von Kapitular Fox höchstselbst mit der Reparatur beauftragt worden war. Eine einzige Räuberbande, die Kirchenbaumeister. Eddie Miller war da keine Ausnahme. Hätte er die Reparatur doch selber machen sollen. Aber erst hatte er keine Leute gehabt, dann keinen Schiefer, und jetzt würde er trotzdem die Hand aufhalten und seinen Obolus verlangen. John würde dem Kapitular mal einen kleinen Hinweis geben. Er konnte gut mit Fox. Feiner Kerl. Hatte Umgang mit den höchsten Kreisen und war trotzdem zu jedermann freundlich.
Der ZWEITE horchte auf. Verbindungen in die höchsten Kreise? Aha. Sogleich suchte er in Johns Hirn nach Bildern und emotionalen Verknüpfungen zu Kapitular Fox. Die Arbeit hätte er sich sparen können. Es dauerte keine 10 Minuten, da stand Fox schon leibhaftig vor ihnen. Flugs wechselte der Außerirdische die Seiten: aus einer Nase raus, in die andere Nase rein. John und sein Auftraggeber mussten gleichzeitig niesen. Fox brummte:
Gesundheit! Herr steh uns bei. Eine Schnupfenepidemie mitten Sommer? Haben wir Schuld auf uns geladen, lieber John?
Der ZWEITE drang direkt ins Großhirn des Kirchenmanns vor. Das hier war schon deutlich komplexer. Um das Wissen und die Informationen zu sichten, die in diesen Zellen gespeichert waren, würde er länger brauchen als bei John. Das Gehirn des Kapitulars erwies sich als Glücksfall - nicht für den ZWEITEN, sondern vor allem für die Zukunft des Planeten Erde. Jeremias Fox war trotz seiner klerikalen Karriere insgeheim ein überzeugter Anhänger der Aufklärung. Sein naturwissenschaftliches Interesse verband sich mit einer umfassenden Bildung. Alles was Fox wusste über die Gesellschaften Europas, über England und seine Kolonien, über die englische Gesellschaftsordnung, über die Rechtsprechung, Monarchie und Parlament, über die Zukunftsperspektiven der europäischen Wirtschaft, Englands Probleme mit den amerikanischen Kolonien, über alle sonstigen Feinde der Krone und die Macht der Kirche, all dies wusste nach drei Monaten intensiver Forschung auch der ZWEITE. Er las sämtliche Zeitungen und Bücher mit, verfolgte die Predigten seines Wirts, verschaffte sich ein Bild über das Denken seiner Zuhörer, seiner Gemeinde und die geistigen Strömungen seiner Zeit, lauschte den Gespräche und Diskussionen des Kirchenmanns. Er genoss dessen Vorliebe für schweren Portwein und fetten Entenbraten, entdeckte seine heimliche Zuneigung zu vollbusigen blonden Damen und auch, wie er sich von diesen Gelüsten befreite. Drei Monate blieb er stiller Beobachter des Alltags von Kapitular Jeremias Fox. Nachdem der ZWEITE jeden Winkel seines Gehirns erforscht hatte, kannte er dessen Weltbild, wusste, wen der Kirchenmann verehrte, verachtete oder fürchtete. Der ZWEITE hatte auch erkannt, dass es den Einen Kopf in London nicht gab. Der frisch gekrönte König Georg der III. konnte es jedenfalls nicht sein. Fox, ein kluger, besonnener, humanistischen Idealen aufgeschlossener Mann, hätte den Einen Kopf, den großen Führer, wohl eher gefürchtet als verehrt. Da er den Einen Kopf nicht identifizieren konnte, erschien es dem ZWEITEN müßig, sich um jene zu kümmern, die Fox Angst einflößten. Zu unser aller Glück wendete er sich denen zu, die Fox verehrte.
Kapitular Fox besuchte regelmäßig den Nature Club, eine Vereinigung vermögender Londoner Intellektueller. Dorthin zog es Künstler, Naturwissenschaftler, Philosophen und Professoren. Der Nature Club galt als klassischer Debattierclub, in dem sich Anhänger unterschiedlicher politischer, naturwissenschaftlicher und philosophischer Richtungen erregte Wortgefechte lieferten. Häufig waren berühmte Geistesgrößen und Vordenker zu Gast, um den Zuhörern weiteren Zündstoff für hitzige Debatten zu liefern. Andererseits einte sie jedoch das gemeinsame Interesse an humanistischen Idealen und eine gewisse Verehrung für die Schönheit der Natur. Den Vorsitz führte der Gründer des Clubs, Lord Thomas Kilroy. Lord Kilroy zeigte einen durchaus widersprüchlichen Charakter. Neben ausgedehnten Ländereien besaß er acht Handelsschiffe, die ihm zu ansehnlichem Reichtum verhalfen. Seine humanistischen Bildungsideale und sein Interesse an der Aufklärung hielten ihn jedoch nicht davon ab, die Besatzungen seiner Schiffe wie Zitronen auszupressen. Seinem Geld, seiner Bildung und seinem unternehmerischen Geschick verdankte er auch seinen politischen Einfluss. Zudem pflegte er verwandtschaftliche Beziehungen zum englischen Königshaus. Allerdings nahm man ihm in konservativen Kreisen seine Begeisterung für die Ideen Jean Jaques Rousseaus krumm. Auch sein Engagement für die Indianer Nordamerikas traf auf nicht allzu viel Gegenliebe. Zwar geriet ganz London aus dem Häuschen, als er einen leibhaftigen Indianerhäuptling, der auf einem seiner Schiffe angereist kam, im Nature-Club auftreten und eine Rede halten ließ. Doch der Indianer selbst war eher eine Enttäuschung. Er stank wie ein Iltis, war ständig betrunken und redete entweder wirres Zeug oder schwieg beharrlich. Seine Auftritte waren Wasser auf die Mühlen derjenigen, die entschieden gegen die Königliche Proklamation von 1763 opponierten. Diese berühmt gewordene Proklamation lieferte Zündstoff für ständigen Ärger. Ihr Kernstück gipfelte in einem Siedlungsverbot für weiße Siedler in Nordamerika. Das Land westlich der Appalachen sollte den Indianern und der Natur vorbehalten bleiben. Landrodungen, Holzeinschlag, die Jagd auf Wildtiere und die Ausbeutung von Bodenschätzen sollten hier für alle Zeit verboten bleiben. In den gehobenen Kreisen Englands hatte man tatsächlich begonnen, sich über den Schutz der Natur Gedanken zu machen. Lord Kilroy galt als einer der geistigen Väter der Proklamation. Der ZWEITE zeigte sich entzückt. Sollte hier ein Umdenken beginnen, sollte der Mensch allmählich die Bedeutung der Großen Symbiose begreifen? Das Siedlungsverbot bewirkte allerdings das glatte Gegenteil. Es löste vor allem Empörung aus und bot weiteren Stoff für den Konflikt zwischen der englischen Krone und den amerikanischen Siedlern. Bald darauf begann der Unabhängigkeitskrieg zwischen England und seinen nordamerikanischen Kolonien. Für den ZWEITEN jedoch stellte alleine schon die Idee eines Siedlungsverbots zugunsten anderer Arten einen großen Hoffnungsschimmer dar. Dieser bekam weitere Nahrung, als es Lord Kilroy im Herbst 1766 gelang, den scheuen Jean Jaques Rousseau für zwei Abende als Gast im Nature Club zu begrüßen. Rousseau hielt erst stotternd, dann immer leidenschaftlicher eine Rede zum Schutz der Natur. Feurig pries er die heilsame Wirkung intakter Natur auf das Gemüt des Menschen. Zum Schluss kam er auf die außerordentliche Bedeutung eines allgemein gültigen, universellen Schönheitsbegriffs zu sprechen, der ausschließlich in der Natur zu finden sei. Bilder, Objekte und Szenen, die auf der ganzen Welt und in allen Kulturen übereinstimmend als schön empfunden würden, seien für die Zukunft der Menschheit von außerordentlicher Bedeutung. So gäbe es niemanden, der den Anblick einer frisch erblühten, zart betauten Rose an einem strahlenden Frühlingsmorgen hässlich fände. Die Schönheit der Natur sei die einzige Möglichkeit, Übereinkunft und Übereinstimmung unter der gewaltigen Masse streitlustiger Individuen herzustellen. Der Meinung, dass eine palmenumsäumte, plätschernde Quelle inmitten einer öden Wüste schön sei, würde niemand widersprechen - außer Wüstenskorpionen und Sandottern. Über alles ließe sich streiten, darüber nicht. Solche allgemein gültigen Wahrheiten, die sich nur in der Schönheit der Natur finden ließen, auf die sich jeder verständigen und die niemand in den Dreck ziehen könne, kurz, über die sich eine globale Übereinkunft erzielen lasse, solche Wahrheiten seien die einzige Möglichkeit, einen universellen Konsens zu erzeugen. Solche glücklichen gemeinsame Empfindungen seien die ersten und wichtigsten Voraussetzungen für eine friedlichere Welt. Rousseau empfahl, aus diesem Verständnis eine Religion zu machen, unter der Hindus, Christen, Moslems und alle anderen zusammenfinden könnten. Umso unverständlicher sei, wie mit den Naturschätzen und ihrer Schönheit umgegangen werde. Er fordere hiermit den hellsichtigeren, den tatkräftigen, den vermögenderen Teil der Menschen, also vor allem jene, die hier vor ihm säßen, dazu auf, ein Pamphlet zur allgemein gültigen Definition von Schönheit und deren Schutz zu entwickeln.
Die Rede fand großen Beifall, auch wenn einige feixend die Unsinnigkeit einer solchen Idee belächelten.
Fox wiederum, dem das Bild des universalen Schönheitsbegriffs anfangs sehr zugesagt hatte, stieß sich an dem Gedanken, in einer globalen Kirche gemeinsam mit Moslems und Hindus bunte Blumen und anmutige Eichhörnchen anbeten zu sollen. Den ZWEITEN enttäuschte diese kleinliche Biederkeit. Rasch verließ er das Gehirn seines jovialen Gastgebers und lief zu Rousseau über. Das Chaos, das er dort antraf, war allerdings eine Überraschung. Welch ein Gegensatz bildete das Neuronenfeuerwerk, auf das er hier traf, gegenüber den beschaulichen Hirnströmen des gemütlichen, in wohlgeordneten Bahnen denkenden Kapitulars. Es dauerte, bis er sich in dem Wirrwarr aus genialen Gedanken und widerstreitenden Gefühlen zurechtgefunden hatte. Doch dann stieß der ZWEITE auf einen Schatz von Erinnerungen, der von höchstem Wert für seine Untersuchung war. Rousseau stand mit allen großen Denkern seiner Zeit in regem Austausch. Das Bemerkenswerte daran: Obwohl Gespräche oder sogar Briefwechsel oft in erbittertem Streit endeten, hatten Rousseaus Zeitgenossen doch im Wesentlichen das gleiche Ziel: Die Verbesserung des Menschen. Nicht die Verbesserung der Lebensumstände, wie man heute vielleicht vermuten würde, war das Ziel, sondern der Mensch an sich, verdorben durch die Entfremdung von sich selbst, sollte auf einen besseren, natürlicheren Weg gebracht werden. Die Unzulänglichkeit und Fehlerhaftigkeit der eigenen Gattung hatte man klar erkannt. Und man wusste sehr wohl um das Gefahrenpotential, das der Mensch für seine Mitmenschen und darüber hinaus für die gesamte Schöpfung darstellte.
Im Jahr 1770 machte James Cook Australien zu einer englischen Kolonie und die Regierung begann damit, tausende Strafgefangene und Kriminelle in dieses unberührte Land zu verfrachten. Die Ureinwohner des neuentdeckten Kontinents wurden in Europa Gesprächsthema und man bestaunte gefangene Aborigines, die in den Großstädten zur Schau gestellt wurden. Der ZWEITE beschloss, einen Abstecher nach Australien zu machen, um die Lebensumstände dieser Menschen zu untersuchen - ein Unternehmen, das ihm spezielle Einsichten bescherte. Er blieb zwei Jahre und untersuchte Kulturen, die sich im Wesentlichen noch in einem Zustand befanden, wie er sie zur Zeit Schnakenbeins vorgefunden hatte. Danach, in Rousseaus letzten Lebensjahren, kehrte er noch einmal in das Gehirn des Philosophen zurück. Von dort aus besuchte er Rousseaus ehemalige und aktuelle Gesprächspartner. Dessen gelehrtesten Freunde und Feinde fand er in Paris, Washington, Genf, London, Madrid, Königsberg und schließlich auch in Weimar.
In diesem beschaulichen Städtchen regierte damals Herzog Karl August von Weimar. Karl August war ein Anhänger des aufgeklärten Absolutismus. Gemeinsam mit seiner Mutter Amalie machte er die kleine sächsische Residenz zu einem Zentrum von Wissenschaft, Philosophie und Kultur. An keinem Punkt Europas drängten sich mehr Geistesgrößen pro Einwohner als ausgerechnet hier. So wie sich heute das Silicon Valley als Zentrum der Digitalen Revolution darstellt, war Weimar zur damaligen Zeit die geistige Schmiede der humanistischen Bewegung. Nach Rousseaus Tod fand der ZWEITE in diesem Umfeld rasch eine neue angemessene Heimstatt - im Gehirn Johann Wolfgang von Goethes.
Dem ZWEITEN gefiel es in Weimar im Allgemeinen und in Goethes Gehirn im Besonderen außerordentlich gut. Er genoss den Hang des Dichters zu guten Speisen und exquisiten Weinen ebenso wie die Neugier und die Kreativität Goethes. Er liebte dessen Hang zu kontroversen Diskussionen und Streitgesprächen, vor allem aber die Begeisterungsfähigkeit des Dichters, die bisweilen in euphorische Schübe ausartete. Der Oxygod genoss es, wenn Goethes Neuronen feuerten und sein Gehirn regelrecht überkochte.
Das Wichtigste aber: Was er in diesen Kreisen sah und hörte, stimmte ihn zuversichtlich für die Zukunft der Menschheit. Wenn diese empfindsamen, naturverliebten Seelen die geistige Elite Europas waren, würde sich die Entwicklung des Menschen zur Dominanten Art gewiss verhindern lassen.
Heimlich wurde eine Reise vorbereitet. Goethes Aufbruch nach seinem Sehnsuchtsort Italien stand bevor. Der Dichter wollte und konnte nicht länger warten. Die Umstände schienen günstig, und im Morgengrauen stahl er sich davon. Nur wenige Eingeweihte wussten von seinem Plan. Der ZWEITE wollte in der Zeit von Goethes Abwesenheit seine Untersuchungen bei anderen Weimarer Persönlichkeiten fortführen. Er beschloss aber, seinen Lieblings-Wirt zwischendurch zu besuchen und streckenweise auf seiner Reise zu begleiten. Goethe in Italien aufzuspüren würde ihm nicht schwerfallen. Die Gehirnströme jedes Menschen haben eine ureigene spezifische Schwingung, die der Oxygod bis zu jedem Punkt der Erde verfolgen konnte. Wenn er einmal das Gehirn eines Menschen bewohnt hatte, konnte er ihn später überall wieder ausfindig machen - vorausgesetzt, sein Gastgeber war noch am Leben und die Gehirnströme funktionierten noch.
Kaum hatte Goethe die Alpen überquert, machte sich auch der ZWEITE auf den Weg zu einer Stippvisite bei seinem Gastgeber. Unweit des Gardasees wurde er fündig. Der Dichterfürst saß in einem knarzenden, holpernden Kutschgefährt, das von zwei großen braunen, beständig furzenden Pferden gezogen wurde. Mit an Bord befanden sich der Maler Giacomo Benetto und ein kleines Mädchen, das krank und verängstigt am Straßenrand gesessen hatte und dem Goethe nun versuchte, in Wein getunktes Brot zu verabreichen. Dabei redete er in seiner insistierenden Art beständig auf den Maler ein, piesackte ihn mit seiner Wissbegier und versuchte alle möglichen Informationen über ein bestimmtes Gemälde in einer bestimmten Kirche in Verona aus ihm heraus zu kitzeln. Zugleich geriet er ein ums andere Mal in Verzückung über die faszinierende Schönheit des noch nahezu jungfräulichen Gardasees und die Lieblichkeit der Landschaft. Obwohl die Reise in unvorstellbarer Langsamkeit vor sich ging - mit jedem Klappfahrrad wäre man schneller vorwärts gekommen - beschwerte sich Goethe beständig über die viel zu hohe Geschwindigkeit und die "rasende Fahrt" des seiner Meinung nach irre gewordenen Kutschers, der ihm keine Gelegenheit zum Innehalten und zum Betrachten der vielen Wunderlichkeiten am Wegesrand gab. Mit seinem Knotenstock schlug er energisch an die Kabinenwand hinter dem Kutschbock, um seinem Chauffeur, einem schnauzbärtigen, nach Schweiß, Knoblauch und Pferdemist stinkenden Kauz, von seiner Raserei abzuhalten und zur Mäßigung zu bewegen. An jedem Felsen, jeder Palme gebot er ihm innezuhalten, damit er zum Studium der Objekte aussteigen konnte. Seine Mitreisenden ergaben sich lachend in ihr Schicksal und beobachteten das Treiben des vornehmen Herrn aus dem Fenster. Goethe ging derweil einfach zu Fuß und ließ die Kutsche alleine davon holpern. Und tatsächlich gab es viel zu staunen. Mancherorts war die Weinlese bereits im Gange. Die Rebstöcke hatte man am Fuße hoher Pappeln gepflanzt und die Triebe rankten hoch ins Geäst, worin Horden singender und johlender Halbwüchsige wie Affen herumkletterten, die Trauben abschnitten und in Weidekörben den untenstehenden Erwachsenen herunterreichten. Goethe eilte hinzu und begann umgehend mit den Bauern über deren absonderliche Art der Weinerziehung zu fachsimpeln. Der großgewachsene Fremde in seinen seltsamen Kleidern erregte sogleich allgemeine Aufmerksamkeit. Die Dorfjugend hüpfte von den Bäumen, die Bauern entkorkten dickbauchige, in feuchte Sackleinen eingenähte Krüge, die den Wein kühl hielten. Große Tonbecher wurden vollgeschenkt und flugs befand man mitten in der schönsten Unterhaltung. Durch die goldenen Blätter der hoch aufragenden Pappeln fiel das verschleierte Licht der nachmittäglichen Septembersonne, zwischen den silbernen Stämmen funkelte der blaue See. An einem knisternden Feuer rösteten einige Frauen Speck und Kastanien, derweil von der Kutsche her das gotteslästerliche Gefluche des Kutschers ertönte, der endlich weiterfahren oder für seine Warterei zumindest mit einer Handvoll Kastanien und einem Krüglein Wein entschädigt werden wollte. Bis man ihm den Gefallen tat, sollte es noch ein Weilchen dauern. Zuerst mussten unter Absingen lustiger Lieder die Eselkarren mit den Körben voller Trauben bepackt werden. Sodann musste der Geheime Rat auf den vordersten Karren gesetzt und mit buntem Weinlaub bekränzt werden. Erst dann durfte sich der Zug in Bewegung setzen und bei maximaler stimmlicher Entfaltung seiner Bewohner gemächlich dem Dorf entgegen rollen. Der Kutscher war mit dem Maler bereits vorgefahren, das Mädchen hatte sich der Dorfjugend angeschlossen. Es würde bei Verwandten übernachten. Giacomo hatte für die Nacht mit Bedacht ein bescheidenes kleines Gasthaus ausgewählt, das er wegen seiner Lage und der Kochkunst der Hausherrin schätzte. Es lag an der Straße nach Malcesine am Ende des Dorfes inmitten eines großen Obstgartens, der direkt an den See grenzte. Nachdem das Gepäck ins gemeinsame Schlafzimmer verbracht und einige Briefe geschrieben waren, setzten sich Goethe und Giacomo an den im Freien gedeckten Tisch. Er befand sich auf der Rückseite des Hauses unter einer kleinen Laube, wenige Schritte vom See entfernt. Der Wirt, der Kutscher, und die drei jüngsten Kinder der Wirtsleute hatten sich ebenfalls schon eingefunden. Die Wirtin und eine Magd brachten das Abendessen auf den Tisch: Sauer eingelegte Süßwasser-Sardinen, wie sie nur im Gardasee vorkommen, dazu Polenta und Tomatensauce. Nach dem Essen schickte die Sonne sich an, blutrot hinter den Bergen am Westufer des Sees zu versinken. Fledermäuse begannen den Garten zu durchschwirren, die Luft war mild und duftete nach See und Rosen. Da wurde die kleine Gesellschaft Zeuge eines Naturschauspiels. Während die untere Hälfte der Sonnenscheibe bereits hinter dem Gebirgskamm versank, stieg direkt daneben die obere Hälfte eines fahlen, bläulich-blassen Vollmonds empor. Für wenige Sekunden linsten Sonne und Mond wie ein halbes rotes und ein halbes silbernes Auge über den Bergkamm, in stiller Eintracht nebeneinander die Welt betrachtend. Dann verschwand die Sonne, und der Mond zeigte sich in voller Pracht. Alle waren aufgesprungen, überwältigt von der Schönheit des Augenblicks. Ergriffen drückte Goethe Giacomos Hand. Der rannte hoch in sein Zimmer und holte Pinsel, Farben und Leinwand. Die Wirtin brachte Kerzen und noch einen Krug Wein, während der Wirt und der Kutscher ihre Pfeifen stopften. Bis Giacomo alles vorbereitet hatte, brach eine helle Nacht herein und der Mond schickte einen breiten Silberstrahl quer übers Wasser, Goethe vor die Füße. Kein Menschenlicht störte den Zauber, nur der Mond und das Gleißen des Firmaments erleuchteten den Garten. Niemand sprach mehr ein Wort und alle schauten stumm und staunend, wie vor ihren Augen Giacomos Bild einer Mondnacht am Gardasee entstand.
Der ZWEITE hatte Goethes Italienreise länger als geplant begleitet und auch nach dessen Rückkehr nach Weimar wollte er noch ein wenig Goethes unfreiwillige Gastfreundschaft genießen. Als aber ein weiteres Jahr in Weimar vergangen war, schien es ihm genug zu sein. Der Oxygod war zuversichtlich. Er würde die Erde mit einem guten Gefühl verlassen.
Die geistige Elite Europas befand sich auf einem guten Weg. Ihre romantische Naturverklärung würde in einer pragmatischen, an den Bedürfnissen der Großen Symbiose orientierten Gesetzgebung zum Ausdruck kommen. Der bescheidene Lebensstil der hier versammelten Geistesgrößen, die ihre materielle Bedürfnislosigkeit geradezu zum Ideal erkoren, würde eine positive Wirkung auf die Erziehung des Volkes, vor allem der Jugend, entfalten. Aber es gab Risiken. Der Mensch erfüllte, so viel hatte der ZWEITE inzwischen herausgefunden, nahezu alle Kriterien einer Dominanten Art. Wenn man sich jedoch die Individuen im Einzelnen betrachtete, ergab sich zum Teil ein ganz anderes Bild.
Die Aborigines zum Beispiel. Sie lebten als Teil der Großen Symbiose, waren eins mit ihr geworden. Waren das etwas keine Menschen? John Mitchell, der Schiffszimmermann, der stundenlang den Schwalben zusehen konnte, wenn sie ihm zu Füßen um den Kirchturm schwirrten; der ansonsten seine Ruhe haben wollte und abends einen Schnaps - auch er zweifellos ein Mensch. Und all diese wunderbaren Denker, die so enthusiastisch an ihren komplizierten Gerüstleitern zum Aufstieg in den Olymp eines moralisch einwandfreien Menschseins bauten, gehörten die zu einer Dominanten Art? Auch die Gefühlswelt der meisten Menschen entsprach keineswegs den Kriterien, die für Dominante Arten galten. Das menschliche Gehirn zum Beispiel ist so programmiert, dass positive Empfindungen ausgelöst werden, wenn man anderen helfen kann. Dieses innere Wohlgefühl, eine Art Befriedigung, ausgelöst durch einen zum Teil genetisch determinierten biochemischen Prozess, stellt sich sogar selbst beim Gießen einer verdorrenden Blume ein. Wie vertrug sich dieser Wesenszug mit dem gnadenlosen, raubtierhaften Vernichtungswillen, der vielen Menschen innewohnte und jederzeit hervorbrechen konnte? Irgendwas war bei dieser Spezies anders und verlief völlig untypisch.
Aufgrund ihrer Lernfähigkeit und unter Anleitung ihrer philosophischen Genies könne die Menschheit, vermutete der ZWEITE, unter gewissen Umständen, zu einer bewahrenden Koexistenz mit der Großen Symbiose finden. Aber der Weg war noch weit und vor allem gab es da noch ein Rätsel zu lösen. Irgendwo existierte eine dunkle Macht, eine Macht, die in ihren Genen schlummerte und diese Spezies in den Untergang trieb. Diese Macht galt es noch zu finden. Sie hatte mit dem Einem Kopf zu tun, dessen war sich der ZWEITE sicher. Doch die Zeit, dieses Rätsel zu lösen, war noch nicht gekommen. Er würde die Erde nun verlassen, aber zu gegebener Zeit zurückkehren.
Ein goldener Morgen Ende Oktober brach an. Die ersten Sonnenstrahlen tasteten sich durch gelb-rot-orange geflammtes Laub und brachten die trüben Fensterscheiben der Schreibstube in Goethes Haus am Frauenplan zum Leuchten. Ihr Licht blendete die Augen des Hausherrn, der sich an seinem Schreibtisch sitzend, gerade Gedanken über das Wesen eben dieses Lichtes und seinen Einfluss auf die Farben machte. Der ZWEITE, der die Überlegungen seines Gastgebers interessiert verfolgte, bereitete sich auf seine Rückkehr nach Oxygard vor. Gerade hatte er beschlossen, das Mittagessen noch abzuwarten. Fräulein Christiane, deren Anblick bei Goethe stets angenehme Gefühlsregungen auslöste, hatte heute Morgen in aller Frühe vier Waldschnepfen vom herzoglichen Jäger bekommen. Die angenehmen Gefühlsregungen Goethes hatten sich daraufhin nochmals außerordentlich gesteigert. Man gedachte, den köstlichen Schnepfendreck, also den naturbelassenen Inhalt der Schnepfen samt Darm und Magen, zur Vorspeise in Butter und Madeira zu rösten und den Rest der guten Tiere, sorgsam gebraten, in Gesellschaft einer Flasche besten Burgunders zu verspeisen. Die zu erwartenden Glücksgefühle des Hausherrn wollte der ZWEITE noch abwarten, um dann für einige hundert Jahre von diesem Planeten zu verschwinden. In diesem Moment klopfte es an die Tür. Der Diener trat ein und meldete einen Boten des Herzogs. Der Geheime Rat möchte sich bitte schnellstens zum Schloss bemühen, es gäbe wichtige Neuigkeiten.
Goethe mochte es nicht, unversehens aufs Schloss zitiert zu werden, und schnellstens schon gar nicht. Dennoch tauschte er nach einigen Seufzern den rotsamtenen Morgenrock mit dem blauen Straßenmantel und machte sich auf den Weg.
Im Großen Sitzungssaal herrschte bereits größte Aufregung. Goethes oberster Dienstherr, Herzog Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach, hatte soeben von einem preußischen Gesandten ungeheuerliche Nachrichten erhalten. Einer der mächtigsten Männer Europas, der französische König Ludwig der XVI. und seine reizende Gattin, die schöne Marie-Antoinette, waren vor wenigen Tagen von einer grölenden fahnenschwingenden Meute aus Versailles getrieben und nach Paris gebracht worden. Die seit Monaten andauernden Unruhen in Frankreich hatten damit eine Wendung genommen, die sich niemand hatte vorstellen können. Der König von Frankreich! In der Hand des Pöbels! Volksaufstand, Revolution, Verrat - ein Weltenbrand war ausgebrochen. Ein unerhörter Vorgang, der einzig und allein in den Untergang der göttlichen Ordnung münden musste. Was, wenn dieses Beispiel Schule machte? Wenn der aufrührerische Ungeist der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, der gerade den französischen Pöbel zur Raserei brachte, nach Sachsen herüberschwappte?
Der ZWEITE beschloss, noch etwas zu bleiben.
NEW YORK
Bea Myers wollte gerade ihre Morgendusche nehmen, als ihr Blick auf das Display ihres Dienst-Handys fiel. Brukenthaler hatte angerufen, vor drei Stunden schon, um vier Uhr morgens New Yorker Zeit. Noch dazu am heiligen Sonntag. Was mochte da wieder los sein?
Leicht genervt suchte sie den Entriegelungscode in ihrer Handtasche. Abhörsichere Handys waren zwar eine feine Sache, aber die Zeremonien vor jedem Anruf nervten. Ihr Gefühl sagte ihr, dass es heute Morgen mit Joggen im Central Park wohl nichts werden würde. Das Gefühl verstärkte sich, als sie den Klang der Stimme ihres Chefs hörte.
Was ist passiert?
Ich habe schlecht geträumt.
Aha. Und deswegen rufst du mich mitten in der Nacht an? Bist du noch in der Schweiz?
Ja. In Como. Ich habe eine Botschaft erhalten.
Eine Botschaft? Von wem?
Von einer außerirdischen Intelligenz.
Bitte, Abbas. Hör auf mit dem Quatsch und sag´ was du auf dem Herzen hast. Irgendwas ist vorgefallen, ich spüre es. Also raus mit der Sprache.
Versprich mir, zu keinem Menschen ein Wort zu sagen.
Versprochen.
Ich weiß nicht mehr weiter. Ich muss eine Telefonnummer anrufen, die mir heute Nacht - im Schlaf - übergeben wurde. Der Überbringer der Nummer war, nun ja, nicht von dieser Welt. Er gab mir den Befehl, diese anzurufen ...
Abbas, um Himmels willen, geh sofort zu einem Arzt, hörst, du? Bitte! Geh zu einem Arzt. Dir ist nicht gut, du brauchst ...
Glaubst du, ich wüsste nicht, wie verrückt das klingt? Ich wollte dich auch nur vorwarnen. Ich werde nun diese Nummer wählen. Du musst heute unbedingt erreichbar sein. Vielleicht brauche ich dich. Du hörst von mir.
KROHNMÜHLE V
Petersen umkreiste mit rotem Kopf und offenem Mund, die Hände auf dem Rücken, unentwegt den Küchentisch. Ab und zu sah er aus dem Küchenfenster und verglich den traurigen Anblick des Neubaugebiets mit den phantastischen Bildern, die ihm der ZWEITE soeben ins Gehirn gezaubert hatte. Die Tage in London und Weimar, die Fahrt zum Gardasee, alles hatte Petersen live und dennoch mit über 200 Jahren Abstand miterleben dürfen. Meine Güte, diese Kinder! Wie sie in den Bäumen rumturnten, so fröhlich und unbeschwert. Wie einfach und natürlich alles gewesen war. Und wie der Wein geschmeckt hatte! So ganz anders, sauer ja, aber so erdig und pur. Und dann diese Nacht in dem Garten, nur Vollmond und See, ohne jedes künstliche Licht. Wie anders die Welt doch vor kurzem noch gewesen war! Rousseaus Idee vom universellen Schönheitsbegriff wurde ihm zunehmend sympathisch. Wer sich daran verging, sollte ausgepeitscht werden, dachte er und sah sich schon Gemeinderatsmitglieder und Architekten vertrimmen.
Nächste Runde um den Küchentisch. Erneut rief er sich die jüngsten Bilder ins Gedächtnis. Er war der einzige Mensch, der je eine Zeitreise unternommen hatte. Ein Menschheitstraum, wahr geworden, nur für ihn. Diese Erfahrung hatte er nun jedem anderen Menschen voraus. Er war der einzige lebende Mensch, der die Steinzeit erlebt hatte. Der die wahren Gesichtszüge Goethes kannte, seine Stimme gehört und die tranige, muffige Ausdünstung seiner Stiefel und Kleider gerochen hatte. Persönlichkeiten, die man von Bildern und aus Büchern kannte, vor Ewigkeiten verstorben - für ihn waren sie in allen Facetten wieder lebendig geworden.
Wo war eigentlich sein Mentor abgeblieben? Petersen brannte darauf, den Fortgang der Geschichte zu erfahren. Wie war Goethe hierhergekommen? Nur Theo kannte die Antwort. Aber er war nicht in seinem Kopf, wo er hingehörte.
Plötzlich sah er ihn. Aufgetaucht wie aus dem Nichts, mitten auf dem Tisch sitzend - im Spagat! War er heimlich im Weinkeller gewesen? Früher hatte er diese Spagat-Nummer immer vorgeführt, wenn er besoffen war. Gelenkig, als gäbe es kein Hüftgelenk. Petersen kratzte sich verdutzt die Glatze. Was sollte das nun wieder?
Könntest du mal mit dem Quatsch aufhören und die Geschichte zu Ende bringen? Die Französische Revolution ist mein Lieblingsthema! Gerade als es interessant wurde, hast du die Vorstellung abgebrochen. Warum bist du raus aus meinem Kopf?
Zu stickig. Du denkst nicht mit. Zwischendurch muss man dir mal auf die Sprünge helfen.
Wieso?
Du willst immer nur wissen, wie Goethe in dein Haus kam - wahrscheinlich, damit du später damit prahlen kannst. Du hättest dich aber auch mal fragen können, warum die Natur der Erde, all den großartigen Denkern, Künstlern und Philosophen zum Trotz, so unter die Räder kam? Warum sich der ZWEITE damals so irren konnte?
Ich gebe zu, das ist eine interessante Frage. Vielleicht war er ja so eine Art Gutmensch. Einer, der das niederträchtige Wesen unserer Spezies einfach nicht wahrhaben wollte. Der sich gutgläubig an die naiven Einsichten weltfremder Philosophen klammerte, wie ein Ertrinkender an einen Strohhalm. So wird´s wohl gewesen sein. Um sich selber reinzuwaschen, schätzte er die weitere Entwicklung der Menschheit viel zu optimistisch ein. Logisch. Und gab sogleich Entwarnung. Die Sauerstoffextraktion wäre andernfalls vermutlich schon längst vollzogen worden, stimmt´s?
Darauf kannst du wetten. Zum Glück für die Menschheit verließ er die Erde, kurz bevor der neue Eine Kopf auftauchte. Dadurch hat er das Ende der alten Ordnung verpasst.
Der neue Eine Kopf? Ende der alten Ordnung? Du sprichst in Rätseln.
Ich spreche von Napoleon Bonaparte.
Napoleon Bonaparte? Das also war der neue Eine Kopf? Klar, der hat mal ordentlich aufgeräumt. Er hat vor allem die Willkürherrschaft des Adels beendet. Was ist daran verkehrt?
Mit Napoleon begann die Ära der Maßlosigkeit. Und aufgeräumt hat er vor allem mit Vernunft und Bescheidenheit. Es stimmt, der ZWEITE verließ die Erde damals in der Überzeugung, der Mensch sei auf einem guten Weg. Weil er den Zeitpunkt seiner Abreise verschoben hatte, konnte er die Ereignisse der Französischen Revolution mitverfolgen. Sie bestärkten ihn in diesem Glauben. Vielleicht war das tatsächlich etwas naiv. Aber die Französische Revolution hatte zunächst einen durchaus positiven Einfluss auf das Bewusstsein der geistigen Elite Europas. Humanistische Ideale, vom Adel bisher mit Argusaugen beäugt, wurden plötzlich salonfähig. Die Protagonisten der Revolution begannen die Natur zu verklären und sich für ihre Schönheit zu begeistern. Man predigte Bescheidenheit und pries das einfache Leben. Sogar der Ruf nach Tier- und Naturschutz wurde laut, auch Tiere sollten Rechte bekommen. Der ZWEITE war überzeugt, dass die Entwicklung in Frankreich einen neuen, humanistischen Führer hervorbringen würde. Aus einer aufgeklärten Geisteshaltung könne Respekt vor der Natur entstehen; die Gier bezähmt und die Menschheit einen Weg zu weiser Selbstbeschränkung finden. Auch Goethe hegte heimliche Sympathie für die Ideale der Französischen Revolution. Auch er war ein naturbesessener Romantiker und seine humanistische und zugleich naturverehrende Grundeinstellung teilte er mit bedeutenden Zeitgenossen. All das wertete der ZWEITE als positives Zeichen für eine Zukunft, in der die Menschen in verträglicher Harmonie mit ihrer Umwelt leben würden. Doch dann kam Napoleon. Und der war alles andere als ein Humanist. Mit ihm begann eine Ära der Gewalt. Seine Zeitgenossen lernten von ihm, wie mächtig Macht sein kann. Den anderen Mächtigen seiner Zeit lebte er es geradezu vor. Von ihm lernten sie, wie leicht sich unbegrenzte Macht erlangen ließ, wenn man alle Regeln brach und sich aller Skrupel und jeglicher Moral entledigte. Und doch bescherte dieser Napoleon unserem verehrten Geheimrat Goethe die vielleicht wichtigste Erkenntnis seines Lebens. Eine Erkenntnis, die auch für uns von größter Bedeutung sein wird.
Wie das?
Nun, die beiden trafen einander, als sich der Kaiser der Franzosen auf dem Höhepunkt seiner Macht befand. Viele Jahre später, im Zuge seiner Lebenserinnerungen, beschrieb der alternde Dichterfürst die Begegnung. Der Schluss, den er daraus zog, lieferte dem ZWEITEN das fehlende Puzzleteil, das entscheidende Verbindungsstück zum Verständnis des Einen Kopfes und dessen Bedeutung für die Menschheit. Aber davon später.
Petersen schwirrte sein eigener Kopf. Ein Treffen von Goethe mit Napoleon vor über 200 Jahren solle also den Schlüssel für die Rettung der Großen Symbiose im 21. Jahrhundert liefern? Die Sache wurde immer rätselhafter. Irritiert versuchte er etwas Klarheit zu erlangen.
Wollen wir nicht einfach mal der Reihe nach vorgehen? Wir waren im Jahr 1789 stehengeblieben, beim Ausbruch der Französischen Revolution und der Gefangennahme des Königs. Just zu diesem Zeitpunkt wollte der ZWEITE die Erde verlassen. Aufgrund der Ereignisse in Frankreich entschloss er sich dann aber, die weitere Entwicklung abzuwarten. Da muss Goethe, warte mal, 40 Jahre alt gewesen sein. Die Gedenktafel im Flur nennt den Oktober 1792 als Zeitraum von Goethes Anwesenheit. Der ZWEITE hat also noch mindestens drei Jahre auf der Erde verbracht. Was geschah in der Zeit? Was geschah im Jahr 1792, als Goethe hier auftauchte?
Wunderbar, er fängt an mitzudenken. Spitz die Ohren. Oktober 1792. Sagt dir das was?
Nein, verdammt noch mal. Das ist fast 250 Jahre her. Irgendwas mit Robespierre und Danton vermutlich. Aber was hat das mit Goethe zu tun? Und mit meinem Anwesen?
Marie-Antoinette?
Wurde geköpft. Aber erst ein Jahr später. Mach´ weiter.
Marie-Antoinette, die Königin von Frankreich, saß im Sommer 1792 bereits seit drei Jahren in Haft. Französische Revolutionäre hatten sie gefangen genommen. Die Königshäuser Europas, ja der gesamte europäische Adel, waren durch strategische Heiraten alle miteinander verwandt. Marie-Antoinette zum Beispiel entstammte dem österreichischen Königshaus. Die Gefangennahme sowohl des Königs als auch der Königin durch Bürgerliche bedeutete in den Augen des europäischen Adels eine unerträgliche Provokation. Hinzu kamen die Adeligen Frankreichs, welche die Revolution in Scharen ins europäische Ausland vertrieben hatte und die nun mächtig Stimmung für eine Konterrevolution machten. Preußen und Österreich einigten sich schließlich auf die Aufstellung eines Heeres, das die alte Ordnung in Frankreich wiederherstellen sollte. Die Landesfürsten sollten dafür Truppen bereitstellen, so auch Kurfürst Carl August von Sachsen-Weimar, der Arbeitgeber Goethes.
Stimmt. Soweit kenne ich die Geschichte auch. Das Abenteuer endete in der Schlacht von Valmy, an der berühmten Mühle. Man sieht sie heute noch von der Autobahn aus, wenn man nach Paris fährt.
Theo nickte beifällig und fuhr fort:
Ungefähr dort, wo heute die Autobahn verläuft, stand Goethe damals, in Dauerregen, Matsch und Modder, am Fuß des Hügels, unterhalb der Mühle, aber außer Schussweite der französischen Artillerie. Das miserable Wetter und die bessere strategische Position der Franzosen brachten an diesem Tag die Wende. Der Feldzug der Alliierten scheiterte an genau diesem Punkt. Am Abend nach der Schlacht, im Kreis einiger Offiziere, sprach Goethe den berühmten Satz: Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen.
Angeblich soll er das ja erst 20 Jahre später gesagt haben.
Stimmt nicht. Abends am Lagerfeuer, kurz vor Mitternacht, hatten ihn die Offiziere gedrängt, etwas Bedeutendes, der Situation angemessenes zu sagen. Da fiel ihm dieser Spruch ein. Der ZWEITE muss es wissen, er saß in Goethes Gehirn. Am nächsten Morgen begann der Rückzug. Die Hälfte der Soldaten war krank, es mangelte an allem, Kleidung und Gepäck waren durchnässt und die Straßen bestanden nur noch aus Schlamm. Auf deutschem Boden angelangt, begann sich das Heer zu teilen, weil man nicht mehr wusste, wie man die Leute auf der vorgegebenen Route noch verpflegen sollte. Ein Teil des Weimarer Bataillons bog nach Süden ab, mittendrin Goethe mit seinem Diener, zwei heruntergekommenen Pferden und einem desolaten Kutschfuhrwerk, das Goethes Gepäck und seine Aufzeichnungen enthielt. Die Truppe fächerte sich weiter auf, denn die Suche nach Verpflegung und einer trockenen Unterkunft wurde immer schwieriger. Der Oktober ging zu Ende, es regnete und stürmte, und gerade als man gegen Abend, die Dämmerung hatte bereits eingesetzt, mit Mühe und Not eine Anhöhe gemeistert hatte, brach die Kutsche endgültig zusammen. Nun war guter Rat teuer. Wohin mit dem Gepäck und Goethes Papieren und Notizen? Unten im Tal erspähte einer der verbliebenen Offiziere ein Licht. Es war die Krohnmühle, wo im Schein einer Tranlampe Müllermeister Krohn gerade seinen Eselkarren auslud und die Werkzeuge verstaute, die er in Eisenberg geholt hatte.
Petersen sprang auf und eilte zu dem riesigen Bücherregal im Wohnzimmer, das sich über die ganze Wand erstreckte. Trotz ihres Umfangs kannte er seine Bibliothek. Nach wenigen Sekunden war er fündig geworden und hielt triumphierend ein schmales Bändchen in die Höhe.
Hier, Goethes Briefwechsel mit seiner Frau, 1792-1807. Am 15. Oktober schrieb er ihr folgenden Brief aus Luxemburg:
"Wir mussten eilig aus Verdun, und nun sind wir seit vorgestern in Luxemburg. In wenigen Tagen geh ich nach Trier und bin wahrscheinlich Ende des Monats in Frankfurt. Wie froh ich bin zurückzukehren, kann ich dir nicht ausdrücken, das Elend, das wir ausgestanden haben, lässt sich nicht beschreiben. Die Armee ist noch zurück, die Wege sind so ruinirt, das Wetter so entsetzlich, dass ich nicht weiß wie Menschen und Wagen aus Frankreich kommen wollen."
Der nächste Brief wurde 20 Tage später, am 4. November aus Koblenz abgeschickt. Er beginnt so:
"Mein schöner Plan, dich bald wiederzusehen, ist auf einige Zeit verrückt. Ich bin glücklich in Coblenz angelangt, es ist eine prächtige Gegend und wir haben das schönste Wetter."
Über die 20 Tage zwischen Luxemburg und Koblenz gibt es keinerlei Aufzeichnungen. Es sollte Januar werden, bis Goethe seine Frau wiedersah. Inzwischen hatten die französischen Revolutionstruppen Mainz und Frankfurt besetzt. Wenn er also hier in der Krohnmühle war, muss das folglich zwischen dem 15. Oktober und dem 4. November passiert sein. Die Krohnmühle liegt aber ungefähr 80 Kilometer südlich der eigentlichen Route Luxemburg - Koblenz. Ist es denkbar, dass man sich mit Pferd und Kutsche dermaßen verfährt? Und wieso berichtete er niemandem von diesem Abenteuer?
Theo lachte.
Für die Ausweichroute nach Süden gibt es eine ganz einfache Erklärung: Der direkte Weg nach Koblenz war im wahrsten Sinne des Wortes leergefressen. 50.000 Mann waren hier bereits ein paar Wochen zuvor durchgezogen, und jetzt strömten alle wieder zurück. Und das alles zu Pferd. Es gab keine Verpflegung mehr und wer sich nichts mit Waffengewalt holen wollte, musste Umwege in Kauf nehmen. Goethes Trupp wählte eine südliche Route, die über den Donnersberg Richtung Worms, Mainz und dann rheinabwärts nach Koblenz führte. Eine Route, die kurze Zeit später übrigens auch ein Teil der französischen Truppen auf ihrem Weg nach Mainz wählte. Dass er gegenüber seiner Frau kein Wort über seinen Aufenthalt in der Krohnmühle verlor, verdanken wir einem adligen französischen Fräulein, das dort ebenfalls Unterschlupf gefunden hatte. Goethe verliebte sich in sie. Über diese Eskapade durfte natürlich nichts bekannt werden, weshalb Goethes Stillschweigen kein Wunder ist.
Was behauptest du da? Goethe hätte ein Techtelmechtel mit einer französischen Gräfin gehabt, hier in diesen Mauern?
Ja. Müller Krohn, ein ehrenwerter, hilfsbereiter Mensch, nahm acht Mann mit vier Pferden für zwei Tage bei sich auf. Auch die Kutsche half er wieder in Stand setzen. Und für Herrn von Goethe räumten Herr und Frau Krohn sogar ihr Ehebett. Bereits zwei Tage zuvor hatte Herr Krohn bereits der bedauernswerten französischen Dame samt ihrer Zofe aus der Patsche geholfen. Auch ihre Kutsche war den schlechten Straßenverhältnissen zum Opfer gefallen und der Herr Gemahl hatte es vorgezogen, sich alleine aus dem Staub zu machen.
Und der ZWEITE logierte derweil in Goethes Kopf und sah alldem zu?
So war es. Tags darauf verließ er die Erde. Die siegreiche Französische Revolution gab seinem Optimismus, die Zukunft der Menschheit betreffend, zusätzlichen Auftrieb. Die Sauerstoffextraktion war erst mal abgewendet.
Petersen musste nachdenken. Jetzt endlich war das Geheimnis der Gedenktafel gelüftet. Unfassbar. Ausgerechnet hier, in seinem Anwesen, soll ein Außerirdischer den Geheimen Rat Johann Wolfgang von Goethe beim Liebesspiel mit einer französischen Gräfin beobachtet haben!
Theo verfolgte amüsiert Petersens fieberhafte Gedankengänge. Irgendwie musste er ihm auf die Sprünge helfen.
Machen wir doch mal einen Zeitsprung.
Ein Zeitsprung? Wohin?
Ins Jahr 2000.
Die Rückkehr des ZWEITEN?
Genau. Die Rückkehr des ZWEITEN. Kurz zuvor hatte der DRITTE die Erde verlassen - sie gaben sich quasi die Klinke in die Hand. Der DRITTE kehrte nach Oxygard zurück, entschlossen, die Sauerstoffextraktion durchzuführen. Seit der Entwarnung des ZWEITEN hatten die Oxygods Napoleon, die industrielle Revolution, zwei Weltkriege und eine gigantische Bevölkerungsexplosion verpasst. Die Menschheit hatte in dieser Zeit mehrmals am Rande eines Atomkriegs gestanden. Sie hatte unzählige Tier- und Pflanzenarten ausgerottet, die Weltmeere überfischt und verdreckt, riesige Naturflächen verbrannt und abgeholzt. Der DRITTE hatte in allem recht behalten und forderte nun Konsequenzen. Allerdings gab es damals, gegen Ende des 2. Jahrtausends, auch einige recht positive Entwicklungen zu vermelden. Nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Zusammenbruch des Ostblocks einigte man sich auf die Vernichtung einer großen Zahl von Atomraketen und schien zu weiteren Abrüstungsschritten bereit zu sein. In Europa und den USA entstanden Umweltschutzbewegungen, es wurden sogar Umweltschutzparteien in die Regierung gewählt. Die Welt schien tatsächlich friedlicher zu werden. Aus diesem Grund folgten die Oxygods dem Vorschlag des ZWEITEN, dem Leben auf diesem Planeten eine letzte Chance zu geben. Sofort machte er sich auf den Weg. Er erreichte die Erde in der Neujahrsnacht des Jahres 2000. Umgehend begann er mit einer erneuten Analyse des menschlichen Gehirns. Sein Hauptproblem war nach wie vor das ungelöste Rätsel um die Einen Köpfe. Der DRITTE vermutete, dass sie bei der Bedürfnisentwicklung des Menschen eine entscheidende Rolle spielten. Aber wie genau das funktionierte, woher die Einen Köpfe kamen, wie sie entstanden und wie man sie bezwingen konnte, all dies blieb ihm weiterhin verborgen. Eine erste Bestandsanalyse der irdischen Natur fiel schockierend aus. Als der ZWEITE im Jahr 1792, vom Haus des Müllermeisters Krohn aus, die Erde verlassen hatte, war die große Symbiose noch weitgehend intakt gewesen. Sechzehn Jahre zuvor hatten die nordamerikanischen Kolonien die Unabhängigkeit von England erklärt und einen eigenen Staat gegründet. Westlich dieses neuen Staates erstreckte sich, quer durch den Kontinent bis zum Pazifik, ein Gebiet von riesigen Ausmaßen mit einer weitgehend unberührten Natur. Der Vernichtungsfeldzug gegen die Natur in den USA, die Umwandlung der schier endlosen Grasprärien in öde Agrarsteppen, die Ausrottung der Bisonherden, die Vernichtung der Indianerstämme, all das gelang erst mit dem Bau der Eisenbahn. Die Dampfmaschine, der erste Motor, der die Kraft von Menschen und Pferden durch thermische Energie ersetzte, nahm ihren Siegeszug auf und mit ihr begann das Sterben der Großen Symbiose. Das durch die Dampfmaschine ausgelöste Vernichtungswerk fiel indessen in Europa noch weitaus dramatischer aus. Sümpfe und Moore, die damals noch weite Teile der nördlichen Hemisphäre bedeckt hatten, verschwanden zusehend durch Umwandlung in Ackerland. Alle größeren Flüsse wurden kanalisiert, die Urwälder bis auf winzige Reste vernichtet. Den gleichen Weg begannen ab den 1960er Jahren nun auch zahllose Staaten in Asien, Afrika und Südamerika einzuschlagen. Auch der Friedensprozess, den die Oxygods kurz zuvor noch als positives Zeichen registriert hatten, kam zusehends zum Erliegen. Stattdessen schossen neue Atommächte wie Pilze aus dem Boden: Indien, Pakistan, Israel, Nordkorea. Dutzende anderer Staaten arbeiteten fieberhaft daran, ebenfalls Atommacht zu werden. Nur mit Atomwaffen, so die Meinung vieler politischer Führer, würde man erst genommen. Der ZWEITE sah die Frist für die letzte Chance schwinden. Im Gegenteil: Die Gefahr eines Atomkriegs war seit seiner Ankunft im Jahr 2000 rapide gestiegen und inzwischen vielleicht sogar noch größer als zur Zeit des Kalten Krieges. Andererseits gab es Regionen relativer Stabilität und Friedfertigkeit, deren Regierungen das Militär am liebsten abgeschafft hätten und die dennoch reich und mächtig waren. War dieser Wohlstand nun das Ergebnis von Friedfertigkeit oder Friedfertigkeit das Ergebnis des Wohlstands? Diese Frage wollte der ZWEITE ergründen und erneut führte ihn sein Weg nach Mitteleuropa.
Petersen fragte verwundert:
Weil er hier am ehesten eine Antwort auf diese Frage zu finden hoffte? Ausgerechnet im alten Europa?
Ja. Die Europäer leben in relativem Wohlstand. Es gibt eine einflussreiche Umweltschutzbewegung, es herrscht seit 80 Jahren Frieden und ebenso lang ist kein Einer Kopf mehr aufgetaucht. Der ZWEITE versuchte den Grund dafür zu finden. Er beschloss, seine Untersuchung am Ort seines letzten Aufenthalts zu beginnen, in der Krohnmühle. Aus purer Neugier wollte er sehen, was aus dem Ort seines Abschieds von Goethe geworden war. Und wen traf er dort an? Einen gewissen Dr. Karl Petersen.
Aha! Wann war das?
Vor ziemlich genau fünf Jahren. Es war ein stürmischer, nasskalter Abend Ende Dezember, als er in dein Wohnzimmer kam. Und womit warst du gerade beschäftigt?
Woher soll ich das heute noch wissen? Nach fünf Jahren?
Du hast Goethe-Biografien studiert!
Stop! Ich erinnere mich. Es war kurz nach Weihnachten, das Wetter schlecht, und ich hatte endlich mal ein wenig Muße, in dem ganzen Goethe-Kram zu schmökern, den ich mir vor den Feiertagen besorgt hatte.
Und warum?
Ich wollte herausfinden, was es mit der Goethe-Gedenktafel im Flur auf sich hatte.
Genauso war´s. Der ZWEITE bemerkte deinen Eifer und begab sich in dein Gehirn. Dort machte er es sich einige Tage bequem. Am zweiten Tag nach seiner Ankunft hast du „Aus meinem Leben“ gelesen, genauer gesagt den zwölften Band von Goethes Erinnerungen. Du studiertest eine Passage, die lange Zeit nach einem denkwürdigen Ereignis entstanden war: Goethes Treffen mit Napoleon Bonaparte. Viele Jahre später erst brachte Goethe seine Erkenntnisse über diese Begegnung zu Papier. Erinnerst du dich noch an den Text?
Ehrlich gesagt nein.
Durch ihn ist der ZWEITE dem Geheimnis des Einen Kopfes auf die Spur gekommen. Dieser Text Goethes war das Missing Link, der letzte Baustein für das Modell von Wille und Möglichkeit.
Das Modell von Wille und Möglichkeit. Aha. Was war das nochmal? Die Voraussetzung zum Verständnis der geheimnisvollen Formel 35/60, stimmt´s?
Das ist richtig. Aber es ist noch mehr. Es beschreibt das Geheimnis der Macht.
Das Geheimnis der Macht! Seit heute früh passierten ständig unerklärliche Dinge. Warum also sollte Petersen nicht auch das Geheimnis der Macht erfahren? Was würde passieren, wenn er dieses Geheimnis kannte? Er begann innerlich zu vibrieren. Unter dem Eindruck der letzten Stunden stellte sich sein überreiztes Hirn ein gewaltiges, düsteres Geheimnis vor, das ihm nun exklusiv offenbart würde. Wie wäre das, wenn er allein dieses Geheimnis kannte? Wenn die Menschen vor Karl Petersens neuer Macht zu zittern begännen, ihm zu Willen sein müssten? Er ganze Armeen befehligen könnte? Eine dunkle Vorfreude erfasste ihn. Er hatte schon immer im Bewusstsein gelebt, etwas Besonderes zu sein. Ein Gefühl, so sicher, dass ihn die Rolle, die ihm nun von einer Höheren Macht zugedacht schien, im Grunde nicht mehr besonders überraschte. Wenn jemand für ein solches Projekt geeignet war, dann er. Ich, Karl, Kaiser und Gott. Eigentlich nur logisch, dass die Wahl auf ihn gefallen war. Ein Ton zerriss die Stille seiner hochfliegenden Gedanken. Ein Ton, den er seit Stunden nicht mehr gehört hatte und der ihm schon fast fremd geworden war. Petersens Handy ließ den hektischen Fanfarenstoß vernehmen, den er als Klingelton geladen hatte. Das Display zeigte das Symbol für eine unterdrückte Nummer an und dass es heute Sonntag um 15 Uhr 30 sei.
Petersen nahm ab.
Petersen.
Die Stimme am anderen Ende der Leitung mit ihrem Schweizer Tonfall klang etwas unsicher:
Herr, äh, Petersen? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, Dr. Karl Petersen.
Aha, Dr. Petersen. Mein Name ist Abbas Brukenthaler. Sie wissen, wer ich bin?
Ja, Sie sind der Generalsekretär der Vereinten Nationen.
Aha. Herr Petersen, kann es sein, dass Ihnen mein Anruf angekündigt wurde?
Genau, Ihr Anruf wurde mir angekündigt.
Aha. Und von wem, wenn ich fragen darf?
Tja, Herr Brukenthaler, das ist nicht so einfach zu beantworten. Vermutlich war es die gleiche, hmm, Person, die Ihnen meine Nummer gegeben hat.
Könnten Sie den Begriff Person vielleicht etwas präzisieren?
Petersen stand seit nunmehr zehn Stunden unter extremer Anspannung. Erst Oxygard, dann Steinzeit, dann Goethe. Dazwischen endlose komplizierte Vorträge des Vertreters einer Höheren Macht. Die Bilder, die ihm dieses Wesen seit sechs Uhr früh ins Hirn spielte, waren mehr, als eine normale menschliche Seele verdauen konnte. Zum Glück traf das Attribut „normale menschliche Seele“ auf Petersen nur bedingt zu. Dennoch schien er heilfroh über Brukenthalers Anruf zu sein. Der erste richtige Mensch seit Stunden. Brukenthaler schätzte er als vernünftig ein. Er kannte ihn aus unzähligen Medienauftritten. Der UN-Generalsekretär schien intelligent, integer, greifbar. Ein Seelenverwandter, ein Mensch. Nicht so ein unfassbarer Untoter wie Theo der ZWEITE, kein Abgesandter und Vasall einer extraterrestrischen Macht. Obwohl er sich mit dessen Existenz abgefunden hatte - so richtig begreifen konnte er das Phänomen noch immer nicht. Nicht, solange noch ein Fünkchen Hoffnung auf Normalität in Form eines Herrn Brukenthaler bestand. Konnte ein UN-Generalsekretär, sofern es sich bei dem Anrufer tatsächlich um diesen handelte, die Sache aufklären? Konnte er ihn aus dieser Lage befreien? Andererseits: Wollte er überhaupt befreit werden? Der Ausflug in die Steinzeit hatte ihn verändert. Er spürte, dass die Oxygods, wenn es sie denn tatsächlich gab und die Unterredungen mit ihrem Stellvertreter keine Launen seines eigenen Hirns waren, im Grunde recht hatten. Die Menschheit befand sich auf Kollisionskurs mit ihrer eigenen Welt. Aber aus eigener Kraft würde sie nicht gegensteuern können. Nur ein Gott könnte vielleicht die Macht dazu haben. Petersen fand zunehmend Gefallen an der Idee, bei der kommenden Neuordnung der Welt nicht nur zuzuschauen, sondern im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen. Das Wissen um das Geheimnis der Macht war ihm in Aussicht gestellt worden. Er hatte zwar noch keinerlei Ahnung vom Was und Wie der neuen Weltordnung, aber er hätte vielleicht die Chance, ihr Gesicht zu sein. Hätte, wäre, wenn. Wenn das nur mal keine Fata Morgana war. Er machte einen letzten Versuch, zur Normalität zu finden. Er würde nun einfach auspacken, auch auf die Gefahr hin, als verrückt zu gelten. Was war Brukenthalers letzte Frage gewesen? Er solle den Begriff "Person" präzisieren?
Nun, Herr Brukenthaler, vielleicht sollten wir nicht länger um den heißen Brei herumreden. Ich werde seit heute Morgen mit unerklärlichen Phänomenen konfrontiert. Eine, nennen wir sie mal ganz allgemein ungewöhnliche Lebensform, ein Mensch, der vor einem Jahr nachweislich starb und jetzt als eine Art Götterbote hier auftaucht, behauptet seit einigen Stunden, dass mich in Kürze der Generalsekretär der Vereinten Nationen anrufen wird - was im Moment ja auch geschieht. Außerdem sehe ich Traumbilder, die ich als absolut real empfinde. Es gibt nun zwei Möglichkeiten: Entweder ist das Ganze eine abgekartete Sache, ein Komplott gegen mich oder meine Partei, und man hat mir halluzinogene Drogen verabreicht, damit ich mir all das nur einbilde. In diesem Fall wären Sie, sofern ich mir auch Ihren Anruf nicht einbilde, Teil eines Komplotts. Das wäre die einfachere Lösung. Falls Ihr Anruf aber nicht Teil dieses Komplotts wäre, sondern andere Gründe hätte, dann, Herr Brukenthaler, hätten wir beide ein Problem. Also, woher haben Sie meine Nummer?
Brukenthaler zögerte einen Moment. Dann räumte er ein, dass diese Frage kaum seriös zu beantworten sei, und fuhr fort:
Wenn ich es dennoch versuche, muss ich zugeben, Ihre Nummer geträumt zu haben. Ich erwachte heute Morgen mit der Gewissheit, dass ich Ihre Telefonnummer anrufen müsse. Verstehen Sie das? Verstehen Sie auch, welche Konsequenzen daraus erwachsen könnten? Deshalb muss die erste Frag lauten: Welche Informationen haben Sie, die ich nicht habe?
Petersen musste innerlich grinsen. Wie es aussah, saßen sie beide im gleichen Boot. So sachlich wie möglich berichtete er nun über die Ereignisse der letzten Stunden und beschränkte sich zunächst nur auf die Fakten: Wie er, als er heute Morgen erwachte, einen bereits verstorbenen Mandanten in seinem Schlafzimmer vorgefunden hatte. Er berichtete von der Patrone, die sich sein Besucher selbst in den Kopf geschossen hatte, vom Kaffee, der durch seinen Körper hindurch tropfte, und wie er sich schließlich in sein Gehirn verabschiedet hatte. Um Brukenthaler nicht zu überfordern, behielt er das, was man ihm während seines virtuellen Besuchs in Oxygard von der Rolle der Oxygods bei der Entstehung des Universums erzählt hatte, erst einmal für sich. Detailliert beschrieb er hingegen das Wesen dieser unsichtbaren Lebensform, ihre Beziehung zum Sauerstoff, und die Lex Vitae, welche sie zum Schutz sämtlicher Lebewesen verpflichtete. Dann kam er zum Kern des Ganzen, den Dominanten Arten, die als eine Fehlentwicklung angesehen würden. Sie stünden daher nicht unter dem Schutz der Lex Vitae und ihr Vorhandensein gestatte den Oxygods die Sauerstoff-Extraktion aus der Atmosphäre belebter Planeten. Danach berichtete er von der Mission Theos des ZWEITEN und der Rolle, die er ihm, Karl Petersen, dabei zugedacht hatte.
Brukenthaler hörte schweigend zu. Am Ende wollte er lediglich wissen, ob es irgendwelche Beweise für diese Geschichte gäbe. Keine, antwortete Petersen wahrheitsgemäß. Genau das hatte Brukenthaler befürchtet. Schwer atmend dachte er nach. Schließlich fuhr er in überraschend gefasstem Ton fort:
Trotzdem weiß ich, dass Sie die Wahrheit sagen. Ist dieses Phänomen, äh, diese Verbindung aus dem verstorbenen Theo Würtz und dem Oxygod namens der ZWEITE, wie Sie es nennen, schon mal anderswo öffentlich in Erscheinung getreten? In irgendeiner Form? Gibt es Berichte von übersinnlichen Wahrnehmungen, die man diesem Phänomen zuordnen könnte?
Petersen überlegte, ob er von der Begegnung des ZWEITEN mit Schnakenbein erzählen sollte. Doch das würde vermutlich die Sache nur noch komplizierter machen. Und so sagte er, davon sei ihm nichts bekannt. Doch Brukenthaler insistierte weiter:
Und dieser Theo Würtz, in dessen Gestalt der ZWEITE Ihnen erscheint, wie muss ich mir den vorstellen? Könnte man wenigstens den mal zu Gesicht kriegen?
Bestimmt. Schauen Sie im Internet nach. Sie finden haufenweise Bilder und Youtube-Videos von ihm. Er war so eine Art Popstar.
Ein toter Popstar, der wieder lebendig geworden ist, um die Welt vor der Vernichtung durch Außerirdische zu retten. Mit Ihrer Hilfe, versteht sich, dem Vorsitzenden der Partei des gesunden Menschenverstands. Klingt irgendwie nicht wirklich überzeugend, oder?
Petersen musste lachen.
Vielleicht tröstet es Sie, dass der ZWEITE auf unserer Seite ist und uns helfen will, die Welt vor dem DRITTEN zu retten.
Das macht´s auch nicht besser. Gibt es denn einen Plan, irgendwelche Forderungen?
Er möchte, dass Sie eine UN-Vollversammlung einberufen, in der er, beziehungsweise ich, unser Anliegen vorstellen kann.
Soso. Eine UN-Vollversammlung soll ich einberufen. Mit welcher Begründung? Weil der Vorsitzende der Partei des gesunden Menschenverstands Halluzinationen hat? Weil mir seine Telefonnummer im Traum erschienen ist? Wie soll das vonstatten gehen, wenn es keine Beweise für die Existenz dieses Phänomens gibt?
Petersens beschlich das Gefühl, so nicht weiter zu kommen. Jemand anders schien ähnlich zu empfinden. Petersens Stimme nahm plötzlich eine andere, höhere Klangfarbe an. Auch der Tonfall wurde spitzer, irgendwie frecher, als er sagte:
Nun, Herr Brukenthaler, wenn ich richtig informiert bin, logieren Sie derzeit im Hotel Beaurivage am Comer See. Ihre Suite hat einen Balkon mit Seeblick.
Woher …
Uninteressant. Stellen Sie sich ans Fenster. Was sehen Sie?
Brukenthaler stellte sich ans Fenster und sah auf den Balkon. Er erstarrte.
Mein Gott …
Sie sehen so was Weißes, stimmt´s?
Aber, das ist doch nicht …
Ja, schauen Sie nur. Jetzt nimmt es Formen an!
Ah! Aahhhhh!!!
Kommt Ihnen bekannt vor, nicht? Erinnert Sie an jemanden, stimmt´s?
COMO II
Abbas Brukenthaler stand wie vom Donner gerührt in seiner Suite. Auf Petersens Wunsch hatte er sich an die Balkontür gestellt und zum Fenster hinausgesehen. Die prominente Lage des etwa drei mal fünf Meter großen Balkons an der Südwand des Hotels mit seinem Boden aus witterungsbeständigem Tropenholz ermöglichte normalerweise einen phantastischen Blick über den See. Doch Brukenthaler bot sich momentan ein gänzlich anderes Schauspiel. Im fahler werdenden Nachmittagslicht formte sich genau in der Mitte der Balkonfläche, wie aus dem Nichts, eine weißschimmernde Säule von nebelhafter Konsistenz. Als sie etwa Mannshöhe erreicht hatte, bildeten sich plötzlich Konturen heraus. Eine menschliche Figur zeichnete sich ab, mit Kopf, Armen, Beinen, Rumpf, alles in nebelhaftem Weiß, als sei sie aus schneeigem Eis gemacht. Allmählich wurden Gesichtszüge erkennbar. Die Konturen nahmen an Schärfe zu, das Eis wurde immer klarer und bald war die Gestalt eines mittelgroßen, schlanken Mannes erkennbar. Die Körperhaltung von lässiger Eleganz, eine Hand in einer imaginären Hosentasche aus blankem Eis. Das schmale Gesicht mit den ausdrucksvollen Augen, dem vollen Mund, dem kantigen Kinn und der hohen Stirn wirkte lebhaft und intelligent. Jetzt verzog sich der Mund zu einem fröhlichen Lächeln. Brukenthaler, der sein Handy weiterhin ans Ohr gepresst hielt, vernahm Petersens Stimme nur noch als Hintergrundrauschen. Doch bei der Frage, an wen ihn die Figur erinnere, erschrak er fast zu Tode. Durch die Fensterscheibe lächelte ihm sein eigenes Spiegelbild entgegen, aus blankem Eis geformt, frei auf dem Balkon stehend. Zu seinem Entsetzen begann der Eis-Mann ihm zuzuwinken. Doch als er den Arm in die Höhe bewegte, brach dieser auf halbem Weg ab und zerbarst auf den Balkonbrettern. Sogleich begann die Figur in rasantem Tempo zu schmelzen und sich in Wasser zu verwandeln. Das war zu viel. Brukenthalers Herzrasen ging in unkontrolliertes Zittern über. Er schrie nach Hilfe.
Franck, Franck, wo sind Sie? Herkommen, sofort!
Das Handy warf er weg und stemmte sich gegen die Balkontür, als sei zu befürchten, sein zerrinnendes Ebenbild wolle das Zimmer stürmen.
Die Tür zum Vorraum flog auf und Franck O´Brian, Brukenthalers oberster Personenschützer, stürmte herein. Der baumlange Ire rannte zur Balkontür und stellte sich schützend vor seinen Chef. Gerade noch sah er die letzten Reste des Eismanns schmelzen. Nur die Bruchstücke des Arms waren seltsamerweise noch intakt. Franck öffnete vorsichtig die Balkontür und betrachtete stirnrunzelnd die Hand aus blankem Eis, die so erschreckend der seines Chefs ähnelte.
Wer war das?
Ich.
Sie? Wieso Sie? Ich meine, wer hat das gemacht? Wer hat diesen Eisklotz auf den Balkon gebracht? Wer hat diese Hand abgeformt? Das waren doch nicht Sie!
Allmählich gewann Brukenthaler seine Fassung wieder. Niemand, auch nicht eine Vertrauensperson wie Franck, durfte zu diesem Zeitpunkt etwas von Außerirdischen erfahren. Verlegen stotterte er herum und war erleichtert, als Franck davonrannte, um sein Handy zu holen, mit dem er den Rest der Eishand fotografieren wollte. Doch als er zurückkam, war sie bereits zusammen mit den anderen Resten des Eismanns durch die Ritzen der Balkonbretter gesickert.
Brukenthaler gab sich einen Ruck:
Bestimmt gibt es eine natürliche Erklärung dafür.
Die wüsste ich gerne.
Naja, Flugzeuge verlieren manchmal solche Eisklumpen.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752136883
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (März)
- Schlagworte
- Weltanschauung Klimawandel Natur Erderwärmung