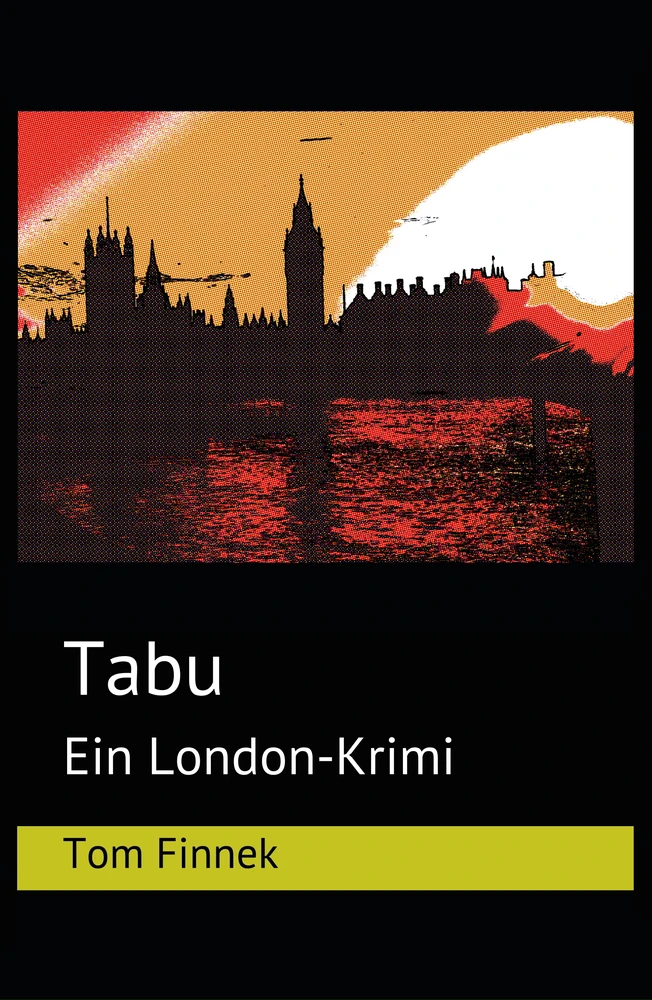Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
–
Im Jahr 1997 erschien – unter dem Namen Mani Beckmann – mein Berlin-Krimi »Tabu« bei »Klein und Blechinger«, einem Verlag aus dem Rheinland, der damals vor allem auf regionale Kriminalromane und weniger auf Großstadtkrimis spezialisiert war. Der Erfolg war entsprechend bescheiden, das Buch verschwand leider allzu bald wieder in der Versenkung, und der Roman ist heute nur noch antiquarisch erhältlich.
Viele Jahre später, während meiner Vor-Ort-Recherche zu einer historischen London-Trilogie – inzwischen unter dem Pseudonym Tom Finnek – kam mir der Gedanke, ob eine recht eigenwillige und mir sehr ans Herz gewachsene Berlin-Geschichte wie »Tabu« auch in einer anderen Stadt und einem anderen Land funktionieren würde. Zum Beispiel in London.
So begann eine schriftstellerische Spielerei, denn während ich die historischen Romane schrieb und in das London vergangener Jahrhunderte eintauchte, entstand gleichzeitig eine heutige London-Version meines Berlin-Krimis. Aus Kreuzberg und Neukölln wurden die City of London und das East End, und ein Abstecher nach Nordfriesland führte nun auf die Isle of Wight. Doch mit dem Austausch der Orte und Örtlichkeiten war es natürlich nicht getan. Die Geschichte und die Figuren bekamen plötzlich eine ganz eigene Dynamik und Atmosphäre, obwohl der Plot und somit auch die Auflösung des Kriminalfalls unverändert geblieben sind.
Der vorliegende Kriminalroman ist das Resultat dieser Spielerei und zugleich ein Experiment. Ob es gelungen ist, überlasse ich dem Urteil der geneigten Leserinnen und Leser. Auf jeden Fall wünsche ich viel Spaß und Spannung in London.
Tom Finnek (alias Mani Beckmann)
Erstes Buch – George
–
»No one’s gonna save your life.
Something strange is going on tonight.«
Wire, »Strange«
–
1
Es war einer dieser Tage, an denen man schon beim Aufstehen ahnt, dass die Mühe nicht lohnt. Ich hatte einige solcher Tage in der letzten Zeit erlebt, ich kannte mich aus. Beim Zähneputzen schaut einen ein knittriges Gesicht aus dem Spiegel an, das man erst nach wiederholtem Hinsehen als das eigene erkennt. Der Kaffee, den man sich zum Frühstück aufsetzt, ist ein bitterer Schlag in die Magengegend, und im Briefkasten findet sich außer der Stromrechnung nur Werbung für einen Pizzaservice. Mit einem Geschenkbon für eine Extra-Portion Peperoni.
Es war eben einer dieser Tage: Mittwoch, der 10. Juli. Ich hatte es mir hinter meinem Schreibtisch gemütlich gemacht und blätterte lustlos in einer Zeitschrift, als es unten an der Haustür klingelte. Schwerfällig nahm ich die Füße vom Schreibtisch – gar nicht so einfach, wenn sie erst mal zwei Stunden so gelegen haben –, versuchte, meinen Kopf, der ebenso lange auf der Stuhllehne geruht hatte, wieder dorthin zu bekommen, wo er normalerweise saß, und ging zur Wohnungstür.
»Ja?«, grunzte ich in die Gegensprechanlage und bekam als Antwort ein männlich knappes »Sind Sie der Privatdetektiv?« Ich öffnete die Wohnungstür. An der Außenseite hing ein schwarzes Metallschild mit einer weißen Aufschrift: »George Ingram. Private Ermittlungen.« Ich drückte erneut auf die Sprechanlage und sagte: »Ja, der bin ich. Kommen Sie rauf. Zweiter Stock.«
Ich ließ die Tür geöffnet, ging zurück in mein Arbeitszimmer und schaute mich um. Viel zu leer und viel zu ordentlich für ein Büro! Zwei Regale an den Wänden, beide leidlich gefüllt. Weil ich nicht genug Gesetzeswälzer, Enzyklopädien und Kriminalstatistiken besessen hatte, hatte ich sie mit Romanen aufgefüllt. Kriminalromane immerhin.
Auch der Schreibtisch sah nicht so aus, als würde viel daran gearbeitet. Der Schein entsprach durchaus der Wahrheit. Ich nahm ein paar leere Briefbögen, zerknüllte sie und warf sie in und neben den Papierkorb und verteilte ein paar Zettel hübsch unordentlich auf dem Schreibtisch. Bevor ich mich setzte, warf ich einen Blick in den Spiegel, der hinter dem Schreibtisch zwischen den beiden Fenstern hing. Ich hatte dringend eine Rasur nötig, und ein Besuch beim Friseur konnte auch nicht schaden.
Mittlerweile waren Schritte im Treppenhaus zu hören, dann das Knarren der Wohnungstür, dann Geraschel an der Garderobe. Und schließlich kam mit einem blonden Hünen ein lässiges Grinsen und ein penetranter Gestank zur Bürotür herein. Frisch parfümiert und nicht zu knapp! Ein Duft für selbstbewusste, leicht ergraute Mittvierziger mit Chancen bei älteren Damen. Der Typ war etwa 40 Jahre alt und hatte gute Karten bei Frauen, nicht nur bei älteren. Marke: Richard Gere für Anspruchslose. Sein Eau de Toilette kannte ich, es hieß »Prudence«. Eine Freundin hatte es mir einmal zum Geburtstag geschenkt. Ich hatte danach nie wieder ein Wort mit ihr gesprochen.
Seitdem ich mir vor einigen Monaten das Rauchen abgewöhnt hatte, reagierte ich allergisch auf üble Gerüche jeder Art. Und gerade bei Duftwässerchen war meine Nase penibel. Ich rümpfte sie andeutungsweise und sagte: »Guten Tag.«
Er sagte nichts, ging zum Regal neben der Tür und fischte sich ein Buch heraus. Er erwischte einen Roman und fragte: »Sie lesen?«
»Seit der Grundschule, aber nur wenn’s keiner sieht.«
Ich zwang mich zu einem Grinsen, das er mit einem abfälligen Schnaufen quittierte. Er stellte das Buch wieder ins Regal und kam im Schlendergang zum Schreibtisch. Er betrachtete mich mit dem gleichen Interesse, mit dem man einen gebrauchten Kaffeefilter im Mülleimer zur Kenntnis nimmt, und schwang sich in den Sessel, der neben ihm stand. Sitzend sah er gar nicht mehr so riesig aus, er schien geschrumpft zu sein, wahrscheinlich hatte er Spinnenbeine. Gelangweilt zog er ein goldenes Zigarettenetui aus der Jackentasche.
»Dies ist ein Nichtraucher-Zimmer«, sagte ich vorsorglich. Zum ersten Mal hatte sein hübsches Gesicht mehr als nur einen selbstgefälligen Ausdruck, er wirkte ehrlich erstaunt.
»Ein nicht rauchender Privatdetektiv?« Er konnte es kaum fassen und schüttelte seinen frisch gefönten Blondschopf. »Sie entsprechen nicht gerade dem Klischee, das man so von Detektiven hat.«
Ich verschwieg, dass er seinem Klischee sehr wohl entsprach, und beließ es bei einem Achselzucken. Noch immer machte er keine Anstalten, gesprächig zu werden, er ließ mir Zeit, ihn zu begutachten. Trotz sommerlicher Mittagshitze trug er Anzug und Krawatte, beides in leuchtenden Farben. Während ich schon beim Anblick seiner Garderobe ins Schwitzen geriet, schienen ihm die Temperaturen nichts auszumachen. Kein Anzeichen von Feuchtigkeit auf seiner Stirn. Allerdings schimmerten seine blassblauen Augen wässrig, als würde er gleich losheulen. Aber wahrscheinlich hatte er schon seit seinem dritten Geburtstag nicht mehr geweint. Nicht in der Öffentlichkeit.
Seine Augen waren stets in Bewegung und blitzten herausfordernd, seine breite Nase und sein Kiefer traten markig hervor. Wenn er lächelte, sah man seine sehr weißen Schneidezähne. Aber er lächelte nicht. Er hatte sich unter Kontrolle. Der Gesamteindruck des energischen, zielstrebigen Machers war antrainiert und saß perfekt.
»Mein Name steht draußen an der Tür«, wagte ich das Schweigen zu stören. »Und wie heißen Sie?«
Wieder sagte er nichts und schob mir stattdessen seine Visitenkarte rüber. Darauf stand: »Das Grauen hat einen Namen: Dungeon Editions Limited. Horror- und Science-Fiction-Literatur.« Darunter eine Adresse an der Bankside und mehrere Telefonnummern. Und schließlich: »Verlagsleiter: Henry Woodlawn.«
»Guten Tag, Mr. Dungeon«, sagte ich und schnippte an der Karte. »Ich hoffe, Sie wollen mir keine Gruselgeschichten aufschwatzen.«
»Sie sind ein Witzbold, was?«, sagte er und lächelte nachdenklich. »Nein, um einen Horror-Roman handelt es sich nicht, eher schon um einen billigen Groschenroman.« Er trommelte mit den Fingern auf dem Zigarettenetui, das er nach wie vor in der Hand hielt. »Ich brauche einen zuverlässigen und verschwiegenen Mann.«
»Ich soll Ihre Frau beschatten«, folgerte ich aus seinem Herumdrucksen, es war wirklich nicht schwer zu erraten. Zwar war ich noch nicht sehr lange im Gewerbe tätig, genau genommen erst seit einem knappen Jahr, aber ich hatte bereits die ernüchternde Erfahrung gemacht, dass Privatdetektive, anders als in Romanen, hauptsächlich von Ehekrisen und Eifersuchtsanfällen lebten. Meine Folgerung war also keineswegs so gewitzt, wie sie vielleicht erschien. Vor allem da man diesem Woodlawn ansah, dass er Konkurrenz, welcher Art auch immer, nicht ausstehen konnte.
»Meine Frau?«, murmelte er überrascht, zögerte eine Sekunde und fügte hinzu: »Beschatten ... ja, so ungefähr.« Er klappte das Etui auf und wieder zu. »Vorausgesetzt Sie sind diskret und verschwiegen. Die Sache ist ein wenig heikel.« Er sah mich plötzlich scharf an. »Sind Sie verlässlich?«
»Ich war mal Detective Sergeant bei der Metropolitan Police«, entgegnete ich, um nicht mit Ja oder Nein antworten zu müssen.
»Das spricht eher gegen Sie. Sind Sie gefeuert worden?«
»Auf eigenen Wunsch aus dem Dienst geschieden«, antwortete ich wahrheitsgemäß. »Zu viel langweilige Büroarbeit, zu wenig Abenteuer und Action.« Das war nun allerdings gelogen, schließlich war es nicht die Schreibtischarbeit gewesen, die meinen Wagen vor gut zwei Jahren in einen Schrotthaufen verwandelt und mir, wenn schon nicht das Leben, so doch die Lust aufs Polizistendasein genommen hatte. Aber ich hatte keine Lust, mit Woodlawn über meine unrühmliche Vergangenheit zu reden, das Thema war mir schlicht zu intim, darum fragte ich: »Wie sind Sie überhaupt auf mich gekommen?«
»Ich wohne auf der anderen Straßenseite, genau im Haus gegenüber. Ihre Detektei war im wahrsten Sinn des Wortes nahe liegend.«
Ich stand auf, nahm meine Brille von der Nase, putzte sie gewissenhaft mit einem Papiertaschentuch, setzte sie wieder an Ort und Stelle, ging zum Fenster, sah hinaus und fragte: »Hausnummer?«
»Fünfundsiebzig.«
Das Haus stand tatsächlich exakt gegenüber meines bescheidenen Domizils. Neubau, roter Klinker, sehr hässlich und bestimmt sehr teuer! Wie alles in der Londoner City.
»Welcher Stock?«, fragte ich, ohne mich umzudrehen.
»Dritter.«
»Rechts oder links vom Treppenhaus?«
»Von hier aus gesehen ...« Er überlegte. »Rechts.«
Obwohl seine Wohnung ein Stockwerk höher lag als mein Büro, konnte ich Teile der Zimmer recht gut einsehen. Ich fragte: »Ihre Küche ist gelb gestrichen?«
»Exakt.«
Ich drehte mich wieder zu ihm um und setzte mich. Er hatte sich nicht bewegt, aber seinem Gesicht war abzulesen, dass er sich entschieden hatte. Ich hatte diesen Job. Der erste Auftrag, den ich dem Hinweisschild an der Haustür zu verdanken hatte.
»Was soll ich nun genau für Sie tun?«
»Meine Frau geht jeden Mittwoch um Punkt halb neun zum Badminton. Vor sechs Wochen hat sie urplötzlich diesen Drang zu sportlicher Aktivität entwickelt, dabei war ihr vorher schon der sonntägliche Spaziergang durch den Postman’s Park zuviel. Sie ist eigentlich kein besonders sportlicher Typ. Hin und wieder ein wenig Yoga im Wohnzimmer, wenn Sie wissen, was ich meine.«
Ich glaubte zu wissen, was er meinte, und grinste.
»Und plötzlich Badminton.« Er schüttelte den Kopf. »Ich glaube jedenfalls, dass der hochrote Kopf, mit dem sie mittwochs anschließend nach Hause kommt, nicht vom Herumhopsen in irgendeiner Turnhalle herrührt.«
»Haben Sie einen Grund für diesen Verdacht?«
Er sah mich ungläubig an, verstand die Frage offensichtlich nicht. »Meine Frau ist ziemlich schön, ausnehmend schön. Das weiß und zeigt sie.« Er stockte und wurde leicht rötlich unter seiner Sonnenbräune. »Und die Männer wissen das auch.«
Ich begnügte mich mit einem anerkennenden »Aha!« und unterließ es, seine Eifersucht zu hinterfragen.
»Ich liebe meine Frau«, sah er sich genötigt hinzuzufügen.
»Aber Sie misstrauen ihr«, entgegnete ich.
Er schwieg.
»Wie heißt Ihre Frau?«
»Eleanor.«
»Und wie alt ist sie?« Ich musste ihm jede Kleinigkeit aus der Nase ziehen, eine Quasselstrippe war Henry Woodlawn wahrlich nicht.
»Fünfundzwanzig.«
»Aha!«, entfuhr es mir erneut, in Gedanken fügte ich hinzu: Und noch ein Klischee! Laut sagte ich: »Kinder?«
Er schüttelte den Kopf und schwieg, er schien nachdenklich. Wahrscheinlich malte er sich gerade in grellsten Farben aus, was seine hübsche Eleanor statt eines Badmintonschlägers (ohne sein Wissen) sonst so alles in die Hand nahm.
»Seit wann sind Sie verheiratet?«
»Seit drei Jahren, aber warum interessiert Sie das alles? Das tut doch gar nichts zur Sache.« Er wurde plötzlich unruhig, rutschte im Sessel hin und her und meinte schließlich: »Ich möchte, dass Sie sie heute Abend beobachten, nachdem sie das Haus verlassen hat. Ich muss wissen, was ...« Er ließ den Satz unbeendet.
Ich sah auf den Kalender. »Warum gerade heute? Warum nicht nächste Woche? Warum nicht vor einem Monat?«
»Ich hab eben so ein Gefühl.« Er sah zu Boden und rieb sich die Hände. »Gestern hab ich Eleanor gefragt, ob sie heute mit ins Theater kommen will. Sie wollte nicht. Ich hab gesagt, so wichtig sei das Badminton doch nicht, ich hätte durch Zufall und Glück zwei Karten fürs Theatre Royal in der Drury Lane bekommen. Irgend ein avantgardistisches und ständig ausverkauftes Musical, sie mag so was eigentlich. Aber sie hat behauptet, sie müsse unbedingt zum Sport. Unter allen Umständen.« Er sah mich an und fügte ganz leise hinzu: »Ich glaube ihr nicht.«
»Sind Sie selbst Ihrer Frau mittwochs schon einmal gefolgt?« Eigentlich eine naheliegende Frage, aber er glotzte mich entsetzt an.
»Wofür halten Sie mich?«
Ich gab ihm keine Antwort. Schließlich wollte ich ihn nicht beleidigen. Henry Woodlawn kramte mittlerweile in seiner Jackentasche herum und zog einen Briefumschlag heraus. Er zögerte einen Moment, dann fingerte er in dem Kuvert herum und brachte zwei Zettel zum Vorschein. Wieder ein kurzes Zögern und ein misstrauischer Blick in meine Richtung.
»Sie haben mich vorhin gefragt, ob ich einen Grund für meinen Verdacht habe«, sagte er und reichte mir einen der beiden Zettel aus dem Kuvert. »Was halten Sie davon?«
Bei dem Zettel handelte es sich um die Fotokopie eines offensichtlich zerknüllten, nicht beendeten, in Frauenhandschrift geschriebenen Briefes mit folgendem Wortlaut: «Mein Schatz, bitte jage mir nie wieder einen solchen Schrecken ein. Sosehr ich mich über deine Nachricht gefreut habe, was wäre wohl passiert, wenn Henry den Zettel unter der Wohnungstür gefunden hätte. Ich darf gar nicht«
Der Brief endete mitten im Satz und war logischerweise nicht unterschrieben. Außer der Anrede »Schatz« war an diesen Sätzen wenig Verfängliches zu entdecken. Vielleicht ging es ja lediglich um ein Geburtstagsgeschenk für Henry Woodlawn, und die mysteriöse Nachricht, auf die sich der Brief bezog, lautete: »Hab den goldenen Füllfederhalter für Henry besorgt. Gruß, Jenny.« Als ich Woodlawns Gesicht sah, wusste ich, dass er keinesfalls eine Geburtstagsüberraschung vermutete. Ich fragte: »Die Handschrift Ihrer Frau?«
Er nickte und fügte vorsichtig hinzu: »Ich habe das Original zu der Fotokopie im Papierkorb gefunden.« Er sah zu mir herüber und wartete. Vielleicht auf eine bissige Bemerkung, mir fiel aber keine ein. Sosehr ich mich auch anstrengte.
»Die Nachricht, von der Ihre Frau spricht, haben Sie nicht zufällig gefunden?« Ich schielte auf das Kuvert in Woodlawns Hand.
»Doch«, entgegnete er und gab mir den zweiten Zettel aus dem Briefumschlag und fügte bedeutsam hinzu: »Eine codierte Botschaft.«
»Auch aus dem Papierkorb?«
Anstatt zu antworten, wurde er rot. Das war mir Antwort genug.
Auch dieser Zettel war eine Fotokopie, wahrscheinlich hatte Woodlawn die Originale zu Hause fein säuberlich hinter Klarsichtfolie in einem Aktenordner abgeheftet, auf dessen Rücken zu lesen war: »Verdachtsmomente«.
Die Nachricht war maschinengeschrieben und lautete:
»Mein Goldkäfer,
†68*5-4;96;†6(45;96-4)80633895-4;
6-426*69469980†?26);986*8*380
6-406828†6-4
F. W. Plumpe, Santa Barbara«
»Kennen Sie diesen Plumpe?«, fragte ich.
»Sie glauben doch nicht im Ernst, dass das sein wirklicher Name ist.« Er sah mich kopfschüttelnd und vorwurfsvoll an.
»Und warum Santa Barbara? « Ich bestaunte erneut die seltsame Botschaft auf dem Papier. »Sie können nicht zufällig etwas mit diesem Unsinn anfangen?«
»Sie sind doch der Detektiv!«
»Gut, dass Sie mich daran erinnern.« Ich steckte die beiden Zettel in die Schreibtischschublade und fragte: »Haben Sie ein Foto von Ihrer Frau dabei?«
»Foto?« Er war verdutzt. »Nein, wieso?«
»Ich soll Ihre Frau beschatten, ohne zu wissen, wie sie aussieht?«
»Sie brauchen kein Foto.« Nun stand er auf und ging zum Fenster. Aus dem sitzenden Zwerg war wieder ein stehender Riese geworden. Während er mit der Hand aus dem Fenster deutete, betrachtete ich seine Beine. Selten zuvor hatte ich solche Stelzen gesehen.
»Sie verlässt die Wohnung immer um halb neun und trägt einen lilafarbenen Trainingsanzug. Und dazu ein knallgelbes Stirnband. Sie können sie gar nicht verpassen, wenn Sie nicht blind sind wie ein Fisch.«
Mein Einwand, Fische seien im Regelfall nicht blind, konnte ihn nicht erheitern. Er schaute immer noch aus dem Fenster, sein Kiefer mahlte unruhig. Mit der linken Hand spielte er an einem Jackenknopf herum, die rechte steckte in der Hose.
»Wo ist diese Sporthalle?«
»In der Carter Lane, hinter St. Paul’s, unten am Fluss. Eleanor geht zu Fuß dorthin. Ist ja nicht weit.«
»Beschreiben Sie bitte Ihre Frau. Ihr Äußeres.«
»Sie hat lange braune Haare, lockig. Sie ist klein, nur etwas mehr als fünf Fuß, und sehr schlank.« Er sah mich an und lächelte. »Sie grinst ständig und lacht sehr viel. Ihr Mund ist ziemlich groß.« Flüsternd, als würde er etwas sehr Intimes von ihr verraten, setzte er hinzu: »Sie hat ein großes Muttermal auf der rechten Wange.«
Ich fasste in Gedanken zusammen: Ein hübsches Muttermal in lila Trainingsanzug mit gelbem Stirnband. Ich hatte schon weniger auffällige Personen beschattet. Ein Teleskop würde ich für diesen Job kaum benötigen.
Ich sah an ihm vorbei durchs Fenster, versuchte in seiner Wohnung jemanden zu erspähen. Nichts rührte sich. Ich fragte: »Ihre Frau ist nicht zu Hause?«
»Sie arbeitet. Im Verlag.« Sein rechter Mundwinkel ging in die Höhe, und er zog die Nase kraus. Kaum sichtbar. »Sie ist so was wie ein Mädchen für alles, hauptsächlich Vertrieb und PR.«
Die hübsche, lächelnde Frau des Chefs, nützlich bei geschäftlichen Treffen und Essen. Zur Auflockerung der Atmosphäre. Und nebenbei immer unter Beobachtung der Argusaugen ihres Mannes. Ich hatte zwar kein Foto, wohl aber ein ziemlich deutliches Bild von Eleanor Woodlawn.
»Wegen der Bezahlung …«, versuchte ich das Geschäftliche einzuläuten.
»So teuer wird ein Abend mit Ihnen schon nicht sein«, unterbrach er mich mit einem gekünstelten Lächeln auf den Lippen und zeigte seine weißen Zähne. Er zog einen Scheck aus der Jackentasche und legte ihn auf den Schreibtisch. Ein Barscheck, unterschrieben, ohne Angabe eines Geldbetrages. »Sie werden mich schon nicht übers Ohr hauen.«
»Seien Sie sich da nicht so sicher«, sagte ich scherzend.
Er verstand keine Scherze und sagte: »Ich bin mir da ganz sicher!« Er ging wieder um den Schreibtisch herum, bückte sich und nahm eines der zerknüllten Papiere vom Boden. Er faltete es auseinander und sah, dass es leer war. Er warf mir einen Blick zu, der »Oh!« ausdrückte. Meine Grimasse antwortete ihm: »Sehen Sie!«
Er grinste abfällig und ging zur Tür.
»Keine weiteren Instruktionen?«, rief ich ihm hinterher.
»Sie schaffen das schon«, antwortete er gütig, »wie ich sehe, haben Sie ja Fantasie und Humor. Wenigstens in dieser Hinsicht entsprechen Sie der Vorstellung, die ich von Privatdetektiven habe.«
»Sie lesen die falschen Bücher«, sagte ich und stand auf, höflich wie ich war, um ihn hinauszugeleiten.
»Nein«, antwortete er, »ich veröffentliche sie.« Er hielt nicht viel von Höflichkeit und verließ das Zimmer, ohne sich umzudrehen oder sich zu verabschieden. Aus dem Flur hörte ich ihn lediglich sagen: »Ich rufe Sie morgen an.«
Ich machte keine Anstalten, ihm hinterherzueilen, und setzte mich wieder. Die Wohnungstür knallte. Weg war er. Nur sein Geruch hing noch in der Luft. Ich öffnete ein Fenster, um mit dem Gestank der Straße den Gestank in meinem Zimmer zu übertünchen. Als ich mich hinausbückte, sah ich Henry Woodlawn das Haus verlassen. Er ging nicht nach Hause, sondern ein paar Schritte die Straße hinunter zu einem schnittigen Cabriolet, das in einer Einfahrt geparkt war und von einigen Jugendlichen belagert und bestaunt wurde. Woodlawn verscheuchte die Kinder mit einer Handbewegung, als wollte er lästige Fliegen von sich fernhalten, stieg ein und brauste mit offenem Verdeck davon. Es tat mir leid um seine hübsche Fönfrisur.
–
2
Es war etwa halb vier, als es erneut an der Tür klingelte. Ich legte die Geheimbotschaft beiseite, die ich fasziniert, aber ratlos betrachtet hatte, schlurfte in den Flur, drückte auf den Summer für die Haustür und öffnete die Wohnungstür einen Spalt breit. Ich fuhr heftig zusammen, als im gleichen Augenblick die Tür ganz geöffnet wurde und eine Frau hereinspaziert kam. Nach dem ersten Schrecken erkannte ich meine Nachbarin Betty. Sie hielt eine Zuckerdose in der Hand und lächelte süßlich.
»Warum starrst du mich so an?«, rief sie und grinste von Ohr zu Ohr. »Wen hast du erwartet, den Gerichtsvollzieher?«
»Ist da ein Unterschied? Du kommst doch auch nur rüber, wenn du irgendwas von mir willst.« Ich schloss die Tür und gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Ich freu mich trotzdem, dich zu sehen.«
Betty wohnte ebenfalls im zweiten Stock, wir wohnten quasi Wand an Wand. Sie und ihr Mann Paul waren die einzigen Nachbarn, zu denen ich in dem Jahr, das ich nun schon in Little Britain wohnte, Kontakt gefunden hatte. Sie waren die einzigen Nachbarn, bei denen ich nicht von irgendeiner Töle angefallen wurde, wenn ich bei ihnen klingelte, die einzigen Nachbarn, bei denen mir nach einem »Guten Tag« nicht gleich der Gesprächsstoff ausblieb.
»Was für ein Scheißtag!«, sagte Betty und ging zielstrebig in die Küche. Sie setzte sich an den Tisch und holte tief Luft. »Heute Morgen verschlafe ich, weil der Wecker in der Nacht stehen geblieben ist. Im Büro stürzt ständig die App ab, an der ich seit Tagen herumbastele. Jetzt komm ich gerade von der Arbeit, bin völlig erledigt und will mir ’ne schöne Tasse Kaffee machen ...«
»Kein Kaffeepulver mehr da«, ergänzte ich und setzte mich zu ihr an den Tisch. Es war immer so angenehm mit Betty zu plaudern, ihr passierten grundsätzlich die gleichen Missgeschicke wie mir. Es fiel mir nie besonders schwer, mich in ihre Lage zu versetzen.
»Richtig! Also nehme ich Instant-Kaffee. Macht ja nichts, denke ich mir, Hauptsache ein Wachmacher. So weit, so gut. Aber dann ...«
»Kein Zucker!«, meinte ich und deutete auf ihre Zuckerdose.
»Exakt, Herr Detektiv. Könntest du mir etwas pumpen?«
»Ich kann dir sogar ein bisschen was schenken, ich sehe das mit dem Zucker nicht so eng. Ich kann dir aber auch einen noch besseren Vorschlag machen: Ich setz uns jetzt einen leckeren Bohnenkaffee auf, und du leistest mir ein paar Minuten Gesellschaft.«
Sie lachte und sagte: »Wir sind im Geschäft.«
Betty war etwa in meinem Alter, Mitte Dreißig also, sie sah jedoch Dekaden jünger aus. Sie war mittelgroß und mittelschlank, ihr kurz geschnittenes Haar war flachsblond und strubbelig und stand wild in der Gegend umher. Ihr Gesicht war stets bleich, Farbe brachten nur die unzähligen Sommersprossen hinein, selbst ihre Lippen waren eher farblos. Betty sah immer etwas traurig aus, obwohl sie ständig grinste. Ein Widerspruch, den ich mir nie erklären konnte.
»Oh George!«, seufzte sie und zog ihre Stirn kraus. »Manchmal hasse ich meine Arbeit.« Betty war Programmiererin oder IT-Entwicklerin oder so was Ähnliches. »Zuerst macht man sich noch vor, dass man als Mensch lediglich eine Maschine benutzt. In Wirklichkeit ist es umgekehrt, du wirst automatisch zum Sklaven deines Instruments! Und wehe, es hakt im System!«
»Erzähl mir bloß nichts von Computern und Smartphones und dem ganzen Kram! Ich hab schon Probleme, wenn ich auf meinem Handy einen neuen Kontakt eingeben muss. Letztens wollte ich online einen Paketschein erstellen und hab's dabei geschafft, meinen kompletten Laptop lahmzulegen. Das Ding funktioniert bis heute nicht richtig, vielleicht kannst du nachher …«
Plötzlich schoss mir ein Gedanke durch den Kopf, und ich fuhr erschrocken zusammen.
"Was ist?", fragte Betty.
Ich hatte etwas vergessen und nun fiel es mir wieder ein. Das Paket! Ich stürzte aus der Küche und kramte im Flur im Altpapier. Da war es. Wie peinlich!
»Ich hab noch was für dich«, rief ich Betty zu. »Der Postbote hat bei mir ein Paket für euch abgegeben.« Ich ging zurück in die Küche, stellte schuldbewusst das Päckchen auf den Tisch und wartete auf eine Reaktion.
Betty sah auf den Absender und schaute fragend in mein vermutlich rötlich angelaufenes Gesicht.
»Seit wann liegt das Päckchen bei dir?«
»Weiß nicht genau«, druckste ich herum, »seit ... hm ... einer Woche ... oder zwei ... höchstens.«
Betty lächelte gequält und schüttelte den Kopf: »Gestern hab ich den Leuten einen bösen Brief geschrieben, weil sie mit ihrer Lieferung so in Verzug sind. George, du bist noch eine größere Schlampe als ich. Und das heißt schon was!«
Sie lehnte sich zurück, schlug die Beine übereinander und zupfte vorne an ihrem Kleid herum, um sich Luft in den Ausschnitt zu fächeln. Wir plauderten und schlürften Kaffee, sie erzählte von ihrer verfluchten Arbeit und ich von meinem neuen Fall (natürlich ohne Namen zu nennen). Als ich die Geheimbotschaft erwähnte, wurde Betty geradezu euphorisch, sie wollte »den Wisch« unbedingt sehen. Sie tat ihr Bestes, um mich zu becircen.
»Ich verzeih dir dann auch die Geschichte mit dem Paket«, sagte sie flehentlich und klimperte mit den Augenlidern.
»Beim besten Willen«, versuchte ich, standhaft zu bleiben, »ich kann dir den Brief nicht zeigen, ich hätte ihn nicht einmal erwähnen dürfen. Auch Privatdetektive haben ein Berufsethos.«
»Georgie, quatsch nicht so ’n verdammten Scheiß!«, rief sie mit einem Mal aufgebracht (wenn Betty aufgeregt war – oder betrunken – verfiel sie mitunter in derben Cockney-Slang). »Vielleicht kann ich dir sogar helfen.«
»Wie das?«
»Ich hab mal an einem Dechiffrierungsprogramm gearbeitet«, sagte sie, wieder völlig ruhig und sachlich, ohne mich jedoch dabei anzusehen. »Wir könnten den Text durch den Computer jagen, vielleicht spuckt der ja das Ergebnis aus.«
Das war ein Wort. Darauf wäre ich nie gekommen. Ich ging ins Arbeitszimmer, schnappte mir die Notiz und gab sie Betty. Sie studierte sie eingehend, gab sie mir dann zurück und lächelte schelmisch.
»Das mit dem Dechiffrierprogramm war geflunkert, ich hab leider überhaupt keine Ahnung, wie man Codes entschlüsselt«, sagte sie, gab mir aber gleichzeitig mit der Hand ein Zeichen, sie nicht zu unterbrechen. »Ich war halt einfach neugierig. Sorry! Trotzdem kann ich dir weiterhelfen.«
Eigentlich hätte ich sauer sein müssen, aber ich war zu gespannt auf das, was sie mir zu erzählen hatte.
»Der seltsame Code sagt mir nichts«, erklärte Betty und machte eine lange Pause, »aber mit der Unterschrift kann ich was anfangen.« Sie grinste triumphierend und fügte hinzu: »Ich weiß, wer F. W. Plumpe ist.«
»Du kennst den?«
»Nicht persönlich, der ist nämlich schon ein paar Jahre tot.« Sie nahm einen großen Schluck Kaffee, stand auf, stellte die Tasse in die Spüle, nahm ihr Päckchen unter den Arm und mich an die Hand und sagte: »Komm mal mit!«
Sie führte mich ins Treppenhaus und schloss ihre Wohnungstür auf. Die Wohnung der beiden war riesig, sowohl Betty als auch Paul hatten eigene Arbeits- wie Schlafzimmer. Und allein das Klo war so geräumig wie meine gesamte Küche.
Betty ging geradewegs in das Arbeitszimmer ihres Mannes, suchte ein paar Sekunden in einem Regal und zog ein dickes Buch heraus, auf dessen Rücken ich »Time Out Film Guide« entziffern konnte. Sie ließ meine Hand los und blätterte in dem Buch herum. Schließlich lächelte sie zufrieden, gab mir das aufgeschlagene Buch, deutete mit dem Zeigefinger auf eine bestimmte Stelle und sagte: »Lies!«
Ich tat, wie mir befohlen, und las: »Murnau, als Friedrich Wilhelm Plumpe am 28. Dezember 1888 in Bielefeld (Deutschland) geboren und am 11. März 1931 in Santa Barbara (USA) gestorben, war einer der einflussreichsten deutschen Filmregisseure der Stummfilmzeit.«
Ich sah Betty erstaunt an und fragte: »Muss man den kennen?«
Betty sah mich erstaunt an und fragte: »Noch nie was von Nosferatu gehört?«
Ich zuckte mit den Schultern und murmelte: »Stummfilme konnte ich noch nie leiden. Nosferatu ist so was Ähnliches wie Dracula, oder?« Ich versuchte vergeblich, mir einen Reim darauf zu machen, und fragte: »Hast du eine Ahnung, ob in den Filmen von Murnau Geheimbotschaften eine Rolle spielen?«
»Nicht in denen, die ich kenne«, antwortete sie.
»Leihst du mir das Buch?«, fragte ich und winkte mit dem Filmlexikon.
»Ich glaube nicht, dass Paul etwas dagegen hätte«, meinte Betty und brachte das Päckchen in ihr Schlafzimmer.
Bei der Erwähnung ihres Mannes kam mir ein Gedanke. Ich wusste, dass Paul Redakteur bei einem dieser unsäglichen Londoner Stadtmagazine war, und ich glaubte mich zu erinnern, dass er irgend etwas mit dem Kulturbereich zu tun hatte.
Ich tippelte Betty ins Schlafgemach hinterher, bemerkte, dass es darin wie in einer Rumpelkammer aussah, und fragte: »Kennt Paul sich mit Londoner Buchverlagen aus?«
»Ich denke schon. Aber warum willst du das wissen?« Sie sah mich forschend an, kniff ihr rechtes Auge zu und presste die Lippen aufeinander. Schließlich kam sie ganz nah an mich heran und flüsterte: »Das hat was mit deinem Fall zu tun, oder? Um welchen Verlag handelt es sich denn?«
Ich antwortete mit einer Gegenfrage: »Wann kommt Paul nach Hause?«
»Erst sehr spät, nicht vor neun oder zehn. Er hat noch ein Interview mit irgendeinem Theaterregisseur.«
»Kann ich ihn in der Redaktion anrufen?«
»Klar.« Sie nahm einen kleinen Zettel, notierte eine Nummer und gab ihn mir. »Wenn du mit Paul darüber redest, werde ich so oder so erfahren, worum es sich handelt.« In scherzendem Tonfall fügte sie hinzu: »Wir haben nämlich keine Geheimnisse voreinander.«
»Siehst du«, entgegnete ich grinsend, »warum soll ich dir dann die Vorfreude nehmen.«
Ich ging zur Tür und winkte und sagte: »Danke. Bis bald.«
–
Es dauerte eine gute Viertelstunde, bis ich Paul endlich an der Strippe hatte. Zunächst musste ich einer übel gelaunten jungen Frau dreimal erklären, wen ich zu sprechen wünschte. Sie schien sich nicht besonders gut in den Redaktionen auszukennen, wahrscheinlich eine Praktikantin, die man zum Telefondienst verdonnert hatte.
»Ach, Paul Butcher wollen Sie«, sagte sie schließlich schnippisch. »Sagen Sie das doch gleich.«
Ich beteuerte, ich hätte es gleich gesagt und zwar dreifach. Sie ging nicht darauf ein, sagte lediglich: »Warten Sie einen Moment.«
Ich wartete zur synthetischen Melodie von Händels Wassermusik. Ausgerechnet. Die Minuten verstrichen, nichts geschah. Händel wiederholte und wiederholte sich. Endlich meldete sich eine Frauenstimme: »Ja?« Es war die Praktikantin. Wiederhören macht Freude!
»Na, das war wohl nichts«, grummelte ich, »klingeln Sie doch bitte noch mal Paul Butcher an. Vielleicht war er ja auf dem Klo.«
Der unvermeidliche Händel ertönte, und tatsächlich hatte ich kurze Zeit später Paul am anderen Ende der Leitung. Er klang nicht sehr erfreut, mich zu hören. Das wunderte mich kaum, ich hatte ihn eigentlich noch nie sehr erfreut erlebt. Er muffelte und murrte ins Telefon und versuchte mich mit Floskeln wie »Weißt du, George, das ist im Moment kein guter Zeitpunkt« oder »Weißt du, ich hab wirklich viel zu tun« abzuwimmeln. Da ich Sätze, die mit »Weißt du« begannen, nicht ausstehen konnte, stellte ich mich taub und beteuerte, es würde wirklich nur einen winzigen Augenblick dauern.
»Na, dann schieß los!«, ließ er sich schließlich gnädig herab.
Ich saß in der Küche, in der Hand das schnurlose Telefon, das ich von meinen Kollegen des CID zum Abschied geschenkt bekommen hatte, und schlürfte den Rest des mittlerweile kalten Kaffees.
»Es geht um einen kleinen Londoner Verlag, der sich, soviel ich weiß, auf Gruselgeschichten spezialisiert hat.« Ich wusste nicht wieso, aber plötzlich hatte ich das unbändige Verlangen, eine Zigarette zu rauchen. Ich kämpfte dagegen an, was blieb mir anderes übrig, ich hätte ohnehin keine Zigaretten im Haus gehabt. Ich überlegte, wo ich stehen geblieben war. Ach ja: »Der Verlag nennt sich Dungeon Editions. Kennst du den?«
»Dungeon? Nicht die Art von Literatur, die ich persönlich bevorzuge. Unappetitlich und reißerisch.« Paul schien es tatsächlich eilig zu haben, er ließ sich nicht einmal die Zeit, in ganzen Sätzen zu reden.
»Was heißt ›unappetitlich‹?«
»Na ja, so als hätte Stephen King eine Überdosis Robert A. Heinlein zu sich genommen.« Er lachte. Er fand so was witzig. Paul besaß die dämliche Angewohnheit, immer irgendwelche Vergleiche anstellen zu müssen. Einmal war ich mit ihm und Betty im Kino gewesen, wir hatten uns eine schräge Komödie angesehen, in der es um irgendwelche abstrusen Figuren in einem abgeschiedenen Dorf im Norden ging. Betty und ich hatten uns krankgelacht, aber Paul hatte uns nachher erklärt, was wir gesehen hätten, wäre ein »Lee Evans der Provinz gewesen, quasi wie Monty Python’s für das dörfliche Spießbürgertum«. Auch darüber hatten wir uns krankgelacht.
»Wie lange gibt’s den Laden schon?«
»Schon ein paar Jährchen. Wahrscheinlich aber nicht mehr lange. Sind so gut wie pleite, hab ich gehört. Haben in den letzten Jahren einige kostspielige Projekte in den Sand gesetzt.«
Am anderen Ende der Leitung wurde es stumm, ich hörte ein Geraschel, dann tiefes Luftholen, dann war Paul wieder da. Er hatte sich eine Zigarette angezündet. Ich beneidete ihn und wunderte mich, dass er in seinem Büro rauchen durfte.
»Weshalb willst du das eigentlich wissen, George?«
»Beruflich.«
»Aha«, meinte er gelangweilt. Er hielt nicht viel von meinem Job. Wir hatten schon öfter darüber gestritten. Paul vertrat die Ansicht, es sei ein Anzeichen einer degenerierten Gesellschaft, wenn Leute dafür bezahlt würden, andere Leuten auszuspionieren. Ich hatte gekontert, es sei doch wohl eher krank, wenn sie es täten, ohne dafür bezahlt zu werden. Meine Logik hatte Paul nicht zugesagt.
»Sonst kannst du mir nichts über den Verlag erzählen? Über die Autoren oder Mitarbeiter oder sonst was? Du bist doch bestimmt auf dem Laufenden und weißt, was so in der Literaturszene abgeht.« Um mit Paul ein Gespräch führen zu können, musste man ihm immer das Gefühl vermitteln, dass er meilenweit über einem stand und seine Ausführungen sozusagen pädagogischen Wert hatten.
»Es scheint so, als hätte Dungeon Editions den Tallinn unter Vertrag genommen. Jedenfalls wenn man der Verlagsankündigung glauben darf, die vor einiger Zeit in die Redaktion geflattert kam.«
»Wie kann man denn eine ganze Stadt unter Vertrag nehmen«, fragte ich und war mir sicher, dass Paul es mir gleich erklären würde.
»Doch nicht die Stadt Tallinn, den Science-Fiction-Autor J. D. Tallinn.« An der Pause, die nun entstand, merkte ich, dass Paul überlegte, wie er einem Kretin wie mir den Sachverhalt erklären konnte. Und ob das überhaupt Sinn hatte. Schließlich fuhr er fort, ganz langsam, als spräche er mit einem Kleinkind: »Tallinn hat vor etlichen Jahren einige sehr viel versprechende fantastische Romane geschrieben. Ein wirkliches Talent. Er galt in gewissen Kreisen quasi als englischer Stanislaw Lem. Aber dann ist es plötzlich ziemlich ruhig um ihn geworden.«
Ich hatte keine Ahnung, wer Stanislaw Lem war, aber ich unterließ es, Paul darauf hinzuweisen, und meinte: »Dass Tallinn jetzt bei Dungeon Editions unterschrieben hat, bedeutet also eher einen Abstieg für ihn.«
»Einen literarischen Abstieg für Tallinn, die letzte Chance für den beinahe bankrotten Verlag. So würde ich das sehen.« Es klang wie Pauls finales Statement, tatsächlich setzte er hinzu: »Sonst noch Fragen? Weißt du, ich hab’s wirklich eilig.«
»Kennst du Henry Woodlawn, den Verleger?«
»Hab ihn mal auf dem London Book Fair getroffen. Ist ein ziemlicher Aufschneider. Redet viel, sagt wenig. Tut gern wichtig.«
Wie einige andere Leute, dachte ich, Kulturredakteure beispielsweise. Ich fragte: »Und seine Frau?«
»Der ist verheiratet? So sieht der gar nicht aus.«
In Pauls Büro wurde es nun merklich unruhig, Türen flogen, Leute redeten durcheinander, ich hörte Paul weit weg sagen: »Ja, ich komm schon«, dann war sein Mund wieder an der Muschel: »Weißt du, George, ehrlich, ich muss los.«
Ich wollte noch: »Weißt du, Paul, ehrlich, danke!« sagen, aber er hatte schon aufgelegt. Er hätte die Ironie ohnehin nicht verstanden.
–
3
Wer auch immer die Mikrowelle erfunden haben mag, ich verdamme ihn oder sie! Vorletztes Jahr hatte meine Mutter mir dieses Teufelswerkzeug zu Weihnachten geschenkt - ich befand mich damals nach meinem Autounfall in der Rehabilitation und humpelte mehr, als dass ich ging, und Mutter meinte, eine Mikrowelle in der Küche würde mir einige Fußwege ersparen. Ich weiß bis heute nicht, wie sie auf diesen Trichter gekommen ist. Vermutlich hatten meine Eltern gehofft, ich würde nach dem Ausscheiden aus dem Polizeidienst zu ihnen zurück nach Cobham, ins beschauliche Surrey ziehen. Vater träumte seit jeher davon, ich könnte eines Tages auf die abwegige Idee kommen, als Kompagnon in seinen Baustoffhandel einzusteigen, und Mutter trauerte seit Jahren darum, mich nicht mehr bekochen und kulinarisch verhätscheln zu können. Vielleicht war die Mikrowelle ihre Form der Rache. Seitdem nämlich das Gerät mich mit seiner rasanten und narrensicheren Essenszubereitung köderte, ernährte ich mich ausschließlich von Junk-Food. Nicht weil ich nicht vernünftig und traditionell hätte kochen können, nicht weil mir der Styropor-Fraß schmeckte, allein aus Gemütlichkeit und Faulheit. Keine Vorbereitung, kein Geschirrspülen. Schnell. Sauber. Ekelhaft.
Mein Magen knurrte wie ein Kettenhund, ich hatte außer Kaffee heute noch nichts zu mir genommen. Es war gleich sechs. Ich starrte erwartungsvoll ins Küchenregal, leckte mir die Lippen und entschied mich für Rindsrouladen mit Kartoffelpüree und Rotkohl. 600 Watt, 3 Minuten.
Im Arbeitszimmer wartete immer noch die verschlüsselte Botschaft auf mich, und ich hatte es mir zum Ziel gesetzt, diese bis zum Abend zu knacken. Ich ging hinüber, setzte mich hinter den Schreibtisch und betrachtete das Papier mit wachsender Begeisterung und Verwirrung. Als Kind hatte ich selbst einmal Geheimbotschaften fabriziert, um sie zu vergraben, am nächsten Tag wieder auszubuddeln und (Sherlock Holmes, der ich war!) zu entschlüsseln.
Plötzlich machte es ganz weit hinten in meinem Oberstübchen Klick! Das Geräusch mag das Klingeln der Mikrowelle in der Küche gewesen sein, aber der Gedanke an Sherlock Holmes brachte mein Gehirn in Gang. Ich erinnerte mich daran, dass ich vor Jahrzehnten eine Geschichte von Arthur Conan Doyle gelesen hatte, in der es um die Entschlüsselung von Geheimcodes ging. Ich stürzte zum Regal, suchte und fand das Buch mit den Sherlock Holmes-Geschichten.
Ich wusste noch, dass es in der Story um irgendwelche Strichmännchen ging, die für bestimmte Buchstaben standen und vom Meisterdetektiv aus der Baker Street mit unschlagbarer Souveränität dechiffriert wurden. Ich wurde auf Anhieb fündig: die Geschichte hieß »Die tanzenden Männchen«. Ich begann zu lesen und fand einige nützliche Hinweise in dem Text. So erfuhr ich etwa, dass der Buchstabe E der häufigste Buchstabe des Alphabets und in einer Geheimbotschaft allein aufgrund dieser Häufigkeit leicht zu entziffern war. Außerdem ließen sich Buchstabenkombinationen wie »the« oder »to« oder »by« ebenso einfach entschlüsseln. Anhand dieser Methode war es, laut Sherlock Holmes, eine Kleinigkeit, eine Geheimbotschaft zu dechiffrieren.
Ich wollte das Buch schon wieder zuklappen, als mir eine handgeschriebene Notiz auf der letzten Seite der Geschichte auffiel. Sie war mit Bleistift geschrieben und stammte von mir höchstpersönlich. Ich konnte mich nicht daran erinnern, sie geschrieben zu haben, aber ich hatte das Buch mindestens zwanzig Jahre nicht mehr in der Hand gehabt. Die krakelige Notiz lautete: »Das hat er von Poe geklaut!«
In diesem Moment fielen mir meine Rouladen ein, die in der Küche seit einer halben Stunde auf mich warteten. Ich sah nach und fühlte an der Kunststoffverpackung: meine Mahlzeit war schon wieder kalt, so kalt jedenfalls, wie sie bei dieser sommerlichen Hitze überhaupt werden konnte. Zweiter Versuch: 600 Watt, 3 Minuten.
Zurück zum Schreibtisch, zurück zu Doyles Ideendiebstahl. »Das hat er von Poe geklaut!« Als Jugendlicher hatte ich Kriminal- und Gruselgeschichten jeder Art verschlungen, je unheimlicher und fantastischer um so besser (selbst wenn ich davon Alpträume bekommen hatte). Mein literarischer Held war (wie hätte es anders sein können) Edgar Allan Poe gewesen. Wieder ging ich zum Regal, diesmal musste ich jedoch länger suchen. Die Kladde, die ich schließlich herauszog, hatte keinen Rücken mehr und war völlig zerfleddert, aber es war das richtige Buch: »Geschichten des Grauens«. Ich war ziemlich aufgeregt, und meine Hände waren verschwitzt, als ich in dem schon leicht modrig riechenden Taschenbuch herumblätterte. Einzelne Seiten fielen heraus. Ich schaute ins Inhaltsverzeichnis, hörte ein Klingeln aus der Küche (das ich ignorierte) und hielt den Atem an, als ich las, welche Geschichte auf Seite 105 begann: »Der Goldkäfer«. Bingo!
Ich überflog den Text, es handelte sich um eine ziemlich spannende, mitunter etwas schaurige Schatzsuchergeschichte. Auf Seite 135 schließlich las ich, wonach ich gesucht hatte. Dort hieß es:
»Zwischen dem Totenkopf und dem jungen Bock erblickte ich folgende, anscheinend von ungeübter Hand geschriebene Zeichen:
53##†305))6*;4826)4#.)4#;806*;48†8]/60))
85;1#(;:#*8†83(88)5*†;46(;88*96*?;8)*#(;485);«
Weitere Zeilen waren mit diesen Hieroglyphen gefüllt, sie wiesen auf den Ort hin, an dem ein sagenhafter Schatz vergraben war. Der Text war exakt in der Geheimsprache geschrieben, die auch F. W. Plumpe in seiner Botschaft verwendete. Oder umgekehrt: Plumpe hatte sich für seine geheime Nachricht bei Poe bedient.
Zum Glück präsentierte Edgar Allan Poe nur wenige Seiten später den entschlüsselten Text (entschlüsselt nach derselben Methode, die auch Sherlock Holmes fünfzig Jahre später anwandte). Er lautete: »A good glass in the bishop’s hostel in the devil’s seat forty-one degrees and thirteen minutes northeast ...«
Der Rest war ziemlich einfach. Selbst meine bescheidenen geistigen Fähigkeiten reichten aus, um aus:
»Mein Goldkäfer,
†68*5-4;96;†6(45;96-4)80633895-4;
6-426*69469980†?26);986*8*380
6-406828†6-4
F. W. Plumpe, Santa Barbara«
mit Hilfe der Poe’schen Anleitung folgenden Text herzustellen:
»Mein Goldkäfer, die Nacht mit dir hat mich selig gemacht. Ich bin im Himmel. Du bist mein Engel. Ich liebe dich. F. W. Plumpe, Santa Barbara«.
Ich war wahnsinnig stolz auf mich und doch ein wenig enttäuscht. Zwar war dies der Beweis, dass Eleanor Woodlawn ihren Mann tatsächlich betrog, allerdings hatte ich (um ehrlich zu sein) hinter der Geheimbotschaft mehr erwartet, als einen ziemlich banalen Liebesbrief. Vielleicht einen sagenhaften Schatz?
Ich studierte erneut den Inhalt der Botschaft und fragte mich, wieso jemand einen solchen Aufwand betrieb (und ein solches Risiko einging), um seiner Liebsten seine Liebe zu erklären. Im Zeitalter der drahtlosen Telekommunikation erschien mir diese Art der Nachrichtenübermittlung doch höchst antiquiert und vorsintflutlich, ja albern. Da will sich jemand wichtig tun, dachte ich, weil mir nichts Besseres einfiel. Eine SMS ist zu banal, und auch ein Brief allein reicht nicht, nein, er muss verschlüsselt sein. Das imponiert den Frauen! Entweder war der Schreiber dieser Zeilen sehr kindisch oder schrecklich eitel. Wahrscheinlich beides.
Und er kannte sich mit Schauergeschichten aus!
Ein Schauer lief auch mir jetzt über den Rücken, denn ich dachte an mein mikrowellenbestrahltes Gericht. Ich sah auf die Uhr, es war beinahe sieben. Meine Rouladen waren längst wieder kalt. Ich ging in die Küche und startete Versuch Nummer drei: 600 Watt, 3 Minuten.
Diesmal blieb ich neben der Höllenmaschine stehen, damit nichts schiefgehen konnte, und während meine Mahlzeit zum dritten Mal erhitzt wurde, dachte ich an den Liebesbrief der Woodlawn. Ich hatte schon lange keinen Liebesbrief mehr erhalten, eigentlich überhaupt erst einen. Ich war ja auch erst einmal richtig verliebt gewesen. In eine Frau mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche.
Die Mikrowelle klingelte, ich holte die Plastikschale heraus und betrachtete das Malheur: das Kartoffelpüree hatte sich in einen Kloß verwandelt, der Kohl schwamm in einer wässrigen Lache, und die Rouladen waren auf halbe Größe geschrumpft und so ledrig, dass ihnen selbst mit einem Messer kaum beizukommen war. Mahlzeit!
–
4
Die Sonne war vor wenigen Minuten hinter den Häusern der anderen Straßenseite verschwunden, die Hitze war geblieben. Ich saß am offenen Fenster, die Füße auf der Fensterbank, kaute auf einem mittlerweile geschmacklosen Kaugummi und schaute hinaus. Das Haus mit der Nummer Fünfundsiebzig an der Tür war das zweite in der Straße, direkt neben dem Eckhaus zur Edward Street. In Woodlawns Wohnung brannte Licht, in der Küche, aber es war kein Mensch zu sehen. Ich hatte die Ankunft der beiden Hübschen verpasst, weil ich meinen eigenen Schweißgestank nicht mehr ausgehalten und mit einer kalten Dusche gegen ihn angekämpft hatte. Vergeblich. Zehn Minuten nach dieser Erfrischung war ich so verschwitzt wie zuvor, und Woodlawns Cabrio stand vor dem Haus. Halb auf dem Gehweg.
Vier Fenster hatte ich von Woodlawns Wohnung im Visier, das geöffnete Küchenfenster, das mir lediglich den Anblick dottergelber Wände bot, daneben ein milchverglastes, es gehörte wahrscheinlich zum Badezimmer, und schließlich zwei mit buntem Stoff verhängte Fenster. Schlafzimmer, tippte ich. Wegen der Vorhänge.
Im Badezimmer wurde das Licht angeschaltet, ein Schatten erschien vor dem Fenster, dann noch einer. Der erste Schatten hantierte an sich herum, der zweite tat gar nichts. Das Licht ging wieder aus.
Die Glocken von St. Botolph’s gegenüber schlugen achtmal. Ich sah auf meine Armbanduhr, es war kurz vor halb neun. Verflucht! Auf die Kirche von England war auch kein Verlass mehr, als Katholik hätte ich das wissen müssen. Also Kaugummi aus dem Fenster, aufgestanden und Jeansjacke an.
Ich wollte schon rausstürmen, um auf der Straße zu sein, wenn Eleanor Woodlawn aus dem Haus trat, als ich auf dem Gehweg vor dem Haus einen Mann sah, der interessiert an der Fassade der Nummer Fünfundsiebzig hochblickte, dann zur Haustür schaute und sich schließlich zur anderen Seite abwandte, als hätte er Angst, ertappt zu werden. Diese Prozedur wiederholte er mehrmals. Er wartete. Auf jemanden, der nicht auf ihn wartete. Der Kerl war noch recht jung, Mitte Zwanzig etwa, hatte dunkelblondes Haar mit einer kleinen Tolle über der Stirn und trug weiße Jeanshosen und ein buntes kurzärmeliges Hemd. Marke: Hawaii. Hätte er einen Schnauzbart getragen, hätte man ihn für den jungen Tom Selleck alias Magnum halten können. Ich sah genauer hin. Er trug einen Schnauzbart.
Im Treppenhaus ging plötzlich das Licht an, trotz geriffelter Trübverglasung konnte ich die Umrisse einer bläulichen Figur vor Woodlawns Wohnungstür erkennen. Am Küchenfenster erschien zur gleichen Zeit eine riesige Schattengestalt und winkte zu mir herüber. Ich winkte zurück, um zu zeigen, dass ich verstanden hatte. Der Schatten in der Küche verschwand.
Ich sah hinunter auf die Straße, der junge Kerl hatte ebenfalls die Treppenhausbeleuchtung gesehen, er stand im Eingang des Nachbarhauses und lugte vorsichtig um die Ecke. Nur seine Haartolle war zu sehen. Und seine Turnschuhe, sie waren rot.
Der bläuliche Schatten war mittlerweile im zweiten Stock angelangt. Und er verharrte dort.
In der Wohnung direkt unter der meines Klienten tat sich etwas: in der Küche, die ich trotz fehlender Beleuchtung hervorragend einsehen konnte, weil sie auf gleicher Höhe war wie mein Büro, stand eine dunkelhaarige Frau im Bademantel auf, ging nach hinten und verschwand. Kurze Zeit später verschwand auch der Schatten aus dem Treppenhaus. Zwei Frauen erschienen in der Küche. Die eine im Bademantel, die andere in einem lilafarbenen Trainingsanzug, Erstere mit einer Tasse am Mund, Letztere mit einem gelben Stirnband am Kopf und einer schwarzen Sporttasche in der Hand. Leider konnte ich ihre Gesichter nicht erkennen, da sie im Schatten und halb mit dem Rücken zum Fenster standen und die Köpfe gesenkt hielten, als gäbe es etwas Interessantes auf dem Fußboden zu beobachten. Sie unterhielten sich kurz und verließen gemeinsam die Küche. Im Badezimmer wurde das Licht angeschaltet, dann auch im Zimmer nebenan, hier hingen weiße Vorhänge vor den Fenstern. Nach kurzer Zeit, in der ich überhaupt nichts wahrnehmen konnte, ging im Treppenhaus das Licht wieder an. Der lila Trainingsanzug erschien und ging nach unten.
Ich schnappte meine Sachen vom Schreibtisch (ein Päckchen Pfefferminzbonbons und ein Buch), rannte zur Wohnungstür hinaus und die Treppe hinunter und stand nur wenige Sekunden später locker und lässig vor der Haustür. Aber nichts geschah, niemand erschien.
Der Kerl im Hauseingang gegenüber hatte sich regelrecht in seiner Ecke verkrochen. Man konnte ihn nur erahnen. Ich wartete. Nichts. Sie hätte längst unten sein müssen. Schließlich ging ich hinüber, ein interessiertes Augenpaar auf mich gerichtet, und spähte in den Eingang. Nichts. Die Haustür stand offen, und ich warf einen vorsichtigen Blick ins frisch gestrichene, nach Farbe riechende Treppenhaus. Immer noch nichts. Schließlich ging ich durch die Hintertür in den Hof. Wieder nichts. Erst jetzt bemerkte ich die riesigen Ausmaße des Innenhofes, ein großer Holztisch mit Bänken stand in der Mitte, im Hintergrund ein ziemlich geräumiger Unterstand für Fahrräder. Dann sah ich die zweite Tür! Dies war der Gemeinschaftshof zweier Häuser. Das zweite Haus war das Eckhaus. Und der zweite Ausgang führte zur Edward Street und nicht nach Little Britain, wo ich mit Magnum auf das Erscheinen eines lila Trainingsanzuges gewartet hatte.
Ich hätte mich ohrfeigen können, lief aber stattdessen auf die Edward Street. Nichts! Ich ging die Straße entlang und betrat den von einer mannshohen Mauer eingefassten Postman’s Park. Ich sah einen schwarzen Riesenköter, der in hohem Bogen einen Baum bepinkelte, ich sah die obligatorischen Obdachlosen auf den Parkbänken, und ich sah einen glänzenden, grell lilafarbenen Trainingsanzug, der gerade den Brunnen in der Mitte des Parks passierte. Lila, fliederblau, eine schöne Farbe für einen Holunderstrauch, eine penetrante für ein Sportdress.
Die Frau im Anzug schien es nicht eilig zu haben, sie schlenderte gemächlich daher. Ich holte tief Luft und machte es ihr nach. Nach einigen Schritten drehte ich mich um, kein Mensch mit weißer Jeanshose und buntem Hawaiihemd verfolgte uns. Er wartete wohl immer noch in seinem Versteck. Ich stutzte. Warum war ich eigentlich so sicher gewesen, dass er auf dieselbe Person gewartet hatte wie ich? Berufliche Intuition wahrscheinlich. Besaß ich so was?
Ich nahm ein Minzbonbon aus der Packung, steckte es in den Mund und anschließend die Packung in die Hose und verstaute das Buch in der Innentasche der Jeansjacke. Die Arbeit begann.
Eleanor Woodlawn nahm das gelbe Stirnband ab, entfernte das Gummi, mit dem sie sich das Haar zu einem Zopf gebunden hatte, und schüttelte ihr Haar. Es war wirklich sehr lang. Allerdings nicht so lockig, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und sie selbst schien nicht so winzig, wie ihr Mann sie beschrieben hatte. Sie war wirklich sehr schön. Ich verstand Woodlawns Eifersucht. Ein wenig, jedenfalls.
Für einen kurzen Augenblick sah sie zu mir herüber, schaute aber an mir vorbei, wie es schien. Sie lächelte gedankenverloren und steckte das Stirnband in die Sporttasche, anscheinend eine Tennistasche, jedenfalls hätten in das Fach, das an der Seite angebracht war, ein Dutzend Badmintonschläger hineingepasst. Sie schulterte die Tasche und schlenderte weiter, ohne Hast. Zum Glück! Ich hatte schon befürchtet, sie würde den Weg zur Sporthalle zu einem kleinen Jogginglauf nutzen. Das hätte mich in Verlegenheit gebracht. Seit meinem Autounfall hatte ich einige Schwierigkeiten mit dem Rennen, zwar humpelte ich nicht gerade, aber mein rechter Fuß war ein wenig taub.
Der wandelnde Fliederbusch promenierte mittlerweile auf der St. Martin’s Le Grand in Richtung St. Paul’s Kathedrale. Männer jeglichen Alters drehten sich nach ihr um, es lag sicherlich nicht allein an ihrem Karnevalskostüm. Auch Frauen drehten sich um, wegen der Männer. Das allgemeine Objekt der Begierde überquerte die Newgate Street im Laufschritt – ihr Haar wogte nur so daher – und betrat den Paternoster Square. Sie schlenderte durch den alten Torbogen der Temple Bar, der so gar nicht zu den sonstigen modernen Gebäuden am Platz passen wollte, ließ St. Paul’s links liegen, überquerte den Churchyard und die dahinter liegende Carter Lane und hielt direkt auf eine alte, backsteinerne Kirche zu, die auf den eigenartigen Namen "St. Andrew-by-the-Wardrobe" hörte.
Allmählich bekam ich eine Ahnung, zu welcher Sporthalle sie gehen würde. Gegenüber der Jugendherberge in der Carter Lane konnte man die rotbraune Klinkerfassade einer Schule erblicken, die offensichtlich zur Kirche gehörte. Tatsächlich steuerte Eleanor Woodlawn zielstrebig auf das vierstöckige, rote Backsteingebäude zu, stand nun vor dem Portal – und ging vorbei. Komisch, dachte ich, sah aber dann direkt neben dem Altbau ein hässliches Betonungetüm mit Glasbausteinfassade. Die Sporthalle. Vor der Halle stand eine Frau, die genau so aussah wie die Woodlawn. Bekleidungsmäßig. Turnschuhe, Stirnband, glitzernder Trainingsanzug. Nur war ihr Anzug nicht lila, sondern violett, ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Die beiden Frauen begrüßten und unterhielten sich. Flieder und Veilchen im Gespräch, wie niedlich. Fehlte nur noch die Kornblume, um das Blau abzurunden. Das Veilchen betrat die Turnhalle. Mein Flieder blieb unschlüssig stehen, sie überlegte und blieb wie und wo sie war. Nach einer langen Pause ging auch sie hinein.
Ich hechtete über die Carter Lane zur Sporthalle und wollte gerade zur Eisentür hineinkiebitzen, als die Tür mit aller Wucht von innen aufgestoßen wurde und mir gegen den Kopf knallte. Meine Brille flog durch die Gegend und ich hinterher. Als ich aufsah, stand die Woodlawn über mir und lächelte verlegen und schuldbewusst. Sie streckte ihre Hand aus und half mir auf die Füße. Ich suchte nach meiner Brille, fand sie und stellte beruhigt fest, dass die Gläser heil waren. Nur der Metallrahmen war verbogen.
»Das tut mir schrecklich leid«, murmelte sie und betrachtete besorgt den Kratzer und die kleine Beule an meiner Stirn. Ich betastete die Beule und jammerte. So klein war sie gar nicht.
»’tschuldigung, ich hab Sie nicht gesehen.« Ihr Blick war so tröstlich wie mütterliche Heilungsformeln: Hush, baby, my dolly, I pray you don’t cry. Ich wünschte mir, sie würde fragen: »Soll ich pusten?«
»Halb so wild«, sagte ich. Und: »Geht schon.« Was man eben so sagt, wenn einem eine sehr schöne Frau eine sehr schwere Eisentür gegen den Schädel gehämmert hat. »Machen Sie sich keine Sorgen.«
»Mach ich nicht«, antwortete sie und strich sich die Haare hinter die Ohren. »Warum spionieren Sie auch Frauen nach?«
Ich weiß nicht, ob ich zusammenzuckte, aber mein »Wieso?« klang sicherlich nicht sehr souverän.
»In der Halle ist heute Abend Frauensport. Sie wollten wohl einen Blick in die Umkleidekabine werfen, was?« Sie lachte.
Ich atmete erleichtert auf, sie hatte keinen Verdacht.
»Nein, ich wollte nachschauen, ob unser Tischtennistraining morgen stattfindet.« Ich kramte umständlich in der Hosentasche, zog ein letztes Pfefferminzbonbon heraus, warf die Verpackung achtlos auf den Boden und schob mir das Dragee zwischen die Zähne.
Sie blickte ungläubig an mir auf und ab und schüttelte unmerklich den Kopf. »Sie spielen Tischtennis?« Sie verkniff sich ein »Sieht man Ihnen gar nicht an.«
Ich grinste blöde und antwortete: »Nein, aber ich werfe gern Blicke in Frauen-Umkleidekabinen.«
Wie hatte Woodlawn gesagt: »Sie grinst ständig und lacht sehr viel.« Er hatte nicht übertrieben. Sie lachte schallend los und zeigte mir ihre Mandeln. Jetzt sah ich an ihr auf und ab, vor allem betrachtete ich ihr rundliches, sonnengebräuntes Gesicht. Das Muttermal wäre mir gar nicht aufgefallen, hätte Woodlawn nicht darauf hingewiesen. Ihre Nase war etwas spitz, aber nicht groß, eine Igelnase. Ihre Augen hatten die Farbe ihrer Haare, dunkelbraun, die Augenbrauen waren buschig und dicht. Ihre Lippen waren eher schmal, nach Woodlawns Beschreibung hatte ich eigentlich einen Brigitte-Bardot-Schmollmund erwartet.
»Darf ich Sie auf ein Bier einladen?«, wurde ich aus meinen Gedanken gerissen. »Als Wiedergutmachung.«
»Wenn’s kein englisches Bier ist.«
Wieder lachte sie laut los. Das würde ein lustiger Abend werden! Endlich hatte ich ein dankbares Publikum für meine dummen Sprüche. Ich nahm das Angebot dankend an.
»Da vorne ist das ›Dark Horse‹, eine meiner Stammkneipen.« Sie deutete mit einer Kopfbewegung nach links, Richtung Themse. Nur wenige Schritte entfernt standen Holztische und -bänke auf dem Gehweg. Finster aussehende Typen räkelten sich auf den Bänken und stürzten Pintgläser voll Porter und Bitter hinunter. Dröhnende Musik drang aus der Kneipe auf die Straße.
»Meinen Sie den Punk-Schuppen da vorne?«, fragte ich unsicher.
Sie merkte, dass mein Blick an ihrer bunten Kostümierung haftete, und lachte neckisch. »Machen Sie sich wegen meiner Aufmachung keine Gedanken. Der Wirt kennt mich.« Sie nahm ihre Sporttasche, zögerte einige Sekunden, in denen sie mich prüfend bis auffordernd ansah, und schulterte schließlich mit begleitendem Achselzucken und hochgezogenen Augenbrauen die Tasche, als sie bemerkte, dass ich keine Anstalten machte, ihr die Last abzunehmen. Ich unterließ dies mit Vorsatz. Ich konnte Frauen nicht leiden, die sich emanzipiert gaben, sich aber mit Vorliebe von galanten Kerlen die Türen öffnen und ganz selbstverständlich den Vortritt geben ließen. Wenn schon Gleichberechtigung, dann auch richtig.
Sie schluckte ihre Verwunderung herunter, bedachte mich mit einem verkniffenen Lächeln und nahm mich schließlich wie einen Schuljungen an die Hand. »Nun, kommen Sie schon!« Sie drehte den Spieß um, und ich ließ ihr den Spaß.
»Wie heißen Sie eigentlich?«
»George.«
Sie lachte und meinte: »Na, macht ja nichts. Ich heiße Nelly.«
»Ein Spitzname?«
»Was sonst?« Sie schaute mich verwirrt an.
Richtig, was sonst? Nelly. Die Kurzform von Eleanor.
»Klingt nett«, sagte ich und war gespannt, was noch alles passieren würde. Der Anfang war jedenfalls vielversprechend. Und selten hatte ich es so einfach gehabt, jemanden zu beschatten.
Leicht verdientes Geld!
–
5
Das »Dark Horse« war dunkel und stickig und laut. Ein Licht wie in einer Gruft, ein Lärm wie im Fußballstadion und eine Luft, die man in Scheiben hätte schneiden können. Es stank nach abgestandenem Bier und ranzigem Schweiß. Die Luft wurde allein durch das Vibrieren der dröhnenden Lautsprecher in Bewegung gehalten. Auch der schmerbäuchige, aknegesichtige und fetthaarige Barkeeper, von dem zumindest ein Teil des ranzigen Geruchs in diesem Laden auszugehen schien, bewegte sich kaum, vor allem nicht seine Lippen. Auf die Frage meiner Begleiterin, ob Joe heute nicht arbeite, antwortete er mit einem gelangweilten Kopfschütteln. Sie sah mich entschuldigend an und grinste verlegen.
»Sollen wir uns nicht raussetzen?«, fragte ich unsicher und deutete durch die verschmierten Fenster auf die Tische auf dem Gehweg. Aber Nelly wollte nicht draußen sitzen, wegen der Hitze, sagte sie. Drinnen war es allerdings nicht kühler. Im Gegenteil.
Sie bestellte ein Guinness, ich ein Foster’s, und wir setzten uns unter den belustigten Blicken einiger lederbekleideter, zumeist vollbärtiger Gestalten an einen klebrigen Ecktisch.
Die Kneipe bestand aus einem einzigen, leidlich großen, quadratischen Raum mit sehr hohen Wänden und einer Decke, von der die Ruinen ehemaligen Stuckwerks herabhingen. Als Mobiliar standen unbehandelte Holztische und altersschwache Stühle unmotiviert in der Gegend herum. Ein System schien hinter der Bestuhlung nicht zu bestehen. Das einzige, das sich in diesem Raum nicht rein zufällig am gegenwärtigen Ort befand, war die schwarze Farbe an den Wänden. Aber auch da war ich mir nicht sicher. Die Farbe und die verdreckten Fenster sorgten jedenfalls dafür, dass man eine Taschenlampe benötigte, um sein Gegenüber am Tisch erkennen zu können.
»Gemütlich wie im Kohlenkeller«, sagte ich.
Nelly hatte meine Bemerkung nicht gehört, vielleicht auch überhört. Sie zog ihre Trainingsjacke aus, das T-Shirt darunter war weiß. Ich war erleichtert, ich hatte schon auf oleandergrün getippt. Ich ließ meine Jacke an, ohne Jacke fühlte ich mich einer Frau gegenüber immer ein wenig nackt, wahrscheinlich weil meine schwabbelige Figur zu sehr in den Vordergrund trat.
Da die Musik so dröhnte, musste Nelly sich zu mir rüberbeugen, um mir ins Ohr zu grölen: »Tut’s noch weh?« Wieder dieser mütterliche Blick.
Ich verschwieg meine Kopfschmerzen, ich schwieg überhaupt. Worüber sollte ich auch reden? Übers Wetter? Über die Liebe und die Ehe? Oder über Eifersucht? Ich entschied mich für das Thema Sport. Naheliegend eigentlich.
»Was treiben Sie eigentlich für einen Sport?« Auch ich kroch ihr fast ins Ohr und nahm dabei eine Nase voll von ihrem Geruch in mich auf. Sie roch gut. »Ins Schwitzen scheint man dabei nicht zu kommen. Oder sind Sie Auswechselspielerin?« Es war angenehm, Fragen zu stellen, auf die man die Antworten längst kannte.
»Ich spiele Badminton.« Sie sah mich mit ihren dunklen Augen nachdenklich an, nahm einen kräftigen Schluck und setzte hinzu: »Aber heute hatte ich keine Lust auf Anstrengendes.«
»Warum dann die Kostümierung?«, fragte ich und deutete auf ihre Trainingsjacke, die sie über die Stuhllehne gehängt hatte. »Warum sind Sie nicht einfach zu Hause geblieben. Oder wäre das auch anstrengend gewesen?«
Sie starrte mich sekundenlang an und machte ein O mit ihrem großen Mund. Schließlich sagte sie: »Sie sind ganz schön neugierig.«
»Berufskrankheit«, rutschte es mir heraus.
Ihre Augen wurden immer größer, sie zog ihre kleine Nase kraus und stellte die sich aufdrängende Frage.
»Polizist«, antwortete ich und kam mir nicht einmal wie ein Lügner vor. »Ich bin Detective Sergeant.«
»Ein Cop?« Sie war entsetzt, schüttelte den Kopf und strich sich mehrmals die Haare hinter die Ohren. Anscheinend eine Marotte von ihr. Sie stierte auf den Tisch und überlegte. Etwas zu lange, für meinen Geschmack. Schließlich fing sie schallend an zu lachen und meinte belustigt: »Na ja, warum eigentlich nicht?!«
»Eben«, sagte ich, »abgesehen davon, dass niemand uns mag und wir dafür bezahlt werden, niemanden zu mögen, ist es ja schließlich auch nur ein Job wie viele andere. Und wie sagt schon die Bibel: ›Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden.‹«
Sie schmetterte mir ihr Lachen entgegen und meinte: »Das steht doch niemals in der Bibel.«
»Und ob! Fünftes Buch Mose. Ich kenn mich da aus.«
»Na dann, cheers!« Sie stieß meine Bierflasche mit ihrem Glas an, in ihrem Blick war immer noch ein wenig Unglaube. Oder Ironie. Oder beides.
»Und was treiben Sie so tagsüber, wenn Sie nicht gerade harmlose Passanten in zwielichtige Kneipen bugsieren?« Ich machte ein unschuldiges Gesicht, das sie gar nicht beachtete.
»Ich arbeite in einem Verlag«, sagte sie, sah mich für einen kurzen Augenblick an und setzte hinzu: »Wehe, Sie sagen jetzt: ›Das ist aber interessant.‹«
Ich sagte: »Das ist aber interessant.«
Sie schüttelte unmerklich den Kopf und griff zu ihrem Glas.
»Was für ein Verlag ist das?«
»Na, Bücher eben. Schundliteratur. Nichts, was ich zu Hause in meinem Regal stehen haben möchte.«
»Welche Autoren verlegen Sie? Kennt man die?«
»Haben Sie schon mal was von J. D. Tallinn gehört?«
»Der englische Stanislaw Lem?«, fragte ich und erntete ein erstauntes und anerkennendes Nicken.
»Eigentlich heißt der James Daniel Thatcher. Früher mal er ein Bestsellerautor, nicht ganz so originell wie Lem, aber immerhin. Doch das ist lange her. Heute ist er gezwungen, bei uns zu veröffentlichen. Kein seriöser Verlag will ihn mehr haben.«
»Sie scheinen nicht viel von Ihrem Arbeitgeber zu halten.«
»Mag sein«, sagte sie, strich sich mal wieder die Haare hinter die Ohren und nahm einen Schluck Guinness. Sie schien wirklich Durst zu haben, ihren Pint hatte sie beinahe ausgetrunken. »Vor allem halte ich wenig von Autoren«, setzte sie nach einer Weile hinzu. »Schriftsteller sind eine Plage.«
Ich lachte, griff in die Innentasche meiner Jeansjacke und zog mein Buch heraus. »Ich muss Ihnen was vorlesen«, sagte ich und blätterte, um die Stelle zu finden, die ich gestern Nacht im Bett gelesen hatte. Ich fand sie: »Alle Schriftsteller sind Arschlöcher, und ich bin eins der größten. Ich habe zwölf Bestseller geschrieben, und wenn ich den Stapel Quatsch da auf dem Schreibtisch zu Ende bringe, dann sind’s vielleicht dreizehn. Und keiner davon ist auch nur einen Schuss Pulver wert.«
»Wer das sagt, könnte auch bei Dungeon Editions unter Vertrag stehen. Hört sich an wie eine Beschreibung unseres aktuellen Verlagsprogramms.« Sie nahm mir das Buch aus der Hand und las: »The Long Goodbye. Schöner Titel.«
»Schönes Buch. Der Schriftsteller wird später umgebracht.«
»Oh«, sagte sie nachdenklich und schwieg. Sie schaute etwas verlegen. »Sie lesen Krimis?«, fragte sie nach einer Weile und setzte erklärend hinzu: »Ich meine, als Polizist.«
»Fast alle Cops lesen Krimis. Was meinen Sie, warum die meisten von ihnen solche Arschlöcher sind? Doch nur, weil sie ihren gedruckten Vorbildern gerecht werden wollen.«
»Sie scheinen aber auch nicht viel von ihren Arbeitskollegen zu halten.« Endlich lachte sie wieder.
»Mag sein.« Sie hatte völlig recht, auch wenn es sich natürlich mittlerweile um ehemalige Kollegen handelte. »Als was arbeiten Sie denn im Verlag, Nelly?«
»So eine Art Sekretärin, ’ne bessere Schreibkraft. Ein bisschen Vertrieb, hin und wieder auch Lektorat, wenn alle anderen im Urlaub sind.« Sie lächelte gezwungen und setzte hinzu: »Meistens aber trister Telefondienst. Ihr Job ist sicherlich interessanter.«
»Na ja«, entgegnete ich mürrisch und bestaunte, wie Nelly ihrem Guinness den Garaus machte. Ich hatte mein Foster’s bisher kaum angerührt. Sie knallte das Glas auf den Tisch und machte: »Ah!«
Mein Blick fiel auf ihre schmalen, sehr zierlichen, etwas geröteten Hände. Ihre Fingernägel waren farblos lackiert und schienen frisch manikürt. Am Ringfinger der linken Hand sah ich einen Solitär. Ein hübscher Ring.
Ich fragte: »Sie sind verheiratet?«
Sie schaute mich prüfend an, kniff den Mund zusammen, zuckte mit den Achseln und blieb stumm. Sie schien nicht erstaunt über die Frage, aber sie wollte nicht darüber sprechen. Ich verstand das, schließlich hatte ich ihren Mann kennengelernt. Der war wahrlich nicht der Rede wert.
»Bei welcher Abteilung der Kriminalpolizei arbeiten Sie eigentlich?«
»MIT.«
»Mordkommission?« Wieder machte sie ihr fischiges O. Es sah eigentlich niedlich aus, wie bei einem kleinen Mädchen, das vergeblich versuchte, ein Kaugummi aufzublasen. »Wahrscheinlich sehr aufregend.« Ihre Augen funkelten neugierig.
»Ich hoffe, Sie fragen mich jetzt nicht, wie viele Leute ich schon umgelegt habe.«
Sie fragte: »Wie viele Leute haben Sie denn auf dem Gewissen?«
»Drei«, log ich mit ernster Miene. »Und Sie?«
Als Antwort bekam ich ein ironisches Schnaufen und dann Schweigen. Schließlich fragte sie: »Hast du heute noch was vor?«
Ich verschluckte mich und sagte: »Wie bitte?«
»Hast du Zeit? Ist nur ’ne Frage.«
Ich glaube, ich wurde rot im Gesicht, als ich sagte: »Kommt drauf an.«
»Willst du mich küssen?«
»Küssen?« Ich kam mir vor wie ein frisch Pubertierender, dem die erste Freundin den ersten Kuss anbot. »Einfach so?«
»Warum nicht?«
Sie lachte. Ich lachte. Und dann küsste sie mich.
Bevor ich vollends rot anlaufen oder etwas allzu Blödes sagen konnte, stand sie auf, nahm ihr Glas und fragte: »Noch ein Foster’s?« Sie wertete mein Schweigen als Bejahung und ging zum Tresen.
Ich fühlte mich, als hätte mich ein Feuerwehrauto gerammt. Mit Blaulicht und Sirene. Ein echter Filmkuss, wie schön.
Beim Küssen hatte ich allerdings bemerkt, dass ich immer noch ein Minzdragee im Mund hatte. Ein Zahnpastakuss, wie ekelhaft. Ich nahm das Bonbon heraus, wusste nicht, wohin damit, steckte es wieder in den Mund und schluckte es mühsam herunter.
Sie kam mit einer Flasche Bier und einem grünlichen Cocktail zurück, lächelte mich an und setzte sich. Sie rückte etwas näher zu mir heran, deutete auf ihr Getränk und meinte: »Grüne Banane.«
»Deine Vorliebe für grelle Farben hab ich schon bemerkt.«
Sie lachte und tätschelte meine Hand. Dann verschwand ihre unter dem Tisch. Ganz beiläufig berührte sie dort mit den Fingern mein Knie, und plötzlich fühlte ich ihre Hand an meinem Innenschenkel. Sie tastete sich hoch. Ich legte nicht gerade Protest ein, aber ganz leise und weit entfernt hörte ich Henry Woodlawns Stimme, die mich am nächsten Tag fragte: »Und? Was haben Sie herausgefunden?« »Ihre Frau betrügt Sie«, würde ich antworten. Ich hörte Woodlawn explodieren: »Wie heißt das Schwein?!« Und ich hörte meine kleinlaute Antwort: »George Ingram. Privatdetektiv. Ein zuverlässiger und verschwiegener Mann.« Was würde Woodlawn amüsiert sein! Zum Totlachen!
Ich starrte auf die beiden Bierflaschen vor mir, stellte mit einiger Erleichterung fest, dass ihre Hand auf meinem Schenkel zum Stillstand gekommen war, und stotterte: »Nelly ist ein hübscher Name. Passt eigentlich gar nicht zu deinem Nachnamen.«
Sie zog abrupt die Hand von meinem Bein weg und sah mich mit zusammengezogenen Augenbrauen finster an. »Mein Nachname?«, fragte sie erstaunt und fixierte mich misstrauisch.
»Na ja«, murmelte ich, »Woodlawn ist ein seltsamer Name. Seit wann gibt es Rasenflächen im Wald?«
Ich war noch nie besonders schnell in meiner Auffassungsgabe gewesen, aber dass ich mich einmal als ein solcher Idiot erweisen würde, hätte selbst ich mir nicht zugetraut. Erst als sie mich mit ihrem vorwurfsvoll fragenden Blick durchbohrte, ging mir ein Licht auf. Sie hatte mir ihren Nachnamen gar nicht genannt.
»Tja«, druckste ich herum und schaute Hilfe suchend auf den Boden. Dort stand ihre Sporttasche. Ein winziger Aufkleber pappte an der Seite. Zu klein, um zu lesen, was darauf stand. Ich nahm ihre Tasche und deutete auf das Etikett. Ich hatte Glück. In kleinen Druckbuchstaben stand dort zu lesen: »Eleanor Woodlawn, 75 Little Britain, London EC1A«.
Ich atmete erleichtert auf, als sie anfing, schallend und laut zu lachen. Auch ich lachte und sagte: »Ich bin halt Polizist.«
»Ich weiß schon, der dreschende Ochse.« Grinsend zog sie an dem Strohhalm in ihrem Cocktail. »Du hast verflucht gute Augen. Ich hätte den Zettel niemals aus der Entfernung entziffern können.«
»Was meinst du, warum ich dieses Ungetüm auf der Nase trage?« Ich versuchte zu grinsen. Es war nicht ganz einfach. Unter meinen Achseln spürte ich den Schweiß, der langsam hinunterlief. Ich stellte die Tasche wieder auf den Boden, stand auf, brummte eine Entschuldigung und ging aufs Klo.
Das war knapp gewesen.
Die Herrentoilette befand sich im Keller, nach Bewältigung einer halsbrecherischen Treppe und eines unbeleuchteten Zwischenraums stand man in einer ebenso winzigen wie ekelhaften Zelle. Die zwei Pinkelbecken waren nicht nebeneinander, sondern an gegenüberliegenden Wänden angebracht. Wenn zwei Leute gleichzeitig ihr Geschäft verrichteten, rieben sie mit den Pobacken aneinander. Wahrscheinlich waren sie mit Absicht so installiert.
Nach Erledigung der Notdurft suchte ich das Waschbecken, es hing in dem düsteren Vorraum. Vielleicht war es besser, es nicht beleuchtet betrachten zu müssen. Ich wusch mir die Hände, Arme, Achseln und das Gesicht, merkte erst anschließend, dass keine Papierhandtücher vorrätig waren, und trocknete mich notdürftig an der Jeansjacke ab.
»Zu Hause keine Dusche?«, hörte ich eine krächzende Stimme hinter mir. Ich sah in den Spiegel und sah, dass es keinen gab. Der Typ mit der Rabenstimme stand mittlerweile im Toilettenraum und gab befriedigt erleichterte Geräusche von sich: »Tut gut, was?«
Ich hielt es nicht für nötig, darauf zu antworten, und ging nach oben. Die Luft im Kneipenraum kam mir plötzlich gar nicht mehr so unerträglich vor. Ich atmete tief durch.
Nelly Woodlawn saß nicht mehr am Tisch, aber ihre Tasche stand noch daneben. Ich sah mich um, die Tür zur Frauentoilette befand sich neben dem Tresen. Ich setzte mich, nahm meinen Krimi vom Tisch, blätterte darin und steckte ihn in die Jacke. Dann genehmigte ich mir einen Schluck Bier und roch anschließend an Nellys grünlichem Cocktail. Schauderhaft.
»Schmeckt’s?« Sie stand plötzlich hinter mir und wuschelte zärtlich in meinen Haaren. »Oder darfst du das jetzt als Mann nicht zugeben?«
»Ich würde das Zeug nicht anrühren, selbst wenn es mich angrinste wie Kate Moss.«
Sie setzte sich und blickte mich mit schelmischem Funkeln in den Augen an. Mir wurde unbehaglich zumute, dieser Blick versprach nichts Gutes. Sie führte irgendetwas im Schilde.
»Wo wohnst du, George?«
»In Lambeth«, log ich.
»So, so ...« Wieder grinste sie neckisch, dass man ihren Schalk im Nacken sehen konnte. »Und? Wie lebt sich’s da … in Lambeth?«
Komische Frage, fand ich. »Nicht anders als anderswo.«
Sie griente und fragte: »Wohnst du allein?«
»Nein, mit meiner Freundin.« Hoffentlich würde diese kleine Notlüge ihr Funkeln in den Augen zum Erlöschen bringen.
»Dann gehen wir eben zu mir«, war alles, was sie darauf entgegnete. Sie nahm meine Hand, ich zog sie weg. Sie nahm sie erneut.
»Aber erst machen wir noch einen kleinen Spaziergang. Wie wär’s mit der Themse, wir könnten ein wenig die Schwäne füttern und den Sonnenuntergang beobachten.«
Ob sie mich auf die Schippe nehmen wollte oder diesen Unsinn ernst meinte, blieb mir schleierhaft. Ich hatte den unangenehmen Eindruck, dass ich nicht mehr sämtliche Fäden in den Händen hielt, falls das überhaupt je der Fall gewesen war. Die vermeintliche Marionette hantierte mit dem Puppenspieler herum. Dieser Abend lief Gefahr, außer Kontrolle zu geraten.
Sie leerte ihr Glas, stand auf, zog ihre Trainingsjacke an, schulterte ihre Sporttasche, stellte sich hinter mich und tätschelte liebevoll meine Wange. »Nun mach schon, oder willst du nicht?«
In Gedanken sah ich mich in ihrem satinbezogenen Ehebett: Sie liegt unbekleidet und schnurrend an meiner Seite und krault meine drei Brusthaare, in der Tür erscheint Henry Woodlawn, auf dem Kopf ein Paar Hörner, in den Augen Eifersucht und Hass, in der Hand eine Schrotflinte. Er zielt auf mich und drückt ab. Blattschuss.
Aber so weit musste es ja nicht kommen, redete ich mir ein.
–
6
Obwohl es bereits weit nach zehn war, hatte die Hitze draußen keineswegs nachgelassen, sie hatte sich nur ein wenig Feuchtigkeit als Verstärkung geholt. Der Himmel war wolkenverhangen und schimmerte zugleich schwarz und rötlich. Es konnte jeden Moment anfangen zu donnern, zu blitzen, zu stürmen und zu regnen. Es konnte aber auch nichts von alldem geschehen. Die Luft stand wie eine Betonmauer, man hätte sich an ihr die Nase einrennen können. Eine bedrohliche Stille herrschte, selbst die vorhin noch so lärmenden Kerle an den Tischen vor der Kneipe schwiegen andächtig. Alles wartete.
Wir gingen in Richtung Themse, und bis wir dort waren, sprach keiner von uns ein Wort. Ich hatte Nellys Sporttasche nun doch an mich genommen und trug sie ihr wie ein Caddie hinterher. Nelly hatte die Arme vor der Brust verschränkt und schlich, den Blick starr auf den Boden gerichtet, über den Gehweg, als hätte sie Angst, mit dem Geräusch ihrer Schritte die drückende Stille zu beleidigen. Auch ich schwieg und schlenderte und dachte nach.
An der Themse angelangt, drehte sie sich plötzlich um, strahlte mich an und hakte sich bei mir ein. Ein wenig lehnte sie sogar ihren Kopf an meine Schulter. »Herrlich, nicht wahr?«, sagte sie.
»Der Fluss?« Ich fand ihn durchaus nicht herrlich. Lediglich dreckig und stinkend.
»Nein, das Wetter. Es ist so ruhig überall. Nur ganz selten herrscht solch eine Stille. Kurz vor einem Abendgewitter und wenn es nachts schneit. Als wäre alles mit Watte bedeckt.«
»Ja, Zuckerwatte vielleicht. Mein Hemd klebt jedenfalls.«
Sie sah mich missbilligend an und verzog den Mund. Ich hatte ihre kitschige Stimmung verdorben. Die ganze Szenerie erschien mir fremd und ein wenig unheimlich. Ich ging mit einer wunderschönen Frau, deren Blick einiges versprach, Arm in Arm an der nächtlichen Themse spazieren. Und ich wurde dafür bezahlt. Das alles war zu schön, um wahr zu sein. Passend zu dieser Überlegung zuckten am Horizont die ersten Blitze. Ich wartete auf den Donner. Der ließ auf sich warten. Das Gewitter war noch weit weg.
Wir waren mittlerweile an der Millennium Bridge angelangt und betraten den Paul’s Walk. Gegenüber auf der Südseite der Themse ragten der alte Industrieschlot der Tate Modern und der OXO-Tower in den schwärzlichen Himmel. Nelly ging ans Wasser und lockte einen Schwan, der gemächlich auf dem Fluss flanierte, heran, indem sie einen Stein ins Wasser warf. Der Schwan vermutete Fütterung, entdeckte den Betrug und kümmerte sich in der Folgezeit nicht mehr um Nellys Bemühungen. Diese wandte sich mir enttäuscht zu und meinte, ebenso vielsagend wie treffend: »Schwäne!«
»Mir hat mal einer die Fingerkuppe abgebissen«, entgegnete ich und zeigte meinen rechten Zeigefinger, der ein bisschen kürzer war als normal und dessen Nagel um die verkürzte Kuppe herumwuchs.
»Ach, komm! Du willst mich doch veräppeln.«
Ich fragte mich schon geraume Zeit, wer hier wen veräppelte.
»Nein, im Ernst«, beteuerte ich. »Ich hatte mich, ohne es zu ahnen, einem Schwanennest am Ufer genähert, und Mama Schwan hat mir das übel genommen. Ich kann froh sein, dass sie nicht mehr von mir verspeist hat. Schwäne können ganz schön gefährlich werden.«
»Sicher.« Sie grinste, sie glaubte mir nicht. Schon seltsam, ich konnte die dreistesten Lügengeschichten erzählen, meine Unschuldmiene dabei aufsetzen, und alle glaubten es. Erzählte ich jedoch einmal die Wahrheit, schon hielt man mich für einen Lügner. Ich wollte gerade einen Überzeugungsversuch starten, als ich den ersten Tropfen auf meinem Kopf spürte. Nelly hatte ebenfalls einen abbekommen. Wir sahen uns gleichzeitig an, und plötzlich brach ein Platzregen los, wie ich ihn schon lange nicht mehr erlebt hatte. Eine wahre Sintflut brach über uns herein. So weit war das Gewitter also doch nicht entfernt gewesen. Nicht einmal auf die Pfadfinderregeln war mehr Verlass. In Sekundenschnelle waren Nelly und ich bis auf die Haut durchnässt. Ich sah an ihr herab, sie hatte ihre Trainingsjacke geöffnet, das T-Shirt darunter wurde durch den Regen transparent. Ich machte sie nicht darauf aufmerksam.
»Wie spät ist es?«, rief Nelly mir durch das Getöse zu, das nun einsetzte. Es blitzte und krachte, als würde die Welt untergehen.
»Viertel vor elf!«
»Na, dann schnell!«
Ich sah sie etwas verwirrt an, sie griente zurück.
»Willst du, oder willst du nicht?«
Ich wollte, aber das sagte ich nicht. Ihr war’s egal, sie nahm mich bei der Hand und zog mich hinter sich her. Sie fing an zu rennen, ich musste es ihr gleichtun, ob mir das lieb war oder nicht. Ich verfluchte mich, weil ich Idiot ihr die Sporttasche abgenommen hatte. So was kommt von so was.
Wir rannten vom Fluss in Richtung St. Paul’s, dann über einen Platz und eine breite Kreuzung, vorbei an einer Kirchenruine und hechteten schließlich irgendeinen Bürgersteig entlang. Ich schaute gar nicht hoch, war völlig aus der Puste, meine Knie schlotterten, mein lädiertes rechtes Bein tat weh.
Nelly bog plötzlich rechts ab und stürmte in einen Hauseingang, ich hinterher. Plötzlich befanden wir uns in einem Treppenhaus. Es roch nach frischer Farbe. Hier war ich heute schon einmal gewesen. Ich verschnaufte, stellte die Sporttasche ab und sank zu Boden.
»Die paar Stufen wirst ja wohl noch schaffen, oder?«
»Gemach, gemach!«
»Richtig, Schlafgemach.«
Ich sah sie verdutzt an, dieser Spruch war selbst unter meinem Niveau. Sie bemerkte meine Verwunderung und entschuldigte sich mit einem reizenden Lächeln, das mir einen Schauer über den Rücken jagte. Nelly Woodlawn war vielleicht ein wenig meschugge (ganz sicher war sie das), aber sie war eine Wucht!
Sie beugte sich zu mir herunter und hielt mir die Hand hin, um mir aufzuhelfen. Wasser tropfte aus ihren Haaren, ein Tropfen hing an ihrer spitzen Nase, ich wartete bis er fiel, schulterte ihre Tasche, nahm ihre Hand und stand auf.
»Ich habe eine Freundin, die ich liebe und respektiere. Und ich halte sehr viel von der Treue«, sagte ich, ohne wirklich zu glauben, dass es Eindruck auf sie machte.
Ich hatte wieder einmal recht, sie sagte: »Das ist schön für dich!« und ging vor mir die Treppe hoch.
Ich nahm einen zweiten Anlauf: »Und dein Mann?«
Sie drehte sich brüsk um, wollte mir etwas verbal an den Kopf schmettern, überlegte es sich anders und fragte: »Warum bist so überzeugt davon, dass ich verheiratet bin?«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Wenn’s dich glücklicher macht«, sagte sie und ging weiter, »mein Mann ist nicht da.« Sie schielte über ihre Schulter und meinte: »Geschäftsreise.«
Ich gab mich geschlagen und schlich ihr mit zittrigen Knien hinterher. Gegen Nelly Woodlawn war einfach kein Kraut gewachsen. »Auf einen Kaffee komme ich noch mit zu dir«, sagte ich, als bedürfte es noch irgendeines Vorwandes. »Und abtrocknen würde ich mich auch ganz gern.«
Es kam mir gar nicht so vor, als hätten wir schon viele Stufen hinter uns gelassen, als Nelly plötzlich stehen blieb und stolz verkündete: »So, da wären wir. Home, sweet home!«
»Wir sind doch nie und nimmer im dritten Stock«, fiepte ich außer Atem. Ich starrte auf die Wohnungstür, las an der Klingel: »Roberts« und konnte beim besten Willen nicht verstehen, was hier gespielt wurde. Verwirrt fragte ich: »Hier wohnst du?«
Sie nickte und lächelte mich verführerisch an.
»In welcher Etage sind wir?«
»Du stellst Fragen«, sagte sie und zog einen Schlüsselbund aus der Jackentasche. »Zweiter Stock natürlich.« Sie fingerte einen Schlüssel hervor und wollte die Tür aufschließen.
»Und dein Name ist Roberts?«
Sie wandte sich zu mir um, betrachtete mich zweifelnd, dachte einen Moment nach und lachte dann laut los: »Jetzt verstehe ich«, meinte sie und deutete auf die Sporttasche, die immer noch an meiner Schulter hing. »Das Namensschildchen! Vertan, vertan! Du solltest eben nicht so neugierig sein, Mr. Detective Sergeant.«
»Wer ist denn diese Eleanor Woodlawn?«
»Eine Freundin.«
»Und was hat das alles ...?«
»Eine lange Geschichte«, schnitt sie mir das Wort ab.
Sie öffnete die Tür und trat ein, in der Wohnung brannte Licht. Nelly bemerkte es, drehte sich zu mir um, als wollte sie etwas sagen, blieb aber stumm. Sie horchte eine Weile und rief: »Eleanor?« Sie wartete auf eine Antwort, aber in der ganzen Wohnung war es still. Nichts rührte sich. Nelly zuckte mit den Schultern und sagte: »Der Vogel ist schon ausgeflogen.«
Sie durchquerte den schmalen Flur, ging in die Küche und sah zur Uhr. »Oh, es ist ja auch schon nach elf. Ich bin zu spät!« Wieder zuckte sie mit ihren hübschen Schultern und fragte in meine Richtung: »Willst du Kaffee oder lieber einen Espresso?«
Ich folgte ihr wie in Trance und schloss die Tür und stand in dem nur durch eine kleine Funzel an der Decke beleuchteten Flur und blickte mich unsicher um. Ich sah eine Garderobe, einen Spiegel, ein Filmplakat, zwei geschlossene Türen. Und natürlich den Eingang zur Küche, in der Nelly vergeblich auf meine Antwort wartete. Ich betrachtete die Tapeten in der Küche. Sie waren weiß, nicht gelb. Hätte ich meine Gedanken bei mir gehabt und wäre ich nicht so verdattert gewesen, hätte ich sicherlich den Geruch wahrgenommen, der im Flur in der Luft lag. Einen Duft, dem ich heute schon einmal begegnet war. Und es war nicht der Geruch nach Farbe.
»Ich könnte jetzt einen Whisky vertragen«, sagte ich, ging zu ihr in die Küche und ließ mich wie in Zeitlupe auf einem Stuhl nieder.
»Ich hab leider nur Gin da«, entgegnete sie entschuldigend und ging zum Kühlschrank.
»Macht nichts«, sagte ich und grinste blöde, »darauf kommt’s jetzt auch nicht mehr an.«
Sie goss mir ein, ich kniff die Augen zu und kippte mir den Fusel hinter die Binde. Ich konnte Gin nicht ausstehen.
–
7
Ich konnte nicht genau sagen, wie lange ich schweigend so dagesessen hatte, nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen, geschweige denn, ihn auszusprechen. Nelly saß mir gegenüber am Küchentisch, direkt am Fenster und sah mich besorgt an. Es schien, als hätte ich ihr einen gehörigen Schrecken eingejagt. Sie hatte sich aus einem Handtuch, das sie aus dem Badezimmer geholt hatte, einen Turban gebunden. Außer der Kopfbekleidung trug sie lediglich einen Bademantel. Auch den hatte ich heute schon einmal gesehen.
Ich sah aus dem Fenster auf die gegenüberliegende Straßenseite. Im Haus gegenüber waren beinahe sämtliche Fenster erleuchtet, alle bis auf drei. Die Fenster meiner Wohnung.
»Deine Kondition ist nicht die beste, oder?«, fragte sie wieder mit ihrem fürsorglichen Mutter-Teresa-Tonfall.
Ich versuchte mich an einem Lächeln, das mir wahrscheinlich nicht sehr gut gelang, kippte mit Widerwillen meinen dritten Gin herunter und zuckte mit den Schultern. Ich konnte ihr schlecht sagen, was mich tatsächlich so mitgenommen hatte. Ich musste nachdenken. Ganz ruhig und systematisch nachdenken. Ich ging zweieinhalb Stunden zurück in der Zeit. Wieder saß ich an meinem Fenster und starrte auf die Wohnung der Woodlawns. Ein blauer Schatten erschien im dritten Stock, ging hinunter und verharrte vor der Wohnung im zweiten Stock. Eine Frau im Bademantel öffnete, ließ den lilafarbenen Trainingsanzug für einen Moment in die Küche, verschwand mit ihr im Bad und schließlich im Schlafzimmer. Dann erschien der Trainingsanzug wieder im Treppenhaus und verließ das Haus, um von mir im Postman’s Park aufgestöbert zu werden.
Der Groschen war gefallen.
Vielleicht weil ihr mein Schweigen unangenehm oder unheimlich war, schaltete Nelly das Radio an, das hinter ihr auf der Fensterbank stand. Sie drehte so lange an der Senderwahl, bis sie etwas Passendes gefunden hatte. Eine Schnulze der Beatles: »And in her eyes you see nothing. No sign of love behind her tears, cried for no one. A love that should have lasted years.«
Ich grinste, und Nelly fragte mich erleichtert: »Geht’s besser? Ist der Kreislauf wieder in Ordnung?«
»Ja, alles okay«, sagte ich. Ich war wieder im Bilde, ich war ausgetrickst worden (und nicht nur ich!), aber nun hatte ich den Anschluss wiedergefunden. Ich hatte nicht eine Person, sondern ein Outfit verfolgt. Besser: die falsche Person im richtigen Outfit. Der perfekte Seitensprung, nur ein Stockwerk unter der eigenen Wohnung.
»Sag mal, wofür steht eigentlich Nelly?«, fragte ich sie.
»Für Helen. Wieso?«
»Nur so.«
Es war so einfach. Und jetzt begriff ich es. Genial, weil simpel. Zu simpel und zu offensichtlich, um Verdacht zu hegen. Vertauschte Klamotten, vertauschte Identität. Niemand hatte Zweifel, die Farbe Lila wurde zum Personalausweis. Wahrscheinlich waren die beiden Frauen sich sogar ziemlich ähnlich. Nicht nur wegen des Namens, auch äußerlich. Jedenfalls traf die Beschreibung, die Henry Woodlawn von seiner Frau gegeben hatte, haargenau auf Nelly Roberts zu.
»Wundervoll«, murmelte ich. Ich war beeindruckt.
»Was?«, fragte sie.
»Du natürlich.«
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783739338736
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2016 (April)
- Schlagworte
- Rache Tragikomödie London Liebe Hass