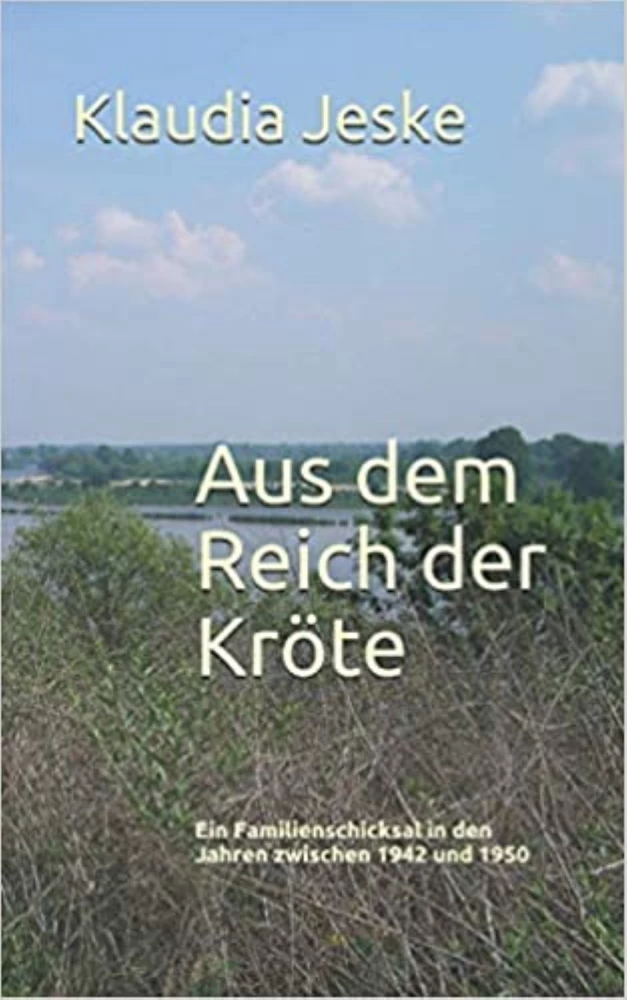Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Łomianki bei Warschau 1925
„Du wirst diesen Mann heiraten!“
„Nein. Niemals!” Anna schürzte ihre vollen Lippen trotzig. „Du kannst mich nicht zwingen, Vater”, sagte sie mit Nachdruck.
Jakob Baumann schnaubte. Er war außer sich vor Wut. Seine kleinen wasserblauen Augen funkelten bedrohlich im zornesroten Gesicht. Ungehalten sprang der Bauer vom knarrenden Armlehnstuhl, seinem Lieblingsplatz, auf. Mit polternden Schritten umrundete er mehrmals den Eichenholztisch, dessen wuchtige Präsenz die Wohnstube des Baumannschen Bauernhäuschens beherrschte. Die wilde Woge seines Zorns begann sich zu glätten. Seit Tagen bemühte sich Jakob vergeblich darum, seiner widerspenstigen Tochter einen vielversprechenden Heiratskandidaten schmackhaft zu machen.
„Dankt man so seinem Vater? Du bist zu alt, um wählerisch zu sein, Anna.“ Jakob Baumann atmete tief durch.
Er war vielleicht nur ein einfacher Bauer, aber immerhin wusste er eine störrische Kuh zu behandeln. Auch bei den Rindviechern konnte man mit Befehlen und Grobheit manchmal nichts ausrichten. Oft half ein Umschwenken auf Sanftheit und gutmütige Ansprache.
Der Klang seiner Stimme wurde weich. „Ich will dich gut versorgt sehen, verstehst du das denn nicht, Kind?”
„Aber es gibt da einen, der mich nehmen würde …”, sagte Anna verzagt. Zum einen war sie sich Jerzys Liebe seit er nach Danzig gegangen war, nicht mehr ganz sicher, zum anderen kannte sie die Einstellung ihres Vaters.
Tatsächlich lachte Jakob höhnisch auf. „Sprich seinen Namen bloß nicht aus. Dieser nichtsnutzige Polak ist nichts für meine Tochter, hörst du. Du bist eine Deutsche und du wirst einen Deutschen heiraten.”
Anna dachte an die Fotografie von Richard Walther, die die Heiratsvermittlerin Hedwig ihr vor zwei Wochen ausgehändigt hatte. Vor der künstlichen Kulisse einer Alpenlandschaft wirkte der abgebildete, etwa vierzigjährige, breitschultrige Mann in seinem schwarzen Sonntagsanzug völlig deplatziert. Grüblerisch und ernst starrte Richard Walther den Betrachter an. Die Vorstellung ihr Bett mit diesem Mann zu teilen, erschien Anna absurd. Sie schluchzte unglücklich: „Vater, dann verheirate mich wenigstens nicht mit dem kleinen, alten, kahlköpfigen … Tölpel.”
„Richard Walther ist weder alt noch ist er dumm. Er ist ein anständiger Mann, der schon einiges in seinem Leben erdulden musste und nun endlich zur Ruhe kommen will. Er braucht ein Weib.” Jakob Baumann sah seine weinende Tochter an und erinnerte sich dunkel daran, dass eine Frau vielleicht noch andere Worte hören wollte. „Er findet dich schön, hat Hedwig gesagt – glaube ich.” Jakob blickte verlegen an die Zimmerdecke.
Jetzt ging er mit seiner Sanftmütigkeit wohl etwas weit, dachte er. Hatte man je von Nachbarn oder Verwandten gehört, die so lange brauchten, um ihren Töchtern mitzuteilen, welcher Mann für sie ausgesucht worden war?
Der Groll in ihm verstärkte sich erneut.
„Hat Hedwig gesagt“, echote Anna gekränkt. Sie hasste den Gedanken, von der geschwätzigen Heiratsvermittlerin verkuppelt zu werden. „Ich weiß, du meinst es gut mit mir, Vater. Aber ich wäre todunglücklich mit einem Bauern. Suche mir einen Bäcker oder einen Kaufmann. Das Landleben ist nichts für mich, glaube mir.”
Auf keinen Fall wollte Anna ein Leben dort führen, wo der Gestank von Dung und den Ausdünstungen der Tiere auf ewig in jede Pore ihrer Haut und in jede Faser ihrer Kleidung dringen würde. Anna Baumann sehnte sich nach dem bunten Treiben in der polnischen Hauptstadt, wo sie gemeinsam mit ihrem Bruder und einem Knecht regelmäßig die Erzeugnisse des Baumannschen Bauernhofs feilbot. Inmitten des polyglotten Sprachengewirrs – polnisch, jiddisch, deutsch, russisch –, zwischen hupenden und dröhnenden Automobilen, die sich an behäbig auf dem Kopfsteinpflaster klappernden Pferdefuhrwerken vorbei rasant durch Warschaus Straßen schlängelten, fühlte sie sich wohl.
Aus dem Schweinestall, der sich direkt an das Baumannsche Bauernhaus anschloss, ertönte aufgeregtes Quieken und Grunzen. Die Tiere wurden gerade gefüttert.
„Du glaubst wohl, geeignete Männer wachsen bei uns an den Bäumen, wie?” brummte Jakob Baumann. „Richard Walther hat ausgezeichnetes Land von seinem Vater überschrieben bekommen, er hat ein kleines Haus gebaut, das nur auf dich wartet. Es wird dir gut gehen.”
„Selbst der Lehrer Seidel hat Interesse an mir gezeigt …”
„So ein Hungerleider!” meinte Jakob Baumann verächtlich. „Ein fleißiger Bauer mit gutem Land wird dich immer ernähren können. Was verdient dagegen schon ein Schulmeister? Tochter, du bist nicht gescheit!”
Er schüttelte ratlos den Kopf, offensichtlich würde er seine Strategie ändern müssen. Von draußen drang das wütende Gebell der Hündin Zora, in das sich das nervöse Gegacker der Hühner mischte, in die Stube. Erwartungsvoll spähte Jakob durch die geklöppelte Spitzengardine zum Fenster hinaus. Zu seiner Enttäuschung war die Heiratsvermittlerin Hedwig, von der er sich nun Beistand erhoffte, noch nicht im Anmarsch. Die Ursache für die Aufregung der Hoftiere ließ sich nicht auszumachen. Vielleicht schlich wieder einmal ein hungriger Wolf ums Haus herum. Jakob dachte nach.
„Es ist längst Abendbrotzeit. Willst du etwas essen?” fragte er.
„Nein”, sagte Anna.
„Du musst doch hungrig sein“, beharrte Jakob und riss abrupt die Zimmertür auf, in deren Nähe sich seine Frau Karoline aufhielt.
„Wie sieht es mit dem Abendessen aus, Karoline?”
„Es steht alles bereit, Jakob. Ich wollte euch nicht stören, es kamen so laute Stimmen aus dem Raum, da dachte ich …”
„Ist ja auch gut, Karoline. Aber jetzt hätte ich gerne eine große Portion zu Essen. Und nimm einen von den alten, abgeplatzten Tellern.”
„Nu, das Alltagsgeschirr, warum auch nicht? Aber nur eine Portion? Und was ist mit Anna, hat sie keinen Hunger?” wunderte sich Karoline Baumann.
„Nu, wir werden sehen.” In Jakobs Augen funkelte es spitzbübisch. Karoline ging kopfschüttelnd in die Küche.
In der Stube belauerte Jakob seine störrische Tochter.
„Du willst also ein schönes Leben und du willst einen hübschen Mann, nicht?”
„Na ja, welches Mädchen träumt schon nicht davon?”
„Ja, ja. Wer nicht?“ Jakob setzte sich in den Armlehnstuhl und betrachtete seine Tochter schweigend.
Minuten später zog Bratenduft durch das Zimmer. Karoline stellte einen an den Rändern abgestoßenen, vergilbten Teller auf den Tisch. Jakob warf einen prüfenden Blick darauf. Mehlige Kartoffeln schwammen dicht gedrängt in einem tiefbraun glänzenden See. Ein stattlicher Hügel Rote Beete Mus dampfte gemeinsam mit einigen Scheiben Schweinebraten, die unter der sämigen Soße begraben lagen, auf dem Teller. Ohne Eile erhob sich Jakob vom Stuhl und ging einige Schritte bis zur zierlichen Glasvitrine, die er mit seinen großen, abgearbeiteten Pranken öffnete. Daraus holte er einen mit rosa Rosen bemalten, weiß schimmernden Porzellanteller hervor. Voller Sanftmut lächelte er seine Tochter an. Dann arrangierte er die beiden ungleichen Teller nebeneinander auf dem Tisch.
„Nun, Anna, hast du die Wahl. Stell dir vor, du hast großen Hunger, einen viel größeren als jetzt. Welchen Teller würdest du wählen?”
„Da gibt es wohl nichts zu überlegen, ich würde natürlich den vollen nehmen.” Anna staunte über die Frage. Was war denn in ihren Vater gefahren?
Doch Jakob betrachtete seine Tochter zufrieden und meinte: „Nu, dann stell dir mal vor, der mit Essen gefüllte Teller, das ist Richard Walther, und der leere da ist ein hübscher, aber armer Polak, der dir in deinem Kopf rumspukt.”
Anna schluckte schwer, während Jakob triumphierend hinzufügte: „Nicht genug zu essen zu haben ist keine feine Lebensaussicht, oder? Richard Walther kommt uns am Sonntag besuchen. Du wirst sehen, der Mann wird dir gefallen.”
Anna:
Da steht er mir also gegenüber, mein Zukünftiger. Der Mann, den mein Vater für mich erwählt hat. Richard Walther erscheint mir zu alt, zu klein, zu kahlköpfig zu sein. Nein, ich finde ihn nicht sehr anziehend.
Eindringlich mustert er mich aus schmalen, katzengrünen Augen. Die Haut an meinem ganzen Körper beginnt unter diesem Blick zu brennen. Es ist als stünde ich nackt vor diesem Mann. Aber anstatt Scham darüber zu empfinden, fühle ich mich gegen meinen Willen wie elektrisiert.
Richard:
Anna und ich tauschen unseren allerersten Blick. Der Speichel in meinem Mund zieht sich zusammen als hätte ich eine besonders köstliche Speise vor meinen Augen. Mein Wunsch mich an dieser bezaubernden Frau zu laben wird übermächtig.
Nach unserer Eheschließung wird Anna sofort schwanger. Es ist ja auch kein Wunder, denn wir können die Finger nicht voneinander lassen. Wir sehen immer schnell zu, beieinander zu liegen, denn unterhalten können wir uns kaum. Es ist, als stammten wir von verschiedenen Planeten, sprächen unterschiedliche Sprachen – damals stört es mich nicht. Im Gegenteil. Anna bleibt ein Geheimnis für mich, und das macht sie nur noch begehrenswerter.
Anna:
Bereits am Anfang unserer Ehe hört mir Richard niemals richtig zu. Ich erzähle ihm von meinem Ärger mit den Mägden und davon, dass ich in Hohenburg herrliche Spitze für den Kragen meines hellgrauen Kleides gefunden habe, doch es ist, als spräche ich mit einer Kuh französisch.
Im ehelichen Bett verflüchtigt sich mein Ärger jedoch schnell. In der Umarmung finden wir unsere gemeinsame Sprache. Bald nach unserer Hochzeit erwarte ich unser erstes Kind. Im Mai 1926 kommt unser erstes Kind, ein Sohn zur Welt: Richard Jakob Walther.
TEIL I : ZUHAUSE
Puschkeiten, Polen
1942 - 1945
1 Anna
Schröttersburg, 15. August 1942
Das metallene, zackige Ding, das ihr vor wenigen Minuten feierlich überreicht worden war, ruhte wie ein Fremdkörper in Anna Walthers linker Faust. Mit einem blütenweißen Leinentaschentuch in der anderen Hand betupfte sie sich die schweißnasse Stirn. Die Luft in dem etwa zwanzig mal zwanzig Meter großen Raum war verbraucht von dem Atem der gewürdigten Frauen und ihrer stolzen Angehörigen.
„Seid fruchtbar und mehret euch“, murmelte Anna leise vor sich hin und wurde dafür von ihrer weizenblonden Sitznachbarin mit einem Knuff in die Seite bedacht. In Gedanken versunken presste Anna die Auszeichnung für ihre Fruchtbarkeit noch fester, so dass sich das spitze Metall ins Fleisch ihrer linken Hand bohrte. Anna ignorierte den Schmerz.
Der Kindersegen war doch Gottes Wille. Warum fühlte sie sich unzufrieden? „Kinder sind der Reichtum des kleinen Mannes“, so lautete von jeher einer der Lieblingssprüche ihres Vaters, des alten Jakob. Möge er in Frieden ruhen.
Auch das Regime förderte und begrüßte Kinderreichtum in den Familien. Wieso konnte sie sich, anders als vermutlich alle anderen Frauen hier im Saal, nicht über das Mutterkreuz freuen? Immerhin, es war eine Anerkennung erheblicher Mühen. Sechs Kinder hatte Anna unter Schmerzen in den vergangenen Jahren das Leben geschenkt, fünf von ihnen lebten. Anna liebte ihren Nachwuchs, trotzdem hatte sie jede Schwangerschaft und Geburt eher als Strafe denn als Auszeichnung empfunden.
Bin ich entartet? – So nannten es die Nationalsozialisten, wenn ein Mensch sich außerhalb der Norm, die einzig und allein sie selbst definierten, befand.
„Ihr deutschen Frauen, gebärt Eurem Volk und Eurem Führer viele Kinder!“ Von der Bühne donnerte die staatstragende Stimme des Bürgermeisters hinunter auf die gebannt lauschende Menge. „Die deutsche kinderreiche Mutter soll den gleichen Ehrenplatz in der deutschen Volksgemeinschaft erhalten, wie der Frontsoldat, denn ihr Einsatz von Leib und Leben für Volk und Vaterland war der gleiche wie der des Frontsoldaten im Donner der Schlachten …“ Die wie unter großer körperlicher Anstrengung hinaus gepresst klingenden Sätze des Redners verursachten bei Anna eine Welle von Übelkeit. Sie musste an ihren Bruder denken, der mit der deutschen Wehrmacht auf der Krim gegen die Russen kämpfte.
Mit dem deutschen Überfall auf Polen im September 1939 als Auslöser des zweiten Weltkriegs, hatte das Unheil, das schon einige Jahre zuvor wie ein bedrohliches Tier in die Welt geschlichen war, seinen Anfang genommen. Die Beute „Polen“ war zwischen des beiden landhungrigen Nachbarn, der Sowjetunion und dem Deutschen Reich, brüderlich aufgeteilt worden. Seither gehörte der künstlich geschaffene Regierungsbezirk Zichenau, in dem die Familie Walther lebte, zu Ostpreußen.
Ruckartig erhob sich Anna vom Stuhl. Das Leinentaschentuch hielt sie vor ihren Mund gepresst. Sie spürte, wie man ihr verständnislose Blicke zuwarf. Sogar der Bürgermeister unterbrach seine Rede, vielleicht nicht unfroh darüber, einen Moment Luft zu holen, bevor er die nächsten schwer verdaulichen Sätze von seinem Manuskript ablesen wollte. Die Aufmerksamkeit, die sie erregte, war Anna egal. Zielstrebig drängte sie durch die Stuhlreihe an misstrauischen Frauengesichtern vorbei und eilte den schmalen Gang hinaus ins Freie. Draußen wurde sie vom gleißenden Augustsonnenlicht geblendet. Einige SA-Leute unterhielten sich vor dem Eingangsportal des Rathauses. Einen Moment lang glaubte Anna das Profil ihres Schwagers zu erkennen. Arthur Reschke fehlte ihr jetzt gerade noch. Die Augen in die Ferne gerichtet hastete sie an den Männern vorbei.
Ein leichter Wind aus Flussrichtung fächelte Anna etwas Kühlung zu. Sie atmete tief durch und wählte den Weg hinunter zur Weichsel.
Jetzt, wo sie frische Luft tief in sich einsaugte, fühlte sie die Schwäche aus ihrem Körper weichen. Nun war wieder Platz für ihre Wut. Anna ärgerte sich, weil sie der Bitte ihres Mannes gefolgt und zu dieser lächerlichen Nazi-Veranstaltung erschienen war. Richard Walther wollte nicht, dass Anna den Machthabern unangenehm auffiel, indem sie die Auszeichnung ablehnte. Vor dem Krieg hatte Richard das Amt des Bürgermeisters in ihrem kleinen Dorf ausgeübt. Doch seit der Naziherrschaft hielt er es für klüger, sich aus einer Politik, die er nicht zu unterstützen gedachte, herauszuhalten. Sein Bauernhof war Richard Walther in den vergangenen drei Jahren wichtiger als jemals zuvor geworden, denn dort war er sein eigener Herr.
Obwohl sie Richards Vorsicht hinsichtlich der Nazis verstehen konnte, wurmte Anna das passive Verhalten ihres Mannes, denn ihrem Wesen nach war Anna ein aufsässiger Mensch. Allerdings hinderte sie ihre ebenfalls angeborene Trägheit daran, den Hang zum Ungehorsam auszuleben. Gleichwohl fühlte sie sich von Menschen, die mutig und energiegeladen gegen den Strom schwammen, angezogen.
Wieder spürte Anna den kreuzförmigen Anhänger in ihrer Hand, unverwandt schaute sie sich die Trophäe ihrer Fruchtbarkeit noch einmal an. In der Mitte des silbernen und blauen Abzeichens prangte ein schwarzes Hitlerkreuz, das mit der Schriftumrandung „Der deutschen Mutter“ versehen war. Entschlossen schüttelte Anna ihren Kopf. Langsam schlenderte sie in Richtung der Weichselbrücke, die das Zentrum der tausendjährigen Bischoffsstadt Płock, seit 1939 in Schröttersburg umbenannt, mit der Ortschaft Radziwie verband. Als Anna die Mitte der Brücke erreichte, lehnte sie sich ein Stückchen über die Brüstung. Das graublaue Wasser unter ihr strömte im pfeilschnellen Tempo in Richtung Meer.
2 Im Brunnen
Puschkeiten, September 1942
„Hühnerwetter, Kinder – hört endlich auf mit dem Geschrei!“, rief Anna Walther, in der stillen Hoffnung eines der Kinder würde ihrer Ermahnung Folge leisten, zum Küchenfenster hinaus. Sie schwenkte einen feuchten Waschlappen drohend in der Luft herum, während eine lachende und kreischende Kinderschar am Küchenfenster entlang stob. Nur die siebenjährige Tochter Mara stoppte am Fenster und sah ihre Mutter etwas besorgt an.
„Geh´ nur Kindchen. Hab du auch deinen Spaß. Aber bleibt nicht ganz so dicht am Haus. Mir brummt der Kopf heute.“ Seufzend ließ Anna sich auf den Schemel fallen und kühlte sich mit dem Lappen die Schläfen. Es war ein sonniger, schwüler Spätsommertag, vielleicht würde es wie gestern Abend ein Wärmegewitter geben. Vor Anna auf dem Tisch lag ein Berg Mohrrüben, die bis zum Abend geschabt werden mussten. Während Jadwiga, die Küchenmagd mit einer Sommergrippe im Bett lag, waren die anderen Mägde auf den Feldern mit der Kartoffelernte beschäftigt. Ergeben begann Anna eine Rübe nach der anderen zu schälen. Draußen kehrte tatsächlich Ruhe ein, die spielenden Kinder schienen sich aus der näheren Umgebung des Bauernhauses verzogen zu haben.
Während sie ihrer eintönigen Beschäftigung nachging, hing Anna mal wieder dem Gedanken nach, wie ihr Leben aussehen würde, wenn sie sich seinerzeit gegen die Heirat mit Richard entschieden hätte. Obwohl sie sich nicht beklagen konnte, verließ sie niemals das unbestimmte Gefühl, die eine große, erfüllende Liebe verpasst zu haben.
Seit nunmehr siebzehn Jahren lebte Anna in dem 60 km weichselaufwärts von Warschau entfernt gelegenen Dorf Puschkeiten. Hier besaßen die Walthers ein kleines Bauernhaus mit Stallungen für Kühe, Schweine, Pferde und Federvieh sowie ertragreiches Ackerland, auf dem Getreide, Kartoffeln und Futterrüben angebaut wurden. Sechs Bauernhöfe zählte der kleine Ort. Die Höfe lagen in großzügigem Abstand voneinander entfernt in der weiten ebenen masowischen Landschaft und reihten sich eine unbefestigte Straße entlang, die bis nach Hohenburg führte. In diesem alten Weichselstädtchen gehörte den Walthers ein Mietshaus, das im Erdgeschoß eine verpachtete Gaststätte beherbergte. In den gemeinsamen Ehejahren hatten sich Anna und Richard Walther einen soliden Wohlstand geschaffen. Und wenn Anna auch das Leben einer Bauersfrau mit wenig Begeisterung führte, so empfand sie Genugtuung darüber, in Hohenburg als recht begüterte Dame auftreten zu können.
Stürmisch stieß jemand die Küchentür auf. Anna wurde jäh aus ihren Gedanken gerissen.
„Mama, Mama!“ Die zwölfjährige Ada Walther stolperte aufgeregt in die Küche. Wenn Ada sich aus ihrer etwas schwerfälligen Ruhe bringen ließ, so war etwas passiert, dachte Anna erschrocken.
„Mama, du musst zum Brunnen kommen. Oskar sitzt im Eimer, und wir bekommen ihn nicht mehr nach oben gezogen!“
Beunruhigt sprang Anna vom Schemel auf. „Herrje, du willst doch nicht sagen, Oskar sitzt im Brunnen fest? Hat Tessa denn nicht aufgepasst!“ Annas älteste Tochter Tessa vergaß in letzter Zeit auffallend oft ihre Pflichten gegenüber den jüngeren Geschwistern.
„Die ist vorhin mit dem Fahrrad abgedampft! Sie hat gesagt, ehe du es bemerkst, ist sie längst wieder zu Hause“, antwortete Ada erregt.
Anna riss die Tür auf und hastete, von Ada dicht gefolgt, den schmalen, sonnenblumengesäumten Gartenpfad entlang in Richtung Brunnen. Im Schatten der mächtigen alten Eiche standen Mara und Luise und brüllten Durchhalteparolen in die Tiefe des Brunnens hinunter.
„Lasst mich vorbei – nichts als Unsinn habt ihr im Kopf!“ Fassungslos starrte Anna in den hohlen, etwa vierzig Meter tiefen Bau. Ein Stückchen über der Wasseroberfläche schwebte Oskar. Er hockte im Eimer und krallte sich mit beiden Händen an den Seilen fest. Dass der jüngste Walther-Spross sich in gefährliche Situationen brachte, war für die Familie nichts Ungewöhnliches. Doch dieses Mal schien sich sogar der Sechsjährige seiner lebensbedrohlichen Lage bewusst zu sein. Voller Furcht blickte er zu seiner Mutter empor.
„Mama, hilf mir!“
Verzweifelt drehte Anna an der Brunnenwinde, doch nichts rührte sich. Die Winde klemmte.
„Warte, Mama, wir versuchen es zusammen.“
Ada begann sich gemeinsam mit ihrer Mutter an der Brunnenwinde abzumühen. Stumm vor Schreck sahen Luise und Mara dabei zu. Oskar, in der Tiefe des Brunnens, schien vor Angst erstarrt zu sein. Das dunkelgrüne gewaltige Blätterdach der Eiche raschelte leise im Sommerwind. Einen Moment lang fühlte sich Anna wie in einem bösen Traum gefangen. Sie zwang sich, eine vernünftige Lösung zu finden.
„Ada, lauf so schnell du kannst zu Reschkes. Versuch Hilfe zu holen. Und ihr zwei“, wandte sich Anna an ihre verschreckten Töchter Luise und Mara, „bleibt bei eurem Bruder. Ich hole Vater vom Feld.“ Sie beugte sich tief über die Brunnenmauer und rief ihrem Sohn zu: „Oskar, du schaffst das. Halte dich weiter so gut fest, wir holen dich da wieder raus!“
Während Anna auf dem sandigen Weg durch die weite, bis zum Horizont reichende Ebene um das Leben ihres einzigen Sohns lief, packte sie eine alt bekannte Verzweiflung. Das Grauen, das sie bei dem Tod ihres erstgeborenen Sohnes empfunden hatte, ergriff sie erneut.
Lieber Herr Jesus, nimm mir nicht auch noch dieses Kind. Gelobt seiest du im Himmel und vergib mir meine Sünden …
Keuchend erreichte Anna den Kartoffelacker, auf dem drei Männer und zwei Frauen mit der schweren Erntearbeit beschäftigt waren. Die Männer liefen die Furchen ab und hoben mit den Mistgabeln Kartoffelsträucher aus der Erde. Die Mägde buddelten die lebenswichtigen Knollen mit ihren Händen aus und sammelten sie in Körben.
„Hilfe! Pomocy!“, schrie Anna verzweifelt. „Oskar steckt im Brunnen fest! Richard!“
Verschwitzt kam Richard Walther, breitschultrig und um Haupteslänge von den beiden Knechten neben sich überragt, von der anderen Seite des Ackers auf seine Frau zugelaufen. Ohne auf weitere Erklärungen zu warten, gebot er: „Schnell, auf den Wagen.“
Während Richard die Pferde antrieb und sicher über den holprigen Weg lenkte, betete Anna voller Inbrunst.
Als sie schließlich den Brunnen erreichten, trafen sie dort eine kleine Menschentraube an. Die Stimmung schien gelöst. Anna sah sofort ihren lachenden Schwager Arthur Reschke mit einigen seiner Knechte. Ina Reschke, Richards jüngste Schwester, hielt Mara und Luise in ihren Armen. In der Mitte der Gruppe stand der kleine Oskar strahlend wie ein Held.
Gelobt sei der Herr!
Erleichtert lief Anna auf ihren Sohn zu, umarmte ihn heftig und küsste ihn, ungeachtet eines gewissen Widerstrebens Oskars, stürmisch ab. Eine Weile ließ Richard seine Frau gewähren. Dann schob er sie zur Seite, legte seinem Sohn die linke Hand auf die schmale Schulter, holte mit der rechten kräftig aus und verabreichte Oskar die schmerzhafteste Ohrfeige seines jungen Lebens. Mit gepresster Stimme blaffte Richard den jammernden Jungen an: „Für diese himmelschreiende Dummheit erwartet dich heute Abend eine ordentliche Tracht Prügel. Damit du nicht vergisst, dich niemals mehr in eine so bodenlos dämliche Gefahr zu bringen. Jetzt muss ich wieder aufs Feld. Die Kartoffeln ernten sich nicht von alleine.“
Oskar rieb sich die schmerzende Wange. Mühsam schaffte er es die Tränen zu unterdrücken. Aus seinen kirschengroßen, dunkelbraunen Augen blickte er dem davon stapfenden Vater erschrocken nach. Wieso lobte der Vater ihn nicht für seine Durchhaltekraft, wie es die anderen getan hatten?
Auch Anna empfand die Reaktion ihres Mannes als hart. Wenn er nicht so schnell verschwunden wäre, hätte sie ihm ihre Meinung dazu gesagt. Wie so oft verspürte Anna große Lust, sich mit Richard zu streiten. Kaltschnäuzig wie immer, dachte sie wütend, und vergaß einmal mehr, dass der ganze landwirtschaftliche Betrieb und auch die Erziehung der Kinder meistens vom kühlen, entschlossenen und durchdachten Handeln Richards profitierten. Die Konsequenz, die Anna fehlte, hatte Richard hohes Ansehen in der Gemeinde gebracht und auch die Kinder achteten die Grenzen, die der Vater zog, sehr genau, während sie der Mutter nur allzu gerne auf der Nase herumtanzten.
„Jetzt einen Schnaps auf den Schreck, nicht wahr?“ Anna machte eine einladende Geste und Ina und deren Mann Arthur, folgten ihr bereitwillig in das kleine, strohgedeckte Bauernhaus, an dessen roten Backsteinmauern weiße, süß duftende Rosen emporrankten. Die polnischen Knechte wurden zurück an die Arbeit geschickt. Anna versprach ihnen später eine Flasche Selbstgebrannten vorbeibringen zu lassen. Die Reschkes machten es sich in der Küche bequem, und Arthur begann ein Gläschen ums andere auf den Schreck zu leeren.
Die Kinder, froh darüber, den Hof nun wieder für sich zu haben, ließen sich noch einmal die Eindrücke, die Oskar in der Tiefe des Brunnens gewonnen hatte, schildern. Und der Sechsjährige genoss es, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, obwohl er die unerfreuliche Aussicht auf die Abendstunde mit seinem Vater nicht ganz aus den Gedanken verdrängen konnte.
*
In der Küche geriet Arthur Reschke ins Politisieren. Die beiden Frauen warfen sich vielsagende Blicke zu. Arthur war dafür berüchtigt, sich unter Alkoholeinfluss in einen Militärexperten allerersten Ranges zu verwandeln. Dabei war er gleich zu Beginn des Krieges wegen eines Herzfehlers ausgemustert worden. Den ersten Weltkrieg hatte er aus der Sicht eines Halbwüchsigen erlebt, während sein dreizehn Jahre älterer Schwager Richard Walther bereits damals Soldat gewesen war.
„Ihr werdet sehen: Hitler wird es dem ganzen Slawenpack zeigen. Die 6. Armee dringt gerade in Stalingrad vor, der Ostfeldzug wird ein Triumph. Ein Tri-umph! Der Überlegenheit unserer germanischen Rasse können die faulen Säcke doch nichts entgegensetzen.“
„Mein Gott, Arthur. Krieg hat noch niemals etwas Gutes für die Menschen gebracht.“ Anna schauderte bei dem Gedanken an die vielen Opfer, die der Krieg bisher gekostet hatte.
„Weibergeschwätz. Der Deutsche bringt Ordnung in die Welt!“ Arthur stemmte ein weiteres Gläschen Selbstgebrannten in die Höhe und schüttete ihn mit Schwung in die Kehle. „Jawohl! Deutsche Gründlichkeit, Sauberkeit, Disziplin, Sitte und Anstand … Polen, Dänemark, Norwegen, Frankreich, Jugoslawien – zack, zack, zack. Alles im Blitzkrieg erobertes Gebiet!“
„Ja, das ging schnell am Anfang. Aber nun ist fast die ganze Welt gegen uns. Selbst die Amerikaner …“ Mit Grauen dachte Anna an den Kampf an allen Fronten.
„Huch, die Amis mit ihren Negern! Der schwarze Mann hat doch keinen Mumm. Vertraut mir, unser Adolf wird es schon richten.“ Leicht schwankend erhob sich Arthur Reschke vom Stuhl, nahm stramme Haltung ein, streckte den Arm zum Hitlergruß mit Inbrunst weit von sich und erklärte zackig: „Sieg Heil!“
„Arthur, ich glaube, du musst mal nach den Knechten sehen. Wer weiß, ob die alles richtig machen“, warf Ina, verschüchtert wie immer, wenn sie mit ihrem selbstherrlichen Mann sprach, ein. Einmal mehr dachte Anna, was für ein ungleiches Paar die beiden waren. Der schlanke, selbstbewusste, gut aussehende, sich immer betont gerade haltende Arthur und seine kleine, pummelige, unscheinbare Frau passten weder äußerlich noch vom Charakter her zueinander.
Geflissentlich überhörte Arthur den Vorschlag seiner Frau, zu gehen. „Tja, den faulen Polaken kann man nicht trauen. Kaum lässt man sie aus den Augen, beklauen sie einen wie die Raben. Es ist die Rettung für unsere Gegend, dass Hitler Zucht in diesen Sauhaufen hineinbringen lässt. Das Wartheland, Oberschlesien und Westpreußen können sich glücklich schätzen seit ´39 zum Deutschen Reich zu gehören! Die Polaken brauchen eine harte Hand, glaubt mir. Heil dem Führer!“ Wieder setzte Arthur schwungvoll das Glas an seine Kehle und stürzte den Inhalt in einem Zug hinunter.
„Aber, Arthur, man kann doch den Polen in ihrem eigenen Land nicht die Luft zum Atmen abschnüren! Wohin soll das führen? Der Hass ist in den letzten Jahren dermaßen gewachsen …“, versuchte Anna zu argumentieren.
„Papperlapapp. Die Polaken haben uns jahrelang auch klein gehalten.“
Ungemütlich rutschte Ina auf ihrem Stuhl hin und her. Aus einem für sie selbst unerfindlichen Grund riefen Arthurs politische Reden bei ihr Nervosität hervor. „Arthur. Unsere Knechte brauchen deine Aufsicht“, traute sie sich mit sanfter Stimme zu erinnern.
„Magst Recht haben. Die Kerle tanzen womöglich auf dem Tisch, wenn sie sich unkontrolliert fühlen“, stimmte Arthur mit Blick auf die halbvolle Schnapsflasche widerwillig zu. Leicht schwankend erhob er sich vom Stuhl. „Na, dann will ich mal los. Dank dir, Anna.“
„Ich habe euch für eure Hilfe tausend Mal zu danken. Nicht auszudenken, wenn Oskar etwas passiert wäre.“
„Nix als Unsinn im Kopf hat dieser Lausejunge. Da hilft nur unerbittliche Strenge. Unser Emil würde sich so etwas erst gar nicht trauen.“ Kopfschüttelnd verließ Arthur die Küche und die Frauen waren endlich unter sich.
Ina seufzte. „Er will aus unserem Emil einen ganz harten Burschen machen. Zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl, flink wie Windhunde – du weißt es ja. Dabei ist Emil gar nicht der Typ dafür. Ein gutherziger Junge ist der, aber das reicht Arthur nicht. Es gefällt ihm nicht einmal.“
„Diese Männer! Nichts als Ärger hat man mit ihnen. Solange sie jung sind, treiben sie Unfug wie im Brunnen zu verschwinden oder in den gefährlichen Weichselstromschnellen zu schwimmen. Wenn sie erwachsen sind, sterben sie sinnlos in Schützengräben, piesacken Menschen, die nicht so sind wie sie, und sie verehren einen Verrückten.“
„Anna! Also, wirklich. Wie kannst du so etwas sagen.“ Ina wirkte aufrichtig entsetzt. Leise flüsternd fügte sie hinzu: „So etwas darfst du nicht einmal denken.“
Eine Weile schwiegen die beiden Frauen.
„Sag mal, wie war es eigentlich neulich in Schröttersburg?“, wechselte Ina das Thema. „Du bist ja jetzt fast etwas Besonderes.“ In Inas Stimme lag ein Anflug von Neid. „Kommst ja in den Genuss von einigen Bevorzugungen. Das Vortrittsrecht an Behördenschaltern würde mir auch ganz gut gefallen. Zeig doch mal das Mutterkreuz her!“
„Das habe ich nicht mehr.“
„Wie – das hast du nicht mehr. Hast du es verloren?
Anna schüttelte langsam den Kopf, nicht sicher, ob sie ihrer Schwägerin gegenüber offen sein sollte. „Um ehrlich zu sein, war ich derartig wütend über die ganze Veranstaltung und das heuchlerische Getue, dass ich das Ding danach gleich in der Weichsel versenkt habe.“
„Anna!“ Ungläubig stand Ina der Mund offen. Sie hatte ja schon immer gewusst, dass Anna ein theatralisches Frauenzimmer war, aber dieses Mal ging sie nun wirklich zu weit.
„Ist doch wahr!“, beharrte Anna. „Die deutsche kinderreiche Mutter wird mit dem Frontsoldaten gleichgesetzt, weil beide den gleichen Einsatz für Volk und Vaterland erbringen. Das ist doch …“
Erwartungsvoll sah Anna ihre Schwägerin an.
„Na ja, ganz unrecht haben die nicht“, sagte Ina lau.
„Ich habe doch meine Kinder nicht wegen Volk und Vaterland zur Welt gebracht, sondern weil dein Bruder seine Finger nicht von mir lassen konnte!“, redete sich Anna in Rage.
Schockiert erhob Ina sich vom Stuhl. Na bitte, nie kannte Anna ihre Grenzen. Ina wandte sich zum Gehen, während Anna weiter schimpfte: „Die wollen doch nur, dass wir Frauen weiter Kanonenfutter für sie produzieren. Himmel, bin ich froh, über meine vier Töchter. Und bis Oskar groß genug ist, wird dieser Wahnsinn hoffentlich vorüber sein.“
Wortlos verließ Ina das Haus.
„Ja, geh´ nur und halte dich aus allem heraus, Ina“, murmelte Anna enttäuscht ihrer Schwägerin hinterher. Es war schwierig mit Menschen zu diskutieren, die sich scheuten eine eigene Meinung zu vertreten.
Unverwandt blickte Anna die Möhren auf dem Küchentisch an. In Kürze war Abendbrotzeit. Nun musste sie ein schnelles Mahl auf den Tisch bringen.
Von der Diele drang gut gelauntes Pfeifen in die Küche. Anna riss die Küchentür auf und entdeckte ihre älteste Tochter Tessa, die sich gerade im mannshohen Dielenspiegel betrachtete. Tessa war eine bemerkenswert hübsche, zartgliedrige Fünfzehnjährige mit den hohen Wangenknochen ihrer Mutter, klaren hellgrünen Augen und vollen, maronenfarbenen Haaren.
„Tessa, trödle nicht vor dem Spiegel herum. Hilf mir lieber in der Küche“, sagte Anna.
„Ist das Essen noch nicht fertig? Papa ist schon auf dem Weg vom Feld. Ich habe ihn gerade mit dem Fahrrad überholt.“ Tessa folgte ihrer Mutter in die Küche.
„Hole Eier und Speck aus der Speisekammer. Es gibt Rühreier mit Brot. Heute war hier die Hölle los, dein Bruder wäre fast im Brunnen ertrunken.“ Ärgerlich fixierte Anna ihre Tochter. „Wieso hast du nicht auf die Kleinen aufgepasst? Du hättest mir Bescheid sagen müssen, dass du fort gehst.“
Erstaunt riss Tessa ihre großen Augen auf: „Aber ich hab doch Ada lang und breit alles erklärt. Hat sie dir denn nichts gesagt?“ Geschäftig verschwand Tessa erst einmal in der Speisekammer. „Du hättest mich fragen müssen“, beharrte Anna als Tessa mit den Zutaten zurückkehrte. Sie machte sich am Herd zu schaffen und reichte Tessa einen großen Bund Petersilie. „Ach Mama, wenn du Kopfweh hast, lässt man dich am besten eine Weile in Ruhe.“ Tessa begann die Petersilie zu hacken.
Während der appetitanregende Duft des ausgelassenen Specks die Küche erfüllte, quirlte Anna drei Duzend Eier mit Salz und Pfeffer. „Du hattest einfach Angst, ich würde es nicht erlauben. Stimmt´ s? Wo warst du überhaupt?“
Tessa druckste herum. Sie hatte sich im Nachbardorf bei den Sieberts aufgehalten und das sah die Mutter nicht gerne. „Wieso interessierst du dich plötzlich dafür? Na ja, ich hab es doch mal erzählt: ich helfe Lisa Siebert bei den Deutschhausaufgaben. Ihr Deutsch ist wirklich jämmerlich. Wenn man bedenkt, dass ihre Eltern unsere Sprache kaum beherrschen.“
Anna nahm ihrer Tochter die fertig gehobelte Petersilie ab und warf die Kräuter schwungvoll in die Eiermasse. „Du weißt, ich halte es für besser, wenn du nicht so viel Zeit mit der Siebert-Sippe verbringst. Die haben sich auf dem Hof anständiger Leute breit gemacht. Und während die Karlowskis ins Generalgouvernement verfrachtet worden sind, fahren die Sieberts die Ernte ein.“
Als „Generalgouvernement“ wurde das polnische Restgebiet, das weder vom Deutschen Reich noch von der Sowjetunion einverleibt worden war, bezeichnet. Auch Warschau gehörte hierzu. Die Nazis betrachteten dieses Gebiet als auszubeutendes Nebenland. Willkür und Unterdrückung waren hier besonders groß. Vor einiger Zeit hatten die Deutschen begonnen die polnische Bevölkerung aus den annektierten Gebieten ins Generalgouvernement abzuschieben und den frei gewordenen Lebensraum mit Deutschstämmigen aus Russland, den Baltischen Staaten und Ostgalizien zu besiedeln. Wenn Anna an diese menschenverachtende Politik dachte, geriet ihr Blut in Wallung.
„Sei nicht ungerecht, Mama. Die Sieberts können doch nichts für die Politik. Die mussten ihren Hof in Litauen ja auch aufgeben, und nun müssen sie sich hier neu zu Recht finden. Außerdem: Wir können hier gar nicht genug Leute haben, die sich zu ihrem Deutschtum bekennen, sagt Hitler.“ Tessas Augen begannen zu leuchten, sie schwärmte: „Stell dir vor: Von nahezu überall her werden die Deutschen heim ins Reich geholt und im Reichsgebiet angesiedelt. Was für ein fantastischer Plan! Welche gewaltige Organisation dahinter steckt.“
„Nu, und diese Heimholung oder soll ich es Heimsuchung nennen …“
„Mama!“
„… das also findest du gut. Wenn wir für immer hier weg müssten und man würde uns wer weiß wohin schicken, da würdest du dich wohl freuen. Oder doch nicht?“ Anna schnaubte verächtlich. „Was ist das alles für ein hin und her?“
„Ach, Mama, du verstehst es nicht. Wir müssen den Slawen in unserem Land eben auch zahlenmäßig überlegen werden.“
„Gott der Allmächtige hat seine Schäfchen alle gleich lieb, der macht keinen Unterschied zwischen Polen, Deutschen oder sonst wem. Nur der Mensch macht alles kaputt. Unsere Familie hat immer dazu gestanden, deutsch zu sein, obwohl wir so manches Mal Nachteile dafür in Kauf nehmen mussten. Es ist noch gar nicht so lange her. 1915, im Weltkrieg war es, da hat man die Deutschstämmigen aus Polen nach Russland an die Wolga verfrachtet, weil man Angst hatte, sie würden für das Deutsche Kaiserreich spionieren. Als Minderheit in einem Land hat man es niemals leicht gehabt.“ Langsam redete sich Anna in Rage. Bevor Tessa etwas entgegnen konnte, entrüstete sie sich weiter. „Es ist doch sehr verwunderlich, wie zahlreich die Volksdeutschen plötzlich aus dem Erdboden schießen seit Hitler in Polen einmarschiert ist. Vor 1939 trugen die vielen Eingedeutschten noch ganz gewöhnliche polnische Namen.“ Anna gab den Teig zu dem brutzelnden Speck in die Pfanne und ließ die Masse langsam stocken. „Manche Menschen stehen eben immer auf der Seite, von der sie sich die größeren Vorteile erhoffen. Ein guter Pole ist auch in Notzeiten stolz auf seine Nationalität.“
Gelangweilt verdrehte Tessa ihre Augen. Sie dachte daran, wie arm die polnische Landbevölkerung zumeist war. Die Leute gingen schäbig gekleidet, Bauernhöfe und Dörfer wurden aus Geldmangel schlecht gehalten. Einige von Tessas Schulkameraden mussten sogar bei Frost und Schnee barfuß laufen, selbst am Essen mangelte es manchen. Die Deutschen würden dieses marode Land mit ihrem Organisationstalent und ihrem Fleiß in Ordnung bringen, davon war Tessa felsenfest überzeugt. Die Mutter war eben hoffnungslos unmodern und hatte den Geist der neuen Zeit nicht erkannt. Es musste noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Als sei sie eine unzufriedene Lehrerin schüttelte Tessa tadelnd den Kopf: „Ach Mama, immer nimmst du die Polen in Schutz. Ich verstehe dich nicht. Wir Deutschen haben genug Hass zu spüren bekommen. Ich weiß noch, wie oft ich früher gehänselt wurde als der Unterricht in Polnisch stattfand. Damit ist Schluss, seit unser Führer dieses Land errettet hat.“ Tessa beobachtete, wie sich ihre Mutter wütend mit dem Bratenwender an den Rühreiern zu schaffen machte. „Aber nun sind die polnischen Kinder die Dummen. Sie müssen deutsch reden und dürfen nur das Allernötigste lernen! Volksverdummung und Unterwerfung heißt das Ziel. Du wirst sehen Tessa, wir werden eines Tages bitter dafür büßen müssen.“
„Ja, ja.“ Tessa verspürte wenig Lust dieses leidige Thema auszuweiten. Außerdem hatte sie ihr Ziel erreicht, nichts von Zygmunt, dem Jungen mit den ach so himmelblauen Augen, erzählen zu müssen. Von draußen drang Stimmengewirr in die Küche, Tessa blickte zum Fenster hinaus. „Vater und die anderen sind schon im Hof.“
„Deck den Tisch. Schnell. Und sag deinen Geschwistern, sie sollen zum Essen kommen.“
Behände erledigte Tessa die Aufgabe und ging dann hinaus, um Ada, Luise, Mara und Oskar zu holen. Schweigend traten Richard Walther, drei seiner polnischen Knechte und die beiden Mägde in die Küche und nahmen am langen, schmalen Esstisch Platz. Wie auf Zehenspitzen schlichen die Walther-Kinder hinzu und setzten sich, was ungewöhnlich war, still auf ihre Stühle. In Anbetracht des heutigen Ereignisses hielten die Kinder es für das Klügste, das Familienoberhaupt nicht weiter zu reizen. Nur Oskar zog etwas blauäugig in Betracht, der Vater könne seine Drohung vergessen haben. Die Älteren befürchteten dagegen eine Bestrafung, da der Vater ihnen vermutlich die Mitschuld an der Brunnengeschichte geben würde. Wortlos füllte Anna das Rührei auf die Teller und stellte frisches Kümmelgraubrot und Butter auf den Tisch. Dann wurde ein Tischgebet gesprochen. „Herr wir danken dir …“
Hungrig vertilgten sie das Mahl. Richard ließ sich von Anna das vom Speckbraten ausgelassene, flüssige Fett in eine große Tasse füllen und trank es in wenigen Zügen aus. Dann leckte er sich zufrieden die Lippen. Zum Nachtisch gab es duftenden Milchreis mit süßem Apfelkompott.
Gut gesättigt sieht die Welt schon freundlicher aus.
Knechte und Mägde dankten für das Mahl und verließen das Haus.
Anna wartete gespannt darauf, welche Strafe ihr Mann für die Kinder ersonnen hatte. Richard Walther räusperte sich und sagte ernst, aber mit unerwarteter Milde: „Kinder, was ihr heute angestellt habt, jeder von euch ist gemeint, war töricht und unverantwortlich. Oskar hätte sein Leben lassen können. Ihr seid alle alt genug, um diese Gefahr zu erkennen. Es ist bekannt, dass Oskar zuweilen das Denken vergisst und sich und andere in schlimme Situationen bringt. Ihr Großen hättet ihn daran hindern müssen. Tessa,“ Richard Walther blickte seine Älteste vorwurfsvoll an, „von dir hätte ich auf jeden Fall erwartet, dass du einschreiten würdest.“
„Ich war doch gar nicht da“ erwiderte Tessa kleinlaut.
„Sie hat sich einfach nicht bei mir abgemeldet, wir haben darüber schon ernsthaft gesprochen“, warf Anna ein.
„Na ja, das steht auf einem anderen Blatt. Aber du, Ada, du hättest es doch auch verhindern können, oder nicht?“ forschte der Vater weiter.
Das Gesicht der zwölfjährigen Ada lief rot an. „Oskar wollte nicht auf mich hören. Er hat mich ausgelacht.“
„Oskar macht immer, was er will“, sprang die siebenjährige Mara ihrer Lieblingsschwester bei.
„Ja, er sagte: Haut ab ihr tumben Gänse, ihr habt doch nur Schiss in der Hose. Ein deutscher Junge hat keine Angst“, traute sich Ada nun zu erzählen.
„Und was meinst du dazu, Luise?“, wandte sich Richard Walther an seine schweigsame, ernsthafte Tochter.
„Es war nicht recht von uns, Vater. Trotzdem, Oskar ist mutig gewesen. Als wir ihn nicht so schnell retten konnten, war er stark und hat sich ganz lange festgehalten – ohne zu jammern oder zu weinen. Ich habe ihn dafür bewundert“, sagte Luise leise. Ein kluges Mädchen, dachte Richard voller Stolz. Er blickte in die Runde gespannter, junger Gesichter und blieb beim eigentlichen Übeltäter Oskar hängen, der seinen Kopf reumütig gesenkt hielt.
„Furchtlosigkeit, mein lieber Sohn, macht nur Sinn in Verbindung mit Überlegung. Sich gedankenlos in eine gefährliche Situation zu begeben, kann oft die einzige Gelegenheit zur Kühnheit im Leben sein. Danach liegt man nicht selten gar nicht heldenhaft mausetot unter der Erde. Mut ist eine hohe Tugend, wenn er zusammen mit Verstand eingesetzt wird.“ Richard seufzte. „Ich glaube, diese einfache Weisheit ist allgemein in Vergessenheit geraten.“ Richard hoffte, die Kinder hatten seine Botschaft verstanden. „Ihr dürft jetzt auf eure Zimmer gehen. Aber, ich rate euch, reizt mich diese Woche nicht mehr. Sonst ist eine gehörige Tracht Prügel fällig – für jeden von euch!“
Während Anna ihrem Mann einen Krug Bier einschenkte, wunderte sie sich wie so oft über seine natürliche Gabe, im entscheidenden Moment das Richtige zu sagen und weise zu handeln.
Nur aus diesem Grund, mein Lieber, habe ich es überhaupt solange mit dir ausgehalten.
„Was für ein Tag“, sagte Richard. Seine Gesichtszüge spannten sich erneut an. „Ich habe Nachricht aus Hohenburg erhalten. Es gibt Ärger wegen der Mieter der Wohnung im zweiten Stock. Der Czerny ist von der Gestapo verhaftet worden, wegen antideutscher Machenschaften. Seine Frau wird die Miete bald nicht mehr aufbringen können, fürchte ich. Kannst du nicht mal mit ihr reden? Bei dem schönen Wetter kann ich es mir im Moment nicht erlauben, die Ernte zu unterbrechen.“ Anna stimmte zu, sie hielt sich gerne in dem Städtchen Hohenburg auf und kümmerte sich des Öfteren um die Belange des Mietshauses.
„Eine schlimme Zeit“, klagte sie und schenkte sich nun auch etwas von dem kühlen Bier ein. So saßen die Eheleute friedlich wie selten beieinander und genossen die Ruhe in ihrem Haus. Denn von den Kindern war tatsächlich an diesem Abend nichts mehr zu hören oder zu sehen.
3 Jerzy (Eins)
Anna:
Mit neunzehn erwischt mich die Liebe so wuchtig, wie der Amboss des Schmiedes das Eisen traf, so gezielt wie der Habicht sich auf seine Beute stürzte, so unausweichlich, wie der Gewitterblitz in die hoch aufragende, einsame Eiche auf der Wiese einschlug.
Auf dem Markt in Warschau half Jerzy Olzsewski am Stand seines Onkels, dem Obsthändler. Ich glaube, alle Frauen schmachteten ihn heimlich an, denn er hatte die glutvollsten Augen, die man sich erträumen kann, und ein furchtloses, siegesgewisses Piratenlachen. Am Ende des Markttages überreichte mir Jerzy eine einzelne rote Rose.
Meine Eltern hätten Jerzy, den Polen, niemals als Heiratskandidaten akzeptiert.
Drei Jahre lang trafen wir uns immer wieder heimlich. Dann verließ Jerzy unsere Gegend, um in Danzig auf einem Frachter anzuheuern. Die Welt zu sehen, das war sein Traum.
Hohenburg, das vor der deutschen Besatzung polnisch Wyszogród hieß, war ein hübsches, altes, etwa 6300 Einwohner zählendes Städtchen am rechten, hohen Weichselufer. Der seit tausend Jahren besiedelte Ort hatte polnische, jiddische und deutsche Wurzeln. In den Gotteshäusern verschiedener Glaubensrichtungen huldigte man – auch wenn die Einsicht hierfür manchem Gemeindemitglied fehlte – dem einen Gott.
Die Bewohner der umliegenden Dörfer kamen hierher, um sich mit Dingen zu versorgen, die sie nicht selber herstellen konnten. Daher gab es eine Anzahl nützlicher kleiner Läden wie ein Kurzwaren-, ein Schreibwaren- und ein Schuhgeschäft. Besonders das Café Chopin übte einen großen Reiz auf die weibliche Kundschaft vom Lande aus. Anna hatte im Sinn, sich später bei einer Tasse Mokka und einem Stückchen Kuchen von ihren Besorgungen zu erholen, doch zunächst war das Walthersche Mietshaus ihr Ziel.
Mit flotten Schritten ging sie über die steinerne Brücke im Herzen Hohenburgs. Eine tiefe Schlucht verlief längs des Ortes und teilte das Städtchen in zwei Teile. Wie immer fühlte sich Anna in Hohenburg wohler als in Puschkeiten. Selbst wenn Hohenburg im Vergleich zu Annas geliebtem Warschau nur einen zarten Hauch von Weitläufigkeit atmete, bewirkte der Aufenthalt in dem Städtchen, dass sich Annas Körpergefühl veränderte. Sie straffte ihre Schultern, reckte das Kinn ein kaum wahrnehmbares Stückchen höher, ihr Gang wurde eleganter, geschmeidiger, … oder lag es nur an den neuen weißen Schuhen mit den hohen Absätzen? In ihrem hellgrauen Kostüm fühlte sie sich wie eine Dame von Welt. Sie trug einen eng geschnittenen Rock, eine schlichte weiße Bluse mit langgezogenem Kragen, eine farblich auf die Schuhe abgestimmte Handtasche und als i-Tüpfelchen einen kecken Hut mit steil hochragender Feder, genau wie sie es bei Zarah Leander in einem ihrer Filme gesehen hatte.
Manchmal konnte Anna kaum glauben, wie schnell die Zeit vergangen war, seit sie Richard geheiratet hatte. Einundvierzig Jahre alt war sie jetzt, was blieb ihr wohl noch, überlegte Anna. Sah sie tatsächlich auch so verbraucht aus, wie ihre Altersgenossinnen auf sie wirkten? Sie dachte an graues, glanzloses Haar, steile Zornes- und Sorgenfalten, Krähenfüße und an von vielen Geburten aus der Fasson geratene Körper. Vor der Auslage des Schuhgeschäfts blieb Anna stehen und betrachtete wohlgefällig ihr Spiegelbild im kleinen Schaufenster.
Eine ordentlich proportionierte, gut frisierte Frau mittleren Alters mit ebenmäßigen Gesichtszügen blickte ihr entgegen. Das noch immer dunkle Haar kontrastierte mit den wasserblauen Augen.
Ja nu, der liebe Gott ist bisher ganz gnädig mit mir.
Der Gleichklang schwerer Stiefel, die über das Kopfsteinpflaster stampften, unterbrach sie in ihren Gedanken. Eine etwa zehnköpfige Truppe braun uniformierter SA-Leute zog singend und Fahnen schwenkend die enge Gasse hinunter und steuerte direkt auf sie zu. Scheinbar wie abgesprochen erhoben die SA-Leute im selben Moment den Arm zum Hitler-Gruß. Anna spürte die Blicke der Männer auf sich gerichtet. Ihr blieb keine andere Wahl als sich mit dem Rücken an das Schaufenster zu pressen und die Gruppe an sich vorbeiziehen zu lassen. Einer der Männer streifte im Vorbeigehen ihre Brust, einen Augenblick lang blieb er bedrohlich dicht vor ihr stehen. Er hatte schmale, dunkle Augen und ein schwarzes Hitlerbärtchen über einem herzförmigen, kleinen Mund. Der nachfolgende Kamerad raunzte ihn an: „Mach Platz!“.
Nun presste sich der Schnauzbärtige noch näher an Anna. Verwirrt spürte sie seine körperliche Erregung. „Du musst den Arm zum Hitler-Gruß ausstrecken, wie es sich gehört! Wann begreift ihr dummen Polaken das endlich?”
Der Schnauzbärtige setzte sich wieder in Bewegung und fiel lauthals in das SA-Lied ein, das seine Truppe inzwischen angestimmt hatte.
Annas Herz pochte ihr bis zum Hals.
„Sie müssen mich nicht belehren, ich bin Deutsche”, sagte sie wütend, doch ihre Worte gingen im lauten Gegröle unter. Der Mann hielt wieder Schritt mit seinen Kameraden und hörte sie nicht mehr.
Du aufgeblasene Erdkröte!
Rauchend vor Zorn riss Anna die Ladentür zum Schuhgeschäft auf, aus der in diesem Moment ein schlanker, fast zierlicher Herr mittleren Alters trat.
„Jerzy”, flüsterte Anna und spürte ein leichtes Flattern in ihrem Bauch.
Ungläubig musterte der Angesprochene Anna. Augenblicklich huschte ein charmantes Lächeln über das schmale Gesicht des Mannes.
„Das gibt es doch gar nicht! Meine Anna. Jung und schön, so als hätten wir uns erst gestern zuletzt gesehen.” Formvollendet beugte Jerzy Olzsewski den Rücken und küsste Annas Hand. Dabei konnte und wollte eine Frau wie Anna Walther es nicht bewenden lassen. Von großer Wiedersehensfreude erfüllt, nahm sie ihren Jugendfreund Jerzy in die Arme und drückte ihn fest an sich.
In einem so kleinen Städtchen wie Hohenburg es war, blieb selten etwas unentdeckt, und es gab genügend Gelangweilte, deren schönste Freizeitbeschäftigung darin bestand, hinter Gardinen versteckt, gierig jede Begebenheit auf der Straße zu registrieren, sich Gedanken dazu zu machen und Schlüsse daraus zu ziehen. Wären Anna und Jerzy nicht so überrascht und überwältigt von ihrer Begegnung nach so vielen Jahren gewesen, hätte vielleicht Anna, bestimmt aber Jerzy darauf geachtet, eine Szene von so offensichtlicher Vertrautheit zu vermeiden.
„Jerzy, mein lieber Jerzy, was machst du hier, um Himmels willen?”
„Wenn ich gewusst hätte, wo du zu finden bist, wäre ich schon viel eher gekommen”, schmunzelte Jerzy. „Nun, ich habe einen Besuch zu machen. In Richtung Gasthof Blunske führt mich mein Weg. Ich glaube, in der nächsten Seitengasse muss es sein.”
Anna lachte fröhlich auf. „So ein Zufall, dort will ich auch hin. Komm.” Sie hakte Jerzy unter. „Was willst du dort? Etwas essen? Dann weiß ich etwas Besseres, ich lade dich ins Café Chopin ein, da ist es viel netter. Dort können wir uns unterhalten, ja?”
„Später gerne. Aber erst mal muss ich einer Verwandten, die in Schwierigkeiten steckt, einen Besuch abstatten. Sie wohnt über der Gastwirtschaft.”
„Doch nicht Frau Czerny? Zu der will ich nämlich auch! Was willst …”
„… du denn da?” fiel Jerzy ihr ins Wort.
Anna protestierte lachend: „… nein, du zuerst.”
Jerzy sah Anna forschend an. „Nun, Frau Czerny ist eine entfernte Cousine von mir. In diesen Zeiten muss man sich umeinander kümmern, du verstehst?”
Obwohl sich Anna über Jerzys abschätzenden Blick wunderte, war sie erleichtert über seine Auskunft. Sie erzählte Jerzy, dass ihr Mann Richard und sie die Eigentümer des Hauses in der Weichselgasse seien und dass sich Richard darum sorge, ob Frau Czerny in Zukunft das Mietverhältnis aufrechterhalten könne, da sie nun – hoffentlich nur vorübergehend, aber wer wusste das schon genau – ohne den Verdienst ihres Mannes auskommen müsse.
Jerzy machte einen Vorschlag: „Da wir wegen derselben Angelegenheit zu Clara Czerny wollen, können wir sie ja gemeinsam besuchen. Vielleicht kann ich gleich helfen, die Mietsache zu klären.”
„Ein ausgezeichnete Idee, und danach gehen wir zusammen ins Café, ja?” strahlte Anna.
„Ich freue mich, dass du dir deine Lebensfreude erhalten hast, Anna. Das ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit”, stellte Jerzy fest.
„Höre ich da einen leisen Tadel? Ich mag dieses Regime auch nicht”, flüsterte Anna, als sie den Gasthof erreichten.
Das Stadthaus der Walthers reihte sich schmal in eine Zeile ähnlicher Bauten ein. Von außen verbarg das zweigeschossige, adrette Haus das Geheimnis seines lang gestreckten Anbaus, der sich wie der Schwanz eines Flusskrebses an den Hauptteil angliederte. Anna schloss die schwere, hölzerne Eingangstür auf. Gemeinsam mit Jerzy betrat sie den dunklen Hausflur, in dem ein intensiver Kohlgeruch hing. Anna zeigte auf die Tür, die rechts vom Flur abzweigte.
„Das ist der Hintereingang von der Gaststube Blunske.”
Anna erklärte, dass das Blunske über den Innenhof des Hauses, der durch einen Torbogen mit der seitlich angrenzenden Gasse verbunden sei, zu erreichen war. Sie zeigte auf die Holztreppe, die links neben der Haustür lag, und winkte Jerzy ihr zu folgen.
„Im gesamten Haus wohnen sechs Mietparteien”, erzählte Anna, während sie die Stufen hinaufstieg. „Bis vor einem Jahr hatte sogar ein sehr netter Fotograf sein kleines Atelier hier. Er hat ganz wunderbare Aufnahmen von meinen Kindern und mir gemacht. Schade, ich habe leider keines der Fotos dabei. Von einen Tag auf den anderen war der Mann plötzlich verschwunden …” Sie hatten den zweiten Stock erreicht. Anna klopfte an die Wohnungstür der Czernys.
„War er Jude?” flüsterte Jerzy.
Anna blieb ihm die Antwort schuldig, denn in diesem Moment wurde die Tür von Clara Czerny, einer etwa dreißigjährigen knochigen Blondine mit rot geweinten Augen, stürmisch aufgerissen.
„Frau Walther, ich hab sie vom Fenster aus kommen sehen. Ich habe mir schon gedacht, dass sie mir einen Besuch abstatten würden”, sagte Frau Czerny und sah trotz ihrer geschwollenen Augen neugierig zu dem gut aussehenden Mann neben ihrer Vermieterin. Doch bevor sie weitersprechen konnte, fiel Jerzy ihr ins Wort.
„Liebe Cousine, schön dich nach so vielen Jahren wieder zu sehen. Mein Gott, wie lange ist es her? Wir waren ja fast noch Kinder …”
Anna fing überrascht Frau Czernys irritierten Blick auf.
Fast beschwörend fügte Jerzy hinzu: „Schrecklich, was deinem Mann widerfahren ist, aber die Familie, unsere gute treue polnische Familie wird dir zur Seite stehen. Sie haben mich gebeten, mich um dich und die Kinder – es sind doch zwei – zu kümmern.”
Nun schien Clara Czerny ihren Cousin wieder zu erkennen, hoffnungsvoll antwortete sie: „Gut das zu wissen. Die beiden Mädchen sind bei Freunden zum Spielen, wir haben Ruhe.” Sie hielt einen Moment inne, dann brach es aus ihr heraus: „Oh Gott, es ist alles so eine Katastrophe, ein Wahnsinn. Sie wollen mir nicht sagen, wohin sie Anton gebracht haben. Was kann er schon Böses getan haben? Ich war gestern bei der Gestapo, sie haben mich hinausgeworfen, beschimpft und gegen eine Flurwand geschleudert. Wenn ich mich dort noch mal sehen lasse, wollen sie mich auch verhaften … Ich habe solche Angst, dass Anton tot ist.”
„Diese Schweine”, zischte Jerzy wütend.
Anna schwieg betreten, unerklärlicherweise fühlte sie sich mitschuldig am Verschwinden Anton Czernys.
Frau Czerny schluckte ihre Tränen hinunter und putzte sich die Nase. „Verzeihen Sie, ich bin unhöflich. Kommen Sie ins Wohnzimmer, Frau Walther, und du auch, lieber Cousin, wir trinken ein Tässchen Tee zusammen.”
Im Wohnzimmer sitzend einigten die drei sich darauf, dass Jerzy die Mietkosten für die nächsten drei Monate übernehmen würde. Falls bis dahin Frau Czernys Mann nicht aus der Gestapohaft aufgetaucht sein würde, was man leider ins Kalkül ziehen musste, würden die drei Czernys bei Verwandten in Warschau Unterschlupf finden.
Nachdem diese Angelegenheit geklärt war, verließen Anna und Jerzy die Wohnung, um das Café Chopin aufzusuchen.
*
Im Café Chopin waren nur wenige Plätze besetzt. Jerzy und Anna hatten einen kleinen Ecktisch für sich allein. Der Apfelkuchen, den Anna von ihren Lebensmittelkarten spendierte, bestand aus einer dünnen Schicht Mürbeteig nach Kriegsart – das heißt, das verarbeitete Mehl war offensichtlich von minderer Qualität gewesen – und einer verhältnismäßig üppigen Lage von saftigen Boskop-Äpfeln.
Anna raunte Jerzy zu: „Die arme Frau Czerny … Dieser Krieg ist so furchtbar … Du bist doch nicht wirklich ihr Cousin?”
Jerzy lachte, aber das Lachen klang falsch. Er konzentrierte sich auf das Kuchenstück auf seinem Teller, sah es mit gespielter Bewunderung an: „Ach, des Septembers reiche Fülle … Weißt du noch, Anna, wie du mich mit leckeren Äpfeln gefüttert hast, wenn wir uns heimlich in den Weichselauen trafen … Eigentlich habe ich gar keine Zeit, hier so gemütlich mit dir rum zu sitzen, aber ich konnte deiner Aufforderung einfach nicht widerstehen. Du hast mich in der Hand, das war schon immer so.” Wieder ließ Jerzy sein charmantes Lächeln aufblitzen, und Anna verlor sich in den schwarzen, tiefgründigen Augen ihrer Jugendliebe.
„Bist du verheiratet? Hast du Kinder?” wollte sie wissen. „Verheiratet bin ich nicht. Aber einen Sohn habe ich. In Rotterdam.” Anna sah Jerzy fragend an. Er trank einen Schluck Mokka und stellte die Tasse wieder ab. „Ja, da staunst du. Ich bin jahrelang zur See gefahren. Danzig war mein Heimathafen, von dort aus habe ich die ganze Welt als Funker auf großen Frachtschiffen bereist. In Rotterdam war ich oft, dort habe ich Geertje kennengelernt, sie bekam unseren Sohn Adam. Wir wollten heiraten, aber als ich nach großer Fahrt nach Rotterdam zurückkehrte, hatte sie sich für einen anderen Mann, einen reichen Juden, entschieden.” Verständnislos schüttelte Jerzy den Kopf. „Nun wächst mein Sohn, er ist inzwischen neun Jahre alt, in unsicheren Verhältnissen heran. Die Deutschen jagen die Juden in Holland genauso wie bei uns in Polen.”
Mitfühlend sah Anna ihn an, leise sagte sie: „Aber in diesem Land ein polnisches Kind zu sein ist momentan auch keine Freude. Fährst du noch immer zur See?”
„Das ist vorbei.” Jerzy zündete sich eine Zigarette an und nahm genussvoll einen Zug. „Jetzt möchte ich etwas über dich wissen. Wie ist es dir ergangen, nachdem du von Zuhause fort bist?”
Anna begann von ihrem Leben auf dem Bauernhof und von ihren Kindern zu erzählen. Sie berichtete auch von ihrem Vater Jakob, der kurz vor seinem Tod vor zwölf Jahren bei der Finanzierung des Mietshauses in Hohenburg geholfen hatte. Aufmerksam hörte Jerzy zu.
„Du hast deinen Mann noch gar nicht erwähnt, ihr versteht euch?” wollte er wissen.
Anna seufzte. ”Was will man von einer arrangierten Ehe schon erwarten? Richard und ich sind so grundverschieden, man könnte sagen, zwei Welten sind aufeinandergeprallt. Anfangs hat Richard mich regelrecht angebetet, doch seit langer Zeit bin ich nur noch eine bessere Arbeitsmagd für ihn. Oft beschimpft er mich, ich sei eine miserable Bäuerin, die nichts zustande bringt. Und das bin ich wohl auch. Nie habe ich mich darum gerissen, so ein Leben zu führen. Aber hier in Hohenburg fühle ich mich wohl.”
Anna fiel auf, wie Jerzys Aufmerksamkeit auf irgendetwas, das sich hinter ihrem Rücken abspielte, gelenkt wurde. Sie drehte sich um. Zwei blonde, knochige Schulmädchen, beinahe unverkennbar Clara Czernys Töchter, kamen zögernd auf ihren Tisch zu. Sie knicksten höflich und begrüßten Anna, dann wandte sich das ältere Mädchen mit schüchterner Stimme an Jerzy: „Meine Mutter lässt Sie herzlich bitten, bereits jetzt nochmals zu ihr zu kommen. Es sei sehr, sehr wichtig, soll ich sagen.”
Ohne zu zögern erhob sich Jerzy vom Stuhl.
„Tut mir leid, Anna, ich muss los. Es war sehr schön dich wieder zu treffen.”
Nein! Du kannst mich doch nicht so schnell wieder verlassen, wir haben uns doch gerade erst wieder gefunden!
In diesem Moment fühlte sich Anna wie berauscht von der altbekannten Anziehungskraft, die von Jerzy ausging. Alle in den vergangenen siebzehn Jahren langsam, aber stetig verblassten Gefühle für ihn flammten plötzlich mit der Kraft eines sommerlichen Waldbrandes nach anhaltender Dürre wieder auf. Am liebsten hätte sie sich auf Jerzys Schoß gesetzt, ihre Arme eng um ihn geschlungen und ihn niemals mehr losgelassen. Doch zugleich spürte Anna deutlich, aus irgendeinem Grund durfte sie ihren alten Freund nicht aufhalten. Etwas in seinem Benehmen hatte sich, in dem Augenblick als die Mädchen das Café betreten hatten, verändert. Hinter Jerzys beherrscht wirkender Fassade verbarg sich Nervosität, vielleicht sogar Angst.
„Jerzy, ich hoffe wir sehen uns wieder …, bald …”
„So Gott will”, meinte Jerzy und küsste flüchtig noch einmal Annas Hand, ehe er mit den Kindern das Café verließ.
Nachdenklich schaute Anna auf die anderen Besucher des Cafés. Von einem Fensterplatz aus nickte ihr eine dicke Frau, deren feistes, rosiges Gesicht kaum noch Konturen aufwies, grüßend zu. Anna erkannte Emma Hammer, die Frau des deutschen Schlachters und gute Bekannte Ina Reschkes. Plötzlich fühlte sich Anna im Chopin nicht mehr wohl, sie ließ sich die Rechnung bringen und zahlte. Beim Verlassen des Cafés hatte sie das Gefühl, als bohrten sich Blicke in ihren Rücken.
Albern, dachte Anna, warum habe ich ein schlechtes Gewissen? Ich habe doch bloß mit einem alten Jugendfreund in aller Öffentlichkeit ein Stück Kuchen gegessen. Und zum Glück hat ja niemand meine Gedanken lesen können.
Wie es ihrer Art entsprach beschäftigte Anna sich nicht gerne mit Dingen, die nicht mehr zu ändern waren, und so schüttelte sie aufkommende Bedenken schnell ab und ging noch kurz vor Ladenschluss ins Schuhgeschäft, um sich durch den Kauf eines neuen Paares abzulenken.
4 Treffpunkt Doppeleiche
Am Nachmittag desselben Tages radelte Tessa Walther erwartungsvoll den schmalen, verschlungenen Pfad am Weichselufer entlang. Nach dem heftigen Gewitter am Vorabend war die Luft etwas abgekühlt, das Laub der Bäume und die Gräser schimmerten noch feucht von den Regengüssen der vergangenen Nacht und die Sonne hatte sich den ganzen Tag lang noch nicht gezeigt. Für heute war Tessa mit Zygmunt bei der Doppeleiche verabredet. Tessa blieben nur noch wenige Tage unbeschwerter Freiheit zu Hause. Nächste Woche sollte sie das für Mädchen im Nationalsozialismus übliche Pflichtjahr beginnen. In dieser Zeit würde sie als Hilfskraft in einer kinderreichen Familie hauswirtschaftliche Aufgaben erledigen müssen. Einerseits freute sich Tessa darauf, für eine Weile ihren oftmals lästigen jüngeren Geschwistern zu entfliehen, andererseits befürchtete sie, es würde in der Gastfamilie auch nicht besser zugehen. Als Tessa den Treffpunkt erreichte, bemerkte sie enttäuscht, dass von Zygmunt noch nichts zu sehen war. Sie parkte ihr Fahrrad und lehnte sich versonnen an den Stamm der prächtigen alten Eiche.
Bei ihrer Nachhilfeschülerin Lisa auf dem Bauernhof hatte Tessa den blonden, blauäugigen Zygmunt in diesem Sommer kennen gelernt. Er war eigentlich ein Gymnasiast aus Warschau, doch die höheren Schulen waren für Polen seit dem Einmarsch der Deutschen geschlossen, und seine Eltern hatten ihn aufs Land geschickt, weil sie dies für sicherer hielten. Bei den Sieberts arbeitete er nun als Erntehelfer. Zygmunt sprach nur polnisch, was für Tessa aber kein Hindernis darstellte. Denn im Gegensatz zu ihren Eltern parlierten die Walther-Kinder fließend polnisch, und sie konnten mühelos – wenn nötig, mitten im Satz – von dieser Sprache ins Deutsche wechseln. Tessas Bewunderung für den siebzehnjährigen Polen war groß, weil Zygmunt klug und lustig war. Aber vor allen Dingen entsprach er dem Naziideal des nordischen Menschen vollkommen. Es konnte gar nicht anders sein, Zygmunt musste einfach germanische Vorfahren haben, da war sich Tessa sicher. Wenn sie ihn nur ansah, fühlte sie sich, als hätte sich ihr Gehirn schlagartig in ein luftiges Wattebällchen verwandelt.
„Ach Zygmunt, wo bleibst du nur?” seufzte Tessa sehnsüchtig. Gelangweilt vom Warten holte sie die Kinderfibel, die sie sich als Übungsmaterial für Zygmunt aus Oskars Schulranzen ausgeliehen hatte, aus ihrem Rucksack hervor und blätterte lustlos darin. Da Oskar sowieso zu faul war, die Hausaufgaben allein zu erledigen, würde das Fehlen des Buches erst am Abend auffallen, wenn Ada ihren kleinen Bruder zum Lesenlernen auffordern würde. Bis dahin wollte Tessa wieder Zuhause sein. Zygmunt, der erst seit einigen Wochen auf dem Hof von Lisas Eltern aushalf, hatte Tessa darum gebeten, ihm etwas Deutsch beizubringen. Als er vorschlug, sich an diesem idyllischen Ort mit ihr zu treffen, hatte Lisa wissend gekichert und Tessa war zu ihrem großen Ärger rot geworden. Nun also saß Tessa wie verabredet hier, sie begann missmutig zu werden. Schon zwanzig Minuten zu spät! Vielleicht hatte der schöne Zygmunt sie nur foppen wollen, dachte sie gekränkt.
Nach einer Stunde vergeblichen Wartens machte sich Tessa enttäuscht auf den Heimweg. Die feuchten Zweige und Blätter, die sie beim Fahrradfahren streifte, und die sie auf dem Hinweg noch als erfrischend und belebend empfunden hatte, störten sie nun. Wütend drosch Tessa auf sie ein, wenn sie ihr im Weg waren. Stirnrunzelnd sah sie zwei Gestalten auf sich zu kommen und bald wurde ihr klar, es handelte sich dabei um Lisa, die die kleine Mara im Schlepptau hatte. Die beiden Gänse hatten ihr gerade noch gefehlt, dachte Tessa ärgerlich. Ohne auf die Rufe der beiden zu achten, wollte sie an den Fußgängerinnen vorbeirauschen.
Da brüllte Mara unüberhörbar: „Nachricht von Zygmunt!”.
Tessa bremste scharf.
„Was ist mit ihm?” fragte sie ungeduldig.
Die für ihre dreizehn Jahre körperlich weit entwickelte, stämmige Lisa hob scheinbar überrascht eine Augenbraue hoch. „Aha, jetzt ist die Dame also doch interessiert.” Lisa machte eine Sprechpause und genoss die plötzliche Macht, die sie nun über die oftmals oberlehrerhafte Tessa spürte. Ein paar Mal zu häufig hatte Tessa ihrer Nachhilfeschülerin zu verstehen gegeben, dass sie diese für schwer von Begriff hielt. „… ja, da war doch etwas, was wir dir ausrichten sollten, was hat Zygmunt nur gesagt? Leider habe ich so ein schwaches Gedächtnis, du weißt es ja …”
Die kleine Mara, die sich sonst am liebsten zurückhielt, sah Lisa verständnislos von der Seite an.
„Na, Zygmunt muss zum Arbeitsdienst nach Deutschland. Er will dir bald schreiben”, platzte es aus ihr heraus und sie beendete damit die Qual ihrer Schwester. Verwundert wandte sich Mara an Lisa. „Wieso weißt du das denn nicht mehr, Lisa? Eben, als du bei uns auf dem Hof nach Tessa gesucht hast, hast du es mir doch selbst gesagt.”
Tessa bedachte die spöttisch lächelnde Lisa mit einem vernichtenden Blick. „Und das konntest du dir nicht merken! Ins Reich muss er also, na, da wird er es auf jeden Fall besser haben als bei euch.”
„Pah, mein Vater sagt, die Reichsdeutschen wissen gar nicht, welchen Fehlgriff sie mit Zygmunt getan haben, der ist so langsam beim Arbeiten. Außerdem hat er sich sowieso nur für die Röcke der Mägde und anderer Weibsleute interessiert.”
Zornig zog Tessa die vor Schmerz aufschreiende Lisa heftig an ihren langen, dunkelbraunen Zöpfen. „Du Aas, such dir eine andere, die versucht, deinem Spatzenhirn Deutsch einzutrichtern. Vermutlich wird es auf ewig verlorene Mühe sein. Mara, setz dich auf den Gepäckträger, wir fahren nach Hause.”
Als sie auf dem Waltherschen Hof ankamen, trafen die beiden Schwestern nur die Küchenmagd Jadwiga an. Die Mutter war noch nicht aus Hohenburg zurückgekehrt und der Vater arbeitete auf dem Feld. Tessa musste sich wohl oder übel bis zum Abend gedulden, um etwas über die Fremdarbeiter zu erfahren, die von den deutschen Machthabern ins Reich zwangsverschickt wurden.
Schließlich ließ sich der Vater nach dem Abendessen in ein Gespräch verwickeln. Angetan von dem plötzlichen Interesse seiner ältesten Tochter an diesem Thema erzählte Richard bereitwillig von dem seit Jahren andauernden Mangel an Knechten bei den deutschen Bauern im Reich. Durch die Einberufungen zur Wehrmacht hatte sich die Situation im Krieg weiter verschärft, daher war man darauf verfallen, das Problem durch den Einsatz zumeist polnischer Arbeitskräfte zu mildern. Noch zu Kriegsbeginn warb man Arbeitskräfte auf freiwilliger Basis an. Doch zu wenig Polen ließen sich von den unattraktiven Aussichten wie geringer Lohn und Verpflichtung zu unbegrenzter Arbeitsleistung ohne Urlaubsanspruch ins Reich locken. Nachdem der Versuch, freiwillige Arbeitskräfte nach Deutschland zu werben, fehlgeschlagen war, hatten die Nazis Zwangsmaßnahmen ergriffen. Mittlerweile wurden Dörfer und Städte durchkämmt, tagsüber waren Kirchen- oder Kinobesucher in Gefahr eingefangen zu werden und sogar nachts wurden Arbeitstaugliche aus ihren Betten gezerrt. Richard Walther hatte stets ein wachsames Auge auf die eigenen Knechte und Erntehelfer.
„Wie ergeht es den Fremdarbeitern im Reich, Vater?” fragte Tessa, nun doch ziemlich beklommen.
Richard Walther zuckte mit den Achseln: „Na ja, ich nehme an, das wird von Fall zu Fall verschieden sein. Wenn Bauer und Fremdarbeiter willig sind, wird es für die Polen auch nicht anders sein als in ihrem eigenen Land zu arbeiten. Während meiner Soldatenzeit habe ich gelernt: Es gibt unter den Menschen, unabhängig davon welcher Nationalität sie angehören, solche und solche. Die einen bleiben menschlich, egal mit wem sie es zu tun haben, die anderen werden zu hochmütigen Bestien. Ich habe längst aufgehört, das begreifen zu wollen. Vielleicht wirst du eines Tages klug daraus werden, mein Kind.”
„Ab ins Bett, Tessa. Es ist Zeit”, mischte sich Anna ins Gespräch und beendete damit die Unterhaltung. Sie selbst war begierig darauf, ihrem Mann vom Besuch bei Clara Czerny in Hohenburg zu erzählen. Das zufällige Zusammentreffen mit ihrem Jugendfreund erwähnte Anna aber nicht.
5 Verdächtigungen
Ina Reschke war eine außergewöhnlich fleißige Frau. Bereits in ihrer Kindheit hatte sie schwer arbeiten müssen. Damals konnte ihre mit dem Bauernhof und der zehnköpfigen Nachkommenschaft ständig überlastete Mutter nicht ohne Mithilfe ihrer Kinder auskommen. Vermochten sich Inas Geschwister auch manchmal vor den anfallenden Tätigkeiten zu drücken, so war Ina schon immer ein Muster an Zuverlässigkeit gewesen. Obwohl sie die Schule kaum besuchen konnte, hatte sie durch rasche Auffassungsgabe und mit viel Eifer lesen, schreiben und rechnen gelernt. Als eine weitere große Genugtuung in ihrem Leben betrachtete Ina ihre Heirat mit dem schmucken Arthur Reschke. Natürlich wusste sie genau, dass sie diesen Fang nicht ihrer übergroßen Anziehungskraft, sondern viel mehr dem beträchtlichen Landbesitz verdankte, den der Vater ihr, und zu gleichen Teilen den im Gebiet ansässigen Geschwistern, überschrieben hatte. Doch der Stolz, jeden Sonntag an der Seite des bestaussehenden Mannes der ganzen Gemeinde die Kirche zu besuchen, wog die kleinen Demütigungen auf, die Ina im täglichen Leben dafür in Kauf nehmen musste. Ihr Arthur war alles andere als ein zartfühlender, rücksichtsvoller Gatte, doch in Inas Augen war er immerhin ein ganzer Kerl, und sie liebte ihn. Und Arthur, der aus sehr bescheidenen Verhältnissen stammte, wusste das Leben als wohlhabender Bauer und Ehemann einer Frau, die für zwei arbeiten konnte, in vollen Zügen zu genießen.
Gerade ackerte Ina Reschke mal wieder im Gemüsegarten hinter dem Haus, sie harkte die Erde heftiger als gewöhnlich und riss mit mehr Kraft, als dafür erforderlich gewesen wäre, Unkräuter aus dem Kohlrabibeet. Die Neuigkeiten aus Hohenburg missfielen ihr sehr. Erst einmal hatte sie erfahren, dass Arthur entgegen seiner Beteuerung das Techtelmechtel mit einer der Wirtinnen des Blunske nicht diskreter behandelte. Es war immer noch Stadtgespräch, wie sie den Schilderungen ihrer Bekannten Emma Hammer entnehmen konnte. Damit nicht genug, hatte ihre Schwägerin mit ihrem Verhalten einem attraktiven Polen gegenüber die Familie ins Gerede gebracht. Seit Tagen zerriss sich die deutsche Hohenburger Gemeinde das Maul über Anna Walther. Ina ahnte, wie willkommen der Klatsch dort aufgenommen wurde. Das war doch was anderes, als die oft deprimierenden Kriegsberichte oder die ewige lärmende Nazipropaganda zu hören.
Von dem hinter dem Gemüsegarten gelegenen Obstgärtchen drang Kindergeschrei zu Ina hinüber. Missmutig richtete sie sich auf und lugte durch die Fliederbeerbüsche zu den Kindern. Unter dem knorrigen alten Weichselkirschbaum spielten ihr Emil mit seiner Schwester Charlotte und den Cousinen Mara und Luise. Die beiden Walther-Mädchen hatten mal wieder ihre Kleider ausgezogen und liefen nur in Unterwäsche herum. Ihre eigenen Kinder sollten sich das nur nicht wagen! Neben den Kleidern im Gras lagen zwei Paar einfache Holzbotten. Wohlwollend registrierte Ina, dass weder Charlotte noch Emil sich getraut hatten, die weißen Söckchen und die hellbraunen Ledersandalen auszuziehen.
Von der Kirschbaumkrone aus winkte eine kleine Hand übermütig: „Tante Ina, huhu, ich bin hier oben!”
Das darf doch wohl nicht wahr sein, dachte Ina entrüstet, hat dieser Bengel immer noch nicht genug von der Gefahr. „Komm sofort da runter, Oskar, oder ich hole deinen Vater, der wird dich windelweich prügeln!” Ina ließ ärgerlich die Harke fallen und eilte zum Kirschbaum. Sie sah Oskar sich behände wie ein Äffchen von einem Ast zum anderen baumeln. Mit einem großen Plumps landete er sicher vor ihren Füßen auf dem Erdboden. Oskar strahlte sie an und erwartete zweifellos mal wieder Lob und Bewunderung, die aber ausblieb.
„Na, traust du dich das auch, Emil?” fragte Oskar herausfordernd.
Emil zuckte mit den Achseln: „Ich darf das sowieso nicht, oder Mutter?”
„Gott bewahre, lass dir so etwas nicht einfallen. Und von dir will ich so eine gefährliche Kletterpartie auch nie wieder sehen, Oskar, verstanden?” Ina wandte sich an ihre Nichten: „Wo habt ihr Eure Kleider gelassen? Wir sind doch hier nicht bei den Hottentotten im Urwald.”
„Was sind Hottentotten?” fragte Oskar höchst interessiert. Woher kannte die langweilige Tante Ina irgendjemanden aus dem Urwald?
„Wilde.” antwortete Ina knapp.
„Ho-ho-ho, Tante Ina, da kommen gerade Hottentotten, dreh dich doch mal um!” Oskar konnte sich vor Lachen gar nicht beruhigen, als seine Tante ungläubig den Kopf wandte. Sie hatte zwar eher damit gerechnet, dass ihr alberner Neffe sie reinlegen wollte, doch am Zaun, der den Obstgarten von der kleinen Durchgangsstrasse abtrennte, standen tatsächlich zwei fremde Frauen, die zu ihnen herüber lugten.
Gereizt meinte Ina: „Aber das sind doch keine Hottentotten, Oskar, das sind …” Sie musterte argwöhnisch die zwei Fremden. Na, die sind bestimmt Juden, das erkannte sie doch auf den ersten Blick, dachte Ina
Ehe sie die Kinder stoppen konnte, rannten Oskar, Mara, Luise, Emil und Charlotte neugierig zum Zaun. Ergeben folgte Ina ihnen dorthin. Es kam in letzter Zeit oft vor, dass hungrige Städter aufs Land fuhren und sich zu Schwarzmarktpreisen mit frischer Ware eindeckten. Auf den Märkten der Städte und in den Geschäften war die Versorgung nicht mehr so gut. Außerdem gab es alles offiziell nur noch auf Lebensmittelkarten. Ina war immer froh, wenn Arthur es übernahm, diese Art von Geschäften abzuwickeln. Ihr gefiel es nicht, mehr Geld für etwas zu verlangen als es wert war. Oskar hatte bereits eine Unterhaltung mit den beiden dunkelhaarigen, in staubig graue Kostüme gekleideten Frauen begonnen.
„Du hast recht”, meinte er gönnerhaft zu seiner Tante, als diese die Gruppe erreichte, „die sind leider keine Hottentotten, …”
„… aber immerhin kommen sie aus Warschau”, schwärmte die zehnjährige Charlotte. Vor einigen Monaten hatte sie ihren Vater in die große Stadt begleiten dürfen, und von den Eindrücken, die sie dort gesammelt hatte, zehrte Charlotte noch immer.
„Reizende Kinder haben sie. So aufgeschlossen …”, meinte die ältere der Damen, Ina freundlich anlächelnd. Die Frau sprach fließend polnisch, doch mit leichtem Akzent.
„Entschuldigung, was wollen sie?” Inas Stimme klang abweisend.
„Nun, wir würden sehr gerne bei Ihnen einkaufen. Obst und Gemüse. Kartoffeln und auch ein paar frische Eier. Wäre es möglich? Wir können zahlen.” Die etwa 50 Jahre alte Dame lächelte weiterhin gewinnend, während die Jüngere, vielleicht die Tochter, eine sehr hübsche goldene Brosche herzeigte.
Langsam schüttelte Ina den Kopf: „Sie sind doch Juden, stimmt´s? Wo ist ihr gelber Stern?”
Während die Ältere sich auf die Lippen biss, meinte die Jüngere brüskiert: „Woher wollen sie das wissen?”
Ina verspürte keinerlei Lust auf Diskussionen, außerdem wollte sie endlich zurück in ihren Gemüsegarten. Ein unerfreulicher Nachmittag war das!
„Vielleicht sehe ich es ihnen einfach an. Vielleicht höre ich es an ihrer Sprache. Ist doch egal. Wir machen keine Geschäfte mit Juden. Das ist verboten. Außerdem ist mein Mann bei der SA. Die polnischen Bauern haben Ihnen wohl auch nichts verkauft, was? Gehen sie besser ganz schnell, das rate ich ihnen.” Entschlossen drehte Ina den Frauen den Rücken zu.
„Das war aber gemein von eurer Mama”, flüsterte Mara den beiden Reschke-Kindern zu. Auch Luises Gerechtigkeitsempfinden war verletzt worden, ihre Schüchternheit überwindend, wandte sie sich an die zwei Frauen, die beratschlagten, was sie nun tun sollten.
„Gnädige Damen, gehen sie am besten einen Hof weiter nach links. Dort wohnen wir. Unsere Mama wird ihnen bestimmt helfen.”
„Klar, wir haben jede Menge Kartoffeln und so. Alles was sie wollen. Und gar nicht so teuer”, stimmte Oskar geschäftstüchtig ein.
Die Jüngere blickte Luise und Oskar zweifelnd an, doch die andere meinte: „Los, Dinah, lass es uns wenigstens versuchen. Viel schlimmer kann es sowieso nicht mehr werden.”
„Ich will auch nach Hause”, krähte nun Mara, „ich begleite sie.”
So kam es, dass die kleine Mara mit zwei fremden Damen auf dem Hof der Walthers auftauchte, und diese zielsicher zur Mutter ins Wohnzimmer führte. Anna saß dort in einer Ecke an ihrer geliebten Nähmaschine und besserte ein paar Kleidungsstücke der Kinder aus.
„Mama, die beiden Damen kommen aus der großen Stadt und möchten ihren Kindern so gerne etwas Köstliches von unserem Bauernhof mitbringen. Kannst du ihnen nicht etwas verkaufen? Du kannst eine goldene Brosche dafür haben, die ist so hübsch …” Mara war ganz begeistert von dem unerwarteten Besuch. Auf dem kurzen Weg nach Hause hatte sie bereits einiges von den Damen erfahren und sie genoss es, einmal diejenige zu sein, die etwas Neues zu berichten hatte. Ansonsten kamen ihr die älteren Geschwister oder der vorlaute Oskar meistens zuvor.
Anna schaute erst ihre aufgeregte Tochter, dann die zwei Unbekannten, die zurückhaltend einige Schritte hinter Mara standen, erstaunt, aber freundlich an. Die Städterinnen schöpften Hoffnung. „Verzeihen Sie die Störung. Wir sind Ruth und Dinah Rosenbaum und kommen eigentlich aus Warschau. Seit einiger Zeit leben wir allerdings im Kreis Schröttersburg. Ihre lieben Kinder, die wir zufällig trafen, meinten, sie würden uns gewiss etwas Gemüse und Obst verkaufen.”
Ruth Rosenbaum war erleichtert, als sie das zustimmende Nicken Annas registrierte. „Ich danke ihnen so sehr”, meinte sie erleichtert.
Ohne viel Aufhebens davon zu machen holte Anna alles, was die beiden Frauen wünschten, aus der Vorratskammer. Sie verpackte die Nahrungsmittel gewissenhaft und sorgte sich darum, dass die vollgepackten Taschen den Frauen nicht zu schwer werden würden. Als es zur Bezahlung ging, nahm Anna die wertvolle Brosche behutsam in die Hände. „Das kann ich nicht annehmen. So viel ist das Essen doch gar nicht wert.”
„Ach gute Frau, wenn man hungert, ist alles Geld und Gold der Welt nicht von Nutzen”, sagte Ruth Rosenbaum und Dinah Rosenbaum fügte hinzu: „Wir geben die Brosche lieber Ihnen als einem anderen. Sie sind ein Mensch. Danke.”
So ganz einverstanden war Anna mit dem Handel noch nicht. „Dann kommen sie aber in den nächsten Monaten so oft sie wollen, ich bringe sie für diesen Preis über den Winter. Versprochen.”
„Sehen Sie, meine Mama ist viel lieber als Tante Ina”, merkte Mara, die die ganze Zeit über selbstvergessen mit den Garnrollen aus dem schönen, alten Nähkästchen der Mutter gespielt hatte, stolz an.
Nun erzählten die beiden Damen Rosenbaum doch noch von ihrer kurzen Begegnung mit Ina Reschke. Schließlich trug Anna ihrer Tochter Mara auf, die Frauen das Stück bis zum Hof der Reschkes zu begleiten und dann mit ihren Geschwistern Oskar und Luise nach Hause zurückzukehren.
*
Ungewöhnlich frühzeitig machte sich Richard Walther an diesem Tag auf den Rückweg vom Feld nach Hause. Vergeblich hatte er versucht, die Gerüchte über seine Frau, die ihm nun schon von verschiedenen Seiten zugetragen worden waren, aus seinem Kopf zu verbannen. Doch es hatte einfach keinen Zweck gehabt, im Gegenteil, in seiner Phantasie wurde die Geschichte eher noch heftiger als sie sowieso schon war. Er brauchte Gewissheit und musste mit Anna selbst reden, dachte sich Richard.
Was sollte er in seinem Leben eigentlich noch alles ertragen müssen? Erst hatte er eine harte Kindheit gehabt, geprägt von zu viel Arbeit, erzogen von einer ständig überlasteten Mutter und einem strengen, selbstgerechten Vater. Nur vier Winter lang konnte Richard einigermaßen regelmäßig die Schule besuchen. Trotzdem war er ein so überdurchschnittlich guter Schüler gewesen, dass man seinen Eltern vorschlug, ihn zum Lehrer ausbilden zu lassen. Doch Richard hatte es nie bereut, Bauer zu werden. Im Gegenteil, er liebte seinen Beruf. Was gab es schöneres, als über seine eigenen weiten Felder zu blicken, seine Kühe, Schweine, Pferde und Hühner wachsen und gedeihen zu sehen, sich an ihren guten Gaben zu erfreuen und vor allen Dingen sein eigener Herr zu sein? Gerade in den heutigen schwierigen Zeiten war es ein Segen, sich aus eigenen Mitteln ernähren zu können. Die Walthers mussten weder Hunger leiden noch mangelte es ihnen an anderen Dingen. Diese Gewissheit erfüllte Richard Walther mit Stolz, seine innere und äußere Unabhängigkeit ließ ihn anderen gegenüber großzügig sein. Nie war er auf irgendjemanden neidisch gewesen. Außerdem hatte ihn das Leben gelehrt, seinen Mitmenschen mit einem Mindestmaß an Achtung zu begegnen.
Richard Walther hatte als russischer Soldat den ersten Weltkrieg überlebt. Damals existierte gerade mal wieder kein eigenständiger polnischer Staat. Polen war ein Teil des riesigen russischen Reiches. Der jeweils älteste Sohn einer Familie wurde zum Militärdienst eingezogen. Doch Richards Vater schickte seinen ältesten Sohn, Ferdinand, ins sichere Amerika, so musste aus dem Zweitgeborenen, Richard, ein russischer Soldat werden. In den harten Jahren als Außenseiter – immerhin war er deutschstämmig und kam außerdem noch aus Polen – erfuhr Richard den Unterschied zwischen Mitmenschlichkeit und menschenverachtender Behandlung. Aus diesem Grund missbilligte er die Ziele der Nazis aus ganzem Herzen. Was sollte der Quatsch mit den “Herren-" und den “Untermenschen”? Wie konnte man so dumm sein zu glauben, ein Riesenreich wie die Sowjetunion erobern zu können? Wozu brauchte irgendeiner den “Lebensraum Ost”? Richard Walther war der Auffassung, dass es Land genug gab für Leute, die fleißig und entschlossen waren, in Polen zu leben. Waren seine Vorfahren nicht auch irgendwann aus deutschem Gebiet hierher gezogen, um ihr Glück in diesem Land mit dem häufig so fruchtbaren Ackerboden zu suchen? Wozu dieses Riesentrara, wie die Nazis es veranstalteten? Das konnte kein gutes Ende nehmen, befürchtete Richard Walther.
Er runzelte gequält die zerfurchte, hohe Stirn. Seine dunklen Haare waren ihm frühzeitig ausgefallen, er trug seit Jahren einen dünnen Haarkranz. Richards Gesichtszüge hatten immer angenehm auf Menschen gewirkt, seine mittelgroße Nase war gerade gewachsen und sein Kinn gab dem eher rundlichen Gesicht den energischen Zug, der dem Charakter Richard Walthers gerecht wurde.
Seine Gedanken wanderten zurück zu seiner Frau. Mit welchen großen Hoffnungen er diese Ehe vor siebzehn Jahren geschlossen hatte! Bereits als er zuerst nur ein Foto von Anna gesehen hatte, war ihm klar gewesen, er wollte diese Frau besitzen. Und tatsächlich, ihre Schönheit und die Sanftheit und der Geruch ihrer Haut hatten ihn für einige erlittene Pein entschädigt. Anfangs störte ihn Annas Desinteresse an seiner geliebten Landwirtschaft kaum. Großmütig schaute er über ihre Vorliebe hinweg, Geld für unnützen Luxus wie Spitzenwäsche, Schmuck und Angorajäckchen auszugeben. Die Mägde gehorchten ihr nicht, und die Haushaltsführung bekam Anna auch nicht in den Griff, dafür erlebte Richard seine Frau nachts als hingebungsvolle Geliebte. Dass sie sich tagsüber nicht viel zu sagen hatten, damit konnte Richard leben, solange sie in den dunklen masowischen Nächten die gemeinsame Sprache der Leidenschaft fanden. Als ihr gemeinsames ersten Kind, ein Sohn, geboren wurde, wähnte sich Richard mit siebenunddreißig Jahren am Ende seiner Wünsche und Ziele: Eine eigene Landwirtschaft zu besitzen, mit einer schönen Frau verheiratet zu sein und einen gesunden Stammhalter gezeugt zu haben, das war alles, was er sich je erträumt hatte.
Doch nahm das Unglück mal wieder seinen Lauf. Der Junge war erst acht Monate alt gewesen, als Richard Anna zu einer mehrtägigen Reise anlässlich einer Hochzeit überredete. Nur widerwillig hatte seine Frau das Baby in der Obhut einer Magd zurückgelassen. Als Richard und Anna nach drei Tagen nach Hause zurückkehrten, lag der Junge im Fieberkoma. Er überlebte nur noch eine weitere Nacht. Damals war etwas in Anna und in ihm und auch zwischen ihnen zerbrochen. Das zarte Pflänzchen der Vertrautheit und der Zuneigung verdorrte nahezu. Von nun an machte seine Frau deutlich, dass sie die Ehe mit Richard für eine Zweckgemeinschaft hielt, und Richard fing an, über Annas Unzulänglichkeit als Bauersfrau zu nörgeln.
Ihre weiteren Kinder wurden geboren. Erst die drei Mädchen: 1927 die temperamentvolle, bildhübsche Tessa, 1930 die gemütliche, kräftige Ada und 1933 die zarte, ernste Luise. Dann folgte 1935 die schwere Geburt von Mara, aus der ein ungewöhnlich umgängliches und rücksichtsvolles Kind geworden war.
Erst 1936 war Richard endlich wieder am Ziel seiner Träume angelangt, der ersehnte Stammhalter Oskar wurde geboren. Mit Stolz dachte Richard an seinen aufgeweckten Sohn, der wie für das Landleben geschaffen schien. Wie keines seiner anderen Kinder ging Oskar völlig in seiner Umgebung auf, liebte die Tiere des Hofes, interessierte sich für die Abläufe des landwirtschaftlichen Lebens, war bei Knechten und Mägden besonders beliebt. Ja, Oskar würde der würdige Erbe seiner Güter werden, darüber gab es keinen Zweifel. Heute plagte Richard allerdings die Sorge, wie er mit seiner Frau weiterleben sollte, wenn die Gerüchte um sie sich als wahr erwiesen. Zeitlebens hatte er sich an eine aufrechte Moral gehalten, die es ihm ermöglicht hatte, noch immer mit gutem Gewissen sein Spiegelbild betrachten zu können. Er galt als respektierter Mann, der für seine Fairness und sein klares Urteilsvermögen bekannt war. Eine untreue Frau würde er um seines Selbstbildes willen nicht ertragen können.
*
Mit aufgewühlten Gefühlen betrat Richard Walther sein Haus. Im Flur rief er nach seiner Frau. Die Wohnzimmertür öffnete sich.
„Richard, was ist los? Wieso bist du schon hier?” fragte Anna erstaunt. Richard drängte sie ins Wohnzimmer: „Wir müssen miteinander reden, Anna. Es gibt Gerüchte, böse Gerüchte …”
Anna sah Richard fragend an.
„… diejenigen, um die es geht, erfahren es immer erst zum Schluss, stimmt´s? Oder tust du nur so ahnungslos?” Richards Stimme klang gepresst.
Anna war verwirrt.
„Sieh mich nicht an wie eine Kuh! Du bist in Hohenburg beobachtet worden wie du mit einem Mann poussiert hast. Ihr sollt zusammen in unserem Mietshaus verschwunden sein und sollt euch eine Stunde lang in der Wohnung der Czernys … vergnügt haben …”
„… aber das ist doch vollkommen lächerlich.” Anna lachte bemüht. „Frau Czerny war doch die ganze Zeit mit uns in ihrer Wohnung!”
Richard blitzte seine Frau wütend an. ”Aha, du leugnest also nicht, dass du mit diesem Kerl zusammen warst! Ein polnischer Verräter soll er auch noch sein!”
Ungläubig starrte Anna ihren Mann an. Was war das für eine Geschichte, die man mir da in die Schuhe schieben will? Womit habe ich solche Niedertracht hervorgerufen? Sie merkte, wie ihr Herz erregt in ihrer Brust hämmerte.
„Davon weiß ich nichts. Es stimmt nur, dass ich meinen alten Jugendfreund Jerzy zufällig nach vielen Jahren in Hohenburg getroffen habe. Vielleicht habe ich ihn aus Wiedersehensfreude umarmt. Na, und …”
Bei diesen Worten baute sich Richard dicht vor ihr auf, sein heißer Atem schlug ihr ins Gesicht. „Du bist verheiratet, hast du das vergessen? Ich erwarte Benehmen von dir! Du sollst ihn abgeknutscht haben!”
„Unsinn!”
„Du bist mit dem Schweinehund in der Wohnung verschwunden!” brüllte Richard, er konnte den Gedanken an Annas Untreue einfach nicht ertragen.
„Ja, weil wir beide mit Frau Czerny …” „So ein Zufall! Ihr beide …”, dröhnte Richard höhnisch.
„Ja. Verdammt! Jerzy ist ein Cousin von Frau Czerny, er wollte sich um sie kümmern, jetzt wo ihr Mann verhaftet worden ist. Und du hast mich doch zu ihr wegen der Miete geschickt. DU WARST ES DOCH!” schrie Anna, nun auch außer sich.
Beide funkelten sich wütend an.
„Pech für dich, Mädchen. Zufällig ist Frau Czerny mit den Kindern beim Einkaufen gesehen worden, während du es mit dem Polak getrieben hast!” zischte der hochrote Richard. Anna resignierte. „Nu, das also glaubst du. Diesem hinterhältigen Geschwätz von irgendwelchen üblen Leuten schenkst du natürlich mehr Glauben als deinem eigenen Weib. Dir ist ja nicht zu helfen! Du tust mir leid.”
„Nun dreh´ den Spieß nicht um, Anna! Warum hast du mir neulich nichts davon erzählt, dass du einen alten Freund getroffen hast? Warum musstest du mir das verheimlichen?” Langsam gewann Richard etwas von seiner Fassung zurück.
Anna zuckte mit den Achseln. „Es war doch völlig belanglos.”
Sie öffnete die Wohnzimmertür. Kein weiteres Wort der Anklage werde ich über mich ergehen lassen.
Im Flur hatten sich Luise, Mara und Oskar versammelt. „Nanu?”
„Warum schreit ihr denn so, Mama? Wenn wir so laut sind, werden wir ausgeschimpft …”, maulte Oskar herum.
Luise stürzte sich schluchzend in Annas Arme. „Bitte nicht streiten, Mama.”
Auch Mara schmiegte sich dicht an die Mutter. Anna streichelte das seidenweiche Haar der beiden Mädchen.
„Ach Kinderchen, ihr streitet euch doch auch mal, da wird man manchmal zu laut. So geht es uns Erwachsenen eben auch.”
Der aus dem Wohnzimmer tretende Vater räusperte sich verlegen.
„Na ja, Kinder, und nach einem Streit kann man sich ja auch wieder vertragen.” Er schaute seine Frau eindringlich an. „Stimmt´s Anna?”
Statt einer Antwort senkte Anna den Blick. Bei Verletzungen ihrer Würde neigte sie dazu nachtragend zu sein.
*
Nach dem gemeinsamen Abendbrot, die Kinder waren gerade zu Bett geschickt worden, erschien Arthur Reschke unerwartet in SA-Uniform. Wichtig nahm er im Wohnzimmer der Walthers Haltung an und salutierte „Heil Hitler! Ich, als euer Schwager muss euch darauf vorbereiten, dass Ärger ins Haus steht!”
Unverfroren taxierte er Anna mit einem abschätzenden Blick.
Richard, dem dies nicht entgangen war, wünschte Arthur einen guten Abend und forderte ihn auf, es sich erst einmal auf dem Sofa bequem zu machen. Dann füllte er drei Schnapsgläser mit Hochprozentigem und bestand darauf, mit Anna und Arthur anzustoßen. Daraufhin erfuhren die Walthers von der Festnahme des polnischen Untergrundkämpfers und Verräters Jerzy Olszewski vor wenigen Stunden durch die Gestapo in Schröttersburg. In diesem Zusammenhang erwarte man morgen früh Anna Walther zum Verhör, teilte Arthur mit. Er habe dafür Sorge zu tragen, dass sie im Gestapoquartier in Schröttersburg pünktlich um zehn Uhr erscheine.
„Ich nehme an, es besteht keine Fluchtgefahr. Du weißt Anna, die Gestapo ist nicht pingelig, was Druck auf Familienangehörige angeht, wenn es Probleme mit dir geben sollte.”
Anna war empört. „Möglicherweise würdest du es spannend finden, einen Schwerverbrecher in der Familie zu haben, aber mit mir kannst du da nicht rechnen, denn ich habe mir überhaupt nichts vorzuwerfen!”
Die Tür laut hinter sich zuknallend verließ Anna gekränkt den Raum. Außerdem machte sie sich große Sorgen um Jerzy. Sicherlich hatte sie geahnt, dass etwas faul an der Cousin- und Cousine-Geschichte gewesen war, aber von einer Untergrundtätigkeit hatte sie absolut nichts gewusst.
Wie soll ich mich morgen bei der Gestapo am besten verhalten? Bei dem bloßen Gedanken daran brach Anna der kalte Schweiß aus.
Im Wohnzimmer informierte Arthur seinen Schwager über die Neuigkeiten, die sich im Zusammenhang mit Annas Tête-à-Tête mit dem polnischen Hurensohn im Umlauf befanden. Am helllichten Tag auf offener Straße waren die beiden von verschiedenen angesehenen Bürgern Hohenburgs in innigster Umarmung beobachtet worden. Im Café Chopin hätten sie ganz schamlos und selbstvergessen Händchen gehalten, hatte Emma Hammer seiner Frau erzählt! Im Treppenhaus wären sie bei einer wilden Knutscherei von zwei Pimpfen ertappt worden! Außerdem hieß es, der Olszewski hätte einen deutschen SS-Mann auf dem Gewissen! Richard versuchte seinen Kummer in Schnaps zu ersaufen, Arthur half ihm bereitwillig dabei. Gemeinsam schimpften sie eine Weile über die verfluchten Weiber, dann torkelte Arthur recht selbstzufrieden nach Hause. Derweil stürmte Richard Walther ungewohnt betrunken, von den Informationen völlig frustriert und aufgebracht, ins Schlafzimmer.
*
Am nächsten Morgen bekam Ina Reschke ihren Angetrauten nur unter Einsatz eines Eimers voll eiskalten Wassers rechtzeitig wach. Fluchend stand Arthur um sieben Uhr auf, sein Kopf brummte, doch hatte er seinen Rausch inzwischen soweit ausgeschlafen, dass er sich an die wichtige Aufgabe, die heute auf ihn wartete, erinnern konnte.
Ina Reschke wusste nicht, was sie von der Geschichte halten sollte. Einerseits wünschte sie ihrer Schwägerin nichts Böses und sie war wirklich besorgt um Anna, weil sie es mit der Geheimen Staatspolizei zu tun bekam. Andererseits war sie noch nie mit Annas unkonventioneller Art, sowohl was die Kindererziehung, den Umgang mit der polnischen Bevölkerung als auch allgemeine Ansichten betraf, einverstanden gewesen. Ob ihre Schwägerin wirklich Ehebruch begangen hatte, bezweifelte Ina. Grundsätzlich hätte sie ihrem Bruder zwar eine fleißigere Frau gewünscht, aber, nun gut, wer hatte schon einen idealen Ehepartner gefunden? Ina warf einen scheelen Blick auf ihren Mann, der sich noch ganz schlaftrunken gerade die Socken anzog. „Beeil dich, Arthur”, mahnte ihn Ina.
„Ja, doch. Hoffentlich kommt es nicht so Dicke für Anna”, murmelte Arthur, während er sich die Schnürsenkel zuband. Na ja, dachte Ina insgeheim, ein wenig auf die Nase zu fallen, schadet der Dame aber auch nicht. Sie warf einen prüfenden Blick auf ihren Mann, der sich zur Begutachtung vor ihr aufgebaut hatte. Die braune SA-Uniform stand ihm ungeheuer gut, fand Ina.
„Na, wie sehe ich aus?” wollte Arthur von ihr wissen.
„Schneidig.” Ina langte hinauf zur Schulter ihres Mannes und fegte einen nicht vorhandenen Fussel fort. „Du wirst mächtigen Eindruck schinden.”
*
Etwa zur selben Zeit kümmerte sich die Magd Jadwiga im Haus der Walthers um die grün und blau geschlagene Anna, die vor Schmerzen nicht auf einem Stuhl sitzen wollte. Jadwiga, eine kleine, drahtige Person von Mitte zwanzig, versorgte Annas Platzwunde oberhalb der linken Augenbraue. Während sie konzentriert die Wunde mit einem sauberen, in Alkohol getränkten Tuch reinigte, fuhr sie sich mit der Zunge über ihre von einem dunklen Flaum beschattete, schmale Oberlippe. Die Kinder standen verstört um die beiden Frauen herum, und beobachteten genau, wie Jadwiga der Mutter half. Luise streichelte sanft Annas Hand.
„Seid nicht traurig, Kinder, bald bin ich wieder munter und hübsch. Au! Jadwiga!” stöhnte Anna vor Schmerz.
„Ach Frau Walther, so schlimm es ist, was meinen sie, wie oft mich mein Taddäus schon verdroschen hat? In seinem Suff ist der einfach nicht zu bremsen!” versuchte Jadwiga zu trösten. Mit Ehekrisen kannte sie sich wahrlich aus. Seit acht Jahren war Jadwiga enttäuschend kinderlos mit dem knorrigen Knecht Taddäus verheiratet. Anstatt sich um seine Angetraute zu kümmern und seinen ehelichen Pflichten gewissenhaft nachzugehen, bevorzugte er es, zum Leidwesen seiner Frau, sich mit seinen Kumpanen herumzutreiben. Dafür machte ihm Jadwiga – sie konnte einfach nicht anders – regelmäßig die Hölle heiß und fing sich dadurch ebenso regelmäßig eine gehörige Tracht Prügel ein.
„Eigentlich können sie heute Morgen gar nicht los. Sie gehören ins Bett”, sagte Jadwiga. Anna schüttelte den Kopf. So viel Schmerz es ihr auch bereitete, derart entwürdigt nach Schröttersburg zu fahren, so ahnte sie doch, dass im Falle ihres Fernbleibens alles nur schlimmer werden würde. Außerdem wollte sie umgehend den Familienanwalt aufsuchen. In der schlaflosen Nacht, die hinter ihr lag, hatte Anna sich dazu entschlossen, die Scheidung von Richard Walther einzureichen.
Niemals werde ich diese ungerechte Schmach verwinden können. Keiner hat das Recht mich derartig zu behandeln. Mein Vater würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, wie der Schwiegersohn seine einzige Tochter zugerichtet hat.
Jadwiga war Anna beim Ankleiden behilflich. Das elegante hellgraue Kostüm verdeckte die Misshandlungen am Körper. Aber ihr Gesicht verriet alles. Anna wählte den breitkrempigen Hut und zog ihn sich ungewohnt weit ins Gesicht. Als Arthur Reschke kurze Zeit später mit seinem Wagen auftauchte, stieg sie wortlos und ohne eine Miene zu verziehen in das Auto. Die Kinder standen winkend am Straßenrand, als ihre Mutter sich auf die Fahrt zum Gestapoquartier nach Schröttersburg machte.
*
Seite an Seite lief das attraktive Paar den langen, schmalen, fensterlosen Korridor der Gestapozentrale in Schröttersburg entlang. Ein penetranter Duft von frischem Bohnerwachs hing in der Luft. Dunkelgraues Linoleum dämmte die Geräusche ihrer Absätze. Anna spürte bleierne Schwere in ihren Beinen und es wunderte sie, dass sie trotzdem mit Arthur, der stolz und gerade neben ihr herging, Schritt halten konnte. Vor dem Zimmer Nummer 127 blieb Arthur Reschke stehen.
„Hier ist es. Wir sollen warten”, murmelte er.
Seufzend lehnte sich Anna an eine der lindgrün gestrichenen Wände. Die Kälte des Mauerwerks drang durch die Kleidung an ihre Haut. Schweigend blickte sie an ihrem Schwager vorbei auf die schwere Eichenholztür, die ins Zimmer Nummer 127 führte. Die Stille im verlassen wirkenden Flur wurde plötzlich von einem gellenden Schrei durchbrochen. Anna zuckte zusammen. Einen Augenblick lang öffnete sich die Tür des gegenüberliegenden Zimmers und Anna sah, wie ein halbbekleideter alter Mann winselnd auf dem Boden zu Füßen seines Peinigers lag. Arthurs Gesicht erstarrte, er stellte sich dicht neben Anna, und zog sie beschützend an sich. Fassungslos sah Anna, wie der alte Mann geschlagen wurde. „Warum machen sie die Tür nicht zu … Die wollen, dass ich sehe, wie sie ihn quälen … Die wollen …“, flüsterte Anna schockiert. „Schsch …“ Arthur legte seinen Zeigefinger auf ihre Lippen.
Durch die Tür trat ein schwarz gekleideter, unscheinbar wirkender Mann mit Akten unter dem Arm. Er nickte den beiden Wartenden kurz zu und fragte nach ihren Namen. Augenblicklich stand Arthur Reschke stramm, stellte sich zackig vor und erklärte in beschwichtigendem Tonfall, seine Schwägerin sei leichtsinnigerweise in eine prekäre Situation geraten, aus diesem Grund sei sie für heute vorgeladen worden. Er als alt gedienter SA-Mann und treues Parteimitglied halte seine Schwägerin jedoch für völlig unschuldig, beteuerte Arthur.
„Das lassen sie gefälligst uns entscheiden, Mann!” fuhr der schwarz Gekleidete ihn scharf an. Mit angewiderter Miene wandte er sich an Anna. „Mitkommen!”
Doch Anna starrte noch immer wie gebannt an dem Gestapomann vorbei in den Raum, in dem der alte Mann gerade von heftigen Hieben getroffen vor sich hin röchelte. Überrascht nahm sie einen schmerzhaften Stoß in ihren eigenen Rücken wahr.
„He, Moment mal, so können sie nicht mit …”, versuchte Arthur gegen die Behandlung seiner Schwägerin zu protestieren.
„Halts Maul, Fatzke. Sonst lasse ich dich einsperren. Geh wieder in dein Kuhdorf zurück.“
Der Gestapomann stieß Anna Walther in das Zimmer Nummer 127 und wies sie an, auf dem Stuhl vor dem klobigen Schreibtisch Platz zu nehmen. In einer Ecke des kargen Raumes stand ein zweiter Mann, ein baumlanger Kerl, der sie aus schmalen Augen kühl musterte. Weiß vor Furcht setzte sich Anna auf einen der beiden harten Holzstühle. Gleichzeitig merkte sie, wie sich Trotz in ihr aufzubäumen begann. Jetzt würde sie nur noch verbissener für ihre Unschuld kämpfen.
Dieses Büro werde ich ungeschoren verlassen, da können diese beiden Knallchargen Gift drauf nehmen.
Aber es wurde schwer. Fragen, die wie Geschosse wirkten, prasselten auf sie ein: Seit wann kannte sie Jerzy Olszewski? Wie oft hatte sie ihn in den vergangenen drei Jahren getroffen? Was wusste sie über die feindliche polnische Untergrundbewegung? Warum war sie nicht Parteimitglied? Zu welchen Polen pflegte sie Kontakte?
Anna ahnte, ihre Chance lag darin, für einfältig gehalten zu werden. „Nu, meine Herren, mir brummt schon der Kopf von den immer gleichen Fragen. Sie sehen doch, ich bin eine ganz unpolitische, dumme, kleine Frau. Lassen Sie mich doch endlich die ganze Geschichte von Anfang an erzählen. Und wenn Ihnen etwas unklar ist, fragen sie danach weiter. Ja?“ Endlich schaffte Anna es, das zufällige Treffen mit ihrem Jugendfreund und den gemeinsamen Besuch bei Frau Czerny aus ihrer Sicht zu schildern. Mit mühsam unterdrücktem Zorn erzählte sie von den Verleumdungen und Gerüchten, die schließlich im Gewaltausbruch ihres Mannes, der sich ohne diese Aufhetzungen niemals zu so einer Tat hätte hinreißen lassen, gegipfelt waren.
„Meine Herren, sehen Sie selbst! Ist es nicht ein Verbrechen eine unschuldige, kleine Frau derartig zuzurichten!” Theatralisch riss Anna sich den breitkrempigen Hut und die Kostümjacke vom Leib und verlor schließlich ihre Fassung.
„Um Himmels Willen, ziehen Sie sich die Sachen wieder an. Wir sind doch hier nicht in einem Etablissement!“ Ganz offensichtlich hatte sie den baumlangen Kerl aus dem Konzept gebracht. Das undurchdringliche Gesicht des Unscheinbaren verriet dagegen keine Regung. Immerhin schienen die Gestapo-Leute nach diesem Gefühlsausbruch genug von ihr zu haben. Nachdem Anna die Verpflichtungserklärung, sich für weitere Befragungen bereit zu halten und sich weiterhin im Kreis Schröttersburg aufzuhalten, unterschrieben hatte, durfte sie das Gestapogebäude als freier Mensch verlassen.
*
Nachts wachte Mara jammernd mit quälenden Ohrenschmerzen auf. Sie kannte dieses unerbittliche Ziehen bereits. Seit sie drei Jahre alt gewesen war, hatte sie damit zu tun gehabt.
„Mama! Komm Mama!” rief sie verzweifelt, dicke Tränen liefen ihre schmalen Wangen herab. Ada und Luise, die mit ihr im Zimmer schliefen, wurden aus dem Schlaf geschreckt. Luise torkelte schlaftrunken zum Bett ihrer kleinen Schwester. „Mama ist doch noch in Schröttersburg. Hast du wieder Ohrenschmerzen? Warte, ich sag Tessa Bescheid.” Mara weinte leise vor sich hin. „Mama hilf mir doch, Mama!”
Im Flur begegnete Luise ihrem Vater.
„Was ist das für ein Lärm?” wollte Richard wissen.
„Mara hat wieder ihre starken Ohrenschmerzen, ich wollte Tessa holen.”
„Sag ihr, sie soll eine Zwiebel schälen und zerkleinern, wir werden Mara Ohrenwickel machen. Ein altes Hausmittel.”
Gemeinsam mit Tessa schafften Richard und Luise es, die Schmerzen Maras soweit zu lindern, dass sie bei Tagesanbruch erschöpft in einen unruhigen Schlaf fiel. Sobald sie wieder wach würde, sollte Tessa mit Mara zum Arzt nach Hohenburg fahren.
*
Anna blieb fünf Tage lang in Schröttersburg. Zuerst telegrafierte sie nach Hause: „BLEIBE VORERST HIER“. Dann mietete sie sich in eine kleine Pension ein, die sie bis auf den täglichen Besuch bei ihrem Anwalt nicht verließ. In dem engen, aber gemütlichen Einbettzimmer betete und weinte sie viel, außerdem pflegte sie ihre äußeren Wunden und versuchte sich darüber klar zu werden, wie sie ihr weiteres Leben bewältigen sollte. Glücklicherweise war Annas finanzielle Lage recht gut, da ihr Vater dafür gesorgt hatte, dass sie Miteigentümerin des Hohenburger Mietshauses geworden war. Aber was sollte mit den Kindern geschehen? Anna war sich ziemlich sicher, ihr Mann würde ihr die Kinder nicht freiwillig überlassen. Vor allen Dingen kam es darauf an, vor Gericht klarzustellen, dass sie zu keinem Zeitpunkt die Ehe gebrochen hatte.
Einige Tage nach der Vernehmung bei der Gestapo erfuhr Anna durch ihren Anwalt, dass sie voraussichtlich nichts zu befürchten hätte, da sich ihre Aussage mit der von Frau Czerny und weiteren Zeugen decken würde. Außerdem hätte man vor Ort Frau Hammer und die beiden Pimpfe zu der Sache befragt. Dabei wurde von den Zeugen bestritten, je über verfängliche Situationen zwischen Frau Walther und Olszewski berichtet zu haben. Mit bangem Herzen dachte Anna an Jerzy. Ihn in der Gewalt der Gestapo zu wissen schmerzte sie sehr. Immerhin, und das war der einzige positive Gedanke, an den sich Anna klammern konnte, hatte sie durch die Zeugenaussagen für die Scheidung alle Trümpfe auf ihrer Seite. Meinte Anna.
*
Zuhause in Puschkeiten sehnten sich die Kinder nach der Rückkehr der Mutter. Tessa hatte ihre Abreise verschieben müssen, da sie nun auf dem Bauernhof die Aufgaben ihrer Mutter übernehmen musste. Außerdem fuhr sie täglich mit Mara zum Arzt nach Hohenburg. Gereizt und im Kommandoton maßregelte Tessa ihre Geschwister, die ihr bereits nach kurzer Zeit die Gefolgschaft verweigerten und erst recht machten, was sie wollten.
Gerade mal wieder ärgerten Oskar und Mara die große Schwester mit ihren albernen Späßchen. Sie liefen im Kreis um ihre Schwester herum, riefen „Tessa wird niemals bessa” und Oskar steckte dabei einen kleinen Frosch in Tessas Schürzentasche. Ärgerlich schubste Tessa ihre Geschwister weg und schrie Oskar an: „Nimm sofort dieses eklige Etwas aus meiner Tasche, sonst kannst du was erleben!”
In diesem Moment betrat Ada geheimnisvoll lächelnd die Küche.
„Schön, dass du dich auch mal hier blicken lässt!” begrüßte Tessa, in deren Augen Angriffslust funkelte, ihre Schwester sarkastisch. „Warum grinst du so dämlich? Fange lieber mal an, die Kartoffeln zu schälen!”
Ada musterte Tessa gelassen aus ihren katzenhaft grün und bernsteinsteinfarben gesprenkelten Augen. Provozierend bedächtig baute sie sich, grobknochig und einen halben Kopf größer als ihre zartgliedrige ältere Schwester, vor Tessa auf. „Mein Gott bist du aber schlecht gelaunt, dabei …” Ada winkte lockend mit einem grauen Briefumschlag „… habe ich etwas Feines für dich.”
Ehe Tessa nach dem Brief langen konnte, hielt Oskar den aus der Schürze befreiten Frosch der erschrockenen Ada direkt vor die Nase, schnappte nach dem Brief und spurtete zur Küchentür. „Flegel!” rief Ada entrüstet.
„Oskar, ich erwürge dich heute noch!” wütend rannte Tessa ihrem Bruder hinterher. Bestimmt hätte Oskar erfolgreich mit dem Brief flüchten können, wäre er nicht an der Haustür auf Luise gestoßen, die durch das Geschrei der älteren Schwester alarmiert, Oskar kurz entschlossen ein Bein stellte. Beim Sturz auf die Steinplatten ließ Oskar den Brief fallen, den die herbeigeeilte Tessa aufheben konnte und nun endlich in ihren Händen hielt.
„Du kleiner Mistkäfer, glaube ja nicht, dass ich dir heute etwas zu essen gebe”, rief sie dem jammernden Oskar, der sich beide Knie blutig aufgeschlagen hatte, mitleidslos zu. „Und ihr drei kümmert euch um die Kartoffeln, ich bin gleich wieder da.”
Luise, Ada und Mara sahen ihrer über den Hof rauschenden Schwester hinterher.
„Ein Dankeschön wäre doch angebracht gewesen, oder?” meinte Luise.
„Hätte ich ihr den Brief bloß erst heute Abend gegeben, jetzt haben wir die Kartoffeln am Hals”, bedauerte Ada.
„Soll ich dir Verbandszeug bringen, Oskar?” erbarmte sich Mara.
*
Tessa lief bis zu dem kleinen Apfelbaumgärtchen. Die Früchte der Bäume waren bereits abgeerntet und für den Winter eingelagert worden. Dort setzte sie sich auf einen Baumstumpf und öffnete vorsichtig den kostbaren Brief. Mit pochendem Herzen las sie auf polnisch:
25. September 1942, Gut Großenbuchen
Meine liebe Tessa,
ich schreibe dir aus dem Deutschen Reich, wohin man mich an dem Tag, als wir uns treffen wollten, verschleppt hat. Es hat mir in der Seele wehgetan, dich vergeblich warten lassen zu müssen. Die Deutschen haben mich auf dem Hof der Sieberts einkassiert, gerade als ich mich auf den Weg zu dir machen wollte. Ich hoffe, Lisa hat dir alles berichtet. Jedenfalls bin ich in der Nähe von Hamburg auf einem großen Gutshof gelandet. Morgens stehe ich um sechs Uhr auf, habe eine Stunde Mittagspause und abends arbeite ich bis acht Uhr. Die Arbeit ist schwer, aber bei den Sieberts wurde mir auch nichts geschenkt. Außer mir gibt es drei weitere Fremdarbeiter. Mit dem Franzosen Luis unterhalte ich mich auf französisch, zum Glück habe ich es in der Schule gelernt. Mit den beiden Polen komme ich auch gut aus. Der eine ist ein verträglicher, ruhiger Familienvater aus der Nähe von Krakow und der andere heißt Janek, ist 20 Jahre alt und stammt aus Chelmno. Er ist zwar nicht besonders helle, aber dafür ein feiner Kerl. Wir haben uns angefreundet. Janek ist seit sechs Monaten auf dem Hof und kennt sich hier sehr gut aus. (Er weiß beispielsweise, wie wir an eine zusätzliche Ration Tabak kommen können). Richtig ärgerlich macht uns der grantige Aufseher, der uns bei der Arbeit antreibt und keinen Spaß versteht. Obwohl die Herrschaft es nicht mag, schimpft der Kerl uns oft „dreckige Polaken” und schlimmer. Aber Zuhause ist das ja auch kaum anders. Was mir hier besonders stinkt, ist, dass wir auf unseren schäbigen Arbeitsklamotten (und sogar auf den Sachen darunter) das Kennzeichen „P” für Pole tragen müssen. Außerdem besteht ein Aufenthaltszwang am Arbeitsort. Nur mit polizeilicher Genehmigung dürfen wir uns vom Hof entfernen, stell dir das mal vor. Es ist aber auch gar nicht verlockend, sagt Janek, den Gutshof zu verlassen, denn wir Zwangsarbeiter dürfen weder öffentliche Verkehrsmittel benutzen noch Kino, Theater und dergleichen besuchen. Insofern gibt es kaum Zerstreuungsmöglichkeiten. So rede ich viel mit Luis, um meine Sprachkenntnisse zu erweitern und ich lerne deutsch, was den Umgang mit den Leuten auf dem Gut erleichtert. Die Herrschaft hat drei Söhne. Der eine, Viktor, ist in meinem Alter und wirklich nett. Er spricht sehr gut französisch. Neulich wollte er eine Menge von mir über die Verhältnisse in Polen wissen, außerdem fragte er mich, ob ich einen Schatz dort zurückgelassen hätte. Ich sagte ihm, ich wäre am Tag der Verschleppung mit einem ganz bezaubernden Mädchen verabredet gewesen. Es macht dir hoffentlich nichts aus, dass ich einem Fremden von deinen schönen grünen Augen, deiner hübschen Figur und deinem vollen dunklen Haar vorschwärmte? Immerhin fragte mich Viktor daraufhin, ob ich dir nicht schreiben wolle. Er wollte den Brief für mich aufgeben, was er wohl auch getan hat, wenn du diese Zeilen jetzt in deinen Händen hältst. Viktor selbst hat eine wunderschöne Freundin mit Namen Liane, die mich ein wenig an dich erinnert. Sie hat ebenso wenig Scheu wie Viktor sich mit mir zu unterhalten, allerdings ist ihr Französisch erbärmlich.
Ich frage mich, ob wir uns eines Tages wieder sehen werden, meine liebe Tessa. Der Gedanke daran gibt mir Kraft, die Zeit hier zu überstehen. Würdest du mir auch mal schreiben? Ich wäre sehr glücklich. Mit großer Sehnsucht denke ich an Zuhause und an dich.
Behalte mich in deinen Träumen, Dein Zygmunt
Was für ein Brief! Tessa presste die Seiten an ihr Herz. Lieber Zygmunt, gewiss würde sie auf ihn warten. Eines Tages würden sie sich in die Arme schließen, dachte Tessa aufgewühlt. Sofort wollte sie ihm antworten. In ihrem Zimmer lag das lindgrüne Briefpapier, das sie zu ihrem 15. Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Sie wollte es mit Mamas Eau de Cologne betupfen und dann würde sie einen ähnlich schönen Brief für ihren Liebsten verfassen. Leichten Herzens und wie berauscht von den liebevollen Worten, die Zygmunt für sie gefunden hatte, kehrte Tessa ins Haus zurück.
*
Dort fand Tessa, umringt von ihren Geschwistern, überraschend ihre Oma Baumann vor. Freudig begrüßte die älteste Enkelin ihre Großmutter. Richard hatte seiner Schwiegermutter Karoline Baumann einen Brief geschrieben und sie darum gebeten, sich einige Tage um die Kinder zu kümmern. Traditionell war Annas Mutter kurz vor jeder Geburt ihrer Enkel erschienen und hatte sich jeweils sechs Wochen danach – für die Zeit des Wochenbetts – im Haushalt nützlich gemacht. Die Oma war in ihrer lieben, ruhigen Art immer ein Lichtblick gewesen. Im Gegensatz zu ihrer träumerischen Tochter hatte Karoline sofort Überblick über jede Situation und sie verfügte außerdem über viel organisatorisches Talent. Pflichtbewusst hatte sich die Fünfundsechzigjährige, sofort nachdem sie die Nachricht erhalten hatte, von Łomianki aus auf den Weg gemacht.
Seit dem Tod ihres Mannes Jakob bewirtschafteten ihr einziger Sohn Leonhard mit seiner Frau Martha den Baumannschen Bauernhof. Eigentlich hatte sich Karoline Baumann längst auf das Altenteil zurückziehen wollen. Doch seit der 38jährige Leonhard Baumann im Kaukasus kämpfte, gab es noch mehr Arbeit auf dem Hof und Karoline packte so gut wie möglich mit an. Besonders die beiden Enkelkinder Julius und Johanna standen unter ihrer Obhut in Łomianki. Umso mehr wusste es Richard Walther zu schätzen, dass die Schwiegermutter seinem Notruf gefolgt war. Alle, besonders aber Tessa und Richard, waren erleichtert, als Karoline Baumann an diesem Tag sofort das Regiment über Haus und Personal übernahm. Die Familie reagierte sogar mit einer gewissen Enttäuschung auf Annas Rückkehr am darauffolgenden Abend. Doch Anna hatte nicht vor, sich länger als nötig in Puschkeiten aufzuhalten. Sie war froh, mit ihrer Mutter alle Einzelheiten der Trennung von Richard durchsprechen zu können. Denn dem klugen, vernünftigen Urteil Karolines hatte Anna schon immer vertraut. Außerdem herrschte durch Karoline Baumanns Anwesenheit eine, wenn auch nicht entspannte, so doch wenigstens besänftigte Atmosphäre. Weder Richard noch Anna wagten es sich laut zu streiten, solange die alte Dame im Hause weilte.
6 Mai 1943
Es war ein betörend schöner, warmer Maitag und die Natur kümmerte es nicht, ob Krieg war oder nicht. Anna schüttelte auf dem kleinen Balkon ihrer Hohenburger Wohnung gerade ein Federbett auf, genießerisch reckte sie ihr Gesicht der Sonne entgegen. Mit geschlossenen Augen atmete sie die weiche Frühlingsluft ein, deutlich erkannte sie den süßen Duft des in voller Blüte stehenden Flieders. Sie öffnete die Augen und freute sich über die blühende Kastanie und die fröhlichen bunten Farbtupfer der späten Tulpen im Hinterhof.
Anfang November hatte sie die ehemalige Wohnung der Czernys im Hohenburger Mietshaus bezogen. Zuerst empfand Anna ein mulmiges Gefühl dabei, Räume zu beziehen, die Menschen bewohnt hatten, denen das Schicksal so übel mitgespielt hatte. Doch ermutigt von ihrer Mutter Karoline richtete sich Anna die Wohnung gemütlich ein. Trotzdem, es blieb erschreckend: Die ganze Familie Czerny hatte plötzlich aufgehört zu existieren. Es hieß, Anton Czerny sei in dunklen Gestapokanälen verschwunden, vermutlich sei er sogar liquidiert worden. Nur auf Umwegen konnte Anna in Erfahrung bringen, dass Clara Czerny als politische Gefangene in einem Konzentrationslager einsaß. Was konnte die arme Frau schon getan haben, fragte sich Anna betroffen. Schlimm war auch, dass die beiden Mädchen wie vom Erdboden verschluckt zu sein schienen. Das Schicksal Jerzy Olszewskis blieb ebenfalls unklar. Anna betete täglich für ihn und die Czernys.
Wenn Anna an die armen Damen Rosenbaum dachte, denen sie versprochen hatte, mit Nahrungsmitteln durch den Winter zu helfen, wurde sie von einem schlechten Gewissen geplagt. Die ganze Zeit über war sie ja überhaupt nicht auf dem Bauernhof anzutreffen gewesen. Allerdings hatten ihre Kinder und die Mägde ihr versichert, dass die beiden Frauen nie wieder in Puschkeiten aufgetaucht waren. Anna hegte daher die schlimmsten Befürchtungen …
Zu der deprimierenden privaten Situation waren in der letzten Zeit die schrecklichen kriegsbedingten Meldungen gekommen. Ende Januar hatte die 6. Armee nach zweimonatigem Einschluss im Raum Stalingrad kapituliert. Zwei Drittel der Soldaten waren gefallen, erfroren oder an Erschöpfung gestorben. Auch in Hohenburg beklagten viele Menschen den schmerzlichen Verlust ihrer Angehörigen. Kinder hatten ihre Väter verloren, Mütter ihre Söhne, Frauen ihre Männer. Obwohl Anna oftmals den Versuch unternahm, solcherlei Nachrichten aus ihrem Leben zu verdrängen, war das Unterfangen letztlich unmöglich. Sie hatte von der Konferenz von Casablanca erfahren, auf der US-Präsident Roosevelt und der englische Premier Churchill die bedingungslose Kapitulation von Deutschland, Italien und Japan forderten. Im Februar war daraufhin Josef Goebbels aufrüttelnde Rede vom „totalen Krieg” gefolgt. Das deutsche Volk hatte nochmals alle Kräfte mobilisiert. Mit Grauen dachte Anna auch an die Massengräber im polnischen Katyn. Dort hatte man über 4000 polnische Offiziere entdeckt, die von der Roten Armee ermordet worden sein sollten.
Hoffentlich bleiben uns die Russen vom Hals.
Außerdem hörte man in diesen Tagen von schweren Unruhen im Warschauer Judenghetto. Überall schien Gewalt zu herrschen. Schrecklich.
Um die Kinder hatte es mit Richard erwartungsgemäß Streit gegeben. Das Scheidungsverfahren lief, und es würde seine Zeit brauchen. Momentan lebten alle Kinder bis auf Mara auf dem Bauernhof in Puschkeiten bei ihrem Vater. Mara war bereits im Januar zu ihrer Mutter gezogen, da sich der Zustand ihrer Ohren im Winter weiter verschlimmert hatte. Sie war dazu gezwungen, in regelmäßiger ärztlicher Behandlung zu bleiben, ansonsten drohte ihr Taubheit. Im Winter hatte man oft mit Schneeverwehungen zu kämpfen und kam dann nicht aus dem Dorf heraus. So hatte Richard eingesehen, dass Mara besser in Hohenburg bei der Mutter und in Arztnähe aufgehoben war. Für Mara bot das Leben in dem kleinen Städtchen weitere Vorteile. Zum einen konnte sie die Schule des Ortes besuchen, so dass sich der einstündige Fußmarsch, den sie zur bisherigen Schule zurücklegen musste, auf fünf Minuten Weg zur Hohenburger Schule verkürzte. Zum anderen hatte sie endlich neue Spielkameraden gefunden, die sie viel interessanter fand als ihre Geschwister und die anderen Dorfkinder in Puschkeiten. Außerdem genoss sie es, sich die Auslagen der Geschäfte anzusehen und ihre Mutter endlich einmal für sich alleine zu haben. Erst neulich hatte sich Mara zu ihrer übergroßen Freude im Konfektionsladen einen bunt geringelten Baumwollpulli, auf den sie nun riesig stolz war, alleine auswählen dürfen. Mutter und Tochter kamen prächtig miteinander aus. Ab und zu fuhren Mara und Anna wie zu Besuch nach Puschkeiten, manchmal schauten die anderen Walther-Kinder bei den beiden in dem Städtchen vorbei.
Gerade war Mara zum Spielen bei den Pileckis, mit deren Tochter Adelina sie sich angefreundet hatte. Frau Pilecki war vor dem Einmarsch der Deutschen Gymnasiallehrerin in Warschau gewesen. Seit den Polen der Besuch höherer Schulen verboten war, gab es keine Aufgabe mehr für sie. Herr Pilecki, ein Verwaltungsbeamter, musste seit dem polnisch-sowjetischen Krieg von 1919 ohne sein linkes Bein auskommen und war aus diesem Grund nicht zum Arbeitsdienst eingezogen worden. Seit Kriegsausbruch war er arbeitslos. Die derzeitigen Machthaber verwalteten das besetzte Land lieber selbst. Um sich über Wasser zu halten, reparierte der geschickte Herr Pilecki Uhren und defekte Radios. Ansonsten trug seine Frau mit Näharbeiten zum kargen Familieneinkommen bei. Mara hielt sich stets gerne bei dieser liebenswürdigen polnischen Familie auf. Besonders mochte sie es, wenn Adelina oder Frau Pilecki Klavier spielten. Eigentlich war es deutschen Kindern nicht erlaubt, Umgang mit polnischen zu pflegen, doch Anna Walther pfiff auf solche Reglementierungen durch die Obrigkeit. Sollen die Nazis doch wenigstens die Kinderchen in Ruhe lassen. Bisher hatte in Hohenburg niemand daran Anstoß genommen.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752138146
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (März)
- Schlagworte
- Zweiter Weltkrieg Masowien Vertreibung Erzgebirge Starke Frauen Flucht