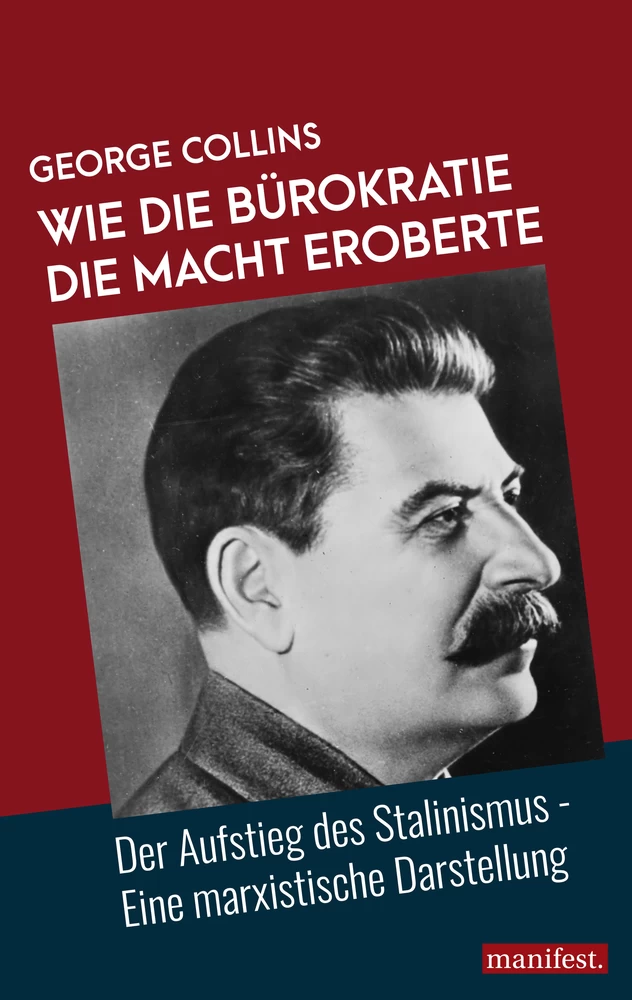Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Die Aussagen des 20-jährigen Genossen Bongani, ein junger südafrikanischer Aktivist aus der Untergrundbewegug in dem Township Tumahole1, machen deutlich, wie wichtig die Beschäftigung mit der sozialistischen Theorie für ernsthafte Kämpfer*innen auf der ganzen Welt ist. Auf die Frage eines Journalisten, was unter People’s Education (dt. „Bildung für das Volk“)2 zu verstehen ist, wird er zitiert:
B: „Ich meine eine Art von Bildung, mit der alle Menschen zufrieden sind, weil sie der Entscheidungsfindung zum Wohle aller dient.
Wenn man sich zum Beispiel mit der Russischen Revolution von 1917 beschäftigt, weil Russland ein kommunistisches Land ist, wird dir die Bantu-Bildung3 dieses und jenes über den Kommunismus erzählen und wie schlecht er ist.
Sie werden einem nicht die wahren Fakten darüber erzählen, was während dieser Zeit in Russland geschah…“
J: „Würden sie gerne den Sozialismus in diesem Land sehen?“
B: „Ja, denn er wird den Kapitalismus abschaffen.“
J: „Was verstehen sie unter Kapitalismus?“
B: „Es ist ein System des Privateigentums einiger Personen, die die Produktionsmittel besitzen. Meine Eltern können von Montag bis Freitag Waren im Wert von R1,0004 produzieren, aber sie werden, sagen wir, nur R50 bekommen. Unsere Eltern werden also ausgebeutet damit bestimmte Individuen reich werden können.
Deshalb bevorzuge ich den Sozialismus, weil die Arbeiter*innenklasse die Produktion kontrollieren wird.“ (Financial Mail, Johannesburg, 31. Oktober 1986)
Es ist kein Zufall, dass dieser Genosse das Beispiel der Russischen Revolution heranzieht, um seinen Punkt zu veranschaulichen. Als erste (und bisher einzige) bewusste sozialistische Revolution bewies sie unwiderlegbar die Möglichkeit, die Herrschaft der reaktionären Klassen zu stürzen und die Herrschaft der Arbeiter*innenklasse zu etablieren.
Trotz der systematischen Verfälschung durch die kapitalistischen Medien und das kapitalistische Bildungssystem sind sich die Arbeiter*innen, die Jugend und die Bauern und Bäuerinnen (vor allem in den unterentwickelten Ländern) der erstaunlichen Umwandlung Russlands von einem rückständigen Bauernland in eine Supermacht bewusst.
Aus diesen Gründen gibt die Russische Revolution weiterhin Millionen unterdrückter Menschen Vertrauen in die Möglichkeit ihres Siegs über den Kapitalismus. Deshalb gibt es kein anderes geschichtliches Ereignis, das wichtigere Lehren für die heutige Arbeiterbewegung enthält.
Was sind die wahren Fakten? Was geschah wirklich während dieser Zeit in Russland? Mit welchem Programm eroberte die russische Arbeiter*innenklasse die Macht? Sind die grundlegenden Ziele dieses Programms noch immer für unseren heutigen Kampf gültig?
Genosse Bongani bezeichnet Russland als ein kommunistisches Land. Inwieweit wurde das Programm von 1917 in die Praxis umgesetzt? Inwieweit hat sich Russland in Richtung Kommunismus entwickelt?
Politisch bewusste Arbeiter*innen sind nicht blind gegenüber den ernsthaften Problemen, die in der Sowjetunion existieren. 1956 verurteilte der sowjetische Führer Chruschtschow5 die monströse Korruption und Repression, die die Herrschaft seines Vorgängers Stalin seit den 1920ern bis zu seinem Tod 1953 kennzeichneten. Dreißig Jahre später prangerte Michail Gorbatschow6 den anhaltenden bürokratischen Missbrauch an.
Genosse Joe Slovo, Vorsitzender der südafrikanischen Kommunistischen Partei, drückt heute seine „Wut und Abscheu“ darüber aus, dass er früher Stalins Regime verteidigte. (Interview mit dem Observer, London, 1. März 1987)
Aber Verurteilungen, Wut und Ekel helfen nicht bei der Beantwortung der eigentlichen Frage: Wie konnte in den Jahren nach 1917 in der Sowjetunion ein Regime der Massenunterdrückung entstehen? Was ist siebzig Jahre später vom ursprünglichen System der Arbeiter*innendemokratie, das unter der Führung von Lenin und Trotzki errichtet wurde, übrig?
Für Sozialist*innen ist es ausschlaggebend, diese Fragen vorbehaltlos und offen zu beantworten. Unsere kritische Betrachtung der Russischen Revolution und ihrer anschließenden Degeneration hat nichts mit dem Klassenhass der Kapitalisten auf die UdSSR gemein. Aber wir müssen „die wahren Fakten“ kennen, um die Lehren aus den Geschehnissen zu ziehen und um korrekt auf die Politik der heutigen sowjetischen Führung reagieren zu können.
Genoss*innen sollten Diskussionen organisieren, in denen diese Ereignisse und die Vorstellungen, auf denen sie basieren, analysiert werden können, in denen Fragen gestellt und Ideen debattiert werden können. Diese Broschüre ist als Beitrag zur Diskussion und als Einführung in die weitere Lektüre gedacht.
Jeder ihrer vier Teile könnte beispielsweise die Grundlage für eine Gruppendiskussion bilden. Einzelne Genoss*innen könnten Beiträge zu den Themen (Abschnitten) vorbereiten, in die jeder Teil unterteilt ist. Die am Ende aufgeführten Bücher und Broschüren sollten von den Genoss*innen studiert werden, die die Themen im Detail verstehen wollen.
Die Umsetzung dieses Studiums und das Begreifen der Lehren ist die beste Art und Weise, den Jahrestag der Russischen Revolution zu feiern.
George Collins, Oktober 1987
I. Die russische Arbeiter*innenklasse ergreift die Macht
- 1. Die Oktoberrevolution
Petrograd7, Hauptstadt Russlands, in der Nacht zum 25. Oktober 1917. Während der Erste Weltkrieg auf den Schlachtfeldern Europas wütet, hat die Russische Revolution ihren entscheidenden Moment erreicht. Bewaffnete Abteilungen aus Arbeiter*innen und Soldaten, organisiert durch die bolschewistische Partei, haben die Kontrolle über die Stadt übernommen. Die pro-kapitalistische Provisorische Regierung, diskreditiert und isoliert, hat aufgehört zu existieren.
Im Smolny-Institut, einer ehemaligen Mädchenschule, tagt der Rätekongress der Arbeiter*innen- und Soldatendeputierten.
Einige Delegierte sind Berufspolitiker*innen, linke Intellektuelle oder radikalisierte Armeeoffiziere. Die große Mehrheit jedoch sind Vertreter*innen der einfachen arbeitenden Bevölkerung: „große Massen von schäbigen Soldaten, schmutzigen Arbeitern, Bauern – arme Männer, gebeugt und vernarbt im brutalen Kampf um ihre Existenz.“ (John Reed, Zehn Tage die die Welt erschütterten) Was sie antreibt ist eine revolutionäre Vision von der Zukunft und eine leidenschaftliche Entschlossenheit, ihrer Unterdrückung ein für alle Mal ein Ende zu bereiten.
Bürgerliche Reformist*innen prangern die Bolschewiki an und fordern die Auflösung des Kongresses. Aber ein Delegierter der Arbeiter*innen, Bauern/Bäuerinnen und Soldaten nach dem anderen weist sie zurück im festen Willen und mit der Begeisterung der Massen, die sich zu ihren Füßen erheben.
Ein Soldat fängt die Stimmung ein: „Ich sage Ihnen, die lettischen Soldaten haben schon oft gesagt: ‚Keine Resolutionen mehr! Kein Gerede mehr! Wir wollen Taten – die Macht muss in unseren Händen liegen!‘“
Der Saal, berichtet John Reed, „bricht in Jubel aus...“
Unter stürmischem Beifall verkünden die Bolschewiki die Übertragung der Staatsmacht an die Arbeiter*innenräte. Eine „Proklamation an die Arbeiter, Soldaten und Bauern“, die von den Bolschewiki vorgelegt wurde, wird mit überwältigender Mehrheit angenommen. Sie fasst die unmittelbaren Aufgaben zusammen:
„Die Sowjetmacht wird sofort allen Völkern einen demokratischen Frieden und den sofortigen Waffenstillstand an allen Fronten anbieten. Sie wird die entschädigungslose Übergabe der Gutsbesitzer-, Kron- und Klosterländereien in die Verfügungsgewalt der Bauernkomitees sichern, sie wird die Rechte der Soldaten schützen, indem sie die volle Demokratisierung der Armee durchführt, sie wird die Arbeiterkontrolle über die Produktion einführen, … sie wird dafür sorgen, dass die Städte mit Brot und die Dörfer mit Gegenständen des dringendsten Bedarf beliefert werden, sie wird allen in Russland lebenden Völkern das wirkliche Recht auf Selbstbestimmung sichern.
Der Kongress beschließt: Die ganze Macht geht allerorts an die Sowjets der Arbeiter-, Soldaten- und Bauerdeputierten über, die eine wirkliche revolutionäre Ordnung zu gewährleisten haben.“ (Zitiert aus: John Reed, 10 Tage, die die Welt erschütterten)
Angeführt von der revolutionären Arbeiter*innenpartei, unterstützt von der Masse der armen Bauern und Bäuerinnen befreite sich das russische Volk aus der jahrhundertelangen Versklavung. Damit zerstörte es die Voraussetzungen für die Existenz des kapitalistischen Systems.
Lenin sprach am folgenden Abend vor dem Kongress. Als er sich schließlich über den tosenden Applaus hinaus Gehör verschaffen konnte, waren seine ersten Worte die Bestätigung der Aufgabe, die die demokratische Revolution auf die Tagesordnung gesetzt hatte:
„Wir gehen jetzt zum Aufbau der sozialistischen Ordnung über.“
Während der langen, harten Jahre des Kampfes, die zu dieser Nacht führten, hatten die Marxist*innen theoretisch dargelegt, was diese Aufgabe beinhalten würde. Nun mussten die bolschewistischen Führer*innen es in praktischen Begriffen erklären.
Leo Trotzki, neben Lenin der maßgebliche Führer der Russischen Revolution, sprach später am selben Abend:
„Unsere ganze Hoffnung jedoch setzen wir darauf, dass unsere Revolution die europäische Revolution entfesseln wird. Werden die aufständischen Völker Europas den Imperialismus nicht erwürgen, dann werden wir erwürgt werden – das ist unbestreitbar. Entweder wird die russische Revolution einen Kampfwirbel im Westen hervorrufen oder die Kapitalisten aller Länder werden unsere Revolution erdrosseln.“ (Zitiert aus: Leo Trotzki, Geschichte der Russischen Revolution)
Die Delegierten, berichtet ein Beobachter, begrüßten diese Worte „mit einem immensen kämpferischen Beifall“. Offensichtlich hatten Lenin und Trotzki die Gedanken und Gefühle der großen Mehrheit der an diesem Abend im Smolny anwesenden revolutionären Kämpfer*innen zum Ausdruck gebracht.
So bekräftigte das neue proletarische Regime in seinen allerersten Stunden zwei grundlegende Aussagen des Marxismus – nicht als theoretische Konzepte, sondern als Grundlagen der staatlichen Politik:
(a) Demokratie und die Lösung der Landfrage ist in einem unterentwickelten Land wie Russland nur unter der Herrschaft der Arbeiter*innenklasse möglich, was den Sturz des Kapitalismus und den Übergang zum Sozialismus mit sich bringt.
(b) Die sozialistische Revolution kann nicht auf die Grenzen eines Landes beschränkt werden; sie kann nur durch den Kampf zum Sturz des Kapitalismus im Weltmaßstab voranschreiten.
Der Rest dieser Broschüre befasst sich mit dem Schicksal der Russischen Revolution in den folgenden zehn bis zwanzig Jahren und mit der Verdrängung der Arbeiter*innendemokratie durch eine monströse bürokratische Diktatur. Aus der sorgfältigen Untersuchung dieser Entwicklungen können Lehren gezogen werden, die heute für den Kampf zum Sturz des Kapitalismus und in der nächsten Periode für den Aufbau gesunder Regime der Arbeiter*innendemokratie von entscheidender Bedeutung sein werden.
-
- 2. Die Konterrevolution
Marx und Engels hatten es für sehr wahrscheinlich gehalten, dass der Kapitalismus zuerst in den entwickelten Ländern besiegt werden würde, wo die Arbeiter*innenklasse am mächtigsten war und bereits eine industrielle Basis für den Übergang zum Sozialismus existierte.
Stattdessen zerbrach im Oktober 1917 die Kette des Weltkapitalismus an ihrem schwächsten Glied.
Die bolschewistische Regierung erbte eine rückständige Gesellschaft in einem Zustand des Zerfalls, erschöpft durch drei Jahre Krieg und eine Reihe vernichtender Niederlagen gegen Deutschland.
Die Imperialisten konnten die Herausforderung ihrer Autorität und die Bedrohung ihrer Interessen in Russland durch die Bolschewiki nicht tolerieren. Wie ein prokapitalistischer Historiker offen zugab: „Sie [die imperialistischen Führer wie Churchill und Foch] warnten davor, dass der Bolschewismus eine gefährliche Bedrohung für die Weltgesellschaft darstellt und zerschlagen werden sollte, solange er noch schwach ist.“ (J. N. Westwood, Russia 1917 to 1964)
Innerhalb Russlands bekämpften die privilegierten und reaktionären Klassen sowie die Reformist*innen in der Arbeiter*innenbewegung die Revolution mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln – Boykott, Wirtschaftssabotage und sogar der Androhung eines Generalstreiks.
Um die Aktivitäten der Kapitalisten bis zu einem gewissen Grad zu kontrollieren, wurde die Kontrolle der Arbeiter*innen über die Produktion durch ein System von Fabrik-, Regional- und Nationalkomitees proklamiert. Trotzdem erwies es sich als unmöglich, den Ausbruch des durch die Revolution entfesselten Klassenkampfes friedlich beizulegen.
Auf der einen Seite weigerten sich die Kapitalisten, sich der Kontrolle der Arbeiter*innen zu unterwerfen. Auf der anderen Seite gaben sich die Arbeiter*innen dort, wo sie ihre Macht geltend machten, nicht damit zufrieden, die Kapitalisten nur zu „kontrollieren“. Sie übernahmen die Fabriken mit allem Drum und Dran, noch bevor ihre Regierung in der Lage war, ihnen Rückendeckung und Ressourcen zu geben.
Diese Kämpfe in der Industrie bestätigten eindeutig die Perspektive, die Trotzki in seiner Theorie der „Permanenten Revolution“ (siehe Kapitel III, Abschnitt 1) erläutert. Sobald die Arbeiter*innenklasse die Macht ergreift, wird es selbst in einem rückständigen Land unmöglich, ihr Programm auf die Grenzen des Kapitalismus zu beschränken. Die Arbeiter*innen werden unweigerlich zur Enteignung der Kapitalisten und zum Programm der sozialistischen Transformation getrieben werden.
Ein bürgerlicher Historiker beschreibt die sich vertiefende Lähmung der russischen Gesellschaft, während sich der Kampf zwischen den Klassen verschärfte:
„Im Frühjahr 1918 näherte sich die russische Wirtschaft dem Punkt des vollständigen Zusammenbruchs. Das Geld verlor jeglichen Wert, die hergestellten Waren verschwanden aus den Geschäften, die Geschäfte selbst schlossen, da die normalen Handelskanäle nicht mehr funktionierten; Spekulation und Korruption waren weit verbreitet.“ (Theodore H. von Laue, Why Lenin? Why Stalin?)
Als die Lebensmittelversorgung fast zum Erliegen kam, verschlimmerte sich der Hunger in den Städten: Warum sollten die Bauern und Bäuerinnen Lebensmittel für den städtischen Markt beschaffen, wenn man selbst im Tauschhandel keine Fertigwaren erhalten konnte?
Revolutionäre Gegenmaßnahmen wurden ergriffen. Die Banken wurden angesichts ihrer anhaltenden Sabotage im Dezember 1917 besetzt und verstaatlicht. Die Arbeiter*innen übernahmen spontan immer mehr Fabriken bis zum Erlass vom Juni 1918, mit dem alle wichtigen Industriezweige in Staatsbesitz überführt wurden.
Komitees der armen Bauern/Bäuerinnen und bewaffnete Arbeiter*innenkommandos wurden organisiert, um die von den reichen Bauern (Kulaken) gehorteten Getreidevorräte zu beschlagnahmen.
Der unversöhnliche Kampf zwischen den Klassen eskalierte zu einem umfassenden Kräftemessen. Auf der Grundlage eines Bündnisses der imperialistischen Mächte mit den Kulaken, den Kapitalisten und den Resten der zaristischen Kräfte begann sich eine bewaffnete Konterrevolution herauszubilden. Der russische Bürgerkrieg wütete mit Höhepunkten und Unterbrechungen von Mai 1918 bis zum Frühjahr 1921.
Wie die Revolution zwingt der Bürgerkrieg jede*n dazu, Partei zu ergreifen – für oder gegen die Regierung. Rechte „Sozialist*innen“, Ex-Revolutionär*innen und Reformist*innen, deren Hass auf den Marxismus (wie immer) stärker war als ihre Angst vor der Reaktion, schlossen sich in großer Zahl dem Angriff auf den Arbeiter*innenstaat an.
Im März 1918 besetzten britische Truppen den Nordhafen von Murmansk und im August eroberten sie Archangelsk und schnitten Russlands Zugang zum Meer ab. Im April landeten japanische Truppen bei Wladiwostok in Ostsibirien.
„Ermutigt durch die Aussicht auf eine alliierte Intervention“, schreibt der führende bürgerliche Historiker E. H. Carr, „befürwortete der rechte Flügel der SR [der rechte Flügel der sogenannten Partei der Sozialrevolutionäre (SR), basierend auf den reicheren Bauern] auf dem Parteitag in Moskau im Mai 1918 offen eine Politik, die darauf abzielte, die bolschewistische Diktatur zu stürzen und eine Regierung zu errichten, die auf dem allgemeinen Wahlrecht beruht und bereit ist, die Hilfe der Alliierten im Krieg gegen Deutschland anzunehmen‘“ (E. H. Carr, The Bolshevik Revolution 1917-1923) – also eine pro-imperialistische Regierung!
Die Menschewiki8, die in alle Richtungen gespalten waren, waren „nur in einem Punkt kompromisslos – in ihrer Feindseligkeit gegenüber dem [bolschewistischen] Regime.“ (E. H. Carr, The Bolshevik Revolution)
In Samara setzten die Sozialrevolutionäre eine anti-bolschewistische „Regierung“ ein und begannen, eine Armee aufzustellen. Im August nahmen sie Kasan ein. Die linken Sozialrevolutionäre, die sich auf die arme Bauernschaft stützten, waren bis März 1918 in Koalition mit den Bolschewiki, ehe sie die Regierung verließen, weil sie den mit Deutschland unterzeichneten Friedensvertrag9 ablehnten und ihn als „Verrat“ bezeichneten.
Jetzt schmiedeten sie ein Komplott gegen die Regierung und versuchten, einen deutschen Angriff zu provozieren, der, wie sie glaubten, mit einem „Revolutionskrieg“ beantwortet werden würde. Da sie die Situation völlig falsch einschätzten, inszenierten sie im Juli einen Aufstand, der rasch zusammenbrach.
Als sich der Krieg der Westmächte gegen Deutschland dem Ende näherte, konzentrierten sie ihre Kräfte auf Russland. Weitere britische, französische und US-amerikanische Truppen landeten in Murmansk und Archangelsk. Amerikanische, japanische, britische, französische und italienische Truppen besetzten Wladiwostok und rückten westwärts bis zum Uralgebirge vor. Eine beträchtliche Zahl französische Truppen wurde am Schwarzen Meer stationiert.
Gleichzeitig finanzierten und bewaffneten die Imperialisten die konterrevolutionären („weißen“) Armeen, die von ehemaligen zaristischen Offizieren aus der rückständigsten Bauernschaft organisiert wurden.
Viktor Serge, damals Mitglied der Bolschewiki, beschreibt anschaulich die verzweifelte Lage im Oktober 1919:
„Die Weißen unter Admiral Koltschak sind die Herren Sibiriens; sie bilden die ‚oberste Regierung‘ der Ukraine unter General Denikin, der sich auf einen Marsch auf Moskau vorbereitet. Im Norden dominieren sie dank der britischen Bataillone eine vage sozialistische Regierung unter dem Vorsitz des alten Tschaikowsky, einem Veteranen der ersten Kämpfe gegen den Zarismus; und General Judenitsch bereitet sich auf die Einnahme Petrograds vor, wo die Menschen auf den Straßen verhungern und sich vor der Großen Oper tote Pferde auftürmen.“ (Victor Serge, From Lenin to Stalin)
Jedoch ein Jahr später wurden die Truppen von General Wrangel (Denikins Nachfolger) auf der Krim zerschlagen und die militärische Bedrohung war faktisch beendet.
Obwohl die Bolschewiki aus einer extrem schwachen Position heraus kämpften, konnten sie die vereinten Kräfte der inneren und äußeren Reaktion schlagen. Ein Sieg, der sicherlich eine der brillantesten militärischen Leistungen aller Zeiten darstellt.
Wie wurde dieser Sieg errungen?
-
- 3. Wie die Bolschewiki die Konterrevolution besiegten
Das Überleben des russischen Arbeiter*innenstaates wurde in erster Linie durch die internationale Unterstützung der Arbeiter*innenklasse in den gewaltigen Bewegungen nach der Oktoberrevolution ermöglicht.
Die Perspektive der Bolschewiki glänzend bestätigend wurde Europa in eine Periode der Revolution gestürzt. In einem Land nach dem anderen öffnete sich der Weg hin zum Sieg der Arbeiter*innenklasse.
Die Imperialisten, gefesselt durch Kämpfe auf Leben und Tod in ihren eigenen Ländern, konnten ihre Angriffe auf Russland nicht fortsetzen, ohne die Arbeiter*innen noch weiter zu provozieren und ihre Soldaten zur Meuterei zu treiben.
Ein Streik der ungarischen Munitionsarbeiter im Januar 1918 breitete sich wie ein Lauffeuer über Wien, Berlin und ganz Deutschland aus, bis schließlich über zwei Millionen Arbeiter*innen an ihm beteiligt waren. Ihre zentrale Forderung, die sich mit der Forderung der russischen Arbeiter*innen deckte, war der Frieden. In Finnland wurde eine Unabhängige Arbeiter*innenrepublik proklamiert. Nach monatelangen Kämpfen wurde sie mit Hilfe der deutschen Truppen zerschlagen.
Am 4. November 1918 brach auf dem deutschen Marinestützpunkt Kiel eine Meuterei aus, die die deutsche Revolution entzündete. Innerhalb weniger Tage war jede größere deutsche Stadt in den Händen der Arbeiter*innenräte.
Diese internationale revolutionäre Welle hatte auf die russische Arbeiter*innenklasse eine geradezu elektrisierende Wirkung. Der Bolschewik Iljin-Schenewski, der an einem Abend eine Aufführung in einem Petrograder Theater besuchte, gibt einen Einblick in die Auswirkungen auf das ganze Land:
„Bevor einer der Auftritte begann, kam ein Mann in Jacke und hohen Stiefeln auf die Bühne und sagte: ‚Genossen! Wir haben gerade Nachricht aus Deutschland erhalten. Es hat in Deutschland eine Revolution stattgefunden. Wilhelm [der Kaiser] ist gestürzt worden. Ein Rat der Arbeiterdeputierten hat sich in Berlin gebildet und uns ein Grußtelegramm geschickt.‘“
„Es ist schwer zu vermitteln, was folgte… Die Bekanntgabe wurde mit einer Art Getöse aufgenommen, und frenetischer Applaus erschütterte das Theater mehrere Minuten lang…“ (Iljin-Schenewski, The Bolsheviks in Power)
In Österreich führten Massenstreiks und Meutereien in der Armee schließlich zum Zusammenbruch des kaiserlichen Habsburg-Regimes. Das Kaiserreich zerfiel. Im März 1919 übernahm in Ungarn eine revolutionäre Räteregierung die Macht.
Frankreich wurde von Massenstreiks und Flottenmeutereien erschüttert. Britische Soldaten meuterten. Die rote Fahne wurde über dem Clyde10, im industriellen schottischen Kernland, gehisst. Irland befand sich in einer bewaffneten Revolte gegen die britische Kolonialherrschaft. 1919 kam es in den USA zu einer Streikwelle, an der sich vier Millionen Arbeiter*innen beteiligten.
Diese Ereignisse, die in den offiziellen Geschichtsbüchern kaum Erwähnung finden, demonstrieren ein Gesetz, das jede*r Sozialist*in verstehen muss: Eine erfolgreiche Arbeiter*innenrevolution hat weltweit unabsehbare Auswirkungen. Sie provoziert die kapitalistische Reaktion, ermutigt aber gleichzeitig die Arbeiter*innen in anderen Ländern, sich für sie einzusetzen und ihrem Beispiel zu folgen.
Der Geist der internationalen Solidarität war die stärkste Waffe der russischen Arbeiter*innen. Nicht durch moralische Appelle an die „Demokratie“ oder an das „Gewissen“ der Kapitalistenklasse, sondern dadurch, dass sie sich mit dem internationalen Kampf der Arbeiter*innenklasse um die Macht verbündeten, gewannen die Bolschewiki massenhaft Unterstützung aus allen Teilen der Welt und eröffneten eine „zweite Front“ im Rücken der imperialistischen Staaten.
Als Antwort auf die kameradschaftliche Aufforderung der Bolschewiki, die Waffen niederzulegen, meuterten Teile der britischen und amerikanischen Truppen in Russland. Am Schwarzen Meer hissten französische Seeleute die rote Flagge. Die Imperialisten sahen sich gezwungen, ihre Truppen zurückzuziehen und die Weißen ihrem Schicksal zu überlassen.
Die frühen Kongresse der Kommunistischen Internationale (siehe Kapitel II, Abschnitt 1) riefen die Arbeiter*innenbewegung international dazu auf, gegen jede Art von Unterstützung für die Weißen in Russland vorzugehen. Im Juli 1920, nach dem Einmarsch reaktionärer polnischer Kräfte in Russland, appellierte der Zweite Kongress:
„Stoppt alle Arbeit, stoppt alle Transporte, wenn ihr seht, dass die kapitalistischen Cliquen eurer Länder trotz eurer Proteste eine neue Intervention gegen Russland vorbereiten. Lasst keinen einzigen Zug, kein einziges Schiff nach Polen durch.“ (An die Arbeiter*innen aller Länder, Dokumente des 2. Kongresses der Kommunistischen Internationale)
In Großbritannien schlossen sich die Londoner Dockarbeiter*innen auf beindruckende Weise ihren Genoss*innen in Russland an, indem sie sich weigerten, das Schiff Jolly George mit Waffen für die Weißen in Polen zu beladen.
Im Juli, als die Rote Armee die Invasoren zurücktrieb, drohte die britische Regierung damit, Truppen nach Polen zu schicken. In ganz Großbritannien wurde von Gewerkschafter*innen ein Aktionsrat eingerichtet, der im Falle einer Fortsetzung der Intervention mit einem Generalstreik drohte.
48 Stunden nachdem sie die sowjetische Antwort auf ihr Ultimatum abgelehnt hatte, sah sich die britische Regierung gezwungen aufzugeben.
Der Sieg der Arbeiter*innen auf den Schlachtfeldern Russlands und auf internationaler Ebene konnte nur durch die kompromisslose revolutionäre Politik der Bolschewiki errungen werden.
Ein Soldat, der auf einer Massenversammlung in Petrograd sprach, veranschaulichte das Klassenprogramm, auf dem die Rote Armee aufgebaut wurde:
„Der Soldat sagt: ‚Zeig mir, wofür ich kämpfe… Ist es die Demokratie oder für die kapitalistischen Plünderer? Wenn Sie mir beweisen können, dass ich die Revolution verteidige, dann werde ich hinausgehen und kämpfen, ohne dass mich die Todesstrafe dazu zwingt.‘“
„Wenn das Land den Bauern gehört und die Fabriken den Arbeiter*innen und die Macht den Sowjets, dann werden wir wissen, dass wir etwas haben, wofür wir kämpfen, und wir werden dafür kämpfen!“ (John Reed, Zehn Tage, die die Welt erschütterten)
Ein Schlüsselfaktor im Kampf der Arbeiter*innenklasse ist ihre Führung – in erster Linie gibt es Ideen und Programme, aber daraus ergibt sich die Notwenigkeit, eine Führung aus Individuen aufzubauen, die diese Ideen begreift, die den Vorwärtsdrang ihrer Klasse verkörpert und die den Weg zu einer erfolgreichen Revolution aufzeigen kann.
Man kann die historische Leistung von Marx und Engels bei der Entwicklung der sozialistischen Theorie wie auch Lenins Beitrag bei der Vorbereitung und Durchführung der Oktoberrevolution unmöglich leugnen.
Ebenso unmöglich ist es, Trotzkis entscheidende Rolle als Kriegskommissar von 1918 bis 1925 beim Aufbau der Roten Armee und bei ihrer Führung zum Sieg zu leugnen.
Trotzki organisierte die Rote Armee als eine Revolutionsarmee, deren Kampfbereitschaft nicht auf blindem Gehorsam beruhte, sondern auf politischem Verständnis. Trotzkis unerschütterliches Vertrauen in die Arbeiter*innen, Jugendlichen und Bauern, die in ihren Reihen standen, kommt am besten in seinen eigenen Worten zum Ausdruck:
„Und doch wurde die Revolution gerettet. Was war dazu erforderlich gewesen? Nicht viel: es war erforderlich, dass die vorgeschrittenen Schichten der Masse die tödliche Gefahr begriffen. Die Hauptbedingung des Erfolges bestand darin, nichts zu verheimlichen, vor allem nicht die eigene Schwäche, mit der Masse keine List zu treiben, alles offen beim Namen zu nennen.“ (Leo Trotzki, Mein Leben)
Engagierte junge Arbeiter*innen wurden von der Armee angezogen und wurden zu ihrer Vorhut. Trotzki fährt fort:
„Die Sowjets, die Partei, die Gewerkschaften schufen neue Abteilungen und schickten Tausende von Kommunisten [an die Front]. Die Mehrzahl der Parteijugend kannte den Gebrauch der Waffen nicht. Aber sie wollte siegen, um jeden Preis. Und das war die Hauptsache. Sie hat dem morschen Körper der Armee das Rückgrat gesteift.“ (Leo Trotzki, Mein Leben)
Der „Wille zu gewinnen“ sei „das Wichtigste“. Der Umgang mit Waffen kann in kurzer Zeit erlernt werden. Der Wille zum Sieg kann nur aus einem Bewusstsein über den Zweck, aus der Motivation für ein klares Ziel, das es zu erkämpfen gilt, und aus dem Verständnis dafür, wie es erreicht werden kann, geboren werden.
Die Bolschewiki mussten zuerst einen moralischen Sieg erringen. Genau diese vitale Kraft, die Kampfmoral, fehlte in den Reihen der Weißen. Sogar der prokapitalistische Westwood sieht sich gezwungen zuzugeben:
„Bis [General] Wrangel die Überreste der Weißen Armee übernahm [d.h. als der Krieg beinah zu Ende war], waren ihre Offiziere ein Vorbild für Trunkenheit, Plünderungen und Gewalt, dem ihre Soldaten bereitwillig folgten. Die empörende Behandlung der einheimischen Bevölkerung, die unverblümte Absicht, die Großgrundbesitzer wieder einzusetzen und die größere soziale Kluft zwischen den Weißen und der Bauernschaft veranlassten letztere schließlich dazu, die Roten zu bevorzugen.“ (J. N. Westwood, Russia 1917 to 1964)
Damit wurde der anfängliche Ansturm der Konterrevolution besiegt. Die Bolschewiki begriffen jedoch, dass ihr Sieg nicht mehr als eine Atempause im Kampf bringen konnte. Wie Lenin 1920 kommentierte:
„Wir sind jetzt vom Krieg zum Frieden übergegangen. Aber wir haben nicht vergessen, dass der Krieg wiederkehren wird. Solange Kapitalismus und Sozialismus bestehen, können wir nicht in Frieden leben: Der eine oder andere wird letzten Endes siegen.“ (Zitiert aus: Leo Trotzki, Geschichte der Russischen Revolution)
-
-
- Diskussionsfragen
-
- Warum ereignete sich die Revolution im rückständigen Russland und nicht in Großbritannien oder Deutschland, wo die Arbeiterklasse stärker war?
- Was wäre passiert, wenn Lenin und Trotzki 1917 nicht in Russland gewesen wären?
- Die Revolution fand in Russland aufgrund einzigartiger Bedingungen (Kriegsmüdigkeit, Hunger, landlose Bauern) statt. Bei uns wird das sicher nicht so sein?
- Hat die Entwicklung eines dreijährigen Bürgerkriegs nicht gezeigt, dass die Bolschewiki nur von einer winzigen Minderheit unterstützt wurden?
- Wie konnten die Bolschewiki im Bürgerkrieg gegen die militärische Übermacht der konterrevolutionären Kräfte gewinnen?
-
-
- Einführende Lektüre
-
- Peter Taaffe: Die Lehren der Februarrevolution (Artikel auf solidarität.info)
- Sascha Staničić: Einige Lehren des Roten Oktober (Artikel auf solidarität.info)
- Wolfram Klein: 1917 – Die Russische Revolution. Eine Einführung
- Leo Trotzki: Die Russische Revolution – Kopenhagener Rede
-
-
- Weiterführende Lektüre
-
- Albert Rhys Williams: Durch die Russische Revolution
- John Reed: 10 Tage, die die Welt erschütterten
- Leo Trotzki: Geschichte der Russischen Revolution
- Leo Trotzki: Revolution in Russland
- Leo Trotzki: Terrorismus und Kommunismus
- Daniel Behruzi: Sowjetunion 1917-24. Revolution, Arbeiterdemokratie, Bürokratisierung
II. Isolation und Degeneration des Arbeiter*innenstaates
- 1. Rückschläge im internationalen Kampf
In den mächtigen Klassenbewegungen, die auf die Oktoberrevolution folgten, stand der Sturz des Kapitalismus in ganz Europa auf der Tagesordnung.
Der Sieg der Arbeiter*innenklasse in den entwickelten Ländern wiederum hätte eine Grundlage zur Überwindung der lähmenden wirtschaftlichen Rückständigkeit Russlands geschaffen und die Gefahr eines imperialistischen Angriffs beseitigt.
Eine internationale Organisation, die die in den verschiedenen Ländern in Aktion tretenden Arbeiter*innen vereinen und den Kampf gegen das weltweite kapitalistische Bündnis führen konnte, war unerlässlich.
Die Zweite (Sozialistische) Internationale hatte 1914 aufgehört, als Instrument der Arbeiter*innen im internationalen Kampf für den Sozialismus zu existieren (siehe Kasten). Eine neue Internationale musste aufgebaut werden.
Vor 1914 war die Zweite Internationale entschlossen, dem imperialistischen Krieg mit allen Mitteln, einschließlich des Generalstreiks, entgegenzutreten. Doch als der Krieg erklärt wurde, entpuppte sich die große Mehrheit ihrer Führung als aktive oder passive Unterstützung ihrer „eigenen“ Regierungen. Was waren die Ursachen für diesen erschütternden Verrat? Die Zweite Internationale wurde 1889 als eine Föderation von (hauptsächlich europäischen) sozialdemokratischen Parteien gegründet, die im Allgemeinen marxistische Ideen vertraten. Sie wurde während einer Periode der imperialistischen Expansion und eines allgemein stabilen Wachstums in den entwickelten kapitalistischen Ländern aufgebaut. Dies hatte einen entscheidenden Einfluss auf ihren Charakter. Wichtige Kämpfe wurden unter dem Banner der Internationale ausgefochten. Wichtige Zugeständnisse wurden gewonnen – demokratische Rechte, bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen. In diesem Prozess entstand eine qualifizierte und relativ gut bezahlte „Arbeiteraristokratie“. Aus dieser Schicht bildete sich zunehmend die Führung, zusammen mit Intellektuellen, die sich entschlossen, Karriere in der organisierten Arbeiter*innenbewegung zu machen. Fernab der täglichen Kämpfe der Arbeiter*innen fühlten sich diese Führungspersönlichkeiten in gut bezahlten Jobs als Parlamentarier*innen oder Partei- und Gewerkschaftsfunktionär*innen zunehmend wohl. Ihre Ideen wurden unweigerlich von ihrer Umgebung beeinflusst. Ihre allgemeine Stimmung wurde in der Theorie des „Reformismus“ des deutschen Sozialdemokraten E. Bernstein zusammengefasst – die Idee, dass der Kapitalismus durch friedliche, parlamentarische Methoden graduell „reformiert“ werden könnte, bis er aufhört zu existieren. Das bedeutete, dass der Kampf zum Sturz des kapitalistischen Staats still und leise in den Hintergrund gedrängt werden konnte. Der „Kampf“ konnte von den bequemen Bänken des Parlaments aus geführt werden – mit einem hohen Gehalt, bezahlt vom Staat! Die reformistische Tendenz nahm immer monströsere Ausmaße an. Sie führte unweigerlich zu einer zunehmenden Zusammenarbeit mit der Kapitalistenklasse. Die Führer*innen der Arbeiter*innenklasse engagierten sich mehr und mehr in den verschiedenen Staatsorganen. Öffentliche Ämter gaben ihnen neue Privilegien. Durch all diese Zwänge wurde eine nationalistische Einstellung kultiviert. Die Perspektive der sozialdemokratischen Führer*innen wurde immer mehr auf die Institutionen der nationalen und lokalen Regierung beschränkt. Ihre Verbindungen mit der internationalen Bewegung wurden auf bloße Gefühle und Phrasen reduziert. Die katastrophalen Folgen dieses allmählichen Prozesses der politischen Degeneration traten im August 1914 an die Oberfläche, als die Reformist*innen sich fast einhellig auf die Seite des kapitalistischen Staates stellten. Der Kampf der Arbeiter*innen zum Sturz des Kapitalismus wurde von diesem Zeitpunkt an von den reformistischen Führer*innen offen und wütend abgelehnt. |
Um den Aufbau einer neuen kämpferischen Internationale voranzutreiben, erhielten Anfang 1919 die Organisationen der revolutionären Arbeiter*innen in verschiedenen Ländern einen historischen Brief: unterzeichnet von Lenin und Trotzki im Namen der Kommunistischen Partei Russlands (dem neuen Namen der Bolschewistischen Partei) sowie von Arbeiterführer*innen aus anderen Ländern. Das Schreiben lud die Organisationen zu einem Kongress in Moskau ein und erklärte den Zweck wie folgt:
„Der Kongress muss ein gemeinsames Kampforgan zwecks permanenter Verbindung und planmäßiger Leitung der Bewegung, ein Zentrum der kommunistischen Internationale, einsetzen und die Interessen der Bewegung in jedem Lande den gemeinsamen Interessen der Revolution auf internationaler Ebene unterordnen.“ (Einladungsschreiben einiger Kommunistischer Parteien zur Teilnahme an einem internationalen Kommunistischen Kongress vom 24. Januar 1919, veröffentlicht in „Die Kommunistische Internationale, Nr. 1, August 1919“)
Auf diesem Kongress, der vom 2. bis 6. März 1919 tagte, wurde die Kommunistische (Dritte) Internationale gegründet.
„Das imperialistische System bricht zusammen. Gärung in den Kolonien, Gärung unter den früher unselbständigen kleinen Nationen, Aufstände des Proletariats, siegreiche proletarische Revolution in einigen Ländern, Auflösung der imperialistischen Armeen, … – dies ist das Bild der jetzigen Zustände in der ganzen Welt.“ „Es gibt nur eine Kraft, die sie [die Menschheit] retten kann, und diese Kraft ist das Proletariat... Sie muss eine wirkliche Ordnung schaffen, die kommunistische Ordnung. Sie muss die Herrschaft des Kapitals brechen, die Kriege unmöglich machen, die Grenzen der Staaten vernichten, die ganze Welt in eine für sich selbst arbeitende Gemeinschaft verwandeln…“ „Das Anwachsen der revolutionären Bewegung in allen Ländern, die Gefahr der Erstickung dieser Revolution durch das Bündnis der kapitalistischen Staaten, … endlich die absolute Notwendigkeit der Koordinierung der proletarischen Aktionen – alles das muss zur Gründung einer wirklich revolutionären und wirklich proletarischen Kommunistischen Internationale führen.“ |
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752137705
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (März)
- Schlagworte
- Sozialismus Oktoberrevolution Marxismus Sowjetunion Bürokratie