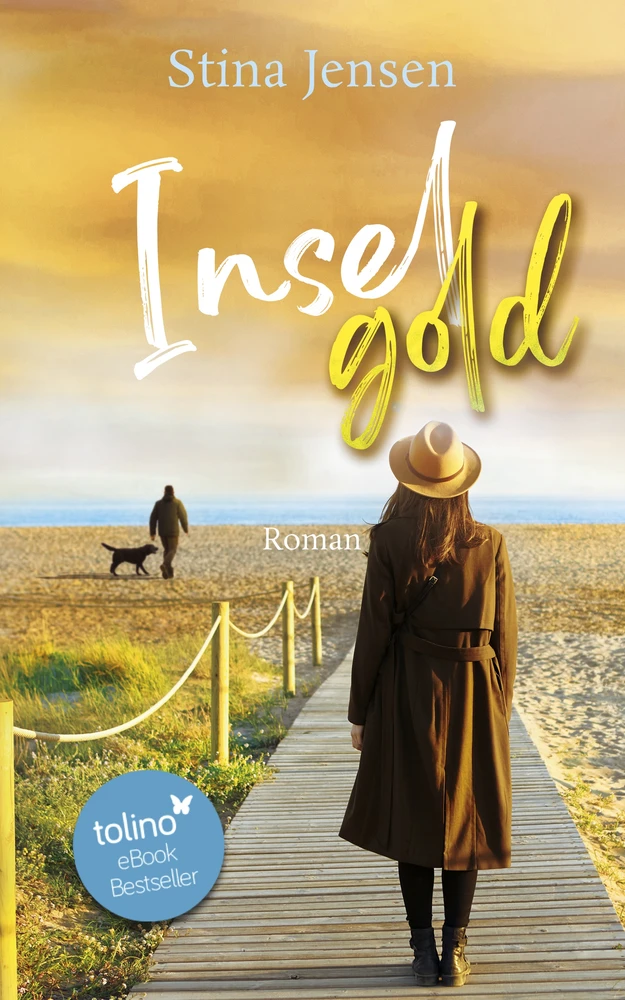Ach, Claire.
Weißt du, was mich in diesen letzten Monaten seit deinem Auszug hat durchhalten lassen? Die Vorfreude auf unser wöchentliches Skypen. Vermutlich war ich an diesem Morgen deshalb so gut drauf, weil ich wusste, dass wir bald miteinander reden würden.
Allerdings verging mir die Vorfreude in dem Moment, in dem ich den Brief von Sven Sandberg in Händen hielt und nicht wagte, ihn zu öffnen.
Um Viertel nach elf sah ich das vertraute Blinken auf meinem Rechner, und kurz darauf lächeltest du mir gequält entgegen. Ich hatte nicht vor, dir von dem Brief zu erzählen.
»Ist etwas passiert?«, fragte ich stattdessen. »Irgendwas mit dem Praktikum? Mit Kristján?«
Du schütteltest den Kopf. »Nein, Mom, hier ist soweit … alles bestens.« Dass es eine Lüge war, sah ich sofort, auch wenn du dich an einem Lächeln versuchtest und mich für mein frisches Aussehen lobtest.
Ich freute mich über dein Kompliment, manchmal fühle ich mich nämlich ganz und gar nicht frisch. Wenn ich das Handy mal versehentlich auf den Selfie-Modus stelle, ohne darauf gefasst zu sein, und dann sehe, wie meine Mundwinkel nach unten zeigen …
Etwas an dir wirkte jedenfalls aufgesetzt, und eine altbekannte Angst kroch mir den Nacken hoch. Gab es etwa wieder Probleme?, fragte ich mich. Wo doch endlich einmal alles gut zu sein schien. Allerdings, mir war klar, dass – wie sehr ich auch nachbohren würde – du nichts preisgeben würdest, es sei denn aus freien Stücken.
Im folgenden Gespräch erzähltest du mir ausgiebig von den neuesten Ereignissen in deinem Praktikum im Hort.
Ich hätte niemals vermutet, dass du ein gutes Händchen für Kinder haben könntest und war daher von deiner Idee, beruflich etwas mit Dreikäsehochs zu machen, sehr überrascht. Inzwischen bin ich natürlich überglücklich, dass du endlich weißt, was du willst. Eine Zeit lang hatte ich wirklich Sorge, Claire, du könntest deinem Vater mehr ähneln, als mir lieb war.
Nachdem ich dir den neuesten Klatsch von der Arbeit berichtet hatte, kamst du auf meine beiden bevorstehenden Verabredungen in der kommenden Woche zu sprechen, die ich den ganzen Morgen erfolgreich aus meinen Gedanken verbannt hatte.
Die Partnersuche angehen zu wollen, war eine Sache, es auch zu tun eine ganz andere. Ein Date hatte ich sogar schon hinter mir, doch der Herr besaß drei Hunde. Drei!
»Also, Mom«, mit diesen Worten sahst du mich beschwörend an, »nutze diese Chance. Stell dir vor, wie schön es wäre, mit einem interessanten Mann die Feiertage zu verbringen. Ihr könntet lange Strandspaziergänge unternehmen und …«
»An den Feiertagen kommst doch du«, unterbrach ich dich, »da werde ich jede freie Minute mit dir verbringen.« Ich tippte mir belustigt an die Stirn. »Denk doch mal nach.«
Du verzogst das Gesicht, als hättest du auf eine Zitrone gebissen. »Stimmt natürlich«, flüstertest du, dann sahst du auf deine Uhr und hauchtest: »Oops, ich muss Schluss machen, wir müssen gleich los. Es ist Schnee angekündigt, und wir wollen noch rechtzeitig in Reykjavík eintreffen.«
»Wir könnten ja nachher noch mal skypen«, schlug ich vor – doch du fuhrst dir mit beiden Händen durchs Haar.
»Wir bekommen vielleicht noch Besuch, ein paar Freunde wollten vorbeikommen. Wir hören uns in einer Woche wieder, Mom, ja? Bis dann!«
Dein Konterfei verschwand von der Bildfläche, und ich war wieder allein.
Du entferntest dich von mir, es war eindeutig. Es sollte mich freuen, jede Mutter sollte sich freuen, wenn das Kind – besonders eines wie du – auf eigenen Beinen steht. Doch die Freude darüber wollte sich nicht so recht einstellen. Stattdessen wuchs das Gefühl, dass du mir eigentlich etwas sagen wolltest, das mich nicht gefreut hätte.
Aber zurück zu deinem Vater. Es war wie in einem Film, in dem die Drehbuchautoren das gern genommene Klischee verwenden, die männliche Hauptfigur damit zu überraschen, dass sie ein Kind hat. Der Held klingelt an der Wohnungstür, und die Verflossene öffnet ihm mit einem Baby auf dem Arm.
Genauso war es bei uns.
Das Baby warst du, mit zweitem Namen hatte ich dich Amber genannt. In einem unserer vielen Gespräche während unseres Zusammenseins hatte dein Vater mir erzählt, dass er – sollte er jemals Kinder haben – seine Tochter unbedingt so nennen wollte. Nach den wertvollen Steinen, die er in seiner Heimat so erfolgreich gesammelt hatte.
Nun, zumindest das war ich ihm doch schuldig gewesen. Damals warst du noch blond wie er. Um den Hals trugst du in jenem Augenblick ein mit Karottenbrei verschmiertes Lätzchen. Das Spucktuch zeigte Big Bird, den riesigen Kanarienvogel aus der Sesamstraße.
Als du Andy sahst, sagtest du »De«.
Andy hielt eine Kamera im Anschlag, um meinen Gesichtsausdruck zu filmen, wenn ich ihn vor der Wohnungstür erblickte.
Ich hingegen werde nie Andys Mienenspiel vergessen.
Wir starrten uns, nachdem er den Camcorder hatte sinken lassen, minutenlang an. Minuten, in denen er sich vermutlich Verschiedenes fragte. Zum Beispiel, ob ich so schnell einen anderen gefunden hatte. Vielleicht sogar, ob ich bereits schwanger gewesen war, als ich ihn traf. Oder ob dies sein Kind sein könnte. So genau konnte er dein Alter sicher nicht auf Anhieb einschätzen.
Niemals hätte ich mit einem Überraschungsbesuch gerechnet. Ich hatte damit kalkuliert, dass er mir in einem seiner Briefe mitteilen könnte, er wolle mich besuchen – das hätte ich schon irgendwie abgewehrt, und wäre es nur gewesen, ihm zu berichten, dass ich einen Freund hatte. Doch er war einfach gekommen. Mit einem Reiserucksack auf dem Rücken, vermutlich auf der Durchreise zu seinem nächsten Trip an der Küste entlang.
Durch unsere Begegnung hatte er sich weniger angesehen als ursprünglich geplant. Dies wollte er nachholen. Das erfuhr ich später.
Nach diesen endlos anmutenden Minuten des Anstarrens fragte Andy schließlich: »Ist das meins?«
Ich konnte nicht lügen. Mein unmissverständlicher Blick genügte als Antwort.
Ohne ein weiteres Wort wandte Andy sich ab und ging.
Ich blieb mit rasendem Herzen und zittrigen Knien an der Haustür stehen und schloss sie schließlich leise hinter mir, kehrte mit dir im Arm zurück in meine Wohnung.
Du sperrtest weiter hungrig den Schnabel auf, als wäre nicht die größte Veränderung in unseren Alltag getreten, wie ein Steinschlag in die unberührte Fläche frisch gefallenen Schnees.
Nach drei Tagen kam er zurück. Er war betrunken. Diesmal war keine Kamera in seinen Händen. Nur ein stiller Vorwurf in den Augen. Den ich sogar verstand. Ich selbst hatte seit drei Nächten nicht geschlafen, mich bei jedem Klingeln gefragt, ob er zurückkehrte. Und was er sagen würde. Ich fühlte mich schuldig. Jemandem ein Kind vorzuenthalten ist kein Klacks. Dich nahm ich nicht mehr mit an die Tür.
Andy öffnete seinen Rucksack und zerrte einen kleinkindgroßen Teddybären hervor, den er mir mit ausgestreckter Hand entgegenhielt. Um den Hals des Teddys baumelte ein Glöckchen. Du hast ihn noch immer, er sitzt auf dem Regal in deinem alten Zimmer.
Ich bat Andy herein. Jetzt, wo er schon mal hier war, konnte ich ihn nicht abweisen. Er hatte nichts Schlimmes getan.
Er stieg die Treppe hinauf wie ein geprügelter Hund, schlich auf Zehenspitzen zu dem Laufstall im Wohnzimmer, in dem du mit dem Daumen im Mund lagst. Ein Speicheltropfen rann an deiner Hand vorbei, deine Wangen zitterten beim Saugen.
Über Andys Gesicht flossen stille Tränen, die mir die Kehle eng werden ließen.
»Ich wollte dich nicht damit belasten«, sagte ich. »Du lebst so weit weg, wolltest reisen …«
Er wischte sich über die Augen und sah mich fragend an. »Darum ging es?«, fragte er. »Es ist nicht, weil du mich nicht wolltest?«
»Natürlich nicht«, log ich.
Wie sollte ich ihm erklären, dass ich mit Problemen besser allein zurechtkam; dass es mich eher belastete, wenn ich sie mit anderen teilte. Ich stimmte mich nicht gern ab, besonders dann nicht, wenn ich selbst hochgradig verunsichert war. Ich hatte ja nicht gewusst, wie es mit Baby werden würde. Und geahnt, dass es sich bei Andy um einen Mann handelte, um den man sich bald ebenso intensiv kümmern müsste wie um ein Kind.
Wie sehr, habe ich damals allerdings nicht ahnen können.
Nachdem er Stunden damit verbracht hatte, dir vor sich hin weinend beim Schlummern zuzusehen, wechselte er vom Weinen ins Lachen und wieder zum Tränenvergießen. Schließlich packte er die Kamera aus und filmte dich beim Schlafen, dabei, wie du aufwachtest, und dabei, wie du ihn zum ersten Mal ansahst.
Er schlief auf der Couch. Machte mir keine Vorwürfe, stellte mir keine Fragen. Er hob tausend Dollar von seinem Konto ab und legte sie mir auf den Tisch. Sein Beitrag zum Baby und zur Miete, sagte er. Er würde gern bleiben.
Ich wollte sagen, er könne nicht bleiben, allenfalls ein Besuchsrecht bekommen … doch mir fehlten die Worte.
Und so kam es, dass ich wieder arbeiten konnte, während dein Vater auf dich achtgab. Finanziell hätte mir nichts Günstigeres passieren können. Und dir nichts Besseres als dein Daddy.
Zunächst.
An jenem Tag, als dieser Brief aus Deutschland eintraf, hielt ich es nachmittags nicht mehr aus und nahm den cremefarbenen Umschlag zur Hand, roch daran. Er duftete nach Papier – etwas anderes war auch nicht zu erwarten gewesen.
Ich trug das Kuvert in die Küche, schaltete die Neonröhre über der Spüle an und hielt den Umschlag darunter, versuchte die Schatten blauer Schrift, die durch das Pergament schimmerten, zu entziffern. Doch wie ich es auch wendete, es war nichts zu erkennen. Auch nicht, als ich mit einer Taschenlampe hinter den Brief leuchtete.
Ich wollte ja gar nicht alles lesen, nur ein Wort erhaschen. Irgendetwas, das mir Aufschluss darüber geben würde, worum es ging. Dabei lag das ja auf der Hand. Vermutlich verhieß diese Post nichts Gutes – meine Befürchtung, Andy sei verstorben, erhärtete sich. Sonst hätte doch er selbst geschrieben, oder etwa nicht?
War der Absender Sven Sandberg Andys Bruder?, fragte ich mich. Der Bernsteinsammler? Dein Dad hatte den Namen nie erwähnt. Oder ein anderer Verwandter? Sein Vater vielleicht?
Dann kam mir ein anderer Gedanke. Hattest du versucht, Kontakt zu Andy aufzunehmen? Immerhin hatte ich dir bei deinem Besuch mit Kristján im Sommer erzählt, dass dein Dad Deutscher war, der früher an der Küste Bernstein sammelte. Auf die Insel Rügen hättest du kommen können.
Hattest du ihn aufgespürt? Schrieb dieser Sven deshalb? Aber dann hättest du ihm doch erzählt, dass du in Island lebst? Und du hättest mir davon berichtet. Zumindest hätte ich es dir an der Nasenspitze angesehen.
Oder wusstest du, dass ein Brief für dich kommen würde und hattest dich beim Skypen deswegen so merkwürdig verhalten?
Ich wusste nicht, was ich denken sollte.
Angenommen, du hattest nichts damit zu tun – wie hatte er meine Adresse finden können? Ich stand nicht im Telefonbuch.
Wenigstens konnte ich versuchen, etwas über diesen Sven herauszufinden, wo ich doch schon nichts über Andy hatte entdecken können.
Eilig öffnete ich meinen Laptop und suchte im Netz nach Sven Sandberg auf Rügen. Ich fand heraus, dass er Inhaber eines »Hotel Sandberg« in einem Ort namens »Ostseebad Binz« war. Das Hotel war ein Fünf-Sterne-Haus direkt am Strand.
Es gab Bilder von großzügigen, hellen Zimmern, einem Frühstücksraum, einer Bar und einem Strand mit Strandkörben. Zwei Kinder auf den Fotos ließen Drachen steigen. Sofort fühlte ich mich an deine Kindheit zurückerinnert, in der wir auch am Strand Drachen hatten fliegen lassen. Auch dein Daddy hatte das mit dir gemacht.
Leider fand ich kein Foto von Sven Sandberg, es hätte mich interessiert, ob er Andy ähnelte.
Was wollte dieser Mann von dir? Ich ahnte nichts Gutes.