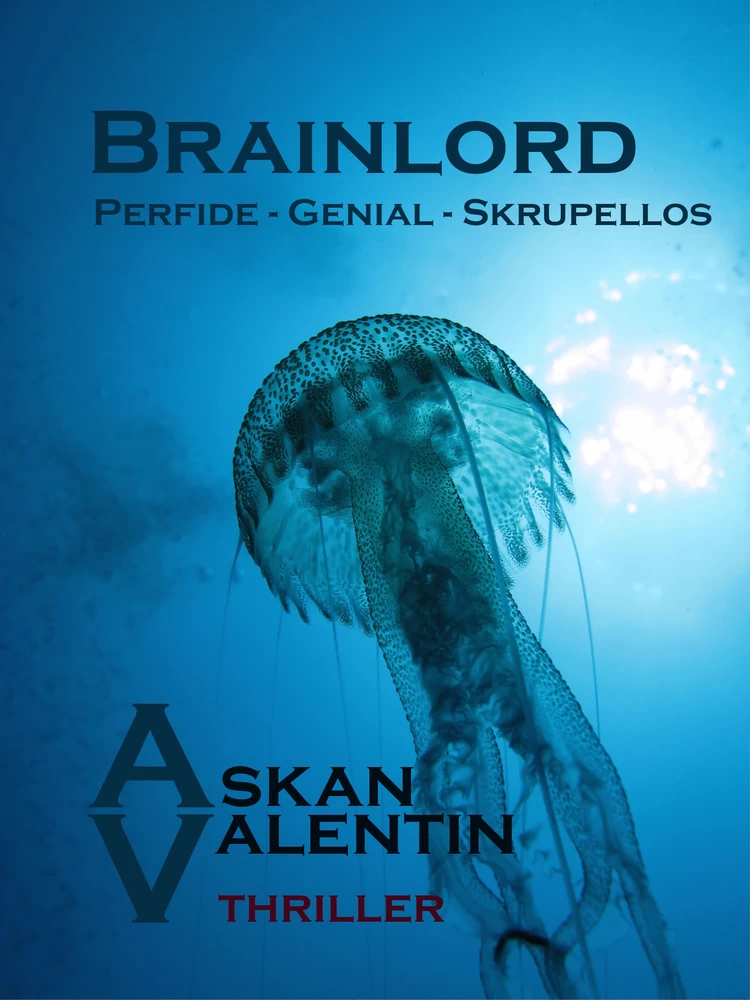Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
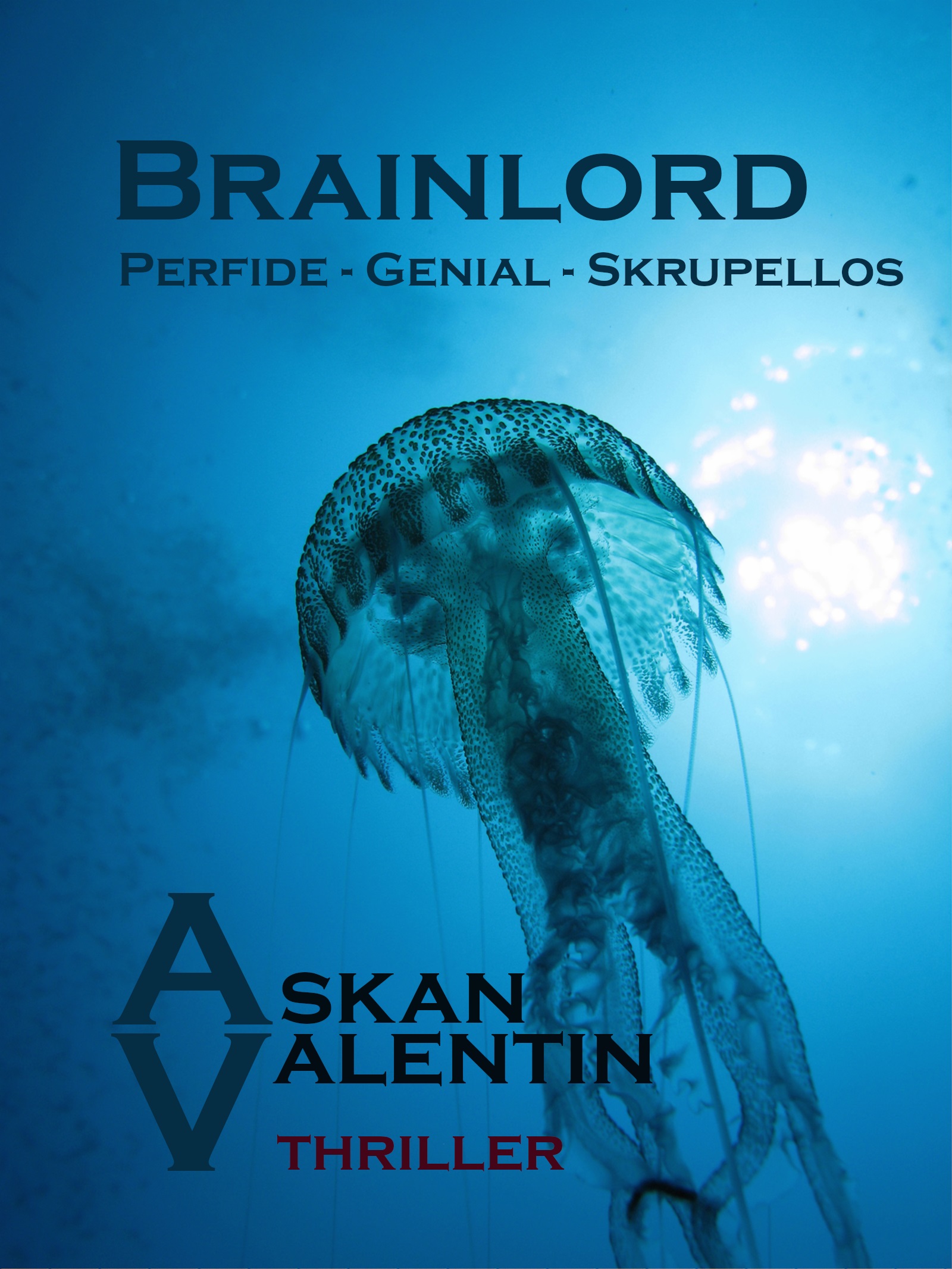
Endbahnhof
Südafrika, Pretoria, ein Monat früher
Die grünen Zahlen des Radioweckers flackerten in den Augen von Husani Cwele, als er mitten in der Nacht aufwachte. Die Ziffern zeigten kurz vor drei Uhr morgens und ein pulsierender Kopfschmerz ließ Husani instinktiv seine Schläfen massieren. Neben ihm schlief seine Frau Azana. Sie schnarchte leise. Seit der Geburt ihres dritten Sohnes hatte sie öfter Probleme mit der Lunge. Husani setzte sich auf und massierte weiter seine Schläfen. Doch der Schmerz wurde unbeeindruckt intensiver. Angesichts der Tatsache, dass Husani Lokführer war und dadurch selten zu Hause, hatte Azana ihre drei Söhne zum großen Teil allein zu versorgen. Dementsprechend leicht war ihr Schlaf und sie bemerkte ihren Mann auf der Bettkante sitzen. Sie war fast schon wieder weggenickt, als Husani aufstand und in den Flur ging. Azana dachte an einen nächtlichen Besuch auf der Toilette, doch ihr Mann blieb im Flur stehen. Sie konnte es zwar nicht sehen, doch sie hörte keine Schritte mehr. Dann meinte sie, das Freizeichen des Telefons zu hören, und tatsächlich wählte ihr Mann eine Nummer. Vorsichtig richtete Azana sich auf und lauschte mit kraus gezogener Stirn. Meldete sich ihr Mann etwa krank? Oder wen rief er um diese Uhrzeit an?
»Husani Cwele 55468732642125489501. Bestätigung. Blue Train von Pretoria nach Kapstadt. Abfahrt heute um 8:00 Uhr. Geplante Ankunft am 8. April um 12:00 Uhr. Gleis zwei.« Er legte den Hörer in die Gabel und seufzte. Nach einigen Sekunden begab er sich auf die Toilette.
Innerlich kopfschüttelnd konnte sich Azana keinen Reim darauf machen. Seit wann musste er seine Routen bestätigen? Und dann noch mitten in der Nacht? Noch bevor sie sich weitere Gedanken machen konnte, tauchte ihr Mann wieder aus dem dunklen Flur auf und legte sich ins Bett.
»Mit wem hast du telefoniert?«, flüsterte Azana. Sie erhielt keine Antwort. Husani war bereits wieder eingeschlafen. Sie schüttelte noch einmal den Kopf und legte sich ebenfalls wieder auf ihr Kopfkissen.
Um 5:30 Uhr dröhnte Husanis Radiowecker mit seinem durchdringenden Quäken durch das kaum möblierte Schlafzimmer. Als Lokführer war er es gewohnt, zu unterschiedlichen Zeiten aufzustehen, und benötigte nicht lange, um sich aus seinem Bett zu schälen. Sofort schwang er sich unter die erfrischende Dusche. Bereits beim Abtrocknen nahm seine Nase den wohligen Duft von frischem Kaffee wahr. Azana ließ es sich nicht nehmen, mit ihrem Mann aufzustehen und zu frühstücken. Fünf Minuten später saßen sie am kleinen Tisch in der Küche. Husani gab seiner Frau einen Kuss auf die Stirn und ließ sich dampfenden Kaffee in seinen Becher gießen.
»Mit wem hast du heute Nacht eigentlich telefoniert?«, versuchte Azana erneut, ihre Neugier zu befriedigen.
»Telefoniert?«, echote ihr Mann und verengte die Augen. »Wann?«
»Sagte ich doch. Heute Nacht. Um kurz vor drei. Du hast deinen Namen gesagt. Und eine Nummer. Ist das deine Personalnummer? Und du hast von deiner heutigen Tour gesprochen. Abfahrt, Ankunft und das Gleis, glaube ich. Seit wann musst du das machen? Und warum mitten in der Nacht? Hatte dein Wecker geklingelt?«
Mit einem sanften Lächeln legte Husani seiner Frau seinen rechten Zeigefinger auf die Lippen. »Stopp. Hol erst mal Luft. Hast du geträumt oder was?«
Kopfschüttelnd antwortete Azana mit einem beleidigten Gesichtsausdruck: »Nein, habe ich nicht. Du bist aufgestanden und dann eine Weile im Flur gestanden. Dann hast du eine Nummer gewählt. Und dann hast du ...«
»Nein, Azana. Ich habe nicht telefoniert. Und ich muss das auch nicht machen. Du wirst geträumt haben.«
»Ich weiß doch, wann ich geträumt habe, Husani. Ich bin davon aufgewacht. Willst du mir wirklich weismachen, dass du nicht telefoniert hast?«
»Ich wüsste niemanden, der es besser wissen müsste«, antwortete er mit einem schelmischen Grinsen. »Hör zu«, er schaute auf die einfache Küchenuhr, die über dem Tisch hing, »es ist schon spät. Ich muss los. Ich melde mich, wenn ich in Kapstadt bin. Wie immer.«
Azana wurde trotz der ablehnenden Haltung ihres Mannes nicht müde, weiter zu protestieren. Zum Abschied gab Husani seiner Frau einen Kuss und flüsterte in ihr rechtes Ohr. »Ich liebe dich. Gib den Kindern einen Kuss.«
»Ich liebe dich auch. Aber wenn du mich anflunkerst und dir neben mir eine Freundin hältst, schneide ich dir was ab. Hörst du?«
Im Umdrehen rief Husani: »Aber ich liebe doch nur dich.«
»Das hoffe ich für dich.« Sie lächelte zögerlich und winkte ihm zum Abschied.
Um 7.30 Uhr schritt Husani auf seine 34-404 Diesellokomotive zu. Aufgrund umfangreicher Reparaturarbeiten an den Streckenabschnitten mit Oberleitung würde er diese Tour vollständig mit der Diesellok fahren. Die Bahnangestellten waren gerade dabei, die schweren Koffer der 74 internationalen Gäste an Board des über 300 Meter langen Luxuszuges zu hieven. Wie immer war der Zug vollständig ausgebucht. Und wie immer ließen sich die sehr betuchten Gäste viel Zeit bei der Anreise und beim Einstieg, sodass sie erst mit gut 30 Minuten Verspätung starten konnten. Aber dabei ging es bei dieser Reise nicht. Niemand hatte einen Anschlusszug zu bekommen oder einen geschäftlichen Termin am Zielort. Der Weg war das Ziel.
Knapp 28 Stunden und einige Pausen zum Augen schließen später fuhr der Blue Train auf sein Ziel zu, den Kopfbahnhof von Kapstadt. Zehn Kilometer vor dem Bahnhofsgelände wurde Husanis Blick trübe. Zwei Minuten und vier Kilometer später ignorierte Husani eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 Stundenkilometer und setzte seine Fahrt unbeirrt mit etwas über 100 Stundenkilometer fort. Immer wenn der sogenannte Totmannschalter summte, sauste seine Hand wie in Trance auf den riesigen Taster herab und ließ das Gerät verstummen. Noch fünf Kilometer.
Ein Mitarbeiter des Zuges schaute aus dem Küchenwagen heraus, als er ein ungewöhnliches Klappern des Geschirrs feststellte. Er erkannte die Häuser von Maitland und konnte sich nicht daran erinnern, dass der Zug schon einmal mit so einer hohen Geschwindigkeit durch das Wohngebiet gefahren war. Eine darauf hingewiesene Kollegin zuckte nur mit den Schultern und räumte das letzte Porzellan in die Schränke.
Im Führerstand der Lokomotive ignorierte Husani das Zugtelefon und das Funkgerät. Die männliche Stimme, die durch das Funkgerät schallte, wurde von Sekunde zu Sekunde nervöser und lauter. Husanis rechte Hand drückte automatisch auf den Totmannschalter und stierte unbeirrt geradeaus. Noch etwas über drei Kilometer. Direkt nach der Durchfahrt der Unterführung des Black-River-Parkway begann der gesamte Zug durch diverse Weichen ruckartig zu rumpeln. Einige Frauen kreischten in den Waggons auf und viele der reisenden Touristen starrten ungläubig auf die vorbeirasende Stadtkulisse. Das Rumpeln und Holpern des Zuges nahm stetig zu. Jetzt wurde es auch dem letzten Angestellten und den meisten Passagieren klar, dass es ein ernsthaftes Problem gab. Der verantwortliche Reiseleiter kämpfte sich durch den schwankenden und lärmenden Zug zum Boardtelefon. Er wählte die Nummer des Lokomotivführers. Es klingelte. Aber niemand ging ran. In der nächsten Sekunde wurde er durch eine harte Rechtskurve und weitere Weichen an die linke Außenwand geworfen und verlor kurzfristig den Halt. Erschrocken angelte er sich wieder den Hörer und schrie hinein: »Stopp!« Aber sofort bemerkte er, trotz der Rumpel- und Quietschgeräusche, dass das Telefon immer noch läutete. Starke Stöße und ein komplett wankender Waggon holten ihn erneut von den Füßen und zum Getöse des ächzenden Zuges gesellten sich die Schreie der Passagiere und Angestellten. In letzter Konsequenz hechtete er auf den Hebel für die Notbremse zu. Doch ein weiterer Schlag des Zuges ließ ihn taumeln und gegen die Ausgangstür knallen. Benebelt sah er, wie Blut aus seiner Nase auf den Boden tropfte.
Husani sah weiter geradeaus. Endlich. Das Ziel war vor seinen Augen. Gleich wäre er erlöst. Die letzte Kurve vor dem Bahnhof hatte den Zug fast aus den Schienen gerissen. Aber wie durch ein Wunder blieben der Triebwagen und alle Waggons in der Spur. Die Dunkelheit des Kopfbahnhofs kam rasend schnell näher und nur wenige Augenblicke später tauchte Husani mit seinem Zug in den Bahnhof ein. Auf dem Bahnsteig des Gleises standen außergewöhnlich viele Menschen. Bahnangestellte versuchten, einige von ihnen hektisch vom Bahnsteig zu entfernen. Doch sie schienen sich zu wehren. Wie auf Kommando begannen plötzlich viele der Wartenden, die kein erschrockenes Gesicht hatten, auf die Lokomotive zuzulaufen. Kurz bevor die Lok an ihnen vorbeirauschen konnte, sprangen sie auf Husani zu. Wie bei einem wilden Trommelwirbel klatschten dutzende Körper gegen die Front der Lok und flogen spritzend auseinander. Husani starrte weiter geradeaus. Seine rechte Hand berührte ein letztes Mal den Totmannschalter. Im gleichen Augenblick erstarb das Getrommel der menschlichen Leiber und die Puffer der Lokomotive bohrten sich in den Prellbock des Gleises. Dieser hatte der enormen Wucht des Zuges nichts entgegenzusetzen. Er wurde zusammen mit der dahinterliegenden Wand aus dem Bahnhofsgebäude geschoben. Nun kam der gesamte Zugkörper aus der Spur. Der Triebwagen und die Waggons begannen sich während ihrer verheerenden letzten Reise querzustellen. Dabei zerstörten sie Mauer- und Stahlpfeiler. Teile der Decke des Bahnhofsgebäudes stürzten polternd herab. Die Menschen, die auf dem Dach des Gebäudes einen Markt besucht hatten oder einen Stand darauf betrieben, hatten keine Chance und verschwanden in den staubenden Löchern, die sich unter ihnen auftaten. Vier Sekunden später kam das letzte Zugabteil, der leere Konferenzwagen, fast unversehrt zum Stehen. Die anderen Waggons waren nicht mehr als Ganzes zu erkennen.
Husani war erlöst.
Am Abend erfuhr Azana zusammen mit ihren drei Kindern vor dem Fernseher von dem Unglück. Die Nachrichtensprecherin war sichtlich schockiert und las von einem knittrigen Zettel die bisherigen Erkenntnisse vor: »Mehrere Überwachungskameras vor und in dem Bahnhof haben das Unglück aufgezeichnet. Der Zug scheint mit voller Geschwindigkeit und ohne Bremsversuch gegen den Prellbock des Gleises geprallt zu sein. Aber noch bevor der Zug durch die Bahnhofsmauer brechen konnte, zeichneten die Kameras auf, dass insgesamt 27 Menschen, die am Bahnsteig warteten, auf den Zug zu rannten und«, sie schluckte mehrfach kräftig, »scheinbar Selbstmord begingen. Bisher hat noch niemand eine Erklärung für das Verhalten. Bei dem Unfall sind im Zug 55 meist ausländische Touristen ums Leben gekommen. 15 wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert und einige werden noch vermisst. Neben dem Zugführer gab es weitere 19 Tote bei den Zugbegleitern. Einige schweben noch in Lebensgefahr. Durch den teilweisen Einsturz des Daches sind weitere zwölf Menschen getötet worden und über hundert verletzt. Die Stadt hat den Notstand ausgerufen und geht nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen von einem terroristischen Anschlag aus.«
Kapitel 1 - Jenny
Deutschland, Raum Hannover
Es war noch dunkel. Alles außerhalb der Bettdecke war dunkel, weit weg und sie fröstelte bei dem Gedanken, auch nur ein Bein herauszustrecken. Wie aus einer entfernten Dimension hörte Jenny die Stimme ihrer Mutter.
»Ich rufe dich jetzt zum letzten Mal«, hörte sie sie wiederholt kreischen. Sie rief das normalerweise mindestens drei Mal, bevor sie die Treppe hochkam und ein Donnerwetter losging. Auf der Treppe rumpelten Schritte. Aber nicht die ihrer Mutter. Es waren die Schritte ihrer trampeligen Schwester. Fast zehn Jahre jünger, aber hundertmal lauter. Alles, was sie tat, war laut. Ihre Stimme, ihre Art zu gehen, und wenn sie ihr Zimmer aufräumte, klang es fast so, als würde sie ausziehen. Inklusive Möbel. Als sie zur Welt kam, war Jenny schon zehn Jahre alt. Das zweite Wunschkind ihrer Eltern entpuppte sich allerdings nicht als Jennys erträumte Schwester. Sie war permanent laut, aggressiv, im Mittelpunkt stehend und sowieso alles besser machend als ihre große Schwester. Es gab keinen Tag, keine Stunde ohne Streit ...
»Jenny«, schallte es die Treppe herauf. »Jetzt platzt mir gleich der Kragen!«
»Ich komme ja«, antwortete Jenny und hielt vorsichtig ein Bein aus dem Bett. Es war tatsächlich kalt außerhalb der kuscheligen Decke.
»Wenn du nicht in einer Minute am Frühstückstisch sitzt, kannst du deinen Ausflug in die Stadt heute vergessen.«
Jenny schlug ihre Augen auf und war mit einem Mal hellwach. Das hatte sie ja völlig vergessen. Sie musste heute früher aufstehen. Sie musste sich chic machen und schminken. Direkt nach der Schule wollte sie mit zwei ihrer Freundinnen und drei Typen aus der zehnten Klasse in die Stadt fahren. In die richtige Stadt. 30 Kilometer mit der Bahn. Mit hunderten Klamottenläden. Riesig und schön. Richtig was los ...
»Hast du mich verstanden?«
»Ja, Mama.« Sie schoss hoch. Die Kälte war vergessen. Die Müdigkeit auch. Gestern hatte sie sich in Gedanken noch zurechtgelegt, was sie anziehen wollte. Heute war sie sich nicht mehr sicher. Was Kurzes musste es sein. Sexy. Simon erschien vor ihrem inneren Auge. Einer der Jungs aus der Zehnten. Sie bekam Herzklopfen, wenn sie an ihn dachte. Und sie musste im Grunde immerzu an ihn denken. Er war anders als die anderen. Cool und hübsch. Wenn er mit seinem Skateboard über den Schulhof glitt, drehten sich nahezu alle weiblichen Köpfe nach ihm um. Klar, bei seiner Erscheinung. Groß, blond und ein Gesicht wie ein Popstar. Und er war nicht so albern ...
»Mama hat gesagt, wenn du nicht ...«, hörte sie ihre Schwester plappern, die plötzlich mit ihrem unter die Achselhöhle geklemmten Kuscheltier vor ihr stand.
»Raus aus meinem Zimmer!«, blökte sie ihre kleine Schwester an und donnerte die Tür zu, dass es im Flur knallte. Sie zog ihren Morgenmantel aus einem am Boden liegenden Kleiderhaufen und betrachtete sich kurz im Spiegelbild einer CD. »Du siehst zum Heulen aus«, sagte sie zu sich selbst, drehte sich um und lief die Treppe hinab zur Toilette. Zwei Minuten später saß sie neben ihrer ununterbrochen meckernden Mutter am Frühstückstisch in der Küche und spürte die Füße ihrer Schwester gegen ihre Knie prallen.
»Hör auf, du blöde Kuh«, schrie sie genervt und rückte etwas von ihr ab.
»Hast du mich verstanden?«, fragte ihre Mutter mit einem ebenfalls genervten Gesichtsausdruck nach.
Jenny dachte kurz nach. Was hatte ihre Mutter gesagt? Sie hatte ihr nicht zugehört. Sie meckerte ununterbrochen. Wie sollte man da die ganze Zeit zuhören? »Was?«
»Wie - was?« Verdutzt taxierte ihre Mutter Jennys Gesicht.
»Was du gesagt hast?«
»Mama hat gesagt ...«
»Ich habe dich nicht gefragt«, schnauzte Jenny ihre kleine Schwester an.
»Ich habe dich gefragt«, versuchte sich ihre Mutter in einem betont ruhigen Ton, »was du anziehen willst.«
»Die kurze weiße Jeans.«
»Die du gestern anhattest?«
Jenny nickte, während sie lustlos von ihrem Toastbrot abbiss.
»Ist in der Wäsche.«
»Was?«, rief Jenny und spuckte dabei ein paar Krümel auf den Tisch. »Die wollte ich heute aber anziehen!«
»Dann hättest du keinen Kirschjoghurt draufkleckern sollen.«
»Scheiße«, rief Jenny aus und schmiss das Toastbrot auf den Teller.
»Scheiße sagt man nicht«, kam es von ihrer Schwester.
Jenny bestrafte ihre Schwester mit einem tödlichen Blick, der von einer mit Nougatcreme beschmierten Zunge beantwortet wurde. Sie stand auf und lief mit wässrigen Augen zum Hauswirtschaftsraum. Im Hintergrund hörte sie ihre Mutter meckern. Sie begann, die beiden Wäschetonnen zu durchwühlen, konnte aber auf Anhieb nichts finden.
»Flecken mit Kirschjoghurt wasche ich sofort und lasse es nicht erst eintrocknen«, hörte sie ihre Mutter sagen, die plötzlich in der Tür stand. »Kannst du nicht die blaue Jeans anziehen?«
»Nein«, antwortete Jenny erbost. »Immer musst du das waschen, was ich anziehen will.«
Ihre Mutter zeigte mit ihrem rechten Zeigefinger drohend in Jennys Gesicht. »Du hast doch selbst die Shorts vor die Tür geworfen. Wenn nicht, wäre sie in deinem - Haufen - verschwunden oder auf dem Toilettenboden gelandet. Also erzähl mir nicht, ich ...«
»Du kapierst es einfach nicht«, antwortete Jenny schnippisch und kurz davor loszuheulen.
»Was kapiere ich nicht?«
»Nichts.«
»Was?«
Die Katzenklappe schepperte und ihr ewig hungriger Kater stand maunzend zwischen ihnen.
»Mach, was du willst. Es ist mir langsam egal. Meinetwegen kannst du die feuchte Hose anziehen, wenn du dich blamieren willst.«
»Du kapierst echt nichts!«, schrie Jenny, warf ein paar Stücke der Schmutzwäsche auf den Boden und stampfte heulend die Treppe hinauf, um kurz danach erneut lautstark die Tür ihres Zimmers ins Schloss fallen zu lassen.
Kapitel 2 - Nur ein Job
Deutschland, Hamburg. Zwei Monate zuvor.
Mit einem Ohrwurm im Kopf tanzte Karl Riewesell pfeifend durch seine kleine Wohnung und packte seinen Reisekoffer. Mittlerweile hatte er sich an diese Tätigkeit so gewöhnt, dass er sie schon fast als liebgewonnenes Ritual durchführte. Kurz nachdem seine Frau sich von ihm hatte scheiden lassen, hatte er sich vollständig auf seine Karriere konzentriert und firmenintern einen neuen Job angeboten bekommen. Zuerst lehnte er dankend ab, überlegte es sich dann aber anders. Grundsätzlich hasste er das Kofferleben, aus dem der neue Job zum Hauptteil bestand. Doch dann dachte er, dass es genau das Richtige wäre. Weg von zu Hause. Weg von der Möglichkeit, seiner Frau, oder schlimmer noch, auch ihrem neuen Freund zu begegnen. Und so wurde er International Manager in einem riesigen Rüstungsunternehmen. Seine Aufgaben umfassten die Akquise und Betreuung von Kundenaufträgen sowie die Vertragsgestaltung bei Großprojekten. Dazu war er in allen möglichen Ländern unterwegs. Nur der ostasiatische Raum war nicht sein Revier. Dorthin schickte man immer seinen Kollegen, der zwei Köpfe größer war als er. Die Asiaten liebten große Europäer, denen sie nur aufgrund ihrer Körpergröße mehr Anerkennung zollten.
Sein nächstes Ziel bedeutete 22 Flugstunden und vier Umsteigeflughäfen, was ihn noch vor einem Jahr schier zur Verzweiflung gebracht hätte. Heute vertrieb er sich die Zeit an der Bar der First Class und flirtete bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Leider ausschließlich ohne Erfolg. Die meisten Frauen konnten mit seinen 1,70 Metern und seinem Haarkranz offensichtlich nicht sympathisieren.
Sein Handy gab einen Ton von sich, den er schon lange nicht mehr gehört hatte. Eine SMS. Er fragte sich, ob das nur eine Werbung war, denn er wüsste nicht, wer auf diese Art mit ihm kommunizierte. Er schaute auf das Display und sah eine ihm unbekannte Nummer. Sollte er sie löschen? Er war sich unsicher und öffnete die SMS.
Hallo Karl. Hab die Nummer von deiner Ex bekommen. Du sollst ja viel unterwegs sein. Wann kann ich dich erreichen? Gruß Ronny
Ronny. Karls Kopf durchzuckte die Schulzeit. Die Zeit in der neunten oder zehnten Klasse. Ronny, mit vollem Namen Ronny Klein. Karl kratzte sich nachdenklich zwischen seinen letzten Haaren am Kopf. War der nicht nur mit Hauptschulabschluss oder sogar ohne in der Neunten abgegangen? Er wusste es nicht mehr genau. War zu lange her. Hatte der nicht ab und zu Dreck am Stecken gehabt? Beim Klassentreffen vor einem halben Jahr hatte er ihn nicht gesehen. Und daran, dass jemand nach ihm gefragt hatte, konnte er sich auch nicht erinnern. Er hatte ihn allerdings auch nicht vermisst. Sollte er ihn anrufen? Oder per SMS antworten? Wenn er erst in den USA war, würde das Gespräch viel teurer. Auf vermeidbare Kosten mit dem Diensttelefon wurde in seinem Unternehmen ein besonderes Augenmerk gelegt. Grundsätzlich verdiente man mit Rüstungsgütern und Kriegswaffen eine Menge Geld, allerdings verschlangen die Geschenke an das Auswärtige Amt, das Wirtschaftsministerium beziehungsweise das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und zu guter Letzt die Bundesregierung einen großen Teil des Gewinns. Innerlich wiegte er ab und antwortete per SMS: Jetzt.
Eine Minute später klingelte sein Handy und sein alter Schulkamerad Ronny begrüßte ihn, als ob sie die dicksten Freunde gewesen wären. Er brauchte nicht lange, um auf den Punkt zu kommen, und bot ihm einen Job an. Einen Nebenjob. Karl sei genau der Richtige, da er überall rumkäme.
»Also«, antwortete Karl ihm nach einem fünfminütigen Monolog auf Seiten Ronnys. »Habe ich das richtig verstanden? Ich soll weltweit - wo ich halt rumkomme, Wasserproben nehmen? Die dann beschriften und an ein Labor schicken?«
»Ganz genau so«, antwortete die Stimme am Telefon.
»Und dafür bekomme ich 3.000 Euro monatlich?«
»Auch richtig.«
»Als Nebengewerbe - oder wie soll das abgerechnet werden?«
»Nee, das bekommst du so.«
»Wie bitte?«
Kurze Pause am Telefon. »Weißt du, das ist ein privates Unterfangen. Von einem Millionär. Der will damit was beweisen und so. Das wäre viel zu umständlich - mit Rechnung und so.«
»Bei ständigen Überweisungen von monatlich 3.000 Euro könnte aber die Bank und somit auch das Finanzamt misstrauisch werden.«
»Ach was, Karl. Das bekommst du als Barkassenfahrt.«
»Barkassenfahrt?«
»Bar - kassen - fahrt.«
»Hä?«
»Bar, Scheine - in einem Umschlag.«
Fast hätte Karl über den Witz gelacht. Aber die Realität holte ihn wieder ein. »Das klingt irgendwie illegal.«
»Was könnte denn an Wasserproben sammeln illegal sein?«
Achselzuckend antwortete er: »Keine Ahnung.«
»Ich auch nicht. Hör mal, Karl. Es geht nur darum, einen Umweltskandal aufzudecken, in den wahrscheinlich die Bundesregierung höchstpersönlich verstrickt ist. Da geht nichts offiziell. Verstehst du?«
»Oh«, antwortete Karl mit hochgezogenen Brauen. »Wenn das so ist ...«
»Heißt das ja?«
»Ja. Okay. Aber ich möchte bei den Recherchen involviert sein und mein Name darf nirgendwo auftauchen.«
Wiederholte Pause in der Leitung. »Okay.«
Kapitel 3 - Brutstätte
Deutschland, Kiel, drei Jahre zuvor
Es regnete Bindfäden. Bereits seit dem frühen Morgen. Ronny schaute auf den nassen, grauen Hof der JVA Kiel. Fünf Monate saß er schon in seiner Zelle. Neun Monate hatte er wegen Kreditkarten- und Steuerbetrugs bekommen. Es ärgerte ihn bis heute maßlos, dass sie ihn erwischt hatten. Sein Plan war eigentlich todsicher gewesen. Nur leider hatte er ein Detail übersehen, weil er keine Ahnung von der Komplexität hatte. So einen Fehler würde er in Zukunft nicht mehr machen. Die Zukunft musste nun aber noch warten. Allerdings rechnete er damit, innerhalb der nächsten Wochen, wegen guter Führung, rauszukommen. Neben ihm schnarchte Steve, auch Keule genannt. Er hatte zwei schlagende Argumente, war aber im Grunde eine gute Seele. Wenn er seine Emotionen im Griff gehabt hätte, wäre der Sozialarbeiter, mit dem er sich angelegt hatte, ohne lebensgefährliche Verletzungen davongekommen. Er hatte ebenfalls neun Monate bekommen. Plus Besuch einer Gewaltpräventionsgruppe. »Psychoquatsch« sagte Steve dazu, ließ sich aber an den Terminen nichts anmerken. Denn auch er hatte begriffen: Gute Führung bedeutete frühes Gehen.
Es war Sonntag. Einer dieser elend langen grauen Sonntage. Normalerweise waren Sonntage die Hauptbesuchstage. Aber Ronny bekam keinen Besuch. Die wenigen Kumpels, die er hatte, saßen entweder selbst ein oder fristeten ihr arbeitsloses Dasein irgendwo in der Welt. Steve hatte dagegen vor einigen Monaten einmal Besuch gehabt. Von seiner Frau in Begleitung ihres Anwalts. Sie hatte die Scheidung eingereicht. Steve hatte sie regelmäßig weichgekloppt. Das war wohl auch ein Grund.
Es klackte. Die Türen wurden geöffnet. Zeit für das Frühstück. Ronny stupste Steve an, der luftschnappend zu sich kam.
»Frühstück, du Penner.«
Schweigend trotteten sie nebeneinander die Stahltreppe hinab. Kaum hatten sie sich mit ihrem Frühstück einen freien Platz am regennassen Fenster gesichert, setzte sich der stellvertretende Direktor der JVA neben sie.
»Guten Morgen, die Herren.«
Ronny und Steve schauten kurz auf, antworteten aber nicht.
»Ich hoffe, ich störe nicht allzu sehr«, unternahm der Stellvertreter einen zweiten Versuch.
Steve brachte kauend ein kaum hörbares »Doch.« über die Lippen.
»Ich kann natürlich warten, bis die Herren mit der Nahrungsaufnahme fertig sind.«
Ronny stieß mit seinem Fuß gegen Steves Schienbein. »Nichts für ungut, Herr Direktor. Steve hat schlecht geschlafen. Was gibt´s denn?«
»Es geht um einen Insassen aus dem Block B. Ein Professor. Es sitzt wegen unerlaubter Tierversuche.«
»Dafür kommt man in den Knast?«
»Wenn ihr wüsstet, was der Kerl mit den Viechern angestellt hat, dann würdet ihr das Strafmaß verstehen.«
»Und was ist mit dem?«
»Er ist erst seit Kurzem hier. Hat auch nur zwei Monate zum Absitzen. Das Problem ist, dass er mit seinen Mitbewohnern nicht zurechtkommt.«
»Aha«, antwortete Ronny und legte sein Besteck auf den Teller.
»Wie ihr sicherlich wisst, benötigt man eine gewisse Körperpräsenz oder die Mitgliedschaft in einer geeigneten Schutzorganisation, um die Tage und Nächte in dieser Anstalt unbeschadet zu überstehen.«
»Höre ich zum ersten Mal«, antwortete Steve kichernd, der ebenfalls mit seinem Frühstück fertig war.
»Natürlich«, erwiderte der stellvertretende Direktor. »Wie dem auch sei. Ich beabsichtige, den Herrn Professor in eure freie Koje zu verlegen. Ich denke, es ist für euch beide ein guter Test, ob ihr es verdient, frühzeitig entlassen zu werden, oder?«
Ronny und Steve nickten zustimmend.
»Gut.« Er schaute auf die leergegessenen Teller. »Offensichtlich sind die Herren fertig. Dann möchte ich euch den Herrn Professor gerne vorstellen. Wenn die Herren mir folgen möchten.«
Nach einer fünfminütigen Unterredung und gegenseitigen Vorstellung fanden sich Ronny und Steve, gefolgt vom Professor, in ihrer Zelle ein. Das Gesicht des Professors zierte ein Veilchen unter dem linken Auge, eine lädierte Lippe und eine verbundene Platzwunde am rechten Ohr. Professor Pichler war Genetiker und forschte aus einem privaten Budget, welches er geerbt hatte. Er hatte das sechszigste Lebensjahr direkt vor sich, war kaum größer als ein zehnjähriger Junge, ebenso schmächtig und vollständig ohne Kopfbehaarung. Von einer dominanten Körperpräsenz war wahrlich nicht zu sprechen.
»So, Professor Pichler«, kam es von Ronny bestimmend. »Wir sprechen uns normalerweise hier mit Vornamen an. Wie sieht es aus? Haben Sie einen abbekommen?«
Der Professor schaute verdutzt und unterdrückte bewusst ein Lächeln, welches seine geschwollene Lippe erneut aufreißen könnte. »Natürlich habe ich einen Vornamen. Kopernikus-Julius.«
»Kop ..., wie?«, nuschelte Steve.
»Was für’n Scheißname«, antwortete Ronny. »Dann sagen wir besser Pichler.«
»Meinetwegen«, entgegnete der Professor. »Ich bestehe nicht auf meinem Titel, er wird mir eh aberkannt werden.«
»Was hast du denn gemacht? Wir haben da etwas von Tierversuchen gehört?«
»Unter anderem. Ja. Ich habe mich in das Gehirn der Tiere geklinkt. Über einen Boten. Den ich in die Tiere gepflanzt habe. Über diesen Boten kann ich Befehle geben, die das Gehirn unter normalen Umständen nicht ausführen würde.«
»Ich verstehe kein Wort ...«, flüsterte Steve.
»Aha«, antwortete Ronny. »Und was für ein Zweck hatte die Aktion?«
»Ganz einfach. Ich habe schweres Rheuma und damit verbunden sehr starke Schmerzschübe. Die bekannten pharmazeutischen Mittel helfen mir nicht, lähmen mein Gehirn oder ich habe allergische Reaktionen darauf, die schlimmer sind als die Schmerzen. Mit dem Boten habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, die Rheumaschübe, beziehungsweise die Schmerzen, zu unterbinden.«
»Mh«, brummte Ronny. »Und dafür muss man in den Knast?«
»Ich wurde mehrfach verwarnt. Und ich bin Privatmann. Außerdem standen die linken Chaoten permanent vor meiner Tür und demonstrierten. Das waren wohl genügend Argumente.«
»Und warum haben dich die Kollegen aus Block B so malträtiert?«, er deutete auf das lädierte Gesicht des Professors.
»Ich habe den Jungs dort die gleiche Geschichte erzählt und dass ich bei einer Weiterentwicklung des Boten ihre Krankheiten ausmerzen könnte.«
»Krankheiten?«
»Kleptomanie, emotionale Gewaltausbrüche und so weiter.«
»Du meinst Klauen und Hauen sind Krankheiten, oder was?«, Ronny erzürnte sich.
»Ja. Das sehe ich so.«
Ronny lächelte schief. »Hätte ich mich nicht im Griff, würde ich dir wahrscheinlich jetzt auch ein paar aufs Maul hauen.«
Kapitel 4 - Zarte Blüten
Deutschland, Hannover, 17. März
Seufzend stand Jenny in der letzten Pause auf dem Schulhof und hielt mit ihren Freundinnen Ausschau nach den Jungs. Keiner von ihnen hatte sich blicken lassen. Den ganzen Tag schon nicht.
»Wo sind die bloß?«, fragte sich Jenny, während sie sich mit den Fingern durch ihre langen Haare fuhr.
»Vielleicht schwänzen sie«, antwortete eine ihrer Freundinnen.
»Oder verstecken sich vor uns, weil wir so hässlich sind«, kam es von Sissi.
Alle Mutmaßungen nutzten nichts, die Pausenglocke klingelte zur letzten Stunde. Nach dem todlangweiligen Deutschunterricht trennten sich die drei Mädchen und fuhren oder gingen nach Hause. Jenny benutzte seit Kurzem kein Fahrrad mehr, nachdem irgend so ein Witzbold es demoliert und mit einem fremden Schloss an ein anderes Fahrrad gekettet hatte. Und da ihr Vater seit einem Jahr einen Kunden in der Schweiz betreute, hatte er während der wenigen Zeit am Wochenende keine Lust, sich um solche Themen zu kümmern. Jenny hatte ihren Vater in den Zeiten seiner häufigen Abwesenheit als schlechtesten Vater der Welt beschimpft. Der konterte nur mit: »Früher haben wir bereits mit zehn Jahren unsere Fahrräder ...«, weiter hatte sie ihm nie zugehört und die Tür zu ihrem Zimmer zugeknallt.
Jenny öffnete die Wohnungstür. Ein gelber Zettel an der Türzarge fiel ihr ins Auge. »Ich habe noch einen Kundenauftrag. Deine Schwester ist bei Oma. Ich schätze, ich bin gegen 18:00 Uhr zu Hause.«
Stöhnend schaute Jenny in den Kühlschrank, um ihr Essen herauszuholen. Es gab mal wieder etwas Nichtessbares. Sie schüttete das Essen eins zu eins in den Mülleimer und drapierte anderen Abfall darüber. Im Anschluss plünderte sie den Schrank mit den Süßigkeiten und verzog sich in ihr Zimmer.
Während sie eine angebrochene Tüte Chips und eine ganze Tafel Schokolade verspeiste, checkte sie ihre Social-Media-Apps auf neue Nachrichten. Das Blut schoss ihr in den Kopf und zugleich begann ihr Herz, wie wild zu klopfen. Simon hatte ihr eine Anfrage geschickt. Heute Vormittag bereits. Sofort klickte sie auf Annehmen. Sie spürte Schweiß in ihren Handflächen, während sie auf seine Profilseite navigierte und die eingestellten Bilder begutachtete.
»Gott, siehst du süß aus«, flüsterte sie und browste sich durch den gesamten Inhalt, bis sie plötzlich eine neue Nachricht von ihm erhielt.
»Hey, was machst du gerade?«, stand da in einer mit Smileys geschmückten Zeile.
Jenny zuckte zusammen. Was sollte sie antworten? Dass sie gerade seine Bilder anschmachtete? Mit zittrigen Fingern tippte sie unsicher eine Antwort.
»Hey Simon. Ich langweile mich. Wir haben euch heute nicht auf dem Schulhof gesehen. Habt ihr eine Projektwoche?«
Nur wenige Sekunden später kam bereits die Antwort. »Nee, wir hatten nur keine Lust. Habt ihr uns auf dem Schulhof vermisst?«
Jenny vergrub ihr Gesicht hinter ihren Händen. Das wurde ja immer heikler. Was sollte sie bloß schreiben?
»Irgendwie schon. Wir haben uns sehr wohl an euerer Seite gefühlt«, tippte Jenny nach ein paar Bedenksekunden und sendete die Antwort. Erwartungsvoll starrte Jenny auf den Bildschirm. Was würde er jetzt wohl fragen? Ob sie ihn persönlich auch vermisst hätte? Was würde sie dann antworten? Einfach ein Ja? Und wenn er dann antwortete: >Ich dich aber nicht<, könnte sie nie mehr in diese Schule gehen. Sie müsste in eine andere Stadt ziehen und eine neue Schule besuchen.
Das Telefon klingelte. Es klingelte sieben Mal. Dann ging der Anrufbeantworter dran. Es war ihre Freundin Sissi. Sie quatschte irgendetwas von einem dringenden Rückruf. Jenny verstand fast nichts und riss sich von ihrem Laptop los. Sie rannte die Treppe hinunter und griff nach dem Telefon.
»Hey Sissi, ich habe keine Zeit. Ich schreibe gerade mit ...«, sie stockte. Sollte sie ihr das erzählen? Oder war Sissi dann vielleicht eifersüchtig ...?
»Mit wem?«, fragte Sissi ungeduldig.
»Du erzählst es aber nicht weiter, versprochen?«
»Ehrenwort.«
»Mit Simon.«
»Echt?«, kam es mit enttäuschtem Unterton aus der Hörmuschel. »Hat er dir eine Anfrage geschickt?«
»Ja, stell dir vor. Und jetzt schreiben wir gerade. Deshalb hab ich keine Zeit. Ich ruf dich heute Abend an. Okay?«
Ohne zu antworten, legte ihre Freundin auf. Ups, dachte sich Jenny und lief zurück in ihr Zimmer. Fassungslos starrte sie auf den Bildschirm. Immer noch keine Antwort von Simon. Hatte sie irgendetwas Dummes geschrieben? Sie schaute noch mal über die alten Fragen und Antworten. Unsicherheit kroch in ihr hoch und sie spürte, wie ihr Hals immer trockener wurde. »Durst«, sagte sie zu sich selbst, schaute noch einmal auf den Bildschirm und lief dann in die Küche, um sich aus Orangensaftkonzentrat, Leitungswasser und Eiswürfeln einen Drink zu mixen. Mit dem Glas in der Hand flog sie förmlich die Treppe zu ihrem Zimmer hinauf. Sie setzte sich vor ihren Laptop und nippte an ihrem Orangensaft. Erneut zuckte sie zusammen, als eine Antwort von Simon auftauchte, und verschüttete dabei Orangensaft auf ihrer Tastatur. »Scheiße, Scheiße, Scheiße«, rief sie aus und versuchte krampfhaft, mit einem gebrauchten Taschentuch das Unglück zu beseitigen. Völlig unerwartet kam bereits wieder eine Antwort von Simon.
»Geht es dir gut?«
Jenny stutzte. Wie kam er denn jetzt auf die Frage? Sie erschrak, als sie ihre letzte Antwort las: »ihoiföjfjöadskvkdlvls«. Schnell tippte sie eine neue Antwort.
»Ich habe Saft auf meine Tastatur geschüttet. Beim Wegmachen habe ich wohl den Quatsch eingegeben.«
Keine zehn Sekunden später kam bereits die Antwort von Simon: »Wollen wir besser telefonieren?«
Das Blut schoss erneut in Jennys Kopf. »Nun wird es ernst«, sagte sie zu sich selbst und tippte zitternd eine bejahende Antwort ein.
Kapitel 5 - Der Plan
Deutschland, Kiel, 3 Jahre zuvor
Fast zwei Monate verbrachte Professor Pichler nun schon in der Zelle mit Ronny und Steve. Sie hatten sich, so gut es ging, arrangiert, obwohl ihre Ansichten unterschiedlicher nicht sein konnten. Professor Pichler redete gern über sein Projekt und stellte das eigentliche Ziel des gezielten Abschaltens von Schmerz über ethische Bedenken. Ronny und Steve suchten dagegen nach Möglichkeiten des Geldverdienens, wenn sie denn wieder in Freiheit wären. Geld hatte dieser verrückte Professor nach eigenen Aussagen genug und Ronny überlegte angestrengt, wie er an das Geld herankommen könnte.
Gleich am nächsten Morgen kam Ronny eine Idee, wie man eventuell mit dem verrückten Professor ein gemeinsames Geschäft aufbauen konnte. Nach dem Frühstück zog er Pichler zur Seite, während Steve ein Comic las.
»Sag mal, Professor. Wenn du dein neues Medikament fertig entwickelt hast, wie bekommst du diesen komischen Boten denn ins Gehirn?«
»Durch eine Spritze in den Kopf.«
»Eine Spritze?«, echote Ronny. »In den Kopf?«
Nickend bejahte Professor Pichler. »Richtig. Es gibt eine Stelle an der Fontanelle, dort kann man ohne ein Loch in die Schädeldecke zu bohren eine Kanüle einführen. Alternativ ginge es natürlich auch durch das Ohr oder das Auge. Die Nase wäre auch noch eine Möglichkeit.«
»Aua. Keine andere Möglichkeit?«
»Warum?«, fragte der Professor verwirrt. »Wenn jemand wegen starker Schmerzen in Behandlung geht, wird das das kleinste Problem sein ...«
Durch das Klackern des Zellenschlosses unterbrochen, schauten die drei auf. Die Tür öffnete sich und zwei Wärter erschienen.
»Guten Morgen«, sagte einer der beiden. »Draußen scheint die Sonne. Wenn auch von ein paar Wolken unterbrochen.« Er begann zu grinsen. »Der Direktor hat eure vorzeitige Entlassung für heute vorgesehen.«
Ronny schaute ungläubig. »Wir alle drei?«
»Korrekt. Die Verwaltung sammelt immer ein bisschen. So sparen sie sich ein wenig Papierkram. Wenn ihr es wünscht, würde einer der Kollegen euch übrigens zum Amt fahren. Für die Arbeitssuche und so.«
»Ich nicht«, antwortete der Professor. »Ich bestelle mir ein Taxi.«
»War nur ein Vorschlag«, erwiderte der Vollzugsbeamte.
»Ja, danke. Aber ich will gleich nach Hause.«
Kaum waren die Wärter verschwunden, begannen die drei ihre Siebensachen einzupacken oder sich von unnötigem Kram zu trennen.
Ronny lehnte sich zum Professor. »Kann ich mir das mal angucken?«
»Was?«
»Das mit den Versuchen. Interessiert mich.«
»Natürlich«, kam es knapp vom Professor. »Warum nicht? Ich freue mich, wenn es jemanden interessiert. Normalerweise treffe ich nur Gegner und Bedenkenträger.«
Kapitel 6 - Jungs
Deutschland, Raum Hannover, 20. März
Seitdem Jenny ihre Handynummer Simon gegeben hatte, war komplette Funkstille eingetreten. Keine Aktionen in den diversen sozialen Netzwerken, keine Messenger-Nachrichten - einfach nichts. Und angerufen hatte er auch nicht. Sie selbst hatte ein paarmal überlegt, ob sie die Initiative ergreifen sollte, konnte sich aber bisher nicht dafür erwärmen. Heute hatte sie außerdem Kopfschmerzen. Eigentlich hatte sie die nur, wenn sie ihre Tage bekam. Aber die hatte sie erst vor einer Woche. Das konnte es also nicht sein.
»Jenny«, rief ihre Mutter von unten. »Komm bitte zum Essen und bring deine Schwester mit. Jetzt und sofort. Und ohne dass ich zehnmal rufen muss.«
Jenny verdrehte die Augen und klappte ihren Laptop zu. Widerwillig erhob sie sich, stockte und bekam glasige Augen. Ohne hinzuschauen, ergriff sie ihr Smartphone und wählte eine Nummer. Am anderen Ende die Stimme eines Anrufbeantworters. Nach dem Piep sprach Jenny in einem mechanischen Ton: »Code 52643856947816774438, Jenny Böge, weiblich, 160 cm, 15 Jahre, Deutschland, Hannover, Schülerin, meine Hobbys sind Shoppen und Musik hören. Ich kenne mich gut mit den aktuellen Kinofilmen und den Musikcharts aus.« Während sie auflegte, kehrte ihr klarer Blick unvermittelt zurück. Sie ging nach unten in die Küche, setzte sich auf ihren Platz und wartete.
»Toll, wie du mich begrüßt«, hörte sie die Stimme ihres Vaters. Sie schaute auf, sah ihrem Vater kurz in die Augen und blickte im Anschluss zu Boden, während sie ihren Mund verzog.
»Da ist dein Vater schon mal so früh zu Hause und du kannst noch nicht mal richtig hallo sagen«, kam es von ihrer Mutter, die irgendetwas in die Teller füllte.
»Hallo«, entgegnete Jenny, ohne aufzuschauen.
»Wie herzlich«, antwortete ihr Vater. »Ich hab dich auch lieb.«
»Wo bleibt deine Schwester? Hast du ihr nicht Bescheid gesagt?«
Jenny zuckte mit den Schultern.
»Ich mach das schon«, flüsterte ihr Vater. »Bemüh dich nicht.«
»Was gibt es denn?«, fragte Jenny und deutete auf eine Auflaufform.
»Gemüseauflauf. Der mit Brokkoli, Blumenkohl, Putenbrust und ...«
»Ich mag keinen Brokkoli. Und auch keinen Blumenkohl.«
»Seit wann das denn nicht?«, antwortete ihre Mutter empört.
»Mochte ich noch nie.«
»So ein Quatsch«, entgegnete ihre Mutter und stellte ihr einen Teller vor die Nase. »Hast du bis jetzt immer gegessen.«
»Hab ich nicht!«
Ihre Mutter drehte sich zu ihr und stützte sich auf dem Küchentisch ab. »Jenny. Was ist los? So geht das nicht weiter. Wenn du nur noch Süßigkeiten isst, wirst du dick.«
»Na und? Ist doch egal. Bin eh hässlich.«
»Geht das schon wieder los. Du weißt ganz genau, dass du ein sehr hübsches Mädchen bist.«
»Und ich?«, kam die lautstarke Frage von Jennys Schwester, die gerade auf den Schultern ihres Vaters in die Küche kam. »Ich bin schöner als Jenny. Oder Mama?«
»Ihr seid beide gleich schön.« Sie stellte den letzten Teller auf den Küchentisch und setzte sich. »Und jetzt möchte ich in Ruhe und ohne Streit essen. Guten Appetit.«
»Guten Appetit«, antworteten Jennys Schwester und ihr Vater im Chor.
»Ich esse den Scheiß nicht«, sagte Jenny und stand auf. »Außerdem habe ich Kopfschmerzen.« Sie drehte sich auf den Hacken um und ging trotz Protest ihrer Eltern in ihr Zimmer. Dort angekommen schoss ihr das Blut in den Kopf, was ihre Kopfschmerzen noch verstärkte. Das Display ihres Handys zeigte an, dass Simon versucht hatte sie anzurufen. Mit den Händen an den Schläfen ließ sich Jenny auf ihr Bett fallen und verfluchte ihre Kopfschmerzen. Und dann knurrte auch noch ihr Magen. Sie öffnete ihre Nachttischschublade und zog einen gebunkerten Schokoriegel heraus. Gleich nachdem sie den Riegel verschlungen hatte, hörten die Kopfschmerzen urplötzlich auf. Fast so, als ob jemand einen Schalter umgelegt hatte. Jetzt ging es ihr besser. Nur etwas zu trinken könnte sie noch gebrauchen, aber im Augenblick ersparte sie sich einen Gang in die Küche. Sie starrte auf das Display ihres Handys. Er musste gerade angerufen haben, als sie runtergegangen war. So ein Pech. Gerade als sie das Telefon wieder auf ihr Bett legen wollte, spürte sie, wie das Gerät vibrierte. Aber nicht so, wie bei einer Nachricht. Nein, länger. Und es hörte nicht auf. Auf dem Display erschien ein aktiver Anruf - von Simon. Jenny war kaum in der Lage, mit ihren zittrigen Fingern die Wischbewegung für die Anrufannahme durchzuführen, schaffte es aber schließlich doch noch.
»Hallo?«
»Hey Jenny. Hier ist Simon.«
»Hey.«
»Störe ich gerade - beim Abendbrot oder so?«
»Nein.«
»Okay. Gestern habe ich es nicht mehr geschafft. Kam noch ein Kumpel vorbei. Er hat ein neues Board. Das mussten wir ausprobieren. Das verstehst du doch, oder?«
»Klar.«
»Wie geht es dir? Was machst du gerade?«
»Gut. Und ich telefoniere gerade.« Sie kicherte verhalten.
»Hast du jetzt Zeit?«
»Wofür?«
»Ich wollte noch mal kurz zur neuen Skateranlage. Hast du Bock mitzukommen?«
»Neue Skateranlage? Wo ist die denn?«
»An der alten Schule. Ich kann dich ja abholen.«
Jenny schaute flüchtig auf ihre Uhr. »Mh. Ich müsste vorher noch was klären. Kann ich dich gleich zurückrufen?«
»Klar doch.«
»Gut. Bis gleich.« Jenny legte auf und rannte in die Küche. Ihr Vater saß mit ihrer Schwester auf dem Schoß am Küchentisch und ihre Mutter räumte gerade den Tisch ab.
»Kann ich noch mal weg?«, platzte sie heraus.
Sechs Augen fixierten sie, wobei ihre Schwester in der nächsten Sekunde versuchte, die Aufmerksamkeit ihres Vaters wieder vollkommen für sich zu beanspruchen.
»Wo willst du denn hin?«, fragte ihre Mutter genervt. »Ohne zu Abend gegessen zu haben.«
»Ich habe einfach keinen Appetit. Verstehst du das nicht?«
»Man muss was essen ...«
»Kann ich?«
»Was?«
»Weg. Wir wollen uns an der Skateranlage treffen.«
»Wer? Du mit deinen Freundinnen?«
Jenny nickte.
»Und was ist da - an der Skateranlage?«, fragte Jennys Mutter mit einem schelmischen Gesichtsausdruck.
»Da treffen sich alle.«
Ihre Mutter verdrehte leicht die Augen. »Ich finde das nicht gut. Es wird noch immer so früh dunkel.«
»Ich werde abgeholt. Und er ...« Jenny stockte.
»Er?«
Grinsend antwortete Jenny: »Ja, er. Er heißt Simon und holt mich ab. Und er wird mich sicherlich auch wieder zur Haustür bringen.
»Was sagst du?«, fragte ihre Mutter ihren selten anwesenden Ehemann.
»Nimm bitte dein Handy mit und lass es angeschaltet.«
»Danke«, sagte Jenny freudig und drückte ihrem Vater einen Kuss auf die Wange, was ihre Schwester noch zu verhindern versuchte.
Kapitel 7 - Zeichen
Frankreich, Montpellier, 20. März
Die Sonne strahlte zwar in ihrer vollen Pracht, hatte aber noch nicht die Kraft, einen wirklich zu erwärmen. Über 2.500 Soldaten der Streitkräfte der Französischen Republik hatten sich zu einer Wehrübung zusammengefunden, die heute am frühen, noch frischen Morgen beginnen sollte. Vorgesehen waren diverse Manöver, die im direkten Zusammenhang mit der Terrorismusbekämpfung standen. Sprengstoffe und Bomben sichern oder sprengen. Schutzkonvois bilden. Gebäude stürmen und vom Feind neutralisieren. Und vieles mehr. Einer der Soldaten, der aus dem Norden des Landes stammte und seine viermonatige Grundausbildung gerade abgeschlossen hatte, stand wie die anderen Kameraden in Reih und Glied zum Morgenappell. Er stach mit seinen 1,92 und breiten, durchtrainierten Schultern aus der Truppe heraus. Was man nicht sehen konnte: Er hatte furchtbare Kopfschmerzen.
Der Unteroffizier brüllte ein paar Einsatzbefehle und im Anschluss stob die Truppe auseinander. Der junge Soldat war bei den Pionieren gelandet und hatte den Befehl, eine zerstörte Brücke wieder überquerbar zu machen. Die Gruppe von 24 Soldaten setzte sich mit ihren Mannschaftswagen und einem Bergepanzer in Bewegung. Am Ziel angekommen, entlud die Mannschaft ihre Werkzeuge und machte sich daran, eine alte Steinbrücke so herzurichten, dass wieder schwere Fahrzeuge darüberfahren konnten. Der Nordfranzose lief seinem Gruppenführer nach. Sein Blick wanderte auf den Nacken seines vor ihm laufenden Kameraden. Am Haaransatz erkannte er eine Tätowierung. Eine Reihe von chinesischen Schriftzeichen, die wahrscheinlich die ganze Wirbelsäule entlang verlief. Die Kopfschmerzen wurden wieder stärker. Der Gruppenführer lief, gefolgt von dem jungen Soldaten, unter die Brücke und begann mit der Inspektion. Die Kraft der Sonne war jetzt schon deutlicher zu spüren, was den Gruppenführer dazu veranlasste, sich seiner Jacke zu entledigen. Mit zusammengekniffenen Augen stierte der Soldat auf die drei obersten nun sichtbaren chinesischen Schriftzeichen. Der Schmerz war allgegenwärtig. Sein Kopf schrie flehend nach Linderung. Sie standen zu zweit direkt unter der Brücke, während der Gruppenführer an ein paar losen Steinen rüttelte.
»Das werden wir stützen müssen«, meinte der Gruppenführer. »Schreib mal auf ...«
Der junge Soldat zückte blitzschnell sein Kampfmesser und rammte es dem Gruppenführer in den Nacken. Der sackte sofort auf die Knie und fiel mit dem Kopf in den Bach, den die Brücke überspannte. Der Soldat zog den Gruppenführer sofort zurück ans Ufer.
»Oh Gott, was ist - passiert«, stotterte der Gruppenführer unter Schmerzen.
»Ich muss dich befreien«, antwortete der Soldat, kniete sich auf den Rücken des Gruppenführers und begann, die chinesischen Schriftzeichen aus der Haut zu schneiden. Der Gruppenführer schrie wie am Spieß und versuchte, sich der Attacke zu erwehren. Doch das Gewicht des Soldaten ließ eine Abwehr nicht zu. Die anderen Pioniere oberhalb der Brücke wurden auf das Geschrei aufmerksam und schauten unter der Brücke nach.
»Was machst du da? Bist du wahnsinnig?«, rief einer der Pioniere und lief zusammen mit seinen Kameraden zum Geschehen.
Beherzt griffen sie zu und zogen den Soldaten von dem Gruppenführer herunter. Zwei hielten seinen rechten Arm fest und entwendeten ihm sein Messer. Der junge Soldat wehrte sich nach Leibeskräften, hatte aber gegen die Übermacht keine Chance. Binnen einer Minute war er außer Gefecht gesetzt und mit Kabelbindern an Armen und Beinen fixiert. Ein Sanitäter kümmerte sich um den Gruppenleiter. Er war zwar ziemlich schlimm zugerichtet und hatte ordentlich Blut verloren, schwebte aber nicht in Lebensgefahr.
»Bist du bescheuert oder was ist mit dir?«, brüllte einer der Kameraden den jungen Soldaten an.
Der Nordfranzose zerrte wie besessen an seinen Fesseln und schrie: »Ich muss ihn befreien. Sie werden ihn töten.«
»Wer wird ihn töten - du?«
Mit all seiner Kraft versuchte der Soldat, seine Hände aus den Kabelbindern zu bekommen. Die umstehenden Kameraden konnten beobachten, wie sich die dünnen Kabelbinder durch die Haut in das Fleisch schnitten, bis das Blut herausquoll.
»Bist du wahnsinnig?«, brüllte ein anderer der Kameraden. »Sani, dem musst du eine Spritze geben! Der ist irre!«
Am darauffolgenden Tag hatten die militärischen Sicherheitskräfte zusammen mit der Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bereits erste erschreckende Ergebnisse. Der junge Soldat aus der Nähe von Paris hatte vor zwei Jahren seinen jüngeren Bruder verloren. Er hatte sich auf dem Schulhof mit einem Chinesen gestritten, der zwei Köpfe kleiner war als er. Als der Streit eskalierte, trat der chinesische Junge dem Bruder ins Gesicht. Der kraftvolle Tritt zertrümmerte das Nasenbein und schob den Schaft bis ins Gehirn. Der Junge starb noch am selben Tag an einer Hirnblutung. Bei den späteren Gerichtsverhandlungen gerieten die Familie des chinesischen Jungen und die Familie des Opfers permanent aneinander. Die Chinesen beharrten auf einem Freispruch wegen Notwehr, während die Anklage eine Verurteilung wegen Totschlages beantragt hatte.
Kapitel 8 - Nächste Versuchsreihe
USA, Florida, Miami, 24. März
Mit seinen 32 Jahren war der Bankmanager schon weit auf der Karriereleiter gekommen. Er schätzte, dass ihm spätestens in fünf Jahren eine Position in der Geschäftsführung angeboten würde. Heute war er allerdings ziemlich müde und er hoffte, dass man ihm das nicht ansah. Die Nacht war einfach zu kurz gewesen, denn er hatte seine Finger einfach nicht von seinem neuen PC-Spiel lassen können. In dem Game verkörperte er das, was er im realen Leben nicht sein konnte. Ein Gangster, der seine aggressiven Eigenschaften offen austrug und seine rabiaten Ziele kompromisslos verfolgte. Obwohl, so dachte er sich, das vom Bankmanager gar nicht so weit entfernt war. Nur dass es im Leben eines Bankmanagers keine Autorennen und Schießereien gab.
Er betrachtete sich noch kurz in der großen Panoramascheibe an der Front seiner 300-Quadratmeter-Villa, rückte seinen 4.000-Dollar-Anzug zurecht und öffnete das elektrische Garagentor. Zum Vorschein kam sein noch ziemlich neuer Mercedes SL 65 AMG, den er als Bonus von seiner Bank erhalten hatte. Er öffnete die große Fahrertür und setzte sich schwungvoll in die angenehmen Ledersitze, deren Bezüge allein 8.000 Dollar extra gekostet hatten. Der Motor war kaum zu hören, als er von seinem Anwesen rollte. Erst auf dem Highway gab er richtig Gas, sodass er in seine Rückenlehne gedrückt wurde. Im gleichen Moment überkamen ihn explosionsartige Kopfschmerzen. Für eine Sekunde war er verwirrt, da er im Grunde nie Kopfschmerzen hatte. Aber bereits in der nächsten Sekunde veränderten sich sein Blickwinkel und die Bäume am Straßenrand wurden seltsam plastisch. Er bog vom Highway ab in Richtung Miami-City. Die Personen auf den Bürgersteigen bewegten sich unnatürlich - irgendwie steril. Niemand redete miteinander. Alle gingen emotionslos aneinander vorbei, ohne sich anzusehen. Mit einem Mal fuhr ein schwarzes Auto aus einer Einfahrt direkt vor seinen SL und nahm ihm die Vorfahrt. Wütend drückte er auf die Fanfare und wetterte lautstark. Der Fahrer des schwarzen Wagens bremste ruckartig ab und zeigte ihm durch die Heckscheibe einen Mittelfinger. Im nächsten Moment bemerkte der Manager, dass der Beifahrer eine abgesägte Schrotflinte aus dem Fenster in seine Richtung hielt. Ohne nachzudenken bremste der Manager kurz ab, um sofort das Pedal voll durchzudrücken. Der SL 65 AMG schoss wie ein Pfeil auf den schwarzen Wagen zu und prallte ihm mit voller Wucht in den Kofferraum. Mit einem massiven Knall stoben Splitter auseinander und der schwarze Wagen geriet ins Schleudern. Mit quietschenden Reifen kam er quer zur Straße zum Stehen. Kurzerhand gab der Manager wieder Gas und umkurvte den querstehenden Wagen. Er meinte zu sehen, wie der Beifahrer mit der Schrotflinte auf ihn schoss. Er drückte das Pedal erneut bis zum Anschlag. Aber statt die Szenerie hinter sich verschwinden zu sehen, nahm er ein halbes Dutzend schwarzer Fahrzeuge wahr, das die Verfolgung aufnahm.
»Mich bekommt ihr nicht!«, schrie der Manager gegen den Motorenlärm an, der aufgrund des voll durchgetretenen Gaspedals lauthals aufbrüllte.
Trotzdem holten die Verfolger auf. Mit qualmenden und quietschenden Reifen bremste der Manager ruckartig und bog an einer Kreuzung Richtung Norden ab, um wieder auf den Highway zu gelangen. Dort würde er die Bande spätestens abhängen. Doch er hatte sich zu früh gefreut. Gerade als er über eine weitgeschwungene Brücke gefahren war, sah er eine Polizeisperre, die sich über alle Spuren erstreckte. Im Rückspiegel sah er die Verfolger schon an sich dran. Es nützte nichts. Er drückte das Gaspedal bis ins Bodenblech und durchfuhr die Absperrung, deren Trümmerteile krachend zersplitterten. Die Polizisten konnten gerade noch rechtzeitig zur Seite springen und wie durch ein Wunder zerstörte das Nagelband seine Reifen nicht. Nach der Brücke ging es nach links zum Highway hinauf. Die Verfolger waren immer noch da. Nur schwarze Fahrzeuge und zusätzlich auch noch Polizei. Kaum gab er auf dem Highway Vollgas, näherte sich ein Polizeihubschrauber. Im Radio kam im selben Moment eine Verkehrswarnung. Der Sprecher sprach von einer Verfolgungsfahrt in der City von Miami. Ein Mercedesfahrer habe das Auto einer jungen Mutter gerammt und im Anschluss Fahrerflucht begangen. Bei seiner Flucht sei er an einer Brückenbaustelle durch die Absperrung gefahren, aber keiner der Bauarbeiter sei verletzt worden. Die Polizei habe die Verfolgung aufgenommen und sperre momentan die Auffahrten des Highways.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752138009
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (März)
- Schlagworte
- Mord Kommissar Geheimnis Spannung Liebe Erpressung Medizin Dystopie Utopie Science Fiction Liebesroman Krimi Ermittler