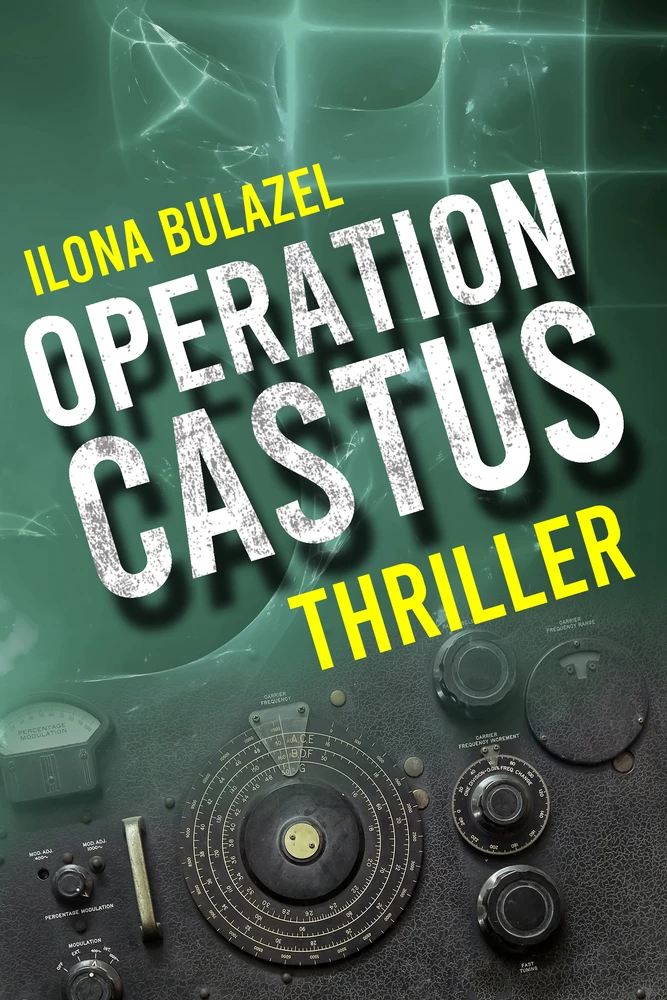Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Tagebucheintrag, 08. Mai 2017
»Operation Castus« ist gescheitert. Um 12.00 Uhr MEZ wurde das erste Ziel getroffen. Die Anlage in Grünau ist zerstört. Um 12.01 Uhr MEZ detonierten neun weitere Sprengladungen auf dem Europaflughafen bei Mainz. Die Auswirkungen waren verheerend – Terminal 1 und 2 haben schwere Schäden erlitten, während Terminal 3 fast dem Erdboden gleichgemacht wurde. Lediglich der Rohbau des neuen Terminals 4 steht noch. Auf allen Kanälen sieht man die Bilder der Zerstörung. Welch ein Anblick! Die Ergebnisse sind beeindruckend, waren jedoch so nicht geplant. Ich muss jetzt alles noch einmal durchgehen. Irgendwo steckt ein Fehler, irgendetwas habe ich übersehen … Ich muss die Tagebucheintragungen meines Vaters nochmals durcharbeiten. Ich habe ihm mein Ehrenwort gegeben und das werde ich halten. Koste es, was es wolle – wir werden siegen!
Deutschland, 8. Mai 2017, später Abend – SoKo »Europaflughafen«
»Sehen Sie das?«
Die anderen im Raum traten näher.
»Spielen Sie das noch mal ab!« Der Beamte am Computer ließ die Aufzeichnung erneut über den großen Bildschirm laufen. Erst in normalem Tempo, dann immer langsamer.
»Und das ist alles, was wir haben?«, fragte einer der Anwesenden. Der Beamte am Computer nickte. Er war erschöpft, genauso wie die anderen Mitarbeiter im Raum. Nach der Katastrophe waren sie alle hier zusammengezogen worden. Eine notdürftig eingerichtete Ermittlungszentrale, so nah wie möglich am zerstörten Europaflughafen. Sie alle waren Spezialisten auf ihrem Gebiet. Dafür ausgebildet, im Falle eines Horrorszenarios wie diesem die Arbeit aufzunehmen. Aber darauf hatte sie niemand vorbereitet. Es gab keine Spuren, keine Hinweise. Niemand wusste, was passiert war. Es gab kein Muster und keinen Anhaltspunkt darüber, was überhaupt die Detonationen ausgelöst hatte. Ein Angriff aus der Luft konnte ausgeschlossen werden. Ein Angriff von innen schien unwahrscheinlich.
In den letzten zwei Jahren war der Europaflughafen zu einem der sichersten Plätze der Welt gemacht worden. Alle renommierten Sicherheitsexperten schlossen Selbstmordattentäter oder Bombenkoffer aus. Vielleicht wäre ein Sprengstoffkoffer durchgekommen. Eine Explosion, die man nicht hätte verhindern können, aber das … Alle waren sich darüber im Klaren, dass man, was die Theorie eines Anschlags anging, komplett im Dunkeln tappte. Ein Sachverhalt, der die leitenden Beamten der Sonderkommission über einen möglichen Unfall nachdenken ließ. Eine Theorie, die man nun mit Eifer versuchte zu belegen.
Der Beamte fing an zu sprechen: »Sämtliche Kameras im Innenbereich sind ausgefallen, bis auf diese.« Er deutete mit dem Finger auf den Bildschirm, dann fuhr er fort: »Wir wissen, dass es kurz vor den Explosionen einen riesigen Energieanstieg gegeben hat, dann ist die gesamte Technik ausgefallen. Einige Außenkameras haben ›überlebt‹. Aber bis auf diese Aufnahmen aus Terminal 1 haben wir nichts wirklich Brauchbares.«
Wieder startete der Beamte die Sequenz. Die Männer und Frauen im Raum starrten reglos auf den Bildschirm. Der Anblick, der sich ihnen bot, würde sich für immer in ihre Köpfe einbrennen. Einige rangen nach Luft, hofften, dass die anderen ihren Schmerz und ihre Angst nicht bemerkten. Sie wollten stark sein für diese Aufgabe, doch die Bilder zwangen die meisten in die Knie. Auch erfahrene Ermittler schluckten schwer.
Die belegte Stimme des Beamten durchbrach das Surren der Computer: »Das Mädchen, es scheint etwas zu bemerken. Es streckt die Hand aus …« Dann brach ihm kurz die Stimme, bevor er sich räusperte und fortfuhr: »Für das Protokoll: Auf dem Bildschirm sieht man dieses Kind, vielleicht sechs Jahre alt. Es trägt eine blaue Latzhose, weiße Söckchen und kleine Turnschuhe. Die braunen Haare sind zu zwei Zöpfen geflochten. Die Anzeige auf dem Bildschirm zeigt 11.59 Uhr.« Wieder musste sich der Sprecher räuspern. Die Sekunden auf der Leinwand zählten unbarmherzig weiter, als der Beamte erneut ansetzte: »Um 12.00 Uhr dreht das Mädchen den Kopf ein wenig. Die Kamera erfasst den Blick des Kindes. Es reißt die Augen weit auf und öffnet den Mund. Dann streckt es einen Arm aus und deutet mit dem Finger in Richtung Gepäckbänder. So, als hätte es etwas entdeckt. Neben dem Mädchen steht die Mutter. Um 12.01 Uhr sieht man weiße Blitze, die Explosion.«
Die nächsten zehn Minuten vergingen für alle Anwesenden endlos langsam. Der Bildschirm blieb weiß, nur die Uhr zählte weiter. Dann konnte man wieder etwas erkennen. Den Ermittlern bot sich ein Bild der Zerstörung: Chaos, Feuer, leblose Körper und einzelne blutige Gliedmaße. Mittendrin stand das kleine Mädchen. Den Arm immer noch ausgestreckt. Es war, als hielte es etwas in seiner Hand, etwas, das tropfte. Einer der geflochtenen Zöpfe hatte sich gelöst. Das Mädchen klammerte sich mit dem anderen Arm ängstlich an das Bein seiner Mutter. Man konnte den weißen Damenpumps erkennen, die leicht gebräunte Haut; um das Knie legte sich der Rocksaum mit hübschem Blumenmotiv. Das Mädchen drückte sich ganz fest daran. Eine Beamtin konnte ein lautes Schluchzen nicht unterdrücken. Die Mutter hatte die Explosion nicht überlebt. Ihr Körper war zerfetzt worden. Alles, was von ihr geblieben war, war dieses eine Körperteil. Das Bein, das das Mädchen nun mit all seiner Kraft umschlang.
Südafrika, 8. Mai 2017, zur gleichen Zeit – Kapstadt
Peter Kromus rieb sich den rasierten Kopf. Er hatte ja schon in einigen unangenehmen Situationen gesteckt, aber dieses Mal war er in Panik. Was, wenn sie ihn foltern würden? Er hatte sich bisher immer in Sicherheit gewogen mit seinem deutschen Pass. Vielleicht zu Unrecht? Schließlich saß er in einer Gefängniszelle, die alles andere als einladend war. Was, wenn er hier nie mehr herauskäme? Wäre er dieses Mal nur vernünftiger gewesen.
Blödsinn!, dachte er. Seit seiner Kindheit hatte er sich auf das Erwachsenenalter gefreut. Diese fantastische Zeit nach all den Gängeleien der Älteren, die einem ständig Vorschriften machten. Er hatte sich damals geschworen, seine Volljährigkeit in vollen Zügen zu genießen. Und das tat er nun bereits seit seinem achtzehnten Lebensjahr sehr ausgiebig. Die letzten zwölf Jahre waren eine Aneinanderreihung von Abenteuern und leichtsinnigen Aktionen gewesen. Trotz seiner Angst musste Peter jetzt schmunzeln. Er dachte an einige verärgerte Damen aus seiner Vergangenheit, die ihm ein einsames und jähes Ende im Gefängnis prophezeit hatten und sich, wüssten sie über seine momentane Situation Bescheid, sicher die Hände reiben würden. Vermutlich käme von mindestens einer der Spruch: »Na, dann wärst du mal lieber bei mir geblieben ...« Aber mit dem »bei mir bleiben« stand Peter nunmal auf Kriegsfuß.
So hatte er dann vor drei Monaten, nach einer etwas turbulenten Geschichte mit einer Frau namens Giselle, die nächste Maschine Richtung »Weit weg« genommen und war in Kapstadt gelandet. Peter betrachtete sich in der Spiegelscherbe über dem verdreckten Miniwaschbecken. Die Bräune hatte er erfreulicherweise noch nicht verloren. Allerdings war er auch erst seit einer Nacht in dieser ungastlichen Behausung. Die Haare hatte er sich glücklicherweise gleich nach seiner Ankunft in Südafrika auf zwei Millimeter herunterrasiert. So musste er jetzt wenigstens keine Probleme mit Ungeziefer fürchten, das sich in seinen dunklen Locken sicher sehr wohlgefühlt hätte. Seine braunen Augen blickten ihn unsicher aus dem Spiegel an. Kurz flackerte erneut die Furcht auf, als er hörte, wie die Tür zum Zellentrakt aufgeschlossen wurde. Sein Herz klopfte und er bekam weiche Knie. Der Wärter öffnete die Tür seiner Zelle und gab ihm ein Zeichen mitzukommen. Peter dachte kurz über eine Flucht nach, als sie sich ihren Weg durch die Menschenmassen suchten, die beschlossen hatten, um diese Zeit die Polizeistation zu bevölkern. Der Wärter sprach Englisch mit Peter. Damit hatte er keine Probleme. Afrikaans wäre ihm jedenfalls sehr viel schwerer gefallen. Ganz zu schweigen von den vielen anderen offiziellen Amtssprachen wie zum Beispiel Siswati, Zulu oder Xitsonga.
Er äugte sehnsüchtig Richtung Ausgang. Leider wurde ihm der Fluchtweg durch eine Gruppe stark übergewichtiger Frauen versperrt, die gerade wild gestikulierend ein Schreikonzert zum Besten gaben. Er seufzte, als ihn der Wachmann unsanft weiterschob. Als sich die Tür des Verhörzimmers hinter ihm schloss, verstummten auch die Schreihälse.
Peter sah sich einem Südafrikaner gegenüber. Der Mann mochte etwa Mitte vierzig sein. Er schaute nur kurz zu Peter auf, nickte und vergrub seinen Kopf wieder in einer Akte. Peter fühlte sich unwohl und dachte an diverse Kinofilme, in denen üble Verhörtaktiken zum Einsatz kamen. Sein Gegenüber sah harmlos aus. Aber sind nicht die Harmlosen die Schlimmsten?
Die Stimme des Südafrikaners riss Peter aus seinen Gedanken. »Mein Name ist Thabo Zuma«, sagte der Schwarze in perfektem Deutsch.
Peter war perplex und verunsichert, aber er hatte keine Zeit zu antworten, der Mann sprach weiter: »Ich habe mir Ihre Aussage angesehen und ich muss schon sagen, Sie scheinen ja wirklich ein richtiger Idiot zu sein.«
Thabo Zuma ließ seine Worte wirken. Er sah die Angst in Peters Augen und hätte ihm gerne noch ein wenig auf den Zahn gefühlt. Er hatte eine ziemlich klare Vorstellung von diesem Deutschen, der sich so sträflich leichtsinnig verhalten hatte. Eine kleine Lektion täte ihm sicher gut. Aber heute war dafür nicht der richtige Zeitpunkt. Nicht nach dem, was passiert war.
Thabo wendete sich ab und lief im Zimmer hin und her. Er hatte zwei Kollegen, zwei Freunde, verloren. Sie waren in einer südafrikanischen Maschine gesessen. Die Explosion hatte den Airbus gleich nach der Landung auf dem Europaflughafen in Deutschland erfasst. Überlebende in der Maschine waren ausgeschlossen. Die Welt war entsetzt, es gab noch keine Neuigkeiten. Die Geheimdienste rotierten. Viele Nationen boten Deutschland ihre Hilfe an, natürlich nicht ganz uneigennützig. Es galt, schnellstmöglich Informationen zu erhalten. Informationen waren das Schmiermittel, das alles am Laufen hielt. Ein »Black Out« wie im Fall Europaflughafen war eine Katastrophe. In so einer Situation ging man immer vom Schlimmsten aus, und die Frage: »Wen trifft es als Nächsten?«, ließ die DEFCON-Stufe sinken. Deshalb schickten die Geheimdienste ihre Leute nach Deutschland, offiziell in diplomatischer Mission. Umgekehrt versuchte man dort »Herr der Lage zu werden« beziehungsweise zumindest den Eindruck zu erwecken. Dafür schickten die deutschen Behörden dürftige Meldungen an die Zentralen der ausländischen Geheimdienste. Doch allen war klar, dass wenige Stunden nach dem »Ereignis« nicht mehr zu erwarten war. Die Geheimdienste waren jedoch nicht die einzigen, die darauf brannten, Neues zu erfahren – längst standen die Medienvertreter vor den Toren des Europaflughafens.
Thabo Zuma riss sich zusammen und blickte erneut auf sein Gegenüber. Seine Meinung stand fest. Er hielt Peter Kromus für einen überheblichen Schönling, der es im Leben zu leicht hatte. Er seufzte, seine persönlichen Gefühle sollten in seinem Job keine Rolle spielen.
Also fuhr er ein wenig freundlicher fort: »Sie behaupten also, Sie haben sich Zugang zum militärischen Sperrgebiet verschafft, um einen »Urban Explorer«-Rekord zu brechen?«
Peter wollte sich zu Wort melden, er musste das besser darstellen. So wie es der südafrikanische Beamte sagte, hörte es sich wirklich an, als wäre Peter ein Idiot.
»Es tut mir leid, wenn ich Ihnen damit Unannehmlichkeiten gemacht habe, das war nicht meine Absicht. Sehen Sie, diese ›Urban Explorer‹-Sache ist vollkommen harmlos, ich sehe mir die Dinge nur an. Ich will nichts zerstören oder stehlen. Ganz im Gegenteil: Wenn ich in einem Gebäude bin, und sehe, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, dann verständige ich sogar den Eigentümer, um so Schlimmeres zu verhindern.«
Thabo hätte dem Jungen am liebsten eine Ohrfeige gegeben. Natürlich hatte er zuerst nicht gewusst, was es mit diesem »Urban Explorer«-Zeugs auf sich hatte. Mittlerweile war er schlauer, das Internet konnte seine Unwissenheit beseitigen. Peter Kromus war also ein leidenschaftlicher »Urbexer«. Er gehörte zu den Menschen, die gerne verlassene, oft auch historische Gebäude, aber auch stillgelegte Kliniken und Schulen, Industrieanlagen, Tunnel oder Kanalisationen aufsuchten, um sie zu erkunden und zu dokumentieren. Deshalb hatte er auch eine Kamera dabei gehabt. Offensichtlich gefiel diesem »Urbexer« die wildromantische Stimmung eines dem Zerfall gewidmeten Ortes. Ein bisschen gruselig war das sicher auch. Thabo hatte sogar ein wenig Verständnis dafür, und wenn er ganz ehrlich war, hätte ihn ein kleines Abenteuer dieser Art auch reizen können. Aber dieser Peter war einfach zu weit gegangen.
Thabo räusperte sich: »Sie haben militärisches Sperrgebiet betreten und sind dann unerlaubt auf ein Kriegsschiff gestiegen, das zum Abwracken im Hafen lag. Jetzt wollen Sie mir erzählen, das alles wäre zum Wohle des südafrikanischen Staates passiert?«
Peter wollte unterbrechen, aber Thabo Zuma hob gebieterisch die Hand: »Sie hätten uns also informiert, wenn es irgendwo im Schiff getropft hätte?« Kurz lächelte Zuma, dann polterte er los: »Was glauben Sie, wer Sie sind? Der verdammte Hausmeister?«
Der junge Deutsche zuckte zusammen und Zuma fuhr unerbittlich fort: »Man hätte Sie erschießen können. In anderen Ländern wären Sie sofort hingerichtet worden. Wir sind hier nicht im Kindergarten und reden auch nicht über einfachen Hausfriedensbruch. Ach, und wie schön, dass Sie auch noch eine Kamera dabei hatten, da müssen wir das Wort ›Spionage‹ gar nicht erst erwähnen.« Zuma funkelte Peter böse an, dem darauf keine Antwort einfiel.
Stattdessen versuchte er abzulenken, und sagte: »Sie sprechen sehr gut Deutsch, Herr Zuma!«
Thabo Zuma musste ein Lächeln unterdrücken und dachte: Dieser Typ ist wirklich ein Kindskopf. Mit strengem Blick antwortete er dem Deutschen: »So, tue ich das?«
Peter nickte eifrig und beobachtete, wie der Beamte in seiner Tasche kramte und etwas herausfummelte. Es war ungefähr 15 Zentimeter lang und röhrenförmig. Er bekam feuchte Hände. Vielleicht war das einer dieser modernen Laser, mit dem man den Gefangenen die Netzhaut verbrannte? Schweiß trat ihm auf die Stirn, als der Südafrikaner mit dem Ding auf ihn zulief und direkt vor seiner Nase einen Auslöser drückte.
Sein gesamter Körper war auf Schmerz eingestellt. Er hatte vor Panik die Augen geschlossen, als ihn Zumas Stimme erlöste: »Hier, unterschreiben Sie das, dann können Sie gehen.«
Peter blickte auf, der Beamte hielt ihm einen Kugelschreiber entgegen. Vor Erleichterung gab er ein Stöhnen von sich. Dann schämte er sich für seinen Kontrollverlust – hoffentlich hatte Herr Zuma das nicht bemerkt. Er griff nach dem Stift und unterschrieb.
Als er aufstehen wollte, legte ihm der Südafrikaner eine Hand auf die Schulter: »Einen Moment, ich muss Ihnen noch etwas mitteilen.« Thabo Zuma setzte sich nun auch und Peter spürte, dass das, was jetzt kommen würde, nichts mit seiner Verhaftung zu tun hatte. Die Nervosität kam zurück.
»Wo wohnen Sie in Deutschland?«
Peters Antwort glich mehr einer Frage: »Berlin?«
Der südafrikanische Beamte schien erleichtert. »Gut. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass es heute um 12.01 Uhr ein schlimmes Unglück auf dem Europaflughafen gegeben hat …«
Zuma erzählte, was er wusste. Er wollte den jungen Mann nicht sich selbst überlassen. Er hätte auch nicht zufällig solch eine Nachricht erfahren wollen, wenn es ein ähnliches Unglück in seiner Heimat gegeben hätte.
Peter schien geschockt. Er hörte die Worte, aber er wollte sie nicht glauben. Erinnerungen an Reportagen über Attentate, Brände und Explosionen schwirrten durch seinen Kopf. Er konnte es nicht fassen, war er doch selbst unzählige Male auf dem Europaflughafen gewesen. Meist als Passagier, einmal auch nur, um den Ausblick von der großen Glaskuppel zu genießen, unter der die Besucherlounge eingerichtet war. Er hatte sich dort immer sicher gefühlt. Flughäfen waren für ihn das Symbol der Freiheit. Peter war ein Weltenbummler und liebte es, unterwegs zu sein. Flughäfen erfüllten ihm diesen Traum vom Reisen und der Europaflughafen war ihm, seit seiner Fertigstellung 2015, der liebste geworden. Dieser Airport war ein gemeinsames Projekt mehrerer EU-Länder gewesen. Er hatte seine Gegner gehabt, aber trotzdem war der Europaflughafen schließlich zu einem Symbol für die Verbundenheit der Nationen geworden. Ein Projekt, das die Menschen wieder mehr für die europäische Idee, die man in den Jahren davor oftmals aus den Augen verloren hatte, begeistern sollte. »Europa bringt uns überall hin!« war der Werbeslogan des Flughafens. Peter dachte an die vielen Menschen, die ständig, wie große Wassermassen, durch die Terminals strömten. Wie viele waren heute gestorben? Tausende hatte Zuma gesagt.
Peter hörte die Worte seines Gegenübers nicht mehr, bis dieser ihn unsanft am Arm schüttelte: »Herr Kromus, haben Sie verstanden? Sie werden nach Deutschland zurückfliegen. Mein Land will, aufgrund der Ereignisse am Europaflughafen, keine diplomatischen Verwicklungen, weil wir einen unreifen Deutschen in unserer Zelle sitzen haben. Allerdings kann meine Regierung Ihr Verhalten auch nicht billigen. Sie werden also umgehend ausreisen.«
Peter nickte. Er wollte zurück nach Deutschland. Eigentlich wusste er nicht, was das nützen sollte, aber irgendwie hatte er das Gefühl, dass es richtig sei.
Zumas Stimme erklang erneut: »Am Cape Town International Airport werden wir ein Flugticket für Sie hinterlegen. Berlin wird im Moment angeflogen. Alles Gute für Sie – und halten Sie sich von militärischem Sperrgebiet fern!«
Kapitel 2
Tagebucheintrag, September 1936
Dank der wieder erstarkten deutschen Nation habe ich endlich die Möglichkeit, mein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Stolz habe ich den Eid auf unseren Führer abgelegt! Die Menschen haben den Verrat des letzten Krieges nie überwunden, nun habe ich die Chance, unter der neuen Fahne all mein Wissen gegen unsere Feinde einzusetzen. Vor einigen Tagen durfte ich meine Entwürfe dem Reichsführer-SS Heinrich Himmler vorlegen – er kam nicht umhin, meine Pläne als »genial« und »wegweisend« zu titulieren. Ich arbeite seither mit Hochdruck daran, mein Projekt in die Tat umzusetzen. Und so es das Schicksal will, kann ich unserem Führer alsbald die ersten Ergebnisse präsentieren!
Flug 1347, 9. Mai 2017, vormittags – von Cape Town/Südafrika nach Berlin/Deutschland
Peter streckte sich auf seinem Sitz. Er hatte einen Fensterplatz und sah auf die Wolkendecke. Für gewöhnlich fühlte er sich eher unbehaglich, wenn er nach Deutschland zurückkehrte. Dieses Mal war er ungeduldig und konnte die Ankunft kaum erwarten. Er blätterte die Ausgabe einer südafrikanischen Tageszeitung durch, das Unglück am Europaflughafen füllte die Seiten. Daneben verblassten Meldungen von Aufständen im Osten des afrikanischen Kontinents und von einem Feuer in einer Fabrik in Namibia. Die Ausgabe vor ihm glich einem Nachruf. Einer der Journalisten hatte sich die Mühe gemacht, die noch junge Geschichte des Europaflughafens zu erzählen: »Das EU-Projekt, die große Hoffnung für Europa …, für noch bessere Verständigung …, 80 Millionen Passagiere jährlich …, 450 Flugziele …«, war da zu lesen.
Peter kannte diese Daten und doch schien ihm, als er sie las, das Geschehene noch unwirklicher. Es gab weiterhin keine Erklärungen. Mit Spekulationen über einen Anschlag von Terroristen hielt sich das Blatt zurück. Ein Zeichen, dass es in diese Richtung keine Anhaltspunkte gab. Die deutschen Behörden verneinten vehement das Vorhandensein irgendwelcher Bekennerschreiben. Es hatten sich nicht einmal die »üblichen« Trittbrettfahrer zu Wort gemeldet.
Kein Wunder!, dachte Peter. Wer dafür verantwortlich war, hatte sich die gesamte Welt zum Feind gemacht.
Die Stewardess kam mit einem Getränkewagen, sie lächelte in Peters Richtung. Er zwinkerte zurück und die Frau kicherte leise. Dann hob er den Kopf und blickte neugierig über die Sesselreihen. Die Maschine war nicht ausgebucht. Nur wer unbedingt musste, würde sich die nächsten Tage in ein Flugzeug setzen beziehungsweise einen Flughafen betreten. Peter wollte sich gerade zurücklehnen, als er stutzte. War da nicht ein bekanntes Gesicht? Ohne lange zu überlegen, quetschte er sich an seinen Sitznachbarn vorbei, nicht ohne freundlich »Verskoon my« zu sagen, was so viel wie »Entschuldigung« auf Afrikaans bedeutete. Erneut zwinkerte er der hübschen Stewardess zu und ließ sich zwei kleine Kaffee in die Hand drücken, um damit ein paar Reihen weiter vorne seine Aufwartung zu machen.
»Herr Zuma, ich hoffe, Sie mögen Kaffee?!« Damit setzte sich Peter auf den freien Platz neben dem überraschten Mann. Zuma stöhnte innerlich auf – natürlich, er hatte ja selbst dafür gesorgt, dass diese Nervensäge den nächsten Flieger nach Berlin nahm. Weiter kam er nicht mit seinen Überlegungen, denn schon fing Peter an, interessiert die Fotografien, die Zuma auf seinen Knien balancierte, zu begutachten. Schnell schob dieser die Bilder zusammen und verstaute sie in seiner Aktentasche.
Peter prostete ihm mit dem Kaffee zu und sagte überflüssigerweise: »Sie fliegen also auch nach Berlin?«
Thabo Zuma gab sich geschlagen, er würde wohl um eine Unterhaltung nicht herumkommen. Mit einem Grinsen antwortete er deshalb: »Erstaunliche Kombinationsgabe, ich bin beeindruckt!«
Peter lachte laut auf und konterte: »Ja, ich bin der meist unterschätzte Mann des Planeten. Mein Schicksal …« Zumas Grinsen wurde breiter, er sagte aber nichts. Stattdessen beobachtete er verstohlen seinen neuen Sitznachbar. Man sah Peter an, dass er vor Neugier beinahe platzte. Der Südafrikaner ließ ihn zappeln und tat so, als würde er dem Nachrichtenticker auf den Bordbildschirmen folgen. Peter rutschte ungeduldig in seinem Sitz hin und her.
Zuma stöhnte laut: »Also schön, ja, ich fliege nach Berlin. Ja, es ist beruflich. Und ja, es hat mit dem Europaflughafen zu tun.«
Peter sah den Südafrikaner mit großen Augen an: »Sie sind doch nur ein Polizist …«, dann lief er rot an und versuchte eine Wiedergutmachung: »Ich wollte damit sagen, Sie sind ein super Polizist, der beste, überhaupt, es ist nur …«
Zuma warf ihm einen forschenden Seitenblick zu und wisperte: »Sie sollten vorsichtig sein, mit dem, was Sie sagen, sonst packe ich vielleicht wieder meinen ›Todeskugelschreiber‹ aus.«
Dann sah er erneut auf die Bildschirme und ein feines Lächeln umspielte seine Lippen.
Peter riss die Augen auf und seine Gesichtsfarbe wurde einen Hauch dunkler: »Sie haben das bemerkt?«
Zuma lachte, es war ein sympathisches Lachen: »Sie haben gezittert wie ein Antilopenschwanz und auf ihrem Gesicht gab es kleine Schweißpfützen.«
»Das lag an der Hitze und dem Schlafentzug.«
»So wird es sein, Herr Kromus.«
Peter verzog ein wenig beleidigt das Gesicht.
Der Südafrikaner hatte erneut Erbarmen und fügte hinzu: »Ich wurde dem Außenministerium unterstellt und bin sozusagen in diplomatischer Mission unterwegs. Und da ich Ihre Sprache spreche …« Er machte eine Handbewegung, die so viel heißen sollte, wie »da war es logisch, dass sie mich schicken.«
Peter war erstaunt: »Dann sind Sie eigentlich gar kein Polizist?«
»Wie man es nimmt. Ich wurde als Polizeibeamter ausgebildet. Bin aber jetzt für andere Abteilungen tätig. Und wenn deutsche ›Urbexer‹ die guten, bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Südafrika bedrohen, dann kann es schon einmal vorkommen, dass ich gerufen werde. Das ist alles.«
»Wow, und jetzt sollen Sie die Katastrophe vom Europaflughafen aufklären!«
Zuma sah den Deutschen ungläubig an: »Was reden Sie denn da? Ich bin als Verbindungsmann unterwegs. Von Berlin aus fahre ich mit dem Auto weiter Richtung Mainz. Fliegen ist momentan nicht möglich. Der Frankfurter Rhein/Main-Flughafen hat, genauso wie alle anderen Flughäfen in der Nähe, aufgrund der jüngsten Ereignisse vorübergehend seinen Betrieb eingestellt.«
Peter nickte, er hatte bereits den Nachrichtenticker gelesen. Momentan wurden, aus Sicherheitsgründen, nur noch wenige Airports in Deutschland angeflogen.
Thabo Zuma sprach leise weiter: »Der Airbus einer südafrikanischen Fluglinie war zum Zeitpunkt der Explosion auf dem Rollfeld des Europaflughafens. Es gab keine Überlebenden.«
»Das tut mir sehr leid.«
Eine Weile saßen die Männer schweigend nebeneinander, jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Peter beobachtete, wie Zuma immer wieder die Augen zufielen. Das gleichförmige Turbinengeräusch und die sanften Schaukelbewegungen erledigten den Rest. Thabo Zuma schlief ein.
Peter war zu nervös, er konnte nicht schlafen. Die letzten Tage, seine Verhaftung, die Nachricht von den Explosionen, das alles saß ihm in den Knochen. Er hatte nach seiner Freilassung gestern Abend noch schnell mit Berlin telefoniert. Glücklicherweise war Ella, die gute Seele des Hauses Kromus, an den Apparat gegangen. Die Haushälterin hatte sich seit damals, als er sechs Jahre alt gewesen war und seine Mutter starb, um ihn gekümmert. Peter hatte kein gutes Verhältnis zu seinem Vater, Kurt Kromus, einem bekannten Berliner Anwalt für Patent-, Marken- und Urheberrecht. Das hatte sich auch mit dessen zweiter Ehe, mit einer Frau namens Claudia, nicht geändert. Claudia war gerade drei Jahre älter als Peter und eigentlich sehr um Harmonie bemüht. Aber auch ihr war es bisher nicht gelungen, das Verhältnis von Vater und Sohn zu verbessern.
Er schob diese Gedanken jedoch beiseite und frönte seinem Entdeckerdrang. Er griff vorsichtig nach Thabo Zumas Aktentasche und zog geschickt die Fotos heraus. Mit offenem Mund betrachtete er die Bilder der Zerstörung. Die Qualität der Aufnahmen war nicht besonders gut – es handelte sich nicht um Fotografien, sondern Faxausdrucke.
Peter war verwirrt. Wieso standen dem afrikanischen Beamten keine hochwertigen Farbaufnahmen zur Verfügung? Er betrachtete die körnigen Ausdrucke. An manchen Stellen gab es kleine handschriftliche Notizen wie: »Aus Terminal 2«, »Krater Rollfeld« oder »Südafrikanische Maschine«. Dann eine Bemerkung: »Hoffe, es hilft!« Was hatte das nun zu bedeuten? Peter drehte und wendete die Aufnahmen in alle Richtungen, doch er konnte nicht allzu viel damit anfangen. Meist sah man nur Bruchstücke, Metallteile und gesplittertes Holz – das hätte alles Mögliche sein können. Er versuchte das, was er sah, in seinem Gedächtnis zu speichern. Konzentriert tastete er die Bilder mit seinen Augen ab. So konzentriert, dass er nicht bemerkte, wie sich Zuma neben ihm bewegte.
Plötzlich wurden ihm die Ausdrucke aus der Hand gerissen und der Südafrikaner blaffte ihn wütend an: »Was fällt Ihnen ein! Wissen Sie noch, was ich Ihnen über militärisches Sperrgebiet gesagt habe? Verschwinden Sie auf Ihren Sitz, bevor ich mich vergesse.«
Peter wollte etwas sagen und stotterte: »Ich will nur helfen, ehrlich, ich …«
Aber Thabo Zuma sah wütend in die andere Richtung und Peter blieb letzten Endes nichts anderes übrig, als zurück zu seinem Sitz zu trotten.
Als die Maschine nach knapp 12 Stunden Flugzeit in Berlin landete, hatte ein leichter Nieselregen eingesetzt. Es war ungewöhnlich kalt. Peter wollte noch einmal mit Thabo Zuma sprechen, konnte ihn aber, nach dem Auschecken, nicht mehr ausfindig machen. Ein Taxi hatte ihn nach Hause gebracht, und er war froh, als er sich, mit dem Hinweis auf den langen Flug, schnell in seine kleine Wohnung im Nebengebäude der stattlichen Villa flüchten konnte. Den Fragen seines Vaters war er ausgewichen und dessen Frau Claudia war es zum Glück gelungen, die kurze Begrüßungszeremonie in friedliche Fahrwasser zu steuern.
Jetzt lag Peter in seinem Bett und konnte nicht schlafen. Er grübelte über Thabo Zuma nach. Die Bilder waren definitiv nicht aus einer offiziellen Quelle, dafür war die Qualität zu schlecht. Nein, er war sich sicher, dass Zuma die Aufnahmen per Fax erhalten hatte und nicht online. Aber warum? Das konnte nur auf eines hindeuten, nämlich dass der Südafrikaner die Aufnahmen gar nicht hätte haben dürfen. In Peters Kopf spielten sich die wildesten Spionageszenarien ab. Dann grübelte er erneut über die Fotos. Ihm war etwas aufgefallen. Auf einem der Bilder sah man ein tellergroßes Metallstück, an dessen oberen Rand ein Symbol zu erkennen war. Es sah aus wie eine Glocke. Ein eigentümliches Gefühl beschlich ihn. Peter hatte dieses Symbol schon einmal irgendwo gesehen – und das war nicht im Zusammenhang mit Kirchengeläut gewesen. Genervt warf er sich im Bett hin und her, bis er schließlich in einen unruhigen Schlaf fiel.
Deutschland, 10. Mai 2017 – Berlin
Thabo Zuma verließ verwirrt die südafrikanische Botschaft in Berlin. Sein Hotel war nicht weit entfernt und so ging er zu Fuß. Tief in Gedanken versunken, spürte er kaum den immer stärker werdenden Regen. Als er die Hotelhalle betrat, war er ziemlich durchnässt.
»Sie hätten einen Schirm mitnehmen sollen.«
Thabo drehte sich um und sah das Gesicht seiner persönlichen Geduldsprobe vor sich. »Herr Kromus, Sie schon wieder? Was wollen Sie?«, knurrte er unwirsch und lief weiter zur Rezeption.
Peter ließ sich nicht einschüchtern, sondern folgte ihm und sagte triumphierend: »Der Europaflughafen … Ich habe etwas herausgefunden.«
Zuma bat die Hotelangestellte, seine Rechnung vorzubereiten und lief zum Aufzug.
Peter blieb ihm auf den Fersen: »Haben Sie gehört? Ich habe etwas herausgefunden.«
Thabo Zuma blickte ihn an und erwiderte: »Glückwunsch!« Damit stieg der Südafrikaner in den Lift und die Türen schlossen sich.
Peter schaffte es gerade noch, seine Hand dazwischenzuschieben, um dann neben Zuma zu treten.
»Sie geben wohl nie auf?«, der Südafrikaner kratzte sich am Kopf, »gut, dann kommen Sie mit, ich werde Ihnen auch etwas zeigen.«
Peter wollte zum Sprechen ansetzen, aber Zuma unterbrach ihn: »Warten Sie, bis Sie das gesehen haben.«
Der Deutsche konnte sich zwar kaum beherrschen, aber er wollte es sich nicht mit dem Mann verderben. Also trottete er schweigsam hinterher. Im Hotelzimmer griff Zuma nach der Fernbedienung und schaltete den Flachbildfernseher ein. Dann forderte er Peter mit einer Kopfbewegung auf, der Sendung zu folgen, und verschwand im Badezimmer. Der junge Deutsche war überrascht, er war schließlich nicht hier, um sich das Mittagsprogramm anzusehen. Er war schon im Begriff Thabo Zuma ins Badezimmer zu folgen, als das Fernsehgerät doch noch seine Aufmerksamkeit erregte. Die laufende Sendung wurde unterbrochen. Es erschien ein Laufband mit den neudeutschen Vokabeln »Breaking News«. Dann tauchte der Kopf einer blonden Sprecherin auf. Peter hörte wie gebannt auf ihre Worte. Mittlerweile trat Zuma mit einem Handtuch in der Hand ins Zimmer.
»Die glauben, das war ein Unfall?« Peter starrte den Südafrikaner erstaunt an.
»Die glauben das nicht nur, die bestätigen das sogar. Ich komme gerade von meiner Botschaft. Heute Morgen wurden alle involvierten Nationen von der Bundesregierung informiert. Somit steht fest, dass eine Verkettung unglücklicher Umstände, Fehlkonstruktionen, menschliches Versagen und ein teuflisches System aus Gasleitungen und Kerosintanks den Europaflughafen in die Knie gezwungen haben.«
Peter schluckte: »Eigentlich ist es ja gut so. Wenn wir wüssten, dass es ein Anschlag gewesen wäre … Undenkbar!«
Zuma rieb sich mit dem Handtuch über sein Gesicht: »Ja, undenkbar …«, murmelte er, drehte sich um und fing an, seine Sachen zusammenzupacken. »So, und jetzt sind Sie dran.«
»Was?«
»Na, Ihre Entdeckung? Wie sagt man bei Ihnen? Ich bin ganz Ohren.«
Peter setzte sich auf einen Sessel und lächelte: »Ohr, es heißt, ich bin ganz Ohr.« Dann zögerte er: »Irgendwie macht das jetzt keinen Sinn mehr.«
Zuma rechnete eigentlich nicht damit, das Peter Kromus einen wertvollen Beitrag zu den Geschehnissen liefern würde. Vermutlich hatte er sich irgendeinen Unsinn zusammengereimt. Thabo hielt den jungen Deutschen nach wie vor für einen Chaoten, dem es an Ernsthaftigkeit fehlte. Trotzdem mochte er ihn irgendwie. Er würde in einer Stunde Richtung Mainz aufbrechen und Peter Kromus wahrscheinlich nie wiedersehen. Was würde es schaden, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen?
Er zog sich einen zweiten Sessel heran, setzte sich und fragte freundlich: »Sie haben sich die Mühe gemacht, mich aufzuspüren, und jetzt wollen Sie nicht legen?«
»Bitte was?«
Zuma setzte noch einmal an: »Na, das heißt doch so, wer gackert, der muss auch legen?«
Peters Gesicht zeigte ein spitzbübisches Grinsen: »Wir sollten einen Deal machen. Ich vermeide militärisches Sperrgebiet, wenn Sie sich von deutschen Redewendungen fernhalten.«
Thabo Zuma verstand und musste lachen: »Na los, erzählen Sie schon.«
Und Peter berichtete dem Südafrikaner von der Glocke, die er auf dem Foto entdeckt hatte.
Zuma war überrascht. Zum einen darüber, dass der Deutsche tatsächlich eine Entdeckung gemacht hatte, zum anderen, dass ihm selbst dieses Symbol nicht aufgefallen war. Er lief zu seiner Tasche und fischte die Fotos heraus, Peter half ihm, das richtige zu finden.
»Sehen Sie, da ist sie. Und in der Mitte ist ein Pfeil, der nach unten zeigt.«
Zuma konnte die aufgemalte Glocke auf dem Splitterteil erkennen. Er holte eine Leselupe aus der Schublade und betrachtete konzentriert das Bild.
Peter räusperte sich, er hatte noch mehr zu sagen. Wahrscheinlich würde ihn Zuma jetzt gleich für einen Spinner halten und rauswerfen. Er atmete durch. Zu Hause war er sich sicher gewesen, dass seine Entdeckung wichtig wäre. Aber das, was er jetzt zu sagen hatte, schien ihm hier in diesem Hotelzimmer irgendwie absurd.
Zuma hob den Kopf und sah zu Peter: »Was gibt es noch?«
Dieser zögerte: »Na ja, ich habe das schon mal gesehen. Das Symbol, diese Glocke. Ich habe deshalb die ganze Nacht gegrübelt. Heute Morgen war die Erinnerung plötzlich da.«
Zuma war jetzt sehr ernst: »An was haben Sie sich erinnert?«
Peter kramte in seiner Jackentasche und zog ein gefaltetes Blatt heraus. »Ich zeige es Ihnen.«
Er trat neben den Südafrikaner, die beiden Männer betrachteten die Seite.
»Sehen Sie, hier. Das Abzeichen, das sieht genauso aus wie das Symbol auf dem Splitterteil.«
Zuma nickte bedächtig. Der Computerausdruck zeigte eine schwarze militärische Schirmmütze. Darunter die Notiz: »Verkauft für 9.000,- Euro/Ich bin der beste Urbexer!«
»Wo haben Sie das her?«
»Das ist eine nicht ganz offizielle Quelle …«
Thabo Zuma legte den Kopf schräg und schnaufte ungeduldig.
»Schon gut«, fuhr Peter fort, »Sie wissen doch von dieser Urban-Explorer-Sache. Nun, die meisten von uns machen das nur aus … sagen wir ideellen Gründen. Wir mögen das Abenteuer, die Atmosphäre und nehmen Erinnerungen lediglich in Form von Fotografien mit. Es gibt aber auch einige, die daraus ein Geschäft gemacht haben. Sie verkaufen Dinge, die sie bei ihren Ausflügen finden. Es gibt eben immer schwarze Schafe. Das hier«, und damit deutete er auf das Blatt Papier, »stammt von so einem schwarzen Schaf. Der Typ ist ein Spinner, hat sich auf alte Militäranlagen spezialisiert und versucht, an Militaria zu kommen, um sie dann zu verkaufen. Sehen Sie mich nicht so an! Ich bin nur ein lautloser Besucher, der nichts berührt. Dieser Typ ist eine Schande für uns Urbexer. Außerdem ist er nicht ganz dicht. Das stammt von seiner Website, Zugang nur über das Urbexer-Netzwerk.«
Zuma betrachtete die Mütze auf dem Ausdruck, er musste eine Entscheidung treffen. Seine Botschaft hatte ihm mitgeteilt, er solle keine weiteren Untersuchungen vornehmen. Sie hatten ihn quasi abgezogen. Seine einzige Aufgabe bestand noch darin, die Formalitäten zu erledigen. Die Südafrikaner, die auf dem Europaflughafen und im Airbus der südafrikanischen Fluglinie gestorben waren, mussten, soweit möglich, in ihre Heimat überführt werden. Es sollte Entschädigungen für die Familien geben, die Bundesregierung hatte großzügige Versprechen gemacht. Jetzt galt es, Formulare auszufüllen. Aber er fühlte sich auch der Wahrheit verpflichtet.
»Sie wissen schon, aus welcher Zeit diese Kopfbedeckung stammt und wer sie getragen hat?«
Peter fühlte sich unwohl: »Ich weiß, es ergibt keinen Sinn. Mir ist auch noch nicht klar, wie das mit dem Unglück auf dem Flughafen zusammenhängen könnte, vielleicht ist das alles nur Zufall. So ein Symbol kann ja überall auftauchen. Vielleicht war das am Flughafen irgendein Dekogegenstand, oder …?«, er hob hilflos die Schultern.
Zuma hätte ihm vielleicht recht gegeben – aber unter diesen Umständen? Er lief wieder zu seiner Aktentasche, zog ein weiteres Papier heraus und reichte es Peter mit den Worten: »Das habe ich heute Morgen erhalten. Ein kleines Mädchen hat die Explosion überlebt. Aufgrund der Aufnahmen einer Überwachungskamera kam das Team zu dem Schluss, dass sie irgendetwas gesehen haben könnte. Eine Befragung hat nichts ergeben. Sie spricht seit dem Vorfall nicht mehr. Dafür hat sie die ganze Zeit immer und immer wieder das gleiche Bild gemalt. Sehen Sie …«
Peter pfiff leise, als er die Kinderzeichnung betrachtete: »Eine Glocke mit einem Pfeil!«
Zuma nickte. »Mein Kontakt war der Meinung, dass das vielleicht ein Hinweis auf etwas sein könnte, eine unbewusste Botschaft. Etwas, was das Kind gesehen hat, aber aufgrund des Schocks nicht beschreiben kann. Die Ermittler vor Ort haben der Sache jedoch bisher keine große Beachtung geschenkt.«
»Aber wenn die Explosion ein Unfall war …?«, stammelte Peter.
Zuma zog die Augenbrauen hoch: »Jetzt aber nicht das Gehirn auf halber Strecke schlapp machen lassen. Sie haben so vielversprechend gestartet. Sehen wir uns die Fakten an. Was haben wir: einen Splitter vom Europaflughafen, auf den eine Glocke mit Pfeil gemalt ist. Eine Schirmmütze, auf der neben dem Totenkopf der Waffen-SS ein Emblem angebracht ist, das haargenau so aussieht, wie das auf dem Splitterteil vom Flughafen. Diese Schirmmütze aus dem Dritten Reich hat Ihr Urbexer-Freund gefunden und sehr lukrativ verkauft. Und zu guter Letzt die Zeichnung eines kleinen Mädchens, das die Explosionen auf dem Flughafen überlebt hat, unter Schock steht und offensichtlich die einzige Zeugin ist. Was sagt uns das?«
»Es war kein Unfall, oder?«
Zuma schüttelte den Kopf und Peter fuhr fort: »Aber was war es dann? Und wieso taucht in diesem Zusammenhang ein Symbol aus dem Dritten Reich auf?«
Thabo Zuma schüttelte erneut den Kopf: »Ich habe keine Ahnung, aber ich werde versuchen, es herauszufinden.«
»Und ich werde Ihnen dabei helfen!«
In Zumas Blick sah man den Zweifel, als er antwortete: »Das wird vielleicht nicht ganz unproblematisch, das ist anders als diese Urban-Explorer-Nummer.«
»Das ist mir egal«, erwiderte Peter fast ein wenig trotzig, »ich weiß, dass es richtig ist. Falls es kein Unfall war, dann müssen wir die Verantwortlichen finden. Niemand darf mit so etwas ungestraft davonkommen.«
Peter war selbst von seinen Worten überrascht. Er hatte sich in der Vergangenheit nie besonders für irgendetwas engagiert. Aber dieses Mal war es ihm, als müsste er sich kümmern – er fühlte sich verpflichtet und er wollte helfen.
Zuma machte sich ebenfalls seine Gedanken. Er wollte natürlich nicht, dass der Junge Probleme bekäme, aber etwas Hilfe würde nicht schaden. Auf weitere Verbündete konnte er kaum hoffen.
Kurz zögerte er, dann fragte er Peter: »Sie haben nicht zufällig ein Geschichtsstudium, so wie dieser Professor aus den Filmen, der viele alte Sprachen spricht und sich bestens in historischen Ereignissen auskennt? Kämpfen kann er auch noch und …«
Peter unterbrach ihn: »Schon gut, ich kenne diese alten Filme. Nein, damit kann ich nicht dienen. Ich habe lediglich ein Sportstudium.«
Thabo Zuma hob theatralisch die Hände gen Himmel und rief: »Gott bewahre, dann hoffen wir einfach, dass uns in einer brenzligen Situation auch eine Kür am Stufenbarren retten kann.«
Zuma hatte, mit Peter im Schlepptau, sein Hotel in Berlin verlassen. Nun saßen die beiden in einem Mietwagen Richtung Mainz.
»Und Sie sind sicher, dass Sie nicht noch einmal nach Hause müssen?«
Peter schüttelte den Kopf: »Nicht nötig, alles, was ich brauche, habe ich hier.« Damit klopfte er auf seinen kleinen Rucksack. »Ohne den gehe ich so gut wie nie aus dem Haus. Ist sozusagen mein Überlebenspaket.«
Zuma lächelte: »Wie haben Sie mich überhaupt in Berlin gefunden?«
Peter gab sich überheblich: »Nun, ich hatte das Glück, dass mir dafür die unglaublichsten und modernsten Techniken zur Verfügung standen.«
Der Südafrikaner warf einen kurzen Blick auf seinen Beifahrer: »Und die wären?«
Peter brachte sich in eine bequeme Sitzposition und grinste: »Das Telefon. Ich habe einfach alle Hotels durchprobiert.«
Zuma lachte herzhaft.
Nun war es an Peter zu fragen: »Wieso sprechen Sie eigentlich so gut Deutsch, Herr Zuma?«
Sein Begleiter beendete noch sein Überholmanöver, dann antwortete er: »Nennen Sie mich doch bitte Thabo! Nun, ich hatte Glück, mein Vater arbeitete als Fahrer für einen deutschen Unternehmer in Kapstadt, der selbst einen Sohn in meinem Alter hatte. So lernte ich Deutsch und der Junge Afrikaans. Außerdem übernahm der Arbeitgeber meines Vaters für mich das Schulgeld und nutzte seine Kontakte. So konnte ich zusammen mit meinem deutschen Freund eine erstklassige Schule besuchen. Nun, als Kind lernt man Sprachen sehr schnell, vor allem, wenn das die einzige Chance auf eine bessere Zukunft ist. Mein Vater hat sein Leben lang alles dafür getan, mir eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Leider ist er früh gestorben.«
»Und Ihre Mutter?«, fragte Peter.
Thabo sagte traurig: »Sie starb, als ich drei Jahre alt war. Damals waren die Straßen von Kapstadt nicht sehr sicher. Sie wurde erschossen.«
Peter schüttelte traurig den Kopf. Er dachte an seine eigene Kindheit ohne Mutter und fühlte sich dem Südafrikaner verbunden: »Ihre Eltern wären sicher stolz auf Sie.«
Thabo nickte kurz: »Jedenfalls wurde Deutsch so zu einer Art Muttersprache für mich.«
Es entstand eine kurze Pause, dann fuhr er fort: »Wenn ich in Mainz mit den Behörden wegen der Formalitäten gesprochen habe, dann möchte ich mich noch mit jemandem treffen«, er warf erneut einen Seitenblick auf Peter, »Sie sollten uns einen Kontakt zu diesem ›Mützenverkäufer‹ herstellen.«
Peter nickte: »Ich werde mein Bestes versuchen!«
Hans Martlow saß vor seinem kleinen Pils. Das Glas hatte eine abgebrochene Stelle. Er drehte es ein wenig und dachte: Wenn man sich in solchen Kaschemmen zu geheimen Treffen verabredet, dann leidet eben die Qualität. Aber er hatte nunmal absichtlich diesen Ort ausgewählt, eine kleine Kneipe in der Nähe des Bahnhofsgebäudes von Mainz. Dunkel und anonym. So viel Laufkundschaft, dass man nicht auffiel.
Er war ein wenig aufgeregt. Nach vierzig Dienstjahren hatte er heute seit Langem wieder einmal das Gefühl an einer großen Sache dranzusein. An einer Sache, die er nicht zu Ende verfolgen konnte. Aber er würde zumindest helfen.
Plötzlich legte sich eine große Hand auf seine Schulter: »Da ist er ja, der wichtigste Mann im schönen Deutschland!« Thabo Zuma strahlte über das ganze Gesicht und auch Hans Martlow zeigte seine Freude über die Begegnung.
Er sprang auf und umarmte seinen alten Freund: »Und da ist der wichtigste Mann aus Südafrika, Thabo, wie schön. Wären es nur andere Umstände.« Dann stutzte Hans Martlow und sah auf Peter: »Ich dachte, du kommst allein …«
Thabo versicherte seinem Freund, dass Peter in Ordnung wäre. Dann setzten sich die drei Männer an den kleinen Tisch in der Ecke. Ein lustloser Kellner brachte Martlow ein weiteres kleines Pils, in einem weiteren kaputten Glas. Thabo und Peter bekamen jeweils einen lauwarmen Kaffee. Vorsichtig, um nicht einem Neugierigen einen Blick darauf zu gestatten, zog der Südafrikaner die Bilder hervor und zeigte sie seinem Freund. Die Glocke mit Pfeil auf dem Splitterteil war auch Hans Martlow bisher entgangen. Über Peters Erklärungen und den Zusammenhang mit den Urbexern runzelte er die Stirn.
»Die Nazis? Das wird ja immer undurchsichtiger. Da stimmt etwas ganz und gar nicht und mittlerweile denke ich, es wäre das beste, die Finger davon zu lassen.«
»Was?«, Thabo war ein wenig empört, »wie kannst du das sagen? Wenn etwas nicht stimmt, dann müssen wir das herausfinden. Das war doch immer dein Motto!«
Hans Martlow rieb sich mit beiden Händen über das Gesicht, dann antwortete er gequält: »Die Zeiten haben sich geändert. Sie haben mich heute in den Ruhestand verabschiedet.«
Thabo war erstaunt: »Ich dachte, du gehst erst in sechs Monaten in Rente?«
Martlow nahm einen großen Schluck von seinem Pils, verzog das Gesicht und kommentierte die Geschmacksenttäuschung mit: »Zu warm«, dann wandte er sich wieder an Thabo und Peter: »Tja, heute Morgen haben sie die Sonderkommission aufgelöst. Akte ›Europaflughafen‹ offiziell geschlossen, schlimmer Unfall, Gasexplosion, blablabla und so weiter. Im gleichen Atemzug mussten wir alle eine Geheimhaltungserklärung unterschreiben. Zusätzlich zu unserem sowieso schon bestehenden Amtseid. Dann haben Männer von irgendeiner Behörde, von der ich noch nie gehört habe, alle Unterlagen eingesammelt. Die Daten abgezogen und alle Informationen auf unseren Rechnern gelöscht. Selbst handschriftliche Notizen mussten abgegeben werden. Ich und ein paar andere, die ebenfalls kurz vor der Rente standen, wurden kurzerhand früher in den Ruhestand geschickt. Als Dankeschön für die gute Arbeit. Das kam vollkommen überraschend und eine dicke Prämie gab es noch oben drauf. Die jüngeren Mitglieder der SoKo bekamen neue, bessere Stellen. Da werden einige die Karriereleiter regelrecht hinauffallen.«
Thabo wusste nicht, was er dazu sagen sollte, er kannte Hans Martlow nun schon sehr lange. Sie hatten sich bei einem Einsatz kennengelernt und er verdankte ihm unter anderem sein Leben. Das waren damals schlimme Zeiten gewesen und Hans war im Zuge eines EU-Hilfsprogramms nach Südafrika gekommen. Seit dieser Zeit hatten die beiden Männer regelmäßig Kontakt und es war eine echte Freundschaft zwischen ihnen entstanden.
Peter traute seinen Ohren nicht: »Die haben Sie zwangsverrentet? Dürfen die das?«
Nun schien Hans Martlow doch amüsiert: »Oh, das ist keine Frage des Dürfens, sondern des Könnens. Was sollte ich dagegen machen? Meine Frau wird überglücklich sein, wenn sie das hört, und die Prämie wird uns schneller als gedacht den Traum vom eigenen Wohnmobil erfüllen. Wir wollten immer schon gemeinsam durch die Welt reisen. Ehrlich gesagt werde ich das so schnell wie möglich machen.«
Thabo wollte ansetzen, aber Hans unterbrach ihn: »Tut mir leid, aber ich werde dir dabei nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn jemand wüsste, dass wir Kontakt haben und ich dich mit Informationen versorge, dann adieu Rente, adieu Wohnmobil, adieu Freiheit. Und das wegen eines ›Unfalls‹ …«
Peter hatte seine Augen weit aufgerissen: »Aber wie kann das sein? Wieso wird das ausschließlich als Unfall behandelt? Das ist eine Frechheit, das ist … eine Lüge!« Er lehnte sich auf dem unbequemen Kneipenstuhl zurück.
»Ich würde nicht Lüge sagen, sondern eher Notlüge«, antwortete Thabo gelassen. Dann trank er zaghaft einen Schluck seines Kaffees und fuhr fort: »Was sollten die Behörden sonst machen? Sie haben offensichtlich nichts Konkretes. Aber die Menschen wollen Antworten. Die Unfalltheorie sorgt dafür, dass die Situation nicht eskaliert. Niemand gerät in Panik und das Leben geht bald wieder seinen normalen Gang.«
»Und wenn wir denen unsere Entdeckung mitteilen?«, drängte Peter weiter.
Mit einem besorgten Blick auf Hans erklärte Thabo: »Wie stellen Sie sich das vor? Erstens können wir denen nicht sagen, woher wir unsere Informationen haben. Und zweitens sind das alles nur Vermutungen, es gibt keine Beweise. Die Unfallgeschichte ist bereits offiziell. Keine Regierung der Welt würde jetzt einen Rückzieher machen. Nicht aufgrund von unseren vagen Spekulationen.«
Peter stöhnte: »Also sollten wir versuchen, mehr herauszufinden.«
»So sieht es aus«, antwortete ihm Thabo.
»Seid auf jeden Fall vorsichtig. Entweder die haben die Ermittlungen wirklich eingestellt, oder die Untersuchungen laufen inoffiziell weiter. In beiden Fällen wären die von eurer Einmischung nicht begeistert«, sagte Hans Martlow.
Thabo hatte verstanden: »Du hast sicher recht, aber ich kann die Angelegenheit nicht einfach vergessen.«
Martlow nahm nochmals einen kräftigen Schluck Bier, dann antwortete er: »Ich wusste, dass du das sagst. Wenn dem so ist, dann solltest du zumindest alles erfahren, was ich weiß. Mehr kann ich aber nicht für dich tun.«
Thabo nickte mitfühlend und Peter fragte sich gerade, ob er nicht genau diese Szene aus einem der zahllosen Spionage-Thriller kannte. Er rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl und blickte zur Tür. Hoffentlich ging gerade wieder einmal seine Fantasie mit ihm durch – anderenfalls würde jetzt sicher in der nächsten Minute ein »Killerkommando« diesen Hort der Ungastlichkeit stürmen. Aber die Tür der Kneipe blieb geschlossen und Hans Martlow erzählte ihnen von den Ermittlungen. Im Prinzip erfuhren sie nichts Brauchbares, bis Hans auf das Video des kleinen Mädchens zu sprechen kam.
»Sie hat die Explosion überlebt, obwohl sie so dicht dran war?«
»Ja«, antwortete Hans mit leiser Stimme, »obwohl ihre Mutter regelrecht zerfetzt wurde, hatte die Kleine keinen Kratzer. Aber das war noch nicht alles.« Instinktiv rückten die Männer näher zusammen, als Hans flüsterte: »Wir konnten feststellen, was sie nach der Explosion in der Hand hielt.« Er machte eine kleine Pause, die anderen blickten wie gebannt auf ihren Kontakt, der schließlich noch leiser fortfuhr: »Es war Schnee …«
Wie aus einem Mund riefen Peter und Thabo: »Schnee?«
»Herrgott«, entfuhr es Hans, »geht's vielleicht noch lauter?«
Betreten hielten sich die beiden die Hände vor den Mund.
Hans winkte ab und sprach ungeduldig weiter: »Ja, Schnee. Wir haben keine Ahnung, wo sie den herhatte. Immerhin ist jetzt Mai. Irgendwer von diesen ›Oberverantwortlichen‹ faselte etwas von vereisten Tragflächen und ungewöhnlichen Flugbahnen, die dieses Eis von dort genommen haben könnten, quasi direkt in die Hand des Kindes. Aber das hört sich für mich vor allem nach einem verzweifelten Erklärungsversuch an.«
Martlow leerte sein Bierglas und kramte in seinem verknautschten Mantel. Dann legte er einen kleinen Zettel auf den Tisch: »Name und Adresse des Mädchens. Die Kleine hat bisher nicht gesprochen. Auf die Fragen unserer Ermittler hat sie nicht reagiert. Einzig die Zeichnungen, von denen ich dir eine gefaxt habe, waren eine Art Antwort. Falls du mit ihr sprechen willst … Wäre nett, wenn du nicht erwähnst, dass du die Anschrift von mir hast. Und hier …«, er zog einen Briefumschlag aus der Innentasche seines Mantels und legte ihn vor Thabo auf den Tisch, »das war der erste vorläufige Bericht unserer Bomben- und Sprengstoffexperten zum Verlauf der Explosionen. Wurde später als falsch deklariert. Könnte für dich interessant sein. Betrachte es als Abschiedsgeschenk.«
Damit stand er auf und auch Thabo erhob sich. Die beiden Männer umarmten sich und Hans Martlow sagte ernst: »Pass auf dich auf!« Dann drehte er sich um und verließ das Lokal. Vor der Tür drückte er dem Kellner, der gerade eine Zigarette rauchte, zehn Euro in die Hand und verschwand anschließend in der Menge.
Kapitel 3
Tagebucheintrag, November 1936
Ein grandioser Durchbruch! Das Projekt wurde vom Führer im Zuge seines Vierjahresplans als »kriegsentscheidend« eingestuft. Somit steht der weiteren Entwicklung nichts mehr im Wege, der Zugriff auf alle benötigten Ressourcen ist sichergestellt. Heute Treffen mit Reichsführer-SS Himmler und dem Referenten für Bauangelegenheiten Kammler auf der Wewelsburg. Der Umfang meiner Unterlagen füllt mittlerweile zwei Lkws …
Deutschland, 10. Mai 2017, nachts
Peter war noch immer fassungslos. Thabo und er hatten die Kneipe kurz nach Hans Martlow verlassen. Zügig waren sie durch das Gewirr von Straßen zurück in ihr Hotel geeilt, es war mittlerweile Nacht. Thabo hatte noch vor seinem Gespräch mit Hans Martlow mit den zuständigen Behörden gesprochen und einen ganzen Stapel Papiere zum Ausfüllen überreicht bekommen. Wenn die Formalitäten erledigt wären, sollte er zurück nach Südafrika.
Für die Vertreter der verschiedenen Nationen hatte man Hotelzimmer zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Katastrophe am Europaflughafen hätte Peter keine Chance gehabt ein eigenes Zimmer zu bekommen. Mainz und Umgebung glichen momentan einem Hexenkessel, die Gebiete um die Unglücksstelle liefen fast vor Menschen über. Neben den Regierungsvertretern und Presseleuten waren viele Angehörige der Verunglückten angereist. Außerdem wimmelte es überall von Sicherheitspersonal.
Thabo hatte am Hoteleingang für Peter gebürgt. Als Vertreter einer der »betroffenen Nationen« – eine Wortwahl, die mittlerweile sowohl die Presse als auch die Politik verwendete – war er mit den entsprechenden Sicherheitsausweisen und Berechtigungskarten ausgestattet. Peter gehörte jetzt de facto zu Thabo Zumas Stab. Im Hotelzimmer angekommen, hatte er zuerst einen kleinen Whisky mit Cola aus der Minibar getrunken, während Thabo sofort den Umschlag von Hans Martlow aufgerissen hatte. Nun saßen sie brütend über dem kurzen Bericht.
Thabo starrte auf die Papiere vor sich und runzelte die Stirn: »Das ergibt keinen Sinn. Laut diesen Unterlagen hat die erste Explosion das südafrikanische Flugzeug erfasst.«
Peter sah die Trauer in seinem Blick und sagte: »Das Flugzeug, in dem Ihre Freunde saßen?«
Thabo nickte und schüttelte sich kurz, so als wolle er die trüben Gedanken vertreiben, dann fuhr er fort: »Die ersten Ergebnisse sahen so aus, als wäre ein Sprengkörper in der Maschine explodiert. Als hätte der Airbus seine eigene Bombe im Gepäck gehabt. Obwohl die Maschine im Ankunftsring von Terminal 2 stand, als sie explodierte, folgte die nächste Explosion in Terminal 1. Dort, wo auch unser ›Schneemädchen‹ war, also weit weg von der südafrikanischen Maschine. Erst danach gab es eine Explosion in Terminal 2, in der Besucherlounge. Und dann flog fast das komplette Terminal 3 in die Luft. Das war Explosion Nummer vier. Die Löscharbeiten waren schwierig und es wurden besondere Techniken angewandt, um die Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Die Ermittler spekulieren an dieser Stelle, ich zitiere: ›Wäre ein Angriff aus der Luft erwiesen, dann würde alles für die Explosion einer Fliegerbombe sprechen.‹ Und so weiter. Im Prinzip steht hier nichts von einem Unfall, insbesondere nichts von einer Gasexplosion. Dieser erste Bericht spricht sich eher für einen Anschlag aus.«
Peter stöhnte auf, während sich der Südafrikaner wieder in den Bericht vertiefte.
Kurz darauf sprach Thabo erneut: »Eine weitere Explosion fand im Eingangsbereich des neuen Terminals 4 statt. Da hier nur der Rohbau steht, gab es zum Glück keine Opfer. Auch die Schäden am Gebäude hielten sich in Grenzen. Dann soll es erneut Detonationen in den Terminals 1 und 2 gegeben haben. Dieses Mal, vermutet man, waren dann auch die Gasleitungen betroffen. Und dann, vollkommen absurd für mich, gab es zwei Explosionen am Rande des Flugfelds, weit ab von Menschen und Flughafenequipment. Das sind die Krater, die die Behörden in ihrem offiziellen Bericht als Resultat einer unterirdischen Gasexplosion bezeichnen. Komisch nur, dass in diesem Protokoll«, Thabo wedelte mit den Blättern in der Luft, »steht, dass diese Explosionen nicht von innen nach außen stattgefunden haben, sondern sich überirdisch ereignet haben müssen. Was sagt man dazu?«
Peter murmelte einen bösen Fluch, dann straffte er sich und fasste das Gehörte zusammen: »Wir haben laut diesem ersten vorläufigen Bericht neun Explosionen, die alle kein Unfall waren, sondern von einem Sprengkörper, also einer Art Bombe, verursacht wurden.«
Thabo nickte: »So sieht es aus. Alles passierte zwar ganz schnell hintereinander, aber an voneinander weit entfernten Standorten des Flughafens.«
Peter raufte sich die stoppeligen Haare: »Wie konnte man den Ablauf überhaupt feststellen?«
Der Südafrikaner blätterte zum Anfang des Protokolls: »Hier steht, dass sie zum einen Augenzeugen hatten, zum anderen konnten einige Außenkameras, die nicht vom Stromausfall betroffen waren, Aufschluss geben.« Er schwieg und betrachtete angestrengt die Seiten vor sich.
Peter beobachtete ihn eine Weile, dann fragte er: »Was ist? Was haben Sie entdeckt?«
Thabo sah ihn an und stieß hörbar die Luft aus: »Ich frage mich, was das soll? Das Ganze wirkt irgendwie«, er suchte nach dem richtigen Wort und beendete seinen Satz mit: »dilettantisch.«
Peter wollte etwas erwidern, aber Thabo fing schon an, sich zu erklären: »Sehen Sie, wir haben einen ›genialen‹ Attentäter, ich sage das einmal ganz provokativ. Derjenige ist in der Lage, neun Sprengsätze in einem der sichersten Flughäfen der Welt zu zünden, ohne dass irgendwer das verhindern kann. Von dem oder den Tätern fehlt bisher jede Spur. Und dann, dann finden diese Explosionen so unorganisiert statt. Eine hier, eine da. Wozu? Wieso zwei Explosionen am Ende des Rollfeldes, anstatt Terminal 4 oder ein Verwaltungsgebäude zu vernichten? Warum nicht gezielter an neuralgischen Punkten, wie zum Beispiel direkt bei den Kerosintanks?«
Peter verstand, auch sein Gehirn arbeitete jetzt auf Hochtouren: »Sie haben recht! Als ob unser Täter weiß, wie es geht, aber nicht weiß, was er eigentlich will. Eigentlich macht nur die erste Explosion, die Ihrer Maschine, den Eindruck, gezielt stattgefunden zu haben.«
Thabo sah den jungen Deutschen mit einem eigentümlichen Blick an. Dann lief er ebenfalls zur Minibar und angelte ein kleines Fläschchen heraus: »Meine Güte, was sind das denn für Zwergengefäße? Ich habe schon Reagenzgläser gesehen, die größer waren.« Damit schraubte er den Deckel ab und trank das bernsteinfarbene Etwas in einem Zug.
Peter hatte ihn beobachtet. Fast erwartete er, dass Thabo das kleine Fläschchen mit seiner großen Hand zu Staub zermahlen würde. Aber der Südafrikaner stellte das Glasbehältnis vorsichtig auf den Tisch.
Peter stellte eine weitere Frage: »Warum gibt es keine Bekenner? Was nützt ein Attentat, wenn die Welt nicht erfährt, warum?«
Thabo seufzte: »Vielleicht wartet der Attentäter noch auf den richtigen Zeitpunkt?«
Peter gab ein Brummen von sich, die Antwort gefiel ihm nicht.
»Woher kommt der Schnee in der Hand des Mädchens?«
Thabo musste erst Peters Gedankensprüngen folgen, dann antwortete er müde: »Ich habe nicht die geringste Ahnung.«
Der junge Deutsche wollte die nächste Frage stellen, aber Thabo winkte ab: »Keine Fragen mehr für heute. Ich muss schlafen. Sie können es sich auf der Couch bequem machen. Vielleicht meldet sich bis morgen ihr Urbexer-Kontakt zurück. Dann sehen wir weiter. Für heute sage ich nur noch: »goeie nag!«
Deutschland, 11. Mai 2017
Peter Kromus und Thabo Zuma saßen in ihrem Mietwagen. Dieses Mal ging es nach Offenbach, das östlich von Mainz lag – dort wohnte das »Schneemädchen«. Thabo hatte am Morgen mit dem Vater, Gerhard Warneck, wegen eines Termins telefoniert. Jetzt lenkte Peter, der sich erboten hatte zu fahren, den Wagen sicher in das familienfreundliche Neubaugebiet, in das ihn das Navi lotste.
Nette kleine Häuser für nette kleine Familien, dachte er. Ihm graute ein wenig davor, gleich auf einen Mann zu treffen, der auf solch schreckliche Weise zum Witwer geworden war. Ganz ohne Vorwarnung, ohne die Möglichkeit, sich zu verabschieden, ohne die Möglichkeit unausgesprochene Dinge endlich zu benennen. Peter schluckte und versuchte sich nichts anmerken zu lassen, als er den Wagen einparkte und den Motor abstellte.
»Was sagen wir jetzt, wenn wir da klingeln?«
Thabo lächelte sanft. Er hatte längst bemerkt, dass Peter weit sensibler war, als er zugab. Ihn freute das. Das zeigte, dass der junge Deutsche ein guter Mensch war.
Er drückte ihm kurz die Schulter: »Lassen Sie einfach mich reden, ich bin ja sozusagen als ›Offizieller‹ hier.«
Peter schluckte den Kloß, der ihm im Hals steckte, herunter und nickte erleichtert.
Als Gerhard Warneck die Tür öffnete, stellte sich Thabo vor und sagte: »Herr Warneck, es tut mir sehr leid, dass wir Sie in Ihrer Trauer stören müssen. Aber wie ich Ihnen schon am Telefon gesagt habe, bin ich ein Vertreter der südafrikanischen Regierung …« Dabei wurstelte Thabo umständlich seinen Pass aus der Tasche, aber Gerhard Warneck winkte nur ab, drehte sich um und erwartete offensichtlich, dass ihm die beiden Männer ins Haus folgen würden.
Thabo trat als Erster ein, danach Peter, der leise die Haustür hinter sich zuzog. Im Gang blieb er kurz stehen und starrte auf die Damenschuhe, die neben zwei rosafarbenen Kindergummistiefeln standen. Im hinteren Teil des Hauses hörte er, wie Thabo eine Frage stellte.
Er vernahm die Antwort von Gerhard Warneck: »Sie hat seither nicht gesprochen …«
Dann hörte er ein Schluchzen. Als er um die Ecke blickte, sah er Gerhard Warneck auf dem Sofa sitzen, am Ende seiner Kräfte und verzweifelt. Thabo hatte ihm eine Hand auf den Arm gelegt und saß einfach nur schweigend daneben. Peter ging wieder zurück in den Gang und erschrak beinahe zu Tode – vor ihm stand plötzlich ein kleines Mädchen. Einer ihrer Zöpfe hatte sich gelöst, der andere war schief geflochten und zerzaust, so als hätte sie ihn selbst gemacht. Die Kleine trug ein einfaches Kleidchen und sah ihn mit ihren großen Augen an. Schließlich hielt sie ihm ein Blatt Papier entgegen. Peter griff danach und sah sich die Kinderzeichnung an. Er kannte das Motiv. Es war die Glocke mit dem Pfeil. Ein ähnliches Bild, wie das, das Thabo von Hans Martlow erhalten hatte. Peter blickte auf die Zeichnung. Das Mädchen stand da, hielt den Kopf ein wenig schräg und beäugte ihn mit neugierigem Blick. Dann sah sie auf die Damenschuhe und wieder zurück zu Peter Kromus, welcher sich kaum zu rühren vermochte. Im nächsten Moment zupfte das Kind an seinem Ärmel und er ging ganz automatisch in die Knie.
Das Mädchen näherte sich seinem Ohr und sagte in einem kaum vernehmlichen Flüstern: »Er ist sehr böse, er hat meine Mama sterben lassen.«
Peters Herz schlug bis zum Hals. Seine Hände fingen an zu zittern, als er das Kind sanft an den Armen berührte und zu sich umdrehte. Er sah in ihre großen Kinderaugen und fragte ganz leise: »Wer? Wer war das?«
Das Mädchen schwieg und betrachte Peters Gesicht. Dann streckte es eine Hand aus und berührte seine Wange. In diesem Moment hatte er das Gefühl ohnmächtig zu werden. Er spürte einen unbekannten Schmerz und hatte den Eindruck eine scharfe Klinge würde in seinem Inneren wüten. Fast hätte er aufgestöhnt, dann war es vorbei. So schnell dieser Schmerz ging, so schnell überkam ihn nun ein neues Gefühl. Eine Welle der Verzweiflung schwappte durch ihn hindurch.
Das Kind nahm die Hand von Peters Gesicht und flüsterte erneut: »Du musst auf dich acht geben. Der Schnee macht ihn unsichtbar.«
Dann trat sie einen Schritt zurück, legte ihren kleinen Zeigefinger auf ihren Mund, zum Zeichen des Schweigens, drehte sich um und verschwand über die Treppe nach oben.
Peter rang nach Luft. Irgendetwas war in seinem Gesicht. Er berührte seine Wangen, es waren Tränen. Tränen, die er vergossen hatte, ohne es zu bemerken. Vorsichtig richtete er sich auf und stützte sich an der Wand ab. Was war hier gerade eben passiert? Langsam begann er wieder, die Stimmen im Wohnzimmer wahrzunehmen.
Aus irgendeinem Grund ließ er die Zeichnung des Mädchens schnell in seiner Jackentasche verschwinden. Er versuchte, sich zusammenzureißen, als Thabo Zuma und Gerhard Warneck in seine Richtung kamen. Thabo warf einen besorgten Blick auf Peter.
»Kommen Sie«, sagte Gerhard Warneck, »ihr Zimmer ist oben.«
Peter folgte den Männern, als sie einen hellen Raum betraten, der eindeutig ein Mädchenkinderzimmer war.
Er sprach fast gehetzt: »Wo ist sie?«
Gerhard Warneck schien erst verwirrt, dann fiel ihm ein, dass Peter bei dem Gespräch im Wohnzimmer nicht dabei gewesen war: »Lisa?«
Peter nickte.
»Meine Eltern haben sie mit nach Süddeutschland genommen, unser Hausarzt meinte, der räumliche Abstand täte ihr gut. Sie spricht nicht …«
Wieder war Gerhard Warneck kurz davor, die Fassung zu verlieren. Thabo wollte Peter eigentlich mit einem tadelnden Blick strafen, aber als er das blasse Gesicht des Deutschen sah, dessen Augen vor Furcht weit aufgerissen waren, unterließ er das.
Er wandte sich an Gerhard Warneck und sagte: »Schon gut, wir wollten uns nur noch die Zeichnungen ansehen, dann gehen wir.«
Der Vater stöhnte verzweifelt: »Sie hat seither nur diese Bilder gemalt. Ich weiß nicht, was ich tun soll …«
Thabo betrachtete in Ruhe die vielen »Glockenbilder«, die überall im Zimmer lagen. Dann gab er Peter ein Zeichen zum Aufbruch und schob Gerhard Warneck vorsichtig aus dem Zimmer.
»Das Kind braucht ein wenig Zeit und Sie auch. Sie sollten jetzt nicht alleine sein.«
Warneck versuchte, gefasst zu klingen: »Mein Bruder und seine Frau sind schon auf dem Weg hierher. Aber danke für Ihre Sorge. Ich hätte Ihnen gerne geholfen. Es scheint alles so sinnlos und ich frage mich andauernd ›Warum meine Frau?‹ …«
Peter war froh, als sie wieder im Auto saßen. Er hatte sich erschöpft auf den Beifahrersitz fallen lassen und kein Wort gesprochen. Thabo war zwar von Peters Mitgefühl gerührt, hatte aber jetzt den Eindruck, dass der junge Mann total durch den Wind war. Als vor ihnen eine Tankstelle auftauchte, schrie Peter plötzlich hysterisch: »Fahren Sie da rein!«
Thabo hätte durch sein kurzfristiges Bremsmanöver beinahe einen Auffahrunfall verursacht. Lautes Hupen begleitete daher sein Abbiegen, kurz hatte er das Gefühl auf den Straßen von Kapstadt unterwegs zu sein. Kaum stand das Fahrzeug, sprang Peter auch schon aus dem Wagen. Thabo sah dem Deutschen kopfschüttelnd hinterher. Er lenkte den Pkw auf einen der eingezeichneten Parkplätze und wartete auf die Rückkehr seines Begleiters. Wieder setzte ein unangenehmer Nieselregen ein, der sich offensichtlich dazu entschieden hatte, zum ausgewachsenen Starkregen zu werden. Plötzlich wurde die Beifahrertür aufgerissen und Thabo wollte Peter deshalb schon zurechtweisen, als er sein immer noch verstörtes Gesicht sah. Ungläubig starrte er auf dessen zitternde Hand, die sich gerade daran machte, eine kleine Schnapsflasche zu öffnen. Der Deutsche nahm einen mehr als kräftigen Schluck und japste anschließend nach Luft.
Thabo entfuhr ein: »Mann, es ist noch nicht mal 12.00 Uhr!«
Peter drehte sich daraufhin langsam zu ihm um und zog die Zeichnung des »Schneemädchens« Lisa aus der Tasche. Wortlos reichte er sie dem Südafrikaner.
Thabo Zuma runzelte die Stirn: »Sie haben eine Zeichnung geklaut? Sind Sie deshalb so aus dem Häuschen?«
»Geklaut? Nein, ich habe sie nicht geklaut, sie hat sie mir gegeben.«
»Wer, sie?«
Peter sah aus dem Fenster und verfolgte den Weg eines Regentropfens, der behäbig über die Frontscheibe glitt. Dann antwortete er mit bebender Stimme: »Das kleine Mädchen, Lisa! Sie hat sie mir vorhin im Haus der Warnecks gegeben.«
Thabos Augen weiteten sich. Bevor er etwas erwidern konnte, begann Peter, ihm von der Begegnung und dem Gespräch mit Lisa zu erzählen.
Kurz herrschte Schweigen und nur das Geprassel des immer stärker werdenden Regens war im Wageninneren zu hören.
Der Südafrikaner räusperte sich und sagte: »Ich hätte nicht gedacht, dass Sie empfänglich sind!«
»Empfänglich? Empfänglich wofür?«
»Na, für die Welt des Unerklärlichen, des Verborgenen, der Geister!«
Peter fühlte sich auf den Arm genommen: »Das ist ein Witz. Sie machen sich lustig«, der Deutsche fing an, zornig zu werden, »ich dachte, Sie sind ein seriöser Polizist …«
Thabo machte ein ernstes Gesicht: »Nun mal ganz ruhig, Herr Kromus. Es war nicht meine Absicht, Sie zu beleidigen. Sie müssen eines verstehen, in meinem Land sind Geister allgegenwärtig. Es ist eine komplexe Welt, die jeder anders verstehen kann. Aber eines ist sicher, die Welt des Übernatürlichen ist in unserem Leben tief verwurzelt und selbst im 21. Jahrhundert in den Alltag integriert.«
Peter hatte eine leichte Gänsehaut, als er Thabos Ausführungen folgte.
Der Südafrikaner fuhr fort: »Ich bin ein Polizist, ganz richtig. Aber in meiner Kultur ist das, was man sehen und erklären kann, nicht das Ende von allem, sondern der Anfang. Es gibt noch mehr.« Thabo lehnte sich zurück und entspannte sich, im Gegensatz zu Peter.
»So einfach? Dann, Mister ›Geisterexperte‹, erklären Sie mir doch mal, was ich da gesehen habe!«
Thabo wirkte unschlüssig, antwortete aber: »Für mich klingt das wie eine Warnung, die vom Unterbewusstsein des Mädchens kam. Gleichzeitig gab Ihnen das Kind auch Informationen, so als wollte es uns bei den Ermittlungen helfen. Wir müssen nur noch verstehen, was diese bedeuten.« Er seufzte.
Peter ging einen anderen Weg. Er verdrängte all die Gefühle, den Schmerz, die Verzweiflung, die er bei seinem Zusammentreffen mit Lisa gespürt hatte, und suchte nach einer Lösung: »Vielleicht hat der Vater gelogen und Lisa war doch im Haus? Ja, das wäre eine Erklärung.«
Thabo runzelte die Stirn: »Das wäre natürlich auch möglich!«
Peter war genervt: »Gefällt Ihnen das nicht?«
Der Südafrikaner blieb ruhig: »Ich weiß nicht recht. Warum sollte der Vater in diesem Punkt lügen?«
Der Deutsche überlegte kurz, dann hatte er eine Idee: »Vielleicht hat er etwas mit der Sache zu tun.«
Thabo verzog das Gesicht und führte den Gedanken weiter: »Und das Mädchen weiß etwas, und er möchte nicht, dass es das ausplaudert. Wäre eine Möglichkeit, aber warum so kompliziert? Er hätte einfach sein Einverständnis für eine Befragung verweigern können. Das hat er aber auch bei den Ermittlern der SoKo nicht gemacht. Also warum das Kind vor uns verstecken?«
Peter kam ins Grübeln: »Sie glauben nicht, dass das Kind im Haus war?«
Thabo glaubte das tatsächlich nicht, antwortete aber diplomatisch: »Der Mann ist Professor für Design. Er war kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Die Trauer um seine Frau war echt. Warum sollte er neun Detonationen auf dem Europaflughafen auslösen und das Ganze, während seine Frau und seine Tochter in der Ankunftshalle stehen? Der Typ kam mir nicht wie ein Irrer vor. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich versuche, den Aufenthaltsort der Tochter zu überprüfen, aber da ich offiziell nicht ermittle, wird das schwierig. Außerdem«, und jetzt warf Thabo einen vielsagenden Blick auf Peter, »gefällt mir die Vorstellung, dass Sie ein ›Empfänglicher‹ sind viel besser.«
Peter stöhnte und nahm noch einen großen Schluck aus der Schnapsflasche: »Hören Sie auf, diese Vorstellung macht mir Angst.«
Thabo lachte. Es war ein offenes Lachen ohne jede Schadenfreude. Dann sagte er: »Empfänglich sein, das ist etwas Gutes. Nur ein Mensch mit einem großen Herzen und der nötigen Sensibilität kann mit dem Übernatürlichen in Kontakt treten. Das ist eine Belohnung.«
Peter griente schief und hielt die Flasche hoch: »Tja, dann bin ich ja ein echtes Glückskind. Prost!«
Die Rückfahrt zum Hotel in Mainz verlief schweigend. Das trübe Wetter passte zur Stimmung der Männer – der Himmel lag grau und schwer über ihnen. Thabo wusste nicht richtig, wo er weitermachen sollte. Er konnte nicht einfach wieder nach Südafrika fliegen, und so tun, als hätte er nichts herausgefunden. Die Zerstörung des Europaflughafens war definitiv ein Anschlag gewesen und kein Unfall. Davon war er überzeugt. Obwohl er eigens nach Deutschland geschickt worden war, um mehr über das Unglück zu erfahren, wurde er gestern von seiner Abteilung telefonisch zurückbeordert. Nach Erledigung der Formalitäten sollte er abreisen. Auch seinen Leuten gegenüber hatte er geschwiegen, denn er brauchte zuerst handfeste Beweise, sonst würde er mit seinen Vermutungen mehr Schaden anrichten als zur Lösung des Falles beizutragen.
Thabo Zuma seufzte leise, da wurden seine Überlegungen von einem eigentümlichen Geräusch unterbrochen. Es war eine ihm vertraute Melodie. Peter fing an, in seinen Taschen zu kramen.
Thabo musste grinsen: »Sie haben die Titelmelodie von Raumschiff Enterprise auf Ihrem Handy? Sie sind wirklich ein Kindskopf.«
Peter Kromus ignorierte diese Bemerkung und sagte stattdessen triumphierend: »SMS! Wir haben einen Termin mit dem ›Mützenverkäufer‹. Gar nicht schlecht für einen Kindskopf.«
Thabo lächelte müde: »Gut, Sie sind der Größte. Dann erzählen Sie mal.«
Peter lehnte sich mit stolzgeschwellter Brust zurück und legte los: »Eigentlich war das ganz einfach, ich hatte ja die E-Mail-Adresse von dem Typen. Also habe ich ihn um ein Treffen gebeten.«
Thabo schien das fast zu einfach: »Der Typ will sich einfach so mit uns treffen? Ich dachte, das mit den Verkäufen und der, nennen wir es mal ›Beschaffung von alten Militaria‹, ist nicht ganz legal. Und da stimmt er einfach so einem Treffen mit einem Wildfremden zu?«
Peter erklärte selbstzufrieden: »Nun ja, ein bisschen Taktik war da schon notwendig. Ich bin kein komplett Fremder für ihn. Auch wenn wir uns noch nie persönlich begegnet sind, verkehren wir doch im gleichen Netzwerk.«
Thabo lachte auf: »Soso, das geheime Netzwerk der sagenumwobenen Urbexer?«
Peter machte eine Grimasse: »Ganz genau«, gab er giftig zurück, »immerhin wären wir nie auf diese Spur gestoßen, wenn es dieses ›sagenumwobene‹ Netzwerk nicht gäbe.«
»Schon gut«, lenkte der Südafrikaner ein, »erzählen Sie weiter.«
Peter warf Thabo einen beleidigten Blick zu, bevor er fortfuhr: »Ich habe ihm gesagt, dass ich jemanden hätte, der an der Schirmmütze interessiert wäre. Daraufhin hat er zurückgemailt, dass sie schon verkauft sei. Meine Antwort war, dass ich und mein Interessent das natürlich wüssten. Deshalb wollten wir den neuen Besitzer der Mütze treffen, um diesem ein sehr lukratives Angebot zu machen. Und für ihn wäre eine hübsche Provision drin.«
Thabo hob die Augenbrauen: »Und Sie denken, wenn er mich sieht, dann glaubt er, dass ich Interesse an einer Nazi-Mütze habe? Finden Sie das nicht ein bisschen abwegig?«
Peter grinste triumphierend: »Nicht, wenn Sie auch nur ein Mittelsmann sind. Sie wären für jeden Interessenten eine hervorragende Tarnung.«
Thabo stöhnte laut: »Sie haben definitiv zu viele Filme gesehen und zu wenig gesunden Menschenverstand zur Verfügung. Hoffen wir mal, dass Ihr Urbexer-Freund uns den Namen seines Käufers nennt, damit wir an weitere Informationen kommen. Wo treffen wir uns?«
Nun wurde Peter doch etwas kleinlaut und rutschte auf seinem Sitz hin und her: »Richtung Straßburg.«
Thabo riss die Augen auf: »Wie bitte? Ich dachte mir schon, dass wir nicht das Glück haben, hier in Mainz auf den Mann zu stoßen. Aber dass wir gleich das Land verlassen müssen? Was wird das, ist Ihr Kollege Franzose?«
Peter druckste ein wenig herum: »Das nicht. Es ist nur so, dass er den Treffpunkt bestimmt hat, und der liegt nunmal im Elsass …«
Thabo war genervt: »Ich mache zur Zeit nichts anderes, als kreuz und quer über die deutschen Autobahnen zu fahren. Jetzt auch noch Richtung Frankreich. Da kommen wir ja nicht vor heute Abend an.«
Peter nickte nur und sagte nebenbei: »Das macht nichts, wir treffen uns erst spät.«
»Und was heißt spät?«
Der Deutsche sah aus dem Fenster und antwortete zögerlich: »Um Mitternacht.«
Thabo war zwischenzeitlich vor ihrem Hotel angekommen. An der Zufahrt zur Tiefgarage des Gebäudekomplexes überprüfte das Sicherheitspersonal ihre Papiere.
Peter nutzte die Gelegenheit, um vom Thema abzulenken: »Eigentlich merkwürdig, dass es immer noch Kontrollen gibt, jetzt, da doch eigentlich offiziell von einem Unfall ausgegangen wird.«
Thabo antwortete: »Die werden Ihnen sagen, dass das die übliche Vorgehensweise ist, wenn so viele Vertreter von ausländischen Regierungen als Gäste da sind. Und jetzt will ich wissen, warum wir uns erst um Mitternacht treffen und vor allem wo genau!«
Kapitel 4
Tagebucheintrag, Juli 1940
Wir siegen auf ganzer Linie! Die Niederlande, Luxemburg und Belgien konnten dank der Weitsicht des Führers innerhalb kürzester Zeit eingenommen werden. Die technische Überlegenheit unserer Truppen ist nicht zuletzt meiner Arbeit zu verdanken – und täglich erreichen mich mehr Anfragen. Ich arbeite Tag und Nacht, um uns mithilfe der Wissenschaft zum Sieg zu führen!
Grenzübergang Deutschland/Frankreich, 11. Mai 2017, 23.15 Uhr
»Mist, ausgerechnet heute!«, Peter war genervt.
Sie hatten nicht mehr viel Zeit, doch seit dreißig Minuten standen sie nun schon in der Schlange vor dem Schlagbaum.
»Warum regen Sie sich auf, wir werden heute Nacht sowieso verhaftet. Entweder gleich hier an der Grenze, weil die meine Papiere nicht anerkennen und ich nicht einreisen darf, oder, und das wäre natürlich viel besser, beim Hausfriedensbruch auf einem Museumsgelände.«
»Unsinn, das sind Zöllner, die suchen Zigaretten, keine südafrikanischen Beamten, die das Elsass besuchen möchten«, sagte Peter mit einer Zuversicht, die er nicht wirklich empfand.
Thabo konnte immer noch nicht glauben, dass er sich auf diesen haarsträubenden Treffpunkt eingelassen hatte. Auch das Peter darauf bestanden hatte, nicht Thabos Mietwagen zu benutzen, sondern einen anderen Wagen auf den Namen Kromus anzumieten, beruhigte den Südafrikaner nicht wirklich.
Peter neben ihm schnaubte verächtlich: »Niemand wird verhaftet, und außerdem ist das kein Hausfriedensbruch. Ich kenne die Anlage. Es gibt quasi keine Absperrung. Man kommt leicht rein und raus. Außerdem machen wir ja nichts kaputt.«
Thabo richtete sich ein wenig in seinem Sitz auf und sah zu Peter: »Sie glauben das wirklich, oder? Ich verrate Ihnen jetzt mal ein Geheimnis: ›Hausfriedensbruch‹ ist es auch dann, wenn das Gebäude nicht durch Stacheldraht und Sprengfallen geschützt ist! Bloß weil kein ›Betreten verboten‹ da steht, heißt das noch lange nicht, dass man sich wie zu Hause fühlen kann.«
Ihre Unterhaltung wurde vom Winken eines französischen Zollbeamten unterbrochen. Er bedeutete ihnen und anderen Fahrzeugen, aus der Warteschlange herauszufahren und die Grenze zu passieren.
»Na endlich«, rief Peter erleichtert, »dann sind wir noch in der Zeit.«
Peter Kromus war froh, dass der Südafrikaner kein allzu großes Theater gemacht hatte, als er ihm offenbaren musste, wo er sich mit diesem anderen Urbexer treffen wollte.
»Der Typ ist eben ein Spinner«, hatte er zu Thabo gesagt, »für den dreht sich wirklich alles um diese Urban-Explorer-Welt. Deshalb fordert er mich quasi heraus. Wenn wir von ihm Informationen wollen, dann müssen wir mitspielen.«
Thabo Zuma hatte die Augen verdreht und die Arme hilflos in die Luft geworfen, dann hatte er sich über kindische Erwachsene ausgelassen und schließlich zugestimmt, Peter zu begleiten. Dieser kannte das Terrain des Treffpunkts – es war ein Freilichtmuseum mit allerlei alten Militärfahrzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg und aus der Zeit des Kalten Krieges. Es gab aber auch eine große Halle mit wertvollen Ausstellungsstücken und verschiedene kleinere Gebäude mit Dioramen. Als Besucher hatte man hier den Eindruck eine Filmkulisse zu betreten. Schaufensterpuppen trugen die Uniformen der Alliierten und deutschen Soldaten. Kriegsmaterial, darunter Flugzeugteile und Bombenreste, lagen zwischen den aufgestellten Panzern und Haubitzen. Ein nachgebautes Feldlazarett, viele Informationstafeln und alte Dokumente leisteten ihren Beitrag, die schreckliche Zeit des Zweiten Weltkrieges nicht einfach zu vergessen und den Opfern des Krieges zu gedenken – ein privater Verein hatte es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Teil der Geschichte am Leben zu halten.
Besonders beeindruckend war der Zugang zu dem Unterstand, der zur Maginot-Linie gehörte. In der kalten Bunkeranlage hatte man mit lebensgroßen Puppen und historischen Gerätschaften den entbehrungsreichen Alltag der Soldaten und der Zivilisten nachgebildet. Peter war beeindruckt gewesen, als er das Gelände das erste Mal, übrigens völlig legal als Besucher, betreten hatte.
Tagebucheintrag, August 1940
Die von den Franzosen entlang der Grenze erbauten Befestigungen aus Beton und Stahl haben unseren Truppen nicht standgehalten. Unsere Panzerverbände stießen durch Belgien, einfach vorbei an der Maginot-Linie! Das Siegesgeheul unserer Sturzkampfbomber hat den Gegner in die Knie gezwungen und meine Männer sind nun dabei, die eroberten Anlagen zu sichten. Meldungen über für meine Zwecke geeignete Bauten sind bereits eingetroffen – ich brenne darauf, bald neue Laboratorien und Forschungsstätten errichten zu können …
Frankreich, 11. Mai, 23.45 Uhr – Museumsgelände nahe Hagenau im Elsass
Mittlerweile war es richtig kalt geworden, Thabo fröstelte. Aber kühle Temperaturen waren nicht sein Problem. Was ihm zu schaffen machte, war der Dauerregen. Er glaubte mittlerweile, dass er während der wenigen Tage hier in Deutschland mehr Regen gesehen hatte, als sein gesamtes Leben über in Südafrika. Er spähte in die Nacht und spürte die penetranten Tropfen auf seinem Gesicht. Seine Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt. Um seine Nervosität in den Griff zu bekommen, probierte er, sich abzulenken. Der Südafrikaner versuchte die Panzer und amphibischen Fahrzeuge, die ihn umgaben, zuzuordnen. Ein deutscher »Tiger« und der berühmte amerikanische »Sherman-Panzer« standen direkt nebeneinander. Auf dem großen Platz nahe dem Eingang konnte er eine russische MIG neben einer ausgemusterten Mirage neueren Datums erkennen.
Was macht Peter nur so lange?, fragte er sich, als ein leises Quietschen an sein Ohr drang. Thabo schreckte zusammen und bewegte schnell den Kopf, dann atmete er erleichtert aus. Das Geräusch kam von den Rotorblättern eines Hubschraubers, der nicht weit seines eigenen Standorts, einsam und verlassen auf einem Grasabschnitt sein Dasein fristete. Die trüben Scheinwerfer, die auf dem Gelände verteilt waren, gaben nicht viel her. Trotzdem konnte Thabo erkennen, dass es sich bei dem Fluggerät um einen russischen Mil-Mi 4 handelte.
Der Südafrikaner kramte in seinem Gedächtnis: Wie war noch mal der Natocodename für dieses Relikt des ›Kalten Krieges‹ gewesen? Weiter kam er nicht, denn neben ihm öffnete sich kreischend die stählerne Seitentür.
Thabo hatte das Gefühl, ihm würde für eine Sekunde das Herz stehen bleiben, dann grinste ihn auch schon ein gut gelaunter Peter Kromus an.
»Sehen Sie, ein Kinderspiel«, flüsterte Peter dem Südafrikaner zu, und gab ihm ein Zeichen einzutreten.
Peter hatte sich über eines der Dachfenster Zugang verschafft. Mit ein wenig Klettererfahrung war das für ihn kein Problem gewesen, der Gerüstbau bot ihm genug Möglichkeiten sicher nach oben und wieder nach unten zu kommen. Thabo betrat beeindruckt die Halle. Wie Peter gesagt hatte, war es den Verantwortlichen gelungen, realistische Szenen aus den Kriegsjahren nachzubilden. Die Halle war gewaltig. Das fahle Licht, das von den Außenscheinwerfern zaghaft seinen Weg durch die wenigen Fenster fand, schaffte eine geradezu unheimliche Atmosphäre. Auch hier standen Panzer und militärische Fahrzeuge. Thabo konnte mehrere Exemplare der 8,8 cm FlaK, einer Flug- und Panzerabwehrkanone der Deutschen, erkennen. Eine »Wespe«, eine alte Panzerhaubitze, ragte hinter den lebensgroßen Nachbildungen mehrerer Militärpferde hervor. Vor ihm lagen Bombensplitter und er musste an die Fotos, die ihm sein Freund Hans Martlow gefaxt hatte, denken.
Sein Blick ging jetzt nach oben. Direkt unter dem Dach baumelte ein gewaltiger Lastensegler. Im schwachen Licht war er fast nicht als Ganzes zu erkennen, sondern wirkte eher wie ein großer Schatten.
Thabo richtete den Blick wieder in die Reihen der Soldaten vor ihnen, Schaufensterpuppen in Uniform »umzingelten« ihn und Peter. Mit der Taschenlampe beleuchtete er ihre Gesichter – vielleicht würde einer von ihnen auch eine Schirmmütze tragen? Eine Schirmmütze der SS mit einem zusätzlichen Emblem neben dem so gefürchteten Symbol des Totenkopfs, das Emblem mit der Glocke und dem Pfeil … Aber Thabo wurde auf die Schnelle nicht fündig.
Die leblosen Puppen standen überall. Fast hatte er das Gefühl, sie würden sich bewegen, wenn er ihnen den Rücken zuwandte, um dann wieder unbeweglich zu erscheinen, wenn er sie mit der Lampe anstrahlte. Peter schien vollkommen fern solcher Gefühle. Obwohl Thabo es nicht gerne zugab, bewunderte er den jungen Deutschen für seine Unbedarftheit. Er selbst hatte ein ungutes Gefühl und witterte Gefahr. Verstohlen betrachtete der Südafrikaner weiter die Puppen. Manche trugen Gasmasken, Ledermäntel und Handschuhe. Niemand hätte auf den ersten Blick feststellen können, ob sich dahinter nicht ein Mensch aus Fleisch und Blut verborgen hielt. Peter summte leise vor sich hin.
»Sie scheinen ja bester Laune«, sagte Thabo flüsternd, hatte aber trotzdem etwas Schärfe in seine Bemerkung gelegt.
Peter zuckte nur mit den Schultern: »Ich bin auch bester Laune. Dieser Typ hat mich herausgefordert. Er war der Meinung, ich würde das nicht bringen. Ich habe es geschafft, jetzt ist er dran. Das war die Bedingung. Wenn ich es hierher schaffe, dann macht er uns mit dem Käufer der Schirmmütze bekannt. Ganz einfach.«
Zu einfach!, dachte Thabo und blickte sich erneut um. Sie hatten die Halle fast durchschritten, als von einer Sekunde zur anderen ein entsetzliches Geschrei, keinen Meter von ihnen entfernt, ertönte. Sie schreckten zusammen, gingen instinktiv in die Knie, als auch schon ein schwarzes Etwas in Richtung ihrer Köpfe flog. Peter schrie schrill auf, das Etwas tat es ihm gleich und verschwand nach oben.
Thabo ächzte und klatschte dem Deutschen auf die Schulter: »Gratuliere, die sind weg.«
Peter schluckte heftig, sein Kopf dröhnte vor Schreck. Ungläubig hauchte er: »Das waren Tauben, oder?«
Thabo hauchte grinsend zurück: »Ja, und Sie haben die Bösewichte mit Ihrem Todesgekreische vertrieben. Respekt.«
Peter ärgerte sich über seine eigene Hysterie, gab aber keine Antwort, sondern zeigte in Richtung einer Tür am hinteren Ende der Halle. Die Männer schlichen weiter und Thabo hatte jetzt noch stärker das Gefühl, dass ihnen die uniformierten Puppen folgen würden. Als sie an der Tür ankamen, konnte der Südafrikaner erkennen, dass es sich um eine massive Stahlvorrichtung handelte. Sie war nicht verriegelt und erfreulicherweise gut geölt.
»Jetzt betreten wir die ›Maginot-Linie‹«, sagte Peter fast feierlich.
Thabo Zuma wusste, von was Peter sprach. Er hätte diesen Ausflug gerne bei Tageslicht und legal unternommen. Die Geschichte Deutschlands, vor allem die beiden Weltkriege und der Kalte Krieg, waren ihm natürlich ein Begriff. Auch wenn er sich selbst nicht als, in dieser Hinsicht, gut informiert bezeichnen würde, so hatte er zumindest aus seiner Schul- und Studienzeit einige Eckdaten parat. Außerdem war Militärgeschichte ein Pflichtfach während seiner Ausbildung gewesen. Heute sollte er also das erste Mal diese berühmte Verteidigungslinie betreten.
Die zumeist unterirdischen Bunkeranlagen, aus der die Maginot-Linie bestand, waren in den Jahren vor 1940 entlang der französischen Ostgrenze gebaut worden.
Feuchte Kälte schlug den Männern aus dem Bunker entgegen. Eine alte Metalltreppe führte sie nach unten. Die Betreiber des Museums hatten kleine Notbeleuchtungen an den Wänden angebracht, aber ohne die Taschenlampen hätten sie nicht viel gesehen. Thabo bereute erneut, dass er nicht als Besucher hier war – auch in der Bunkeranlage selbst hatte man das Leben der Soldaten sehr anschaulich nachgestellt. Schlafsäle und Küche waren getreu der Zeit um 1940 nachgebildet worden. Hier unten hatte man sogar ein eigenes Stromkraftwerk und gewaltige Wassertanks aufgebaut. Es gab Gefechtstürme und natürlich eine Krankenstation, in der eine »Schaufenster-Zahnarztpuppe« mit irrem Blick gerade dabei war, einem armen Gefreiten einen Zahn zu ziehen. Nach ein paar Metern blieb Peter stehen, ein Absperrband markierte für die Besucher, dass der Weg zu Ende war.
»Hier ist unser Treffpunkt.«
Thabo schnaufte verächtlich. Sie saßen auf dem Präsentierteller. Vor ihnen lag eine Art Weggabelung, ein Vorplatz, von dem weitere Gänge abzweigten.
»Wir sollten zurück in den Gang und nicht hier herumstehen.«
Ein Knacken und ein fieses Kichern ließen sie herumfahren, dann ertönte eine unangenehme Stimme, zu der eine nicht minder unangenehme Gestalt gehörte, die sich jetzt aus dem Dunkeln schälte und auf Peter und Thabo zuging. Der Fremde musste der Urbexer sein. Thabo hoffte es zumindest und ärgerte sich, dass er keine Waffe dabei hatte. Im Licht seiner Taschenlampe sah er, dass der Mann seine Haare zu einem Zopf gebunden und ein Tätowierung am Hals hatte, die nach einem floralen Muster aussah. Der Fremde kam näher, grinste überheblich und entblößte makellose Zähne, was Thabo noch mehr beunruhigte. Es blieb zu befürchten, dass Peter den Mann unterschätzt hatte, und der Südafrikaner hoffte daher, dass das Geldverdienen für den Fremden tatsächlich oberste Priorität hatte – jemand, der Gewinne machen will, behandelt potenzielle Kunden pfleglich.
Wieder erklang die unangenehme Stimme des Mannes, dieses Mal an Thabo gewandt: »Und du willst also eine SS-Mütze? Na, das ist mal was Neues!«
Peter Kromus hatte ebenfalls ein ungutes Gefühl, auch er hatte sich den Urbexer anders vorgestellt. Verstohlen betrachtete er sein Gegenüber, doch er musste sich an den Plan halten, und sagte deshalb: »Das ist ein Mittelsmann. Also, was ist jetzt?«
Der Urbexer kniff die Augen zusammen und sprach erneut: »Noch ein Mittelsmann? Das ist ja wie bei den Matrjoschka-Puppen.«
Dann kramte der Fremde in der Tasche seines Ledermantels und zog etwas heraus. Mit äußerster Sorgfalt wickelte er ein Bonbon aus seiner bunten Verpackung und steckte es sich in den Mund. Das Papier ließ er achtlos auf den Boden fallen. Peter hob es auf und wollte eine Bemerkung bezüglich des Urbexer-Codex machen, als die Stimme des Mannes erneut erklang: »Wieso diese Mütze? Ich kann euch eine andere besorgen …«
Peter trat einen Schritt auf den Mann zu: »Mein Freund, wir hatten einen Deal, wir treffen uns hier und du stellst den Kontakt zu deinem Käufer her. Keine Fragen, keine anderen Mützen, keine …«
In diesem Moment peitschte ein Schuss durch den Untergrund, ein zweiter folgte eine Sekunde später. Der fremde Urbexer fiel nach vorne und schlug neben ihnen auf dem Boden auf. Thabo zögerte nicht und schnappte sich Peter. Mit unerwarteter Kraft schleuderte er ihn in einen der Gänge. Dann griff er nach dem Mantel des Fremden und zog ihn zu sich, aus der Schusslinie. Sie hörten Schritte.
»Los, durchsuchen Sie seine Taschen!«, Peter stand unter Schock und Thabo fuhr ihn grob an: »Machen Sie schon, sehen Sie nach, ob er eine Waffe hat.«
In diesem Moment sah Peter, der auf dem Boden saß, eine Stiefelspitze, die um die Ecke linste. Thabo griff nach dem Bein, das in dem Stiefel steckte, und brachte damit den dazugehörigen Mann zu Fall. Dann setzte er nach und ein harter Schlag traf den Fremden mitten ins Gesicht. Der Südafrikaner schnappte sich die Waffe des bewusstlosen Angreifers, trat aus dem Gang und schoss. Es waren zwei Schüsse und zwei Treffer.
Peter saß mit offenem Mund am Boden und hatte das Gefühl, nicht wirklich anwesend zu sein. Seine Ohren klingelten. Thabo zog ihn hoch und schüttelte ihn heftig, in der Hand hielt er immer noch die Pistole: »Reißen Sie sich zusammen, bringen Sie uns hier raus. Schnell!«
Peter erwachte aus seiner Trance. Adrenalin schoss durch seinen Körper, so wie damals, als er in Südafrika auf diesem Schiff gewesen war. Alle seine Sinne schienen schlagartig geschärft – er war ein Urbexer und damit ein Experte im Rein- und Rauskommen. Er nahm sich zusammen, orientierte sich kurz und rannte los. Thabo folgte ihm, hinter sich hörten sie entfernt Schritte. Peter lief durch die Gänge, als wäre er in dieser Anlage zu Hause. Bald erreichte er, über eine schmale Treppe, eine kleine Tür, schickte ein stummes Gebet in den Himmel und dankte seinem Schöpfer, als sich der Türknauf drehen ließ. Sie waren wieder in der Ausstellungshalle. Die Tür war hinter einem alten Radarfahrzeug versteckt, damit hatten sie Deckung. Kein Geräusch war in dem großen Raum zu hören und selbst die aufgebrachten Tauben von vorhin waren, angesichts der Gefahr, verstummt.
Thabos Nackenhaare stellten sich auf. Wie viele Schüsse hatte er in seiner Pistole? Würde es reichen? Er gab Peter ein Zeichen, sie mussten sich zur anderen Seite, Richtung Ausgang, durchschlagen. Dann sah er die Bewegung im Augenwinkel. Eine der vermeintlichen Soldatenpuppen kam mit ausgestrecktem Arm auf ihn zu. In der Hand, die in einem Lederhandschuh steckte, hielt der Angreifer einen kurzläufigen Revolver. Thabo schoss erneut, ohne zu zögern. Für eine Sekunde waren sie gerettet, aber der Schuss hatte leider auch ihr Versteck verraten. Es galt, keine Zeit mehr zu verlieren. Die Kulissen und die Fahrzeuge würden als Deckung reichen, sie mussten hier raus.
Thabo riss Peter hoch, blickte ihm in die Augen und sagte leise: »Lauf Junge, so schnell du kannst«, dann brüllte der Südafrikaner: »Los!«
Peter rannte. Er war noch nie in seinem Leben so schnell gelaufen. Er sprang über die Hindernisse, die ihm im Weg standen, hinter ihm hallten Schüsse. Er war schon fast an der Tür, als ihn brutal ein Faustschlag traf und zusammensacken ließ. Nach Luft ringend blieb er auf dem Rücken liegen. Thabo schrie etwas und Peter sah die Gestalt mit Gasmaske, die sich jetzt direkt über ihn beugte. Sein Widersacher zielte auf ihn. Peters Arm entwickelte ein Eigenleben und tastete hektisch die Umgebung ab, griff nach dem Erstbesten, was er fand, und rammte es tief in den Bauch seines Gegners. Warme Tropfen trafen Peters Gesicht. Es roch metallisch. Erneut stieß er zu. Das Bajonett, das er neben sich gefunden hatte, drang unbarmherzig in den Unterleib des Mannes ein. Peter versetzte ihm einen letzten Stoß und rollte sich zur Seite, um so zu verhindern, dass der leblose Körper seines Feindes auf ihn fiel.
Er bemerkte, dass jemand an seinem Arm zerrte. »Thabo!«, stammelte er, richtete sich auf und folgte seinem Freund.
Eine Minute später spürten sie, wie sich ihre Lungen mit frischer Luft füllten – sie waren unter freiem Himmel. Der Südafrikaner lotste Peter über eine Mauer. Neben einer alten Haubitze, im feuchten Gras kniend, sahen sie zurück zum Museumsgelände.
»Ich denke, wir sind außer Gefahr«, flüsterte Thabo, als ein Knacken ihn herumfahren ließ. Er blickte genau in den Lauf eines Karabiners und dachte: Mauser 98k, das ist das Ende!
Peter Kromus war der Erste, der sprach. Seine Stimme zitterte, als er sagte: »Sind Sie ein Nazi?«
Die Gestalt hinter dem Gewehr bewegte sich. Thabo nutzte die kurze Unachtsamkeit des Bewaffneten, umklammerte dessen Beine und beförderte ihn mit einem kurzen Ruck unsanft auf den Boden.
Merkwürdig, dachte Thabo, der ist ja ganz leicht …
Die Person neben ihm am Boden begann wüst zu fluchen, und Thabo konnte ihr gerade noch den Mund zuhalten, um eine Entdeckung durch die Angreifer, die auf dem Außengelände des Museums ausgeschwärmt waren, zu verhindern. Der Südafrikaner sah verblüfft sein Gegenüber an. Selbst im trüben Licht konnte er erkennen, dass neben ihm eine Frau saß.
Etwas verlegen ob seiner Grobheit wollte sich Thabo schon entschuldigen, aber die Unbekannte mit dem Gewehr kam ihm zuvor: »Was soll das heißen, Nazi? Und was fällt Ihnen überhaupt ein, Sie …«
Weiter kam die Frau nicht, denn in diesem Moment drangen Stimmen über das Gelände. Instinktiv drückten sich die drei an die Mauer und machten sich klein. Die Haubitze bot ihnen zwar Sichtschutz, machte sie aber noch lange nicht unsichtbar.
Die Stimmen kamen näher und einzelne Satzfetzen waren zu verstehen: »Wo sind die beiden hin? … längst über alle Berge … gibt Ärger … wer war der Kaffer bei ihm? Der war ausgebildet … schaffen wir die Leichen weg, ich will nach Hause … Scheiß Wetter!«
Noch eine ganze Weile verharrten die drei schweigend in ihrem Versteck, dann bewegte sich Thabo vorsichtig und flüsterte: »Wir sollten hier verschwinden«, damit reichte er seiner neuen Bekanntschaft die Hand. Die Frau ergriff sie und ließ sich aufhelfen. Sie bedeutete den beiden Männern, ihr zu folgen. Über einen kleinen Trampelpfad, der sie durch ein verwildertes Grundstück führte, erreichten sie einen Feldweg, auf dem ein Auto stand. Die Frau holte die Schlüssel aus ihrer Jackentasche und löste durch Knopfdruck auf die Fernbedienung die Entriegelung der Türen aus. Dann legte sie den Karabiner in den Kofferraum und öffnete die Fahrertür. Thabo und Peter standen unschlüssig vor dem Wagen. Die Frau verzog genervt das Gesicht und meinte: »Was ist? Brauchen Sie eine Extraeinladung oder soll ich sagen ›Steig ein, wenn du Leben willst‹?«
Thabo konnte sich trotz der Umstände ein Grinsen nicht verkneifen. Auch Peter hatte das Filmzitat erkannt, hätte sich aber nie träumen lassen, es einmal aus dem Munde einer siebzigjährigen Dame mit Gewehr zu hören, die ihn damit auffordern würde, in ihren Kleinwagen mit seniorengerechten Voll-LED-Frontscheinwerfern zu steigen, nachdem er einer Horde Nazis entkommen war.
Frankreich, Elsass, 12. Mai 2017, 1.00 Uhr morgens im Haus von Catherine Morel
»Gut, meine Lieben, Zeit sich vorzustellen. Wer sind Sie und was haben Sie auf unserem Museumsgelände gemacht?«
Thabo sah aus dem Fenster des Fachwerkhauses und beobachtete den Garten. Es schien alles friedlich. Peter war in einen der alten Ohrensessel gesunken und hielt sich an einem Glas Calvados fest, der sicher bereits fünfundzwanzig Jahre alt war und mit mindestens doppelt so viel Prozent aufwarten konnte.
Wieder hatte eine Art Schock bei ihm eingesetzt. Er wäre heute beinahe gestorben, man hatte ihn tatsächlich erschießen wollen. Verstohlen blickte er zu Thabo. Der Südafrikaner schien vom Geschehenen unberührt. Peter seufzte vernehmlich, die Gedanken in seinem Kopf überschlugen sich – er hatte einen Menschen getötet! War er jetzt ein Mörder? Aber es war Notwehr gewesen, hatte er denn eine andere Wahl gehabt? Ihm fiel das Auto ein, es stand noch immer etwas abseits des Geländes auf einem großen Parkplatz.
»Wir müssen zum Wagen«, sagte er.
Catherine Morel stöhnte. Der Junge sah nett aus, schien aber nicht besonders schlau. »Sie sollten jetzt besser nirgendwo hingehen, solange Menschen im Umkreis von einem Kilometer herumschleichen, die Sie töten wollen. Womit wir wieder bei der Frage wären, wer Sie sind. Ich kann Sie auch noch einmal mit dem Gewehr bedrohen …«
Thabo öffnete das Fenster und klappte die alten Läden davor zu. So konnte ein ungebetener Gast wenigstens nicht ins Innere des Hauses sehen. Catherine ließ ihn gewähren. Dann kam Thabo auf sie zu und hielt ihr seine Hand entgegen.
Als sie sie ergriff, sagte er: »Mein Name ist Thabo Zuma. Ich bin vom südafrikanischen Geheimdienst und«, er stockte kurz, »bin wohl in eine unschöne Sache geraten.«
Peter hatte den Kopf gehoben und rief: »Geheimdienst? Ich denke, Sie sind Polizist?«
Thabo lächelte etwas verlegen und sagte entschuldigend: »Ich bin kein Agent wie in den Kinofilmen, wenn du das meinst«, er war ganz automatisch zum »Du« übergegangen. Was er und Peter heute durchgemacht hatten, ließ keinen Raum mehr für Förmlichkeiten und Geheimnisse.
»Im Prinzip bin ich Polizist, nur eben mit gelegentlichen ›Sonderaufgaben‹. Zum Beispiel als Mitarbeiter des diplomatischen Dienstes oder des Außenministeriums. Die meiste Zeit sitze ich hinter einem Schreibtisch. Ganz unspektakulär.«
»Aber heute Abend, Sie … du hast gekämpft«, stotterte Peter.
Thabo hob ein wenig verlegen die Schultern: »Nun, an den Ausbildungen und regelmäßigen Trainingseinheiten muss ich trotzdem teilnehmen«, antwortete der Südafrikaner und dachte: Zum Glück!
Peter blickte Thabo mit großen Augen an und stellte leise die Frage, die ihn seit den Schüssen in der Bunkeranlage der Maginot-Linie am meisten beschäftigte: »Warum wollten die uns umbringen?«
Thabo hatte sich diese Frage selbst schon gestellt. Gerne hätte er dem jungen Deutschen die Antwort erspart, aber was würde das für einen Sinn machen? Geräuschvoll stieß er deshalb die Luft aus und antwortete: »Ich befürchte, dieser Urbexer-Typ hat uns in eine Falle gelockt. Wir sind falsch vorgegangen und haben direkt in ein Fliegennest gestochen.«
Peter schüttelte den Kopf, verbesserte das »Fliegennest« jedoch nicht in ein »Wespennest«, sondern winkte nur ab und nahm einen Schluck Calvados, der ihm ein tiefes Rot ins Gesicht trieb.
Etwas leiser fügte der Südafrikaner hinzu: »Aber nichtsdestotrotz sind wir auf etwas gestoßen, dein ›Urbexer-Freund‹ hat sich offensichtlich über-, und seine Geschäftspartner unterschätzt, denn jetzt ist er tot. Derjenige, der dahintersteckt, ist gut organisiert, er hat eigene Leute und sicher auch ausreichend Kleingeld …«
In diesem Moment klingelte bei Catherine Morel das Telefon. Als sie abhob, konnte man durch den Hörer eine aufgeregte Stimme vernehmen und einen Schwall französischer Worte. Catherine zog die Stirn in Falten und machte ein besorgtes Gesicht. Ihre Antworten waren knapp und als sie auflegte, flüsterte sie ein »Mon Dieu«.
Thabo und Peter sahen ihre Retterin fragend an. Doch, statt eine Antwort zu geben, lief die Französin zum Fenster und öffnete die Klappläden. Die Männer waren ihr gefolgt. Fassungslos starrten sie in Richtung Museum. Die Dunkelheit, die die Bunkeranlage noch bis vor wenigen Minuten umgeben hatte, war einem hellen Licht gewichen, die Ausstellungshalle brannte lichterloh. Schon hörte man die Sirenen der Feuerwehr und entfernte Stimmen von Menschen, die sich etwas zuriefen. Catherine Morel schluckte schwer. Philippe, der Vereinsvorsitzende, hatte eben angerufen. Mit erstickter Stimme hatte er sie darüber informiert, dass es auf dem Museumsgelände brannte. Die Feuerwehr würde es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Auf seine Frage, ob sie bei ihrer Patrouille etwas bemerkt hätte, hatte sie mit »Nein« geantwortet. Ihm nicht die Wahrheit zu sagen, war eine intuitive Entscheidung gewesen. Die beiden Fremden in ihrem Haus konnten das Feuer nicht gelegt haben, das wusste sie. Sie hatte die Verfolger auf dem Gelände gehört, ihre abfälligen Bemerkungen bezüglich des Südafrikaners.
Catherine blickte zu Thabo und vollendete dessen letzten Satz: »… und derjenige hat keinerlei Skrupel.« Kurz zögerte die Französin, dann sagte sie: »Ich habe soeben einen guten Freund belogen. Damit verhindere ich vielleicht, dass diejenigen, die für die Zerstörung unseres Museums verantwortlich sind, je gefasst werden. Vielleicht bin ich sogar noch dazu gezwungen, die Polizei zu belügen!« Catherine verschwieg geflissentlich, dass ihr diese Lüge wesentlich leichter fallen würde, als die gegenüber Philippe – aber das mussten die beiden nicht unbedingt wissen.
Armer Philippe, dachte sie, wie viele der seltenen Exponate waren heute Nacht wohl zerstört worden? Dann räusperte sie sich und sagte leise: »Ich denke, ich verdiene die Wahrheit.«
Thabo hatte sich entschieden auch Catherine Morel gegenüber offen zu sein. Die Frau hatte ihnen vertraut, bei der Flucht geholfen und sie jetzt sogar in ihrem Haus aufgenommen. Sie waren vermutlich noch auf weitere Hilfe angewiesen. Deshalb sagte er: »Ich will nicht länger wie ein bellender Hund um den heißen Brei reden.«
Peter stöhnte erneut auf und Catherine Morel sah den Südafrikaner gespannt an. So hatte sie sich die heutige Nacht eigentlich nicht vorgestellt. Sie war lediglich auf einer harmlosen »Patrouille« gewesen. Seit immer öfter Unbefugte nachts im Museum unterwegs waren, und auch schon einige, der mühsam zusammengetragenen, historischen Stücke gestohlen wurden, hatten die Mitglieder des Vereins beschlossen, abwechselnd nachts Streife zu fahren. Natürlich war der Plan gewesen, die Polizei zu verständigen, wenn jemanden bei seinem Rundgang etwas Ungewöhnliches aufgefallen wäre. Catherine hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, tatsächlich anzurufen – aber was hätte das genützt? Bis die Gesetzeshüter am Museum angekommen wären, hätten sich die vermeintlichen Eindringlinge längst davongemacht.
Thabo räusperte sich und erzählte Catherine von der südafrikanischen Maschine und wie er deswegen zum Europaflughafen geschickt worden war, um dann zu erfahren, dass man bezüglich der Explosion von einem Unfall ausging. Er blickte kurz zu Peter. Der Deutsche nickte ihm zu und er erzählte von Peters Entdeckung des ungewöhnlichen Symbols und von ihrem Gespräch mit einem Informanten – den Namen von Hans Martlow behielt er für sich, ebenso den Namen des Schneemädchens, Lisa Warneck. Als der Südafrikaner von Peters Begegnung mit dem Kind sprach, stutzte Catherine zwar, unterbrach ihr Gegenüber aber nicht.
Erst nachdem Thabo von der Verbindung zwischen dem Glockensymbol, der SS-Mütze und dem Urbexer sowie ihrem Treffen in der Maginot-Linie erzählt hatte, runzelte Catherine Morel die Stirn und sagte nicht ohne ironischen Unterton: »Und da erwachten dann unsere Schaufensterpuppen zu schießwütigen Nazis?«
Bevor er antworten konnte, unterbrach ihn Peter. Dieser war jetzt sehr gefasst und schien um Jahre gealtert: »Hören Sie, Madame Morel, alles, was mein Freund Ihnen erzählt hat«, er hatte ganz selbstverständlich das Wort Freund verwendet, »entspricht der Wahrheit. Wir haben herausgefunden, dass die Zerstörungen auf dem Europaflughafen nicht die Folgen eines Gasunfalls waren, sondern, dass es sich dabei um ein Attentat handelte. Diese Sache heute Nacht war meine Schuld. Ich hatte nicht begriffen, welches Risiko wir eingehen. Die wollten mich umbringen. Und hätten auch Thabo, ohne zu zögern, getötet. Das, was heute Nacht passiert ist, war meine Schuld, und«, Peter stockte, dann sagte er ganz leise, »ich habe einen Menschen getötet …«
Thabo legte ihm kurz die Hand auf die Schulter, und Catherine Morel ließ sich das eben Gehörte noch einmal durch den Kopf gehen. Nicht ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass, sollte die Geschichte stimmen, sie sich damit soeben wieder einmal in Gefahr gebracht hatte.
Ein guter Freund hatte ihr einmal gesagt, dass in dieser Welt nichts einfach so passieren würde, dass alles einen Sinn hätte. Aus irgendeinem Grund war sie heute Nacht draußen vor dem Bunker gewesen. Und aus irgendeinem Grund hatte sie beschlossen, selbst nachzusehen, anstatt auf die Polizei zu warten. Dann hatte sie in die klugen Augen dieses Afrikaners geblickt und innerhalb weniger Sekunden eine Entscheidung getroffen, die ihr sicherlich noch Kopfschmerzen bereiten würde. Aber den einfachen Weg hatte sie sowieso selten gewählt. Nein, heute Nacht war alles aus einem guten Grund passiert. Ein Gedanke, der Catherine Morel auf seltsame Weise beruhigte. Die beiden Männer würden ihre Hilfe brauchen und sie würde sie ihnen geben.
Catherine schenkte Peter Kromus von dem Calvados nach, reichte Thabo ebenfalls ein Glas der starken Spirituose und nahm sich dann selbst einen gut gefüllten Schwenker.
Sie prostete den beiden Männern zu und sagte: »Herzlichen Glückwunsch, meine Herren! Es scheint, dass Sie die Büchse der Pandora geöffnet haben. Lassen Sie sich das von einer altgedienten Journalistin gesagt sein.«
Kurz schwiegen die drei, dann wandte sich Catherine an Peter: »Zeigen Sie mir dieses Symbol.«
Peter sah fragend zu Thabo, der nickte und meinte: »Gib ihr die Zeichnung, ich denke, sie kann uns helfen.«
Der Südafrikaner hatte sich nur kurz in dem Wohnraum umsehen müssen, um zu erkennen, dass die Journalistin eine sehr gebildete Frau war. Das Zimmer erinnerte ihn an seine eigene kleine Wohnung in Kapstadt. In jeder Ecke standen und lagen Bücher, die Regale an der Wand quollen fast über. Und das Schöne war, dass man den Büchern ansah, dass sie auch gelesen wurden. Überall gab es Exemplare, in denen mit Zetteln und Lesezeichen Seiten markiert waren, dort ein aufgeschlagenes Exemplar eines Nachschlagewerks, neben dem Ohrensessel ein angelesener Roman und auf dem überfüllten kleinen Schreibtisch lag ein E-Reader, dessen Akku gerade geladen wurde. Thabo stand vor einem Regal, in dem dicke Wälzer zum Thema Erster und Zweiter Weltkrieg standen.
Schließlich drehte er sich um und kramte die Unterlagen von Hans Martlow aus der Tasche: »Hier, das habe ich von meiner Quelle«, dann nahm er Peter die Kinderzeichnung mit dem Glockensymbol ab und reichte sie weiter an Catherine, »und das haben wir aus dem Haus des Mädchens.«
Peter, der bereits glasige Augen hatte, meinte dazu bitter: »Vom ›Geist‹ des Kindes, für den ich empfänglich bin, na toll!«
Catherines Lippen umspielte ein feines Lächeln: »Je älter man wird, desto weniger Rätsel hält das Leben für einen bereit. Das liegt daran, dass wir mit den Jahren auf die meisten Fragen auch eine Antwort haben. Deshalb ist davon auszugehen, dass auch alles, was Ihr ›Schneemädchen‹ betrifft, enträtselt werden kann. Wir müssen nur an den richtigen Stellen suchen.«
»Wir?«, warf Thabo ein.
Catherine drehte sich zu ihm um und auf ihrem immer noch attraktiven Gesicht zeichnete sich ein spitzbübisches Lächeln ab: »Ich denke nicht, dass es Ihnen ohne mich überhaupt gelingen wird, das Elsass zu verlassen.«
Er lachte schallend und Catherine begann die spärlichen Unterlagen zu studieren. Nach einer Weile blickte sie auf und lief zu ihrem Regal. Zielsicher griff sie nach ein paar Büchern und breitete sie auf dem Boden aus. Die beiden Männer setzten sich auf den Teppich und Catherine zeigte ihnen, welche Stellen sie nachlesen sollten. Dann schnappte sie sich ihren Laptop und gesellte sich zwischen die Männer auf die Erde. Im Internet zeigte sie den beiden weitere Artikel und Berichte. Zwei Stunden später saßen die drei wieder in den bequemen Sesseln.
»Fällt Ihnen etwas auf?«, fragte Catherine, die mittlerweile einen starken Kaffee für sich und ihre Besucher gemacht hatte.
»Es gibt unzählige Theorien über die ›Glocke‹«, sagte Peter, der sich noch nie so intensiv mit der Geschichte des Dritten Reichs befasst hatte, wie heute. Natürlich wusste er von den Gräueltaten und dem Holocaust, aber davon irgendwann einmal gehört zu haben, war einfach. Anders war es, wenn jemand wie Catherine davon erzählte. Peter hatte bei ihren Berichten mehrmals vor Entsetzen eine Gänsehaut bekommen. Er hatte die Bilder in den Büchern betrachtet, die vor ihm auf dem Boden gelegen waren, die Untertitel gelesen und ihm war übel geworden. Er hatte sich nie wirklich mit der Geschichte seines Landes befasst. Und was wusste er von Thabos Kontinent? Er hatte plötzlich das starke Bedürfnis mehr zu erfahren, die Dinge zu hinterfragen.
Catherine unterbrach seine Gedanken: »Genau, es gibt unzählige Theorien über die ›Glocke‹, dieses Ding taucht immer wieder auf. Mal als Fluggerät, mal als möglicher Antrieb, dann als ›super geheime Supergeheimwaffe‹. Aber es gibt keine Belege, nur Gerüchte! Was ich noch nie gesehen habe, ist das Glockensymbol in der uns vorliegenden Form, also mit dem Pfeil in der Mitte.«
»Und was bedeutet das?«, Peter war hellwach.
Catherine zögerte: »Ich bin kein Freund von Spekulationen, meine Welt ist die Welt der Fakten und sauberen Recherche. Aber wenn ich mir doch mal untreu werden sollte …«
Thabo lächelte Catherine an: »Bitte, tun Sie uns diesen Gefallen.«
»Also schön«, antwortete Madame Morel, »dann könnte man eventuell vermuten, dass diese ganzen Gerüchte einen tatsächlichen Hintergrund haben und dass das Symbol, das Sie entdeckt haben, helfen kann, ein bisher gut gehütetes Geheimnis zu entschlüsseln. Und diese SS-Schirmmütze gibt mir zu denken. Wenn die echt ist, dann hat das Glockensymbol darauf etwas zu bedeuten.«
»Aber wie konnte das so lange unentdeckt bleiben? Und was hat das mit dem Europaflughafen zu tun?«, fragte Peter.
Die Französin streckte sich ein wenig: »Vieles blieb bis heute verborgen, warum nicht auch das? Und was den Europaflughafen angeht – vielleicht bringt die Antwort auf die Frage: ›Was ist die Glocke?‹ auch die Lösung für die Geschehnisse dort.«
Etwas spöttisch sagte Peter: »Sie meinen, für den Anschlag auf den Europaflughafen ist eine alte Geheimwaffe der Nazis verantwortlich?«
»Möglich wäre es.«
»Aber ich dachte, die Nazis wären längst …«, er rang nach Worten und Catherine sprang ein: »Ausgestorben?«
Er nickte.
Um Catherines Mund erschien ein zynischer Zug: »Weil diese Gruppierungen verboten wurden? Ich bitte Sie. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, lehrten mich, dass das Böse nie ausstirbt. Es gibt immer und überall Sadismus, Mord, Gemeinheit und Gier. Wer dahintersteckt, ob Skinheads, eine Neonazi-Gruppe oder andere Fanatiker, kann ich Ihnen nicht sagen, aber unterschätzen Sie niemals die Grausamkeit der menschlichen Natur.«
Peter ließ nicht locker: »Aber wenn es Nazis waren, warum den Europaflughafen in die Luft jagen? Warum ein Ziel in Deutschland zerstören?«
Catherine sah den jungen Deutschen nachdenklich an: »Na, das wäre ja nicht das erste Mal in der Geschichte, dass ein Anschlag im eigenen Land inszeniert wird, um ihn dann später jemand anderem in die Schuhe zu schieben.«
Kurz starrte sie in ihre Kaffeetasse, dann stand sie langsam auf und sah auf die Uhr: »Ich denke, wir können alle etwas Schlaf gebrauchen, wir müssen morgen fit sein.«
Thabo blickte fragend in Catherines Richtung, was diese veranlasste, ihren letzten Satz genauer auszuführen: »Wir werden einen alten Freund von mir besuchen. Er kann uns vielleicht helfen. Dummerweise hat er weder Telefon noch eine E-Mail-Adresse. Also wird das eine ganz altmodische Recherche mit einer langen Autobahnfahrt, Stift und Schreibblock.«
Kapitel 5
Tagebucheintrag, Juli 1941
Unsere Arbeit verläuft überaus erfolgreich. Gegenüber den Entwicklungen anderer Wissenschaftler sind wir um Jahre voraus. Vor wenigen Wochen erreichte mich die Nachricht über ein ähnliches Projekt, welches jedoch gegenüber dem unsrigen lachhaft rückständig ist! Die Geheimhaltung läuft perfekt, niemandem aus dem Kollegenkreis ist unsere Errungenschaft bekannt. Die Erfolge der Luftangriffe auf London und die des Unternehmens Barbarossa sind auch unsere Erfolge. Ich bin stolz, zum Sieg beitragen zu können! Der Reichsführer-SS hat uns die Ehre zuteil kommen lassen, nun das Glockensymbol als offizielles Zeichen unserer Projekte tragen zu dürfen.
Polen, 12. Mai 2017, 17.30 Uhr – im Haus von Jonasch Torwitsch, nahe der polnischen Grenze
Mittlerweile waren Catherine, Peter und Thabo von der breiten Dorfstraße auf einen schmalen Feldweg abgebogen. Das Auto der Französin hatte sie sicher hierhergebracht. Peters Leihwagen war unauffällig vom Parkplatz in der Nähe der Museumsanlage geholt und bereits kurz nach der Grenze, bei einer Außenstelle der Verleihfirma, abgegeben worden. Thabo hatte seine E-Mails abgerufen und sich telefonisch bei seiner Botschaft in Berlin gemeldet. Den Satz Papiere, der für die deutschen Behörden ausgefüllt werden musste, hatte er bereits per Kurierdienst an die südafrikanische Vertretung in Deutschland weitergeleitet. Letztendlich war er in diesem Fall nicht mehr als ein Botenjunge. Wenn die Unterlagen zurückkommen würden, bräuchte er sie nur noch ergänzen und den deutschen Beamten übergeben, damit wäre seine Aufgabe erfüllt. Unter anderen Umständen hätte er sich über die Sinnlosigkeit seiner Anwesenheit geärgert, aber momentan verschaffte ihm diese, in Verbindung mit den Mühlen der Bürokratie, die Freiheit auf eigene Faust ermitteln zu können.
Peter hatte seit dem Grenzübertritt nach Polen nicht mehr gesprochen. Konzentriert hatte er das, was er sah, in sich aufgenommen. Als er am frühen Morgen im Gästezimmer von Catherine Morel gelegen hatte, war der erlösende Schlaf leider nicht gekommen. So hatte er sich noch einmal ins Wohnzimmer geschlichen und einen der dicken Wälzer aus dem Regal genommen, ein Buch über die Geschichte des Dritten Reiches. Er hatte noch lange darin geblättert. Gedanklich ließ er das Gelesene Revue passieren. Jetzt befand er sich also in Polen. Das Land, das von Hitler damals als Erstes angegriffen wurde. Ein Krieg, der mit einer Lüge begann.
Peter dachte an Catharines Worte, dann beugte er sich nach vorne zu der Französin, die auf dem Beifahrersitz saß, um sie nach Jonasch Torwitsch zu fragen: »Und Ihr Freund hat wirklich keine E-Mail-Adresse? Nicht einmal ein Telefon?«
Catherine musste schmunzeln: »Schwer vorzustellen heutzutage, da haben Sie recht. Aber Jonasch sagt, wer mit ihm in Kontakt treten will, der kann ihm einen Brief schreiben oder ihn besuchen, mehr sei nicht nötig. Wer schnellere Wege der Kommunikation benötigt, dem ginge es nur um den Austausch unwichtiger Belanglosigkeiten, damit wolle er seine Zeit nicht verschwenden.«
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752138917
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (März)
- Schlagworte
- Action Drittes Reich Thriller Abenteuer Verschwörung Teleportation V2 Anschlag Glocke Roman Militär Krieg Historisch Fantasy Krimi Ermittler