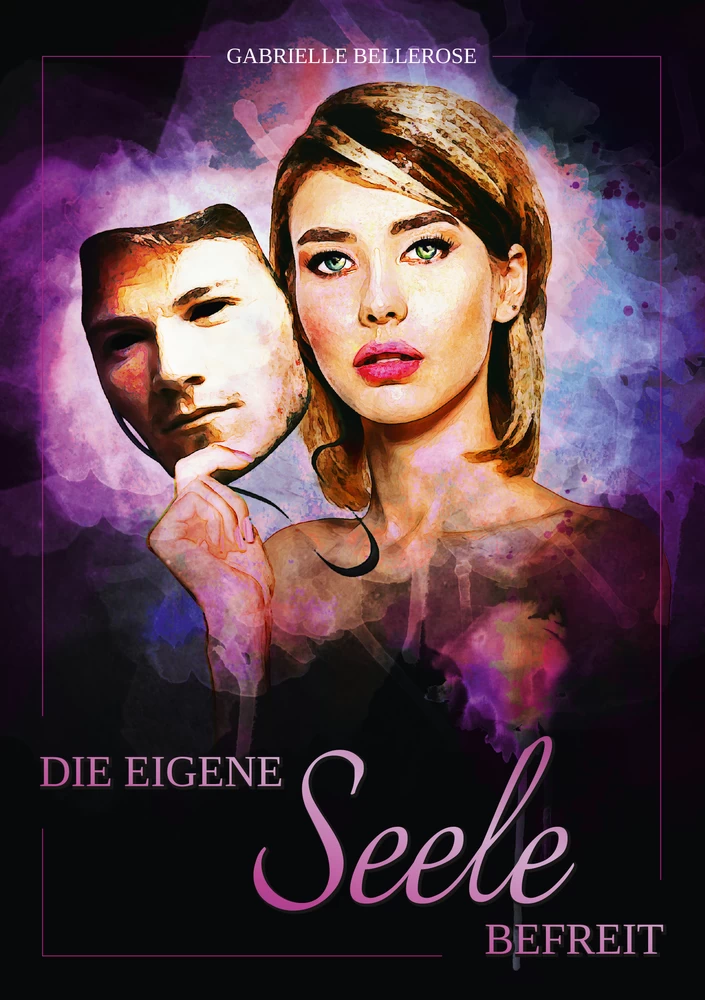Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Der Zug hielt in Lausanne an, es war ein sonniger, freundlicher Januartag nach der Jahrtausendwende. Ich schleppte meine zwei Koffer mit meinen Habseligkeiten ächzend aus dem Zug. Klar, der eine Koffer enthielt natürlich noch einiges Zusätzliches, was ich vermutlich unter normalen Umständen nie brauchen würde. Den Sitzring hatte ich von einer Kollegin erhalten, die Watte und die entsprechend bequem großen Slips besorgte ich mir einige Tage vorher in einem Kaufhaus. Ich war ja gespannt, ob ich die Sachen alle wirklich brauchen würde.
Dann ging ich, wie immer, den Weg des geringsten Widerstands suchend, schnurstracks in Richtung Taxistand. An diesem Tag war wenig Betrieb und sogleich kam auch schon ein sportlich erscheinender junger Mann auf mich zu und fragte:
»Kann ich Ihnen helfen, Madame?«
»Madame« hatte er mich genannt. Mein Herz hüpfte vor Freude. Hocherfreut antwortete ich ihm in rassenreinem Französisch, das ich natürlich noch von meiner Genfer Zeit her perfekt beherrschte: »Ja, vielen Dank, das ist sehr nett! Ich muss zur Klinik. Sind Sie gerade frei?« Er bejahte dies zwar, meinte aber, die Klinik sei ja nicht so weit, ob ich denn wirklich ein Taxi nehmen wolle. Das war ich gar nicht gewohnt von den Taxifahrern, dass sie freiwillig auf eine Fahrt würden verzichten wollen. Aber es amüsierte mich.
Ich wusste natürlich nur allzu genau, warum ich dorthin gefahren werden wollte und ich hatte ausgerechnet an diesem für mich so wichtigen Tag wirklich so etwas von überhaupt keine Lust, mich die fünfhundert Meter mit meinen Koffern in diesem hügeligen Lausanne auf dem Weg in die Klinik abzumühen. So packte er also meine Koffer in sein Auto und wir begaben uns zu besagtem Ziel.
Die Fahrt dauerte gerade Mal vier Minuten bis zur Clinique Beaulieu. Dort angekommen, wusste ich zuerst nicht so recht, ob ich wirklich an der richtigen Adresse war. Der Name dieses Hauses schien durchaus richtig ausgewählt – Beaulieu – Schöner Ort. Treffender konnte man ein Gebäude nicht bezeichnen – nomen est omen. Etwas schüchtern und gleichzeitig respektvoll bewegte ich mich in Richtung Eingang. Das wuchtige, kunstvoll geschwungene Eisentor ging wie von Geisterhand auf und ich betrat andächtig die heiligen Gewölbe des Ortes, der mein Leben so nachhaltig verändern sollte.
Knapp fünfzehn Meter lang und sicher drei Meter breit war der dicke rote Teppich, auf dem sich meine Füße wie in Trance Richtung Empfang bewegten. Das Ganze kam mir wie in einer Hotellobby vor. Die Gemälde an den Wänden, die leicht barock angehauchte Baukunst des Gebäudes und die mindestens acht Meter hohe Eingangshalle erinnerten mich an Fünf-Sterne- Hotels meiner besten Erfahrungen.
Selbstverständlich wurde ich erst einmal auch nicht als Patientin, sondern als Kundin behandelt. Höflich wurde ich gebeten, mich doch noch quelques minutes zu gedulden, bis ich abgeholt und in mein Zimmer gebracht würde. Es vergingen dann aber doch fast zehn Minuten, die ich dort unten staunend dem Treiben dieser Eingangshalle zuschaute, bis mich die Empfangsdame an der Rezeption an eine weitere Frau verwies, die allerdings unverkennbar als Krankenschwester auftrat.
»Je suis Denise«, hatte sich die rund fünfundvierzigjährige und attraktive Frau vorgestellt. Ihre Krankenschwesterhaube ein bisschen keck über das leicht lockige mittellange Haar gezogen, meinte sie dann noch: »Enchantée de vous connaître, Madame.«
Ich merkte, wie ich leicht errötete und entgegnete fast ein bisschen stotternd: »Pareillement, Denise.«
Der Bann war gebrochen. Auf dem Weg in mein Zimmer erklärte sie mir vorab die wichtigsten Dinge, die mir das Leben hier noch ein bisschen angenehmer gestalten sollten. Dann, nach einem kleinen Zwischenhalt im zweiten Stock, betrat ich mein Hotelzimmer.
Denise meinte nur noch, sie wolle mich in aller Ruhe auspacken lassen und käme dann in einer halben Stunde nochmals. Auspacken? Nichts da. Zuallererst die Koffer aufs Bett werfen und dann Fenster auf und bei strahlend blauem Himmel die freie Sicht auf den Genfer See genießen. Das war das, was ich jetzt zuerst brauchte. Mein Genfersee! So lange habe ich dich nicht gesehen. Ein Heimatgefühl beschlich mich kurz. Ich träumte.
Brrrrrrrrrrrrrr! Das Vibrieren meines Mobiltelefons riss mich aus meiner Ruhe heraus. Silvia wollte sich erkundigen, ob ich gut angekommen sei. Ich meinte nur:
»Ja, es ist unglaublich, aber wahr. Ich bin hier.«
An dem Ort, an dem ich am nächsten Tag endlich die lang ersehnte Operation haben durfte.
Danach, wie es sich schließlich für eine Frau gehört – immer diese Klischees schmunzelte ich zu mir – räumte ich alles schön säuberlich in die Schränke, welche dafür zur Verfügung standen. Die Schränke ließen das Gefühl des vermeintlichen Hotelzimmers eindeutig verblassen und das Bett, das darin stand, auch noch dazu. Trotzdem! Es war wunderbar und doch war mir gleichzeitig etwas mulmig zumute. Fast schon ein bisschen Angst stellte sich vor der fünfstündigen Operation ein. ›Komm schon‹, sagte ich zu mir selbst, um mir Mut zu machen. ›Du hast es so lange gewollt. Jetzt ist es endlich soweit. Du bist jetzt hier und es darf kein Zurück mehr geben‹, trichterte ich mir immer wieder ein.
Kaum eingerichtet, kam auch schon die erste von vielen Krankenschwestern herein. Ich erwartete eigentlich Denise, sollte aber dann schnell merken, dass da eine ganze Schar von Krankenschwestern sein musste. Sie stellte sich mit Olga vor und fragte mich, welches Menü ich denn zum Abendessen möge. Ich war platt. Ich beschäftigte mich die ganze Zeit damit, warum ich eigentlich hier war und diese Frau fragte mich, was ich zu Abend essen möchte. Leicht verwirrt, musste ich sie einige Minuten vertrösten, bis ich mich wieder fassen konnte. Dann aber, ja dann war ich bereit. Bereit für alles – auch für das Abendessen. Ich rief nach ihr und bestellte. Olga sprach nur sehr gebrochen Französisch. Sie war aus der Ukraine. Aber sie strahlte eine Herzlichkeit aus, die ihre Französischkenntnisse zweitrangig werden ließen. Hoffentlich hat sie alles gut verstanden, dachte ich noch.
Kurze Zeit später genoss ich dann das, für meine Verhältnisse doch sehr leichte, Abendessen. Aber ich wusste ja, dass das vor einer Operation immer so ist.
Um punkt neunzehn Uhr, ich war gerade dabei in einer Zeitschrift zu schmökern, kam Marie-Thérèse herein. Marie-Thérèse war, zusammen mit Denise, eine der wenigen westschweizerischen Krankenschwestern in dieser Klinik. Mit einer zwar sehr angenehmen, aber doch fordernden Stimme, machte sie mir klar, dass sie mir jetzt einige Medikamente zur sofortigen Einnahme geben müsse und einige weitere für die Nacht bereitstellen wolle. Natürlich hatte sie schon bemerkt, dass ich mich ein wenig sträubte, schon um neunzehn Uhr Medikamente einzunehmen. Schließlich verstand ich ja nicht, weshalb ich das tun sollte, da ja die Operation erst am anderen Tag sei. Sie erklärte aber, diesmal in einem viel weicheren Ton, dass die Operation schon um sieben Uhr morgens beginnen würde und es deshalb nötig wäre, schon etwas am Vorabend zu sich zu nehmen.
Kaum war Marie-Thérèse wieder draußen, kam auch schon der Narkosearzt. Ich dachte noch: ›Ein Verkehr ist das hier...‹ Aber der Narkosearzt. Mann, war dieser Mann schön. Braunhäutig, eine makellose Gesichtskontur und einen Körper hatte diese Schönheit. Kein See auf dieser Welt hat diese hellblaue Farbe mit dem wachen Glitzern und kein Filmstar diese Ausstrahlung. ›Was macht so ein Mensch als Narkosearzt‹, fragte ich mich. Selbst Adonis wäre neidisch geworden ob dieser Tadellosigkeit von Mannsbild.
»Je suis Dr. Samulahawi, votre anésthésiste«, stellte er sich mir mit leicht verschmitztem Lächeln vor.
Klar! Der hatte natürlich voll bemerkt, wie ich wahrscheinlich mit leicht hängendem Kiefer diese Schönheit bestaunte.
Als ich mich wieder einigermaßen fassen konnte – die paar Sekunden kamen mir wie eine Ewigkeit vor – erklärte mir Dr. Samulahawi, wie am nächsten Morgen, sechs Uhr dreißig alles vonstattengehen sollte. Ich konnte nur halbherzig zuhören, so sehr war ich von diesem Mann fasziniert. Aber irgendwie gelang es mir dann doch, noch zwei unbedeutende Fragen zu stellen, bevor er sich dann wieder von mir verabschiedete, nicht ohne mich vorher noch zu beruhigen:
»Il ne faut pas vous inquiéter – tout se passera bien.«
Ich solle mir keine Sorgen machen, es werde schon alles gut gehen, versuchte er mich zu beruhigen. Den Worten dieses Mannes MUSS man einfach glauben.
Fünf Uhr: Die Krankenschwester weckte mich sanft und sagte, ich solle jetzt das Schlafmittel einnehmen, das mich schon ein wenig beruhigen sollte. Von beruhigen spricht diese Frau. Dabei bin ich erstaunlicherweise die Ruhe selbst – noch. Doch das sollte sich kurze Zeit später akut und ziemlich dramatisch ändern.
Um sechs Uhr fünfzehn kamen mich eine Krankenschwester und ein Krankenpfleger in meinem Zimmer abholen. ›Aha, es gibt also auch männliche Krankenschwestern hier‹, dachte ich grinsend. Die beiden schoben mich sehr behutsam mitsamt meinem Bett in den Vorraum des Operationssaals. Ihre Namen hatte ich nie zu Ohren bekommen. Wahrscheinlich wirkte das Dormikum schon ein bisschen. Dort wechselte ich noch selbst auf den OP-Schragen, wie in der Schweiz diese Liege genannt wird. Mit meinem Gewicht war es besser, dieses noch selber zu tun, denn die Helferinnen und Helfer wären sicher ziemlich gefordert, höchstwahrscheinlich aber überfordert gewesen.
Nun lag ich also auf dieser Operationsliege. Festgeschnallt. Leicht benommen. Aber jetzt klopfte mein Herz wie wild, legte immer wieder einen Hüpfer hin. Ich war aufgeregt, vorfreudig und jetzt auch so richtig ängstlich. Aber trotzdem konnte ich es kaum erwarten. Auf diesen Moment hatte ich jahrelang gewartet, insgeheim vielleicht ein Leben lang.
Neben mir ging eine OP-Schwester, sie war weiß gekleidet und trug einen Mundschutz um den Hals.
»Sie müssen keine Angst haben«, sagte sie in einem Deutsch mit charmantem Akzent, lächelte und legte eine Hand auf meine Schulter.
Ich versuchte, mich aufzurichten um ihr zu erklären, dass ich keine Angst habe, dass ich mich vielmehr freue. Ich schaffte aber nur noch ein schwaches Zucken mit meinem Arm und aus meinem Mund kam ein unverständlich lallendes Gebrabbel. Die Betäubungsmittel mussten schon angeschlagen haben. Aber meine Gedanken waren noch einigermaßen klar. Die Schwester lächelte verständnisvoll und meinte beruhigend:
»Sie werden bald immer ruhiger werden und dann einschlafen. Wenn Sie wieder aufwachen, sind Sie ein neuer Mensch. Dann haben Sie es geschafft.«
Ein neuer Mensch. Das hallte in mir wider, während man mich durch die Schiebetür in den Operationssaal schob.
Mein Körper war ebenfalls in einen weißen Kittel gehüllt. Ein neuer Mensch. Stimmte das wirklich? Ich merkte, wie mir ein wenig schummrig wurde und Bilder vor mir auftauchten.
Dann ein abrupter Unterbruch, den ich allerdings, wenn auch schon leicht benommen, wahrnahm. Der Arzt, der mich operieren sollte! Freundlich fragte er mich, wie es mir gehe. Ich lallte beim Versuch scherzhaft zu antworten:
»Ich hoffe, Sie sind fit so früh am Morgen, ich erwarte ein gutes Resultat.«
Ich wusste nicht mehr, was er geantwortet hatte – weg war ich.
Rund sieben Stunden später:
Ich befand mich im Aufwachraum. Völlig benommen schaute ich meinem Körper entlang nach unten und sah eine zentimeterdicke Schicht von Verbänden in der Mitte meines Körpers.
»Bonjour Madame«, hörte ich die warme Stimme des Professors, der mich operiert hatte.
»Tout s’est bien passé.«
›Tout s’est bien passé‹, hat er gesagt. Alles ist gut gegangen! Ich war nur noch glücklich. Nach einem langen Leidensweg, der mich ein Leben lang verfolgt hatte, hatte ich endlich den großen Meilenstein erreicht, den ich mir so sehr wünschte.
Mein ganzes Leben lief wie in einem Film vor mir ab. Alle diese Erlebnisse und Stationen, die ich durchlaufen musste, um diesen Meilenstein zu erreichen. Aber dann wurde mir bewusst, dass es trotzdem nur ein Meilenstein war – das wahre Leben als Frau begann erst jetzt. Die Höhen und Tiefen, die gesellschaftlichen Probleme, das Gefühls- und Sexleben als Frau. Ich war sehr gespannt darauf, wie sich mein weiteres Leben als Frau entwickeln würde.
Kindheit & Jugendzeit
Schulzeit
Ein kleines Provinzstädtchen im schweizerischen Aargau in einem kleinen Außenquartier. Keine reichen Leute wohnten hier. Alte, teilweise schon renovationsbedürftige Wohnblöcke, wenngleich auch mit viel Grün, da sehr nahe des Waldrandes, prägten – zusammen mit dem damals einzigen städtischen Altersheim – diese recht ärmliche Gegend.
Ich, dazumal noch als Jochen lebend, war für meine erst elf Jahre schon recht groß gewachsen und kräftig. Nicht selten hielten mich die Erwachsenen bereits für dreizehn oder vierzehn Jahre alt. Diese Größe kam mir aber gerade recht, wenn mich die anderen Kinder hänselten, nicht nur weil ich als Deutscher mehr als einmal von den anderen Knirpsen als Hitlerjunge bezeichnet wurde, obwohl ich doch in der Schweiz geboren und aufgewachsen bin und mit Hitler überhaupt nichts am Hut hatte. Aber der Krieg schien ganz offensichtlich noch nicht lange genug vorbei zu sein, so dass die Eltern der Kinder diese natürlich vor allem und allen warnten, was nur irgendwie deutsch aussah oder so tönte. Ich konnte die Abneigung, die diesen jungen Kindern von ihren Eltern eingeprägt wurde, gut spüren und ihr leider nicht entkommen. Klar und deutlich wurde mir zu verstehen gegeben, dass ich gefälligst nur geduldet sei und mich so schweizerisch wie nur möglich zu verhalten habe. Das traf mich, denn ich verstand nicht, was ich denn diesen anderen Kindern angetan hatte. Mehr als einmal rannte ich, als die Schule aus war, direkt nach Hause und ließ mich von meiner Mutter trösten.
Aber es gab noch einen anderen Grund, weshalb die kleinen Bengel, denn es waren vor allem Knaben, mich so dermaßen aufzogen. Sie beobachteten mich, wie ich immer wieder versuchte, mit den Nachbarsmädchen anzubändeln, um mit diesen zu spielen. Nun, ich fand daran überhaupt nichts Schlimmes. Was konnte ich denn dafür, wenn mir die Räuber und Polizeispiele der Jungen nichts sagten. Nein, da war mir bei den kleinen kichernden und geheimnisvoll tuschelnden Mädchen schon viel wohler. Allerdings war es auch recht schwierig, mit diesen jungen Fräuleins regelmäßig in Kontakt zu kommen. Denn diese fragten sich natürlich zu Recht:
»Das ist doch ein Junge, was will der denn mit uns?«
Außer mit Marianne. Mit ihr schien es doch ein wenig anders zu sein. Marianne war klein, zierlich und hatte wunderschönes, langes, glänzendes, braunes Haar mit zwei Zöpfen. So bieder sie auf den ersten Blick schien, so faustdick hatte sie es wohl auch hinter den Ohren. Ihr entging natürlich nicht, dass ich lieber mit den Mädchen spielte als mit den Jungs. Und dann eines Tages, ich kam gerade schlendernd vom Pausenhof und wollte mich schon auf den Heimweg machen, zischelte es hinter einer Hausecke: »Jochen, hey Jochen!«
Ich konnte die Stimme nicht gleich erkennen und schon gar nicht, woher sie kam. Aber dann sprang auf einmal mit einem riesigen Hüpfer Marianne hervor, stellte sich keck vor mich hin und fragte mich scheinheilig, aber doch leicht neckisch und mit spitzbübisch blinzelnden Augen:
»Willst du schon nach Hause gehen?«
Ich stand da, leicht verdattert ob dieser Situation, spürte wie mir das Blut ins Gesicht schoss und stotterte nur:
»n...ein, ne...in. Nicht ... wirklich sofort.«
»Also komm mit«, forderte sie mich auf und nahm mich bei meiner Hand.
Gott, was hatte dieses Mädchen vor? Ich musste zugeben, dass die Situation mich einerseits zwar sehr freute, andererseits mir aber doch ziemlich mulmig dabei war. Marianne zog mich mit entschlossenen Schritten in ein Nachbargebäude, das gerade vollständig renoviert wurde und deshalb eine einzige große Baustelle war. Freilich war es verboten, die Baustelle zu betreten. Aber das kümmerte Marianne nicht im Geringsten. Mit Todesverachtung schob sie die Absperrung beiseite und gebot mir, ihr zu folgen. Erst zögernd, dann ein bisschen mutiger, leistete ich ihr folge. Geheimnisvoll führte sie mich die Treppe hinab in ein Kellergeschoss, in dem es allerdings ziemlich dunkel war. Dann sah ich sie nicht mehr. Plötzlich hielten mir von hinten zwei kleine Hände meine Augen zu, drehten meinen Kopf und ich spürte wie sich ein zarter Mund auf meinen eigenen presste. Und wieder spürte ich wie mir warm, nein heiß im Kopf wurde. Die Temperatur in meinem Kopf war gefühlte fünfzig Grad. Ich konnte nichts sagen! Mein erster Kuss! Ich genoß den Moment. Aber gleichzeitig war da noch etwas anderes. Ich wusste nicht, was es war. Es war etwas in mir, das ich nicht zuordnen konnte. Eine Gefühlskombination von schön und doch irgendwie seltsam.
»Was ist?«, fragte mich Marianne, als ich so sprachlos vor ihr stand.
»Hat es dir nicht gefallen?«
»Doch, doch«, korrigierte ich schnell.
»Gut, dann ist das jetzt unser gemeinsames Geheimnis und Versteck, wenn wir uns treffen wollen«, bestimmte sie.
Die Monate verstrichen und wir wurden uns sehr vertraut. Bis dann die Primarschule zu Ende war. Gleichzeitig zog Marianne fort in einen anderen Kanton. Jetzt hieß es Abschied nehmen. Traurig hockten wir beide in unserem Verlies, küssten uns so innig, wie man das mit elfeinhalb Jahren machte, und lagen uns weinend in den Armen.
So sehr der Abschied von Marianne schmerzte, waren wenigstens die Primarschule mit ihren strengen Lehrern, den fast schon altertümlich anmutenden Hausregeln des Schulareals und die ständigen Hänseleien endlich überstanden. Alle Zeichen schienen auf Neubeginn zu stehen. Das Gymnasium lag auf einer Anhöhe nahe am Stadtzentrum. Jetzt lockte die Kleinstadt und ein erster Hauch von Freiheit flatterte um meine Nase. Weite und Erleichterung. Ich freute mich darauf, der Enge des ärmlichen Viertels täglich ein Weilchen mehr zu entkommen. Zwar wohnte ich noch dort, aber jetzt wenigstens durfte ich in die Stadt zur Schule fahren.
Erster Schultag
Eine Schar von Schülern strömte auf das große Eingangsportal zu, ich mittendrin, immer noch größer als die meisten anderen. Ich war jetzt offenbar Teil des Ganzen – nicht mehr der deutsche Außenseiter, der mit Mädchen spielen wollte. Ich gehörte dazu. Ein berauschendes Gefühl!
Mein Magen fing an zu knurren. Ich hatte vor Aufregung zum Frühstück keinen Bissen heruntergebracht. Mit etwas trockenem Mund eilte ich mit großen Schritten dem Schulhaus entgegen. Plötzlich wurde ich unsanft aus meinen Gedanken gerissen. Ein Rucksack hatte die Unverschämtheit, mich anzurempeln.
»Tschuldigung«, murmelte die Trägerin dieses Ungetüms mit weiß Gott was für Sachen drin. Ein mittelgroßes Mädchen mit braunen Zöpfen, blickte kurz auf. Ich erschrak! War sie es oder war sie es nicht? Doch, sie musste es sein. Ich blickte sie einige Sekunden an, die mir wie eine Ewigkeit vorkamen. Nein, es war doch nicht mein erstes Schulschätzchen Marianne, die ich ja schon monatelang nicht mehr gesehen hatte. Diese hier kannte ich also nicht. Sie musste sich denken:
»Was für ein Lulatsch!« Naja, ein bisschen lulatschig muss ich schon dreingeschaut haben.
Zugegebenermaßen verwirrt ging ich weiter, den anderen hinterher, die steinernen Stufen hinauf und hinein in die kühle Halle. Hier roch es fast ein bisschen modernd. Der Baustil und die Art, wie die Eingangshalle ausgestattet war, ließen keine Zweifel offen: Dieses Schulhaus hatte bestimmt schon unsere Lehrer und deren Väter und Mütter als Schüler gesehen.
»Wo ist denn dieses Klassenzimmer?«, fragte ich mich, suchend die Stockwerke rauf und runter irrend.
Es stimmte schon: Ich hatte noch nie einen guten Orientierungssinn. Sonst wäre ich nicht mindestens zweimal schon daran vorbeigelaufen.
›Ahh, da ist es ja‹, dachte ich erleichtert, als ich den Raum endlich entdeckte.
Das Erste, was mir auffiel, war, dass das Klassenzimmer frisch grün gestrichen war. Der Raum füllte sich schnell mit unbekannten Gesichtern. Einige kleine Grüppchen hatten sich schon, eifrig schwatzend, gebildet. Kannten die sich vielleicht schon von vorher? Einige sicher. Andere hatten sich eben gerade kennen gelernt. Zwischen all diesen, meinen offenbar künftigen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, entdeckte ich auch die Mausaugen und die braunen Zöpfe, die zur eiligen Remplerin gehörten.
»Das ist also auch meine Klassenkameradin!«, sagte ich zu mir.
Auch sie schien mich wieder erkannt zu haben. Zuerst sah sie mich nur kurz an, musterte mich aber danach fast schon aufdringlich. Ich spürte, wie mir wieder die Röte ins Gesicht schoss. Das passierte mir immer, wenn ich spürte, dass mich jemand musterte. War etwas anders an mir? Ich verstand es nicht. Endlich! Mit einem neckischen Kopfdreher, der ihre Zöpfe schwungvoll um ihr Gesicht wedeln ließ, wandte sich ihr Blick von mir ab.
Die Tische waren in Paaren zu zweien hintereinander angelegt und ich steuerte wie von einem Magneten angezogen den Platz vor einem alten Schrank an. Im Augenwinkel immer diese grässliche grüne Wand. Ein kleiner, eher schmächtig wirkender Junge steuerte ebenfalls den Tisch vor dem Schrank an, stutzte aber, als er diesen bereits durch mich besetzt sah. Er blickte sich Hilfe suchend um. Aber ich hatte keine Lust, den Zwerg neben mir zu haben und deutete ihm deshalb auch mit keinerlei Geste an, sich zu setzen. Nein, vielmehr verschränkte ich die Arme vor der Brust und sah ihn bewegungslos aber mit giftig blitzenden Augen an. Verängstigt und verwirrt zottelte er wieder davon und suchte sich anderweitig eine Sitzgelegenheit.
Unwillkürlich hob ich mein Kinn, beteiligte mich jedoch nicht am Stimmengewirr, sondern beobachtete sehr genau, wie sich nahezu von selbst überall heftig gestikulierende Grüppchen bildeten. Klar! Viele der Schüler kannten sich schon von der Primarschule. Witze wurden ausgetauscht, die kommende Fußballsaison diskutiert. Die Mädchen saßen mehrheitlich an ihren Plätzen, beobachteten mit hochgezogenen Brauen das Geschehen. Scheinbar beste Freundinnen tuschelten und kicherten. Wortfetzen und Seitenblicke trafen mich. Die Remplerin schien gerade ihr Erlebnis mit mir ihrer Nachbarin zu berichten – auffallendes Gekicher von dieser. Ich spürte wieder die Röte, die in mein Gesicht strömte und wandte deshalb den Kopf der Wand zu. Nur wenige Sekunden später traf mich etwas an der Schulter und ich vernahm ein Kichern. Langsam drehte ich mich wieder zum Raum, blickte allerdings – wie könnte es anders sein – nur in unschuldige Mienen. Klar, dass das niemand gewesen war. Ich verzog meinen Mund zu einem schiefen Grinsen, so als ob mich das Ganze überhaupt gar nichts anginge und gab scheinheilig vor, etwas in meinem Schulsack zu suchen. Und während ich so eifrig suchte, standen die Buben bereits beieinander, verglichen ihre Schulsäcke, Pausenbrote und vieles andere mehr untereinander. Es war Sommer und alle trugen kurze Hosen. Die teilweise verschrammten Knie zeigten schon deutlich, wer eher der kämpferischen Sorte zuzuordnen war und wer eben weniger. So richtige Buben halt. Aus einigen Hosentaschen zwinkerten verstohlen Zigarettenschachteln hinaus. Ein beschämendes Gefühl beschlich mich. Ich sollte mich wohl besser auch zu den anderen Jungs gesellen aber etwas Unsichtbares zog mich immer wieder zu den Mädchen hin. Warum war das so? Warum sagte es mir nichts, mich unter die Gruppe der Buben zu mischen? Da war es wieder, dieses undefinierbare Gefühl von Anderssein.
Der Klassenlehrer wurde abrupt mitten im Satz unterbrochen. Rrrrrring – die Pausenglocke. Grinsende Kinder erhoben sich und drängten dem Ausgang zu. Buben und Mädchen für sich und auch ich für mich. Pause!
Der Pausenhof füllte sich rasch. Ein paar Jungs verzogen sich hinter einer Weide. Fetzen von bitterem und aromatischem Tabakduft drangen einem hin und wieder in die Nase. Ein lautes Stimmengewirr – viele Grüppchen. Ich stand gelangweilt allein in einer Ecke und beobachtete das Pausentreiben.
Das war sie jetzt also – die große weite Welt? Und ich fragte mich, warum war ich schon wieder allein?
Zögernd machte ich ein paar Schritte auf die Weide zu, hinter der sich die Raucher versammelt hatten. Das war ja irgendwie noch cool, so hinter dem Baum, nur halb versteckt. Doch da sahen mich die Rauchenden herannahen, ich war ja auch kaum zu übersehen.
»Was willst denn du?«, fragte einer der Knirpse provozierend und mit herausforderndem Blick, die Hand lässig in der Hosentasche.
»Ich...«, begann ich leise stotternd. Und da merkte ich, dass ich ja gar nicht wusste, was ich überhaupt wollte.
»Gar nichts«, murmelte ich schnell und drehte wieder ab, jetzt mit hochrotem Kopf.
Betont lässig begab ich mich in eine andere Ecke des Pausenhofes. In meinem Kopf jedoch ratterten die Gedanken. Schon wieder abgewimmelt. Bin ich wirklich so unerträglich? Was ist an mir so anders, dass ich mich bei den Jungs nicht integrieren kann?
›Klar, solche Freunde brauchte ich nicht. Mit den Mädchen wäre mir das gewiss nicht passiert‹, dachte ich so bei mir. Ich versuchte, mir einzureden, dass ja alles gar nicht so schlimm war. Aber es war schlimm! Und es störte mich, dass ich mich nicht integrieren konnte und es störte mich, dass sich die anderen über mich lustig machten und es störte mich, dass ich anders war.
Nein, es war mir nicht egal! Es schmerzte tief in mir drin. Wütend trat ich mit dem Fuß auf den geteerten Platz. Immer wieder die Frage: Warum nur muss ich so sein wie ich bin?
Währenddessen hockten die Mädchen in kleinen Gruppen beieinander, tauschten in leisen Stimmen kleine und große Geheimnisse aus und begannen so, erste Freundschaften zu gründen. Eine etwas Dickliche hockte sich einsam dazu und blickte mit ihrer hohen Stirn schicksalsergeben auf das Treiben, das ohne sie stattfand. Auch sie gehörte nicht dazu. Aber das war mir egal. Zu sehr war ich mit mir selbst beschäftigt.
Ich drehte eine Runde, Hände in den Taschen, die Schultern leicht nach vorne gebeugt, nachdenklich. Ich fühlte mich von den Mädchen angezogen – immer wieder. Unmerklich näherte ich mich der Gruppe, um dann auch gleich wieder verstohlen mich abzuwenden. Ich wurde noch wütender auf mich.
Das Bild meines Vaters erschien jetzt vor meinem inneren Auge, der am Wochenende vor Schulbeginn wieder einmal eines seiner Männergespräche hatte führen wollen.
»Nun wirst du langsam erwachsen Jochen. Männer müssen in dieser Gesellschaft Verantwortung übernehmen lernen. Dazu braucht es Disziplin, Ehrgeiz und einen festen Willen. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Männer sind hart und geradlinig... und nun schau dich an...«
Nie werde ich seinen abschätzigen Blick vergessen. Geradlinig, genau, echte Kerle. Das bin ich dann ja wohl nicht. Immer wieder kam das Thema, wie ein Mann zu sein hatte, zur Sprache. Wofür sollte das gut sein? Wollte er mich zum Rauchen, Brüllen, Springen, laut und hart sein erziehen? Wenn ich doch nur den Mut gehabt hätte, ihm ins Gesicht zu schreien, dass ich nicht so bin, wie er mich haben wollte. Dass ich mich am liebsten mitten unter die tuschelnden Mädchen gesetzt und mit ihnen gelacht und geschwatzt hätte. Aber irgendwie durfte es nicht sein. Ich hätte heulen können.
Schon schauten sie auf, denn ich hatte mich ihnen unbewusst immer mehr genähert, mit einem betont schlurfenden Gang. Die Remplerin stieß ihre Freundin an, ihre Namen hatte ich mir noch nicht alle merken können. Diese schaute auf und grinste, die Mädchen ringsum begannen zu kichern. Nur die Dickliche mit dem fettigen Haar versuchte, freundlich zu lächeln. Erschrocken drehte ich ab. Ich zog mich in mich zurück, dorthin wo auch die Gedanken leiser wurden und nur noch Traurigkeit zurückblieb. Dann fasste ich einen Entschluss.
Die Geschichtslehrerin hatte rot gefärbte Haare, die in Büscheln von ihrem Kopf abstanden. Über den, von Tag zu Tag wechselnden Tönen geschminkten Lippen, umrandete eine kantige Brille ihre Habichtnase und sie trug sehr gerne farbige Kleider.
Kein Wunder zog sie den Spott der Buben in der Klasse auf sich. Sobald sie sich zur Tafel wandte, um eines ihrer beständigen Diagramme zu zeichnen, traf sie eine kleine Papierkugel am Rücken. Nicht immer merkte sie das, aber wenn ja, drehte sie mit einem erschreckten Huch das entrüstete Gesicht der Klasse zu, um dort allerdings in unschuldig konzentrierte Mienen zu blicken. Wandte sie sich dann erneut ihrer Zeichnung zu, ertönte nicht selten ein Huch aus den Reihen hinter ihr.
Frau Huch, wie sie aufgrund ihrer Eigenart inzwischen von uns genannt wurde, hatte es gewiss nicht leicht. Die Buben nahmen sie kaum ernst, freundlich und ein wenig naiv, wie sie war, und die Mädchen, schon beginnend damenhafte Manieren zu erproben, mokierten sich über ihre Kleidungsgewohnheiten und ihre Frisur. Mir hatte es besonders ihre Brille angetan. Allerdings konnte ich mir nicht erklären, warum das so war – brauchte ich selbst doch gar keine Brille. Aber irgendwie zog mich das an.
Die ganze Klasse war überrascht. Für gewöhnlich war ich ziemlich still und brütete oft ein wenig vor mich hin. Ich verhielt mich auch nicht auffällig und beteiligte mich je nach Fach eher wenig am Unterricht. Aber dann erschien ich eines Tages mit einer klobigen Brille auf der Nase zum Geschichtsunterricht. Es war klar, dass ich damit Frau Huch nachäffte. Verwunderte Blicke der Klasse begegneten mir. Als Frau Huch den Raum betrat, und ihr Blick auf mich fiel, fragte sie mit besorgt empor gezogenen Augenbrauen, ob ich beim Augenarzt gewesen sei. Meine Antwort allein in einem überraschten Huch bestehend, hatte durchschlagenden Erfolg.
Die Buben schüttelten sich vor Lachen, die Mädchen lachten ebenfalls laut, während Frau Huch mit säuerlicher Miene und hektischem Schnaufen hinter dem Pult ein paar Dinge aus ihrer Tasche hervorzukramen begann. Ich sonnte mich in der unerwarteten Aufmerksamkeit, die mir nun von den Klassenkameraden zuteil wurde. Das ließ ich mir freilich nicht anmerken, sondern legte mein gewohnt ironisches Lächeln auf und ließ die Brille schnell verschwinden. Mein fast etwas demonstrativ schüchternes Schweigen verdeckte sehr gut meinen inneren Stolz. Es fühlte sich warm und gut an, gesehen und wahrgenommen zu werden. Allerdings sollte dies der Beginn einer Karriere der ganz neuen Art sein.
Ich sah Bilder. Bilder eines Waldes mit einem Teppich aus weichem Moos, Efeu an manchem Stamm. Tannen erhoben sich aus dem Unterholz und hektisches Rascheln unterstrich den bitteren Erdgeruch. Vereinzelte Sonnenstrahlen bahnten sich einen Weg durch das Dach aus Laub und Nadelzweigen. Und da konnte ich es fühlen. Ich war nicht allein. Neben mir atmete jemand. Zwar konnte ich das Gesicht nicht erkennen, es blieb immer im Schatten. Aber der Griff einer zarten, weiblichen Hand, mit dem sie den Arm um meine Hüfte geschlungen hatte, war fest und sicher. Es war fast so, als würde sie mich tragen. Ich konnte ihren Atem spüren. Langsam – ein und aus. Meine Hand lag auf ihrer Schulter. Ich stützte mich auf sie, nur ein wenig. So ließen wir uns in den Frühling tragen. Warm und konturlos fühlte ich mich. Als ich versuchte, den Mund zum Sprechen zu öffnen, versagte mir die Stimme. Ich wollte doch ihren Namen erfragen. Doch beruhigend drückte sie ihre Hand in meine Seite, still ging ihr Atem weiter – ein und aus. Wir gingen nicht auf dem Weg – es gab auch keinen in diesem Wald. Wir brauchten auch keinen. Ich versuchte immer wieder sie anzusehen, aber ich konnte ihr Gesicht nicht erkennen. Es war wie ein Schatten und dies machte mir Angst. Sie roch nach frisch feuchtem Moos. Nein, ich wusste ihren Namen nicht – vermutlich hatte sie keinen. Langsam verblasste ihr Geruch, entschwand mir ihr Griff und ich war wieder allein. »Jochen!« Ich schrak auf. Lächelte verlegen, öffnete ganz die Augen.
»Wie war die Frage?«
»Das war keine Frage.«
»Ach so...« Verwirrt blickte ich um mich, die Gesichter der Kameradinnen mir zugewandt.
Neben meinem Pult standen ein Junge und Herr Rubikon, unser Lehrer für Französisch.
»Das ist Paul.«
Schüchtern blickte der mich an. Ein schmales Gesicht, stille braune Augen. Ich grinste. Paul grinste auch, testend. Zwinkern. Das war gut. Rubikon blickte mich streng an.
»Paul wird ab jetzt neben dir sitzen.«
Der Platz neben mir war frei geblieben, anfangs, weil niemand neben dem Eigenbrötler sitzen wollte, später, weil niemand mehr durfte – man fürchtete den schlechten Einfluss des neuerdings so beliebten wie aufsässigen Jochen. Ich blickte forschend in Rubikons Gesicht. Was wollte der genau? Mich bestrafen? Wegen der nassen Kreide letzter Woche?
»Hast du gehört?«
»Das ist Paul. Paul wird ab jetzt neben mir sitzen«, äffte ich ihn nach, grinste und blickte aus dem Augenwinkel in die Runde. Die Mädchen kicherten.
»Lass den Quatsch!«
Rubikon war nervös, vielleicht fragte er sich, ob das gut gehen würde, den offenbar schüchternen und stillen Paul neben mich, dem zwar ebenfalls stillen, aber bisweilen arroganten Jochen zu setzen. Schließlich war ich nie ganz zu kontrollieren und seit meinem Erfolg mit Frau Huch, fiel mir auch immer etwas ein, an dem sich alle belustigen konnten.
Überrascht zog ich die Augenbrauen hoch.
»Ach, ist das gar nicht Paul? Dann muss ich das geträumt haben, verzeihen Sie, Herr Rubikon.«
Ich zwinkerte Paul nochmals zu und der verzog seine schmalen Lippen zu einem leichten Grinsen. Von der anderen Seite des Raums fing ich Ursels Blick ein. Rubikon, der leicht zu erregen war, schaute mich wütend an.
»Hör auf, schon wieder den Clown zu spielen! Ich verbitte mir das. Und den Paul wirst du bestimmt nicht plagen, sonst bekommst du es mit mir zu tun, verstanden?«
»Verstanden.« Ich nickte Paul aufmunternd zu.
Nein, den würde ich gewiss nicht plagen, der gefiel mir gleich. Paul war sicher einen halben Kopf kleiner als ich, schmal gebaut, feingliedrig und sah aus wie jemand, der kein Wässerchen trüben konnte. Vielleicht konnte er das auch nicht, aber seine grauen Augen strahlten eine tiefe Empfänglichkeit für die fröhlichen Seiten des Lebens aus. Das gefiel mir.
Daheim wich ich Vater aus. Es war wieder mal die Hölle los. Mein Vater musste wegen mir in die Schule. Rubikon hatte ihn einmal angerufen und in die Schule zitiert. Eigentlich war Ursel schuld. Sie hatte irgendwie erfahren, dass Rubikon Pferde liebte. Über alles liebte und wohl auch eines besaß. Das hatte sie mir kichernd berichtet, als wir in einer Pause zusammensaßen. Paul gesellte sich nun manchmal auch zu uns. »Rössliiiii«, hatte sie gesagt, und mit den Augen gerollt. Sie war eines der wenigen Mädchen, das nicht selbst dieser Manie verfallen war.
Natürlich war mir sofort klar, dass daraus ein besonderer Scherz gemacht werden musste. Das war ich mir und meinem mittlerweile erworbenen Ruf als Alleinunterhalter schon beinahe schuldig.
Als Rubikon am übernächsten Tag in die Klasse trat, ertönte aus der Gegend des Schranks ein heftiges Wiehern. Rubikon, gerötete Wangen vom schnellen Marsch durch die Korridore, blickte genervt.
»Jochen!«
Ich tat erstaunt.
»Ist was?«
Rubikon schüttelte das graue Haupt, stieß verächtlich die Luft aus.
»Heute bekommst du gleich einen Eintrag, dass das klar ist.«
Energisch schritt er zum Pult, warf seine Tasche auf den Stuhl, zog die Schublade auf, in der das Klassenbuch aufbewahrt wurde und langte hinein. Blickte auf. Erstarrte. Zog eine Grimasse. Öffnete den Mund, um etwas zu äußern. Währenddessen zog ich grinsend das Klassenbuch aus dem Schrank hervor.
»Das muss gewiehert haben, Herr Rubikon!«
Rubikon war unterdessen vor Ekel erstarrt. Langsam und ungläubig zog er seine braungrün verschmierte Hand aus der Schublade, in der anstelle des Klassenbuchs eine Schüssel voller Pferdeäpfel stand.
Da hatte ich es wohl wirklich übertrieben. Rubikon starrte mich stumm und voller Hass an, stürmte aus dem Klassenraum, Tränen in den Augen, die besudelte Hand dabei weit von sich gestreckt, hochrotes Gesicht und murmelte
»Das wird Konsequenzen haben.«
Die hatte es auch. Unmittelbar nur verhaltenes Gelächter in der Klasse. Irgendwie spürten alle, dass ich zu weit gegangen war. Niemand mochte sich so recht freuen, ich selbst auch nicht. Rubikon hatte fast geweint. Auch Paul lachte nicht. Die Folge davon war der besagte Anruf des Schulrektors bei uns daheim. Zur Strafe hatte ich in den nächsten drei Wochen dem Reinigungspersonal der Schultoiletten tatkräftige Hilfe zu leisten. Von meinem Vater erntete ich seitdem nicht so sehr Wut und Zorn, als vielmehr eine Art enttäuschter Verachtung.
»Und ich dachte, aus dir wird irgendwann noch ein rechter Mann, Jochen.«
Das war sein einziger Kommentar. Aber ich redete mir ein, dass er fast ein bisschen schmunzeln musste. Schließlich war ich doch jetzt ein richtiger Bub.
Unausgesprochen wurde mein Elternhaus für mich noch dunkler als vorher; jedenfalls wenn der Vater da war. Es war, als wäre ich für ihn irgendwie nicht mehr existent. War schon vorher vieles nicht recht gewesen, so war nun eigentlich gar nichts mehr so richtig gut, was von mir kam. Ich war wohl in seinen Augen ... missraten. Ich konnte damals nicht wissen, dass ich ihn völlig falsch einschätzte und wie unrecht ich ihm tat.
Gott sei Dank sah das meine Mutter anders. Bei ihr suchte ich Zuflucht und Geborgenheit. Keinesfalls war Mutter dafür, dass ich den Französischlehrer mit Rossmist versehen sollte und entsprechend tadelte sie dies. Dennoch sah sie wohl, dass solches Verhalten kein Ausdruck eines boshaften Charakters sein musste. Sie sah die Traurigkeit und Sehnsucht in meinen Augen und, dass mein Lächeln ein Ausdruck von Hilflosigkeit war. Mutter verstand mich. Irgendwie. Und dafür liebte ich sie nur umso mehr.
Mutter war immer gut zu mir. Sie hatte ein eigenes Zimmer für sich, Haushaltszimmer nannte sie das. Eine alte Nähmaschine stand dort, ein Bügelbrett und eine Chaiselongue. Ein kleiner Sekretär, auf dem stets frische Blumen in einer Vase steckten, wenn die Jahreszeit es zuließ.
Ich war gerne im Zimmer der Mutter – und sie ließ mich. Manchen Nachmittag verbrachte ich hier, wenn der Vater mir Hausarrest verordnet hatte. Verträumte die Stunden auf der Chaiselongue. Mutter hatte einen Stapel zerlesener Frauenzeitschriften neben den Sekretär gelegt, aus denen sie die Muster für Handarbeiten entnahm. Nur zu gerne durchblätterte ich sie. Kleidung. Ratschläge für Figur und Makeup. Für die Pflege von Hand und Fuß. Frisuren. Ich genoss diese Momente, in denen ich mich immer gut fühlte. Und es sah mich ja niemand. Ich konnte es ganz im Stillen genießen.
Es war wieder einmal Sommer und die Tage waren lang. Die Gänge über dem Schulhof waren nicht mehr einsam, Paul und ich gingen inzwischen wie selbstverständlich gemeinsam in die Pausen. Es hatte sich eine richtige Freundschaft zwischen uns beiden entwickelt. Die Laufbahn des boshaften Schelms hatte ich verlassen – nur gelegentlich noch erlaubte ich mir kleinere Scherze, deren Gutmütigkeit selbst Rubikon nicht mehr zur Raserei zu bringen vermochten. Keine nasse Kreide mehr und auch kein Huch zu Frau Huch. Die Lehrer waren mir dankbar. Ich hatte anderes zu tun. Es war Sommer und sie hieß Susanne. Ihre roten Haare erschienen mir in einem besonderen Licht. Es war irgendwie aufregend und es schien mir auch selbstverständlich. Trotzdem war da etwas, was ich nicht zuordnen konnte und was sich immer wie ein drohender Schatten zwischen mich und mein Umfeld stellte.
Dieser Sommer ist Körperzeit. In meinem Gesicht erschienen die ersten Züge der Männlichkeit. Unter Susannes Bluse zeichneten sich kleine Brüste ab. Sie trug ihre Haare in einem Pferdeschwanz, der feurig rot durch die sonnigen Tage strahlte. Das Kribbeln im Bauch, das ich hatte, wenn sie in der Nähe war, konnte ich nicht zuordnen. War es einfach nur Zuneigung oder Neid, weil ich nicht so sein konnte wie sie. Das Kribbeln war immer gepaart mit einem Gefühl von Sehnsucht, die ich aber nicht beschreiben konnte. Diese meine Sehnsucht musste mein Geheimnis bleiben.
Die langen heißen Nachmittage im Schwimmbad. Ausgestreckt auf Badetüchern im Halbschatten, Stimmengewirr, Lachen, Rufen, der Geruch von Sonnencreme auf der Haut. Sonnenbrand an den Waden und auf den Füßen. Warum vergaßen wir bloß immer, uns auch dort einzucremen. Susanne ganz nah, die Haut voller Sommersprossen, die inzwischen nicht mehr so kleinen Brüste vom Atem auf und ab getragen. Wie selbstverständlich lag ihr Kopf an meiner Schulter. Ja, Sommerzeit ist Körperzeit und Liebe ein Körpergefühl. Aber das Körpergefühl war alles andere als Liebe in jenen Tagen. Ich wurde immer männlicher und die Erregung, die sich von Zeit zu Zeit nicht ganz verbergen ließ, erweckte in mir komische Gefühle.
Aber Susannes Kopf war an meiner Schulter. Das wollte ich auf keinen Fall vermissen. Sie gab mir ein Gefühl von Wärme und Zutraulichkeit – das war ein schönes Gefühl. Ich versuchte, meine eigenen gefühlsmäßigen Schwankungen zu ignorieren und genoss in vollen Zügen ihre Nähe. Sanft legte ich meinen Arm über ihren schattenkühlen Rücken. Sie schnurrte wohlig und rückte sich auf dem Tuch zurecht, noch ein wenig näher zu mir hin. Ich schloss die Augen. Ignorierte alles um mich herum. Mein Gesicht brannte und mein Herz klopfte. Ich schämte mich, als ich merkte, dass Susanne mich ansah, schon eine Zeitlang angesehen haben musste. Sie lächelte, aber ihr Lächeln war nicht spöttisch. Der Blick ihrer grünen Augen fand mich. Sie schloss die Augen und kuschelte sich wieder an mich. Rote Haarspitzen auf meinen Schultern.
Bald zogen die Sommertage davon und machten immer kürzer werdenden Herbsttagen Platz. Aber Susanne blieb. Die Blicke der Kameraden auf mich hatten ihre Farbe, von erster Indifferenz über lächelnd-geringschätzige Anerkennung hin zu zurückhaltender Bewunderung, gewandelt.
Meine schüchterne, zwischenzeitlich lärmige Stille war nun vollends als ehrliche Freundlichkeit anerkannt. Ich war beliebt und Susanne gehörte zu mir. Liebschaften waren schulbezogen; keinesfalls hätte ich das Mädchen zu mir nach Hause einladen dürfen.
Es war Herbst geworden. Merklich hatte der Sommer seine Kraft verloren. Immer öfter gab es Gänsehaut von den kühlen Temperaturen am Abend. Auf der Hügelkette machten sich immer mehr gelbe Flecken breit. Und wir? Wir wuchsen und unsere Körper entwickelten sich weiter.
Paul war zu mir nach Hause gekommen. Wir wohnten seit einiger Zeit sozusagen Tür an Tür – zufällig. Er kam an einem Donnerstag, breit grinsend zu mir. Dieses breite Grinsen verzog sein ganzes Gesicht zu einer einzigen Grimasse. Er machte komische greifende Bewegungen mit beiden Händen und ich vermutete, er wollte mich auf Susannes Brüste hinweisen. Ein genervtes Lachen im Gesicht, setzte ich zu einer abfälligen Bemerkung an.
Paul grinste noch mehr. »Das auch«, meinte er schelmisch, »aber ich hab noch was anderes.«
Ich zog die Augenbrauen hoch. »Willst du mich zum Melken mitnehmen?«, spottete ich.
»Nein Mann, spinnst du? Wir brauchen noch einen Rückraum Mitte.«
Ich verstand kein Wort. Paul hatte vor ein paar Monaten begonnen, Handball zu spielen.
»Hast du Lust?«
Ich verstand zwar immer noch nicht, was ein Rückraum Mitte sein sollte. Doch dann überlegte ich kurz und sagte mir, gesteuert von meiner neugierigen Ader: ›Wenn Paul das macht, kann es sicher nichts schlechtes sein.‹ Es hatte schon was für sich: Zweimal die Woche die Nachmittage nicht daheim verbringen zu müssen, mit Paul und den anderen, die ich ja noch nicht kannte, ein paar Bälle werfen zu können. Ja, das klang verlockend. Und auch die Unruhe abschütteln, die mich ständig begleitete. Zudem würde mein Vater diesen Sport sofort akzeptieren, war es doch ein richtiger Männersport – zu jener Zeit. Richtige Kerle machten sowas. Die träumten nicht, die drängten, schrien und rempelten sich gegenseitig an. Ich grinste und meinte leicht fordernd.
»Warum nicht?«
»Kommst du gleich heute?«, drängte Paul.
»Wir haben bald ein Meisterschaftsspiel, vielleicht können wir dich dort schon einsetzen.«
»Warum nicht«, sagte ich, nochmals leise.
»Ja, logisch«, ich versuchte cool zu bleiben, war aber innerlich ziemlich aufgeregt. Schließlich wusste ich ja nicht, was mich in diesem harten Männersport so erwartete. Paul grinste siegesfreudig.
Die Turnhalle roch nach Gummi und Staub. Es war eine Mehrzweckhalle mit asphaltiertem Boden, alt und veraltet aber zur damaligen Zeit das Beste, was diese Kleinstadt an Turnhallen für Handball zu bieten hatte. Die Schritte waren auf dem asphaltierten und staubbedeckten Boden kaum hörbar. Zu vernehmen war nur das stoßweise Atmen der jungen Spieler, sowie von Zeit zu Zeit ein kurzer Aufruf des Trainers. Die letzten zwanzig Minuten des Trainings war ein Spiel angesagt. Mann, gingen diese Burschen zur Sache. Ich war zwar groß und kräftig, aber überhaupt nicht gewohnt, zu rempeln und die körperliche Härte zu suchen. Trotzdem spielte ich mit – machte, was ich den anderen abguckte. Paul war begeistert. Offenbar stellte ich mich beim ersten Mal Handball spielen nicht so dumm an. Seine Kameraden waren voller Bewunderung für den Neuen und niemand war hier aus dem Gymnasium. Da musste man noch was zeigen. Und ich zeigte. Als würde ich das für Paul tun, zuerst. Aber dann hörte ich auf, nachzudenken. Konzentration auf den Ball und die Füße und Arme der anderen. Schnelle Bewegungen, das Pochen des Blutes in den Ohren, Hitze in den Wangen und tiefe schnelle Atemzüge. Passen – Rennen – Werfen – Abfangen. Ich spürte die Zeit nicht mehr und vergessen war der sterbende Sommer.
»Und, kommst du wieder?«, fragte mich der Trainer.
Ich nickte. »Klar«, sagte ich.
Zum Schluss hockten alle mit aufgeschürften Knien, pulsierender Wärme, Staub und Gummi um den Mittelkreis und in der Mitte lag ein Ball. »Also dann ab zum Duschen.« Der Trainer war ein beleibter Mann mit kurzen Stoffhosen. Sein Schnauz war grau. An seinen blassen Beinen kräuselten sich dunkle Haare. Ich ertappte mich, wie ich ihn genau musterte. Ein interessanter Mann.
Die Duschen waren voller Dampf. Ein gefliester Raum, rundum metallene Düsen, nackt standen wir im Kreis, aber niemand kehrte den Rücken zur Mitte. Das heiße Wasser strömte über die Körper, troff aus den Haaren, lief über die Gesichter. Wir sprachen nicht. Eine seltsame Feierlichkeit hatte uns alle ergriffen. Die Blicke waren unbeirrt auf den Boden gerichtet, zuckten aber hin und wieder verstohlen von Penis zu Penis. Schwänze. Das war die Welt. Manche noch ganz kindlich, vollständig unbehaart und stummelig geradeaus gerichtet. Manche hängend, fleischig. Ein Junge war beschnitten. Ich starrte. Fühlte mich taub. Blickte hilflos auf mein eigenes Würstchen. Das Einseifen dauerte bei allen lange, man nahm sich Zeit, fasste sich auch gerne ein bisschen an, irgendwie. Hände, als würden sie die Eier wiegen. Das Gewicht der Seele zwischen der Hüfte. Ich fasste mich an. Ich starrte auf meine Finger. Man musste sich auch unter der Vorhaut waschen, nur der Beschnittene musste das nicht. Auch zwischen meinen Fingern Fleisch. Fremdes Fleisch. Ich fühlte mich komisch. Wütend. Stellte mir vor, dass es Susannes weiche Finger waren. ›Das auch‹, hallte es in meinem Kopf. Mir wurde schwindlig. Ich fühlte mich wie beduselt.
Draußen regnete es. Meine Haare waren nass. Ich bestieg den Bus. Dann zu Hause angekommen:
»Jochen, ich muss mit dir reden.«
Die Stimme des Vaters klang fremd. Dumpf in der dunklen Diele. Ich wollte in das Zimmer der Mutter, allein sein und den Geruch des Schweißes vergessen.
»Träumst du schon wieder?«
Ich blickte auf, der Vater schaute streng.
»Wir müssen schon in drei Wochen in eine größere Wohnung umziehen. Ich erwarte, dass du deine Sachen selbständig zusammenräumst. Beim Tragen werden wir auch deine Hilfe brauchen.«
Forschend blickte der Vater mich an. Ich sah nur Susannes weiche Finger. Das Zimmer der Mutter. Taub.
»Natürlich«, zwang ich mich zu antworten und holte einen komisch freundlichen Blick hervor, der jeder Schauspielerin Konkurrenz gemacht hätte.
Auf einmal spürte ich meinen Unterleib, unvermittelt. Musste an die Dusche denken. Über dem Ansatz meines Gliedes wuchs ein Flaum. Er begann schon zu hängen, war aber immer noch sehr kindlich. Ich würde dafür sorgen, dass die Nadelpuppe mitkam. Für mich war es ein Abschied.
Die neue Wohnung konnte in nichts mehr mit der Alten verglichen werden. Das Zimmer der Mutter war nicht mehr. Nun gab es eine Ecke, einen Bereich, aber keine Heimlichkeit mehr. Die Nähmaschine stand in einem Winkel der Wohnstube und die Chaiselongue war in den Keller gewandert. Dort blieb sie vermodernd bis sie schließlich einige Jahre später entsorgt wurde. Die Wohnung hatte keine dunkle Diele mehr, aber schattige Flecken waren in ihr, sie wanderten wie Ölschwaden unter Wasser. Die Schulzeit war beendet und Susanne war nicht mehr in meinem Leben. Die Zuneigung, die ich für sie empfunden hatte, war einfach gegangen, von einem Tag auf den anderen. Auch ich war gegangen. Weitergegangen. Hatte mich abgewendet, wie von einem langweiligen Gegenstand. Paul hatte das nicht verstehen wollen. Susanne auch nicht. Und so richtig hatte ich es wohl auch nicht verstanden.
»Was gibt es da schon zu verstehen?«, hatte ich Paul grimmig gefragt, als er nach dem Training schon wieder damit begann.
Ich hatte keine weiteren Erklärungen gegeben, mich stumm weiter mit dem Frotteetuch abgerieben und an das verschwundene Zimmer gedacht. An den Hautgeruch, den ich nicht verstand. Der manchmal groß zu werden schien. Das Leben ging weiter und manchmal entdeckte ich beim Aufwachen Flecken auf dem Laken und im Pyjama und ich schämte mich. Aufgeklärt waren wir ja alle irgendwie. Außerdem gab es genug davon, fast schon zu viele. Es war Frühling geworden. Für mich waren es die letzten Schultage. Dann sollte der Ernst des Lebens beginnen. Anscheinend. Meine Berufslehre stand vor der Tür. Ich war gespannt. Aber jetzt war es Frühling. Und nahezu jedes Dorf hatte sein Fest. Und obwohl Susanne nicht mehr bei mir war, blieb ich selten allein, weder in der Schule noch an den Abenden, an denen Paul und ich loszogen um die Umgebung unsicher zu machen.
Pubertät
Mit vierzehn Jahren, mitten in der Pubertät und nach dem Ende des Gymnasiums, begann ich meine Lehre. Der Einstieg ins Berufsleben war das, ein Erwachsenwerden im allerbesten Sinn, so wie es sich die meisten wünschen. Gewiss hegte auch mein Vater einige Hoffnungen, dass ich nun endgültig auf – aus seiner Sicht – geraderen Bahnen laufen würde.
Mir tat es gut, den schwülwarmen Nachmittagen der Schulmüdigkeit zu entkommen. Feste Zeitpläne, Frühaufstehen. Vielleicht würde das auch helfen, die Anflüge von unerklärbarer Zerstreutheit zu bekämpfen, die mich dann und wann überfielen, immer noch und immer wieder.
Gleich am ersten Tag in meiner Lehrfirma fühlte ich mich wohl. Die mir zugedachten Tätigkeiten umfassten zwar vorerst nur die Neuordnung des Archivs und das Zubereiten von Kaffee, dennoch kam keine Langeweile auf. Die Atmosphäre war gut und ich mochte meine Arbeitskollegen. Einige waren Draufgänger, echte Kerle irgendwie – und sie nahmen mich freundlich auf. Meine Statur verbarg mein stilles Wesen. ›Jochen, ein echter Kerl!‹, dachten alle. Aber es fehlte etwas. Schon lange hatte ich diesen Eindruck. Leider konnte ich es nicht begreifen und auch nicht zuordnen, was da mit meinen Gefühlen von Zeit zu Zeit passierte. Was auch immer mit mir los war. Vielleicht würde ich es eines Tages erfahren.
In den Mittagspausen pflegte sich die Belegschaft im Hinterhof des Gebäudes zu versammeln, wo man an den bereitgestellten Tischen und Bänke die mitgebrachten Schinken-Käsebrote und den Kaffee aus Pappbechern genießen konnte. Gleich nebenan stand eine Reihe von Motorrädern, von denen einige meinen Arbeitskollegen gehörten. Klar wurde dort gefachsimpelt, Meinungen ausgetauscht. Und klar, hatte jeder die beste Maschine der Welt. Männerwelten! Nur ich kam weiterhin mit dem Bus oder dem Fahrrad zur Arbeit. Die Mittagspause war wie damals der Schulhof. Verunsichert umkreiste ich den schattigen Ort. Auf den Sätteln lag Pollenstaub. Lässig stand Hans an seine Maschine gelehnt. Und von Zeit zu Zeit spürte ich eine Leere in mir und eine Sehnsucht nach ... Scheiße, schon wieder.
Erwachsenwerden – jetzt wollte ich handeln. Keine Lust mehr auf Sentimentalitäten, nicht immer wieder. Einmal mittendrin dabei sein.
Von meinem ersten Monatsgehalt, und zum Missfallen meines Vaters, kaufte ich mir ein Mofa. Der schien sich irgendwie betrogen oder übergangen zu fühlen, ich wusste es nicht, verstand es aber auch nicht. Er klärte mich auf:
»Tagein, tagaus schufte ich mir den Rücken krumm, um für Nahrung zu sorgen und du Jochen, du gibst dein erstes eigenes Geld nicht für etwas Anständiges aus, sondern für so einen unnötigen Mist. Du könntest doch auch weiterhin mit dem Fahrrad fahren und Geld sparen.«
Ja, Geld sparen, das war die Erziehung der Kriegsgeneration. Geld sparen. Aber auch meine Mutter war voller Sorge. In ihren Vorstellungen sah sie mich schon verdreht und blutig am Straßengraben liegen.
Doch die vermeintlich rüde Reaktion meines Vaters war nur vorgetäuscht, war nur eine Maske, um seinen heimlichen Stolz zu verbergen, seine Freude an meinem aufrechten Gang, an meinem Besitztum. Nun war wohl auch ich in seinen Augen ein Mann geworden. Wird gar vielleicht dann doch noch was aus ihm? So fragte er sich bestimmt. Irgendwie veränderte sich auch meine Gefühlswelt. Ich dachte, dass der Mofakauf vielleicht eine Lösung für die Leere im Bauch, den Schwindel im Kopf und ein unfühlbar weinendes Herz sei. Geschwindigkeit und Freiheit. Eigenständigkeit und Dazugehörigkeit. Das ging irgendwie zusammen in diesem Gefährt. Und der, aufgrund eines technischen Defekts, weitherum hörbare Motorenlärm verschaffte mir meinen ersten eigenen Namen.
Jürgen, mit dem ich mich gut verstand, hatte bei seinen Eltern, auf einem kleinen Bauernhof in einem Schuppen, eine Werkstatt eingerichtet. Da roch es nach Öl, Heu und Terpentin. Wir saßen auf alten Hackklötzen, jeder sein Bierchen in der schwarzen, ölverschmierten Hand und wir hatten zusammen einen heiden Spaß. War es uns doch gelungen, mein Mofa so zu frisieren, dass es jetzt praktisch doppelt so schnell fuhr wie ab Werk. Nur, jetzt übertönte es sogar den Trecker des Bauern und es lief an die sechzig Stundenkilometern. Erlaubt für diese Kategorie waren höchstens dreißig. Wir waren begeistert. Und nachdem ich meine erste Runde zwischen den Äckern gedreht und dabei fast, mit ohrenbetäubendem Lärm, in die Jauchegrube gerast wäre und aufgescheuchte Hühner nach allen Seiten davon flatterten, hieß ich nur noch Jet. Jochen war jetzt Jet und Jet war schnell. Nicht nur auf der Arbeit, sondern auch bei neuen Kollegen oder Freunden der Kollegen war ich fortan Jet. Jochen war vergangen, irgendwie, auch für Paul, meinen guten Freund aus der Schulzeit, den ich weiterhin sah und der mir ein Gefährte blieb, angesteckt von der Lust an Geschwindigkeit.
Ich war stolz! Wenn ich heimkam und die heimliche Anerkennung in den Augen meines Vaters sah, fühlte ich mich irgendwie richtig. Jet im Rudel. Jet mit Paul nicht mehr auf Katzenpfoten und in Wolkenkuckucksheimen schwüler Lieben, sondern schnell und laut. Als würde ich endlich auf dem richtigen Weg sein.
Aber manchmal, wenn ich allein daheim war, die Mutter bei einer Freundin zum Kaffee oder beim Einkaufen und der Vater auf der Arbeit, stürzte alles in sich ein. Als würde ich in mir selbst zusammenfallen. Als wäre alles, was jetzt richtig schien, nicht wirklich. Weggewischt. Jet draußen an die Leine gelegt. In diesen Momenten schlich ich dann wie in Trance zu Mutters Sachen. Ganz verstohlen, als ob doch jemand im Haus wäre, der mich sehen oder hören könnte. So schleichend verbarg ich mich vor Jet, der Welt, den Maschinen, der Geschwindigkeit und der harten Männerwelt.
Mutter bewahrte ihre Kleidung im Schlafzimmer der Eltern auf. Alles ordentlich verstaut. Ihre Strumpfhosen lagen in einem separaten Fach im Kasten.
Die Strumpfhose saß angenehm an meinen noch nicht behaarten Beinen. Ich schlug die Beine übereinander und saß so, wie die Frauen meistens sitzen, minutenlang auf dem Sofa. Nur Minuten. Diese aber schienen mir wie eine Ewigkeit. Irgendwie träumte es in mir von einer anderen Welt. Und ich mittendrin. Ich strich mir über die Beine. Was für ein Gefühl! Aber dann wurde mir plötzlich schlecht. Ich begann zu realisieren, was ich da machte. Ich schämte mich. Aber irgendwie traf es das nicht. Und dann waren sie wieder da, der Schwindel und die Übelkeit. Ich zog mir die Strumpfhose von den Beinen, knüllte sie in das Fach des Kastens und stürmte aus dem Zimmer. Die Knöpfe der Hose noch offen, hastete ich aufs WC und übergab mich. Ich war wütend und verwirrt. Wütend auf mich. Wütend auf diese innere Gespaltenheit und verwirrt über meine undefinierbaren Gefühle.
Und dann war plötzlich alles vorbei. Ich ließ mich auf mein Bett fallen, streckte mich so richtig durch und ekelte mich vor mir selber. ›Bist doch kein Kind mehr‹, dachte ich bei mir. Nach einer Weile hatte ich alles vergessen. Vergaß es jedes Mal, wenn ich es tat. Immer und immer wieder. Vergaß es, weil ich es innerlich verdrängte, ohne dass ich es wusste. Aber es nagte sehr an mir, dass ich so in die Wechselbäder der Gefühle eintauchen musste. Es machte mir die Freude daran kaputt, mich als Jet gefunden zu haben. Ich konnte es nicht genießen – nicht als Jet und nicht mit der Strumpfhose.
Aber dann geschah etwas, was mich nicht mehr vergessen ließ. Es war wieder einmal so ein Tag, an dem man am liebsten gar nicht erst aufgestanden wäre. Auf der Arbeit war es anstrengend gewesen. Ich kriegte vom Chef einen Zusammenschiss, weil ich ein paar Papiere verschlampt hatte. Zu allem Überfluss regnete es auf dem Heimweg in Strömen. Ich kam deswegen mit meinem Mofa ins Schlingern und konnte mich gerade noch vor der Leitplanke auffangen. Triefend vor Nässe und mit einem kleinen Schock wegen des Beinahe-Unfalls, kam ich zuhause an. Ich stellte mich unter die heiße Dusche. Ließ das Wasser über Kopf und Bauch fließen – den ganzen Körper. Ich spülte den Tag ab.
Und auf einmal fand ich mich im Schlafzimmer der Eltern wieder, die Haare noch nass. Ich trug die Strumpfhose meiner Mutter und schrak auf, weil ich Schritte in der Diele hörte. Und schon ging die Tür auf – Vater stand im Türrahmen. Er prallte zurück als er mich sah. In seinen Augen spiegelten sich zunächst Ungläubigkeit und Erstaunen. Und dann Wut.
»Was ist jetzt los – bist du jetzt eine Mary?«, zischte er beinahe hysterisch.
Ich spürte, wie mir das Blut ins Gesicht stieg. Fühlte mich wie gelähmt. Wusste nicht, wie ich hierhergekommen war. Konnte nichts mehr sagen. Meine Kehle war trocken. Wo war denn meine Mutter? Ich hätte sie jetzt so sehr gebraucht.
»Zieh das sofort aus, bevor das noch jemand sieht!«, zeterte es aus seinem Mund.
Aber es hatte es doch schon jemand gesehen. ER hatte es gesehen. Ich war verwirrt und rannte am Vater vorbei hinaus in den Regen, setzte mich aufs Mofa und fuhr los. Fuhr ziellos durch die Gegend. Ich war wütend auf mich aber auch auf den Vater. Was in aller Welt war geschehen? Die Wut in den Augen meines Vaters nahm ich als ziehenden Schmerz in meiner Bauchgegend wahr. Sah mich selbst in seinen Augen. Ich schrie in den Regen hinaus. Jochen schrie. Jet schrie. Der Regen klatschte mir ins Gesicht. Bevor das noch jemand sieht, hatte er gesagt. Bist du jetzt eine Mary? Eine Mary? Hallte es in meinem Kopf. Bist du jetzt eine Mary?
Bist du jetzt eine Mary? Hallte es in mir, sprach es aus den Augen des Vaters. Aber wir sprachen nicht mehr darüber. Meine Mutter wusste von nichts, der Bruder schon gar nicht, niemand. ›Bevor das noch jemand sieht, bist du jetzt eine Mary?‹, dröhnte es in meinem Schädel.
Meine Mutter sollte es nie erfahren. Oder ich sollte nie erfahren, ob sie es wusste. Ihre Augen hatten nie gefragt, nie die Wut und Enttäuschung getragen, die im Gesicht meines Vaters standen. Bist du jetzt eine Mary? Mutter fragte es nicht. Vielleicht, weil sie als einfühlsame Frau die Antwort bereits ahnte. Ich erfuhr es leider nie.
Tod der geliebten Mutter
Ich war im zweiten Lehrjahr. An einem frühlingshaften Samstag spielte ich Handball, mit Paul. Wir waren bei einem Turnier in einem rund eine halbe Stunde weit weg gelegenen Dorf. Verschwitzt und lachend standen wir unter der Dusche. Das war ein guter Tag gewesen. Wir hatten einige Spiele gewonnen und konnten am Sonntag um das Finale spielen.
Als ich am Abend gut gelaunt nach Hause kam, sah ich meine Mutter erschöpft auf der Couch liegen. Auf meine Frage hin, was denn los sei, sagte sie nur, sie fühle sich schwach und müde. Sie sei auch schon beim Arzt gewesen und der hätte ihr ein Elektrokardiogramm gemacht, aber nichts gefunden.
»Es ist sicher nichts Schlimmes«, versuchte ich, sie aufzumuntern.
»Das vergeht sicher bald wieder und du fühlst dich wieder topfit.«
Ich konnte nicht ahnen, dass dies nicht einfach vorübergehen würde.
Am nächsten Tag wieder in Aarau am Turnier. Das Finale konnten wir nicht gewinnen, aber wir waren trotzdem zufrieden mit unserer Leistung. Als ich am späten Nachmittag heimkam, schien alles normal. Auch meiner Mutter war der vermeintliche Schwächeanfall vom Samstag nicht mehr groß anzusehen. Wir aßen gemütlich zu Abend. Ich ging früh zu Bett, müde vom Sport.
Plötzlich erwachte ich. Schrak auf. In meinem Zimmer war es dunkel. Von vorne aus dem Wohnzimmer drangen Lärm und aufgeregte Stimmen zu mir herüber. Ich stand auf und ging durch den dunklen Flur zum Wohnzimmer hin. Durch die angelehnte Stubentür drang Licht. Ich stieß sie auf. Im Schein der Esstischlampe sah ich meine Mutter auf dem Boden liegen, ein fremder Mann, der wie ein Arzt aussah, über sie gebeugt. Er stieß seine übereinandergelegten Hände rhythmisch pressend auf ihre Brust. Mutters Körper wurde durch seine Stöße geschüttelt. Eine Haarsträhne klebte ihr im Gesicht. Sie war verschwitzt. Mein Vater stand hinter dem Stubentisch, rang die Hände. Sein Gesicht war voller Angst. Er drehte sich, wendete sich.
»Ruf die Ambulanz, ruf schnell die Ambulanz!«, rief er mir zu.
Erschrocken und verdattert eilte ich zum Telefon. In mir war alles taub. Wie in Zeitlupe vergingen die Minuten, bis der Krankenwagen kam. Der Vater schritt unruhig zwischen dem Arzt und mir hin und her, der Holzboden knarrte unter seinen Füßen. Immer noch klebte der Mutter das Haar im Gesicht, wie eine dunkle Strieme, die Wange hinab. Eine Fliege musste unablässig verscheucht werden. Offenbar atmete sie wieder, denn nun hob und senkte sich ihre Brust von allein. Sehr langsam. Der Arzt hatte sein hektisches Pumpen aufgegeben. Sein Gesicht war aus Stein. Meine reglose Mutter wurde behutsam auf eine Trage gelegt und in den Krankenwagen getragen. Wie selbstverständlich stieg ich hinten zu ihr. Ich saß weinend neben ihr und hielt ihre Hand. Die war kühl und feucht. Ich hatte Angst. Ständig blickte ich zu ihr.
»Bitte, bitte bleib bei uns!«, flehte ich sie an. Ganz ruhig und still war sie. Wie von Ferne.
Vater kam mit dem Auto nach.
Im Kantonspital brachte man unterdessen meine Mutter direkt auf die Intensivstation. Ich blieb mit meinem Vater auf dem Parkplatz des Krankenhauses, nah beieinander, keine Wut war zwischen uns. Manchmal stehend, manchmal auf dem Asphalt kniend beteten wir zu Gott. Lieber Gott, lass sie nicht sterben! Mutter muss weiterleben. Meine über alles geliebte Mutter musste doch weiterleben! Ich brauchte sie doch! In dem Moment, als sie Mutter, mit Schläuchen behängt, in das große Gebäude fuhren, überkam mich eine riesengroße Angst. Pflegepersonal und Ärzte, in ihren weißen Kittel, waren im Laufschritt mit ihr unterwegs.
»Bitte, bitte lieber Gott, lass sie nicht sterben!« Ich drückte Vaters Hand, er die meine.
Als könnten wir uns gegenseitig festhalten und vor dem Sturz in den Abgrund, der sich vor uns öffnete, bewahren.
Morgens um halb vier öffnete sich die Tür. Nebeneinander kamen der Arzt und der Notarzt heraus Es war der gleiche Notarzt, der meine Mutter schon zuvor am Samstag bei uns zuhause behandelt hatte. Der Doktor, seine Miene weiter unbewegt, schaute uns an, lächelte fast ein wenig mitleidig, zuckte die Schultern.
»Es tut mir leid, meine Herren, sie ist gestorben.«
In dieser Sekunde riss etwas in mir. Alles wurde rot, feurig rot. In meinem Kopf hämmerte es wie wild. Ich ballte die Fäuste, mein ganzer Körper verspannte sich. Dann stürmte ich los, mein Vater hinter mir her. Er musste mich festhalten. Sonst hätte ich ganz sicher diesen schon alten Menschen, der sich Arzt schimpfte, und ganz offensichtlich schon am Samstag eine Fehldiagnose gestellt hatte, ohne weiteres getötet. Ich schrie wie wahnsinnig und fuchtelte mit meinen Armen herum. Nein, das konnte nicht sein! Nein, das war ein Irrtum! Nein, es durfte nicht sein! Mein Vater musste mich immer noch festhalten, ich wäre sonst auf diesen Scharlatan losgestürmt und hätte ihn vor unsäglicher Wut, Trauer und Ohnmacht erschlagen.
Als wir gegen fünf Uhr nach Hause kamen, stand mein Bruder in Tränen aufgelöst, noch im Schlafanzug, an der Tür. »Ist sie tot, ist sie tot?«, stammelte er. Mein Vater nahm ihn wortlos bei der Hand und führte ihn ins Haus. Ich ging wie in Trance hinterher. In das Haus, das jetzt leer war. Leer und kalt. Mein Magen krampfte sich zusammen. Ich folgte ihnen durch die dunkle Diele in die Stube, wo ich die Stimme meines Vaters hörte, immer wieder unterbrochen vom Schluchzen meines Bruders. Ich setzte mich zu ihnen. Und konnte die Tränen nicht mehr halten. Verzweiflung und Wut ließen meinen Körper zittern. Ich wollte es nicht glauben. Die Plötzlichkeit, mit der die Leere da war und die warme Insel unserer Familie mit sich gerissen hatte. Diese Ungerechtigkeit. Diese Sinnlosigkeit. Immer wieder ballte ich die Faust und hieb auf den Tisch. Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus, ging in mein Zimmer und warf mich aufs Bett, auf die kalten Decken. Ich weinte und schlug in die Kissen. Nach einiger Zeit hörte ich die Schritte meines Bruders, dann schloss sich die Tür seines Zimmers. Wir weinten hinter geschlossenen Türen.
Irgendwann musste ich dann aber doch eingeschlafen sein. Als ich am nächsten Tag aufwachte, wusste ich zunächst nicht, was passiert war. Einige Sekunden, zwischen Schlaf und Wachsein, fand ich mich in der warmen Mattigkeit, die nach dem Schlaf der Erschöpfung kommt. Da hörte ich gedämpft durch die Tür die Stimme meines Vaters, der offenbar am Telefon war. Wortfetzen.
»Ja... ja... verstehe es auch nicht... plötzlich.«
Da traf mich die nackte Realität wie ein Hieb in den Bauch. Mit versteinerter Miene stand ich auf und zog mich an. Ich spürte eine unsägliche Kälte in meiner Seele, und eine harte Entschlossenheit. Ich ging in die Stube. Mein Vater legte gerade den Hörer auf. Seine Augen waren rot und geschwollen. Er zitterte. Ich trat zu ihm, legte meine Hand auf seine Schulter und fragte:
»Was soll ich tun?«
Handeln. Jetzt musste gehandelt werden. Die Bewältigung des Todes unseres, für ihn wie für mich, allerliebsten Menschen organisieren. Telefonate führen, einen Sarg bestellen, Menschen anrufen, und so vieles mehr. Mein Vater schien hilflos. Auf einmal war er allein, mit zwei pubertierenden Knaben.
»Wir müssen jetzt mehr denn je zusammenhalten«, schluchzte er.
»Ich brauche euch jetzt – habe ja nur noch euch.«
Dieser und der nächste Tag waren geprägt von unzähligen Telefonaten und ständigen immer wiederkehrenden Schluchzern und Wutausbrüchen. Und der Frage, die sich mein Vater und ich immer und immer und immer wieder stellten: WARUM NUR? Meine Totschlaggedanken waren immer noch sehr präsent. Ich hatte hierfür schon ein langes Küchenmesser in meinem Zimmer versteckt. Ich würde ihn abstechen, diesen Mann, der meine geliebte Mutter auf dem Gewissen hatte. Mein Vater musste mich immer wieder beschwichtigen und beruhigen, was ihm aber nur teilweise gelang. Immerhin reichte es, um den alten Mann leben zu lassen. Er musste selbst mit seiner Fehldiagnose klarkommen.
Dann die Beerdigung. Einige Menschen aus der Familie, Kränze, stickige Luft in der Kapelle und Worthülsen, die auf mich eindringen wollten, jedoch keinen Widerhall in mir fanden. Der Gang zum Grab, der schwere Eichensarg, ein dunkles Rechteck, und Hände voll Erde. »Mein Beileid«, »mein Beileid«, »mein Beileid.« Die Kette der kondolierenden Menschen schien nicht mehr aufzuhören. Viele Hände der Trauergemeinde waren feucht. Unser Vater weinte, mein Bruder auch und ich, ich stand stumm und verschlossen, ja wie versteinert da. Warf wortlos die Erde auf das Holz. Nur noch ein Rest Wut war in mir. Was sollten die fremden Gesichter unter den schwarzen Hüten schon wissen, was Mutter mir bedeutet hatte, was sie mit sich nahm und was mir genommen worden war? Aber das Leben musste dennoch weitergehen, redeten wir uns immer wieder ein. Vielleicht hatte es über die erste schwere Zeit ein ganz kleines bisschen hinweggetröstet.
Nachdem Mutter tot war, kam Vaters Mutter von Deutschland zu uns. Sie wollte helfen, wo sie konnte, im Haushalt vor allem. Sie war zwar kein Mutterersatz, aber wenigstens eine weibliche, erwachsene Person. Und ich mochte sie. Ich war ja auch immer gerne bei ihr in den Ferien. Wir waren immer noch wie betäubt – die Beerdigung lag ja erst einige Tage zurück. Sie versuchte, ein wenig Behaglichkeit zu verbreiten. Werkelte hier und dort herum, so gut sie konnte, kochte Essen und zündete beharrlich in allen Räumen die Lichter an.
»Dann ist es nicht so dunkel«, sagte sie, und: »Das ist alles so unglaublich schrecklich.«
Großmutter hatte zwar Licht, aber keine Wärme um sich verbreitet. Wir konnten nicht über Mutter sprechen, auch nicht, was passiert war, es gab nichts zu sagen, nichts zu verstehen, nichts zu denken.
Und immer wieder die Frage: WARUM? Alles war ein großer, dumpfer Schmerz, der sich wie ein Schleier über das Sehen, das Hören und sogar das Schmecken legte. Alle Speisen schmeckten gleich, mir war es gleich, was ich aß oder ob ich überhaupt aß. Verspürte eine verzweifelte Wut auf eine Welt, die farblos geworden war und auf einen Gott, den es für mich nun nicht mehr gab.
Und als wäre all das Unglück noch nicht genug gewesen, ereilte Großmutter nach zwei Wochen ein Herzinfarkt. Sie stand am Herd, Vater war auf der Arbeit, plötzlich ließ sie den Kochlöffel fallen, ich war gerade dabei, den Tisch zu decken. Der Löffel schlug auf dem Boden auf, ich drehte mich um und wollte ihn aufheben, als ich sah, dass Großmutter schwankte und sich mit schmerzverzerrtem Gesicht ans Herz fasste. Wie in Trance ging ich zu ihr.
»Oma, was ist?«, fasste sie an den Schultern und brachte sie zu einem Stuhl, auf dem sie niedersank.
Und wieder wählte ich die Nummer des Rettungsdienstes, dann die des Vaters, gemeinsam fuhren wir wieder ins Kantonspital, wieder ein Körper auf der Bahre. Wieder dasselbe Krankenhaus, das mir vor nur Kurzem alles nahm, was ich im Leben hatte. Alles zog an mir vorüber wie die Wiederholung eines schlechten, bösen Films. Meine Oma wurde versorgt und dann auf ein Zimmer verlegt, in dem wir sie besuchen durften. So vergingen drei Tage. Mein Vater und ich gingen sie jeden Tag besuchen.
Dann am Dienstagabend gegen einundzwanzig Uhr – mein Vater war im Fußballtraining – klingelte das Telefon.
»Guten Abend. Ist Ihr Vater zuhause?«, fragte eine ernste Stimme.
»Nein, er ist im Training«, antwortete ich.
»Warum?«
»Ich rufe vom Krankenhaus an.«
»Können Sie kommen?«, fragte sie.
»Ja, klar – ich bin in zwanzig Minuten dort.«
Meinen Vater konnte ich zwar auf dem Trainingsfeld nicht erreichen, deswegen rief ich im Club an.
Niemand musste mir sagen, was passiert war. Ich wusste es, fühlte es – ahnte es. Als nach kurzer Zeit ein Arzt zu mir trat, brauchte er gar nicht so zu blicken, brauchte sich keine Mühe zu geben.
»Sie ist tot, nicht wahr?«, fragte ich bereits ahnend, was geschehen war.
Inzwischen traf mein Vater ein, noch in den Trainingsklamotten. Der Arzt bestätigte:
»Ja, es tut mir leid, sie ist vor zwei Stunden verstorben.«
Ich wandte mich ab, nahm meinen Vater in den Arm und ging wie betäubt zu unserem Auto. Klar, ich hatte es begriffen: Nun war auch meine Großmutter tot. Aber der Schmerz über den Verlust meiner Mutter zwei Wochen vorher war noch zu frisch und zu stark. So konnte ich nicht einmal richtig über die Großmutter trauern, die es auch verdient hatte, dass um sie getrauert wird.
Die Heimfahrt. Das leere Haus. Die Dunkelheit. Eins nach dem anderen schaltete ich die Lichter in der Wohnung wieder aus. Dunkelheit. Ich wusste nichts mehr. Wollte nichts mehr wissen. Wollte nichts mehr hören oder sehen.
So musste es auch Vater gehen, der wie betäubt seine Routine vollzog. Wie konnte er so auf mich zählen? Alle Trauer, alle Wut in mir richteten sich auf ihn. Auf seine stoppeligen Wangen. Auf sein verzweifeltes Bemühen. Sollte er doch sehen, wie er zurechtkam. Als ob jetzt noch irgendetwas Sinn hätte!
Vater war leer und erschöpft. Er leitete eine Abteilung in einer großen Firma in einem Nachbarort. Mittags brachte er meinem Bruder und mir jeweils Essen aus der Kantine. Ging wieder zur Arbeit und nahm die Resten mit. Abends kam er erschöpft Heim und sprach wenig. Die Tage verliefen eintönig und unser Haus war endgültig stumm geworden. Vater war schwach geworden. Er bemühte sich, das konnte man ihm jedoch ansehen. Jedes Mal, wenn ich ihn sah, die hängenden Wangen, die traurigen leeren Augen und sein Bemühen, uns mit dem Nötigsten zu versorgen, spürte ich Mitleid – dann Wut. Jemanden versorgen. Vielleicht konnte er sich nicht vorstellen, dass das mehr bedeutete, als Essensreste aus der Kantine zu organisieren. Mehr als unsere Mäuler füttern. Versorgen hieß auch, die Wärme hüten. Aber das konnte oder wusste er nicht. Ich verstand das nicht und begann immer mehr, ihn zu verachten, meine eigenen Wege zu gehen. Mein Bruder nebenher, mit seinen elf Jahren war für mich noch ein Kind. War ohnehin Papas Liebling. Sollte es auch immer bleiben.
Er blieb es auch, als mein Bruder immer mehr seine eigenen Wege ging. Abends riss er oft aus. Blieb nach der Schule lange weg. Einmal wurde er von einem Polizisten heimgebracht. Ich war zufällig allein daheim, als es an der Tür klingelte. Als ich öffnete, stand dort dieser Mann in Uniform, der mich vorwurfsvoll anblickte. Neben ihm mein Bruder mit trotzigem Gesicht. Ich konnte mir schon ungefähr vorstellen, was los gewesen war. Wandte mich an ihn, mit betont freundlicher Stimmer:
»Was ist los?«
Dann fuhr der Polizist dazwischen: »Ich habe ihn erwischt, wie er zusammen mit anderen Lausbuben ein Straßenschild abmontieren wollte! Wo sind die Eltern?«
Ich musste innerlich lachen, als ich mir vorstellte, wie eine Horde Knaben zusammen an einem Mast hingen, bewaffnet mit Schraubenziehern und niemand groß genug, um im Stehen an das Schild heranzureichen.
»Meine Mutter ist tot und mein Vater auf der Arbeit«, sagte ich gleichzeitig lakonisch und forsch, »Sie können gern heute Abend wiederkommen.«
»Aber wer hat denn hier das sagen?«
»Eben niemand«, entgegnete ich knapp.
Der Polizist versuchte, ein betrübtes Gesicht zu machen, mir tröstlich die Hand auf die Schulter zu legen. Ich wich zurück.
»Das ist ja schrecklich, mein Junge«, sagte er in einem Ton, als wolle er mir gleich ein Bonbon anbieten und mich dann auffordern, in sein Auto zu steigen, um mir etwas ganz besonders Schönes zeigen.
»Ja, das ist schrecklich.«
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752139624
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (März)
- Schlagworte
- Autobiographie coming-out Transgender Trans Mann Gender Trans Frau Trans Biografien Transgender Buch Trans Frau sein