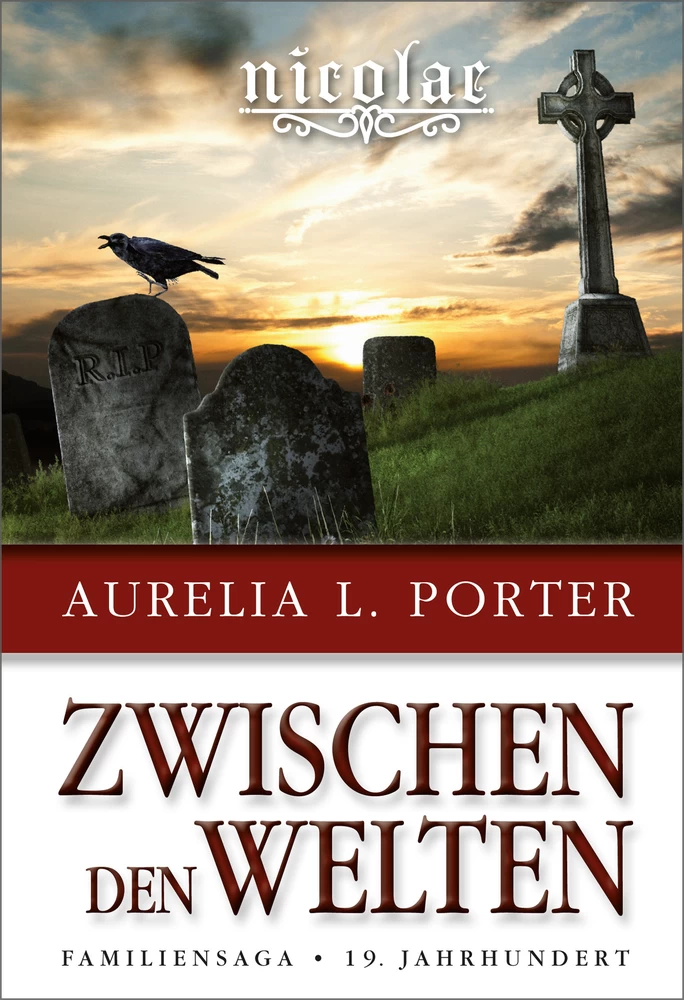Nicolae - Zwischen den Welten
Familiensaga 19. Jahrhundert
Zusammenfassung
„Sei gewarnt! Die Wahrheit, die wir dir erzählen werden, könnte dir den Verstand rauben …“
Was hat der plötzliche Tod der Vikarsgattin mit dem Verschwinden einer jungen Frau zu tun? Wer ist für die Zerstörung des keltischen Kreuzes auf dem Friedhof verantwortlich? Und welche Botschaft birgt die Wandmalerei in der kürzlich entdeckten Krypta von St. Mary’s?
Ein kleiner Junge namens Nicholas vermag Licht ins Dunkle zu bringen. Stückweise geben seine Träume ein gut gehütetes Geheimnis preis, das in seinem Heimatort begraben liegt. Immer tiefer geraten seine Mutter und er in die Wirren ihrer eigenen Familiengeschichte und damit in große Gefahr.
Zwischen den Welten ist der in sich abgeschlossene erste Band der Nicolae-Saga, die im Jahre 1866 in einem Küstenort Englands ihren Anfang nimmt.
In dem Auftakt zu ihrem siebenbändigen Familienepos erzählt Aurelia L. Porter einfühlsam wie bildgewaltig die Geschichte eines hochsensiblen Jungen, der auf der Suche nach der Wahrheit auf Lebenslügen, Verblendung und die Schatten seiner Ahnen trifft.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Nicolae
Zwischen den Welten
Familiensaga 19. Jahrhundert
(1860 bis 1869)
Band 1 der Nicolae-Saga von
Aurelia L. Porter
© 2021 Aurelia L. Porter
Umschlaggestaltung: Saeed Maleki, Hamburg
Umschlagmotiv: Shutterstock
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Neuauflage der Printausgaben
ISBN 978-3-347-05985-6 (Paperback)
ISBN 978-3-347-19931-6 (Hardcover)
Verlag & Druck: tredition GmbH,
Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Autors zulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Zu diesem Buch gibt es Musik!
Hören Sie kostenlos in den Soundtrack hinein:
https://maximilianzemke.bandcamp.com/album/zwischen-den-welten
Info: https://www.aurelia-porter.de/
Das Buch
Zwischen den Welten ist der Auftakt zu einem historischen Familienepos in sieben Bänden, angesiedelt im viktorianischen England und im sagenumwobenen Rumänien.
1866. Rebecca ist mit ihrem kleinen Sohn Nicholas (später Nicolae) aus London in ihren Heimatort an der Küste Kents zurückgekehrt. Als sie beginnt, dem rätselhaften Tod ihrer Mutter auf den Grund zu gehen, stößt sie auf unerwartete Widerstände. Selbst ihrem Vater, dem Vikar, scheint es zu missfallen, dass sie in der Vergangenheit gräbt.
Nach und nach enthüllen Nicholas‘ Träume ein dunkles Geheimnis um eine vermisste junge Frau und eine keltische Kultstätte. Noch ahnt Rebecca nichts von den Verwicklungen mit ihrer eigenen Familiengeschichte und den Abgründen, in die sie blicken werden.
Auf subtile Art zieht Aurelia L. Porter ihre Leser immer tiefer in das spannungsgeladene Familiengeschehen hinein.
„Hüte dich davor, an nur eine einzige Wahrheit zu glauben, denn wissen tut der Mensch in Wirklichkeit nichts …“
Die Autorin
Aurelia L. Porter wurde 1962 in Hamburg geboren. Die Literaten des 19. Jahrhunderts – von Dickens bis Dostojewski – haben sie von Jugendjahren an begleitet. Sie kann sich durchaus vorstellen, schon einmal in dieser Epoche gelebt zu haben, so vertraut erscheint ihr diese.
Das viktorianische England hat sie schon immer fasziniert. Seit sie 2005 begonnen hat, die Nicolae-Saga zu schreiben, begeistert sie sich ebenfalls für ein Land auf der entgegengesetzten Seite Europas: für Rumänien.
Ihr Titelheld mit seinen keltischen Vorfahren hat sie dorthin geführt, wo Sagen und Legenden zu Hause sind. Diese eröffnen ihr und den Lesern einen völlig neuen Blickwinkel auf die Historie und stellen so manche bisher geglaubte Wahrheit infrage.
„Beim Schreiben öffnet sich mir ein Portal zu einer verborgenen Welt.“
Was ist, wenn ihr eines Tages feststellt,
dass eins plus eins doch nicht zwei ergibt?
Wenn sich plötzlich Welten vor euch auftun,
die ihr zuvor nie gesehen habt
und damit all euer stolzes Wissen ad absurdum geführt wird?
(Rebecca)
Rebecca – 1860
Kapitel 1
Zum wiederholten Mal glitten ihre Augen über den soeben verfassten Brief. Rebecca bemühte sich, zwischen ihren eigenen Zeilen zu lesen, denn ihre Schwester täte es ganz gewiss. So gefühlsbeherrscht und sachlich Judith auch war, so feinfühlig und hinterfragend war sie im Umgang mit ihr, ihrer kleinen Schwester, die es selbst aus der Ferne noch zu beschützen und zu erziehen galt – wenn auch nicht mehr durch das gesprochene, so nun durch das geschriebene Wort. Hatte Judith früher Rebeccas wahren Gemütszustand anhand des Tonfalls, der Mimik und Gestik herauszufinden vermocht, so gelang es ihr jetzt durch die Art, wie sie die Feder angesetzt oder die Bögen geschwungen hatte. Darum prüfte Rebecca ganz genau, ob sie die Unruhe, die sie seit geraumer Zeit befallen hatte, vor ihrer Schwester hatte verbergen können. Judith sollte sich nicht unnötig sorgen.
Eine laue Brise strich durch das hochgeschobene Fenster ins Zimmer herein. Seufzend blickte sie auf und betrachtete gedankenverloren den über dem Meer bereits rötlich verfärbten Himmel. Drei Möwen, deren weiße Bäuche von der tief stehenden Sonne in ein leuchtendes Orange getaucht waren, glitten stumm vorbei, als trauten sie sich nicht, die andächtige Stille des sich herabsenkenden Abends zu stören.
Rebecca war sich dessen bewusst, dass ihr Brief einen klagenden Ton beinhaltete, zu dem sie keinerlei Recht besaß, denn eigentlich hatte sich nichts geändert. Zwar hatte ihre Schwester vor Kurzem ihren eigenen neuen Lebensweg fernab ihres Heimatortes beschritten, doch war dieses einschneidende Ereignis nicht aus heiterem Himmel über Rebecca hereingebrochen. Sie hatte Zeit genug gehabt, sich an den Gedanken, ihr Leben künftig ohne ihre geliebte Schwester bestreiten zu müssen, zu gewöhnen. Auch ihren Vater traf keine Schuld an ihrer unglücklichen Verfassung. Er kam wie eh und je seinen beruflichen Verpflichtungen nach und war obendrein in die Restaurierungsarbeiten an St. Mary’s eingebunden. Selbst die Menschen um sie herum, die sie von Kindesbeinen an kannte, hatten sich nicht verändert. Alles war in schönster Ordnung:
Die Fischer dieses südenglischen Küstenortes, die einst der Hungersnot wegen aus Irland eingewandert waren, kamen klaglos ihrer täglichen Mühsal nach, um sich und ihre Familien am Leben zu erhalten, während die heimischen Bauern von frühmorgens bis spätabends die umliegenden Ländereien bewirtschafteten und die Nase über das nach Fisch stinkende Volk aus dem Norden rümpften – obgleich sie kaum mehr im Geldbeutel hatten und ihnen ein strenger Geruch von Jauche anhaftete. Die feinen Herrschaften – oder solche, die sich dazu zählten – frönten wie eh und je ihren heimlichen Lastern, verhalfen sich gegenseitig zu noch mehr Reichtum und Macht und spannen so manche Intrige, die zu Aufstieg oder Fall Einzelner führte und nebenbei für Kurzweil sorgte. Alle übrigen Bürger verrichteten redlich und unbemerkt ihr Tagewerk. Manche sicherten sich mithilfe des wachsenden sommerlichen Badebetriebs ein gutes Zubrot. Jene, die es dadurch zu etwas Wohlstand gebracht hatten, begannen den oberen Ständen nachzueifern, ohne zu bemerken, welch groteske Figuren sie hierbei abgaben. Rebeccas Vater, Vikar dieser kleinen aufstrebenden Gemeinde, erteilte allen jeden Sonntag, den sieben Todsünden zum Trotz, die Absolution.
Es war also alles beim Alten, alles, wie es sich gehörte. Das Einzige, das sich verändert hatte, war Rebecca selbst, als sie in ihrer ungewohnten Einsamkeit begonnen hatte, ihre Augen richtig zu öffnen. Aber es waren keineswegs die bisher kaum wahrgenommenen Realitäten, die sie schreckten. Es war etwas Tiefergehendes, etwas Unerklärliches, das unaufhaltsam auf sie zukam und sich Zutritt zu ihrem Innersten bahnte. Dieses Gefühl einer diffusen Gefahr ließ sie des Nachts in unruhige Träume fallen, während tagsüber das zart schillernde Gebilde, das ihre Welt bisher schützend umgeben hatte, sich mehr und mehr zurückzog.
Unwillkürlich wanderten Rebeccas Augen zu dem verzierten Silberrahmen auf dem Sekretär. Das Antlitz ihrer Mutter mit seinen mädchenhaft verträumen Zügen blickte ihr entgegen. Das Haar fiel in leicht wallenden ungekünstelten Flechten, nur gehalten von einem Kranz aus Blüten. Ein feenhaftes, wissendes Lächeln umspielte ihre sanft geschwungenen Lippen.
Entschlossen spannte Rebecca die Schultern und las ihre Zeilen ein allerletztes Mal:
Kent, im August 1860
Meine liebste Judy,
wie sehr wünsche ich Dich bei mir! Das Leben so allein mit Vater fällt mir schwer. Er ist wie immer viel im Dienste der Kirche unterwegs. Kaum ist er zu Hause, steckt sein Kopf in den Plänen von St. Mary’s. Daher bin ich so oft wie möglich im Cottage-Garten, um nach Mutters Pflanzen zu sehen, was Vater allerdings nicht recht ist. Es sei nicht damenhaft und zudem ein „böses Omen“ mit bloßen Händen in der Erde zu wühlen. Wahrscheinlich ist er besorgt, mein Verehrer könnte Anstoß daran nehmen.
Gestern hat Mr. Cornelly mir erneut seine Aufwartung gemacht. Ich fürchte, Vater hört bereits die Hochzeitsglocken läuten. Aber Gott bewahre, dass er um meine Hand anhält! Ich kann nur inständig hoffen, dass ihm meine Finger zu schmutzig sind.
Ich hatte Dir ja bereits in meinem letzten Brief von dieser unglückseligen Begegnung mit Peter Cornelly berichtet. Es hat sich herausgestellt, dass er in London als Im- und Exporteur im Tuchhandel tätig ist und hier ein paar Tage bei seiner Cousine Mrs. Randon verweilt. Leider interessiert er sich, wie es in seinen Kreisen wohl üblich ist, nur für die neuesten Börsennachrichten und vermag weder der Natur noch den schönen Künsten etwas abzugewinnen. Immerhin sieht er ganz passabel aus mit seinem seitlich gescheitelten blonden Haar und seinem gemäßigten Backenbart, der sein schmales Gesicht etwas voller erscheinen lässt. Auch weiß er sich gut zu kleiden und gibt in den Salons, trotz seiner schmächtigen Statur, eine schneidige Figur ab.
Morgen Abend sind wir zum alljährlichen Sommerball der Randons eingeladen. Mal sehen, wie er sich auf dem Tanzparkett ausnimmt. Einerseits freue ich mich auf die Musik und den Tanz, andererseits … Du weißt, wie sehr ich die gesellschaftlichen Veranstaltungen bei den Randons verabscheue, Judy. Nun habe ich noch nicht einmal Dich zur Seite, die mich von den zu Gebote stehenden Plaudereien entlastet und meine „Grobheiten“ ausbügelt. Keine Sorge, Schwesterherz, ich werde mich zu benehmen wissen. Aber erwarte von mir bitte nicht, dass ich mich amüsiere!
So liebste Schwester, nun zu Dir. Wie geht es Dir im fernen London? Gefällt Dir die Arbeit am St. Thomas’ noch immer? Ich wette, seit Du dort bist, gesunden mehr Patienten, als dass sie sterben, nicht wahr?
Ich vermisse Dich sehr. Bitte schreibe mir zurück, sobald es Dir Deine Zeit erlaubt.
Deine Becky
Zugegeben, ihre bewusst kurz gefassten Zeilen wirkten wie das Quengeln eines verwöhnten, noch etwas unreifen Mädchens, das sich schwer damit tat, seinem Leben die für eine junge Dame ihres Alters geziemende Richtung zu geben. Dennoch würde Judith sich hierüber kaum wundern. Auch das Schriftbild war ein ebenmäßiges. Nein, es stand nichts zwischen den Zeilen. Die Worte selbst zeugten von ihrer Verlorenheit. Zuversichtlicher klingende Sätze hätten ihre Schwester nur misstrauisch gemacht.
Sie stöpselte das Tintenfass zu, griff zur Silberdose und streute ein Duftpulver aus getrockneten Rosenblüten auf ihren Briefbogen, bevor sie ihn in das bereitliegende Kuvert steckte. Sie musste sich sputen, um den Brief mit der letzten Abendpost aufzugeben.
Als Rebecca vor die Tür des Pfarrhauses trat, wurde sie von einer eigentümlichen Stimmung erfasst, die sie trotz ihrer Eile innehalten ließ. Das gewohnte Rauschen der Brandung war verstummt. Nicht die leiseste Brise strich mehr über die Klippe. Schwer wie eine Winterdecke hatte sich die von der Augustsonne aufgeheizte Abendluft auf alles gelegt und hüllte es in gedämpfte Mattigkeit.
Sie ließ ihren Blick über die Bucht schweifen. Die Fischerboote unten am Pier schaukelten unmerklich auf spiegelglattem Wasser; wie in Trance flanierten einzelne Saisongäste die Seepromenade entlang; in der Ferne schimmerten die Kreidefelsen in den gleißenden Farben der versinkenden Sonne und flossen mit den kühlen Tönen des Meeres zusammen. Eine sonderbare Trägheit lag über der gesamten Szenerie.
Gleich morgen früh würde sie ihre Pastellkreiden hervorholen und sich diesen einmaligen Eindruck in Erinnerung rufen, um ihn für die Ewigkeit festzuhalten. Sie würde mit den Brauntönen nicht sparen dürfen, die sie unter das Orange zu mischen hätte, um so die beklemmende Schwere dieses Abends darstellen.
Zügig lenkte Rebecca ihre Schritte durch die engen Gassen Richtung Poststation. Die stehende Luft zwischen den gedrungenen Fachwerkhäusern war erfüllt vom Duft der vielen Blumenampeln, die die Häuserfronten und Straßenlaternen zierten. Darunter mischte sich nur vage der Geruch vom Meer.
Rebecca liebte ihren Heimatort. Sie konnte sich nicht vorstellen, in einer Großstadt wie London zu leben. Sie brauchte den offenen Blick aufs Meer, der ihre Sehnsucht nach fernen Welten beflügelte, ebenso wie die sanften grünen Hügel des Hinterlandes, die ihr ein Gefühl von heimatlicher Geborgenheit vermittelten.
»Guten Abend, Miss Woodward! Wieder ein Brief für Ihre liebe Schwester?« Mr. Major, der hiesige Postamtsleiter, lächelte Rebecca in seiner gewohnt freundlichen Art über die goldgerahmte Brille hinweg an. »Wie gefällt ihr denn das Leben in London?«
Rebecca erwiderte seinen Gruß, während sie ihm den Brief überreichte. »Danke der Nachfrage. Judy ist sehr zufrieden. Die Schwesternschülerinnen am St. Thomas’ werden nach modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen angeleitet, wie sie schreibt. Was für ein Glück, dass sie an Miss Nightingales neu eröffneter Schule aufgenommen wurde – obwohl sie bei uns eine große Lücke hinterlässt.«
»Das glaube ich gern«, entgegnete Mr. Major mitfühlend und stempelte den Brief. »Wie geht es Ihrem Vater? Hat er immer noch so viel um die Ohren?«
»Leider«, erwiderte Rebecca mit einem leisen Seufzer und fischte Geld für das Porto aus ihrem Beutel. »Kein Tag vergeht, an dem er nicht über den Plänen brütet.«
»Das ist ja auch ein bedeutendes Vorhaben für unsere kleine Gemeinde«, schmunzelte Mr. Major. Er tat die Münzen in die Portokasse und wünschte ihr einen guten Abend, wie immer verbunden mit den besten Empfehlungen an den Herrn Vater und Vikar.
Edward Major schaute Rebecca eine Weile durchs Türfenster hinterher. Das kleine Postamt führte er fast sein ganzes Leben lang. Er hatte die beiden Woodward-Schwestern aufwachsen sehen. Darum bemerkte er die Veränderung an der kleinen Becky, wie er die Achtzehnjährige im Stillen immer noch nannte. Seit dem plötzlichen Tod der Mutter vor zwei Jahren und dem kürzlichen Fortgang der Schwester war die Kleine einfach nicht mehr dieselbe. Als Kind war sie stets summend in sein Postamt gehüpft und war überhaupt ein rechter Springinsfeld gewesen, völlig anders als die eher verschlossene, um drei Jahre ältere Judith. Später war ihm zu Ohren gekommen – denn bei achthundertfünfzig Seelen blieb ein ordentlicher Tratsch im Postamt nicht aus –, dass sich Rebecca zu einem Wildfang entwickelt hatte. Zum Leidwesen ihres Vaters war sie lieber in Bäumen und in den Klippen herumgeklettert, war durch die Wiesen und am Strand entlanggestreunt, als dass sie sich mit einer Nadelarbeit, wie es sich für eine wohlerzogene junge Dame gehörte, in den Salon zurückgezogen hätte. Die Liebe zur Natur hatte die kleine Becky bis heute beibehalten, auch wenn sie inzwischen nicht mehr auf Bäume kletterte. Seit dem Tod der Mutter kümmerte sie sich hingebungsvoll um deren Garten und studierte die Botanik.
Edward Major hatte Catherine O’Connor gut leiden können. Sie war mit ihren Eltern aus Irland gekommen, hatte die Kirchenorgel gespielt, die Sonntagsschule geleitet und im Handumdrehen des Vikars Herz erobert. Aber irgendetwas Rätselhaftes war an dieser jungen Frau gewesen, was später ebenfalls ihren Mädchen anhaftete. Sie hatten stets abgeschottet in ihrer eigenen kleinen Welt zwischen Pfarrhaus und großelterlichem Cottage gelebt. Mit Rücksicht auf den Vikar waren sie zwar höflich, aber distanziert behandelt worden. Keiner von den Leuten hatte das Bedürfnis verspürt, sich näher mit den Woodward-Frauen einzulassen. Die Tatsache, dass Catherine sich lieber mit Kräuterkunde beschäftigte, statt den nachmittäglichen Teegesellschaften beizuwohnen, hatte die hiesigen Damen sehr befremdet. Ihre häufige Abwesenheit hatte für Tuscheleien gesorgt. Und die Phantasie der Damenwelt trieb oft seltsame Blüten! So war aufs schönste spekuliert worden, mit welchen „Künsten“ sich die Vikarsgattin wohl abgab. Insgeheim aber hatte sich die eine oder andere gerne ein Pülverchen oder eine Tinktur aus Catherines Naturapotheke geholt, wie Mr. Major den Andeutungen seiner Kundinnen hatte entnehmen können. Vor allem, wenn es um Frauenleiden ging, mieden die Damen offenbar den Gang zu Dr. Pearce, dem hiesigen Leibarzt. Aber keine von ihnen hätte zugegeben, Catherines Dienste in Anspruch genommen zu haben. Auf ihren hochgeschätzten Dr. William Pearce ließen sie nichts kommen.
Der gute Vikar war zwar bekümmert gewesen, dass seine Frau ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen so selten nachkam, weil er aber närrisch in sie verliebt gewesen war, hatte er sie gewähren lassen. Von Catherines geheimen Behandlungen wusste er anscheinend bis heute nichts. Seit die kleine Becky kürzlich dahintergekommen war, wurde das Mädchen von Tag zu Tag ernster. Er verspürte eine väterliche Sorge ihr gegenüber und fragte sich, ob er sich erdreisten dürfe, den Vikar am Sonntag nach der Messe darauf anzusprechen.
Rebecca Woodward war seinen Blicken längst entschwunden, als die letzte Postkutsche des Tages vorfuhr und Edward Major ging, um den Postsack zu überreichen.
Schnellen Schrittes marschierte Rebecca die gewundene Landstraße entlang, vorbei an Wiesen und Weiden, bis sie am Ortsausgang und gut anderthalb Meilen vom Pfarrhaus entfernt das großelterliche Cottage erreichte. Der Garten lag geborgen hinter einer Sandsteinmauer, umgeben von Feldern, Pferdekoppeln und einem Wäldchen. Das kleine reetgedeckte Haus, in dem die Großeltern viele Jahre gelebt hatten, hatte Rebeccas Vater einst für diese erworben, damit die Eltern seiner Ehefrau nicht länger unten im Fischerviertel hausen mussten. Auf ihre alten Tage waren die Großeltern jedoch zu ihren Wurzeln nach Galway zurückgekehrt und hatten Haus und Garten ihrer Tochter Catherine überlassen. Nun war es Rebeccas Aufgabe, sich um beides zu kümmern. Sie tat es freudigen Herzens.
Als sie durch den mit Rosen berankten Torbogen schritt, wurde sie von der ins Abendlicht getauchten Vielfalt an Blumen und Kräutern empfangen. Lavendel, Rosen und Malven wuchsen in stiller Eintracht neben Salbei, Thymian und Johanniskraut. Emsig flogen die letzten Hummeln und Bienen umher, um sich alsbald mit einem reichen Nachtmahl zurückzuziehen. Es war der wohl friedlichste und idyllischste Flecken Erde, den sich Rebecca vorstellen konnte. Sie hatte ihre ganze Kindheit hier verbracht. In jedem Winkel steckten Erinnerungen an ihre geliebten Großeltern und an ihre verstorbene Mutter.
Flink band sie sich eine Gartenschürze um und füllte die beiden Gießkannen mit Wasser aus dem Pumpbrunnen. Vor Einbruch der Dunkelheit musste sie wieder zu Hause sein und es gab allerlei zu tun. Sämtliche Beete sowie die Pflanzen im Gewächshaus mussten gewässert werden, und der hinter dem Haus gelegene Obst- und Gemüsegarten erforderte ebenfalls seine Zeit.
Als sie den Schwengel zum wiederholten Male bediente, geriet sie darüber ins Schwitzen. Sie hielt einen Moment lang inne, um sich abzukühlen, doch regte sich nach wie vor kein Lüftchen. Rebecca ließ die schweren Kannen stehen und schlenderte zu der prachtvollen Linde, die inmitten des offenen Gartens ein wunderbarer Schattenspender war. Die Bank darunter war seit jeher ihr Lieblingsplatz. Wie oft hatten sie alle gemeinsam – die Großeltern, Mutter, Judy und sie – hier gesessen und bei einer Tasse Tee einander Geschichten erzählt, Gedichte vorgetragen oder zusammen musiziert.
Rebeccas Blick fiel auf den Holunderbusch, dessen Beeren bereits die schwarze Reifefärbung annahmen. Vielleicht fände sie in der Kräuterkammer noch ein Fläschchen von Mutters Holunderbeerwein, der gegen Albträume helfen sollte.
Geschwind machte sie sich wieder an die Arbeit und wässerte die Rosenstöcke. Sie waren Mutters ganzer Stolz gewesen. Danach griff sie zur Schere und knipste die verwelkten Blüten ab. Mit Sorge sah sie das goldene Licht schwinden und der Abenddämmerung Platz machen. Im Gemüsegarten zupfte sie daher nur noch im Vorbeigehen das eine oder andere Unkraut und beschloss, die prall auf ihren Stängeln sitzenden Bohnen erst am nächsten Tag zu ernten. Vor dem von Hortensienbüschen eingebetteten Gewächshaus blieb sie dennoch für einen kurzen Moment stehen und bewunderte den malerischen Anblick, der sich ihr bot. Die rot-blauen Blütenkugeln leuchteten jetzt besonders intensiv und grenzten harmonisch an die weiß verputzte Hauswand. Diese war von einer spät blühenden zartrosa Clematis berankt, welche die blau gestrichene Haustür schön zur Geltung brachte. Wie oft hatte sie dieses Motiv nun schon gemalt, und doch sah es in diesem einzigartigen Licht völlig anders aus. Bei den Sommerfrischlern auf der Promenade fanden ihre Bilder stets viel Anklang, und so hatte sie bereits einige verkauft. Die Saisongäste waren berauscht von der Farbenpracht hier im Süden. Nicht umsonst nannte man die Grafschaft den Garten Englands.
Ein seltsamer Laut holte Rebecca aus ihren künstlerischen Betrachtungen und ließ sie aufhorchen. Aber es war anscheinend nur eine Amsel gewesen, die am Waldesrand hoch oben auf einer Tannenspitze ihr Abendständchen trällerte.
Im Gewächshaus war es so stickig, dass sie die oberen Knöpfe ihres Kleides öffnen musste. Der Duft der Datura lag schwer in der warmen Luft und ließ sie ihre Arbeit schnell beenden.
Sich des Holunderbeerweins entsinnend, begab sich Rebecca in ihr heimliches Arbeitsrevier. Die Kräuterkammer, deren Eingang sich gut verborgen im hinteren Teil des Gewächshauses befand, lag halb unter der Erde. Rebecca stieg die drei Stufen in den dunklen Raum hinab und entzündete eine kleine Öllampe. Die deckenhohen Regale waren gefüllt mit vielerlei Gläsern, Fläschchen und Tiegeln, die verschiedene Essenzen und Tinkturen enthielten. Alle waren feinsäuberlich etikettiert. In den unteren Fächern waren Nachschlagewerke und Notizen verwahrt.
Etliche Stunden hatten Judith und sie nach dem Tod der Mutter hier unten verbracht und deren Aufzeichnungen gesichtet, von denen sie bis dahin keine Ahnung gehabt hatten. Ein selbst verfasstes Wörterbuch über Heilpflanzen und ihre Wirkungen war als Hauptwerk zurückgeblieben. Der Tausendsassa unter den Pflanzen, stand darin zu lesen, sei das Wermutkraut: Artemisia absinthium. Es helfe gegen fast alle erdenklichen Beschwerden, gleich ob Durchfall, Rheuma, Infektionen, Skorbut, Zahnschmerzen, Menstruationsbeschwerden, Fieber oder Parasiten. Judith und sie waren beeindruckt gewesen.
Doch nie würde Rebecca den Tag vergessen, an dem sie in einer der Schubladen auf einen doppelten Boden gestoßen waren und darin ein Behandlungsverzeichnis sowie eine Kladde mit der Aufschrift Rezepturen der Kräutersammler gefunden hatten. Während Judith sich Ersteres vorgenommen hatte, hatte sie sich in die Kladde vertieft. Darin war sie auf so aufregende Dinge wie Liebestränke und Orakelkraut gestoßen, welche die Zigeunerinnen aus den Samen der Datura, auch Engelstrompete, herstellten. Rebecca hatte sich mehr als einmal gefragt, ob Mutter diese unter der ausführlich geschilderten Zeremonie je zur Anwendung gebracht hatte. Und falls ja, bei wem.
Ihre erste Aufregung war jedoch bald einer großen Nachdenklichkeit gewichen, als sie beim Durchblättern des Behandlungsverzeichnisses auf höchst illustre Namen gestoßen war, die ihre Mutter nebst Fallstudie dort notiert gehabt hatte. Ausgerechnet jene von Elizabeth Randon und Helen Forsyth waren darunter gewesen, die beiden tonangebenden Damen der hiesigen Gesellschaft, die stets versucht hatten, Rebeccas Mutter in ein zweifelhaftes Licht zu rücken. Dies hatte sie jedoch erst kürzlich herausgefunden. Seitdem fühlte sie einen verletzten Stolz, der ihre Abneigung gegenüber Elizabeth Randon um ein Vielfaches steigerte.
Ein paarmal hatten Judith und sie versucht, mit ihrem Vater über ihre Entdeckungen zu sprechen. Doch wann immer sie nach dem Tod der Mutter das Cottage erwähnt hatten, hatte sich seine Miene verschlossen, sodass sie das Thema bald ganz hatten fallen lassen. Sie hatten ihn in seiner Trauer nicht unnötig damit quälen wollen.
Erschrocken tauchte Rebecca aus ihren Gedanken auf und eilte nach oben. Draußen war es zwischenzeitlich fast dunkel geworden. Hastig wusch sie sich die Hände und legte die Schürze ab.
Sie war gerade dabei, die Gartenpforte hinter sich zu schließen, als sie wiederum einen fremdartigen Laut zu vernehmen glaubte. Sie hielt inne und lauschte. Das geschäftige Summen der Bienen und Hummeln war inzwischen verstummt, kein letztes Wiehern der Pferde klang mehr von der Koppel herüber, selbst die Amsel auf der Tannenspitze hatte soeben ihr Abendkonzert beendet und flog lautlos in den Wald hinein. Der Himmel über den dunklen Baumwipfeln war bereits in ein kräftiges Türkis getaucht und gemahnte sie, ihre Schritte endlich heimwärts zu lenken. Im selben Moment durchbrach der eigenartige Laut erneut die dämmrige Stille. Er klang ähnlich dem Jaulen eines Hundes, aber anders – lang gezogener, zu Herzen gehender. Das nächste Heulen war derart durchdringend, dass sie sich entschlossen auf den Weg zum Wäldchen machte, aus dem sie meinte, den Laut vernommen zu haben.
Kaum hatte sie die ersten Baumreihen passiert, drang dieser aus unmittelbarer Nähe an ihr Gehör. Angestrengt suchten ihre Augen das Unterholz ab. Eine Laterne wäre jetzt nützlich gewesen. Aber aufgrund der vorgerückten Stunde entschied sie, diese nicht zu holen; schließlich kannte sie das Wäldchen wie ihre Rocktasche.
Schon näherte sie sich der knorrigen alten Eiche, in deren oberem Geäst sie als Kind so manche Stunde verträumt hatte. Ihre herbe hölzerne Wärme hatte ihr stets Trost und Kraft gespendet.
Ein plötzliches Flattern ließ Rebecca zusammenschrecken, doch es war nur die Amsel, die dicht an ihr vorbei ins Dickicht flüchtete. Darauf bedacht, mit dem Kleid nicht im Gestrüpp hängen zu bleiben, folgte sie ihr. Nur wenige Schritte später verspürte sie deutlich die Nähe eines ihr fremden Wesens und blieb stehen. Doch nichts als ihr eigener Atem war zu hören. Die unnatürliche Stille begann sie zu ängstigen. Pochenden Herzens versuchte sie das Dunkel zu durchdringen, als sie sich auf einmal von zwei leuchtenden Augen erfasst sah. Vor Schreck entfuhr ihr ein leiser Schrei. Wie angewurzelt stand sie da, unfähig sich zu rühren. Nur undeutlich konnte sie die Umrisse der Kreatur erkennen, die ihr wie die eines großen Hundes erschienen. Mit Hunden kannte sie sich aus, versuchte sie sich zu beruhigen, ihre Großeltern hatten früher einen Hirtenhund gehalten. Mutig näherte sie sich dem fremden Wesen und sprach besänftigend auf es ein. Es stand reglos und ließ sie nicht aus den Augen. Rebecca war nur noch wenige Schritte von ihm entfernt, als der fast volle Mond durch zwei Tannenspitzen lugte und den Platz in ein fahles Licht tauchte. Erschrocken wich sie zurück. Sie traute ihren Augen nicht. Vor ihr stand ein Wolf! Obwohl sie wusste, dass es in England seit dem 17. Jahrhundert keine Wölfe mehr gab, so stand sie zweifelsohne einem leibhaftigen Exemplar gegenüber. Sie hatte genügend Radierungen in ihren Naturkundebüchern gesehen, um einen Wolf von einem Hund unterscheiden zu können.
Vorsichtig tat sie einen weiteren Schritt zurück, bevor ihr Blick auf die Pfoten des Tieres fiel. Da erkannte sie den Grund seines Klagens. Er war in eine Fuchsfalle geraten, denn Füchse hatten sie in dieser Gegend nur allzu viele. Winselnd versuchte er, seine linke Vorderpfote von der Falle zu befreien, als wollte er mit dieser Geste ihre Hilfe einfordern. Als die Wolfsaugen sie für diesen kurzen Moment freigaben, verspürte Rebecca den Impuls fortzulaufen, doch schon hielt der Blick des Wolfs sie erneut fest. Ein seltsames Gefühl von Unverwundbarkeit überkam sie. Ihr war, als ob sich etwas in ihrem Inneren löste und sie ihre eigene Hülle durchbrechen könnte. Beherzt trat sie auf den Wolf zu und streckte ihm ihre Hand entgegen. Er berührte diese sanft mit der Schnauze. Da packte sie die Falle mit beiden Händen und bog sie auf.
Der Wolf war frei. Umgehend beleckte er seine blutende Pfote und war plötzlich verschwunden. Ungläubig starrte Rebecca auf den Fleck, an dem er nur wenige Sekunden zuvor zum Bleiben verdammt gewesen war. Der Mond wanderte derweil seelenruhig weiter und ließ sie in der Finsternis allein zurück.
Als Rebecca im Bett lag, überlegte sie, ob sie jemandem von diesem unglaublichen Vorfall berichten sollte. Ihrem Vater, der sie zornig empfangen hatte, da sie mehr als eine Stunde verspätet heimgekommen war, hatte sie nichts davon erzählt. Zumindest Marc Jennings, dem hiesigen Förster, wollte sie morgen Bescheid geben. Er musste davon unterrichtet werden, wer sich in seinem Forstbezirk herumtrieb. Nur wie sollte sie ihm erklären, dass sie den Wolf von der Falle befreit und damit laufen gelassen hatte? Sie verstand es ja selbst nicht. Woher nur hatte sie die dafür nötige Kraft und Furchtlosigkeit genommen? Und wohin war der Wolf plötzlich entschwunden?
Trotz des in der Kräuterkammer vergessenen Holunderbeerweins schlief sie in dieser Nacht außergewöhnlich tief und fest. Am nächsten Morgen kam ihr das vorabendliche Erlebnis so unwirklich vor, dass sie fast meinte, es nur geträumt zu haben. Lediglich der noch immer vorwurfsvolle Blick ihres Vaters am Frühstückstisch erinnerte sie unangenehm an die Strafpredigt, die sie deswegen hatte über sich ergehen lassen müssen.
Kapitel 2
»Rebecca, bist du so weit?«
»Ja, Papa, ich komme!« Rebecca legte das Perlencollier ihrer Mutter an und warf einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel. Sie war zufrieden. Das neue Abendkleid aus nachtblauem Satin harmonierte vorzüglich zu ihrem aufgesteckten, kupferroten Haar und brachte das leuchtende Blau ihrer Augen gut zur Geltung. Kaskadenförmig fiel der seidige Stoff über die Krinoline und betonte so ihre ohnehin schlanke Taille.
Als sie die Treppe hinabstieg, wo ihr Vater sie bereits erwartete, bemerkte sie seinen beifälligen Blick.
»Du siehst wunderschön aus in diesem Kleid, mein Kind!«
Er ließ sie sich einmal um ihre eigene Achse drehen.
»Danke, Papa«, entgegnete Rebecca erfreut und knöpfte ihre Handschuhe. »Ich habe es bei Lucy‘s anfertigen lassen. Sie haben es nach einem Modell von Worth nachgeschneidert.«
»Demzufolge bist du nach der neuesten Mode gekleidet, nehme ich an«, stellte er schmunzelnd fest und nahm von Mrs. Finigan Hut und Stock entgegen.
»Das hoffe ich doch sehr, denn es hat dich ein kleines Vermögen gekostet«, lachte Rebecca, als sie sich von der Haushälterin in die farblich auf ihr Kleid abgestimmte Mantille helfen ließ.
»Das bist du mir wert, mein liebes Kind. Ich wollte ja, dass du dir zu deinem Geburtstag etwas Hübsches aussuchst. Nicht nur St. Mary’s soll sich in einem neuen Gewand zeigen!«
Mit einem zustimmenden Nicken öffnete Mrs. Finigan ihnen die Haustür und wünschte einen schönen Abend. Draußen wartete bereits die angeforderte Droschke.
Die Zeit wollte einfach nicht verstreichen! Mr. Cornelly, der offenbar glaubte, ein Anrecht auf sie zu haben, nahm sie durchgehend in Beschlag und verhinderte somit, dass andere Herren sie zum Tanz baten. Seine diesbezüglichen Fähigkeiten waren von eher bescheidener Natur, weswegen sie sich gleich nach dem Eröffnungstanz an den für sie reservierten Tisch zurückgezogen hatten. Seit Stunden, so kam es ihr zumindest vor, lauschte sie artig seinen Berichten aus der Londoner Geschäftswelt. Er erzählte mit Eifer und viel Begeisterung von dem überaus erfreulichen Aufschwung seiner kleinen Handelsfirma, den technischen Entwicklungen in der stoffverarbeitenden Industrie und den glorreichen Expansionen der Webfabriken im ganzen Land, als wüsste er nicht, dass es sich nicht schickte, Damen mit derlei Themen zu langweilen. Unterdessen ließ Rebecca ihre Blicke sehnsüchtig über die Tanzfläche schweifen, wo andere Paare zu beschwingten Melodien über das Parkett glitten. Die Kapelle spielte famos einen Walzer nach dem anderen. Doch die Musik schien Mr. Cornelly nicht zu erreichen, zu sehr war er wohl mit tanzenden Zahlen vor seinem geistigen Auge beschäftigt.
Als er von den neu aufgenommenen Handelsbeziehungen zum Kontinent zu berichten begann, vermochte sie ein Gähnen kaum noch zu unterdrücken. Abermals nippte sie an ihrem Getränk, als sie in unmittelbarer Nähe Melissa Randon bemerkte. Die Tochter des Hauses war, wie nicht anders zu erwarten, von einer Traube junger Verehrer umgeben, die sich an Komplimenten verausgabten, um die Ehre eines Tanzes zu erhalten. Melissa verstand sich auf die Kunst, allen gleich viel Aufmerksamkeit zu schenken und damit die Hoffnung bei jedem einzelnen zu schüren. Kokett lachend warf sie ihren Kopf nach hinten, bevor sie einem ihrer Galane den behandschuhten Arm bot, der sie daraufhin mit stolzgeschwellter Brust zum Tanzparkett führte. Als Schönheit hätte man Melissa nicht bezeichnen können, ihr Gesicht erinnerte eher an das eines Pferdes, aber als Ausgleich setzte sie geschickt ihre weiblichen Reize ein. Ihr vieldeutiger Augenaufschlag sowie ihr in eine gewisse Richtung gehendes Geplänkel hätte man als anzüglich bezeichnen können, doch ihr gesellschaftlicher Rang erlaubte es ihr. Ihren Verehrern schien es offenbar zu gefallen. Wie Mrs. Randon so hielt auch Melissa die Fäden in der Hand und ließ alle nach ihrer Pfeife tanzen. Rebecca wunderte sich über die Einfalt der jungen Herren. Durchschauten sie Melissas Spiel wirklich nicht, oder fanden sie einfach Gefallen daran, sich wie eine Horde sabbernder Köter um sie zu scharen?
»… das bedeutet einen Gewinn von achttausend Pfund pro Jahr. Mr. Farlow muss nur noch den Vertrag unterzeichnen. Damit wäre es mir in absehbarer Zeit möglich, eine Wohnung in einem respektablen Stadtbezirk zu beziehen und darüber hinaus ... Hören Sie mir überhaupt noch zu, Miss Woodward?«
Rebecca tauchte aus ihren gehässigen Gedanken auf und begegnete Peter Cornelly mit einem schuldbewussten Lächeln.
»Bitte verzeihen Sie mir. Ich fürchte, mir ist nicht ganz wohl.«
»Darf ich Sie an die frische Luft begleiten?« Umgehend erhob er sich, um ihr seinen Arm zu reichen. Seine sanften Augen glitten besorgt über ihr Gesicht.
»Sehr liebenswürdig, Mr. Cornelly, aber bitte bemühen Sie sich nicht, ich komme schon allein zurecht.«
Damit ließ sie ihn stehen und gelangte forschen Schrittes, die Blicke der anderen Gäste meidend, auf die gegenüberliegende Seite des Saals, wo zwei geöffnete Flügeltüren auf eine großzügige Terrasse hinausführten. Dort tummelten sich bereits einige Gäste, um wie sie frische Luft zu schnappen. Rebecca suchte sich einen einsamen Winkel, von wo aus sie die herrliche Parkanlage überblicken konnte. Während die Klänge eines Wiener Walzers zu ihr herausschwebten, stellte sie betroffen fest, dass es noch früh am Abend war; die Dämmerung hatte gerade erst eingesetzt. Weitere Stunden Langeweile standen ihr bevor, bis die Etikette es zuließ, sich zu verabschieden.
Kein Wunder, dass Elizabeth Randon wie eine venezianische Löwin um das Anwesen gekämpft hatte, ging es Rebecca bei dem Anblick, der sich ihr bot, durch den Kopf. Gleich nachdem die Randons aus Florenz zurückgekehrt waren, wo James ein Vermögen mit Immobilien gemacht hatte, hatten sie das baufällige Herrenhaus seinem Besitzer, einem hochbetagten Aristokraten ohne Familienanhang, abzukaufen versucht. Elizabeth hatte es damals maßlos empört, dass sich Lord Harrington – trotz der unerhörten Summe, die ihr Gatte bereit gewesen war für diese Ruine nebst verwilderter Parkanlage zu zahlen – strikt geweigert hatte, sein Anwesen zu veräußern. Immer wieder hatten sie mit dem schrulligen Kauz, wie sie den Lord respektlos genannt hatten, Verhandlungen aufgenommen. Vergebens. Bis eines Tages das Glück in Form des unerwarteten Todesfalls von Lord Harrington Elizabeth zum Objekt ihrer Begierde verholfen hatte. Da es keinerlei Erben gegeben hatte, die Anspruch hätten erheben können, war das Anwesen sowie die dazugehörigen Ländereien in den Besitz der Diözese gefallen. Die Randons zählten den Erzbischof von Canterbury zu ihren näheren Bekannten. Somit war es ihnen ein Leichtes gewesen, endlich in den Besitz des Anwesens zu gelangen. Sie hatten das alte Herrenhaus abreißen lassen und den jetzigen Palast im florentinischen Stil darauf errichtet. Er wurde von allen mit einem leicht spöttischen Unterton Il Palazzo genannt, denn er nahm sich ein wenig sonderbar in der englischen Steilküstenlandschaft aus. Auch hatte Elizabeth ihre liebe Not mit den nicht heimischen Pflanzen. Zypressen und Pinienbäume mochten sich hier im Süden des Landes noch akklimatisieren, aber Oliven- und Orangenhaine ließen sich beim besten Willen nicht kultivieren, weswegen bereits drei Gärtner ohne Lohn entlassen worden waren.
Obwohl Rebecca die Herrin des Hauses nicht leiden konnte, musste sie ihr bezüglich der Gartengestaltung Anerkennung zollen. Von der Terrasse aus führte eine Zypressenallee zu einem Springbrunnen mit einer römischen Götterstatue in dessen Mitte. Umstehende Marmorbänke, flankiert von Rosenbeeten und Amphoren aus Terrakotta, luden zum Verweilen ein. Die Allee führte von dort zu einem im waldigen Bereich des Gartens gelegenen römischen Tempel, den man von der Terrasse aus nur als hellen Fleck im dunklen Grün ausmachen konnte. Aus irgendeinem Grunde blieb Rebeccas Blick genau dort hängen. Ein unerklärlicher Drang, sich umgehend dorthin zu begeben, bemächtigte sich ihrer.
Sie war gerade im Begriff, zu der in den Garten hinabführenden Freitreppe zu gehen, als sie beim Namen gerufen wurde. Irritiert blickte sie sich um und sah ihren Vater auf sich zutreten.
»Geht es dir nicht gut, mein Kind?«, fragte er besorgt und bot ihr seinen Arm zum Spaziergang. »Du siehst müde aus.«
»Keine Sorge, Papa, es ist alles in Ordnung«, versicherte sie ihm und hakte sich bei ihm ein. »Mir war nur nach frischer Luft, es ist recht stickig im Saal.«
Gemeinsam stiegen sie die Treppe hinab, die am Fuße zu beiden Seiten von auf Podesten sitzenden venezianischen Löwen gesäumt wurde, und spazierten die einsame Zypressenallee entlang. Musik und Stimmengemurmel aus dem Tanzsaal verblassten und wichen dem Abendgesang der Vögel sowie dem Zirpen vereinzelter Grillen. Ihre Schritte knirschten überlaut auf dem im Zwielicht leuchtenden Kies.
»Ich bin nicht müde, Papa«, nahm Rebecca das Thema wieder auf, »nur … ermüdet. Mr. Cornelly lässt mich kaum aus den Augen!«
»Ist das ein Wunder?«
Rebecca warf ihrem Vater ein scheues Lächeln zu. Wie immer, wenn sich mit ihm ernste Gespräche anbahnten, legte sich eine eiserne Fessel um ihren Hals.
»Ehrlich gesagt«, presste sie hervor, »halte ich Mr. Cornelly für einen recht langweiligen Menschen.«
Die zu erwartende Reaktion ihres Vaters kam prompt.
»Wie kannst du jemanden so schnell aburteilen, Becky?«, entrüstete er sich und warf ihr einen tadelnden Blick zu. »Du kennst ihn doch noch gar nicht richtig. Er hat jedenfalls eine vielversprechende Zukunft vor sich. Demnächst will er Robert Emerson zu seinem Teilhaber machen. Dessen Handelsfirma beliefert die angesehensten Maßschneidereien in St. James’s.«
Als Rebecca sich davon unbeeindruckt zeigte, fuhr er umso eindringlicher fort:
»Du solltest dich allmählich anderen Dingen zuwenden als nur deinen Blumen und Phantastereien. Dieser hoffnungsvolle junge Mann steht immerhin mit beiden Beinen im Leben. Es wird ihm ein Leichtes sein, eine Familie zu ernähren.«
»Was soll das heißen, Papa?«, brauste Rebecca auf und blieb auf der Stelle stehen. »Willst du mich möglichst schnell unter die Haube bringen? Bin ich dir so sehr im Weg?«
»Rebecca!«
Verlegen bat sie um Verzeihung.
»Es wird nur langsam Zeit«, fuhr er besänftigt fort, als sie ihre Schritte wieder aufnahmen, »dass du dich nach einem geeigneten Ehemann umsiehst.«
»Das sagst ausgerechnet du, wo du selbst erst so spät geheiratet hast?«
»Bei uns Männern ist das etwas anderes, mein Kind. Doch du musst deiner Bestimmung als Frau nachkommen. Deine Mutter war übrigens im selben Alter wie du, als sie mich heiratete. – Du hast bisher nur wenig Interesse an möglichen Bewerbern gezeigt, Becky«, fügte er mahnend hinzu. »Peter Cornelly scheint ganz vernarrt in dich zu sein. Diese Chance solltest du nutzen.«
»Aber wenn ich mir doch so gar nichts aus ihm mache?«
Ein mildes Lächeln huschte über die strengen Züge ihres Vaters. »Manchmal kommt die Liebe erst in der Ehe, Becky, sie muss sich entwickeln, verstehst du?«
Beim römischen Brunnen angelangt, blieb er stehen und nahm sie mit väterlicher Fürsorge bei den Schultern. »Gott segnet diejenigen mit Glück, die frommen und guten Herzens sind. Vertrau auf Gott, mein Kind, dann wirst auch du glücklich werden.«
Die warmen braunen Augen ihres Vaters füllten sie wie immer mit ungewollter Zuversicht.
»Du hast Mutter doch aus Liebe geheiratet, nicht wahr, Papa?«, fragte sie zaghaft, während Amors Pfeil im hohen Bogen Wasser in den Abendhimmel schoss.
»Ja, das habe ich. Es war Liebe auf den ersten Blick. Meine Catherine war ein Gottesgeschenk.« Für einen Augenblick legte sich ein feuchter Schleier auf seine Augen, bevor er sich wieder besann und fortfuhr. »Aber so etwas ist selten, Becky. Darauf darfst du nicht warten. Deine besten Jahre laufen dir sonst davon.«
»Ach, Papa«, entgegnete Rebecca fast schon ein wenig belustigt, »ich bin doch gerade erst achtzehn geworden.«
»Auch ich bin, wie mir scheint, vor Kurzem erst achtzehn geworden, und dann hat der liebe Gott mich so lange warten lassen.«
Schweigsam setzten sie ihre Schritte fort, ein jeder in seine Gedanken vertieft. Die Vögel waren inzwischen verstummt und ließen den Grillen den Vortritt.
»Die Zeit verrinnt schneller, als du glaubst, mein Kind«, nahm er den Faden wieder auf. »Für deine Schwester ist der Zug bereits abgefahren, wie man so sagt. Wer aus den besseren Kreisen will schon ein berufstätiges Weib an seiner Seite? Bis Judith ihre Ausbildung beendet hat, gilt sie ohnehin als alte Jungfer.«
»Was bist du nur altmodisch, Papa«, lachte Rebecca auf. »In London denkt man anders darüber. Judy schreibt, dass dort etliche Frauen studieren oder einen Beruf ausüben, bevor sie in den Bund der Ehe treten.«
»Was deine Schwester dir für unerhörte Flausen in den Kopf setzt!«, schnaubte er. »Was wolltest du dort wohl studieren? Wie man sich als Dienstmagd oder Fabrikarbeiterin verdingt? Wie man sich die Finger wund näht oder in einer Wäscherei die Haut von den Händen schrubbt? Das hast du bei deinem Aussehen und meinem Ansehen, Gott sei’s gedankt, nicht nötig, auch wenn ich dir ansonsten nur wenig mit in die Ehe geben kann. Wenn du es geschickt anstellst und dir die Gunst der Stunde nicht entgehen lässt, Becky, wirst du schon bald einen ehrenwerten Haushalt in London führen und selbst eine Dienstmagd und Waschfrau befehligen.«
»Aber ich –«
»Aber du«, schnitt ihr Vater ihr brüsk das Wort ab, »wirst auf jeden Fall heiraten, Rebecca.«
Das schnürende Gefühl in der Kehle nahm ihr fast die Luft. Sie kam sich vor wie ein in die Enge getriebenes Wild, das zum Abschuss freigegeben war. Ihr Vater fungierte in diesem bösen Spiel als Treiber, Peter Cornelly als Jäger. Aber wieso sollte sie das unschuldige Reh abgeben? Wer sagte, dass sie mitspielen wollte?
Ein trotziger Zug legte sich um ihre Mundwinkel. Sie ließ ihren Vater stehen und stieg die fünf bemoosten Stufen zum Tempel hinauf, den sie mittlerweile erreicht hatten. Aus den Augenwinkeln sah Rebecca ihren Vater ihr streng hinterherblicken.
Auf einmal war es wieder da, dieses unerklärliche Drängen, das sie hergeführt hatte. Alle grimmigen Gedanken verflogen und machten Platz für etwas Größeres, Bedeutsameres, dessen Wesensart sie nicht zu greifen vermochte. Ein sonderbares Gefühl erfüllte mit ungestümer Macht ihre Sinne. Mit beschleunigtem Herzschlag betrat sie die Galerie und schaute zu den in Stein gemeißelten Köpfen empor. Deren seelenlose Augen ließen sie frösteln. Ein schmiedeeisernes Tor versperrte den Zugang zum Inneren des Tempels, der in völliger Dunkelheit lag. In ihren eigenartigen Empfindungen gefangen, betrachtete sie die ins Zwielicht getauchten Reliefs, als sie meinte, einen flüchtigen Schatten in die Finsternis des Tempelinneren eintauchen zu sehen. Sie spürte die Gegenwart einer ihr fremden und zugleich seltsam vertrauten Macht. Plötzlich war ihr, als ob sich alles Erdrückende von ihr höbe und sie schwerelos zurückließ. Wie schon einmal vor Kurzem glaubte sie, ihre sie einengende Hülle verlassen und aus ihrem Körper hinaustreten zu können. Dieses Gefühl grenzenloser Freiheit brachte sie ins Taumeln. Halt suchend lehnte sie sich an eine der Säulen, froh, den kalten festen Stein im Rücken zu spüren. Kraft und Wille schwanden derweil immer mehr, als ob sich Körper und Geist auflösten, um in eine andere Welt einzutreten. Sie vermochte sich nicht dagegen zu wehren, vielmehr verspürte sie den Wunsch, es geschehen zu lassen. Als etwas Besitz von ihr ergriff, erschauerte sie bis ins Mark.
»Rebecca, was ist mit dir?!«
Ein Ruck durchfuhr sie und warf sie zurück in ihre Welt. Sie war wieder die Gefangene ihrer selbst.
Schwankend griff sich Rebecca ans Herz. Der sehnsuchtsvolle Schmerz, der sie unversehens erfasste, war so groß, dass er ihr die Tränen in die Augen trieb. Erschrocken eilte ihr Vater die fünf Stufen zu ihr hoch und stützte sie.
»Macht dir der Gedanke an eine Heirat so sehr zu schaffen, mein Kind?«, fragte er besorgt.
Rebecca sah sich nicht in der Lage, das Missverständnis aufzuklären. Was hätte sie antworten, wie ihre soeben durchlebten Empfindungen beschreiben sollen?
»Nun gut, ich denke, wir sollten uns wieder unter die Leute mischen, Becky«, beschloss er, als er keine Antwort erhielt.
Schweigend traten sie den Rückweg an. Inzwischen hatte sich völlige Dunkelheit über den Garten gelegt. Rebeccas Inneres jedoch war in hellem Aufruhr.
Als Rebecca und ihr Vater den von Kronleuchtern erhellten Saal betraten, spielte die Kapelle gerade die Quadrille. Beim Klang der Musik wurde Rebecca sofort leichter ums Herz. Eine Zeit lang sah sie den Tanzenden zu. Nur wenige tummelten sich jetzt noch am Rande, darunter, wie sollte es anders sein, Peter Cornelly. Er schaute dem Treiben von ihrem Tisch aus gelangweilt zu, bis er den Kopf wandte, um vermutlich nach ihr Ausschau zu halten. Schnell versteckte sie sich hinter einem Farn, der auf einer Säule am Rande der Tanzfläche platziert war.
Nach der Quadrille kam glücklicherweise Simon Forsyth auf sie zu und bat sie um den nächsten Tanz. Er war der Sohn des Bankdirektors George Forsyth und dessen Gattin Helen, die gerade mit ihrem Vater ins Gespräch gekommen waren. Wie die meisten der an diesem Abend geladenen Gäste, führten die Forsyths ihre Geschäfte in London und unterhielten hier einen Landsitz. Auch der ansässige Adel war vertreten sowie die Würdenträger der Gemeinde, was ihrem Vater, dem Vikar von St. Mary’s, die Gelegenheit bot, Geldgeber für die Restaurierung seiner Kirche zu finden.
Rebecca genoss die rasanten Hüpfbewegungen der Polka, die leider viel zu schnell endete. Simon hatte sie leichtfüßig zu führen gewusst. Höflich bedankte er sich für den Tanz und wandte sich wieder seiner Dame des Abends zu.
Kaum hatte Rebecca die Tanzfläche verlassen, sah sie Peter Cornelly auf sich zusteuern. Hastig lenkte sie ihre Schritte zum Buffet, um das sich gerade mehrere Gäste versammelt hatten, und tauchte in der Menge unter. Ihr war bewusst, wie unhöflich ihr Verhalten auf Mr. Cornelly wirken musste; in Gedanken hörte sie bereits die Schelte ihrer Schwester. Aber nach den nun offenkundigen Bestrebungen ihres Vaters, vermochte sie Peter Cornellys Gegenwart noch weniger zu ertragen. Ihr war klar, dass beide schon Gespräche bezüglich einer etwaigen Verbindung geführt hatten. Jeden Blick und jedes Wort von ihr würde Mr. Cornelly darum auf die Waagschale legen und nach Möglichkeit zu seinen Gunsten auslegen. Oh nein, sie wollte ihn keinesfalls durch irgendeine unbedachte Äußerung oder Geste auch noch ermutigen. Jedwede nicht zu vermeidende Konversation mit ihm würde sie von jetzt an mit besonderer Vorsicht führen müssen. Allein der Gedanke daran war erschöpfend.
Die Schlange der Wartenden, in die Rebecca sich eingereiht hatte, war mittlerweile bis zum Tafelanfang vorgerückt. Verstohlen hielt sie nach ihrem Verfolger Ausschau und gewahrte ihn ganz in der Nähe, wo er in ein Gespräch verwickelt worden war. Erleichtert ließ sie ihre Blicke über die ihr fremden italienischen Speisen gleiten, während ein Diener geduldig auf ihre Auswahl wartete. Gerade als sie unschlüssig wieder aufsah, kam die Gastgeberin mit zuckersüßer Miene auf sie zustolziert.
»Da sind Sie ja, meine Liebe«, flötete Elizabeth mit erhobener Stimme, die ihr die Aufmerksamkeit der Umstehenden garantierte. »Wir haben Sie schon überall gesucht. Man möchte meinen, Sie hätten sich mit Absicht hier versteckt!«
Rebecca wusste ihr nur mit einem verlegenen Lächeln zu antworten und ärgerte sich, dass sie keine passende Antwort parat hatte.
»Der gute Peter vermisst Sie bereits«, flüsterte Elizabeth hinter vorgehaltener Hand und brachte durch eine affektierte Geste ihre Brillantringe auf den karminroten Handschuhen zum Funkeln. »Wie schön, dass auch für Sie endlich jemand Interesse bekundet, wir hatten uns schon ernsthaft Sorgen um Sie gemacht, Kindchen! Einen Mangel an Bewerbern sind wir von unserer Melissa ja nun wirklich nicht gewohnt.« Sie stieß ein falsches Lachen aus, das dem eines Wieherns nicht unähnlich war. »Ich hoffe doch, meine Liebe, dass Sie meine Fürsprache zu schätzen wissen. Man tut, was man kann, nicht wahr?« Damit entschwand sie, um lautstark einen spät ankommenden Gast zu begrüßen.
Rebecca schäumte vor Wut. Ihr hatte sie also diesen unliebsamen Verehrer zu verdanken! Doch Elizabeth spielte bestimmt nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit die Kupplerin. War sie womöglich in Sorge, Rebecca könnte etwas von ihrem kleinen Geheimnis in Erfahrung gebracht haben? Ihr war nicht entgangen, dass Mrs. Randon ihren Vater in seiner Meinung bestärkte, dass das verlassene Cottage kein angemessener Aufenthaltsort für eine junge Dame sei. Daher lag der Verdacht nahe, dass Elizabeth sie aus dem Weg haben wollte. Doch so einfach würde sie das Feld nicht räumen. Mochten alle anderen nach Mrs. Randons Pfeife tanzen, sie jedenfalls nicht!
Erst durch das diskrete Räuspern des Dieners, der immer noch darauf wartete, etwas von den vielen Köstlichkeiten für sie auflegen zu dürfen, tauchte sie aus ihren düsteren Gedanken wieder auf. Dankend lehnte sie ab. Der Appetit war ihr restlos vergangen. Sie spürte nur noch den dringenden Wunsch, von hier fortzukommen. Abrupt drehte sie sich um und stieß mit einem hochgewachsenen Herrn zusammen, der sich gerade mit einem Glas Rotwein in der Hand dem Buffet genähert hatte. Ein Teil des Weines schwappte über seinen äußerst eleganten Abendanzug und tropfte zu Boden.
»Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung, mein Herr!«, rief Rebecca erschrocken aus. Ohne aufzuschauen, griff sie nach einer Serviette, um den Wein von seinem Revers zu tupfen, als seine behandschuhte Hand sich auf die ihre legte. Schlagartig hielt sie in ihrer Bewegung inne und sah zu dem Fremden auf. Zwei tiefschwarze Augen erfassten die ihren und schauten ihr bis auf den Grund ihrer Seele. Sie erstarrte und konnte weder ihren Blick abwenden, noch war sie zu einer sonstigen Handlung fähig. Sie hätte fast das Atmen vergessen, wenn der Fremde den Bann nicht durch ein versöhnliches Lächeln gebrochen hätte.
»Ich habe mich bei Ihnen zu entschuldigen, gnädiges Fräulein, da ich Ihnen offenbar in die Quere gekommen bin«, entgegnete er mit einer tief tönenden, sanften Stimme, in der ein leichter Akzent durchklang. »Verzeihen Sie bitte meine Unaufmerksamkeit.«
Erst jetzt löste er seine Hand von der ihren und Rebecca erwachte aus ihrer Starre. Zu sehr hatte seine unerwartete Berührung sowie sein intensiver Blick sie verwirrt gehabt. Als sie ihn nun genauer betrachtete, bemerkte sie seine fremdländisch und zugleich aristokratisch wirkenden Gesichtszüge. Entgegen der englischen Herrenmode trug er keinen Bart. Sein kräftiges schwarzes Haar fiel in sanften Wellen bis auf die Schultern. Kinn und Lippen verliehen ihm einen strengen, fast gebieterischen Ausdruck, der im starken Kontrast zu seinem weichen, geheimnisvollen Blick stand. Die dunkelrote mit Goldstickerei versetzte Weste unterstrich seine exotische Vornehmheit.
»Sie haben es wohl ziemlich eilig?«, fragte er interessiert.
Rebecca lächelte verlegen. »Ich wollte eigentlich ...«
Sie stutzte. Mir ein ruhiges Plätzchen suchen, hatte sie sagen wollen, stattdessen gestand sie offen:
»... einfach nur fort von hier.«
»Wie außerordentlich schade! Ich hatte gehofft, noch ein wenig mit Ihnen plaudern zu dürfen. Es kommt nicht häufig vor, dass mich eine junge Dame mit Wein überschüttet, noch bevor ich mit ihr ein paar Worte gewechselt habe«, fügte er augenzwinkernd hinzu.
Rebecca errötete. »Es tut mir wirklich furchtbar leid, mein Herr. Wie kann ich es wieder gutmachen?«
»Nichts einfacher als das, schenken Sie mir den nächsten Tanz!«
»Sehr gerne«, willigte Rebecca ein. Eine unerklärliche Erregung bemächtigte sich ihrer. Die Kapelle spielte die ersten Takte eines Strauß-Walzers an und ehe sie sich versah, legte er seine Hand um ihre Taille und wirbelte sie zum Takt der Musik herum. Doch wie geschah ihr? Ihr war, als ob sie sich in seinen Armen auflöste, ganz so, wie sie es kurz zuvor beim Tempel erlebt hatte. Eine von ihm ausgehende überirdische Kraft zog sie mit sich in einen nicht enden wollenden Strudel. Ihr Herz klopfte bis zum Zerspringen. Für den Bruchteil einer Sekunde stieg Furcht in ihr auf und sie meinte, gegen etwas, von dem sie nicht wusste, was es war, ankämpfen zu müssen. Doch dann gab sie nach und ließ es siegen.
Kent im August 1860
Liebe Judy,
es tut mir leid, dass Du so lange auf Antwort von mir warten musstest. Zu viele Gedanken und Gefühle haben mich in den letzten Tagen aufgewühlt. Mir ist schon ganz wirr davon.
Es hat sich vieles ereignet seit meinem letzten Brief – unwirklich Schönes, aber auch Furchtbares, geradezu Unfassbares. Ich weiß gar nicht, was ich denken, glauben oder fühlen soll. Ach, wärest Du doch bei mir, Judy! Ich brauche jemanden, der mir meine krausen Gedanken glattzieht und meine wirren Gefühle ordnet. Ich werde sonst noch verrückt.
Zunächst zu den furchtbaren Dingen: Mr. Cornelly hat am Sonntag um meine Hand angehalten! Du hältst mich jetzt gewiss für undankbar. Schließlich müsste ich mich glücklich schätzen, eine so gute Partie zu machen, zumal ein finanziell sorgenfreies und gesellschaftlich attraktives Leben in London auf mich wartet. Das ist jedenfalls das, was Papa meint. Er ist wild entschlossen, mich ihm zur Frau zu geben. Eigentlich ist die Sache bereits besiegelt.
Du weißt, dass ich für solch ein Leben nicht geschaffen bin, Judy. Ich werde in London verdorren wie eine Blume in der Wüste. Der einzige Lichtblick scheint mir, dass Du dann wieder in meiner Nähe wärest.
Natürlich habe ich mich bis zum Äußersten gewehrt, worüber Papa so erzürnt war, dass er mir drohte, mich in ein Kloster auf dem Kontinent zu schicken, falls ich mich partout weigern sollte. Daraufhin habe ich die Nerven verloren und sehr unbedachte Dinge gesagt. Im Nachhinein schäme ich mich dafür, aber es sprach die pure Verzweiflung aus mir. Ein Wort gab das andere. Papa beklagte sich bitterlich, dass ich meine Zeit ohnehin nur unnütz in „diesem verdammten Garten“ vertrödeln würde. Da fühlte ich mich so verletzt, dass ich ihn bezichtigte, keine Ahnung von Mutters Heilkünsten gehabt zu haben, deren Aufzeichnungen ich nun studierte, um ihr Wissen fortleben zu lassen, und dass alle anderen darüber Bescheid gewusst hätten und jahrelang Nutznießer gewesen seien, nur er es nicht habe wahrhaben wollen.
Es war schlimm, Judy, so außer sich habe ich Papa noch nie erlebt. Er hat mich geohrfeigt und behauptet, dies sei eine Lüge. Ich verstand nicht, warum er Mutters Fähigkeiten derart leugnete, und habe ihn aufgefordert, sich selbst ein Bild davon zu machen.
Judy, bitte vergib mir! Ich hasse mich selbst dafür, dass ich ihn in Mutters Kräuterkammer führte. Dort ist das Unfassbare passiert: In einem Anfall von Raserei hat er sämtliche Fläschchen und Tiegel aus den Regalen gefegt, bis sie in Scherben am Boden lagen. Danach hat er zum Spaten gegriffen und alle Zöglinge und Pflanzen im Gewächshaus zerhackt. Ich hatte ernsthaft Sorge, er würde als nächstes damit auch auf mich losgehen!
Ich habe ihn angefleht einzuhalten, doch er war wie von Sinnen. Schließlich hat er in der Wohnstube nebenan ein Feuer im Kamin entzündet und sämtliche ihrer Aufzeichnungen verbrannt. Ich habe geschrien, dass er kein Recht dazu habe, aber das hat ihn nur noch rasender gemacht.
Judy, unser Vater hat gewütet wie der Leibhaftige! Ich hatte solche Angst! Mutters Lebenswerk liegt in Schutt und Asche. Er hat alles vernichtet, alles … meine ganze Welt. Was soll ich bloß tun?
Ich fürchte, ich muss diesen Brief ein anderes Mal fortsetzen. Die schrecklichen Erinnerungen kosten mir zu viel Kraft. Ich verlasse mein Zimmer seitdem kaum noch. Wohin sollte ich mich auch wenden? Der Anblick der Verwüstung raubt mir den Verstand.
Gott, verzeihe mir, dass es so weit gekommen ist! Ich finde nur noch Trost in einem einzigen Traum.
Deine verzweifelte Becky
Rebecca brachte den Brief noch am selben Abend zu Mr. Major, der ob Rebeccas mitgenommenen Aussehens sehr erschrak. Er besaß allerdings zu viel Taktgefühl, um Fragen zu stellen. Einiges über diesen sonderbaren Ball im Hause der Randons war bereits zu ihm durchgedrungen. Miss Becky solle in aller Öffentlichkeit ihren Bewerber Mr. Cornelly brüskiert haben, indem sie bis weit in die Morgenstunden hinein allein mit einem der anderen Gäste getanzt habe, noch dazu mit einem Ausländer! Als ihr Vater ihr schließlich Einhalt geboten habe, sei es zu einer hässlichen Szene zwischen Vater und Tochter gekommen. Vikar Woodward habe daraufhin dem zukünftigen Bräutigam mit Engelszungen zureden müssen, um ihn von einem Duell mit dem fremden Edelmann abzuhalten. Dieses wäre auf jeden Fall tödlich für Mr. Cornelly ausgegangen, da waren sich seltsamerweise alle Zeugen des Vorfalls einig.
Ihm tat das Kind leid. Miss Becky war noch so jung und gefühlsmäßig sicher ein wenig verwirrt, wie es junge Damen oftmals waren. Woher sollte sie auch wissen, was für sie gut war? Gottlob war Vikar Woodward ein besonnener, liebevoller Mensch, der mit Gottes Hilfe, und diese war ihm dank seines Berufes gewiss, Miss Becky schon auf den richtigen Weg führen würde.
Kapitel 3
An einem wolkenverhangenen Sonntagmorgen entstieg der ersten Postkutsche des Tages, die am King‘s Arms Inn neben der Poststation hielt, eine sorgenvolle Judith Woodward. Unter normalen Umständen wäre sie voll freudiger Erwartung nach Hause zurückgekehrt, aber der Brief ihrer Schwester hatte sie zu sehr beunruhigt.
Judith zahlte den Kutscher aus und nahm gierig ein paar tiefe Atemzüge voll Seeluft. Dann prüfte sie den Sitz ihrer Haube, hob ihre Tasche auf und machte sich auf den Weg zu ihrem Elternhaus.
Die Main Street war zu dieser frühen Stunde menschenleer. Die meisten Leute saßen noch beim Frühstück oder bereits in der Messe. Unten am Strand warteten die aufgereihten Bademaschinen auf die wasserfreudigen Saisongäste, um sie ins Meer zu befördern, wo sie sich, vor fremden Blicken geschützt, am kühlen Nass erfreuen konnten. Als Judith ihren Blick hob, konnte sie einen Teil des Pfarrhauses erkennen, das auf der vor ihr liegenden Klippe lag. Der Kirchturm von St. Mary’s diente nicht nur den Seeleuten seit jeher als Orientierung. Er strahlte eine heimelige Verlässlichkeit aus.
Trotz der kühlen Brise an diesem Morgen geriet Judith auf dem stetig ansteigenden Weg ins Schwitzen. In der Church Lane vernahm sie das Kyrie aus dem Inneren St. Mary’s; der Gottesdienst war also noch in vollem Gange. Daher bestand eine gute Chance, ihre Schwester allein anzutreffen. Judith hatte ihr Kommen nicht angekündigt, dafür war ihre Entscheidung zu spontan gewesen.
Sie betätigte den Türklopfer. Alles blieb ruhig, nichts regte sich im Haus. Mrs. Finigan nahm gewiss wie üblich an der sonntäglichen Frühmesse teil, um sich anschließend in aller Ruhe dem Sonntagsbraten widmen zu können. Doch sollte auch Becky dies tun, nach allem was vorgefallen war? Sie konnte es sich nicht vorstellen und vermutete ihre Schwester noch im Bett. Daher nahm sie ein paar Kieselsteine auf, ging zur Rückseite des Hauses und warf diese an Rebeccas Schlafzimmerfenster. Sie musste dies mehrmals wiederholen, bis die Gardine zur Seite gezogen und das Fenster hochgeschoben wurde. Der schlaftrunkene Kopf ihrer Schwester erschien.
»Judy! Träume ich, oder bist du es wirklich?« Ungläubig starrte Rebecca zu ihr herunter, als wäre sie eine Erscheinung.
»Ich bin es leibhaftig, Becky. Komm runter und lass mich rein!«
Kaum war die Haustür geöffnet, flog ihr Rebecca, nur im Nachtkleid und auf bloßen Füßen, um den Hals. »Du bist da, ich kann es kaum fassen«, weinte sie außer sich vor Freude.
»Um Gottes willen«, erwiderte Judith, nachdem sie sich aus den Armen ihrer Schwester befreit hatte, »du siehst ja todkrank aus!« Ohne abzulegen, führte sie ihre Schwester zurück auf ihr Zimmer.
»Wie lange kannst du bleiben?«, fragte Rebecca eingeschüchtert, als Judith sie sanft aufs Bett schob, um ihren Puls zu fühlen.
»Ich fürchte, ich muss bereits morgen Mittag wieder abreisen, Becky, mein Dienstplan ist sehr eng.«
»Bitte schlaf heute Nacht bei mir mit im Zimmer!«
»Das mach ich gerne. – Dein Puls ist zwar etwas erhöht, aber das darf ich wohl meiner Gegenwart zuschreiben. Allerdings gefällt mir deine extreme Blässe überhaupt nicht.«
»Ich habe seit Nächten nicht geschlafen ...«
»Du musst mir nachher alles ganz genau erzählen. Aber habe bitte Verständnis dafür, dass ich auch mit Vater ein paar Worte unter vier Augen sprechen möchte.«
»Natürlich, Judy«, entgegnete Rebecca. »Ich bin so froh, dass du da bist. Ich weiß weder ein noch aus.«
»Hast du Fieber?« Besorgt legte Judith ihr die Hand auf die Stirn.
»Ich glaube nicht, nur furchtbare Kopfschmerzen. Sie plagen mich schon seit Tagen. Dr. Pearce hat mir Laudanum verschrieben, aber es hilft nicht. Ich schlafe meist erst in den späten Morgenstunden ein. Dann träume ich wirr und wache schweißgebadet auf.«
»Du solltest dich jetzt erst einmal anziehen und frühstücken«, entschied Judith. »Danach kannst du dir bei einem Spaziergang alles von der Seele reden. Du wirst sehen, heute Nacht wirst du besser schlafen. Ich werde dir deine Albträume schon zu verscheuchen wissen!« Aufmunternd tätschelte sie ihrer Schwester die Wange.
Am selbigen Abend schlief Rebecca tatsächlich sofort ein. Allerdings lag nun Judith wach. Besorgt blickte sie auf ihre neben ihr liegende Schwester, deren Augen von dunklen Schatten ummantelt waren. Ihr sonst leicht bronzierter Teint wirkte fast durchscheinend. Ab und zu stieß sie einen erschöpften Seufzer aus, der ihren zarten Körper erbeben ließ.
Was mochte die Ärmste alles durchlitten haben in der kurzen Zeit? Ein Frösteln durchlief Judith. Hauptsache, Becky fand jetzt etwas erholsamen Schlaf, damit sich kein Nervenfieber entwickelte. Zärtlich strich sie ihr durch die kupfernen Locken.
Sie hatte immer gehofft, dass Beckys selbst erschaffenes Paradies dieser so lange wie möglich erhalten bliebe. Wie glücklich und arglos sie vormals zwischen buntem Blütenzauber und romantischen Gedichten umhergewandelt war. Doch nun hatte die raue Wirklichkeit sie mit großen Pranken gepackt und das seidene Netz ihrer schillernden Traumwelt jäh zerrissen. Der Fall war grausam und hart. Aber mitten hinein in dieses böse Erwachen hatte ihre von Mythen und Sagen gespeiste Phantasie ihr einen Schutzpatron zur Seite gestellt, der sie vor den tiefsten Abgründen bewahrte und ihre verletzte Seele salbte. Arme kleine Becky, ihre Sinne mussten ja völlig verwirrt sein!
Was sich allerdings tatsächlich hier am Rande der großen Welt binnen weniger Tage abgespielt haben mochte, wollte sich Judith einfach nicht erschließen. An diesem Sonntag hatte sie vieles gehört, vor allem das, was ihr tunlichst verschwiegen worden war. Dank ihres klaren Verstandes und ihrer Kombinationsgabe hatte sie einen kurzen Blick hinter die Kulissen erhascht. Aber was sie dort zu sehen bekommen hatte, weigerte sich ihr Verstand zu glauben.
Der Spaziergang hatte ihrer Schwester in der Tat äußerst gutgetan. Für einen erholsamen Moment hatte Becky ihre Sorgen und Ängste vergessen können und sich des sonntäglichen Promenadenkonzertes erfreut, während sie Arm in Arm zwischen den Saisongästen und Sonntagsausflüglern umherspaziert waren. Nach einer Weile hatten sie ihre Schritte Richtung Cottage gelenkt.
Judith wäre fast das Herz stehen geblieben, nachdem sie das Gewächshaus betreten hatte, um sich von der in Rebeccas Brief geschilderten Zerstörung zu überzeugen. Der Anblick des Scherbenhaufens sowie die Verwüstung der Heilpflanzenkulturen machten sie fassungslos. Die Kräuterkammer fand sie leer, sämtliche Schubladen waren herausgerissen, die Regale blank, nur der Aschehaufen im Kamin nebenan zeugte von ehemals Dagewesenem.
Becky war nicht mit eingetreten. Sie war zurückgeblieben und wartete auf der Bank unter der Linde. Wortlos setzte sich Judith neben sie. Der Garten war erfüllt von Leben. Alle Blumen hatten unter der Mittagssonne ihre Blüten geöffnet, Käfer und Schmetterlinge flogen geschäftig umher und eine Spatzenfamilie im Baum über ihnen gab ein Mittagskonzert zum Besten. Doch für all dies schien Becky zum ersten Mal in ihrem Leben keinen Sinn zu haben.
»Weißt du noch, als Mutter damals den Slip Jig auf ihrer Fiedel gespielt hat und wir dazu getanzt haben?«, fragte Becky mit verträumtem Blick.
»Ja, Schwesterherz, wir hatten eine wunderbare Kindheit. Aber sie ist vorbei, wir sind erwachsen geworden. Ich habe meine Arbeit in London und du wirst bald heiraten.«
»Sprich nicht davon!«, entfuhr es Becky heftig, während sich ihr Gesicht verdunkelte.
»Nun gut, dann erzähle mir von dem Ball bei den Randons. Wie macht sich Mr. Cornelly denn nun als Tänzer?«
»Grässlich, einfach nur grässlich!«
Um ihre Mundwinkel hatte sich dieser für sie so typische trotzige Zug gelegt, den sie als Kind stets angenommen hatte, sobald etwas nicht nach ihrem Willen gegangen war.
»Und wie war der Ball abgesehen von dem grässlichen Mr. Cornelly?«, zog Judith sie ein wenig auf. »Ich nehme doch an, dass es wieder einmal ordentliches Getratsche gegeben hat. Schließlich ist il Palazzo als Gerüchteküche allseits bekannt. Gibt es denn gar keine Skandale, über die du mir berichten kannst?«
»Höchstens über meinen eigenen«, antwortete ihre Schwester mit gesenktem Blick. »Es war ein sonderbarer Abend ...«
Daraufhin erfuhr Judith, warum Becky vor Mr. Cornellys Gerede in den Garten geflüchtet war sowie alles über das anschließende Gespräch mit ihrem Vater, welches ihr so zugesetzt hatte und von den unverschämten Bemerkungen Mrs. Randons gekrönt worden war. Als nächstes erwähnte Becky auffällig beiläufig einen geheimnisvollen Fremden, der ihr den Abend gerettet habe. Danach verstummte sie. Erst auf Nachfrage fügte sie hinzu, dass er ein fantastischer Tänzer gewesen sei, sodass sie Mr. Cornelly darüber völlig vergessen gehabt habe. Deshalb sei Vater ärgerlich mit ihr geworden.
»Stell dir vor«, ereiferte sie sich, »ich stand im Garten mit dem Herrn ins Gespräch vertieft, als Vater mich von der Terrasse aus im strengen Ton zu sich rief und mich umgehend nach Hause schickte. Als ich nach dem Grund fragte, sagte er mir, ich hätte mich unmöglich benommen und sowohl Mr. Cornelly als auch ihn vor allen Leuten brüskiert! Hat man dafür Worte? Nur weil ich es gewagt hatte, mich zu amüsieren? Sonst beklagt er sich immer, dass ich es nicht tue. Genau das habe ich ihm entgegnet, woraufhin er wortwörtlich erwiderte, mit dem Teufel amüsiere man sich nicht! Kannst du dir vorstellen, wie peinlich mir das war? Vater hatte nicht gerade leise gesprochen. Ich höre jetzt noch das Getuschel der Umstehenden.«
Stille Tränen tropften an ihren bleichen Wangen herab.
»Ich war so außer mir, Judy«, fuhr sie mit belegter Stimme fort, »dass ich Vater anschrie, mir sei ein Teufel lieber als ein Langweiler.« Beschämt schlug sie die Hände vors Gesicht.
Judith angelte ein Taschentuch aus ihrem Beutel und reichte es ihr.
»Und dann, Becky?«, fragte sie behutsam, nachdem diese sich die Tränen getrocknet hatte. »Was ist noch passiert in jener Nacht?«
Verlegen knetete Rebecca das Tuch in ihrer Hand.
»Vater war so zornig, dass er mich in aller Öffentlichkeit ohrfeigte. Dann hat er mich nach Hause gezerrt und mich in meinem Zimmer eingesperrt, wo ich beten und Gott für meine schändlichen Worte um Vergebung bitten sollte. Danach haben wir bis zu Peter Cornellys Heiratsantrag kaum mehr ein Wort miteinander gewechselt. Den Rest kennst du aus meinem Brief.«
Judith hatte sie nicht länger quälen wollen, darum hatte sie auf weitere Nachfragen verzichtet. Doch war sie das Gefühl nicht losgeworden, dass ihre Schwester ihr nicht alles erzählt hatte. Sie hatte gehofft, dass das Gespräch mit ihrem Vater zu etwas mehr Klarheit führen würde.
»Judith, mein liebes Kind, ich fürchte, deine Schwester ist zurzeit etwas überspannt. Darum solltest du ihren Worten nicht allzu viel Bedeutung beimessen«, hatte ihr Vater sie beschwichtigt, als sie ihn nach dem Fünfuhrtee im Altarraum bei den Vorbereitungen für die Abendmesse aufgesucht hatte. »In den heiligen Bund der Ehe zu treten ist ein besonderer Abschnitt im Leben eines jeden jungen Mädchens und führt verständlicherweise zu gewissen Beunruhigungen. Doch das wird sich legen«, hatte er zuversichtlich geendet.
»Aber wenn Becky ihm doch so gar keine Gefühle entgegenbringt …«, hatte Judith gewagt einzuwenden.
»Gott wird’s schon richten! Darüber hinaus wird das Leben in London Becky auf andere Gedanken bringen. Sie wird dort reifen und endlich ihre Phantastereien ablegen. Als Ehefrau eines angesehenen Londoner Kaufmanns hat sie repräsentative Pflichten zu erfüllen wie Empfänge und Teegesellschaften zu geben. Sie wird endlich lernen, gesellschaftlichen Umgang zu pflegen, und das wird ihr guttun. Du wirst schon sehen, Judith. Außerdem weiß ich dich in ihrer Nähe, sodass es ihr an nichts mangeln dürfte.«
Dem war nichts entgegenzusetzen gewesen, außer dass ihre Schwester ihren Lebensweg nicht selbst bestimmen durfte so wie sie – obwohl Judith wusste, dass ihrem Vater der ihrige nicht wirklich behagte. Trotzdem hatte er sie gewähren lassen, als sie kurz nach Mutters Tod erklärt hatte, sie wolle Krankenschwester werden. Damals war sie am St. John’s den Barmherzigen Schwestern zur Hand gegangen. »Wenn Gott diesen Weg für dich bestimmt hat, mein Kind, dann solltest du ihn gehen«, war alles, was er dazu gesagt gehabt hatte. Erst der kürzliche Umzug nach London hatte ihm zu schaffen gemacht. In seinen Augen gehörte es sich nicht für eine junge Dame, ohne männlichen Schutz in einer solchen Stadt zu leben, die bekanntlich voller Gesindel war. Dennoch hatte er sich am Mittagstisch höflich nach ihrem Leben dort erkundigt. Sie hatte ihn damit zu beruhigen vermocht, dass sie vor lauter Arbeit kaum aus dem Krankenhaus herauskomme, wo sie lediglich von respektablen Ärzten und Wissenschaftlern umgeben sei – als ob diese keine Männer wären! Doch ihr Vater hatte sich zufrieden gezeigt.
Als Judith später mit ihm zusammen am Grabe ihrer Mutter gestanden hatte, hatte sie ihn geradeheraus gefragt, wieso er deren Heilpräparate und Aufzeichnungen vernichtet habe. Einen Moment lang war er ins Stocken geraten, hatte sich dann aber schnell wieder gefangen und im ruhigen Ton erwidert, dass er sie nur zu Rebeccas Schutze beseitigt habe, schließlich wisse man nicht, was die Tinkturen im Einzelnen bewirkten. Sie würde sich ohnehin zu sehr mit Dingen beschäftigen, von denen sie nichts verstünde und sich damit womöglich schaden. Immerhin hätten sie ihren guten Dr. Pearce, wenn es um körperliche Beschwerden gehe, und für die seelischen Belange sei die Kirche zuständig. Was die Aufzeichnungen seiner geliebten Catherine angehe, könne er nicht zulassen, dass diese in falsche Hände gerieten und man ihr womöglich Übles nachsage. Das Andenken Verstorbener solle man in Ehren halten.
Nach seiner Version hatte er also lediglich zum Schutze seiner Lieben gehandelt. Von seiner unbeherrschten Wut, wie Becky sie beschrieben hatte, war ihm nichts mehr anzumerken gewesen. Der Ort des Geschehens hatte jedoch für sich gesprochen.
Zurück im Pfarrhaus hatte sie ein mehr als merkwürdiges Gespräch mit Mrs. Finigan geführt, als diese damit beschäftigt gewesen war, den Teewagen abzuräumen. Was sie denn vom Verschwinden der armen Miss Randon halte, hatte die Haushälterin ganz nebenbei gefragt, woraufhin Judith sie nur verwirrt angeblickt hatte. Ob sie denn von diesem schrecklichen Vorfall noch gar nichts gehört habe? Peinlich berührt hatte Judith verneint. Naja, Miss Becky sei wohl zu sehr mit eigenen Problemen beschäftigt, um sich auch noch darüber Gedanken zu machen, hatte Mrs. Finigan verständnisvoll entgegnet. Jedenfalls würde Melissa Randon seit dem Abend des Balles vermisst. Schon bei der Quadrille sei sie nicht mehr gesehen worden. Die Randons hätten bei allen Gästen nachgefragt; jeder ihrer Verehrer sei davon ausgegangen, dass sie sich mit einem ihrer Favoriten in einen stillen Winkel zurückgezogen habe. Am nächsten Tag hätten die Randons Constable O’Brian hinzugezogen und inzwischen sei, dank Mr. Randons Beziehungen, sogar Scotland Yard mit dem Fall betraut. Überall in London würden jetzt Steckbriefe aushängen in der Hoffnung, dass Melissa dort irgendwo gesichtet werde. Mrs. Finigan würde jeden Abend für die arme Miss Randon beten, wer wisse schon, ob das arme Kind überhaupt noch lebe! Es sei immerhin kein Erpresserbrief aufgetaucht, wie es in Entführungsfällen doch sonst üblich wäre.
Judith hatte sich ein Schmunzeln gerade noch verkneifen können, wusste sie doch, dass Mrs. Finigan eine leidenschaftliche Leserin von Kriminalfällen war, deren Artikel sie aus der Zeitung schnitt und in einer Mappe unter ihrem Bett verwahrte. Was Judith an der Geschichte jedoch befremdete, war weniger der Umstand, dass Melissa verschwunden war – sie vermutete sie in der Londoner Junggesellenwohnung eines ihrer Verehrer –, sondern die Tatsache, dass nicht einmal Vater ihr davon erzählt hatte. Becky war zu durcheinander, aber Vater als Hirte dieser Gemeinde?
Das Absonderlichste hatte sich erst später ereignet, als die Sonntagsausflügler wieder in ihre Städte und die Sommergäste in ihre Hotels und Pensionen zurückgekehrt waren. Die Luft war noch milde und so hatten Becky und sie beschlossen, nach dem Abendessen ihre geheime Bucht aufzusuchen. Als Kinder waren sie oft zum Spielen und Schwimmen dort gewesen. Die kleine abseits gelegene Bucht lag unterhalb einer überhängenden Klippe und war zu beiden Seiten von ins Wasser ragenden Felsblöcken flankiert, sodass man vor rauen Winden und fremden Blicken geschützt war.
Eine Weile schauten sie dem Wechsel des Abendlichtes zu. Als auch die letzten Möwen sich in ihr Nachtquartier zurückzogen und nur noch das Meer unermüdlich seine Wogen an den Strand spülte, legte Becky sämtliche Kleidung ab und stürzte sich unbekümmert in die Wellen.
»Komm doch auch ins Wasser, Judy!«, rief sie ihr unerwartet vergnügt zu. Alle Seelenpein schien schlagartig von ihr abzufallen.
Judith gab sich einen Ruck und folgte ihrer Schwester, nachdem sie die mitgebrachte Laterne neben der abgelegten Kleidung entzündet hatte. Sie allerdings behielt Leibchen und Unterhose an.
Genüsslich ließen sie sich hinter der Brandung im Wasser treiben und schauten zum Abendhimmel auf, an dem nach und nach immer mehr Sterne hervortraten.
»Sie sind so verlässlich«, murmelte Becky. »Nichts und niemand kann den Aufgang der Sterne aufhalten. Ebenso wenig wie den Lauf der Gezeiten. Sie haben Bestand bis in alle Ewigkeit.«
Mit geschlossenen Augen ließ sie sich von den Wellen schaukeln. »Wie sanft das Wasser die Haut umspielt, als ob …«
»Als ob was?«, fragte Judith, nachdem ihre Schwester so plötzlich verstummt war.
Wie aus einem Traum gerissen, schlug Becky die Augen auf.
»Lass uns zurückschwimmen, Judy«, erwiderte sie tonlos, »mir wird langsam kalt.«
Zurück am Strand trockneten sie sich mit ihren Unterröcken. Da fiel der Lichtstrahl der Laterne auf die Unterseite von Rebeccas Handgelenk. Erschrocken starrte Judith auf den erhabenen Streifen, der sich dort dunkel auf der hellen Haut abzeichnete. Solcher Art Verletzung war ihr leider zur Genüge bekannt.
»Was ist dir geschehen, Becky?«, fragte sie alarmiert und wies auf die noch nicht ganz verheilte Wunde.
Stumm kleidete sich ihre Schwester weiter an. Dann setzte sie sich, fest in ihr Schultertuch gewickelt, auf einen ins Wasser ragenden Felsblock und starrte ins tintenschwarze Meer.
Wieder hatte Judith keine Antwort erhalten, doch diesmal ließ sie nicht locker. »Becky, ich bitte dich!«, drang sie auf diese ein. »Wir haben uns doch immer alles anvertraut.«
Sekundenlang rang Rebecca mit sich, dann gab sie leise Antwort. Mit jedem ihrer Worte bekam es Judith mehr mit der Angst zu tun.
»An jenem Abend, an dem Vater im Gewächshaus gewütet hatte«, begann Rebecca mit starrer Miene zu erzählen, »war ich selbst völlig erschlagen. An ein und demselben Tag wurde ich einem Mann versprochen, der mir nichts bedeutet, und mein Zuhause zerstört. Gegenwart und Zukunft erschienen mir unerträglich. Ich saß weinend inmitten des Scherbenhaufens, als ich mit einem Mal eine scharfkantige Glasscherbe in der Hand hielt. Ein kurzer Schnitt nur, ging es mir durch den Kopf, und ich wäre von meinen Fesseln endgültig befreit. Aber dann ...«
Wieder verstummte sie. Schließlich erhob sie sich und schaute panisch in alle Richtungen.
»Was ist?«, fragte Judith bestürzt.
»Psst!« Mahnend hob Rebecca die Hand. »Ich kann ihn spüren«, flüsterte sie und lauschte angestrengt. »Er ist da, ganz in der Nähe.«
»Was redest du? Wer ist da?«
Judith begann sich ob des verwirrten Zustandes ihrer Schwester zu sorgen. Immer wieder suchten deren Augen die Dunkelheit ab, bis Judith sie zurück auf den Fels zog.
»Es ist niemand hier außer uns«, versicherte sie ihr und strich ihr eine nasse Haarsträhne aus der Stirn. »Wen meintest du denn gehört oder gesehen zu haben?«
Unbehaglich rutschte Becky auf ihrem Platz hin und her.
»Versprich mir, dass du mich nicht auslachst, Judy«, bat sie mit einem verschämten Augenaufschlag. »Ich weiß sehr gut, dass sich dies alles wirr für dich anhören muss, ich glaube es ja selbst kaum.«
Judith war auf alles gefasst gewesen, nur darauf nicht.
Die Nähe eines Wolfes wollte Becky gespürt haben. Er sei ihr kürzlich im Wäldchen begegnet und später, nach dem Ball bei den Randons, unter ihrem Zimmerfenster. Hinter dem Kirschbaum habe er gestanden und zu ihr heraufgestarrt. Schließlich sei er ein drittes Mal aufgetaucht, genau in dem Moment, als sie aus dieser Welt habe scheiden wollen. Strafenden Blickes habe er sich ihr genähert, sodass sie vor Schreck die Scherbe habe fallen lassen. Dann habe er behutsam ihre blutende Wunde geleckt, sodass sich diese umgehend geschlossen habe.
»Ich bin mir sicher, Judy«, flüsterte Becky ehrfurchtsvoll, »dass er genau wusste, was ich beabsichtigte zu tun. Er hat mir das Leben gerettet, so wie ich ihm, als ich ihn bei unserer ersten Begegnung aus der Falle befreite.«
Judith wusste darauf nichts zu erwidern. Minutenlang erfüllte nur das regelmäßige Rauschen der Brandung die nächtliche Stille.
»Und dann? Was ist dann passiert?«
»Ich muss eingeschlafen sein«, gab Becky mit einem flüchtigen Seitenblick zur Antwort. »Als ich wieder aufwachte, lag ich auf dem Kanapee. Ich weiß nicht, wie ich dorthin gekommen bin. Die Verbindungstür zum Gewächshaus stand offen, obwohl ich sie stets geschlossen halte. Es muss weit nach Mitternacht gewesen sein. Kalte Luft zog durch das zerbrochene Fensterglas im Gewächshaus in die Wohnstube herein. Da bemerkte ich, dass ich mit der Wolldecke zugedeckt war, die sonst zusammengerollt am Fußende liegt.«
Judith atmete auf. Für sie stand fest, dass Becky sich in ihrem Verzweiflungszustand zwar zu einem Selbstmordversuch hatte verleiten lassen, dieser aber misslungen und sie hernach vor Erschöpfung eingeschlafen war. Wahrscheinlich hatte sie es gerade noch geschafft, sich in die Wohnstube zu schleppen, jedoch nicht mehr, die Tür hinter sich zu schließen. Dort war sie auf dem Kanapee zusammengebrochen und hatte im Halbschlaf nach der Decke gegriffen. Als sie in der Nacht erwacht war, waren ihre Nerven noch dermaßen überreizt gewesen, dass ihre Phantasie ihr einen Beschützer in Gestalt eines Wolfes erschaffen hatte, der über sie wachte.
Trotz aller Absurdität beschloss Judith zu schweigen. Wenn Becky in der Phantomgestalt des Wolfes jemanden hatte, der sie von der schlimmsten Sünde, dem Selbstmord, abhielt, sollte sie ruhig an ihrer selbstgeschaffenen Stütze festhalten. Sie hatte kein Recht, ihrer Schwester die Illusion, die sie am Leben hielt, zu rauben.
Doch schon im nächsten Augenblick kamen ihr Zweifel an ihrer just aufgestellten Hypothese, als ihre Schwester völlig entrückt ihren vermeintlichen Erinnerungen freien Lauf ließ.
»Als ich wieder zu mir kam, war mir, als ob jemand im Raum wäre. Ich spähte in die Dunkelheit, konnte aber nichts erkennen. Es herrschte absolute Stille, nur der Nachtwind zog leise um die Ecke. Plötzlich löst sich aus dem Winkel neben dem Vertiko ein Schatten. Eine hohe Gestalt kommt auf mich zu. Ich will schreien, bringe aber keinen Ton heraus. Da steht er plötzlich vor mir und alles Grauen ist fort. Seine Hände ziehen mich in seine Arme. An seiner starken Brust kann mein Herz sich endlich beruhigen, kann ich wieder zu Atem kommen, kann ich leben. Ich brauche mich meiner Tränen nicht zu schämen, ich darf sie fließen lassen, während er mir sanft durchs Haar streicht; bis er mir jede einzelne aus dem Gesicht küsst und sie somit zum Versiegen bringt. Mein Blick verliert sich in den Tiefen seiner Augen und ich lasse mich hineinfallen ins Nichts und Alles, bin frei und doch geborgen. Ich zerfließe in seinen liebkosenden Händen. Und doch vermag er mich zu halten wie Wasser, das durch seine Finger rinnt und gleichsam schützend von ihnen umschlossen wird. Wie ist das möglich? Wie ist das nur möglich? Es ist nicht möglich, nur eine Illusion … Aber nein, es war keine! Ganz bestimmt nicht!«
Judith packte ihre Schwester bei den Schultern und holte sie in die Realität zurück. »Wer, glaubst du, war bei dir in jener Nacht?«
Beckys Augen weiteten sich vor Erstaunen, als wüsste sie nicht, wie sie an diesen Ort geraten war. Langsam klärte sich ihr Blick.
»Entschuldige. Was hast du mich eben gefragt, Judy?«
»Von wem du gesprochen hast, möchte ich wissen!«
»Von einem Traum«, erklärte Becky beklommen und zog ihren Schal fester.
Schweigend machten sie sich auf den Rückweg.
Rebecca dankte Mrs. Finigan, die ihr Tee nachgeschenkt hatte. Als sie ihre Schwester hinter vorgehaltener Hand ein Gähnen verstecken sah, warf sie ihr einen schuldbewussten Blick zu. Sie schämte sich. Es tat ihr leid, dass sie ihr am Abend zuvor einen solchen Schrecken eingejagt hatte; sie hatte ihre fast verheilte Wunde ganz vergessen gehabt. Es war ihr daher nichts anderes übrig geblieben, als Judy die Wahrheit zu gestehen. Dass sie in ihrer Verzweiflung Hand an sich hatte legen wollen, hatte diese ihr sofort geglaubt, denn den Beweis hatte sie mit eigenen Augen gesehen. Alles Weitere jedoch hielt sie bestimmt für Phantasterei. Sie konnte es ihr nicht verdenken. Am nächsten Morgen war sie sich selbst nicht mehr sicher gewesen, ob nicht doch alles bloß ein Traum gewesen war. Erst am Abend hatte sie Gewissheit erhalten.
Judith blätterte verschlafen die Morgenzeitung um, während sie mit der anderen Hand geräuschvoll in ihrer Teetasse rührte. Rebecca musste lächeln. Wie sehr sie diesen Anblick vermisst hatte!
Plötzlich kam ihr die angekokelte Tarotkarte in den Sinn, die sie nach jener denkwürdigen Nacht im Cottage aus der erkalteten Asche gezogen hatte. Verwundert hatte sie sich gefragt, wie sie zwischen die Aufzeichnungen ihrer Mutter geraten sein mochte. Rebeccas Name hatte darauf gestanden, in der Handschrift ihrer Mutter! Befremdet hatte sie die Karte umgedreht. Da wäre ihr fast das Herz stehen geblieben. Die Rückseite hatte einen Turm mit Torbogen gezeigt, neben dem ein Wolf wachte! Auf das eigenartigste davon berührt, hatte sie die Karte an sich genommen und in ihrem Nachtschrank verwahrt. Vielleicht wäre sie irgendwann einmal das einzig Greifbare in einer unbegreiflichen Welt.
»Schade, dass du heute schon abreisen musst«, sagte Rebecca, nachdem sie einen Schluck Tee genommen hatte. »Es war so schön, dich wieder hierzuhaben, Judy. So gut wie letzte Nacht habe ich lange nicht mehr geschlafen.«
»Das freut mich, Becky«, entgegnete Judith. »Allerdings kann ich das Gleiche von mir nicht behaupten. Ich war wohl zu sehr damit beschäftigt, dir deine Albträume zu verscheuchen.«
»Und dafür danke ich dir sehr, Schwesterherz.«
»Ich wünschte, ich hätte mehr für dich tun können, als dir nur zu einer vernünftigen Portion Schlaf zu verhelfen«, erwiderte sie, indem sie ihre geröstete Brotscheibe mit bitterer Orangenmarmelade bestrich.
»Aber das hast du doch, Judy!«
Überrascht schaute diese auf. »Wirklich?«
»Aber ja. Sei unbesorgt.«
Rebecca schenkte ihrer Schwester einen liebevollen Blick, bevor sie sich vom Frühstückstisch erhob und zum Panoramafenster hinüberschlenderte. Durch eine der Sprossen blickte sie zum außergewöhnlich klaren Himmel über dem Meer auf.
»Es ist an der Zeit, dass ich die Vergangenheit loslasse und mich der Gegenwart stelle«, erklärte sie mit einer Festigkeit in der Stimme, die sie selbst überraschte.
Erleichtert nahm Judith kurz darauf von ihr Abschied.
Mein Nachtengel sagt:
wenn die Menschen dieser Welt sich trauen würden,
ihre Augen richtig zu öffnen,
sähen sie mehr,
als ihr Verstand verkraften könne.
(Nicholas)
Teil I Cottage in Kent – Frühling/Sommer 1866
Kapitel 1
Friedlich zogen die beiden schneeweißen Einhörner ihres Weges. Sie hatten einen Auftrag zu erfüllen und begaben sich ohne Umschweife zur schwarzen Burg, die sich im Finsterwald befand. Die gute Fee Gwynalda hatte sie mit all ihren Zauberkünsten gestärkt, damit ihnen auf ihrem gefährlichen Weg nichts Schlimmes widerführe.
Im Finsterwald herrschte der böse Zauberer Cornelius. Ihn selbst bekam man nur selten zu Gesicht, denn er verließ seine schützende Burg höchst ungern. Für seine bösen Machenschaften hatte er seine Spione und Handlanger, allen voran den fiesen Riesen Wachholz, der hinter jedem Baum und jeder Hecke auf einen lauern konnte. Wachholz sah und hörte alles! Obwohl er so groß war und einen aus düsteren Augen anblickte, erkannten die Leute seine Bosheit nicht. Er hatte sich mit einem magischen Mantel getarnt, der ein gütiges und mildtätiges Lächeln in sein Gesicht zauberte. So glaubten die Leute, ihm alles anvertrauen zu können. Dies nutzte er für seine Zwecke und erstattete dem bösen Zauberer Cornelius regelmäßig Bericht.
Vor vielen Jahren hatte Cornelius mithilfe des Riesen Wachholz eine wunderschöne Prinzessin aus ihrem Zaubergarten entführt. Sie hieß Dicentra, was so viel wie „Tränendes Herz“ bedeutet, denn seit der Entführung aus ihrem Zaubergarten weinte das Herz der schönen Prinzessin. Cornelius sperrte sie in seine schwarze Burg, aus der es kein Entrinnen gab. Er wollte sie ganz für sich allein. Keiner sonst sollte ihre Schönheit zu sehen bekommen.
Mit der Zeit wurde Dicentra immer trauriger. Sie verging fast vor Sehnsucht nach ihrem schönen Zaubergarten, in dem sie so viele glückliche Jahre verbracht hatte. Wenn sie aus ihrem Turmzimmer schaute, erblickte sie nichts als einen bleiverhangenen Himmel mit schwarzen Wolken, aus denen es Pech regnete.
So weinte Dicentra sich jeden Abend in den Schlaf, aus dem sie am liebsten nie mehr erwacht wäre.
Eines Nachts jedoch, als sie wieder einmal die Mondgöttin anflehte, ihr zu helfen, sandte diese einen silbernen Mondstrahl direkt in Dicentras Gemach. Auf diesem glitt ein Nachtengel zu ihr herab und sprach:
»Sei nicht länger traurig, holde Dicentra, denn du wirst bald ein Kind gebären, das dich all deinen Kummer vergessen lässt.«
Und schon löste sich der Engel in der Schwärze der Nacht auf. Nur sein schönes Antlitz fuhr als funkelnder Stern wieder zum Himmel empor.
»Nick!«
Es geschah, wie der Engel es versprochen hatte. Im nächsten Frühjahr gebar Dicentra einen Sohn.
»Nicholas!«
Und sie war eine Weile sehr glücklich. Doch dann verlangte der böse Zauberer Cornelius von ihr, ihr Kind in fremde Hände zu geben, damit es dort erzogen werde.
»Wo steckst du schon wieder?!«
Da wurde Prinzessin Dicentra tiefunglücklich und weinte verzweifelt um ihr Kind.
»Nicholas, komm schnell! Ein Brief von Granny und Grandpa ist eingetroffen!«
Diesmal jedoch war Dicentras Trauer so groß, dass sie sich aus dem Turmfenster in den tiefen Abgrund stüüü...
»Autsch!« Hastig hatte er sich von der breiten Astgabel der alten Eiche auf den Waldboden hinuntergleiten lassen und war mit einem dumpfen Aufprall auf seinem Hinterteil gelandet.
»Ich komme schon, Mummy, ich komme!«, rief er aus Leibeskräften.
Er rappelte sich auf, klopfte sich flüchtig die feuchte Erde von seiner Kniehose, sprang über Baumwurzeln und Gesträuch, kletterte behände über die Steinmauer und lief dann so schnell er konnte durch den Regen zum Haus. Kurz vor seinem Ziel rutschte er auf dem nassen Rasen aus und schlitterte der Länge nach fast bis vor die geöffnete Haustür. Diese führte in eine kleine behagliche Küche, in der ein Wasserkessel bereits fröhlich vor sich hin flötete.
Vor Anstrengung und Aufregung keuchend stand Nicholas vor seiner Mutter, die noch in den soeben geöffneten Brief vertieft war.
»Was schreiben sie?«, fragte er hoffnungsfroh. »Kommen sie zu meinem Geburtstag?«
Ungeduldig trappelte er von einem Fuß auf den anderen, während er auf Antwort wartete. Endlich wurde sie seiner gewahr.
»Nicholas, du lieber Himmel!«, rief sie erschrocken. »Wie siehst du denn aus? Und wo sind deine Schuhe und Strümpfe?«
Verwundert schaute Nicholas an sich herab. Erst jetzt fiel ihm auf, dass er völlig durchnässt und mit verschmutzten bloßen Beinen und Füßen vor seiner Mutter stand. Schuhe und Strümpfe hatte er in der Eile am Stamm der alten Eiche vergessen.
»Ach, die hol ich nachher«, sagte er mit einer wegwerfenden Geste. »Aber sag endlich, Mummy, kommen Granny Bridget und Grandpa Patty uns besuchen?« Erwartungsvoll blickte er zu ihr auf.
»Ja, mein kleiner Dreckspatz«, antwortete sie mit einem nachsichtigen Lächeln. »Sie reisen schon nächste Woche an.«
»Prima, dann können wir endlich wieder die alten Lieder zusammen singen und zur Quetsche und Fiedel tanzen, und GranGranny und GranGrandpa werden mir wieder Märchen und Geschichten von früher erzählen und –«
»Wir werden gewiss eine schöne Zeit zusammen haben«, unterbrach ihn seine Mutter lachend und strich ihm das feuchte Haar aus der Stirn. »Vielleicht wird es wieder ein wenig wie früher sein, als ich so klein war wie du, Nick, und Granny und Grandpa noch hier in diesem Haus lebten. Und deine Großmutter Catherine ...«
»Wirst du jetzt wieder traurig, Mummy?«
Besorgt blickte er ihr ins Gesicht. Ihre Augen hatten wieder diesen in sich gekehrten Ausdruck angenommen.
»Ach wo!«, erwiderte sie mit einem gezwungenen Lächeln. »Es ist alles in bester Ordnung, mein Liebling.«
In letzter Zeit war seine Mutter oft traurig. Sie weinte heimlich. Zwar versuchte sie es vor ihm zu verbergen, aber er konnte ihren Kummer deutlich spüren. Wann immer er sie danach befragte, leugnete sie es und gab sich dann übertrieben fröhlich. Das hasste er, denn er hätte sie gerne getröstet.
»Ich freue mich so sehr auf meinen Geburtstag, Mummy, dann bin ich endlich eine ganze Handvoll!«, seufzte er glücklich.
»Ja, mein kleiner Großer. Wie schnell doch die Zeit vergeht … So, nun musst du aber schleunigst aus den nassen Sachen raus, sonst bist du zu deinem Geburtstag noch krank.«
Nicholas warf seiner Mutter einen verständnislosen Blick zu. Warum sagte sie so etwas nur immer? Als ob er schon einmal krank gewesen wäre!
Rebecca führte ihren Sohn zum Waschtisch hinter dem Paravent. Sie goss etwas heißes Wasser, das sie eigentlich für den Tee aufgesetzt hatte, in die Schüssel und mischte es mit kaltem aus dem Krug. Gedankenversunken streute sie Seifenflocken ins Wasser, bevor sie den bereitliegenden Schwamm darin einweichte. Sie half ihrem Sohn beim Entkleiden und ließ die Schmutzwäsche auf dem Fußboden liegen. Gerade als sie den Schwamm ausdrückte, vernahm sie Hundegebell aus der entfernten Nachbarschaft. Erschrocken hielt sie in ihrer Bewegung inne, dann begann sie hastig Nicholas’ Gesicht zu waschen. Noch bevor sie bei seinen schmutzverkrusteten Knien angelangt war, hörte sie das dumpfe Klappern von Hufen. Hitze stieg in ihr auf. Ein paar Minuten würde er für die Bezahlung des Kutschers und den kleinen Fußweg zum Cottage schon noch brauchen.
»Jetzt schnell die Füße gewaschen, Nick«, sagte sie atemlos und unterdrückte ein Husten. Mit einer fahrigen Bewegung stellte sie die Waschschüssel auf das auf dem Boden ausgebreitete Handtuch, wobei ein wenig Wasser überschwappte.
»Oje, da reicht der Schwamm wohl nicht«, stellte Rebecca fest, nachdem sie seine Fußsohlen begutachtet hatte.
»Bitte nicht die Bürste, Mummy«, rief Nicholas, obwohl er genau wusste, dass kein Weg daran vorbeiführte. Schon stützte er sich auf ihrem gebeugten Rücken ab, um nicht vor Lachen umzufallen.
»Aufhören, das kitzelt so furchtbar«, kicherte er lauthals, als die Haustür aufging.
Augenblicklich verstummte Nicholas.
Peter begrüßte sie knapp und missmutigen Blickes, bevor er seinen triefendnassen Zylinder und Überzieher an den Garderobenhaken neben der Haustür hängte und wortlos in der angrenzenden Wohnstube verschwand.
Mit schuldbewusster Miene sah Nicholas zu, wie sich das Wasser in der Schüssel schwarz und schwärzer färbte.
»Komm, Nick, zieh dir schon mal dein Nachthemd an«, forderte Rebecca ihn auf, nachdem sie ihm die Füße getrocknet hatte.
»Aber Mummy, es ist doch noch nicht einmal dunkel draußen«, protestierte er leise.
Sie warf ihm einen flehenden Blick zu. Er verstand und verzog sich schnurstracks in seine Schlafkammer.
In dieser standen lediglich sein Bett, eine alte Spiegelkommode und ein schmaler Kleiderschrank. Auf einem Regal über der Stirnseite des Bettes saß Mr. Tom, der Bär. Seine Aufgabe war es, am Tage über die Figuren in den neben ihm liegenden Bilderbüchern zu wachen, damit diese ihre Seiten nicht heimlich verließen. In dem Bilderbuch, das er von Tante Judith bekommen hatte, konnten die Ritter, wenn man an einer Papierzunge am Bilderbuchrand zog, ihre Schwerter heben und senken. Auch das Gitter des Burgtores ließ sich hochschieben und die Zugbrücke herunterlassen. Die Ritter führten ein ziemlich bewegtes Leben zwischen den dicken Papierseiten. In dem Bilderbuch von Granny Bridget hingegen lebten Feen mit zarten Flügeln, schneeweiße Einhörner mit gedrehten goldenen Hörnern, Zwerge, die in Pilzen wohnten und Riesen, die in Bergen hausten. So manches Zauberwesen schwebte aufs zierlichste zwischen den Seiten umher. Aber Mr. Tom passte gut darauf auf, dass keines von ihnen entfleuchte und sich plötzlich inmitten eines ritterlichen Schwertkampfes wiederfand. Alle sollten hübsch in ihrer eigenen Welt bleiben.
Beide Bilderbücher sahen schon recht abgegriffen aus, denn Nicholas schaute sie sich jeden Abend vor dem Einschlafen an. Oftmals kam er nicht über die erste Seite hinaus, weil ihm zu jedem Bild immer wieder eine neue Geschichte einfiel. Diese erzählte er sich im Stillen selbst, bis ihm vor Müdigkeit die Augen zufielen. Manchmal setzten sie sich in seinen Träumen fort.
Neben den Bilderbüchern stand ein eingestaubter Abakus, den sein Vater von einem russischen Handelspartner aus St. Petersburg geschenkt bekommen hatte. Sein Vater hatte anfangs versucht, ihm zu zeigen, wie man damit rechnete, es dann aber bald aufgegeben, als er merkte, wie schwer es Nicholas fiel. Er hatte einfach keine Freude daran gefunden.
In einer kleinen Truhe am Ende des Bettes befanden sich weitere Spielsachen, darunter Bauklötze, ein alter Brummkreisel und ein Säckchen mit Glasmurmeln. Sein schönstes Spielzeug aber thronte an der Wandseite längs des Bettes. Es war ein von Grandpa Patty gefertigter Bogen mit dazugehörigem Köcher und Pfeilen. Nicholas wurde es nicht müde, damit in Robin Hoods Schuhe zu schlüpfen und im Wäldchen für Gerechtigkeit zu kämpfen. Gewiss würde Grandpa Patty ihm wieder ein neues Abenteuer von diesem Helden erzählen.
Nachdem Nicholas sich mit den Knöpfen seines Nachthemdes abgemüht hatte, zog er sich seine Lieblingsstrümpfe über die kalten Füße. Granny Bridget hatte sie ihm gestrickt, in jeder Masche steckte ganz viel Liebe.
Danach warf er einen Blick aus dem Fenster. Noch immer zogen die grauen Wolken lange Bindfäden hinter sich her. Mit Schrecken fiel ihm ein, dass seine Schuhe und Strümpfe noch am Fuße der alten Eiche standen. So ein Mist! Jetzt musste er sich in Nachtwäsche heimlich aus dem Haus schleichen, um sie zu holen. Wenn sein Vater davon erführe, gäbe es bestimmt ein Donnerwetter!
Geschwind holte er aus dem Kleiderschrank ein Regencape, das ihm noch um einiges zu groß war. Anschließend stahl er sich auf leisen Sohlen durch die Küche zur Haustür. Im Vorbeihuschen konnte er durch die geöffnete Stubentür seinen Vater im Lehnstuhl vor dem Kamin sitzen sehen. Nur gut, dass dieser mit dem Rücken zur Tür saß und seine Mutter hinter dem Paravent noch mit dem Säubern des Waschtisches beschäftigt war. Hurtig schlüpfte er in ihre Wellingtons, die stets neben der Haustür parat standen, und zog behutsam die Tür hinter sich zu. Dann machte er sich schleunigst auf den Weg zur alten Eiche.
Nach erledigter Arbeit trat Rebecca zu Peter. Schwerfällig erhob er sich aus dem Sessel und küsste sie flüchtig auf die Stirn.
»Du bist früh heute«, stellte sie mit einem versöhnlichen Lächeln fest und nahm ihm gegenüber auf dem Kanapee Platz.
»Es war nicht viel los im Kontor, sodass ich bereits die Mittagskutsche nehmen konnte«, antwortete er eisig. Dann wandte er sich wieder seinem Whiskey zu.
Eine Weile herrschte Schweigen.
»Hattest du eine so schwere Woche oder schlägt dir nur das Wetter aufs Gemüt?«, fragte sie ob seines mürrischen Verhaltens.
»Weder noch!«
Rebecca verstummte. Sie ahnte, was sonst gekommen wäre. Er hatte es ihr nach fast einem halben Jahr immer noch nicht verziehen, dass sie wieder in ihrem Heimatort wohnte. Bedrückt schaute sie den Regentropfen nach, die an der Fensterscheibe entlangliefen und die Außenwelt in ein undurchdringliches Grau tauchten.
»Das Abendessen wird gleich fertig sein«, sagte sie, um einen leichten Tonfall bemüht.
Peter erwiderte hierauf nichts. Finster starrte er ins Feuer und drehte unablässig das Glas in seiner Hand.
Warum fühlte sie sich in seiner Gegenwart nur immer so schuldig? War sie wirklich eine so schlechte Ehefrau? Sie hatte doch alles getan, was von ihr erwartet worden war. Sie war mit ihm nach London gezogen, hatte die perfekte Gastgeberin auf den Abendgesellschaften mit seinen Geschäftspartnern gespielt, hatte deren Gattinnen regelmäßig zum Tee empfangen und ihm sogar einen Sohn geboren. Was wollte er mehr? War es denn ihre Schuld, dass die rußige Londoner Luft ihr auf die Lunge geschlagen war und Dr. Mansfield ihr dringend einen Klimawechsel empfohlen hatte? Was lag näher, als in ihren Heimatort zurückzukehren, an dem sie jeden Tag die reine Seeluft atmen konnte? Ihr Hustenreiz hatte sich seitdem immerhin merklich gebessert. Außerdem wurde Peter werktags bestens von Margret versorgt, und die Landluft am Wochenende tat auch ihm gut.
»Und wann gedenkst du deinen Kuraufenthalt hier zu beenden und wieder nach Hause zurückzukehren?«
Verlegen wich sie seinem Blick aus. »Bitte, Peter, fang nicht wieder damit an«, bat sie eindringlich. »Du weißt genau, dass es mir hier um so viel besser geht.«
»Du willst doch wohl damit nicht andeuten, dass es sich um einen Dauerzustand handeln soll?«, brauste er jedoch auf. »Was macht es für einen Eindruck, wenn meine Gattin es vorzieht, in einer Fischerkate auf dem Lande zu hausen, statt am Londoner Gesellschaftsleben teilzunehmen? Darüber hinaus zwingst du mich, meine Geschäftsbeziehungen zu vernachlässigen. Heute Abend hätte ich mich eigentlich in Covent Garden, zumindest aber im Club sehen lassen müssen. Dort werden nämlich die eigentlichen Geschäfte getätigt, meine Liebe!«
Als sie auf seine Vorwürfe nicht reagierte, stand er ungehalten auf und verhalf sich zu einem weiteren Glas Whiskey.
Ängstlich beobachtete sie seine linke Schläfenader, die unter der blassen Haut bläulich hindurchschimmerte und bedrohlich zu pochen begann. Sie wusste, dass sie dem nicht lange würde standhalten können, sie hatte einfach keine Kraft mehr dazu. Sie schämte sich ihrer Herkunft nicht. Auch wenn ihr Großvater mütterlicherseits nur ein einfacher Fischer gewesen war und ihre Großmutter früher in einem der hiesigen Hotels den Sommergästen Tee serviert hatte, so hatte es immerhin ihr Vater zu einigem Ansehen als Vikar dieser Gemeinde gebracht – obwohl es sich nur um eine ländliche Pfarrei handelte, wie Peter gern betonte. Ihm als Stadtmenschen war ohnehin alles zuwider, was mit dem Landleben zu tun hatte.
»Dir sind deine Geschäfte also wichtiger als meine Gesundheit?«, bäumte sie sich noch einmal auf, aber schon spürte sie die aufkommende Enge in ihrer Brust und vermochte ein leises Husten nicht mehr zu unterdrücken.
Statt einer Antwort warf Peter ihr nur einen spöttischen Blick zu. Sie wusste, dass er glaubte, sie würde ihren angegriffenen Gesundheitszustand als Vorwand nutzen, um, wie einst ihre Mutter, ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen nicht nachkommen zu müssen.
»Wozu hast du mich bloß geheiratet, wenn ich dir nicht standesgemäß genug bin?«, polterte es nunmehr haltlos aus ihr hervor. »Du wusstest doch, dass ich für ein Leben, wie du es führen willst, nicht geeignet bin. London und deine wichtigtuerischen Geschäftspartner mit ihren aufgeplusterten Ehefrauen machen mich einfach krank!«
Schon liefen die ersten Tränen über ihre erhitzten Wangen. Sie hasste sich dafür, dass es ihm allein mit seinem Schweigen jedes Mal gelang, sie dermaßen aus der Fassung zu bringen.
»Aha, du gibst es also zu«, rief er triumphierend aus und erhob sein Glas, als wollte er ihr zuprosten.
»Was gebe ich zu?«, fragte Rebecca völlig aufgelöst.
»Dass du nicht bereit bist, zu mir zurückzukehren. Wenn das Leben an meiner Seite dich so krank macht …«
»Das habe ich nicht gesagt«, stieß sie entsetzt hervor, in dem schwachen Versuch zu retten, was bereits nicht mehr zu retten war.
»Natürlich nicht«, entgegnete er mit kalter Wut und stellte sein geleertes Whiskeyglas mit Nachdruck auf den Servierwagen zurück.
Wie betäubt sah Rebecca zu, wie er forschen Schrittes den Raum verließ, sich seine Pelerine umlegte und hastig die Handschuhe überstreifte.
»Wo willst du hin, Peter?«
Sie nicht beachtend, griff er nach Hut und Stock und riss die Haustür auf. Genau in dem Moment kam Nicholas mit den durchnässten Schuhen in der Hand zum Haus zurückgelaufen.
***
Endlich Montag! Versonnen lauschte sie dem steten Tropfen vor ihrem Schlafzimmerfenster. Ein tiefer Frieden breitete sich in ihr aus. Peter war in aller Früh abgereist. Die nächsten Tage würden nur Nicholas und ihr gehören. In aller Ruhe würde sie ihre Alltagsarbeiten verrichten, die Vorbereitungen für Grannys und Grandpas Ankunft treffen und sich ihres kleinen Paradieses erfreuen.
In den zurückliegenden Monaten hatte sie im Cottage alles wieder hergerichtet. Das Kanapee hatte einen frischen Bezug mit modernen Streifen erhalten, und diese Woche noch wollte sie die neuen Vorhänge aufhängen, die der kleinen Wohnstube einen noch behaglicheren Anstrich verleihen würden.
Die meiste Arbeit aber hatte der Garten gekostet. Zu Londoner Zeiten hatte sie sich nicht überwinden können, während der seltenen Besuche im Pfarrhaus in Cottage und Garten nach dem Rechten zu sehen. Zu schmerzhafte Erinnerungen waren damit verbunden gewesen. Mittlerweile jedoch hatten sich diese in Sehnsüchte nach glücklicheren Tagen verwandelt.
Bei ihrer Rückkehr im Januar waren sämtliche Beete von gefrorenem Unkraut überwuchert gewesen. Unter den Obstbäumen hatten sich verrottete Früchte und matschiges Laub aus den Vorjahren geschichtet. Es war ein trostloser Anblick gewesen. Nach der Frostperiode hatte Rebecca darum jeden Tag bis zum Einbruch der Dunkelheit im Garten gearbeitet und war anschließend mit schmerzendem Rücken ins Bett gefallen. Es hatte sich gelohnt! Der Garten stand wieder in schönster Blüte. Das Gewächshaus allerdings hatte sie nur notdürftig repariert und bisher noch nicht wieder in Betrieb genommen. Alles andere sah fast so aus wie früher.
Seit Rebeccas Hochzeit vor sechs Jahren waren die Großeltern nicht mehr im Cottage gewesen. In den Vorjahren hatten sie bei ihren Besuchen wie alle anderen im Gästehaus neben dem Pfarrhaus übernachtet. Das jährliche Familientreffen, das um Nicholas’ Geburtstag herum stattfand, weil sich die Großeltern zu dieser Zeit auf „Pilgerfahrt“ nach Stonehenge begaben, würde zum ersten Mal im Cottage abgehalten werden. Rebecca hatte lange kämpfen müssen, um sich mit dieser Idee sowohl bei Peter als auch bei ihrem Vater durchzusetzen.
Bei dem Gedanken, was sie bis zur Ankunft der Großeltern noch alles zu erledigen hätte, wurde sie augenblicklich munter. Sie weckte Nicholas nicht, denn er war wie immer erst spät eingeschlafen.
Als sie vor ihrem Jasmin-Tee saß und an einem Stück gerösteten Brotes knabberte, kamen ihr die Erinnerungen an den gestrigen Tag, der ebenso schlimm angefangen, wie der davor geendet hatte …
Sie hatte sich schon gedacht, als sie Sonntagfrüh allein in ihrem Bett erwacht war, dass Peter Unterschlupf bei ihrem Vater gesucht hatte. Wohin sonst hätte er flüchten sollen? Die Blöße, bei seiner Cousine aufzutauchen, würde er sich nicht geben.
Nach einem schnellen Frühstück eilte sie im Sonntagsstaat mit Nicholas zur Kirche. Rebecca nahm Umwege in Kauf, um möglichst wenigen Leuten zu begegnen. Auf dem Kirchhof gesellte sich Peter unbemerkt zu ihnen, damit es niemandem auffiel, dass sie nicht gemeinsam gekommen waren.
Steif nahmen sie nebeneinander ihre Plätze auf der Kirchenbank ein. Vikar Woodward hatte die hohe Bedeutung der Ehe und Familie zum Thema seiner Predigt gemacht und Rebecca beschlich das ungute Gefühl, dass selbst dem Letzten in der hintersten Bankreihe klar wurde, an wen diese gerichtet war. Sie schickte ihrem Vater wütende Blicke zur Kanzel empor.
Nach der Messe fing ihr Vater sie, wie befürchtet, ab und nahm sie wortwörtlich ins Gebet: wie aufgelöst der arme Peter letzte Nacht vor seiner Tür gestanden habe; dass sie dankbar sein solle für einen so rücksichtsvollen Ehemann, der sich lediglich seine Frau an seiner Seite wünsche, wie es sein gutes Recht sei; und dass sie ihre ehelichen Pflichten nicht so grob vernachlässigen dürfe.
Beschämt hörte sie zu und fand keine Worte der Erwiderung.
Den kleinen „Vorfall“ solle sie sich nicht so zu Herzen nehmen, schließlich habe Nicholas eine ordentliche Tracht Prügel verdient gehabt. Seiner Meinung nach seien sie ohnehin nicht streng genug mit dem Jungen, oder wie sonst könne es angehen, dass er dermaßen unpfleglich mit seinen Sachen umgehe und zudem zu so später Stunde, wo andere Kinder längst im Bett lägen, in aller Heimlichkeit draußen herumstrolche. Der anschließende „Ausrutscher“ sei im Eifer des Gefechts geschehen und müsse dem nach einer harten Woche Arbeit so rüde empfangenen Ehemann nachgesehen werden.
Wortlos wandte sich Rebecca ab. Ihre Hände hatten sich unwillkürlich zu Fäusten geballt. Mit brennenden Augen sah sie den mit Blutergüssen übersäten Körper ihres Sohnes wieder vor sich.
Zu allem Überfluss trat auch noch Elizabeth Randon auf sie zu und bat sie zum Lunch. Das war nun wirklich das Letzte, was sie sich vorstellen konnte, aber sie durften die Einladung der Cousine ihres Mannes nicht ausschlagen. So machte sie drei Stunden lang gute Miene zum bösen Spiel.
Natürlich kommentierte Elizabeth ihren Aufenthalt im Cottage mit spitzer Zunge, hob Peters gesellschaftliche Stellung hervor und zeigte auch ansonsten ein reges Interesse an ihrem Eheleben, wodurch sie Rebecca mehr als einmal in Verlegenheit brachte. Sie würdigte Nicholas keines Blickes, geschweige denn, dass sie ihn ansprach. Elizabeth tat immer so, als existierte er nicht, wenn sie nicht irgendeine Gelegenheit fand, ihn absurder Dinge zu beschuldigen. Schließlich gehöre ein Kind seines Alters, wie sie nicht müde wurde zu betonen, in die Obhut eines Kindermädchens und nicht in Gesellschaft, was bei Peter jedes Mal einen triumphierenden Blick hervorrief. James hingegen versuchte wenigstens ab und zu, ihn mit einem einigermaßen freundlichen Blick zu bedenken.
Beides änderte sich schlagartig, als Nicholas während der Vorspeise seinen Löffel klirrend in den Suppenteller fallen ließ, sodass die Minestrone die blütenweiße Tischdecke aus italienischem Damast bespritzte. Tadelnde Blicke richteten sich auf ihn, doch er starrte weiterhin mit bleichem Gesicht auf das Gemälde über dem Kamin und fragte leise, wer die junge Frau auf dem Bild sei.
Zunächst herrschte betretenes Schweigen. Dann erklärte James sichtlich bewegt, dass es ihre seit Jahren vermisste Tochter Melissa sei. In die sich anschließende andächtige Stille verkündete Nicholas ohne den Blick vom Gemälde zu nehmen, dass Melissa sich noch im Haus befinde.
Entsetzen breitete sich aus, welches erst durch Elizabeths Ohnmachtsschrei durchbrochen wurde. In dem folgenden Tumult, der aus Rufen nach Riechsalz, Bedauern der armen Elizabeth und empörten Schimpftiraden auf Nicholas bestand, bemerkte keiner Rebeccas Erschütterung. Hinter den Augen ihres Sohnes war offenbar ein weiteres Bild aufgetaucht, das kein anderer zu sehen vermochte. Das Gefühl, von nun an auf der Hut sein zu müssen, lähmte sie.
Nachdem sich alle etwas gefasst hatten und Elizabeth wieder aufrecht im Stuhl saß, verwies James Nicholas ob seiner schockierenden Äußerung des Tisches. Die restliche Zeit musste er mit dem Gesicht zur Wand stehen, nicht ohne zuvor von Peter vor aller Augen geohrfeigt worden zu sein. Rebecca hatte deutlich Genugtuung in Elizabeths Augen aufblitzen sehen, während es sie selbst im Hals gewürgt hatte.
Zur eigentlichen Aussöhnung zwischen Peter und ihr war es erst am Abend gekommen, sofern man es überhaupt so nennen konnte. Peter hatte seine Liebe zu ihr beteuert und sie auf Knien um Verzeihung für sein unbeherrschtes Verhalten gebeten, bei dem sie zwischen seinen prügelnden Stock und ihren am Boden kauernden Sohn geraten war. Er habe lediglich ihr gemeinsames Glück im Sinn und könne ohne sie an seiner Seite nicht leben.
Ihr war nichts anderes übrig geblieben, als ihm zu vergeben, aber im Grunde ihres Herzens konnte sie es nicht. Zu ihrem Entsetzen hatte er in derselben Nacht seine Rechte als Ehemann geltend gemacht. Sie hatte es mit geschlossenen Augen über sich ergehen lassen und im Stillen gebetet, dass nichts daraus erwüchse.
Im Laufe des Vormittages hörte es endlich auf zu regnen. Die dunklen Wolken schoben sich auseinander und ließen ein fahles Licht durch. Rebecca stieg in ihre Wellingtons, band sich die Gartenschürze um ihr schlichtes Hauskleid, griff sich den Weidenkorb und ging in den Gemüsegarten hinaus.
Tief atmete sie die feuchte Luft ein, die nach aufgeweichter, sich langsam erwärmender Erde roch. Die Vögel, die ihren Gesang in den letzten Tagen so gut wie eingestellt hatten, schienen alles nachholen zu wollen und überboten sich gegenseitig an fröhlichem Gezwitscher. Hummeln, Bienen und Schmetterlinge flogen suchend umher und kämpften mit manch auf den Blütenblättern hängen gebliebenem Regentropfen. Die gereinigte Luft brachte die Farben intensiv zum Leuchten. Ein tiefer Frieden legte sich auf Rebeccas Gemüt.
Als sie mit reich gefülltem Korb zurück in die Küche kam, wankte ihr ein schlaftrunkenes Kind entgegen. Es blinzelte kurz ins helle Licht, dann vergrub es seinen Kopf in ihrer Schürze.
»Na, meine kleine Schlafmütze? Es ist gleich schon wieder Mittag.« Lachend fuhr Rebecca ihm durch sein zerzaustes Haar.
Nicholas drehte den Kopf zur Seite und erblickte den Korb auf dem Küchentisch. »Ach, Mummy, ich wollte dir doch beim Ernten helfen!«, rief er enttäuscht.
»Tja, das hast du verschlafen, aber du kannst mir beim Erbsenpulen helfen.«
In Windeseile zog sich Nicholas an und spritzte sich am Waschtisch etwas Wasser ins Gesicht, wobei Rebecca ihn wie jeden Tag darauf hinwies, dass dies nicht die richtige Reihenfolge sei. Mit drei schnellen Bürstenstrichen beendete er seine Morgentoilette. Artig aß er sein Porridge und trank seinen Tee. Dann machte er sich über die Erbsen her, wobei jede zweite in seinem Mund landete. Zur Belohnung für seine Hilfe, las Rebecca ihm aus ihrem alten Märchenbuch vor. Ganz eng rückten sie auf dem Kanapee zusammen und entglitten gemeinsam in andere Welten.
Kapitel 2
... Diesmal war ihre Trauer so groß, dass sie sich aus dem Turmfenster in den Abgrund stürzen wollte. Sich vorbeugend wurde sie augenblicklich von Schwindel erfasst, der sie in die Tiefe zog. Sie spürte, wie sie unaufhaltsam fiel und glaubte, dass ihr Leben nun gleich ein Ende nähme. Sie wurde ohnmächtig. Als sie wieder zu sich kam, wurde sie von dem strahlenden Antlitz des Nachtengels geblendet, den die Mondgöttin ihr zur Rettung gesandt hatte. Er hatte sie mit seinen schwarzen Schwingen aufgefangen und schwebte mit ihr durch den Nachthimmel dahin. Ernst blickte der Engel ihr ins Gesicht und sprach: »Deine Zeit zu sterben ist noch nicht gekommen, Dicentra. Denke an dein Kind! Eure Liebe bindet dich an diese Welt, welche dir so unerträglich erscheint. Halte durch, Dicentra, und glaube an mich.« Behutsam setzte der Engel sie wieder in ihrem Gemach ab und bedeckte sie mit ferner Hoffnung.
In derselben Nacht betraten die beiden Einhörner aus dem hohen Norden den Finsterwald. Der fiese Riese Wachholz lag bereits auf der Lauer. Als die Einhörner sich der schwarzen Burg näherten, warf er sein dorniges Lasso aus. Doch sobald sich dieses um ihre Hälse legte, löste es sich zu des Riesen Erstaunen in Luft auf. Welch starker Zauber war hier im Spiel? War es möglich, dass es einen noch mächtigeren gab als den seines Herrn? Hilflos musste der böse Riese mit ansehen, wie die Einhörner zuerst Prinzessin Dicentra und danach ihr Kind aus der schwarzen Burg befreiten und sie aus dem Finsterwald hinaustrugen.
Im frohen Galopp erreichten sie den Zaubergarten. Überglücklich zeigte Dicentra ihrem Kind ihr wahres Zuhause und sie bewunderten alle zusammen die vielen Blumen, die ihnen die Herzen öffneten. Dann verneigten sie sich ehrfurchtsvoll vor den beiden Einhörnern und überschütteten sie mit Dank und der Bitte, sie wieder einmal in ihrem Zaubergarten zu besuchen. Dieses Versprechen gaben die beiden Einhörner gerne ab. …
Freudig umarmte Nicholas den mächtigen Stamm der alten Eiche und sog ihren herb-würzigen Duft ein. Er spürte, wie Wärme und Kraft von Jahrhunderten ihn durchströmten. »Danke, lieber Märchenbaum«, murmelte er und presste seine Wange an ihre zerfurchte Rinde. Zufrieden ließ er von ihr ab und säuberte sich die Fußsohlen. Als er zu seinen Strümpfen greifen wollte, fuhr er durch ein Knacken im Gehölz zusammen.
»Granny Bridget!«, rief er außer sich vor Freude und stürzte sich seiner Urgroßmutter in die Arme. Fest drückte diese ihn an sich und schien ihn nicht wieder loslassen zu wollen. Der für sie typische Lavendelduft stieg ihm in die Nase.
»Lass dich anschauen, Nick, nein, wie groß du geworden bist«, sagte sie, ihn etwas von sich haltend, und blickte ihn liebevoll aus weichen, klaren Zügen an. Trotz der vielen Jahre, die feine Linien auf ihrem Gesicht hinterlassen hatten, wirkte es immer noch jugendlich frisch. Ihre vollen Wangen wiesen eine gesunde Röte auf und bildeten einen schönen Kontrast zu ihrem schlohweißen Haupt, auf dem stets eine schwarze, mit weißer Spitze umsäumte Haube thronte. Ihr einfaches Kleid bauschte sich von den vielen Unterröcken, die sie immer noch trug.
»In neun Tagen werde ich ja auch schon fünf Jahre alt«, berichtete Nicholas voller Stolz.
»Wer weiß«, erwiderte Granny Bridget augenzwinkernd, »vielleicht wirst du ja mal so groß wie diese alte Eiche hier.« Ehrfurchtsvoll ließ sie ihren Blick an deren Stamm emporwandern.
»Vielleicht, wenn ich auch so alt werde wie sie«, sagte er. »Sie muss schon sehr alt sein, so viele Geschichten, wie sie kennt.«
»Du hast also schon öfter Geschichten von ihr vernommen?«
»Ja, aber manchmal schweigt sie auch.«
»Könnte es nicht sein, dass der Rabe, der in dieser alten Eiche wohnt, dir die Geschichten erzählt?«
Überrascht blickte Nicholas auf und entdeckte hoch oben im Geäst einen Raben, der ihm schon häufiger begegnet war, ohne dass er ihn mit seinen Märchenträumen in Verbindung gebracht hätte. Der Rabe sah mit schief gelegtem Kopf zu ihnen herunter, als habe er ihren Worten gelauscht. Dann flog er lautlos davon.
»Der Rabe gilt als Bote zwischen den Welten«, fuhr seine Urgroßmutter mit geheimnisvoller Stimme fort. »Er sieht Zukunft und Vergangenheit!«
Ihre Augen, die wie die seinen und die seiner Mutter von intensivem Blau waren, hatten einen besonderen Glanz angenommen.
Der Rabe sah Zukunft und Vergangenheit? Nicholas’ Herz begann aufgeregt zu pochen. »Werden die Geschichten, die er mir erzählt, denn wirklich passieren, oder sind sie gar schon passiert?«
»Nun, sie haben zumindest eine Bedeutung. Sie zeigen dir etwas aus der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Später, wenn du älter bist, Nicholas, wirst du sie zu deuten wissen.«
Granny Bridget tätschelte ihm mit ruhiger Gewissheit die Schulter. Er nahm ihre Hand und sie schlenderten im Wäldchen umher. Sie war die Einzige, die seine Träume wirklich ernst nahm. Im Gegensatz zu Vater, der ihn jedes Mal schalt, wenn er auch nur andeutungsweise etwas von ihnen erzählte, weswegen er es in seiner Gegenwart nicht mehr tat; oder zu Mummy, die stets erschrocken aufblickte und anschließend betreten schwieg; oder zu Grandpa Patty, der ihm zwar interessiert zuhörte, aber glaubte, dass er sich diese Geschichten selbst ausdachte.
»Wusstest du, Nick, dass schon deine Mutter und davor deine Großmutter Catherine die alte Eiche zu ihrem Lieblingsplatz auserkoren hatten? Sie übt einen besonderen Reiz aus, nicht wahr?«
»Ja, in ihr fühle ich mich immer so geborgen. – Granny Bridget? Wie ist Großmutter eigentlich gestorben?«
»Hat deine Mutter dir das noch nicht erzählt?«
»Nur, dass man sie eines Tages tot im Gewächshaus gefunden hat. Mummy wird immer ganz traurig, wenn ich sie nach Granny Catherine frage, darum lasse ich es lieber. Aber woran ist sie denn gestorben? War sie krank?«
»Nein, Nick. Ihr Herz hat einfach aufgehört zu schlagen. Das kommt manchmal vor, weißt du?«
»Aber warum denn? Ich habe einmal gehört, wie Mummy sagte, sie sei noch viel zu jung zum Sterben gewesen.«
»Keiner, außer Gott, kann das wissen. Es ist nun einmal geschehen«, schloss Granny Bridget traurig.
»Möchtest du jetzt meine Märchenbaum-Geschichte hören?«, fragte er, um seine Urgroßmutter auf andere Gedanken zu bringen.
»Gerne, Nick«, lachte sie. »Aber zuvor solltest du deinen Urgroßvater begrüßen gehen. Er wartet doch schon sehnsüchtig auf dich.«
»Aber gewiss doch.« Ungeduldig zog er sie hinter sich her.
»Aber Nick!«, schalt sie ihn scherzhaft und deutete auf seine bloßen Füße.
Grinsend lief er los, um seine Schuhe und Strümpfe zu holen.
Trotz seiner fünfundsiebzig Jahre ließ es sich Grandpa Patty nicht nehmen, seinen Urenkel zur Begrüßung hochzuheben und ihn im Kreis herumzuschwingen, sodass er sich anschließend taumelig, aber lachend auf die Gartenbank fallen ließ. Nicholas hatte ihm seine körperliche Eskapade mit einem begeisterten Jauchzer vergolten und hockte sich rittlings auf seinen Schoß.
»Hast du auch deine Quetsche mitgebracht, Grandpa Patty?«, fragte er laut, denn sein Urgroßvater konnte nicht mehr so gut hören. Er habe das Meeresrauschen im Ohr, behauptete er stets.
»Aber natürlich, mein Junge, du weißt doch, ich reise niemals ohne meine Quetsche«, antwortete dieser ebenso laut und lächelte seinen Urenkel aus Augen an, die von so wässrigem Blau waren wie das Meer, auf dem er die meiste Zeit seines Lebens verbracht hatte. Seine Wangen und Nase waren mit kleinen roten Äderchen übersät und die Lachfalten, die seine Augen umkränzten, waren tief in das von Gischt gegerbte Gesicht gegraben. So sah er immer aus, als ob er lachte. Zwischen seinem silberkrausen Rauschbart schaute stets eine Pfeife hervor, und auf seinem ebenso silbrigen Haupte saß zu jeder Jahreszeit eine Fischermütze. Nicholas war davon überzeugt, dass sein Urgroßvater sogar mit Mütze und Pfeife ins Bett ging, denn ohne diese beiden Teile hatte er ihn noch nie gesehen.
»Dann lass uns nach dem Tee ein wenig musizieren, ja Gran-Grandpa?«
»Das tun wir, du Lausbub, das tun wir«, brummte dieser vergnügt und kniff seinem Enkel in die Wange.
Im Gegenzug zupfte dieser ihm am Bart.
»Grandpa Patty? Werde ich später auch mal so einen Silberbart bekommen wie du?«
»Ganz gewiss, mein Junge. Du musst wissen, als ich noch jung war, hatte ich ebenso rabenschwarzes Haar wie du, und es hat ebenso kreuz und quer gestanden wie deines. Das tut es übrigens noch«, raunte er ihm zu. »Deshalb trage ich immer meine Mütze.«
Beide lachten und Nicholas drückte seinen Urgroßvater ganz fest. Er roch so gut nach Meer und Tabak.
Nachdem sie ihren Tee unter der Linde getrunken, zum Akkordeon die alten Lieder gesungen und im Wäldchen neue Abenteuer mit Robin Hood erlebt hatten, saßen sie am späten Abend gemeinsam um den Küchentisch. Die Öllampe verbreitete ein warmes Licht. Sie aßen eingelegte Salzheringe mit Brot, und die Erwachsenen tranken dazu eine durchsichtige Flüssigkeit aus winzigen Gläsern. Nicholas wollte probieren, doch sobald der erste Tropfen seine Zungenspitze berührte, verzog er das Gesicht und spülte mit viel Wasser nach.
»Ihr habt aber einen komischen Geschmack«, empörte er sich.
»Na, mein Junge, eines Tages wirst du auch dahinterkommen«, meinte Grandpa Patty und alle lachten.
Dann gab er seine alten Seemannsgeschichten zum Besten, die allesamt von Seeungeheuern, Zauberfischen und Meerjungfrauen handelten, denen er einst auf hoher See begegnet sei. Nicholas lauschte mit angehaltenem Atem.
»Das ist man alles nur olles Seemannsgarn, Patrick O’Connor«, schimpfte Granny Bridget das eine um das andere Mal, aber er ließ sich nicht davon abbringen.
Später holte seine Mutter ihre alte Fiedel hervor und spielte den Mooncoin Jig. Die beiden alten Leute konnten ihre Beine nicht mehr still halten, und so tanzten sie in der kleinen Küche, dass Granny Bridgets Röcke nur so flogen und Grandpa Pattys Pfeife auf und ab wippte, denn diese hatte er selbst zum Tanz nicht abgelegt. Nicholas tanzte mit ihnen und wollte gar nicht wieder aufhören. Erst als alle The Spinning Wheel sangen, schlief er erschöpft auf dem Schoß seiner Urgroßmutter ein. Da war es schon weit nach Mitternacht.
***
An einem Samstag Anfang Juni, ein Tag vor Nicholas‘ Geburtstag, reiste Judith aus London an. Es war eine freudige Begrüßung, viele Neuigkeiten wurden ausgetauscht. Danach machten sich die drei Frauen an die Vorbereitungen für die Geburtstagstafel. Die beiden Männer wurden zum Eierholen und Gemüseernten geschickt, was sie unter gespieltem Protest dann doch taten. In der kleinen Küche wurde derweil gerührt, geschnippelt, gebacken, geredet und gelacht.
Am Nachmittag hatte sich Grandpa Patty mit Nicholas vorsichtshalber an den Strand verzogen. »Hier sind wir nur im Weg, mein Junge«, hatte er gemeint, nachdem er das geschäftige Treiben eine Weile beobachtet hatte, und seinen Urenkel an die Hand genommen. Die Brise roch heute stark nach Seetang.
»Grandpa Patty, was ist eigentlich auf der anderen Seite vom Meer?«
»Da ist der Kontinent, mein Junge. Bei guter Sicht kannst du die Küste Frankreichs uns gegenüber liegen sehen.«
»Warst du mal dort, als du noch jung warst, GranGrandpa?«
»Nein. Die einzige Reise meines Lebens hat mich zu diesem Flecken hier geführt. Ansonsten haben wir unsere schöne grüne Insel nie verlassen. Wenn du etwas älter bist, Nick, musst du uns mal in Galway besuchen kommen. In der Bucht, wo Granny und ich wohnen, spült der Atlantik hohe Wogen an den Strand – das sind viel größere Wellen als hier. Ich fahre noch manchmal mit meinem alten Kutter raus zum Fischfang. Da würde ich dich gerne mal mitnehmen. An manchen Tagen kann man die Seehunde draußen auf den Felsen liegen sehen. Es würde dir bestimmt gefallen.«
Mit leuchtenden Augen fing Grandpa Patty an, das Lied von der Galway-Bucht zu singen, bis er plötzlich abbrach.
»Warum hast du aufgehört?«, fragte Nicholas verwundert.
»Die nächsten Strophen gehen mir zu sehr zu Herzen. – Wenn ich eines Tages aus diesem Leben treten muss, mein Junge, möchte ich, dass du mir dieses Lied zum Abschied singst.«
Als Grandpa Patty seinen erschrockenen Gesichtsausdruck bemerkte, beeilte er sich hinzuzufügen: »Keine Angst, das dauert, so Gott will, noch eine ganze Weile!«
»Eines Tages werde ich Granny Bridget und dich in Galway besuchen, das verspreche ich dir«, sagte Nicholas feierlich.
Eine Weile schauten sie stumm aufs Meer hinaus.
»Habt ihr auch Wälder?«, fragte Nicholas unvermittelt. »Dunkle Wälder mit schroffen Berggipfeln, auf denen auch im Sommer noch Schnee liegt?«
Verwundert schaute ihm Grandpa Patty ins Gesicht.
»Berge haben wir auch, aber ich selbst war noch nicht dort. Bin halt ein Küstenmensch. Wie kommst du darauf?«
»Ich habe einen Traum.« Nicholas sah, wie sein Urgroßvater die buschigen Augenbrauen hob und fügte eilig hinzu: »Ich meine einen richtigen Traum! Darin bin ich in einem tiefen Wald, wo die Bäume so dicht stehen, dass kaum ein Tageslicht eindringt. Es ist schön kühl und schattig dort, und ganz still. Auf einmal stehe ich vor einer Schlucht. Ein mächtiger Wasserfall donnert herunter. Da entdecke ich an einer steilen Felswand einen schmalen Pfad, der stetig bergan führt. Er ist beschwerlich. Ich weiß nicht, wo er endet, nur, dass ich ihn gehen muss. – Ob es einen solchen Wald tatsächlich irgendwo auf der Welt gibt?«
»Mag sein. Ist es denn schön dort?«
»Und wie! Es ist märchenhaft.«
»Aha, dachte ich’s mir doch. Dann pass bloß auf, falls du eines schönen Nachts an einem Hexenhäuschen vorbeikommen solltest. Nicht, dass du an der Lebkuchentür knabberst, das könnte brenzlig für dich werden, mein Junge.«
»Ach, GranGrandpa, du nimmst mich ja gar nicht ernst.«
»Oh doch, das tue ich. Aber ich werde wohl mit deiner Mutter ein ernstes Wort reden müssen. Sie sollte dir vor dem Einschlafen nicht mehr so viele Märchen erzählen.«
»Aber die liebe ich doch so sehr!«
Neckisch zupfte er seinen Urgroßvater am Bart. Dieser zog ihm als Revanche die Ohren lang, und beide mussten lachen.
Bevor sie ihren Rückweg antraten, sammelte Nicholas Muscheln in seine Jackentaschen. »Die bringe ich Tante Judith mit, damit sie in London eine Erinnerung ans Meer hat«, erklärte er. Er packte auch etwas Sand dazu und eine Möwenfeder.
Kapitel 3
Müde ließ sich Nicholas auf die durchgesessene Kirchenbank fallen, froh, sich an diesem lichtgedämpften Ort eine Zeit lang ausruhen zu können. Seine erste lange Hose, gewebt aus feinster Schurwolle, kratzte an seinen an Freiheit gewohnten Waden. Unbequem wand er sich darin und erhielt prompt einen strafenden Blick von seinem Vater. Begütigend legte seine Mutter ihm ihre Hand auf die seine.
Tief atmete Nicholas den modrigen Geruch des alten Holzgestühls ein, das – wie sein Großvater den Saisongästen und Durchreisenden stets voller Stolz erzählte – noch aus dem 13. Jahrhundert stammte und 1705 beim Großen Sturm sehr gelitten hatte. In dem Zusammenhang wies er auch immer auf den Opferstock neben dem Weihwasserbecken hin, der zusätzlich für Spenden zur Restaurierung der Kirche aufgestellt worden war. Nicholas liebte diesen Geruch. Augenblicklich begann er zu entspannen; er fühlte bereits das leichte Kribbeln in Armen und Beinen, das sich auf seinen gesamten Leib ausbreiten würde. Es war, als ob Körper und Geist in einen erholsamen Schlummer fielen.
Die Litanei seines Großvaters lullte ihn endgültig ein, bis ein Rippenstoß seines Vaters ihn ans Gebet gemahnte. Nur widerwillig gehorchten ihm seine Glieder. Im Halbschlaf auf die Knie sinkend, faltete er die Hände zum Gebet.
Die sich anschließende Predigt weckte ihn vollends aus seinem schläfrigen Zustand. Wie immer fühlte er sich unbehaglich. Vikar Woodwards Stimme gemahnte in einem solch anklagenden Ton an Sittsamkeit und Frömmigkeit, drohte mit Hölle und Fegefeuer, dass Nicholas unweigerlich ein schlechtes Gewissen bekam. Er wusste nur nicht, weswegen. Hatte er denn gesündigt? Mit Schrecken fiel ihm ein, dass er letzte Woche beim Märchenerzählen auf dem Schoß seiner Urgroßmutter eingeschlafen war und versäumt hatte, sein Abendgebet aufzusagen. Ihm wurde ganz heiß. Stumm bat er den Fenster-Jesus um Vergebung und versprach, am heutigen Abend gleich drei Gebete auf einmal zu sprechen.
Er war erleichtert, als die Psalmen gesungen wurden. Nicht mehr lange, dann würden sie den Heimweg antreten und endlich seinen Geburtstag feiern. Was Onkel Bob ihm wohl diesmal von seiner Reise mitgebracht hatte?
Ein langer dünner Mann in modisch karierten Beinkleidern näherte sich mit federndem Gang der im Garten versammelten Gesellschaft und lüpfte seinen Zylinder. Sein mittelbraunes, seitlich gescheiteltes Haar war bereits schütter, was durch einen mächtigen Oberlippen- und Backenbart wieder ausgeglichen wurde. Zur Begrüßung breitete er die Arme aus, als wollte er die ganze Welt umarmen. Seine bernsteinfarbenen Augen funkelten vor Freude.
»Seniora Cornelli, che bella! So zart wie eine Rose im Sommerwind. Oh, und Sie duften sogar wie eine solche!« Galant beugte er sich über Rebeccas Hand, die ihn lächelnd gewähren ließ.
»Peter, du alter Scharlatan«, wandte er sich sodann an diesen, »warum hast du mir verschwiegen, dass deine liebreizende Gattin zu solch einer vollendeten Blüte genesen ist? Du versteckst sie hier doch wohl nicht vor mir und aller Welt, was?«
Peter, der bei Robert Emersons Ankunft zusammen mit Rebecca auf diesen zugetreten war, verzog seinen Mund zu einem gequälten Lächeln.
»Und da ist ja auch unser Geburtstagskind!«, fuhr Robert, ohne eine Antwort abzuwarten, fort und breitete abermals seine Arme aus. »Tanti auguri, il mio amico! Ich gratuliere dir, mein Sportsfreund. Na, wollen wir nachher eine Partie lang unsere Kräfte messen?«
»Gewiss, Onkel Bob, darauf freue ich mich schon sehr. Diesmal gewinne bestimmt ich!«, frohlockte Nicholas.
»So ist’s recht, nimm einem alten Mann nur den letzten Funken Hoffnung, Bürschchen! Na, dann wollen wir mal schauen, was der liebe Onkel Bob dir mitgebracht hat, nicht wahr?« Damit kramte er ein rechteckiges Paket aus seiner Tasche.
Nicholas befreite es schnell von seinem Packpapier. Zum Vorschein kam ein Holzkästchen. Als er den Messingverschlag öffnete und den Deckel anhob, erblickte er darin ein Dutzend bunter Kugeln, in deren Mitte eine kleinere lag. Fragend schaute er auf.
»Da staunst du, was? Das habe ich dir aus Italien mitgebracht, es ist ein dort sehr beliebtes Spiel namens Boccia. Überall in den Parks und auf den Plätzen stehen Männer und spielen Boccia, dabei reden sie ununterbrochen in einer unziemlichen Lautstärke und mit Händen und Füßen. Damit ihnen die Zunge nicht am Gaumen kleben bleibt, trinken sie Unmengen von Rotwein, und je mehr sie davon trinken, desto lustiger wird’s. Es geht recht lebhaft in diesem Land zu, bis in die späten Abendstunden. Tagsüber scheint fast immer die Sonne und lässt Zitronen und Orangen an den Bäumen wachsen.«
Nicholas hatte mit offenem Mund zugehört. »Das Land der bunten Kugeln«, murmelte er beeindruckt. »Wer ist denn der Mann auf dem Deckel?«, fragte er, als er sich das Kästchen genauer besah.
»Das ist der König von Italien – Vittorio Emanuele II. Er ist in Turin geboren, das bis vor zwei Jahren noch die Hauptstadt Italiens war. Jetzt ist es das schöne Florenz, wohin mich mein Weg im Übrigen auch geführt hat, und wo Michelangelos berühmter –«
»Du liebe Zeit!«, unterbrach Grandpa Patty Roberts Redefluss lachend. »Ich glaube, wir müssen Mr. Emerson dringend ein Glas Wein anbieten, sonst bleibt seine Zunge wie den Italienern am Gaumen kleben.« Herzhaft schüttelte er diesem die Hand. »Sie müssen uns nachher unbedingt noch mehr von ihren Reisen berichten, aber meine bessere Hälfte hat mir soeben zu verstehen gegeben, dass das Essen nicht mehr lange auf sich warten lässt.«
»O’Connor, mein Guter! Alles noch grün auf der Insel?« Robert klopfte Grandpa Patty jovial die Schulter.
Jetzt trat auch Rebeccas Vater auf Robert Emerson zu.
»Vikar Woodward«, wandte sich Robert diesem zu, »ich bin untröstlich, dass ich der Messe nicht habe beiwohnen können, aber die lange Anfahrt hat es mir leider unmöglich gemacht. Sie müssen mir nachher unbedingt die kürzlich freigelegten Deckengemälde in der Seitenkapelle zeigen. Sie sollen aus dem 15. Jahrhundert stammen, habe ich gehört? Was für eine Sensation für die Kunsthistoriker. Bedenken Sie die Signifikanz für den Orden«, plapperte er fort, während Jeremiah ihn unterhakte und außer Hörweite zog.
Rebecca sah schmunzelnd hinter ihnen her. »Typisch Robert, er hat sich kein bisschen verändert«, sagte sie zu Peter gewandt.
»Da hast du wohl recht, Becky. Er schwirrt fast nur noch in der Welt umher. Immerhin hat er im letzten Quartal zwei neue Großkunden aufgetan. Aber kaum ist er im Lande, treibt es ihn wieder in die Clubs und auf die Rennbahnen. Wenn ich nicht die Stellung im Kontor halten würde –«
»Granny ist gleich mit dem Sonntagsbraten fertig, Peter«, fiel Rebecca ihm ins Wort. »Ich gehe, um Mrs. Finigan beim Auftragen zu helfen. Es wäre nett, wenn du die anderen inzwischen zu Tisch bitten könntest.« Mit einem höflichen Lächeln wandte sie sich um und entschwand Richtung Cottage.
Wenige Minuten später kam sie mit gefüllten Platten und Schüsseln zurück, aus denen verschiedene Gemüse sowie geröstete Kartoffeln dampften. Wie geplant, hatten sie unter der schattigen Linde eine große Tafel aufgestellt. Mrs. Finigan war hinzugebeten worden, um der Gesellschaft beim Speisen aufzuwarten und in der Küche zur Hand zu gehen, aber bisher hatte Granny Bridget dort das Zepter geschwungen. Zartrosa lag das in dünne Scheiben geschnittene Roastbeef auf dem Silbertablett, der Yorkshire-Pudding verströmte sein würziges Aroma von Muskat und Granny Bridget hatte ihr berühmtes Chutney zubereitet, dessen Rezeptur sie streng geheim hielt. Sie mussten sie fast gewaltsam aus der Küche schieben. Drei Mal musste Mrs. Finigan ihr versichern, dass auch sie in der Lage sei, die Custard Cream für den Rhabarberstreusel ohne Klümpchen hinzubekommen, bevor sie den Kochlöffel schweren Herzens aus der Hand gab.
»Was machen die Geschäfte, Mr. Emerson?«, fragte Jeremiah, nachdem sich Peter mit den beiden und Patrick O‘Connor nach dem Essen mit einem Glas Portwein in die kleine Stube zurückgezogen hatte.
»Könnten nicht besser laufen, was, Peter?«, antwortete Robert und zog genussvoll an seiner Havanna.
Bestätigend nickte er. »Gottlob haben wir den Schwarzen Freitag Anfang Mai unbeschadet überstanden und sogar davon profitiert, dass einige Konkurrenzunternehmen Konkurs anmelden mussten.«
»Inzwischen exportieren wir in alle Herren Länder, mein lieber Vikar«, ergänzte Robert seine Worte. »Feines englisches Tuch ist weltweit gefragt. Die Maschinenwebereien im Norden laufen auf Hochtouren. Wenn es so weitergeht, müssen wir wohl bald Personal und Lager aufstocken, was, Peter?«
»Wir können jedenfalls schon jetzt mit einem netten kleinen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres rechnen«, stellte er zufrieden fest, bevor er sich einen Schluck Port genehmigte.
»Das freut mich außerordentlich«, erwiderte Jeremiah mit einem wohlwollenden Blick auf ihn, seinen Schwiegersohn. »Jaja, Gott belohnt den tüchtigen Mann.«
Grandpa Patty fielen die Augen zu. Dieser hatte bereits bei Tisch den Gesprächen nur schwer folgen können, die von einer ihm fremden Welt gehandelt hatten. Es war um die verstopften Straßen Londons gegangen und um den Bau weiterer Untergrundbahnen zwecks Transports von fast drei Millionen Einwohnern – für den Alten gewiss eine unvorstellbare Zahl! Sie hatten den technischen Fortschritt gepriesen und waren auf die neuen Schraubendampfer zu sprechen gekommen, die dabei waren, die guten alten Segler zu verdrängen. Daraufhin hatte Robert Wetten für das Teeklipper-Rennen abschließen wollen, was Peter missfallen hatte, aber dann war er doch darauf eingegangen. Anschließend hatte sich Robert bei Judith mit seiner Teilnahme an den erstmaligen Leichtathletik-Meisterschaften hervortun wollen, war aber bei ihr abgeblitzt. Sie konnte ihn offenbar nicht leiden. Nicholas hatte derweil mal wieder geträumt, was er ihm mit einem bösen Blick quittiert hatte. Da hatte sich Rebecca nach Roberts Reiseplänen erkundigt, aber die Stimmung war bereits gekippt. Vom Säbelrasseln eines Herrn Bismarck hatte dieser noch kurz geknurrt, aber für den Wirrwarr auf dem Kontinent hatte sich keiner interessiert. Dann war der Nachtisch aufgetragen worden und alle hatten zufrieden vor sich hin gelöffelt.
Nach einer Weile zog sich auch sein Schwiegervater zu einem Mittagsschläfchen zurück und Peter blieb mit Robert und dem schnarchenden Grandpa Patty allein in der Stube.
»So, du alter Griesgram«, nahm sein Kompagnon ihn plötzlich ins Verhör, »nun erkläre mir bitte mal dein sauertöpfisches Gesicht! Du kannst ein bildschönes Eheweib nebst niedlichem Knaben dein Eigen nennen, dazu die beiden Alten, gütig und harmlos, und der Herr Schwiegervater und Vikar voll offenkundiger Bewunderung für dich – was willst du mehr? Deine Schwägerin mag ein wenig spröde sein, aber gewiss eine zuverlässige Seele. Sie scheint recht ehrgeizig zu sein, was? Hat wohl nur ihre Arbeit im Kopf. Es fehlt ihr womöglich an männlichem Umgang und anderweitigen Zerstreuungen. Vielleicht sollte ich sie einmal ausführen, was meinst du?«
»Untersteh dich, Robert! Sie hat keinerlei Interesse, glaub mir.«
»Nun, Interesse kann man wecken, nicht wahr? – Du hast mir noch nicht auf meine erste Frage geantwortet, mein Freund!«
»Ich bitte dich«, wich Peter aus und leerte sein Glas.
Wie käme er dazu, ausgerechnet mit Robert, der ohne jegliche Bindungen und Verpflichtungen sorglos in den Tag hineinlebte und stets darauf bedacht war, keine seiner zahlreichen Vergnügungen zu verpassen, Familiäres zu erörtern?
Als Peter ihm die Antwort schuldig blieb, zuckte Robert lediglich mit den Achseln und griff nach der Zeitung.
Während Rebecca, Judith und Mrs. Finigan sich um den Abwasch kümmerten, saß Granny Bridget mit ihrem Urenkel auf einem Gartensessel unter den schützenden Armen der Linde. Kleine Lichtflecken, die ab und zu durch das raschelnde Blätterdach gelangten, tanzten über ihre Gesichter. Bis auf das geschäftige Summen der Insekten, herrschte ein schläfriger Frieden ringsum. Granny Bridget hatte Nicholas zu sich auf den Schoß gezogen und schlug das Buch auf, das er von Judith geschenkt bekommen hatte.
»Alice langweilte sich allmählich«, begann sie zu lesen. »Sie saß neben ihrer Schwester am Hang und hatte absolut nichts zu tun. Es war ein heißer Sommertag und die Sonne machte sie dumpf und schläfrig.*«
»Oh, das kenne ich gut«, murmelte Nicholas, der sich träge an Granny Bridgets Busen schmiegte.
»Was muss ich da hören, du hast nichts zu tun, Bengelchen?«, schalt sie ihn neckend. »Dann wird es höchste Zeit, dass du deiner Mutter bei der Arbeit zur Hand gehst!«
»Aber nein, GranGranny, ich meine doch das mit der Sonne. Langweilig ist mir nie. Außerdem helfe ich Mummy ganz oft, kannst sie ruhig fragen.«
Schmunzelnd fuhr Granny Bridget mit der Geschichte fort. …
»Kannst du mir auch einen Trunk bereiten, der mich ganz klein macht, GranGranny?«, unterbrach er sie mit hoffnungsvoller Miene. »Stell dir vor, ich wäre nur so groß wie die Raupe, dann würde ich mich in das Gefieder des Raben setzen, der in der alten Eiche wohnt, und mit ihm durch die Zeiten fliegen. Die tollsten Abenteuer würden wir erleben und Dinge sehen, die anderen verborgen blieben …« Die Welt um ihn herum verblasste.
Granny Bridget legte das Buch zur Seite. Die Hand auf seinem Herzen, tauchte auch sie in sein Traumland ein …
Der Rabe nahm sein Nachtquartier in einer alten Eiche. Von dort hatte er einen guten Überblick. So sah er, wie sich der Riese Wachholz eines Nachts in den Zaubergarten stahl. In der Hand hielt er eine Phiole mit einem leuchtend grünen Elixier. Er weckte Prinzessin Dicentra aus ihrem Schlaf und bot ihr seinen eigens für sie gebrauten Trunk an, der ihr Erlösung von ihrer Seelenpein versprach. Prinzessin Dicentra schaute in seine dunklen Augen und sein gütiges Lächeln überzeugte sie davon, dass er es gut mit ihr meinte. Sie dankte ihrem Wohltäter, als ihr Kind erwachte. Dieses schrie beim Anblick des Riesen zu Tode erschrocken auf. Sie versuchte ihren Sohn zu beruhigen und bat ihn, Vertrauen zu ihrem Wohltäter zu haben, hätte er doch keine Kosten und Mühen gescheut, ihr mitten in der Nacht ein Elixier zu überreichen, welches ihr endlich Frieden brächte. Doch der Knabe erkannte die Bosheit des Riesen und flehte seine Mutter an, nichts von dem Elixier zu trinken. Der Riese blickte grimmig auf den Knaben und drohte ihm mit ewiger Verdammnis im Höllenschlund, wenn er nicht stille schwiege. Das Elixier sei das Einzige, das seine Mutter von ihren Qualen befreien könne und sie vor dem Fegefeuer bewahre, denn sie hätte schwer gesündigt, in der Absicht, sich das Leben zu nehmen.
Verängstigt wartete das Kind, bis der Riese verschwunden war, dann bestürmte es seine Mutter aufs Neue. Doch diese war so sehr davon überzeugt, dass nur die regelmäßige Einnahme des Elixiers ihr helfen würde, dass sie umgehend einen Schluck davon trank. Zum Entsetzen des Knaben wurde sie augenblicklich ein wenig kleiner, doch sie selbst bemerkte davon nichts.
Der Rabe, der alles beobachtet hatte, näherte sich am nächsten Morgen dem verzweifelten Kind und sprach zu ihm: »Verzage nicht, deine Mutter wird gerettet werden, denn es gibt eine Macht, die größer ist als die des Herrn des Riesen Wachholz. Sei unbesorgt, Hilfe naht!«, und er flatterte davon.
Einige Zeit verstrich und Prinzessin Dicentra wurde mit jedem Schluck des Elixiers weniger. Sie schwand ganz allmählich dahin. Alsbald war sie von der Größe ihres eigenen Sohnes, der vor Kummer und Sorge verging und sich jeden Abend in den Schlaf weinte. »Es hat keinen Sinn zu weinen«, belehrte ihn Alice streng. …
Nicholas schoss in die Höhe. Sein Herz raste. Nur langsam begriff er, wo er war, und wandte sich hilfesuchend zu seiner Urgroßmutter um, die ihn aus schreckgeweiteten Augen anstarrte.
»Beruhige dich, mein Kind«, flüsterte sie und wiegte ihn in ihren Armen. »Es war nur ein Albtraum. Du hast zu viel vom Rhabarber-Streusel gegessen, der liegt schwer im Magen und verursacht –«
Da hörten sie ein Rascheln über sich in der Linde. Als sie aufblickten, flog ein schwarzer Vogel Richtung Wäldchen davon.
»Das war er, nicht wahr?«, fragte Nicholas furchtsam. »Der Rabe aus der alten Eiche.«
Granny Bridget nickte stumm. Ihr Blick blieb ernst, während sie ihm den Rücken streichelte.
»Du weißt, dass er die Gabe hat, nicht wahr, Becky?«
»Ja, Granny. Und es bereitet mir Sorge.«
»Das muss es nicht, Liebes, es ist ein Geschenk. Er wird nur lernen müssen, vorsichtig damit umzugehen.«
»Er ist noch zu klein, um zu begreifen ...«
»Er versteht bereits mehr, als du denkst, mein Kind. Du solltest ihn allmählich vorbereiten. Gewiss weiß er einiges noch nicht richtig zu deuten, aber bald wird er bereit sein. – Unsere Augen und Ohren sehen und hören so viel mehr, wenn wir es nur zulassen.«
Der aus einer bauchigen Kanne dampfende Tee verbreitete einen intensiven Duft in der Küche.
»Deine Mutter hatte sie, du zumindest als Kind, und nun –«
»Sie hat Mutter das Leben gekostet, Granny! Hast du das vergessen?«
»Du glaubst nicht an einen natürlichen Tod deiner Mutter?«
Rebecca schüttelte den Kopf. »Ich kann es nur nicht beweisen.«
Nervös ließ sie ihren Blick über die Karten auf dem Küchentisch gleiten, die als Keltisches Kreuz ausgelegt waren.
»Ich mache mir große Sorgen um Nicholas, Granny, seine Äußerungen erregen Anstoß. Er trifft jetzt schon überall auf Ablehnung und versteht nicht, warum. Auch Judy und ich waren immer alleine, aber wir hatten uns wenigstens gegenseitig. Ich war glücklich mit euch. Mehr brauchte ich nicht in unserem kleinen Paradies. Ich habe das boshafte Gerede erst nach Mutters Tod wahrgenommen, so unwissend bin ich gewesen! Nicholas soll nicht auch darunter leiden.«
»Das ist nun einmal der Preis, den wir dafür zu zahlen haben«, erwiderte ihre Großmutter und griff nach ihrer Hand. »Wir sind mit Wissen behaftet, das wir nicht teilen dürfen. Wir sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, aber auch zur Wahrheit – vor allem uns selbst gegenüber! Du darfst deine Natur nicht verleugnen, Becky, das zehrt an deinen Kräften.«
»Ich weiß, Granny, aber wie soll ich an Peters Seite in Wahrhaftigkeit leben, wenn ich es an Vaters Seite kaum geschafft habe? Ich fürchte, ich bin meiner Aufgabe einfach nicht gewachsen.«
»Keine Sorge, Becky.« Aufmunternd klopfte Granny Bridget ihr den Handrücken. »Nicholas ist ein liebenswürdiger kleiner Kerl, voller Feingefühl und Charme. Du wirst ihn schon zu meistern wissen.« Plötzlich beugte sie sich vor und schaute ihr tief in die Augen. »Wisse«, flüsterte sie, »dass sein Krafttier der Rabe ist.«
Entsetzen breitete sich in Rebecca aus.
»Nein, nein, liebes Kind«, wurde sie umgehend beschwichtigt, »du hast keinen Grund zur Furcht. Der Vogel der Todesgöttin wird ihm ein starker Beschützer sein und ihn bei seiner Wandlung unterstützen. Höre ihm nur gut zu!«
Zuversichtlich tätschelte Granny ihr die Wange, bevor sie sich wieder den Karten zuwandte. Sie deckte den Gaukler mit seiner herrschaftlichen Kopfbedeckung auf. Fragend blickte Rebecca auf. Aber wie erschrak sie, als sie ihre Großmutter erblassen sah.
»Granny, was hat das zu bedeuten?!«
»Du musst äußerste Vorsicht walten lassen, mein Kind. Nicht jeder ist der, für den du ihn hältst. Gib acht, wem du dein Vertrauen schenkst! Mehr kann ich dir dazu leider nicht sagen.«
Judith steckte den Kopf zur Küchentür herein.
»Ach, hier seid ihr! Ihr werdet schon vermisst. Mr. Emerson will uns in die Geheimnisse des Boccia-Spiels einweihen.«
Schnell sammelte Granny Bridget ihre Tarotkarten ein.
»Wir kommen schon, Liebes.«
»Jetzt fehlt nur noch das Geburtstagskind«, stellte Robert Emerson fest, als er in die Runde blickte. »Ohne meinen Sportsfreund können wir auf gar keinen Fall beginnen.«
»Wo steckt der Bengel nur wieder?« Missmutig schaute sich Peter im Garten um.
»Ich kann mir schon denken, wohin er sich zurückgezogen hat.« Amüsiert marschierte Granny Bridget Richtung Wäldchen.
»Das gibt’s ja wohl nicht, selbst an seinem Geburtstag hockt er wie ein Affe in den Bäumen«, brummte Peter verärgert.
»Aber, aber, lieber Peter«, suchte Robert ihn zu beschwichtigen, »sei doch nicht so streng am Geburtstag deines Kindes.«
Freundschaftlich legte er den Arm um Peters Schulter. Rebecca lächelte ihm dankbar zu.
Kurz darauf kam Nicholas auch schon angelaufen. »Onkel Bob«, rief er voll freudiger Erwartung. »Spielen wir jetzt das bunte Kugelspiel?« Keuchend kam er vor ihm zu stehen.
»Ja, Sportsfreund, das machen –«
»WAS IST DAS?« Zornesröte überzog Peters Gesicht, während er auf Nicholas‘ neue Hose wies, die mit Moosflecken übersät war.
Erschrocken sah Nicholas an sich herab.
»Ich, ich ...« Hilfe suchend schaute er zu seiner Mutter.
»Schon gut, ich werde es gleich herauswaschen«, sagte Rebecca einlenkend und nahm Nicholas an die Hand.
»Es ist nicht gut!«, donnerte Jeremiah dazwischen. »Wie kannst du so etwas nur durchgehen lassen, Becky?«
Vorwurfsvoll blickte er auf seine Tochter, die vor Scham errötete und mit Nicholas in die Küche eilte.
»Du liebe Zeit, so viel Lärm um nichts!«, rief Grandpa Patty aus und schlug die Hände über dem Kopf zusammen.
»Was sagst du da, Patrick, Lärm um nichts?«, ereiferte sich Peter. »Der Junge hat seine nagelneue Hose ruiniert! Feinste Schurwolle! Er soll schließlich nicht wie ein Landlümmel herumlaufen.«
Grandpa Patty wandte sich beleidigt ab. Wenn auch von schlichter Natur, so hatte er den Affront auf seine Herkunft doch verstanden. Granny Bridget schnaubte und warf Peter einen verärgerten Blick hinterher, bevor sie sich zu ihrem Mann gesellte.
»Da ist ja wohl was fällig, nicht wahr, Peter?«, forderte Jeremiah seinen Schwiegersohn auf und nickte ihm bedeutsam zu.
»Allerdings!« Energischen Schrittes eilte Peter ins Haus.
Judith, die dem Ganzen sprachlos zugehört hatte, war bestürzt über die Spannungen, die hier zutage traten. Verstohlen blickte sie zu Robert Emerson, der sich ratlos am Bart zupfte. Da drangen die eindeutigen Geräusche körperlicher Züchtigung durch die nur angelehnte Tür zu ihnen heraus. Sie wurden begleitet von den wütenden Ausrufen Peters, der seinem Sohn schon lehren wolle, pfleglich mit seinen Sachen umzugehen, und Rebeccas Flehen, wenigstens an Nicholas‘ Geburtstag von diesem abzulassen.
Betretenes Schweigen herrschte in der Runde. Granny Bridget und Grandpa Patty nahmen mit bekümmerten Mienen auf der Gartenbank Platz, Jeremiah schaute mit triumphierenden Gesicht zum Haus, Robert fingerte betrübt in der Boccia-Kiste und Judith, die von einem zum anderen blickte, blieb verwundert an dem Gesicht ihres Vaters hängen. Ein ersticktes Aufschluchzen ließ sie und die anderen zusammenzucken. Aber es kam nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, von Nicholas, sondern von Rebecca.
Sofort erhob sich Granny Bridget von der Bank und ließ sich auch von den Worten ihres Gatten, sich aus der Sache herauszuhalten, nicht davon abbringen, ihrer Enkelin zu Hilfe zu eilen. Judith lief ihr beunruhigt hinterher, den missbilligenden Blick ihres Vaters ignorierend.
Als Judith die Küche betrat, bot sich ihr ein verstörendes Bild. Sie sah ihre Schwester zusammengesunken auf dem Küchenstuhl in ihre vors Gesicht gehaltenen Hände schluchzen. Vor ihr auf dem Tisch lag Nicholas‘ neue Hose, daneben die Waschschüssel mit Seife und Bürste. Granny legte ihr tröstend den Arm um die zuckenden Schultern und redete tröstend auf sie ein. Unterdessen stand Peter schwer atmend vor seinem kleinen Sohn und schaute mit einem so hasserfüllten Blick auf diesen, dass Judith zutiefst erschrak. Nicholas jedoch hielt dem Blick seines Vaters nicht nur stand, sondern bedachte ihn seinerseits mit einem derart eisigen Blick, dass es Judith kalt den Rücken hinunterlief. Schließlich wandte sich Peter mit hochrotem Gesicht ab und warf die Tür hinter sich ins Schloss. Stumm zog sich Nicholas die Unterhose über sein wundes Gesäß.
Es dauerte eine Weile, bis Judith begriff, was sie so seltsam anmutete: Nicht die Spur einer Träne war in Nicholas‘ Gesicht zu entdecken, stattdessen weinte Rebecca. Als Nicholas dies bemerkte, eilte er zu ihr. Granny Bridget gab Judith einen Wink.
Im Hinausgehen hörten sie, wie er zu seiner Mutter sagte: »Nicht weinen, Mummy, ich hatte dir doch versprochen, dass er mir nie wieder wehtun kann!«
Als Judith einen Blick zurückwarf, sah sie, wie Nicholas seiner Mutter die Tränen trocknete.
Peter war zu der im Garten wartenden Gesellschaft getreten und hatte sich für die unschöne Unterbrechung entschuldigt. Seine väterlichen Pflichten hätten jedoch keinen Aufschub geduldet.
Jeremiah nickte ihm beipflichtend zu, die anderen schwiegen verlegen. Judith räusperte sich und schlug vor, das Bocciaspiel auf die Abendstunden zu verlegen, jetzt sei es ohnehin noch viel zu warm. Alle gingen sichtlich erleichtert auf diesen Vorschlag ein und begannen sich zu zerstreuen. Robert bat den Vikar ihm die freigelegten Deckengemälde in St. Mary’s zu zeigen. Beide machten sich auf den Weg dorthin. Die beiden Alten ruhten sich von der Aufregung auf der Gartenbank aus. Und Judith wandte sich an ihren noch sichtlich erregten Schwager.
»Beruhige dich, Peter«, sagte sie, indem sie ihm eine Tasse Tee vom Servierwagen reichte. »Zu viel Aufregung ist weder für die Nerven noch fürs Herz gut. Lass dir das von einer angehenden Krankenschwester gesagt sein!«
Peter nahm die Tasse dankend entgegen.
»Was ist los?«, fragte sie nach einer Weile des Schweigens. »Tragt ihr eure Eheprobleme neuerdings auf dem verlängerten Rücken eures Sohnes aus? – Ich habe gesehen, wie du Nicholas angeschaut hast, Peter«, fügte sie hinzu, bevor er Protest einlegen konnte. »So sieht kein Vater seinen kleinen Sohn an, noch nicht einmal wenn er wütend auf ihn ist.«
Seine sonst so perfekte Maske bekam feine Risse.
»Warum hegst du derart negative Gefühle für Nicholas?«, ließ sie jedoch nicht locker. »Was hat der kleine Kerl dir angetan?«
Zitternd stellte Peter die Tasse ab und räusperte sich. »Lass uns ein wenig spazieren gehen, Judith«, presste er mühsam hervor.
Sie schlugen einen Wiesenweg entlang des Flusses ein. Nach einer Weile gelangten sie zu einer Bank und nahmen dort Platz. Judith klappte ihren Sonnenschirm zu; die Trauerweide, deren hintere Zweige ins glitzernde Wasser ragten, spendete ihnen einen lichten Schatten. Zwei Stockenten schwammen heran und schauten erwartungsvoll auf, doch keiner von beiden nahm Notiz von ihnen.
»Warum kannst du deinen Sohn nicht lieben, Peter?«, eröffnete Judith unumwunden das Gespräch und sah ihren Schwager unmerklich zusammenzucken.
Er setzte seinen Hut ab und stülpte ihn über den an die Bank gelehnten Spazierstock. Feine Schweißperlen standen auf seiner Stirn. Mit einem kaum wahrnehmbaren Ächzen zog er sein Taschentuch aus der Rocktasche und tupfte sie auf.
»Die Frage ist vielmehr«, erwiderte er endlich, »warum kann mich meine Frau nicht lieben?«
»Vielleicht erhältst du Antwort auf deine Frage, wenn du mir zunächst die meine beantwortest.«
Peter stutzte. »Du gehst ziemlich hart mit mir um, liebe Schwägerin! Womit habe ich das verdient?«
»So muss ich mit dir umgehen, mein lieber Peter, weil ich euch alle drei glücklich sehen möchte.«
»Das wünsche ich mir schon seit Jahren, Judith«, sagte er leise, während sich sein Blick auf dem gekräuselten Wasser verlor. »Aber so sehr ich mich auch darum bemühe, es scheint nicht zu gelingen.«
Sie warf ihm einen bekümmerten Blick zu und wartete geduldig, dass er weitersprach.
»Als ich mich vor sechs Jahren in Becky verliebte«, begann er mit angestrengter Stimme, die deutlich zeigte, wie viel Überwindung ihn dies vertrauliche Gespräch kostete, »und sie mir nach anfänglichem Zaudern ihr Ja-Wort gab, war ich der wohl glücklichste Mensch auf Erden.« Gedankenverloren knetete er sein Taschentuch. »Zunächst waren wir beide sehr glücklich. Nachdem wir die Räumlichkeiten in der Berkeley Street bezogen hatten, war Becky, wie du dich sicher erinnern wirst, mit Eifer dabei, diese äußerst geschmackvoll einzurichten. Und als sie kurz darauf guter Hoffnung war, schien unser Glück perfekt. Becky blühte auf und war meine ganze Freude. – Dann, mit Nicholas’ Geburt«, fuhr Peter mit sich verfinsternder Miene fort, »änderte sich schlagartig alles. Becky lebte von dem Tag an nur noch für ihn. – Ich weiß«, fügte er eilig hinzu, »das dies dem normalen Verhalten einer Wöchnerin entspricht, aber … es hat sich bis heute nicht geändert.«
Judith äugte zu ihrem Schwager, der seinen Blick starr auf das in seinen Händen zusammengeknüllte Tuch gerichtet hielt.
»Du glaubst also«, vergewisserte sie sich nach einem Moment des Nachdenkens, »dein Sohn, der heute gerade mal fünf Jahre alt geworden ist, hätte die Liebe deiner Frau zu dir gestohlen? Und darum bist du nun voller Hass auf ihn? Aus einer Art Eifersucht?«
Peters Blick schnellte hoch. »So wie du es sagst«, gab er zurück, »klingt es profan und abgedroschen, ein lächerlicher Zustand, wie er in vielen jungen Familien vorkommen mag. Der Ehemann fühlt sich zurückgesetzt und zieht sich beleidigt zurück, von egoistischer Natur und unedlen Gefühlen getrieben. Willst du mir das tatsächlich unterstellen? Du tust mir bitter Unrecht, Judith! Ich habe mich auf unser Kind gefreut und war selig, wenn ich meinen Sohn am Abend für einen kurzen Moment im Arm halten durfte. Ich habe Becky jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Mein einziges Ansinnen war – und ist! –, dass es Mutter und Kind gut geht!«
Tief holte er Luft, ehe er mit hängenden Schultern fortfuhr: »Aber wie du selbst weißt, ging es Becky bald gar nicht mehr gut. Auch du warst damals der Meinung, sie solle sich um Gottes willen eine Amme nehmen. Doch trotz der häufigen Schüttelfieber, die sie ans Bett fesselten, bestand sie hartnäckig darauf, ihr Kind selbst zu nähren. – Ich werde den Anblick nie vergessen, wie das kleine Wesen gierig und rücksichtslos an ihr zerrte und zehrte. Machtlos musste ich mit ansehen, wie der Junge ihr sämtliche Kraft aussaugte und sich selbst einverleibte.«
Judith erschrak weniger wegen Peters Worte als wegen seines verzerrten Gesichtes.
»Meine Becky wurde von Tag zu Tag schwächer«, fügte er ächzend hinzu. »Ich verging fast vor Sorge um sie.«
Erneut tupfte er sich die Stirn. Judith ließ ihm Zeit. Sie konnte sich noch gut daran erinnern. Auch sie war damals um die Konstitution ihrer Schwester besorgt, doch es war nicht zu reden gewesen mit ihr.
»Bereits zu jener Zeit«, sprach Peter um Fassung bemüht weiter, »fing unser gesellschaftliches als auch unser Eheleben an zu leiden. Durch Beckys geschwächten Zustand und die Tatsache, dass sie den Jungen selber stillte, war es uns im ersten Jahr nach seiner Geburt unmöglich, Gäste zu empfangen, Einladungen anzunehmen oder sonstigen Geselligkeiten beizuwohnen. Ich kam in die unangenehme Lage, die häufige Abwesenheit meiner Gattin mit Ausflüchten und Notlügen rechtfertigen zu müssen. Gott sei Dank war Robert seinerzeit noch zur Stelle, wenn man ihn brauchte. – Kaum, dass der Junge aus dem Gröbsten heraus war und Becky ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen wieder nachzugehen vermochte, fing, wie du weißt, ihre Gesundheit an zu leiden. Wieder musste sie das Haus hüten. Inzwischen glaubt sie, nur hier draußen auf dem Lande leben zu können. Aber ich brauche sie bei mir in London, in unserem gemeinsamen Zuhause. – Irgendwie scheint der Junge ihr immer noch alle Kräfte zu rauben, aber von einer Kinderfrau will Becky nach wie vor nichts wissen. Sie will ihn selbst erziehen, wie sie sagt. Wenn sie es denn nur täte! Was soll bloß aus dem Jungen werden, wenn sie ihn weiterhin so verzärtelt?«
Um seinen Mundwinkel hatte sich ein bitterer Zug gelegt. Trotz der harten Worte brachte Judith ihrem Schwager ein gewisses Maß an Verständnis entgegen. Sie mochte ihren Neffen von Herzen gern, doch verstand er sich ausgezeichnet darauf, unmerklich alles und jedes bei seiner Mutter durchzusetzen. Ihre Schwester war wie Butter in seinen kleinen Händen. Allerdings musste sie zugeben, dass es ihr zuweilen selbst schwerfiel, sich seinem vereinnahmenden Wesen zu entziehen. Ob es sein intensiver Blick war, der einen bis ins Innerste zu erfassen schien, seine leise, gleichsam gebieterische Stimme oder sein wissendes Lächeln, das sich seltsam in den kindlichen Zügen ausnahm, hätte sie nicht zu sagen vermocht; wahrscheinlich alles zusammen. Während Beckys Herz dahinschmolz, was ihren Sohn anbelangte, brachte Judith genügend Abstand mit, um ihn zu durchschauen. Bei Peter hingegen schienen Nicholas‘ Verführungskünste gar nicht erst zu fruchten. Er vermochte seinen Sohn abzuwehren, weil er in ihm einen Rivalen sah – einen Rivalen, der den Sieg im Kampf um Beckys Herz längst davongetragen hatte.
»Was unser Eheleben anbelangt«, fuhr Peter mit hohler Stimme fort, »ist es fast gänzlich zum Erliegen gekommen. Anfangs glaubte ich, dass dies ganz normal sei nach der Geburt eines Kindes und sich irgendwann legen würde. Aber darauf warte ich bis heute.«
Traurig ließ er den Kopf sinken. »Manchmal«, fügte er flüsternd hinzu, »habe ich den Eindruck, meine Gegenwart widert Becky an.«
»Peter«, fuhr Judith betroffen auf und legte ihm ihre Hand auf den Unterarm. »So etwas darfst du noch nicht einmal denken!«
»Doch, Judith, ich weiß, dass es so ist«, entgegnete er hitzig und wandte ihr erstmals voll sein Gesicht zu. »Jedes Mal, wenn ich mich ihr zu nähern versuche, weicht sie zurück oder erstarrt zu einem Stück Holz. Ich will mein Bett aber nicht mit einem Stück Holz teilen!« Erschrocken wandte er sich ab. Eine sichtbare Woge der Scham durchlief ihn.
»Bitte verzeih, Judith. Verzeih mir meine unbedachten Worte. Ich hatte nicht die Absicht, dich derart in Verlegenheit zu bringen.«
Judith war tatsächlich unangenehm berührt, von diesen intimen Details zu erfahren, doch zeigte es ihr, in welch hoffnungsloser Lage sich ihr Schwager glaubte, wenn er sich so weit vergaß.
»Schon gut, Peter«, erwiderte sie, um einen gefassten Ton bemüht. »Ich kenne meine Schwester gut genug, um deinen Worten Glauben zu schenken. Doch ich fürchte, du findest mich ratlos. Ich kann dir lediglich meine Eindrücke schildern.«
»Nur zu«, forderte er sie mit schiefem Lächeln auf, »sprich ohne Zwang! Ich habe es ja auch getan«
»Also gut. In deiner Verzweiflung, Beckys Liebe zurückzugewinnen, wodurch auch immer sie abhandengekommen sein mag, fixierst du dich viel zu sehr auf Nicholas. Du siehst in ihm den Grund all deines Leids und verkennst dabei, dass es sich lediglich um einen kleinen Jungen handelt, der zugegebenermaßen sehr an seiner Mutter hängt. Nicholas ist ein extrem feinfühliges Kind und wird gewiss spüren, dass du ihn dermaßen ablehnst, Peter. Was könnte es wohl Schlimmeres für ein Kind geben?«
Erschrocken hielt Judith inne, als ihr bewusst wurde, dass Peter diesbezüglich über keinerlei Erfahrung verfügte; war er doch im Waisenhaus aufgewachsen und erst während seiner frühen Lehrjahre in die Obhut eines entfernten Verwandten gekommen, der ihm aufgrund seines außerordentlichen Fleißes und in Ermangelung eines Stammhalters, sein kleines Handelsgeschäft vermacht hatte. Es war das Einzige, worauf Peter zurückblicken konnte.
Judith musterte ihren Schwager, um zu prüfen, wie viel er noch verkraften würde; es stand ihr schließlich nicht zu, Kritik an ihm zu üben. Er hatte seinen Spazierstock ergriffen, als brauchte er etwas, an dem er sich festhalten konnte. Seine Schläfenader zuckte nervös.
»Was vorhin zwischen dir und Nicholas in der Küche vorgefallen ist«, fuhr sie beherzt fort, »war ein Machtkampf, den du verloren hast, Peter. In Wirklichkeit hast du Becky geschlagen, und das weißt du auch, nicht wahr?«
Diesmal war er heftig zusammengezuckt. Gequält wandte er sich zu ihr um. Sein Gesicht spiegelte eine derartige Mutlosigkeit, dass es Judith bereits leidtat, so zu ihm gesprochen zu haben.
»Du musst deinen Sohn in dein Herz lassen, Peter«, bat sie eindringlich, »dann ist dir auch Beckys Herz wieder zugetan.«
Deutlich erkannte sie seine Zweifel. »Sieh in Nicholas das, was er ist«, setzte sie darum hinzu, »einen fünfjährigen Jungen, der auch der Liebe seines Vaters bedarf.«
»Vielleicht hast du recht, Judith«, räumte er nach einer Weile ein. »Nur weiß ich nicht, ob es dafür nicht bereits zu spät ist.«
»Für solche Dinge ist es niemals zu spät!«
Entschlossen griff Judith nach ihrem Sonnenschirm und erhob sich. Peter steckte das Taschentuch ein und setzte seinen Hut auf.
»Danke, Judith, dass du so offen zu mir gesprochen hast«, sagte er, während sie sich auf den Rückweg machten. »Und bitte verzeih das ungebührliche Thema.«
»Was meinst du wohl, was ich mir von meinen Patienten alles anhören muss.« Mit einem Zwinkern hakte sie sich bei ihm unter.
Am Abend, nachdem sich alle zurückgezogen hatten, wollte Judith die Gelegenheit nutzen, ein paar ungestörte Worte mit ihrer Schwester zu wechseln, als diese ihr zuvorkam.
»Danke, Judy, dass du mir Peter heute Nachmittag vom Halse geschaffen hast«, begann sie, kaum dass sich die Schlafkammertür hinter den Großeltern geschlossen hatte.
»Das war gar nicht meine Absicht, Becky. Der Ärmste war nur dermaßen aufgebracht, dass ich annahm, ein Spaziergang würde ihm guttun.« Damit setzte sie sich zu ihrer Schwester aufs Kanapee.
»Wieso tut Peter allen immer so leid, möchte ich wissen? Von Vater wird er auch ständig bedauert«, erwiderte Rebecca gereizt.
»Er ist unglücklich, Becky. Genauso wie du!«
Betroffen blickte Rebecca auf, dann legte sich der trotzige Zug um ihre Mundwinkel. »Dann soll er uns endlich in Ruhe lassen!«
»In Ruhe lassen?«, empörte sich Judith. »Becky, er ist dein Ehemann! Natürlich wird er euch nicht in Ruhe lassen. Er möchte euch bei sich haben, das ist doch wohl verständlich.«
Rebecca erstarrte. »Nein, Judy, ich bin nicht mehr für ihn als ein schmückendes Beiwerk, ähnlich einer Brosche, die man sich zu besonderen Anlässen ans Revers steckt und die restliche Zeit wieder in einer Schatulle verwahrt. Peter ist einzig an seinem beruflichen Fortkommen und gesellschaftlichen Aufstieg interessiert. Aus Nicholas macht er sich gar nichts.«
»Das sind harte Worte, Becky. Vielleicht bemerkst du es schon nicht mehr, aber er liebt dich immer noch wie am ersten Tag.«
»Hat er etwa mit dir über uns gesprochen?«
»Er leidet! Er hat das Gefühl, dass du all deine Liebe nur noch Nicholas schenkst. Hat er da nicht ein bisschen recht?«
Rebeccas Miene blieb verschlossen.
»Gewiss ist es verwunderlich, dies ausgerechnet aus meinem Mund zu hören«, fuhr Judith unbeirrt fort, »aber ich finde, dir stünde etwas mehr Dankbarkeit besser zu Gesicht, Schwesterherz! Was erwartest du eigentlich vom Leben? Du hast doch bereits alles, was sich eine Frau nur wünschen kann – obwohl ich weiß, dass es nicht deinen ureigentlichen Bedürfnissen entspricht. Trotzdem hast du dich vor sechs Jahren für ein Leben an Peters Seite entschieden, also gib nicht ihm die Schuld, wenn es ein Fehler gewesen sein sollte.«
»Als ob ich eine Wahl gehabt hätte!«
»Die hat man immer, Becky.«
»Richtig, ich hatte die Wahl, mich hinter die Mauern eines Klosters oder in das Gefängnis einer Ehe zu begeben.«
Für einen Moment spürte Judith Zorn in sich auflodern, als sie an das Los der Frauen aus den Arbeiterquartieren dachte. Rebecca hatte durch ihre Heirat einen gewaltigen gesellschaftlichen Aufstieg getan, den sie weder zu schätzen noch zu nutzen wusste. Judith behandelte im Krankenhaus täglich Frauen, die auf der andere Seite des Lebens standen: Arbeiterinnen, die sich schwere Verletzungen in den Fabriken zugezogen hatten; Ehefrauen, die aus Verzweiflung über die elfte Schwangerschaft eine missglückte Abtreibung an sich vorgenommen hatten; Freudenmädchen, die von ihren Zuhältern übel zugerichtet worden waren; Mütter, die aufgrund der elenden Wohnverhältnisse von Typhus und anderen Krankheiten dahingerafft wurden. Das ganze Elend lastete oft schwer auf ihr. Trotzdem war Judith froh, die Not der Ärmsten, wenn auch nur vorübergehend, ein wenig lindern zu können. Auch die Großeltern hatten es nicht immer leicht. Die Armut ließ ihnen streckenweise kaum etwas zum Leben; und doch dankten sie ihrem Herrgott in Demut für das, was sie hatten, und teilten es gerne.
»Beständige Zufriedenheit ist mehr wert als vergängliches Glück, Becky. Oder glaubst du, die jungen Damen aus dem Adel können sich aussuchen, an wessen Seite sie ihr Leben verbringen, und tun und lassen was ihnen gefällt? Jeder hat seine Aufgabe zu erfüllen, so gut er es eben vermag. Aber Zufriedenheit oder gar Erfüllung stellt sich nur dann ein, wenn du deinen dir zugedachten Lebensweg annimmst und das Beste aus ihm machst. Dein Glück liegt in deinen eigenen Händen, Becky, also zerdrücke es nicht in deinen Fäusten.«
Wütende Blicke trafen Judith. »Was für ein Geschwafel, Judy! Du hast doch überhaupt keine Ahnung, wie sehr ein Eheleben einen erdrücken kann; du siehst doch nur den Wohlstand, der mich umgibt; als ob das allein zum Glück gereichte!«
»Du irrst, Becky, ich –«
»Du weißt überhaupt nicht, was es bedeutet, tagein, tagaus ein fremdbestimmtes Leben zu führen, du hast dir deinen Weg damals selbst aussuchen dürfen. Ich hingegen bin nicht gefragt worden.«
Tränen schossen Rebecca in die Augen und Judith sah sich am Ende ihrer reichlich missglückten Mission.
»Becky, ich bitte dich, ich will dir und Peter doch nur helfen«, suchte sie ihre Schwester zu beschwichtigen. »Ich kann es nicht ertragen, euch beide so unglücklich zu sehen.«
Unruhig rutschte Rebecca auf ihrem Platz hin und her.
»Ach, Judy, wie soll ich dir nur begreiflich machen, was in mir vorgeht? Peter und du, ihr seid euch so ähnlich. Was wisst ihr schon von Liebe, von Sehnsüchten und Träumen? Ihr seht nur eure eigene begrenzte Welt, in der alles seine schönste Ordnung hat, solange jeder die ihm auferlegte Pflicht darin erfüllt wie eine Maschine. Alles hat nach einem bestimmten Muster zu funktionieren, für alles gibt es eine Regel, eine Erklärung, eine Antwort. Aber ihr irrt euch!«
Ratlos verharrte Judith in Schweigen.
»Das Lebensglück ist keine mathematische Formel, Judy, bei der die richtigen Zahlen und Zeichen zwangsläufig zum positiven Ergebnis führen. Es gibt weit mehr Unbekannte, als ihr überhaupt ahnt; so vieles, das ihr nicht seht, weil ihr eure Sinne dem längst verschlossen habt und ihr nur nach euren Lehrbuchanweisungen lebt, die euch vermeintliche Sicherheit bietet. Was ist, wenn ihr eines Tages feststellt, dass eins plus eins doch nicht zwei ergibt? Wenn sich plötzlich Welten vor euch auftun, die ihr zuvor nie gesehen habt und damit all euer stolzes Wissen ad absurdum geführt wird?«
Was sollte Judith darauf erwidern? Die Worte ihrer Schwester waren ihr fremd; so fremd, als spräche sie eine andere Sprache.
Besorgt blickte sie zu Rebecca, die erschöpft in ihrer Ecke saß und ins Leere starrte.
»Ich habe Angst, Judy«, fuhr diese leise fort. »Furchtbare Angst!«
»Wovor, Becky?«
Angestrengt suchte Rebecca nach einer Antwort, während sie mit dem Troddeln des Zierkissens auf ihrem Schoß spielte. Wie hilfesuchend äugte sie zur Schlafkammer, aus der das Schnarchen des Großvaters drang. Plötzlich kam Judith ein Verdacht.
»Du hast dir vorhin von Granny die Karten legen lassen, als ich zu euch in die Küche kam, stimmt’s?«
»Es waren Tarotkarten«, antwortete Rebecca, als würde dies irgendetwas erklären.
Judith fehlten die Worte und spürte gleichzeitig so etwas wie Erleichterung.
»Warum lässt du dich bloß von solchem Unfug beeinflussen, Becky? Granny ist eine alte Frau, die sich bekanntlich gerne mit derlei Dingen beschäftigen. Aber so etwas darf doch nicht dein Leben und das deiner Familie bestimmen. Lass das bitte nicht zu!«
Rebecca schwieg mit niedergeschlagenen Augen. Schließlich holte sie tief Luft und erhob sich.
»Vielleicht hast du recht, Judy«, sagte sie. »Ich hoffe es sogar sehr.« Dann drückte sie ihr einen Gutenachtkuss auf die Stirn und reichte ihr Kissen und Decke.
Als Rebecca ins Bett schlüpfte, griff Nicholas im Schlaf nach einer ihrer Haarsträhnen. Alsbald spürte sie seinen regelmäßigen Atem im Gesicht und ihre Locke entglitt seinen Fingern.
Rebecca war traurig. Im Laufe der letzten Jahre hatten Judith und sie sich immer weiter voneinander entfernt. Ihre Schwester schien sie kaum noch zu verstehen, dabei brauchte sie sie gerade jetzt so sehr. Judith war der einzige Mensch, auf den sie sich immer hatte verlassen können, dem sie ihr Leben anvertrauen würde und der sie bedingungslos liebte. In ihrem Abendgebet bat sie Gott, dass ihre Geschwisterliebe stärker sein möge als alle Worte dieser Welt.
Nach zweieinhalb Wochen brachen Bridget und Patrick O’Connor zu ihrer alljährlichen Mittsommernachtsfeier in Stonehenge auf. Sie versprachen Nicholas, ihn eines Tages dorthin mitzunehmen.
Er hielt Granny Bridget lange umarmt und sog genussvoll ihren Lavendelduft ein. »Lass dich von deinem Engel leiten, Nick«, flüsterte sie ihm ins Ohr, woraufhin er ihre butterweiche Wange küsste.
»Vielen Dank, Becky. Hab Dank für unser altes Zuhause, das du uns bereitet hast.« Zärtlich gab Granny Bridget ihrer Enkelin einen Kuss auf die Stirn. »Und höre auf Bran«, fügte sie leise hinzu und sah ihr dabei bedeutungsvoll in die Augen.
»So mein Junge, nun heißt es Abschiednehmen!« Grandpa Patty hatte so laut gesprochen, dass Nicholas ein wenig zusammengezuckt war. »Pass mir gut auf deine Mutter auf!«
»Das verspreche ich dir, GranGrandpa.« Nicholas schlang seine Ärmchen um den alten Seemann und konnte es sich nicht verkneifen, diesen ein letztes Mal am Bart zu zupfen.
»Mein lieber Junge«, schniefte Grandpa Patty und zog ihm sanft die Ohren lang. Mit feuchten Augen wandte er sich an seine Enkelin, um auch von ihr Abschied zu nehmen. Dann stieg er sichtbar schweren Herzens in die vor der Poststation abfahrbereite Kutsche.
Nicholas und Rebecca winkten ihnen lange hinterher, bis das von Granny Bridget geschwungene weiße Tuch nicht mehr zu sehen war. Mit gesenktem Haupt griff Nicholas nach der Hand seiner Mutter. Schweigsam traten beide den Rückweg zum Cottage an.
Edward Major schaute ihnen mit einem leisen Lächeln hinterher. Auch wenn viel über diese Familie getuschelt wurde, so konnte er die Vorbehalte der Leute nicht teilen. Zugegeben, war auch er zuweilen von Bridget O’Connors Blick eigentümlich berührt und empfand deren Ausübung der jahrhundertealten Riten ihrer keltischen Vorfahren als etwas verschroben. Aber sie deswegen der Hexerei zu bezichtigen, führte für seinen Geschmack zu weit. Nicht dass in seiner Gegenwart dieses Wort je gefallen wäre, aber die Andeutungen, vor allem einer bestimmten Dame aus den höchsten Gesellschaftskreisen, hatten keinerlei Zweifel daran gelassen, welche Art Tätigkeit die Alte ausübte. Diese Kunst werde von Generation zu Generation weitergegeben, und nach dem Tode der Tochter würden nun die Enkelinnen unterwiesen werden, so hieß es. Auch der kleine Nicholas solle bereits das Gift in sich tragen, habe er doch denselben unheimlichen Blick und schockiere die Leute mit ungeheuerlichen Äußerungen. Sein Großvater habe darum ein besonderes Augenmerk auf den Jungen, dessen Seelenheil es zu retten gelte. Er gebe niemals eines seiner Schäfchen verloren, erst recht nicht, wenn es sich um seinen eigenen Enkel handele.
Von dem ganzen Gerede hielt Edward Major überhaupt nichts. Er wusste, dass selbst wenn ein winziges Körnchen Wahrheit darin enthalten sein mochte, der Rest hinzugedichtet und maßlos aufgebauscht wurde. Er jedenfalls wechselte gerne mit der jungen Mrs. Cornelly ein Wort. Und auch den kleinen Nicholas, der ab und zu die Briefe der Mutter an Schwester und Großeltern bei ihm aufgab, konnte er gut leiden. Er hatte ihn als sehr scheues Kind kennengelernt, doch seit Edward Major ihm jedes Mal ein freundliches Wort und einen Bonbon schenkte, war er schnell zutraulicher geworden. Aber wehe, jemand betrat das Postamt, dann schnappte er zu wie eine Auster und verabschiedete sich hastig, ohne auf seinen Pfefferminzbonbon zu warten. Edward Major spürte deutlich, dass dieses Kind bereits schlechte Erfahrungen im Umgang mit Menschen gemacht hatte. Es tat ihm daher von Herzen leid. So würgte er neuerdings die Gespräche ab, sobald Schlechtes über den Jungen gesprochen wurde. Das hatte ihm schon manchen verwunderten Blick eingehandelt, denn so etwas war man von ihm nicht gewohnt.
Kapitel 4
Peter hatte ihnen gestattet, noch für die nächsten beiden Monate im Cottage zu bleiben. Das hatten sie dem ungewöhnlich heißen Sommer zu verdanken, der die Temperaturen in London auf mehr als neunzig Grad Fahrenheit steigen ließ. Die aufgeheizte Luft mischte sich mit dem Ruß aus den qualmenden Fabrikschloten und legte sich wie eine Dunstglocke über die ganze Stadt. Dies hatte bei etlichen Londonern bereits zu akuter Atemnot geführt. Für Rebeccas angegriffene Lunge wäre es unzumutbar gewesen.
Sie war froh, dass Peter an den Wochenenden Robert mitbrachte. Dieser trug wesentlich dazu bei, die angespannte Stimmung zwischen ihnen zu lockern. Die neue Eisenbahnstrecke von Victoria Station nach Dover erleichterte den beiden die Anreise erheblich.
Auch Nicholas freute sich, seinen Patenonkel um sich zu haben. Nicht nur, weil dieser oft mit ihm spielte, sondern auch, weil er niemals müde wurde, seine immer neuen Fragen zu beantworteten. »Du musst wohl alles ganz genau wissen, was Sportsfreund? Aber frag nur, auf die paar Löcher mehr oder weniger in meinem Bauch kommt es jetzt auch nicht mehr an!«, neckte er Nicholas zuweilen. Mit seiner komischen Art brachte er oft alle zum Lachen.
Nach der Sonntagsmesse fanden sich alle im Pfarrhaus ein, wo Peter und Robert aus London berichteten. Es war oft von Kämpfen die Rede, wie Rebecca, über eine Handarbeit gebeugt, besorgt zur Kenntnis nahm. Die Demonstrationen der Arbeiterschaft nähmen immer größere Ausmaße an. Fast wöchentlich komme es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, welche die verbotenen Versammlungen im Hyde Park zu unterbinden suchte. Peter war es mehr als einmal passiert, dass er inmitten der hoffnungslos verstopften Oxford Street in einer Droschke festsaß und den restlichen Heimweg zu Fuß fortsetzen musste. »Und das bei dieser Hitze und dem Gestank«, beschwerte er sich. »Da nützt selbst die letztes Jahr in Betrieb genommene Kanalisation des guten Bazalgette nichts.«
Nicholas, der in einer Ecke des Zimmers die Ohren spitzte, sah des Öfteren verstört von seinem Legespiel auf. Obgleich er das meiste noch nicht begriff und er zu vielen Wörtern kein Bild hatte, entging ihm das Wesentliche trotzdem nicht. Über die achttausend preußischen und habsburgischen Soldaten, die in der Schlacht bei Königgrätz ihr Leben gelassen hatten, kam er einfach nicht hinweg. Für Nicholas war dies eine nicht vorstellbare Zahl und darum umso beängstigender. Als er Großvater Jeremiah fragte, warum der liebe Gott so etwas Schreckliches zugelassen habe, wurde er ohne Erklärung des Zimmers verwiesen.
Einige Wochen später schrak Nicholas regelrecht zusammen, als von blutigen Auseinandersetzungen zwischen tausendsiebenhundert Polizisten und Tausenden von Demonstranten die Rede war, die sich in London eine Schlacht geliefert hätten. Hier ging es nicht mehr um gefallene Soldaten irgendwo auf dem Kontinent, sondern um Tote und Verletzte in London, der Stadt, in der sie wohnten. Er hörte seinen Vater die Demonstranten „Proletenpack“ schimpfen und sie beschuldigen, lediglich auf Krawall gebürstet zu sein. Doch hieß er das von der Reform League geforderte Wahlrecht für den städtischen Mittelstand gut. Nicholas fand das alles sehr verwirrend.
Unter diesen Eindrücken stehend, war er stets froh, wenn Mrs. Finigan zum Essen läutete. Stand erst der Sonntagsbraten auf dem Tisch, verflüchtigten sich seine bedrückenden Empfindungen und bis zum Kuchen waren die vollends verflogen.
An einem sehr heißen Sonntag kramte Rebecca nach der Mittagsruhe in ihrem Jungmädchenzimmer in einer Kiste. Als sie mit einer triumphierenden Geste eine kleine Blechschachtel mit Pastellkreiden hervorzauberte, strahlte Nicholas begeistert. Am selben Nachmittag saßen sie lange auf der Bank an der Kirchhofmauer und malten, was die Natur ihnen vorgab, während die drei Herren die voranschreitenden Restaurierungsarbeiten in St. Mary’s begutachteten.
Am Abend wurden ihre Kunstwerke allgemein bestaunt; nur Peter konnte sich nicht enthalten anzumerken, dass es sinnvoller wäre, dem Jungen endlich ein gewisses Zahlenverständnis beizubringen, schließlich solle er einmal die Geschäfte übernehmen! Robert erging sich sogleich in Schwärmereien über den neuen Malstil der Franzosen, deren Werke ebenso draußen in der Natur entstünden wie die ihren. Vor allem über einen gewissen Edouard Manet ließ er sich aus, dessen Motive bereits für manchen Skandal in der Kunstwelt gesorgt hätten. Als Nicholas nachfragte, was dieser denn male, erging sich Robert in vieldeutigen Umschreibungen, die ein ungehaltenes Räuspern des Vikars und einen strafenden Blick Peters nach sich zogen. Nicholas schaute ratlos, als er etwas von „Körperlandschaften“ vernahm. Rebecca hingegen konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, wofür sie umgehend ermahnt wurde. Robert jedoch war kaum zu bremsen, nachdem er einem weiteren Gläschen Port zugesprochen hatte. »O là là, quel filou, dieser Edouard!« Seine Augen blitzten vor Vergnügen, als er versprach, Nicholas später mit auf Reisen zu nehmen, um ihm Manets Olympia im Pariser Salon des Refusés vorzustellen – falls diese bis dahin nicht einen Liebhaber gefunden hätte. Rebecca musste sich auf die Zunge beißen, um ein Kichern zu unterdrücken. Nur gut, dass weder Peter noch ihr Vater wussten, um was für ein Frauenzimmer es sich hierbei handelte.
Anfang August erhielt Rebecca schlimme Nachrichten von Judith, die an einem ihrer wenigen freien Tage zu Besuch hatte kommen wollen. Doch eine Ende Juli in London ausgebrochene Cholera-Epidemie machte diese dort unabkömmlich. Trotz der Sachlichkeit, in der ihr Brief verfasst war, las er sich beängstigend.
Vor allem die im Osten gelegenen Stadtteile, in der Judith ihren Dienst versah, waren von der Epidemie betroffen. Neben ihrer Tätigkeit am St. Thomas‘ Hospital arbeitete sie seit Kurzem für den Armenarzt Dr. Johnson, der seine Praxis in Stepney führte und dankbar war für jede helfende Hand, gleich ob männlich oder weiblich. Das Elend in diesem Viertel, so schrieb Judith, koste ihr mehr Kraft als die Arbeit selbst:
Seit Wochen stellen wir ein und dieselbe Diagnose: Cholera. Kaum, dass wir die verdreckten und viel zu engen Behausungen betreten, stößt uns der Geruch des Todes entgegen, den selbst der Gestank nach Unrat und Fäkalien nicht zu übertünchen vermag. Ein Bild des Jammers empfängt uns. Die Erkrankten lagern oftmals nur auf etwas Stroh oder verschmutzten Fetzen am Boden. Abgemagert und von Krämpfen gepeinigt, blicken sie uns teilnahmslos aus eingesunkenen Augen entgegen, die Gesichter grau wie Blei. Dann wissen wir bereits, dass wir zu spät kommen. Um sie herum weinende Kinder, klagende Frauen, betrunkene Männer oder streunende Hunde und Katzen auf der Suche nach Nahrung, von denen die hier lebenden Menschen kaum selbst genug haben.
All diesem Leid ohnmächtig gegenüberzustehen, macht mich oft wütend. Ich war zu lange Miss Nightingales Schülerin, um nicht die Ursache dieser Seuche in den unhygienischen und unmenschlichen Wohnbedingungen zu sehen. Die mangelhafte Ernährung tut gewiss das Übrige dazu. Außerdem gibt es mir zu denken, dass im Zentrum der Stadt, wo dank Bazalgette das Trinkwasser aus der Themse an dem Abwasser vorbeigeleitet wird, kaum Cholerafälle gemeldet werden, wohingegen sich die Seuche in den östlichen Bezirken, vorrangig in den Arbeitervierteln, gnadenlos austobt. Dr. Johnson zeigt sich von meiner Theorie, dass die Übertragung der Cholera mit der Verunreinigung des Trinkwassers zusammenhängen könnte, beeindruckt und berichtete mir, dass der Armenarzt John Snow bereits 1854 die gleiche Theorie aufgestellt habe, nachdem es in jenem Jahr vermehrt zu Cholerafällen im Umkreis einer viel benutzten Straßenpumpe in der Broad Street gekommen sei. Doch zur selben Zeit sei ein deutscher Wissenschaftler namens Max von Pettenkofer zu der Überzeugung gelangt, dass Cholera durch Gasentwicklung bei der Zersetzung flüssiger Exkremente im Erdreich verursacht werde und die Ansteckung daher über die Luft erfolge. Eine Ausbreitung über Trinkwasser halte dieser für ausgeschlossen.
Aber ich will Dich nicht mit medizinischen Details langweilen, Becky. Gesagt sei nur noch, dass Dr. Johnson mich sehr in meinen Forschungen unterstützt und mit entsprechender Fachliteratur versorgt, die sonst nur Medizinern zugänglich ist. Er hat sich inzwischen damit abgefunden, dass ich den Dingen mit wissenschaftlichem Verstand auf den Grund zu gehen trachte, eine Eigenschaft, die er uns weiblichen Wesen bisher abgesprochen hatte. Anscheinend habe ich ihn eines Besseren belehrt! Auch seine Frau scheint meine Anwesenheit inzwischen nicht mehr groß zu stören.
Mittlerweile lässt mich Dr. Johnson in seiner Sprechstunde einige seiner weiblichen Patienten behandeln. Sie legen mir gegenüber ihre Scheu bei der Untersuchung wesentlich schneller ab. Er arbeite ausgesprochen gern mit mir zusammen, versicherte er mir kürzlich, wolle mich aber trotzdem in meinen Bestrebungen, ein Medizinstudium aufzunehmen, unterstützen. Die gegenwärtige Situation lässt jedoch keinen Gedanken an die Zukunft zu. In nur wenigen Tagen hatten wir an die hundert Todesfälle zu melden. ...
Nach dem Lesen dieses Briefes konnte Rebecca nicht umhin, um das Leben ihrer Schwester zu bangen. Was, wenn auch sie an dieser todbringenden Seuche erkrankte? Doch Judith war von ihrer aufgestellten Ursachen- und Ausbreitungstheorie dermaßen überzeugt, dass sie keine unmittelbare Gefahr für sich sah. Sie halte sich streng an die Hygienevorschriften, und auch den noch gesunden Menschen im Viertel rate sie, das Trinkwasser abzukochen und vor der Mahlzeit die Hände zu waschen. Sie verteile stets ein kleines Stück Seife, obwohl sie wenig Hoffnung hege, dass die Leute Gebrauch davon machten.
Einmal mehr bewunderte Rebecca die Stärke ihrer Schwester, die sich so selbstlos für die unterprivilegierte Bevölkerungsschicht einsetzte, ohne an ihre eigene Schonung zu denken.
Unterdessen hatte Rebecca im Garten alle Hände voll zu tun, um in den noch heißeren Augusttagen alles am Grünen und Blühen zu halten. Bei bedecktem Himmel ging Nicholas ihr zur Hand. Er zupfte Unkraut, goss Blumen, fragte nach deren Namen und zeichnete sie. Schon bald setzte er ihre botanischen Namen darunter. Anfangs führte Rebecca ihm die Hand, doch mit der Zeit schaffte er es ganz allein. Die für ihn neue Welt der Buchstaben begeisterte ihn. Darum bemühte er sich, die kurzen Texte in seinen Bilderbüchern zu entziffern. Mit Eifer saß er davor und strahlte vor Freude, wenn es ihm gelang. Wann er zur Schule komme, wollte er wissen. Das habe noch Zeit, antwortete sie ihm und tat innerlich einen erleichterten Seufzer.
Am Abend, wenn die Sonne ihre gnadenlosen Strahlen zur Ruhe schickte, kletterte er in den Klippen umher und kühlte sich anschließend im Meer ab, während sie dem Farbwechsel des Abendhimmels zusah. Er bat sie, ihm das Schwimmen beizubringen. Zu seinem Verdruss gelang ihm jedoch nicht mehr als ein einzelner Schwimmzug, bevor es ihn wieder unter Wasser zog. Eines Abends beschloss er, nicht eher heimzugehen, als bis ihm noch ein weiterer gelänge. So bemerkten sie erst spät, dass es dunkel geworden war.
»Jetzt aber schnell nach Hause, du Wasserratte«, lachte Rebecca.
»Aber Mummy, jetzt kommt doch der schönste Teil!«
Mit diesen Worten streckte er sich auf einem vom Mond beschienenen Flecken aus. Auf ihrem Lieblingsstein, dicht unterhalb der Klippe, hielt auch Rebecca ihr Gesicht den silbrigen Strahlen entgegen. »Der Mond streichelt mich, Mummy«, hörte sie ihn murmeln. »Spürst du ihn auch?«
»Mmh …«, seufzte sie schwer. Eine tiefe Sehnsucht hatte ihr Herz erfasst.
»Onkel Bob sagt, dass in Italien und Frankreich der Mond eine Frau ist. La luna heißt er in Italien, la lune in Frankreich. In Deutschland hingegen ist er ein Mann: der Mond. Und bei uns?«
»Das lehren uns die Dichter, Nick: Who but is pleased to watch the moon on high; travelling where – she – from time to time enshrouds* …«
»Es kann ja gar nicht anders sein, als dass der Mond eine Frau ist, Mummy, denn er ist ebenso geheimnisvoll.«
»Soso, du findest also, dass Frauen geheimnisvoll sind?«
»Du auf jeden Fall. Und Granny Bridget erst recht«, antwortete er feierlich.
Am nächsten Morgen kam Nicholas aufgeregt in die Küche gerannt.
»Mummy, Mummy, heute Abend werde ich richtig schwimmen können!«, rief er mit weit aufgerissenen Augen, die noch in ihren vom Schlaf gedunsenen Betten lagen.
»So? Woher nimmst du diese Gewissheit, mein Liebling?«
»Ich habe es geträumt ...«
»Na, erzähl schon«, forderte sie ihn auf, während er sich noch die Schlafkörnchen aus den Augen rieb.
»Ich war wieder in dem dichten Wald, von dem ich schon so oft geträumt habe. Aber diesmal bin ich nicht entlang der Schlucht den steilen Pfad nach oben gegangen, sondern tiefer in den Wald hinein. Der Mond hat mir den Weg geleuchtet. Plötzlich stand ich vor einem Waldsee. Das Wasser kam aus einer nahen Felsquelle, ich konnte es plätschern hören. Tausend Sterne spiegelten sich in dem dunklen See. Eine Stimme flüsterte mir zu: »Schwimm zur Quelle, Nicholas!« Es war in einer fremden Sprache, aber ich konnte sie trotzdem verstehen. Ich wusste, dass ich der Stimme gehorchen muss, darum habe ich meine Kleider ausgezogen und bin Schritt für Schritt in den See gegangen, bis ich plötzlich keinen Boden mehr unter den Füßen hatte. Ich war frei, ganz frei. Da begann mein Herz ganz doll zu klopfen. Ich habe die Schwimmbewegungen gemacht, die du mir beigebracht hast, Mummy, und dann bin ich richtig geschwommen! Das Wasser hat mich bis zur Quelle getragen. Als ich dort dem See entstiegen bin, hat mein ganzer Körper geleuchtet.«
»Was für ein wundervoller Traum, Nick«, sagte Rebecca ergriffen, obwohl ihr ein wenig beklommen ums Herz geworden war. »Aber jetzt wird gefrühstückt«, fügte sie, die seltsame Empfindung beiseite schiebend, fröhlich hinzu.
Am selben Abend schaffte Nicholas tatsächlich erst zwei, dann drei und schließlich sieben Schwimmzüge hintereinander. Er wollte nicht mehr aus dem Wasser heraus. Immer mehr Züge gelangen ihm und am Ende schwamm er wie ein Fischlein im Meer. Erst als er blaue Lippen bekam, ließ er sich überreden, am Strand in der noch warmen Sommerluft sein geliebtes Mondbad zu nehmen.
Der Mond hatte an diesem Abend sein volles Rund erreicht und übergoss den Strand mit einer wahren Silberflut. Rebecca hob ihr Gesicht zum östlichen Nachthimmel und stimmte eine uralte Weise an. Sie handelte vom Siebengestirn. Und obwohl sie diese zum ersten Mal in Nicholas’ Gegenwart sang, behauptete er, sie bereits zu kennen. Da wusste sie, dass Granny Bridget recht hatte.
Ende August bereitete Rebecca alles für ihre Abreise nach London vor und beauftragte Mrs. Finigan mit der Gartenpflege.
Den letzten Tag verbrachte Nicholas im Garten unter der Linde und im Wäldchen auf der alten Eiche. Der Rabe war aushäusig, worüber er froh und traurig zugleich war. Am Abend sagte er dem Meer auf Wiedersehen und stopfte sich die Taschen voller Muscheln und Sand, bevor er die geheime Bucht verließ.
Ihre Herzen waren schwer vom Abschiednehmen. Gemeinsam gedachten sie der glücklichen Tage, die sie hier verlebt hatten. Ihre Abreise kam ihnen vor wie die Vertreibung aus dem Paradies.
Teil II Berkeley Street in London – Herbst/Winter 1866
Kapitel 1
An einem sonnigen Tag Anfang Oktober ritt Peter zusammen mit Robert im Hyde Park aus, als er Zeuge eines Überfalls wurde. Eine Gruppe zerlumpter Kinder, deren Anführer höchstens vierzehn Jahre zählen mochte, hatte sich einer allein im Park spazieren gehenden Dame genähert und sie umzingelt. Peter, der dies von Weitem beobachtet hatte, beschloss ihr zur Hilfe zu eilen. Als Robert und er im vollen Galopp angeritten kamen, erschraken einige der Kinder derart, dass sie laut aufschrien, was Peters Pferd zum Scheuen brachte. Es bäumte sich auf die Hinterbeine und die Kinderbande stob unverrichteter Dinge davon. Die Dame jedoch, starr vor Schreck, wäre von den Vorderhufen des wieder auf die Beine kommenden Pferdes erfasst worden, hätte Peter nicht in letzter Sekunde die Zügel zur Seite gerissen, sodass sein Pferd beim Absetzen eine leichte Drehung vollführte. Dieses, noch von Sinnen, scheute erneut und warf Peter aus dem Sattel. Robert und die fremde Dame kümmerten sich um ihn, während das wild gewordene Pferd von einem beherzten Spaziergänger aufgehalten und beruhigt wurde. Peter glaubte sich unverletzt. Als er sich jedoch erheben wollte, schoss ein stechender Schmerz in seinen rechten Unterarm, sodass er laut aufstöhnend zurücksank. Mit einer Droschke wurde er in Dr. Mansfields Praxis gebracht, der den gebrochenen Unterarm richtete und schiente.
Dieses Ereignis, das Peter zwingen sollte, seine Arbeit für eine gewisse Zeit ruhen zu lassen, warf ihn völlig aus der Bahn. In der ersten Woche nach dem Unfall machte er die Erfahrung, dass er zum Müßiggang einfach nicht geboren war. Abgesehen von den ständigen Schmerzen, die nur mithilfe des Medikaments einigermaßen zu ertragen waren, trieb die verordnete Untätigkeit ihn fast in den Wahnsinn. Der von Rebecca angebotenen Lektüre vermochte er nicht viel abzugewinnen und wegen seiner beim Gehen schmerzenden Hüfte waren Spaziergänge oder Museumsbesuche ausgeschlossen. So blieb ihm nichts anderes übrig, als die Tage lustlos in Zeitungen und Magazinen zu blättern, über deren Artikel er sich dermaßen erregte, dass sich seine Laune noch mehr verschlechterte. Besonders als er in der Times von den vielen Kinderbanden und Straßenräubern las, denen die Polizei einfach nicht Herr wurde. Was war bloß los mit diesem Land, dass man als unbescholtener Bürger nicht mehr unbehelligt seiner Wege gehen konnte?
Missmutig warf er die Zeitung zur Seite und klingelte ungehalten nach Margret, die sich mit dem Servieren des Tees schon wieder verspätet hatte. Machte denn hier jeder nur noch, was er wollte?
Obwohl Dr. Mansfield Peter noch absolute Ruhe verordnet hatte, fuhr er nach Ablauf der dritten Woche wieder ins Kontor, »nur um nach dem Rechten zu sehen«, wie er betonte. Doch konnte er den Anblick des sich türmenden Papierberges auf seinem Schreibtisch nicht ertragen. Den Schmerz ignorierend, der ihm beim Schreiben durch den Arm schoss, machte er sich an die Arbeit, bis ihm übel davon wurde. Es blieb ihm daher nichts anderes übrig, als die Dosis des verordneten Schmerzmittels eigenmächtig zu erhöhen. Nur so konnte er seiner Arbeit wieder einigermaßen nachgehen. Und das musste er, wenn er nicht verrückt werden wollte! Außerdem hatte Robert seine Geschäftsreise schon zu lange hinausschieben müssen. Peters Anwesenheit im Kontor war also unabdingbar.
***
Die Luft war in den letzten Tagen merklich kühler geworden. Die eine Hälfte des bunten Herbstlaubes bedeckte bereits Parkwege und Straßen, während die andere noch in den Baumkronen leuchtete. Nur die Kastanien hatten in diesem Jahr ihr Laub schon zur Gänze abgeworfen und kündigten mit ihrem kahlen Geäst den bevorstehenden Winter an.
Die Eichhörnchen im Regent’s Park suchten eifrig nach Wintervorräten, indes die Enten ihr Gefieder fetteten. Rebecca sog die würzige Luft ein und genoss den Frieden, der sich über die zur Ruhe kommende Natur legte. Sie hatte sich auf einer Parkbank nahe dem See niedergelassen, wo stets einige Spaziergänger vorbeikamen.
Peter hatte ihr Anweisung erteilt, niemals an uneinsichtigen Orten zu verweilen. Seit dem Vorfall im Hyde Park war er ständig um ihre Sicherheit besorgt. Am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn sie ohne ihn nirgends mehr hingegangen wäre. Aber Rebecca hielt es so allein in der Wohnung einfach nicht aus.
Sie holte einen Gedichtband aus ihrem Beutel und strich gedankenverloren über den Buchdeckel der Portugiesischen Sonette. Elizabeth Barrett-Browning war die Lieblingsdichterin ihrer Mutter gewesen, das Büchlein hatte stets auf ihrem Nachttisch gelegen. Wie sehr sie sich dieser Tage nach ihrer Mutter sehnte! All ihre Seelenpein hätte sie dieser mitteilen können und Verständnis und Trost erfahren, zumindest eine liebevolle Umarmung.
Sie schlug das Büchlein auf und ein Windzug wehte die ersten Seiten um. Unwillkürlich begann Rebecca zu lesen:
Mag Land um Land anwachsen zwischen uns, so muss doch dein Herz in dem meinen bleiben, doppelt schlagend. Und was ich tu und träume, schließt dich ein: So sind die Trauben überall im Wein. Und ruf ich Gott zu mir: Er kommt zu zwein; Und sieht mein Auge zweier Tränen tragend.*
Mit feuchten Wangen blickte sie den schnell ziehenden Wolken hinterher und betete inständig, sie würden diese Worte mit sich auf Reisen nehmen und am richtigen Ort niederregnen lassen.
Abrupt stand sie auf und verließ zügigen Schrittes den Park. Es war noch zu früh, darum beschloss sie, in einer der vielen kleineren Kirchen in St. Marylebone zu einem stillen Gebet einzukehren, bis ihre aufgewühlte Seele wieder etwas Frieden fände.
»Ich danke Ihnen, Miss Thompson. Ihre Dienste werden für heute nicht mehr benötigt!«
»Danke, Ma’am.«
Freudig nahm Harriet Thompson die drei Schillinge entgegen, knickste und suchte das Weite. Es war nicht schlecht für eine bereits bezahlte Arbeit nochmals entlohnt zu werden, um sie nicht zu tun.
Rebecca sah Harriet Thompson mit wehenden Häubchenbändern enteilen. Sie stellte sich vor, wie diese sich heimlich ins Fäustchen lachte und ihr zusätzliches Geld in einem der Wirtshäuser in Soho in Gin umsetzte. Noch immer konnte sie es nicht fassen, dass Peter ausgerechnet diese Person als Kindermädchen eingestellt hatte. Auf sie jedenfalls wirkte diese nicht besonders vertrauenswürdig, man sah ja, wie bestechlich sie war! In diesem Fall zu Rebeccas Gunsten und so arrangierte sie sich mit ihr. Ihre Einwände hätten bei Peter sowieso kein Gehör gefunden.
Zum wiederholten Male schaute sie auf die große Uhr über dem Eingang des Schulgebäudes. Noch zehn Minuten, dann würde er wie immer als einer der Letzten herauskommen.
Rebecca fröstelte und begann die Straße auf und ab zu gehen.
Es hatte ja unbedingt eine Schule im vornehmen Kensington sein müssen, obwohl das Schulgeld unverschämt hoch war und sie weit von ihrem Wohnort entfernt lag. Nicholas musste sich jeden Morgen in die überfüllten Abteile zweier Untergrundbahnen zwängen, um hierher zu gelangen. Nachmittags das Gleiche retour. Miss Thompsons Aufgabe bestand darin, ihn bei diesen zeitaufwändigen Fahrten zu begleiten. Pferdeomnibusse boten keine Alternative, Droschken kamen zu teuer und eigen Pferd und Wagen konnten sie sich zu Peters Bedauern immer noch nicht leisten.
Ein Schauer durchlief sie, als sie an den schlimmen Tag Anfang September zurückdachte. Kaum dass sie sich in der Berkeley Street wieder eingerichtet gehabt hatten, hatte Peter ihr eröffnet, dass er Nicholas an einem Internat außerhalb Londons angemeldet habe. Fassungslos hatte sie ihn angestarrt und geglaubt, er treibe Scherz mit ihr, aber sein Gesicht hatte keine Spur von Heiterkeit gezeigt. »Das kann nicht dein Ernst sein, Peter!«, hatte sie ihm ungläubig entgegnet, aber er war auf ihre Reaktion vorbereitet gewesen und hatte eine „Liste guter Gründe“ parat, die er ihr triumphierend vorgetragen hatte. Außerdem würde ihr Vater dies ebenfalls befürworten und habe eigens seine Kontakte spielen lassen, damit Nicholas dort Aufnahme fände.
Es hatte eine Weile gedauert, bis sie begriffen hatte, dass alles bereits geregelt und abgemacht gewesen war. Daraufhin war ihr alles Blut aus dem Kopf gewichen. Als sie wieder zu sich gekommen war, hatte Peter ihr besorgt ein Glas Brandy an die Lippen gehalten. Nachdem sie wieder hatte klar denken können, hatte sie ihn angefleht, ihr das nicht anzutun, wenn er sie noch liebe. Doch er hatte nur reglos dagesessen. Daraufhin hatte sie sich ihm zu Füßen geworfen, hatte gebeten und gebettelt, sie nicht von ihrem Kind zu trennen. Wütend war er aufgesprungen und hatte sie angezischt, dass Nicholas eine Entwöhnung von ihr dringend nottäte.
Dieser hatte, von ihnen unbemerkt, alles mit angehört und war in sein Zimmer gerannt. Erschrocken war Rebecca hinter ihm her geeilt, aber er hatte sich eingeschlossen und auf ihre Zurufe nicht geantwortet.
Wie betäubt hatte sie sich auf ihr Bett fallen lassen, als ihr plötzlich, mitten in ihrer Verzweiflung, die Worte eines Traumes in den Sinn gekommen waren, den Nicholas ihr einmal am Strand erzählt hatte: Und sie waren eine Weile sehr glücklich. Doch dann verlangte der böse Zauberer Cornelius von ihr, ihr Kind in fremde Hände zu geben, damit es dort erzogen werde. Prinzessin Dicentra weinte verzweifelt um ihr Kind … Mit klopfendem Herzen hatte sie erkannt, dass Nicholas alles vorhergesehen hatte. Hör auf Bran, hatte Granny Bridget ihr zum Abschied geraten, doch Rebecca hatte nicht daran glauben wollen. Hatte letztendlich nicht ein Nachtengel Dicentra vor ihrem Sturz in die Tiefe bewahrt? Denke an dein Kind! Eure Liebe bindet dich an dieses Dasein, das dir so unerträglich erscheint. Halte aus, holde Dicentra, und glaube an mich!
Ja, sie wollte gerne an ihn glauben!
Sie hatte sich die Haare geordnet und war entschlossen vor Peter getreten. Mit fester Stimme hatte sie ihn gefragt, ob er lieber ein verlassener Ehemann oder ein Witwer sein wolle – noch hätte er die Wahl. Sie hatte alles auf eine Karte gesetzt, denn sie hatte nichts zu verlieren gehabt. Das Kostbarste, das sie im Leben besaß, war Peter gerade im Begriff gewesen, ihr zu nehmen.
Daraufhin hatte er die Fassung verloren. Er lasse sich nicht erpressen, hatte er getobt, er sei der Herr im Haus und sie habe sich gefälligst zu fügen! Als sie seine zu Fäusten geballten Hände erblickt hatte, war sie erschrocken zurückgewichen. Sie hatte gemeint, einen Fremden vor sich zu haben.
Es sei sein Gewissen, dem gegenüber er verantwortlich sei, hatte sie ihm ruhig zu entgegnen vermocht, bevor sie sich entfernt hatte.
Als sie an Nicholas’ Zimmer vorbeigekommen war, hatte sie seine Tür nunmehr unverschlossen vorgefunden. Sie hatte sich zu ihm gelegt und ihn fest in die Arme genommen. Peter würde sie nicht eher voneinander trennen können, bis er einwilligte, Nicholas nicht in dieses schreckliche Internat zu schicken! Sie ahnte, dass ihr Vater seine Hände bei all dem mit im Spiel hatte.
Zähneknirschend hatte Peter nachgegeben, aber darauf bestanden, dass Nicholas stattdessen eine angesehene Schule in London besuchte und sich in der übrigen Zeit ein Kindermädchen um ihn kümmerte. So kam es, dass Rebecca kaum Zeit mit ihrem Sohn verbringen konnte, wenn sie sich diese nicht erschlich oder erkaufte.
Etwas verloren stand er auf dem inzwischen verlassenen Schulhof und schaute sich suchend um. Ein kräftiger Windstoß, der um die Gebäudeecke pfiff, drohte ihn fast umzuwerfen. Zart und zerbrechlich wirkte er in dieser ihm fremden Welt; wie ein Vergissmeinnicht, das zwischen den Fugen des Kopfsteinpflasters in der Oxford Street hervorschaut, in der unsinnigen Hoffnung, den Tag zu überleben.
Rebecca eilte zu ihm und drückte ihn an sich, in dem Wunsch, ein Stückchen Lebendigkeit in ihm zu finden. Doch sie wurde wieder einmal enttäuscht. Bekümmert nahm sie ihn bei der kalten Hand und rief eine Droschke heran.
»Dieser Nachmittag gehört nur uns beiden. Freust du dich?«
Er nickte und sah dankbar zu ihr auf.
»Was möchtest du machen, wo sollen wir hinfahren, mein Liebling?«
Ein sehnsüchtiger Blick trat in seine Augen. »Ich möchte nach Hause, Mummy«, antwortete er kaum hörbar.
»Wir wären nicht lange allein dort, Nick. Dein Vater kommt heute früher von der Arbeit zurück, weil wir am Abend Gäste erwarten.«
Nicholas blickte verwirrt. »Ich meinte nicht die Berkeley Street. Ich möchte in unser richtiges Zuhause. Das aus meinen Träumen.«
Fröstelnd zog Rebecca ihren Umhang fester.
Ihm wurde übel, und für einen kurzen Augenblick glaubte er, den Boden unter sich schwanken zu spüren. Diesmal lag es jedoch nicht an den Schmerzen in seinem Arm, sondern an der ungeheuerlichen Erkenntnis, die sich ihm auftat. Ungläubig starrte er auf die vor ihm liegenden Zahlen, unfähig, den völlig abwegigen Gedanken, der sich ihm aufdrängte, zu Ende zu denken. Nein, das konnte einfach nicht sein! Er würde dies gleich morgen früh mit seinem Buchhalter klären. Samuel Ferguson war die Korrektheit in Person, aber schließlich konnte auch ihm einmal ein Fehler unterlaufen. Eine andere Erklärung gab es hierfür einfach nicht. Trotzdem lag ihm ein Stein im Magen. Er schlug das Kassenbuch zu und starrte gedankenverloren aus dem Fenster. Vor dem Haus hielt eine Droschke, aus der er seine Frau und seinen Sohn aussteigen sah. Wo war Miss Thompson? Peter spürte Hitze in sich aufsteigen.
»Ich bin den beiden zufällig begegnet und habe Miss Thompson etwas früher aus ihren Diensten entlassen, da sie ihre kranke Mutter besuchen wollte«, hatte sich Rebecca eine passende Antwort bereits zurecht gelegt. Sie wusste, dass er sich nicht die Blöße geben würde, beim Kindermädchen nachzufragen, ob dies stimmte.
»So hatte ich wenigstens heute einmal Gelegenheit, ein paar Worte mit meinem Kind zu wechseln«, fügte sie spitz hinzu.
»Und wer bringt den Jungen nachher zu Bett? Du weißt doch, dass wir heute Abend Gäste erwarten. Ich will nicht, dass Nicholas dann noch irgendwo hier herumgeistert!«
»Das wird Margret heute mal übernehmen, nicht wahr, Maggie?«, wandte sich Rebecca an die gerade hereinkommende Haushälterin.
»Gewiss Ma’am, das mache ich gerne«, antwortete diese prompt und zwinkerte Rebecca verschwörerisch zu.
Grummelnd ging er, um sich für den Abend umzukleiden.
Hätte er bloß auf seinen Schwiegervater gehört! Es hatte sich so gut wie nichts geändert. Zwar hatte er seine Frau wieder an seiner Seite, aber seine geliebte Becky schien ein für alle Mal entschwunden. Gewiss, seit dem Drama vor zwei Monaten war Rebecca bemüht, ihn nicht unnötig zu reizen; nur ab und an konnte sie sich eine bissige Bemerkung nicht verkneifen. Ansonsten tat sie alles, was er von ihr verlangte. Sie mimte die perfekte Gastgeberin und begleitete ihn auf alle anstehenden Geselligkeiten. Nach außen hin wirkte sie gelassen, schenkte jedem ein bezaubernd falsches Lächeln und gab vor, sich zu amüsieren. Die Leute bemerkten anscheinend nichts von ihrem Schauspiel, sie waren viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt.
Wieder einmal hatte er Rebecca nachgegeben und einen Kompromiss für Nicholas’ Erziehung gefunden, was ihm sein Schwiegervater prompt als unverbesserliche Schwäche vorgeworfen hatte. Oh ja, Jeremiah hatte deutlich seine Enttäuschung ob Peters Nachgiebigkeit kundgetan, sodass er sich genötigt gesehen hatte, von da an besondere Strenge walten zu lassen, um nicht völlig sein Gesicht zu verlieren. Er hatte zwar immer noch die Worte seiner Schwägerin im Ohr, die ihm geraten hatte, seinen Sohn in sein Herz zu lassen, um dasjenige Rebeccas zurückzugewinnen, aber es hatte einfach nicht funktioniert. Also vermied er Begegnungen mit Nicholas, und wenn sich diese nicht vermeiden ließen, bemühte er sich, ihn so gut es ging zu ignorieren.
Dies gelang ihm jedoch in letzter Zeit immer weniger. An manchen Tagen reizte es ihn allein schon, den Jungen wortlos dasitzen zu sehen. Wenn Peter dann eine Frage an ihn richtete, bekam er meist einsilbige Antworten und bedauerte sofort, überhaupt ein Wort an ihn verschwendet zu haben. Manchmal zweifelte er ernsthaft an dem Verstand des Kindes. Vielleicht sollte man ihn einmal einem Nervenarzt vorstellen, sein Verhalten war doch einfach nicht normal! Er hoffte, dass wenigstens seine Lehrer noch etwas geradezubiegen vermochten. Immerhin war es Becky nun nicht mehr möglich, den Jungen von morgens bis abends zu verhätscheln. Wenn sich jetzt nur noch ihr Herz ihm wieder öffnen würde …! Seine innigen Gefühle für sie hielt er jedoch streng unter Verschluss. Sie wären sonst allzu leicht Verletzungen preisgegeben.
Mit einer gequälten Geste wischte er die unerquicklichen Gedanken beiseite. Zurzeit hatte er andere Sorgen! Samuel Ferguson hatte ihm nachweisen können, dass ihm bei der Führung der Geschäftsbücher kein Fehler unterlaufen war. In seiner Ehre gekränkt, hatte dieser es sich nicht nehmen lassen, sämtliche Buchungsbelege vorzulegen. Die große Differenz sei durch eine von Mr. Emerson im August angewiesene Auszahlung erfolgt, deren Belege dieser habe nachreichen wollen, was jedoch bis heute nicht geschehen sei. Peter war es anfangs nicht gelungen, Kontakt zu Robert herzustellen, der schon seit Wochen in Deutschland herumreiste. Jedes Mal hatte er ihn an seinem aktuellen Aufenthaltsort knapp verfehlt. Erst in der dritten Novemberwoche hatte Peter Erfolg gehabt. Robert hatte telegraphiert, dass er sich wegen der Differenz nicht sorgen solle, es handele sich um eine gute Investition. Sein nächster Stopp sei Frankfurt. Sie sähen sich Weihnachten.
All das beruhigte Peter keineswegs. Wie kam Robert dazu, eine solch ungeheure Summe aus dem Firmenvermögen herauszuziehen, ohne dies mit ihm abzusprechen?
Des Weiteren machte sein Arm ihm immer noch zu schaffen, obwohl der Unfall nun schon fast acht Wochen zurücklag. Aber nicht nur das hinderte ihn am zügigen Arbeiten, sondern obendrein ein unerträglicher Kopfschmerz, der sich neuerdings zum Nachmittag einstellte. Peter hatte sich darum genötigt gesehen, die Dosis des Schmerzmittels ein weiteres Mal zu erhöhen.
Es war ein kalter, trüber Nachmittag Anfang Dezember, als Peter beschloss, seiner Schwägerin in Dr. Johnsons Arztpraxis einen Besuch abzustatten, obwohl ihm dies einige Überwindung kostete. Die Praxis lag in einem Stadtteil, wo sich ein Mann seines Standes nicht gerade freiwillig hinbegab. Er wies den Droschkenkutscher deshalb an, direkt vor dem Hauseingang zu halten und dort auf ihn zu warten, was dieser jedoch nur gegen ein entsprechend hohes Trinkgeld bereit war zu tun. Er setze schließlich Leben und Gesundheit aufs Spiel, meinte dieser, was Peter ihm durchaus zu glauben bereit war, als sein Blick in eine finstere Seitengasse fiel, wo eine Handvoll zerlumpter Kinder herumlungerte und unverschämt zu ihm herüberglotzte. Als das Gegröle eines Trunkenboldes durch die Straßenflucht hallte, zogen sie sich in ihre verwahrlosten Wohnbaracken zurück, deren zerbrochene Fensterscheiben notdürftig mit Pappe oder Zeitungspapier gestopft waren. Peter bemühte sich, die drei Schritte bis zum Hauseingang, ohne Luft zu holen, zu passieren. Die ganze Gegend stank widerwärtig nach Urin und anderen Ausscheidungen.
Judith war nicht wenig überrascht, ihn eine halbe Stunde vor Praxisbeginn im Wartezimmer zu erblicken.
»Sag nicht, du bist gerade zufällig hier vorbeigekommen, Peter!«, begrüßte sie ihn heiter.
»Ich gebe zu, ich wollte dich sprechen, Judith«, gestand er mit einem, wie er selbst merkte, gezwungenen Lächeln. »Vielleicht kannst du dir mal meinen Arm ansehen, er macht mir immer noch Schwierigkeiten. Dr. Mansfield vertröstet mich ständig, ich solle Geduld haben, aber die habe ich nicht – nur viel Arbeit!«
Judith führte ihn in ein Behandlungszimmer. Peter legte Mantel und Rock ab, dann krempelte er bereitwillig seinen Hemdsärmel auf, bevor er auf dem ihm zugewiesenen Behandlungsstuhl Platz nahm. Während Judith seinen Arm abtastete, schaute er sich unauffällig im Raum um. Er war immerhin sauber.
»Du hast immer noch starke Schmerzen?«, fragte Judith erstaunt. Peter bejahte. »Seltsam, der Knochen scheint völlig verheilt. Möglicherweise ist ein Stück davon abgesplittert und reizt einen Nerv. –Was ist? Warum lächelst du?«
»Du hörst dich schon an wie ein richtiger Arzt.«
»Dr. Johnson bietet mir hier auch alle Möglichkeiten zu lernen.« Mit diesen Worten begann sie, einen neuen Schienenverband anzulegen. »Du musst deinen Arm unbedingt weiterhin schonen, Peter. Wenn du den Nerv immer wieder reizt, wirst du deine Beschwerden nie los.«
»Was soll ich machen? Wir stehen kurz vor dem Jahresabschluss. Momentan muss ich bis spät in die Abendstunden arbeiten.«
»Soso! Du vernachlässigst also deine Familie?«, neckte sie ihn, während sie noch mehr Mull abwickelte.
»Ich glaube kaum, dass mich jemand entbehrt.«
Betroffen schaute Judith von ihrer Arbeit auf. »Hat sich denn gar nichts geändert?«
Peter schüttelte den Kopf. »Was machen deine Pläne, Judith?«, fragte er, um das Thema zu wechseln.
»Wir haben uns noch nicht vollständig von der Epidemie erholt. Jetzt müssen wir uns dringend um unsere vernachlässigten Dauerpatienten kümmern und um die Kinder, deren Eltern und Familien von der Cholera dahingerafft wurden. Ein junger Student am London Hospital nimmt sich ihrer an. Thomas Barnardo heißt er, vielleicht hast du schon von ihm gehört? Er wohnt gleich hier um die Ecke. Er hat vor, im Stepney Causeway ein Waisenheim zu eröffnen. Dr. Johnson unterstützt sein Vorhaben, wo er nur kann. – Es ist so traurig, das Leid all dieser verwaisten Kinder mit anzusehen. Sie leben quasi auf der Straße, keiner, der ihnen zu essen gibt oder sich um sie kümmert. Und jetzt steht ihnen auch noch ein kalter Winter bevor.« Judith verknotete die Bandage und begann ein Dreieckstuch zu einer Armschlinge zu knoten.
»Ich erinnere mich, neulich etwas über dieses Waisenhaus-Projekt in der Zeitung gelesen zu haben«, sinnierte Peter. »Ich frage mich nur, wie man es ertragen kann, hier zu leben, zwischen all dem Dreck und Gestank und den heruntergekommenen Kreaturen ...«
»Es sind Menschen, Peter, auch wenn sie schlimmer leben als das Vieh. Menschen, die nur Arbeit und Armut kennen und nicht wie wir das Glück hatten, in besseren Verhältnissen aufzuwachsen – oder eine kleine Handelsfirma zu erben! Viele von ihnen sind nicht einmal des Lesens und Schreibens mächtig und besitzen kaum mehr als das, was sie auf dem Leibe tragen.«
»Du musst sehr edler Gesinnung sein, dass du diese Arbeit hier verrichten kannst.«
»Deshalb bin ich Krankenschwester geworden, deshalb möchte ich Arzt werden.« Sie schenkte ihm ein zuversichtliches Lächeln.
Peter schaute in Augen, die denen seiner Frau so sehr glichen, doch wirkte Judiths ruhiger fester Blick völlig anders, so zielstrebig und energisch, und gleichsam von einer großen Anteilnahme durchdrungen. All ihr Denken und Handeln war stets auf das Wohl ihrer Mitmenschen ausgerichtet.
»Peter, sag bitte Becky noch nichts davon, aber ich trage mich seit geraumer Zeit mit dem Gedanken, mich an verschiedenen Universitäten in Neuengland zu bewerben. Es gibt dort Frauenuniversitäten, an denen ich studieren könnte. Hierzulande besteht kaum Aussicht, dass ich in absehbarer Zeit zugelassen werde. Dr. Johnson meint ebenfalls, dass es pure Verschwendung sei, wenn ich mit meinen inzwischen erworbenen Kenntnissen weiterhin in der Krankenpflege arbeite. Außerdem möchte ich in die Forschung. Auf dem Gebiet der Seuchenbekämpfung liegt noch vieles im Dunkeln.«
Obwohl Peter den Gedanken, dass eine Frau einen Männerberuf ergreifen wollte, recht absonderlich fand, war er beeindruckt. Judiths ganzes Wesen strahlte so viel Kraft und Beharrlichkeit aus, dass er davon überzeugt war, dass sie ihren Weg gehen werde.
Behutsam platzierte sie seinen Arm in der Schlinge.
»So, das war’s. Es dürfte dir bald bessergehen, wenn du dich wie verordnet ruhig hältst!«
Verlegen blieb er auf dem Behandlungsstuhl sitzen.
»Hast du noch etwas anderes auf dem Herzen, Peter?«
»Naja, ich bräuchte noch etwas gegen die Schmerzen.«
»Hat Dr. Mansfield dir kein Schmerzmittel verschrieben?«
»Ich hatte keine Zeit, ihn nochmals aufzusuchen«, antwortete er ausweichend und mied ihren Blick.
Einen Moment zögerte sie, dann griff sie zum Rezeptblock.
»Du musst vorsichtig sein, Peter«, mahnte sie, während sie etwas notierte. »Die meisten Ärzte verschreiben morphiumhaltige Medikamente allzu sorglos. Aber ich habe meine eigenen Beobachtungen dazu angestellt. Bei regelmäßiger Einnahme scheint der Körper irgendwann danach zu verlangen!«
Sie sah ihm eindringlich in die Augen, als sie ihm das von Dr. Johnson vorunterzeichnete Rezept überreichte. Mit Mühe gelang es ihm, ein leichtes Zittern seiner Hände zu unterdrücken.
»Nur im äußersten Notfall, Peter!«, schärfte seine Schwägerin ihm ein. Unvermittelt brach ihm kalter Schweiß aus. Mit fahrigen Fingern zog er sein Schnupftuch aus der Westentasche und tupfte sich damit die Stirn. Dann erhob er sich und ließ sich von Judith Rock und Mantel umlegen. Er dankte ihr, griff nach Hut und Stock und verließ eiligen Schrittes das Behandlungszimmer.
Als er bereits in der Praxistür stand, machte er spontan kehrt und drückte seine Schwägerin mit dem gesunden Arm kurz und heftig an seine Brust. In der Droschke, sah er Judith am Fenster stehen und ihm einen besorgten Blick hinterherwerfen.
***
Schon der November mit seinem dichten Nebel, Regen und Stürmen hatte es Rebecca nahezu unmöglich gemacht, das Haus in der Berkeley Street zu verlassen. Ihr Husten war in solch einer Vehemenz wieder aufgetreten, dass Dr. Mansfield zur Vorsicht gemahnt hatte. Anfangs war es ihr schwergefallen, ganze Tage lang das Haus zu hüten, war sie es doch gewohnt, durch Parks und Straßen zu schlendern und bei weniger angenehmem Wetter den Museen und Galerien einen Besuch abzustatten, also alles zu tun, um ihren düsteren Gedanken zu entgehen, die sie so ruhelos umhertrieben.
Nun, im nasskalten Dezember, war sie restlos mit ihren Gedanken zu Hause gefangen. Sie bemächtigten sich ihrer mit unbarmherziger Gewalt. Schon bald sah sich Rebecca nicht mehr imstande, vor der Mittagszeit das Bett zu verlassen. Immer häufiger schlug sie Einladungen zu Teegesellschaften oder Abendveranstaltungen aus. Stattdessen saß sie ermattet in ihrem Lehnstuhl am Erkerfenster und blickte hinaus auf das kahle Geäst einer vor dem Hause stehenden Platane, das sich düster vor einem bleiverhangenen Himmel abzeichnete. Margret kümmerte sich liebevoll um sie, nahm ihr Besorgungen ab und braute ihr einen lungenkräftigenden Tee.
Der einzige Lichtblick des Tages war, wenn am Nachmittag Miss Thompson mit Nicholas nach Hause kam. Da Peter dieser Tage bis spät in die Abendstunden arbeitete, schickte sie das Kindermädchen vorzeitig fort und verbrachte einige stille Stunden mit ihrem Sohn.
Doch die Sorge um sein verändertes Verhalten ließ sie ihre Zweisamkeit nicht wirklich genießen. Nicholas war mit der Zeit immer mehr verstummt. Er erzählte weder aus der Schule noch von den Unternehmungen mit Miss Thompson. Sein Interesse an den Dingen, die ihn während der Sommermonate noch so sehr begeistert hatten, war gänzlich erstorben. Kein Lächeln huschte mehr über sein bleiches Gesicht, kein freudiges Funkeln erhellte das Blau seiner Augen. Er saß still und stumm. Jegliches Leben schien aus ihm gewichen zu sein. Völlig unvermittelt sprach er dann und wann ganz leise und mit versunkenem Blick den einen Satz, der Rebecca jedes Mal das Herz schnürte: »Ich möchte heim, Mummy!«
Eines Nachmittags, kurz vor Weihnachten, schauten beide im stummen Leid hinaus in den Winterhimmel. Dunkle Wolken trieben vorüber, die Schnee mitzubringen versprachen. Plötzlich ließ sich ein Rabe in den Ästen der Platane vor ihrem Fenster nieder. Der Wind zerzauste sein schwarzes Gefieder und ließ die vor Kälte erstarrten Zweige erzittern.
Trotz des im Kamin knisternden Feuers erschauerte Rebecca. Als sie zu Nicholas hinsah, gewahrte sie, wie auch ihn ein kaum merkliches Beben durchfuhr. Daraufhin hielt er seinen Kopf etwas schief, als ob er lauschte. Seine Atmung schien angehalten, so bewegungslos verharrte er in dieser Position. Sie war beunruhigt, denn seine Pupillen hatten sich auf die Größe eines Stecknadelkopfes verkleinert, aber sie traute sich nicht, ihn anzusprechen. Sie spürte, dass etwas Unbegreifliches mit ihm geschah, welches sie kein Recht hatte zu unterbinden.
Nach einer Weile löste er sich aus seiner Erstarrung, griff nach Papier und Stift und fing sorgfältig an zu schreiben. Als er sein Schriftstück beendet hatte, reichte er es ihr mit sichtbarer Erschöpfung. Pochenden Herzens begann Rebecca zu lesen:
Love and Sleep
Lying asleep between the strokes of night
I saw my love lean over my sad bed,
Pale as the duskiest lily’s leaf or head,
Smooth-skinned and dark, with bare throat made to bite,
Too wan for blushing and too warm for white,
But perfect-coloured without white or red.
And her lips opened amorously, and said –
I wist not what, saving one word – Delight.
And all her face was honey to my mouth,
And all her body pasture to mine eyes;
The long lithe arms and hotter hands than fire,
The quivering flanks, hair smelling of the south,
the bright light feet, the splendid supple thighs
And glittering eyelids of my soul’s desire.*
Ihr war, als gefröre Zeit und Raum. Nichts rührte sich, weder im noch außerhalb des Hauses. Nicholas schaute mit mattem Blick zu ihr hin; kein Atemzug hob seine Brust, kein Wimpernschlag durchbrach das Blau seiner Augen; draußen im Baum saß der Rabe und starrte zu ihnen herein, sein Gefieder lag aalglatt; und selbst die Zweige schienen nun wie dunkle Risse im eisigen Winterhimmel. Nur das Ticken der Kaminuhr und das Knistern des Feuers machten den Gedanken unmöglich, dass die Zeit stehen geblieben war.
Erschrocken fuhr Rebecca herum, als Margret das Zimmer betrat, um zu vermelden, dass das Abendessen fertig sei. Der Herr habe einen Boten geschickt, um ausrichten zu lassen, dass er später komme und sie ohne ihn mit dem Essen anfangen sollten.
Der Bann war gebrochen.
Wortlos nahm Rebecca das Gesagte zur Kenntnis und blickte dann wieder auf das in der Handschrift ihres Sohnes geschriebene Liebesgedicht. Von Unglauben getrieben, las sie die Zeilen erneut. Sie erschauerte abermals, als ihr klar wurde, dass es kein Traum gewesen war. In einem Anflug von Panik wollte sie das Papier den Flammen übergeben, um das Unmögliche ungeschehen zu machen, aber die Zeilen hatten sich bereits unauslöschlich in ihre Seele gebrannt. Sie konnte und wollte das Unfassbare nicht zerstören. Zärtlich strich sie über das Blatt, bevor sie es zusammenfaltete und in ihrem Ärmel verschwinden ließ. Als sie sich wieder zu Nicholas umwandte, blieb ihr fast das Herz stehen. Er lächelte!
***
Drei Tage vor Weihnachten kam Robert Emerson von seinen Reisen zurück und schneite unangemeldet in der Berkeley Street herein. Rebecca ließ bitten. Er erschrak über ihren kränklichen Anblick und versuchte es zu überspielen. Den weitaus größeren Schrecken erfuhr er jedoch, als Nicholas den Raum betrat. Still setzte sich dieser zu ihnen und hörte aufmerksam zu, als Robert von seiner Reise durch Deutschland berichtete. Keine wissbegierige Frage folgte, kein interessiertes Heben der Brauen und erst recht kein Lächeln.
»Bekommt ihm die Schule so wenig?«, wandte sich Robert besorgt an Judith, die ebenfalls vorbeigekommen war.
»Ich weiß es nicht«, antwortete sie bekümmert. »Er spricht nicht darüber. Er spricht überhaupt nicht mehr viel.«
»Das habe ich bemerkt. Was ist geschehen? Weiß das Kindermädchen vielleicht Näheres?«
»Miss Thompson? Ach, woher! Sie scheint keinerlei Beziehung zu ihm aufgebaut zu haben. Ein Jammer«, seufzte sie, »Becky mit ihrer angegriffenen Gesundheit und Nicholas mit seiner Schwermut ... Peter geht es übrigens auch nicht gut.«
»Jaja, kaum ist man mal außer Landes, bricht alles zusammen«, versuchte Robert zu witzeln, doch sein Lachen blieb ihm in der Kehle stecken. »Vielleicht sollte man Mutter und Kind auf eine Badekur schicken. In Preußen bin ich durch einige prächtige Kuranlagen gekommen. Halb Europa trifft sich dort.«
Judith ahnte, dass Robert in erster Linie die dortigen Kasinos meinte. Trotzdem fand sie den Gedanken erwägenswert.
»DU BIST WAS?«
»Reg dich bitte nicht unnötig auf, mein lieber Peter, es ist unseren Geschäften außerordentlich zuträglich. Ich befinde mich damit in bester Gesellschaft mit hochrangigen Persönlichkeiten aus ganz Europa. Oder was glaubst du, wie ich zu den vielfältigen Geschäftsverbindungen gekommen bin? Es ist ein gigantisches Netzwerk gegenseitiger Unterstützung. Wie bei den Musketieren: Einer für alle, alle für einen!«
Begeisterung sprühte aus Roberts Augen, die von Peters finsterer Miene umgehend gedämmt wurde.
»Das gibt dir noch lange nicht das Recht, dich am Firmenvermögen zu vergreifen«, zischte er seinen Kompagnon an.
Robert schaute bestürzt. »Aber es ist doch nur zum Besten der Firma! Du wirst sehen, Peter, auf lange Sicht werden sich die von mir getätigten Investitionen rentieren. Dann lassen wir nur noch das Geld für uns arbeiten, während wir uns ein schönes Leben machen.« Vergnügt rieb er sich die Hände. »Eine Yacht an der Côte d‘Azur? Eine Villa bei Florenz? Warum denn nicht?«
Peter war fassungslos und spürte seine Schläfenader pochen.
»Robert, ich bin dein Kompagnon, und du hältst es nicht für nötig, mit mir über so umfangreiche Transaktionen vorher zu sprechen? Ganz zu schweigen davon, dass ich meine Kalkulationen über den Haufen werfen kann und unsere Bücher nicht korrekt geführt sind! Warum hast du das Geld nicht aus deinem Privatvermögen genommen? Schließlich handelt es sich um eine Angelegenheit privater Natur.«
»Du irrst, mein Lieber! Es geht rein ums Geschäft. – Abgesehen davon, komme ich zurzeit nicht an mein Privatvermögen heran«, fügte er kleinlaut hinzu und räusperte sich.
»Wieso nicht, was soll das heißen, Robert?«
»Nun ja, ich bin momentan ... nicht liquide.«
Peter stockte der Atem. Sein anfänglicher Zorn wich blankem Entsetzen. Eine erdrückende Stille breitete sich aus, die erst von Roberts heiserer Stimme durchbrochen wurde, mit der er erklärte, dass seine Auslandsreisen immerhin viel Geld gekostet hätten, woraufhin Peter ihm entgegenschleuderte, dass er das meiste als Geschäftskosten geltend gemacht habe und sein Spesenkonto mehr als großzügig bemessen gewesen sei. Er bestand darauf, zu erfahren, wie es zu diesem für einen ehrbaren Kaufmann unsäglichen Zustand hatte kommen können. Gequält gab Robert zu, auf den heimischen Pferderennbahnen Wettschulden in beträchtlicher Höhe gemacht zu haben, die ihn zu Spekulationen an der Börse verleitet hätten, welche unglücklicherweise beim Börsenkrach im Mai nicht ganz seinen Erwartungen entsprechend ausgefallen seien. Daraufhin habe er gehofft, an den Spieltischen Europas sein Glück zu machen, leider –
»Ich erwarte von dir, dass du sämtliche deiner zuletzt getätigten Aktionen offenlegst, Robert! Das ist das Mindeste, das ich von dir verlangen kann.«
»Ich fürchte, das wird nicht so ohne Weiteres möglich sein, mein lieber Peter«, erwiderte Robert zerknirscht. »Denn sieh, wir Logenbrüder sind per Eid zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet.«
Etwas kochend Heißes stieg in Peter auf.
»Gut, dann wirst du alleine zusehen müssen, wie du die Differenz bis zum Jahreswechsel ausgeglichen bekommst«, presste er mühsam hervor. »Es bleibt dir eine Woche Zeit.«
Erschrocken starrte Robert ihn an.
»Das kann nicht dein Ernst sein, Peter! Du siehst die Dinge viel zu verbissen. Was ist schon dabei, mit einem kleinen Minus ins neue Geschäftsjahr zu gehen? Spätestens in einem halben Jahr werden wir dicke Gewinne einfahren, das verspreche ich dir.«
»Keine Diskussion«, brüllte Peter, während sich seine Hände zu Fäusten ballten. »Ich will wissen, in was für windige Geschäfte du unser Firmenvermögen gesteckt hast! Es steht schließlich auch mein Ruf auf dem Spiel!«
Eingeschüchtert zuckte Robert zurück.
Auch Judith tat so, als sie Peters erhobene Stimme hinter der Tür vernahm. Zögernd klopfte sie an und wurde unwirsch hereingebeten. Sie entschuldigte sich für die ungelegene Störung und erklärte, dass sie sich lediglich habe verabschieden wollen.
Eine unangenehme Spannung hing im Raum. An beiden Gesichtern konnte sie ablesen, dass wirklich ernste Dinge zur Sprache gekommen waren. Der sonst so lässige Mr. Emerson zupfte verlegen an seinem Bart, während Peters Erregung sich durch eine unnatürliche Röte und zuckende Schläfenader kundtat. Es sah aus, als wollte er am liebsten mit Fäusten auf seinen Geschäftspartner losgehen. Mit Besorgnis stellte sie fest, dass es ihm selbst in ihrer Gegenwart kaum gelang, Haltung zu wahren. Als Robert sie mit einem galanten Handkuss verabschiedete, blieben dessen Gesichtszüge versteinert.
Zutiefst beunruhigt verließ Judith die Berkeley Street. Peter schien einem siedenden Druckkessel gleich, der jeden Augenblick zu explodieren drohte.
***
Harriet Thompson war über die Weihnachtstage zu ihrer Familie gefahren und Margret mit den Vorbereitungen für das Weihnachtsessen beschäftigt. Ermattet saß Rebecca in ihrem Lehnstuhl. Es war Heilig Abend und Nicholas in sein Zimmer verbannt worden.
Kurz zuvor hatte er am Erkerfenster gestanden und auf Schneeflocken gewartet, als er meinte, ein Tier entdeckt zu haben, das sich hinter dem Stamm der Platane verborgen hielt. Aufgeregt hatte er sich zu ihr umgewandt und verkündet, dass ein Wolf unten auf der Straße stünde. Augenblicklich war ihr das Blut aus dem Kopf gewichen. Eine Antwort hatte er von ihr nicht mehr erhalten, sondern von seinem Vater, der just in dem Moment zur Zimmertür hereingekommen war. Erbost über diesen Unsinn, hatte Peter ihn mit einer saftigen Ohrfeige in sein Zimmer geschickt.
Rebecca schloss die Augen. Die Zeilen des ihr fremden Liebesgedichts in der Handschrift ihres Sohnes zogen in köstlich schmerzlichen Bildern an ihr vorbei. Ein wehmütiges Lächeln huschte um ihre fahlen Lippen, bevor sie die Augen wieder aufschlug.
Besorgt stellte sie fest, dass Peter sich bereits das dritte Glas Scotch einschenkte, welches er, wie schon die anderen zuvor, in einem Zug hinunterstürzte. Danach nahm er wieder am Sekretär Platz und wandte sich mit einem tiefen Ächzen seinen Geschäftsbüchern zu. Unmutig trommelte er mit den Fingern auf der Schreibunterlage.
In dieser Verfassung war er bereits heimgekehrt. Bisher hatte sie es nicht einmal gewagt, sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Sie war froh, dass wenigstens Robert innerhalb der nächsten Stunde eintreffen würde, da schon Judith dem Dinner fernblieb. Diese unterstützte Mr. Barnardo in seiner wohltätigen Arbeit, indem sie den obdachlosen Lumpenkindern am Heiligen Abend zu einer warmen Mahlzeit und warmer Kleidung verhalf.
Als Robert eine halbe Stunde später den Salon betrat, deutlich weniger heiter als sonst, überreichte er Rebecca ein Päckchen mit den Worten, ein Botenjunge habe ihm dieses soeben für sie in die Hand gedrückt.
Dankend nahm sie es entgegen und wickelte es aus. Ein Büchlein kam zum Vorschein. »Gedichte und Balladen von Algernon Charles Swinburne«, las Rebecca die Aufschrift des Einbandes laut vor.
»Welch vortreffliche Wahl!«, rief Robert begeistert aus. »Ich hätte keine bessere treffen können. Swinburne, dieser Echauffierer, dieser Nihilist unter den Bibelkundigen, dieser Aufrührer unserer geheimsten Gelüste! Ja, er hat fürwahr in diesem Jahr die keusche Bürgerseele zum Kochen gebracht.«
Peter warf einen alarmierten Blick auf den Gedichtband.
»Ist das etwa dieser Schmierfink, der seine perversen Phantasien in schöngeistige Reime verpackt?«, fragte er gereizt.
Verwirrt blickte Rebecca zwischen den beiden hin und her.
»Ebendieser, lieber Peter. Keiner hat es wie er geschafft, die Lust der Liebe in so sinnlich erotische Gedichte zu kleiden«, schwärmte Robert, was Peter offenkundig nur noch mehr aufbrachte.
»Wie kommst du dazu, meiner Frau ein derart geschmackloses Geschenk zu machen?«, polterte er los.
»Du irrst, Peter, ich habe nichts dergleichen getan! Ich sagte doch schon, dass mir ein Botenjunge das Päckchen überreicht hat. Aber bevor du dich zu sehr ereiferst, solltest du selbst einmal einen Blick in den Gedichtband werfen, um dir ein eigenes Urteil über die angeblich so anstößigen Zeilen zu bilden. Vielleicht findest du ja – ganz im Geheimen, versteht sich! – Gefallen daran.«
Ein spöttisches Lächeln kroch um Roberts Mundwinkel, wo normalerweise ein herzhaftes Lachen entströmt wäre.
Peter schnaubte verächtlich. »Nie im Leben! – Becky, ich verbiete dir, auch nur einen einzige Zeile darin zu lesen! Am besten wirfst du es gleich ins Feuer! – Ich frage mich nur, wer sich sonst erdreisten sollte, dir einen solchen Schmutz zukommen zu lassen.«
Er warf Robert einen strafenden Blick zu, den dieser mit einem gleichgültigen Zucken der Achseln beantwortete.
Betreten legte sie das Büchlein zur Seite und dankte Robert leise für das Überbringen. Glücklicherweise meldete Margret in dem Moment, dass das Dinner angerichtet sei. Unbemerkt bedeckte Rebecca den Gedichtband mit einem Kissen, bevor sie sich erhob, um ins Speisezimmer hinüberzugehen.
***
Die Vilas* zeigen sich nur zwischen Mitternacht und Morgengrauen. Die Menschen verwechseln ihre Gestalten leicht mit Nebelschwaden, die tief zwischen den Bäumen hängen. Doch wer ganz still ist und lauscht, kann auch heute manchmal hören, wie Giselle den anderen Mädchen ihre traurige Geschichte erzählt.*
Als der erste Ton von Adolphe Adams Ballettmusik im festlich erleuchteten Opernhaus erklang, fand eine wundersame Wandlung in Nicholas statt. Es war, als hätte eine unsichtbare Hand seinem Herzen einen Stoß versetzt und den unsichtbaren Schutzschild von seinem Leib gerissen. Seine Seele erwachte und sein Geist machte sich bereit, bisher unbekannte Gefilde erhabener Reize zu betreten, nicht ahnend, in welchen Strudel sinnlicher Gelüste er noch an diesem Abend geraten sollte. Und als nach der Ouvertüre die ersten Tänzer über die Bühne schwebten, war ihm, als höbe sich ein Schleier von seinen Augen, der den Blick auf eine ihm bis dahin verborgene Welt freigab. Wie gebannt verfolgte er die ihm überirdisch anmutenden Tänzer, welche sich in vollkommener Harmonie den Klängen der Musik fügten.
Der zweite Akt mit seinem Geisterreigen tanzsüchtiger Vilas, dem nun auch Giselle nach ihrem Tode angehörte, ließ Nicholas‘ Atem vollends stocken. Die Ballerinen schienen schwerelos über die Bühne zu schweben, jeden in ihren Bann ziehend, der ihnen zu nahe kam. Herzog Albrecht geriet in ihren magischen Kreis, und Myrtha, die Königin der Vilas, befahl Giselle, ihn zu Tode zu tanzen.
Nicholas hielt es auf seinem Logensitz nicht mehr aus. Er lehnte sich über die Balustrade und fieberte zusammen mit dem unglücklichen Albrecht dem Morgengrauen entgegen.
Der rettende Glockenschlag erlöste beide aus ihrem Zustand höchster Verzweiflung. Albrecht fand sich kniend vor Giselles Grab wieder, in dem diese kurz zuvor wieder versunken war. Nicholas sank erschöpft in seinem Sitz zurück. Selbst der frenetische Schlussapplaus vermochte den Zauber des soeben Erlebten nicht von ihm zu nehmen.
Nach und nach erloschen die Lichter des Opernhauses. Wehmütig schaute Nicholas auf den magischen Ort zurück, an dem die Geister aus der anderen Welt heraufbeschworen worden waren, um die Seelen der Zuschauer zu entführen. Diese Stätte, in der sich beide Welten miteinander verbanden, wollte er für immer in Erinnerung behalten.
»So majestätisch wie Herzog Albrecht möchte ich auch einmal tanzen können«, sagte er mit einem verträumten Blick aus dem Kutschenfenster.
»Vielleicht wirst du das eines Tages, mein Liebling«, antwortete Rebecca und drückte ihm liebevoll die Hand.
»Das fehlte noch«, schnaubte Peter. »Setz dem Jungen ruhig noch mehr Flausen in den Kopf! Als wenn er nicht schon Traumtänzer genug wäre.«
Stumm zog Rebecca Nicholas näher an sich heran.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752139631
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (März)
- Schlagworte
- Verblendung Handlungsort Rumänien Lebenslügen Keltische Mythen Viktorianisches England Familienepos Vorfahren History&Mystery Familiengeheimnisse Bücherserie/Sammelband