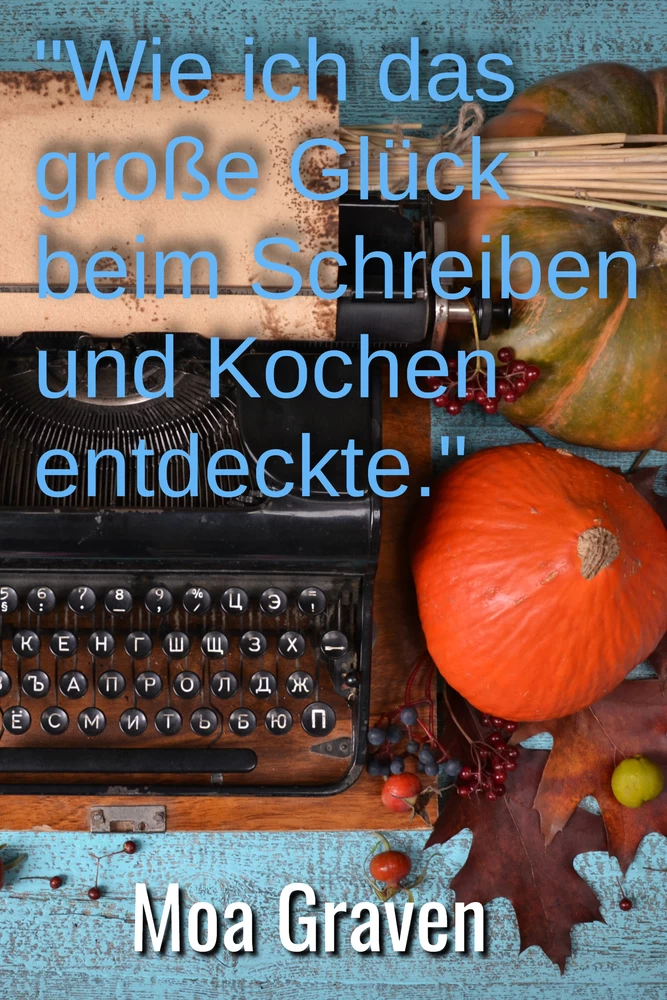Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Wortzähler: 68211
„Wie ich das große Glück
beim Schreiben und Kochen entdeckte.“
Die Autobiografie und das Kochbuch in einem Doppelband
Moa Graven
Moa Graven
Impressum
„Wie ich das große Glück beim Schreiben und Kochen entdeckte“ – Doppelband mit der Autobiografie „Ich mach das jetzt einfach mal … Vom stillen Mädchen zur Bestsellerautorin“ und „Ich hab’s angerichtet – Selber kochen ist das neue Glück“
Alle Rechte am Werk liegen bei der Autorin Moa Graven
Erschienen im Criminal-kick-Verlag Ostfriesland
Das Krimihaus – 3. Südwieke 128a – 26817 Rhauderfehn
Juli 2020
Covergestaltung: Moa Graven
AUTOBIOGRAFIE
Die Autobiografie „Ich mach das jetzt einfach mal ... – Vom stillen Mädchen zur Bestsellerautorin“

Zum Inhalt
Moa Graven – Die Autobiografie – Vom stillen Mädchen zur Bestsellerautorin – Emotional erzählt sie ihr Leben, packend und spannend zugleich!
Wer Moa Graven heute kennenlernt, trifft auf eine gestandene Frau und Unternehmerin, die seit 2017 vom Schreiben leben kann. Ihre Karriere als Krimiautorin begann für sie erst mit fünfzig Jahren, als sie einen Fortsetzungskrimi für ein Monatsmagazin schrieb.
„Ich habe erst mit fünfzig meine Leidenschaft für das subtile Verbrechen entdeckt“, sagt die Autorin selber gerne mit einem Schmunzeln. Ihre Krimis, die sich deutschlandweit größter Beliebtheit erfreuen, bringt sie im eigenen Verlag heraus und vermarktet sie auch selber.
Doch es gibt auch ein Leben vor der Krimiautorin. Von klein auf hat Moa Graven gelernt, dass sie mehr oder weniger auf sich selbst gestellt ist im Leben. Das hat sie stark gemacht, doch oft auch einsam. Die Leere, die Menschen bei ihr hinterließen, wurde durch die Liebe zu Tieren aufgewogen. Moa Graven liebt alle Tiere, besonders aber Katzen und Hunde, die sie schon ihr Leben lang begleiten. Sie war ein stilles Kind, aber nicht dumm. Was sie nicht sagen konnte oder wollte, das schrieb sie auf. Damit begann sie schon als kleines Mädchen. Es war ihre zweite Leidenschaft neben dem Lesen.
Sie liebte Märchenbücher … und wie ein Märchen liest sich auch das, was ihr mit fünfzig Jahren passierte, als sie ihren Kommissar Guntram in Leer erfand.
„Dieses Buch soll Frauen Mut machen“, sagt Moa Graven über ihre Autobiografie. Wenn man etwas wirklich erreichen wolle, dann könne man es auch schaffen. „Dazu gehört die Lust, auch immer mal wieder gegen den Strom zu schwimmen.“
Lesen Sie mehr zu dieser Ausnahme- und Powerfrau, die immer, wenn ihr Leben an Grenzen stieß, mutig sagte: „Ich mach das jetzt einfach mal.“
Bilder aus dem Leben der Autorin Moa Graven finden Sie am Ende des Buches. „Ich finde es schöner, wenn der Lesefluss nicht ständig durch Bilder unterbrochen wird“, erklärt Moa Graven dazu.
Vorwort
Wenn ich ganz ehrlich bin, da habe ich in den letzten dreißig bis vierzig Jahren gar nicht so gerne über mein bisheriges Leben nachgedacht, geschweige denn, gesprochen. Ja, eigentlich gucke ich generell nicht gerne zurück, weil es auch immer sehr unschöne Momente sind, die mir dann in den Sinn kommen. Oft beherrscht von Gewalt.
Im März 2019 traf ich allerdings auf eine ebenfalls selbständige Frau, die gerade versuchte, ihr Leben auch als Autorin auf die Beine zu stellen. Sie war förmlich erschlagen von dem, was ich in den letzten Jahren geleistet hatte. Dass es über fünfzig Krimis waren, die ich veröffentlicht hatte, war für mich nicht außergewöhnlich. Doch sie stand nur mit großen Augen da und bewunderte meinen Mut, alles selbst in die Hand zu nehmen. Wir kamen weiter ins Gespräch und sie meinte, das wäre doch mal etwas, was man in einem Buch erzählen müsste. Auch, um anderen Frauen Mut zu machen, sich etwas zu trauen. Zunächst fand ich den Gedanken merkwürdig, ja geradezu absurd. Was sollte an meinem Leben denn interessant sein? Und außerdem, aus oben besagten Gründen, schaue ich nicht gerne zurück. Wir unterhielten uns eine Weile, sie gab mir ihre Karte.
Nach der Messe hielten wir per Messenger weiter Kontakt und einige Wochen später besuchte sie mich im Krimihaus. Und wieder stand die Idee im Raum, doch meine Biografie zu schreiben. Yvonne Roth, so heißt die Frau, die es schaffte, dass ich jetzt dieses Buch tatsächlich geschrieben habe. Mit allen Konsequenzen und Offenheit darüber, was mir in meiner Kindheit und im weiteren Leben passiert ist. Und wie ich es letztlich schaffte, Krimiautorin zu sein und meinen mich mürbe machenden Bürojob an den Nagel zu hängen, um dann vom Schreiben zu leben.
Yvonne Roth ist unter anderem auch Autorencoach und versucht, sich damit ein ganz neues Leben aufzubauen. Nun, um zu schreiben, habe ich nie einen Coach gebraucht. Ich mag das Wort Coaching auch irgendwie nicht, dafür wird es viel zu sehr missbraucht. Was Yvonne allerdings geschafft hat, ist, dass ich auf mein Leben zurückgeblickt habe, auch wenn es an vielen Stellen sehr schmerzlich für mich war. Und am Ende hat es mir tatsächlich gut getan. Wenn man Dinge aufschreibt, kann man sie irgendwie auch ein Stückchen hinter sich lassen.
Und das sagt Yvonne Roth zu unserer ersten Begegnung auf der Leipziger Buchmesse 2019
Von Moa war ich sofort fasziniert. Warum?
Weil sie mir unter anderem eine ganz besondere Sache voraushat: Sie schert sich sowas von überhaupt nicht darum, was andere von ihr denken. Sie macht ihr Ding! Sie hat meine Vorstellungskraft in puncto „Was ist möglich?“ sehr erweitert. Als ich auf der Leipziger Buchmesse neugierig durch die Hallen schlenderte, stand ich plötzlich vor Moas Stand.
Sie selbst habe ich gar nicht gesehen. Als erstes habe ich mit ihrem Mann Andreas geredet. Der hat sich sehr freundlich mit mir unterhalten. Wir haben über die Autorin der Krimibücher geredet, die am Stand alle sehr liebevoll ausgestellt waren. Es waren sehr viele Bücher. Und ich dachte, diese Bücher hätte Moa alle irgendwann im Laufe der letzten 20 Jahre verfasst. Doch Andreas belehrte mich eines Besseren. Moa wäre erst seit ihrem 50. Lebensjahr als Autorin unterwegs.
Ich schaute ihn an und fragte, wie lange ihr 50. Geburtstag denn her wäre. Denn auf dem Flyer, den er mir zusammen mit einem Päckchen Ostfriesentee überreicht hatte, war noch keine 70-jährige Frau abgebildet. Er sagte, dass Moa die Bücher innerhalb von vier bis fünf Jahren geschrieben hätte. Ich war erstmal platt.
Ich fragte ihn, wo Moa denn heute sei. Er zeigte an einen Tisch mit einem Stuhl. Auf diesem Stuhl saß eine Frau mit schwarzen langen Haaren und einer Brille auf der Nase. Sie war sehr vertieft in etwas. Sie nahm mich nicht wahr. Ich ging zu ihr.
Meine erste Frage: Sind Sie die Autorin all dieser Bücher?
Sie (knapp): Ja.
Ich: Und ist es wahr, dass sie die in vier Jahren geschrieben haben?
Sie (knapp): Ja.
Ich: Schön, dass Sie heute hier sind und ich Sie kennenlernen darf.
Sie: Ja. Eigentlich reine Zeitverschwendung. Ich könnte weiter an meinem Buch schreiben. (jetzt lacht sie auch)
Moa ist kein Mainstream. Eine weitere Eigenschaft, die ich sehr an ihr bewundere. Ich wollte unbedingt wissen, woher sie diesen Mut nahm, einfach ihr Ding zu machen und fragte sie, ob es eine Biografie von ihr gäbe.
Die Idee an sich war für sie wohl ziemlich absurd. Doch ich sagte ihr, dass das, was sie einfach mal so machte, für die Mehrheit der Menschen (insbesondere für Frauen) nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit sei. Viele gehen ihre Träume oder das, was sie eigentlich tun möchten, nie an. Weil sie denken, sie haben noch so viel Zeit. Oder, weil sie Angst haben. Angst vor ihrer eigenen Großartigkeit.
Und hier saß eine Frau, die einfach drauflosschreibt.
Ich finde, Moa ist ein gutes Vorbild – vor allem für Frauen, um zu zeigen, was möglich ist. Ob das das Schreiben ist oder das Verkaufen von Schuhen. Es ist schlichtweg egal, worum es bei jedem Einzelnen geht.
Moa geht hier voran. Und zwar ungeachtet dessen, was einmal war. Denn (und das hat mir mal eine liebe Freundin gesagt): „Irgendwann ist nicht mehr die Hebamme schuld.“
Jeder kann sein Leben so leben, wie er das möchte. Moa gibt durch ihr Tun die „Absolution“ dazu. Moa ist ECHT. Moa ist AUTHENTISCH. Moa nimmt kein Blatt vor den Mund (und wenn, dann, um die Worte darauf zu schreiben, die sie auch gesprochen von sich geben würde).
Moa lebt – meines Erachtens – nach dem Prinzip:
Love it. Change it. Leave it.
Bei meinem Besuch im Krimihaus führten wir sehr schöne und tiefgreifende Gespräche. Ehrliche Gespräche.
Moa hatte es nicht immer leicht. Doch sie hat sich entschlossen, eine erfolgreiche Autorin zu werden.
Immer wieder höre und lese ich von Menschen, die irgendwann in ihrem Leben lediglich eine Sache getan haben, die ihr Leben zum Positiven verändert hat:
Sie haben eine Entscheidung getroffen!
Moa und ich saßen bei ihren drei Hühnern und haben geredet. Wir saßen mit Hund und Katzen zusammen und haben diese gestreichelt.
Und während dieser beiden Tage ist etwas bei mir passiert. Ich hätte es nie für möglich gehalten:
Vor dem Besuch bei ihr in Rhauderfehn war ich Allergikerin. Allergisch gegen Tierhaare aller Art. Was soll ich sagen … Die Allergie ist weg. Weg!!!
Ich kann mir das nur so erklären:
Während ich bei Moa war, habe auch ICH eine Entscheidung getroffen:
Ich möchte Autorin sein. Mit ganzem Herzen. Und ich möchte anderen Menschen helfen, das zu tun, was sie sich wünschen, um das Leben leben zu können, das sie wirklich leben wollen.
Jeder Mensch soll die Möglichkeit bekommen, seine Geschichte zu erzählen – in Form eines Buches, eines Artikels, eines Drehbuchs, Hörbuchs, eines Theaterstücks, eines Musicals … Wie auch immer.
Und Menschen wie Moa zeigen, dass es möglich ist.
Schreiben wir – ob die eigene Geschichte oder welche Geschichten auch immer – kommen wir irgendwie immer an die Essenz von dem, was uns im Innersten bewegt.
Und was soll ich sagen … Durch diese Geschichten wird eines – wie ich finde klar: Dass wir alle dieselben sind.
Ich bin sehr gespannt auf Moas Biografie.
Die Biografie einer Frau, die DAS JETZT EINFACH MAL MACHT.
Herzlichen Glückwunsch zu dieser mutigen Entscheidung!
Du tust das – meiner Meinung nach – nicht nur für Dich, sondern für Deine jetzigen und für Deine zukünftigen Leser – für viele andere Menschen und gibst ihnen eine wichtige Botschaft mit:
Dass Angst eine Illusion ist.
Ich möchte mich herzlich bedanken für so vieles:
Für Deine Gastfreundschaft.
Dafür, dass ich Deine komplette Familie kennenlernen durfte (inklusive eines jeden einzelnen Tieres).
Für die tollen Gespräche.
Für die Einladung zum Italiener.
Für den Ostfriesentee mit Kandiszucker, der in Deinem Beisein einfach am besten schmeckt.
Für das Frühstücken mit den leckeren frischen Eiern direkt aus den Hühnern.
Und last – but not at least, at all – für Deine Freundschaft und Deine Ehrlichkeit.
Ich freu mich wie Bolle auf Deine Biografie!
Deine Freundin Yvonne
Das Lesen - Meine Leidenschaft
Kindern schenkt man gerne Märchenbücher. In meinem Fall war es wohl der Beginn meiner größten Leidenschaft. Nämlich dem Lesen und Eintauchen in andere Welten. Mein erstes Märchenbuch, das habe ich immer noch in meinem Regal. Als Kind habe ich es rauf und runtergelesen, immer wieder. Tage- und nächtelang. Es lag wohl auch daran, dass ich die meiste Zeit, jedenfalls im Winter oder bei ostfriesischem Wetter, gerne in meinem Zimmer verbracht habe. Damals, da gab es ja noch kein Dauerfernsehen oder Smartphones. Und ja, darüber bin ich wirklich sehr froh.
Also, mein Märchenbuch, das gibt es noch. Es ist sehr zerfleddert, der Rücken hängt nur noch am seidenen Faden zusammen. Und immer, wenn ich es nun in die Hand nehme, dann weiß ich wieder, wie es damals war. Sie denken jetzt sicher beim Lesen, dass ich eine schöne Kindheit erlebt habe. Aber so war es nicht. Doch darauf gehe ich in anderen Kapiteln detaillierter ein.
Neben dem Lesen, das ich natürlich erst in der Schule lernte, begann dann die nächste Leidenschaft, sich Bahn zu brechen. Ich liebte das Schreiben. Erst, so kam es mir vor, wenn ein Wort wirklich auf dem Papier stand, dann war es auch wahr. Wenn andere Schüler stöhnten, wenn sie immer wieder die Buchstaben seitenweise in ihr Heft zu schreiben hatten, so war es für mich ein Fest. Zunächst mit dem Bleistift, später in Tinte. Ja, manchmal hatte ich den Eindruck, damit zu malen. Ach, und dann die bunten Wachsmalstifte. Wie habe ich diesen Geruch geliebt. Und geliebt habe ich auch die Schule insgesamt. Morgens aufstehen, sich fertig machen, den Ranzen auf den Rücken geschnallt ging es zu Fuß los in die Dorfschule in Großoldendorf. Das Lehrerehepaar, das dort mehrere Jahrgänge gleichzeitig unterrichtete, hat mein Leben maßgeblich geprägt. Sie haben es wirklich verstanden, einem das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu erleben, wenn man lernt. In dem Raum mit den Erstklässlern, die alleine unterrichtet wurden, gab es einen alten Ofen, der im Winter bollerte. Wir waren nur wenige Schüler. Jeder kannte jeden. Und irgendwie mochte auch jeder jeden. Natürlich, den einen oder anderen, den mochte man mehr. Aber wenn man keine große Auswahl hat, dann rauft man sich zusammen.
Zur Pause wurde auf die Uhr gesehen, und nachdem wir draußen auf dem Schulhof ausgiebig getobt, gelacht, unser Brot gegessen und die Milch oder den Saft getrunken hatten, wurde in die Hände geklatscht, damit es weiterging. Der Lehrer bestand darauf, dass wir uns in zwei Reihen aufstellten, bevor wir wieder in die Klassenzimmer gehen durften. Niemand hätte es gewagt, hier aus der Reihe zu tanzen. So war das damals. Als Kind hörte man noch auf das, was Erwachsene sagten. Und tat dann, was sie sich wünschten oder, wenn es sein musste, auch verlangten. Nachdruck verschaffte sich der Lehrer bei renitenten Schülern, die es natürlich auch damals schon gab, mit dem berühmten Rohrstock. Ich selber bin nie damit in Berührung gekommen. Ich war ein stilles Mädchen. Fast schon unsichtbar. Ich habe immer artig gelernt, mich hin und wieder zu Wort gemeldet und meine Hausaufgaben mit viel Liebe gemacht. Wie gesagt, es war ein Fest für mich, zur Schule zu gehen.
Vielleicht wundert es Sie nicht, dass ich in den Jahren in der Dorfschule immer die beste Schülerin im Deutschunterricht war. Wo ich doch das Lesen so liebte. Und nein, leider weiß es nicht mehr genau zu erinnern, aber ich denke, ich habe mich auch schon vor der Schule mit den Buchstaben auseinandergesetzt. Ich wollte hinter das Geheimnis kommen, was sie erzählten. Und als ich dann endlich lesen konnte, da wurde ich reichlich beschenkt. Für Kinder wie mich gab es in der Dorfschule übrigens ein Belohnungssystem. Da war so ein Schrank, in dem Spiele lagen, Bücher oder Malstifte. Es waren wohl gesponserte Geschenke von Banken oder so. Auf jeden Fall durfte jeder, der eine Eins geschrieben hatte, sich etwas aus dem Schrank aussuchen. Sie ahnen es schon, ich hab den Schrank ganz schön geplündert. Und mein Lehrer, das weiß ich noch wie heute, der hat einmal gesagt, bevor wir in die weitere Schule wechseln sollten, dass das Mädchen mit der blauen Strickjacke, also ich, dass dieses Mädchen einmal etwas Besonderes werden würde. Vielleicht sogar Rektorin an einer Schule oder Ähnliches. Nun, Lehrerin zu werden, war nie mein Wunsch gewesen. Das liegt unter anderem daran, dass ich irgendwann differenzieren konnte zwischen den Schülern, die nett waren und denen, die man einfach nicht ausstehen konnte. Und solchen Kindern wollte ich nicht verzweifelt versuchen, etwas beizubringen. Warum ich einige Schüler so schrecklich fand? Nun, zum einen waren sie gemein zu anderen. Zogen Mädchen an den Haaren, schubsten schwächere Schüler in den Sand. Oder, was für mich das Schlimmste überhaupt war, sie quälten wehrlose Tiere. Kranke Vögel oder Katzenbabys wurden von ihnen gegen die Wand oder an den Baum geschmissen, bis sie qualvoll starben. Und ich stand fassungslos, mit Tränen in den Augen, daneben und konnte nichts dagegen tun. Damals, da hatte ich noch Angst.
Diese Angst rührte aus der Art her, wie ich im Elternhaus aufgezogen wurde. Ich musste still, ja am besten unsichtbar, sein. Geredet wurde nicht viel bei Tisch.
Mein zwei Jahre jüngerer Bruder und ich, wir lebten oft in Angst. Und das war nicht unbegründet, denn wir wurden hin und wieder geschlagen. Eigentlich hatten wir nie etwas getan. Für diesen Zorn, da gab es wohl andere Gründe, die gar nichts mit uns Kindern zu tun hatten.
Aber zurück zu meiner Liebe für das Lernen, das Lesen, die Schule. Sie setzte sich fort, auch, als es ab der vierten Klasse hieß, dass wir von Großoldendorf nach Remels wechseln mussten. Remels war schon eine Nummer größer. Während es bei der Dorfschule eben nur den Sandplatz vor der Schule gab, waren es in Remels gleich mehrere geteerte Pausenhöfe. Die Schule roch auch ganz anders. Es gab keine Öfen mehr. Dafür moderne Fußböden und Schulbänke. Und natürlich viel mehr Schüler. Manchmal pendelte man in den Pausen von einem Unterrichtsraum zum nächsten. Die gewohnte Monotonie, die mir nicht unlieb war, sie war dahin. Die große Pause verbrachte man in der sogenannten Aula, wo es Schulmilch gab. Ich mochte Vanille am liebsten. Auch hier standen die Schüler Schlange. Und auch, wenn alles etwas größer war, ich fühlte mich doch irgendwann wohl. Wir wurden mit dem Bus zur Schule gefahren. Im Sommer legten wir die drei Kilometer lange Strecke auch gerne mit dem Fahrrad zurück.
Zu den Fächern Deutsch und Rechnen kamen jetzt Biologie, Erdkunde und weitere hinzu. Mein Wissensdurst, der nach wie vor ungebrochen war, wurde immer weitgreifender gestillt. Am liebsten mochte ich immer noch den Deutschunterricht. Und die große Bücherei in Remels. Es dauerte nicht lange, und ich war dort regelmäßiger Gast, um zwischen den Regalen zu stöbern. Meine Leselust war ungebrochen. Ich bewunderte Menschen, die ich nicht kannte, die aber in der Lage waren, über dreihundert Seiten dicke Bücher zu schreiben. Es faszinierte mich, wie gut sie erzählen konnten. Ich liebte Geschichten über alles. Das Leben der anderen, ich las mich dort hinein und war bei ihnen. Litt mit und lachte. Ja, es war damals schon so, dass ich das Gefühl hatte, die Menschen in den Büchern vor meinem inneren Auge zu sehen. Es spielte keine Rolle, ob sie nur erfunden waren, für mich war das, was sie sagten, erlebten und dachten real. Was machte es da für einen Unterschied, dass es nur Fiktion war? Es hätte doch genauso gewesen sein können, wie es sich der Autor des Buches vorgestellt hatte.
Ich erwähnte ja schon, dass ich die Deutschstunden liebte. Und es war mir wohl gegeben, selber eine gute Erzählerin in mir zu erwecken. In der sechsten Klasse, da schrieb ich einen Aufsatz zu dem Thema »Wer nicht hören will, muss fühlen«.
Der erschien meinem Deutschlehrer so gelungen, dass er mich bat, ihn doch bei der nächsten Elternversammlung in der großen Aula vorzulesen. Und das mir, dem stillen Mädchen, das zuhause den Mund verboten bekam. Ich sollte vor einer großen Menge Menschen etwas vorlesen, das ich auch noch selber geschrieben hatte. Sicher, ich fühlte mich geschmeichelt. Welches Mädchen wird nicht gerne vom Lehrer gelobt. Aber das? Natürlich stimmte ich zu. Ich hatte nicht gelernt, zu widersprechen.
Der besagte Abend rückte immer näher, ich las meinen Aufsatz immer wieder, um mich ja beim Vorlesen nicht zu verhaspeln.
Schon, als mich dann mein Lehrer, der bereits oben auf der Bühne stand, beim Namen nannte und mich bat, heraufzukommen, zitterten mir die Knie. Doch irgendwie überwand ich meine Angst, ging nach oben, setzte mich an den einzelnen Tisch, der auf der Bühne stand. Es wurde still in der Aula. Und ich las vor. Nein, ich rappelte meinen nur zwei Seiten langen Aufsatz mehr oder weniger herunter, während mir mein Herz bis zum Hals klopfte. Dann war es geschafft, Applaus brandete auf. Heute weiß ich, dass sie klatschten, weil ich ein Kind war, das so mutig dort oben gelesen hatte. Und ja, wenn ich heute an die Zeit zurückdenke, dann wage ich zu behaupten, dass es meine erste öffentliche Lesung gewesen ist. Dieses natürlich mit einem Augenzwinkern bedacht, denn damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass ich selber einmal eine Autorin sein würde.
Es war einmal ... so fingen viele Geschichten in meinem Märchenbuch an. Es würde nach diesem Auftritt an besagtem Elternabend noch fast vierzig Jahre dauern, bis ich mit fünfzig die ersten Schritte zu meiner Karriere als Krimiautorin machen sollte.
Das Elternhaus
Das Licht der Welt erblickte ich am 9. November 1962 in Ostfriesland in einem großen Bauernhaus, in dem auch schon meine Großmutter und mein Vater zur Welt gekommen waren. Es war eine Hausgeburt und das Haus, es steht noch immer dort in Wiesmoor, gehört meiner Familie aber schon seit vielen Jahren nicht mehr.
Meine Eltern lebten damals im ersten Stock, unten wohnte meine Großmutter mit ihrem Mann, der nicht mein Opa war. Die Kriegsjahre hatten zu der Zeit bei vielen Menschen ihre Spuren hinterlassen.
Für mich als Neugeborene war das natürlich nicht von Bedeutung. Jetzt war ich erst mal da. Meine Mutter, ein Kriegsflüchtling aus Ostpreußen, war gerade einmal einundzwanzig, als sie mich bekam. Meine Großmutter mochte sie nicht. Mein Vater, ein gelernter Tischler, ebenfalls einundzwanzig, war der einzige Sohn. Und dann tauchte da plötzlich so eine Flüchtlingsfrau auf und stahl ihn seiner Mutter. Vielleicht war es das, was meine Großmutter dazu bewog, immer gegen meine Mutter zu zetern. Ich weiß es nicht genau. Aber dass die beiden sich mehr oder weniger verachteten, das habe ich später als Kind natürlich hautnah miterlebt. Dieser Umstand jedenfalls führte dazu, dass wir, als ich zwei Jahre alt war, nach Großoldendorf, also gute zwanzig Kilometer entfernt, in ein altes Bauernhaus mit Plumpsklo zur Miete umzogen. Es lag direkt an einem Wald. Hollsand. In diesem Wald, da habe ich praktisch meine Kindheit verbracht. Und die war draußen wirklich abenteuerlich.
Praktisch den ganzen Tag streiften die anderen Kinder, mein Bruder und ich durch den Wald, kletterten auf Bäume, versuchten, Erdhöhlen zu bauen. Wir zogen morgens los und kamen erst zurück, wenn unser Magen knurrte. Gleich beim Wald in der Nähe, da gab es eine Gastwirtschaft, die auch heute noch als Ausflugslokal existiert. Ich war mit der Tochter, die vielleicht zwei Jahre jünger war als ich, befreundet. Und so konnte ich dort immer spielen, rote Nüsse aus dem Automaten ziehen oder umsonst Cola trinken. Auf einer Wiese bei der Gastwirtschaft wurde zudem immer ein Jahrmarkt aufgebaut mit einem großen Kettenkarussell. Da die Wirtstochter immer umsonst mitfuhr, durfte ich das als Freundin natürlich auch. Ja, da draußen, da hatten wir wirklich jede Menge Spaß.
Der allerdings hörte spätestens an der Haustür wieder auf. Man kann es sich ja als Kind leider nicht aussuchen. Mich hatte das Schicksal mit einem jähzornigen Vater bedacht. Heute habe ich die Einstellung, dass alles im Leben kein Zufall ist. Vielleicht musste ich durch diese harte Schule gehen, um später im Leben das Selbstbewusstsein zu entwickeln, das mich zu einer stillen Märtyrerin heranwachsen ließ. Wenn mein Vater etwas sagte, dann waren alle anderen still. Meine Mutter kenne ich die ersten Jahre nur als Frau, die immer nickt. Die nicht widerspricht. Eine Frau, die das tut, was man von ihr eben als Hausfrau und Mutter erwartet. Und auch die Hausarbeit war zu der Zeit ja noch eine richtige Plackerei, die keinen Spaß machte. Ich bekam schon früh das Gefühl, dass meine Mutter uns Kinder im Grunde nicht mag. Schließlich waren mein Bruder und ich es, die ihr Leben in diese Katastrophe geführt hatten. Ich natürlich an erster Stelle. Bestimmt war sie nicht freiwillig mit mir schwanger geworden. Auch da hatte mein Vater sich genommen, wonach ihm der Sinn stand. Er trank damals viel. Demolierte Autos bei Unfällen. Anschließend räumte er in seiner Familie auf. Ich erinnere mich dunkel an Streitereien, wo meine Mutter durch die Gegend gestoßen wurde. Wir ertrugen alles in stumme Angst gehüllt. Desto weniger man auffiel, umso besser.
Wir wohnten noch in diesem Haus am Wald, als ich endlich eingeschult wurde. Vielleicht können sie jetzt besser nachvollziehen, warum ich so gerne in die Schule ging. Da musste ich keine Angst haben, dass eine Hand ausholte und mir eine Backpfeife gab. Einfach so. Ich musste nicht damit rechnen, dass plötzlich jemand hinter mir stand und mich fragte, was ich wieder gemacht hatte, um mich dann zu verprügeln. Der kleinste Anlass genügte manchmal, und mein Hintern feierte Hochzeit, wie es damals bei Familienfeiern immer launig hieß. Für mich war das alles andere als lustig. Ebenso wenig wie das, was ich mein Leben lang mit mir herumgeschleppt habe, weil ich es niemandem erzählen konnte. Der Missbrauch. Ich werde nicht weiter darauf eingehen. Es ist vielleicht nur wichtig für Sie als Leser, damit sie verstehen, warum ich so einsam war. Was soll man von den Menschen halten, die nach außen hin so nett sind und bei allen herzlich willkommen. Was wirklich bei uns los war und hinter verschlossenen Türen stattfand, das wusste nur ich. Und vielleicht wusste es auch meine Mutter. Gesprochen haben wir nie darüber. Ja, sicher hat das auch dazu beigetragen, dass ich mein Leben lang ein distanziertes Verhältnis zu meiner Mutter hatte. Wäre sie nicht diejenige gewesen, die mir hätte helfen müssen, mich retten? Sie hat es nicht getan. Ich war auf mich allein gestellt.
Und deshalb war alles, was mich aus diesem Elternhaus herausholte, willkommen. Die Schule, der Wald, die Freundin in der Gaststätte. Ich war schon von klein auf gezwungen, nach Alternativen zu suchen, um Dinge, die eigentlich für eine kleine Kinderseele kaum zu verkraften waren, zu kompensieren. Eine große Hilfe dabei waren mir auch immer die Tiere. Hier besonders Hunde und Katzen.
Vielleicht rührt auch aus diesen Erfahrungen meine spätere Leidenschaft für das Lesen. Auch da konnte ich flüchten. Ich lernte in den Büchern Menschen kennen, die ebenso Probleme hatten, wie ich. Und ich las, wie sie damit umzugehen versuchten. Eben nicht aufgaben, sondern kämpften. Meine spätere Affinität zur Psychologie wurde wohl schon in Kindertagen gelegt. Ich wollte immer wissen, warum ein Mensch welche Dinge tut. Dahinter verbarg sich bestimmt auch immer die Suche nach der Antwort auf die Frage, warum mein Vater so war wie er war. Kalt, brutal und nach außen hin ein Saubermann. Ja, auf das Äußere wurde viel wert gelegt. Die Hecke vor dem Haus, der Rasen, alles musste immer akkurat geschnitten sein. Wehe, man käme in den Verdacht, dass jemand über einen redete. Mir sind von jeher Menschen suspekt, die ihren Rasen mit der Nagelschere bearbeiten und an ihre Hecken Zollstöcke anlegen. Für mich haben solche Menschen immer dunkle Geheimnisse, die sie damit zu kaschieren versuchen.
Es sind dann wohl auch diese dunklen Geheimnisse, die mich in späteren Jahren, als ich die Realschule in Remels besuchte, hin zu Autoren wie Dostojewski, Frisch und Lenz führten. Ich weiß es noch wie heute, wie wir im Unterricht die »Deutschstunde« von Siegfried Lenz besprochen haben. Jede dieser Stunden habe ich geliebt. Doch ich habe es immer mehr oder weniger für mich behalten. Ich genoss im Stillen, von der Vielfalt der menschlichen Seele zu hören. Aktiv am Unterricht beteiligte ich mich kaum. Es lag nicht daran, dass ich nichts zu sagen gewusst hätte. Doch ich hatte das Schweigen gelernt. Mir war zuhause so oft der Mund verboten worden, dass ich schlichtweg vergaß, ihn zu gebrauchen. Wenn mir etwas auf dem Herzen lag, dann schrieb ich es auf. Zuhause in meinem Zimmer. Ich hatte Bücher, in die ich Geschichten und Gedichte schrieb. Sie alle handelten von großen Gefühlen, die ein Mensch empfand, Ängsten, die er zu bewältigen hatte und von Tod und Gewalt.
Meiner Passivität, also meiner Unaufdringlichkeit, möchte ich es eher nennen, habe ich es auch wohl zu verdanken, dass es bei mir nie zu einer Empfehlung fürs Gymnasium gekommen ist, obwohl meine schriftlichen Noten durchaus Grund dazu gegeben hätten. Wahrscheinlich hielten mich die Lehrer für bockig, weil ich mich, obwohl sie mich immer wieder dazu aufforderten, nicht am Unterricht beteiligte. Nicht lebhaft mit den Armen wedelte wie die anderen. Nicht mit den Fingern schnipste, um unbedingt dranzukommen. Nein, dran war ich zuhause schon genug. Im Unterricht, da wollte ich meine Ruhe haben. Mich nicht in den Mittelpunkt stellen, nicht auffallen. Einfach nur ein Schatten meiner selbst sein, eingehüllt in ein wohliges Beisammensein.
Wie dem auch sei. Ich habe die Schule geschafft und so wie die anderen die Entlassung 1979 mit viel Sekt und bunten Farben gefeiert. Doch eigentlich war es mir da schon klar, dass ein Stück Glück mit dem Tag verlorenging. Die Unbeschwertheit, mit denen Schüler, die gut mitkommen, in den Tag hineinleben können. Irgendwann, da wählt man sich ja aus, was einen interessiert. Stammkundin in der Bücherei bin ich auch nach meiner Schulentlassung geblieben. Und mit meinem Taschengeld kaufte ich mir jede Woche als erstes ein Buch. Wenn dann noch Geld übrig war, dann vielleicht auch Schreibwerkzeug und Papier. Ja, das war auch wichtig. Schönes Papier. Es roch immer so gut. Oder ein gebundenes Buch, das man aus der Folie nahm. Das erste Mal darin blätterte. Ich habe den Duft der Seiten immer gierig aufgesogen, bevor ich es dann las.
Meine Liebe zu Büchern, Sie ahnen es schon, konnte ich mit niemandem in meinem Elternhaus teilen. Und auch meine Schulfreundinnen hatten nicht diese große Leidenschaft dafür. Also saß ich in meinem Zimmer, meinem Schutzraum, jedenfalls meistens. Ab einem gewissen Alter traute ich mich dann auch immer öfter, die Tür hinter mir abzuschießen.
Im Gegensatz zu meiner Liebe zu den Worten, fehlte mir hingegen jegliches Verständnis für Zahlen. Die Mathematik, sie wurde mir zwar von meiner Lehrerin gut erklärt und nahegebracht, doch geliebt habe ich diese Kurven und Wurzelzeichen nie. Ein notwendiges Übel, könnte man sagen, dass man errechnen konnte, wie lange jemand mit dem Zug von München nach Hamburg fuhr, wenn er dreimal zwanzig Minuten Aufenthalt hatte und um acht Uhr fünfundzwanzig losgefahren war. Mir jedenfalls war es völlig schnuppe. Mich hätte eher interessiert, warum er dahin fuhr, was er während der Fahrt dachte und ob ihn etwas bedrückte. Doch für solche Überlegungen gibt es in der Mathematik bekanntlich keinen Raum. Trotz meines Unverständnisses bin ich immer mit einer Drei durch die Welt der Zahlen gelaufen. Immerhin.
Sie sehen, ich bin bei der Beschreibung meines Elternhauses schon wieder in die Schule abgeschweift. Wieder ein Ablenkungsmanöver?, könnten Sie sich fragen. Wahrscheinlich ist es so. Im Grunde ist über meine Eltern schon alles gesagt. Sie kamen mir oft wie Fremde vor, bei denen ich leben musste. Spaß hat mir das nie gemacht. In meinen Träumen, ganz weit weg alleine in meinem Zimmer, da habe ich mir oft vorgestellt, dass mich eine nette Familie adoptieren würde. Es gab sie wirklich, diese wunderbaren Familien. Ich habe sie kennen gelernt, wenn ich Schulfreunde zuhause besuchte. Dort war es immer viel heller, lauter und fröhlicher als bei uns. Deshalb lud ich kaum Freunde zu mir nach Hause ein. Vielleicht habe ich mich sogar dafür geschämt, wie es bei uns war. Oder ich habe gefürchtet, dass jemand merken könnte, was wirklich hinter unseren verschlossenen Türen abging.
Wenn ich also unterwegs war, draußen, in der Schule oder sonst wo, dann war mein Leben in Ordnung. Oder sagen wir mal, es war erträglich. Deshalb spielte ich, als es um die Berufswahl ging, auch tatsächlich mit dem Gedanken, als Au Pair nach Frankreich zu gehen. Ach, wie gerne hätte ich das gemacht. Doch ich traute es mich einfach nicht. Dafür war ich viel zu klein gemacht worden. Genauso, wie meine Mutter. Die hat sich ja auch nie etwas getraut. Den Führerschein, den sie mit Ende dreißig, glaube ich, war sie da schon, gemacht hat, der lag dann in der Schublade seine Zeit ab. Nur einmal, so habe ich damals gedacht, hätte ich mir gewünscht, dass meine Mutter mutig gewesen wäre, wenn wieder einmal eisige Stimmung im Haus herrschte. Hätte sie doch den Mut gehabt, uns Kinder zu nehmen und irgendwo hinzugehen, wo wir endlich hätten lachen können, bis uns der Bauch wehtat.
Abends weinte ich oft in meinen großen gelben Teddy, weil wir blieben, wo wir waren. Und ich weinte auch, als man meinen über alles geliebten Rauhaardackel Moritz erschlagen draußen in einem Straßengraben fand. Es waren wohl irgendwelche Nachbarn gewesen, die es nicht ertragen konnten, dass er vor ihrer Tür wegen einer läufigen Hündin rumlungerte. Von diesem Tag an, da hasste ich diese Menschen und ging mit vom Weinen geschwollenen Augen zur Schule.
Der Beruf
Ab der achten Klasse muss man sich ja Gedanken über den Rest des Lebens machen. Also, was will man machen, bis man in Rente geht. Es ist wichtig, eine Ausbildung ins Auge zu fassen, als die Berufsberatung auch in meine Klasse kommt. Selbst für Mädchen. Allerdings herrscht Mitte der siebziger Jahre bei den Männern, die auch mich beraten, die Meinung vor, dass man sowieso heiraten wird. Also sollte man das, was man sich da überlegt, nicht übertreiben. Es reicht eine einfache Ausbildung, bitteschön. Wäre ich damals ein Junge gewesen, wären solche Gespräche anders verlaufen. Für mich blieb allerdings nach einem kurzen Blick auf meine Zeugnisse das Büro übrig. Irgendwo Tippse spielen. Es interessierte niemanden, dass ich gerne schrieb und mir hätte vorstellen können, als Journalistin zu arbeiten. Denn auch das Fotografieren machte mir schon immer Spaß.
Meine erste Kamera gewann ich mit vielleicht sieben Jahren auf dem Schützenfest in Remels, ein Plastikteil, mit dem ich die ersten Bilder von Bäumen schoss. Oder was mich auch schon immer fasziniert hat, war die Polizeiarbeit. Nicht die Streife. Nein, ich wäre für mein Leben gerne zur Kriminalpolizei gegangen. Doch ich war unsportlich. Eine Klassenkameradin von mir war übrigens die Tochter unseres Ortspolizisten. Sie hat das gemacht, was ich liebend gerne getan hätte. Sie erzählte mir später, als wir uns zufällig in Remels in einem Geschäft trafen, dass es am schlimmsten wäre, wenn es um Kinder ginge. Auch das brannte sich bei mir ein. Die Vorstellung, auf ein totes Kind zu treffen, war einfach unvorstellbar. Und dabei hatte ich mit elf oder zwölf Jahren ein totes Kind gesehen. Das vergesse ich hin und wieder im Alltag, weil es mit zu den Erlebnissen gehört, die ich am liebsten löschen würde. Es war Ostersonntag. Die Eier waren gefärbt und sollten jetzt gekullert werden. Eigentlich hätten mein Bruder und ich einfach in den Wald laufen können, um das zu tun. Doch mein Vater wollte mit uns woanders hinfahren. Warum auch immer. Jedenfalls stiegen wir in den Wagen und bei einer vielleicht drei Kilometer entfernten Straße auf der anderen Seite des Waldes, wo nur ein paar Häuser standen, da lief plötzlich ein kleiner Junge hinter einer Hecke hervor und direkt vor unser Auto. Er war glaube ich sofort tot. Wenn ich daran zurückdenke, dann stelle ich mir immer vor, was er heute wohl machen würde. Nein, solche Erlebnisse, die lassen einen niemals wieder los. Und ich konnte doch gar nichts dafür.
Ich gehörte also ins Büro. Der Landkreis war bereit, mich zur Bürogehilfin auszubilden. Das Diktat, was zur Aufnahmeprüfung gehörte, fiel wohl gut aus, ich wurde als eine von sechs Auszubildenden unter glaube ich zweihundert Bewerberinnen ausgewählt. Es war nicht so, dass ich nun vor lauter Gram gestorben wäre. Nein, es ging ja immer noch um Papier. Warum sollte so eine Ausbildung schlecht sein. Ich würde an der Schreibmaschine schreiben. Das hatte ich ja schon in der Realschule gelernt. Und Stenografie. Beides lag mir. Ich beherrschte es routiniert und fehlerfrei. Außerdem hatte ich Spaß am Büro, das hatte ich schon als Kind immer gerne gespielt und Papiere sortiert und Stempel gesammelt.
Ernüchterung machte sich dann schnell breit. Die Ausbildung bestand in erster Linie darin, Texte nach Phonodiktat runterzuschreiben. Oder Sortier- und Vernichtungsarbeiten erledigen. Behördenkram eben. Schon schnell fühlte ich mich dort fehl am Platze. Ich hatte einfach zu viel Fantasie und Lust am eigenen Gestalten. Als kleines Rädchen, das ich war, gab es für mich keine Entfaltungsmöglichkeiten. Trotzdem gingen die zwei Jahre, wo ich sehr nette Kollegen hatte, schnell rum und ich kündigte, um die Fachoberschule Wirtschaft zu besuchen. Genauso gut hätte ich den bequemeren Weg wählen können, denn eine Anstellung nach Ausbildungsende auf Lebenszeit schwebte im Raum. Schon damals hab ich wohl gedacht, dass das nicht alles im Leben sein konnte.
In der Fachoberschule war ich dann fast die Jüngste in der Klasse. Und ja, ich war happy, konnte ich doch endlich wieder zur Schule gehen. Ich lernte eine Menge über wirtschaftliche Zusammenhänge, noch mehr zur Mathematik und meine Deutschlehrerin war eine faszinierende ältere Dame, die immer mit Stock ging. Sie schaffte es erneut, mich für Bücher zu begeistern. Noch weiter einzutauchen in die Faszination des geschriebenen Wortes. Was ich absolut nicht mochte, war Buchführung. Gehörte aber irgendwie auch dazu. Zu dieser Zeit war ich achtzehn und ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hatte. Aber ich glaube Buchführung in der Kombination mit Chemie haben mich wohl kirre gemacht. Auf jeden Fall war ich kurz vor dem Abschluss soweit zu sagen, nein, Wirtschaft ist dann doch wohl nichts für mich. Plötzlich langweilte mich die Erzählung darüber, dass wir alles andere als im Überfluss lebten, so, wie mein Wirtschaftslehrer es darstellte. In dieser Zeit, da war ich der Meinung, dass es von allem zu viel gab. Es wurden so viele Lebensmittel weggeschmissen und auf anderen Kontinenten verhungerten die Menschen. Da wollte ich nicht zu denen gehören, die unbedingt einen Joghurt aus Bayern in den Norden transportiert wissen wollten für einen besonderen Geschmack. Ich lief rum wie eine Ökotante mit selbstgestrickten bunten Pullovern, langen Wollröcken und ging oft gesenkten Hauptes alleine durch die Straßen. Ich hatte über so vieles nachzudenken. Vieles erschien mir sinnlos. Ich trieb mich in der Friedensbewegung herum und hatte interessante Freundschaften. Ausgewählt, aber nichts von echter Dauer. Die Intellektuellen, zu denen ich mich nicht zählte, hatten noch mehr Angst vor Nähe als ich.
Nach einem kurzen Ausflug in die fixe Idee, etwas Handwerkliches, also Bodenständiges zu erlernen, wo ich mich in einem Betrieb für Industriemechanik vorstellte, kehrte ich dann doch wieder auf den rechten Pfad zurück und schloss die Fachoberschule Wirtschaft ab. Ich hatte mir überlegt, mit dem Abschluss etwas Soziales zu machen. Erzieherin oder Sozialpädagogin. Ich wollte gerne Menschen helfen. Die Wirtschaft reizte mich nicht mehr. Dafür musste ich allerdings ein Praktikum im sozialen Bereich machen, bevor ich an die Fachhochschule in den Bereich Soziales wechseln konnte.
Ich entschloss mich für den Kindergarten in Remels. Schon damals interessierte ich mich eher für die Kinder, die still waren. Die lauten frechen Kinder, ganz ehrlich, sie gingen mir auf die Nerven. Ich wollte zum Beispiel wissen, was ein Mädchen, das sich immer in der hintersten Ecke verkroch, für ein Problem hatte. Ich beschäftigte mich ja immer noch leidenschaftlich mit dem Thema Psychologie. Vielleicht hätte ich ihr ja helfen können.
Als ich jedoch erkannte, dass die Arbeit im Kindergarten nichts für mich ist, zog ich nach einem Vierteljahr die Reißleine. Auch den schrecklichen Geruch dort aus dem Waschraum, wenn sich alle die Zähne putzten, ich werde ihn nie vergessen. Und kurz darauf erfuhr ich, dass ich schwanger war.
Erste große Liebe
Bisher habe ich noch gar nichts zu meinen sogenannten »wilden Zeiten«, die jeder Mensch erlebt, gesagt. Ich wuchs mit der Musik von Heintje, Heino und Alexandra auf. Später dann Smokie, Abbba und Bay City Rollers. Und als ich älter wurde, war die erste Platte, die ich mir kaufte, von Pink Floyd »Shine on you crazy Diamond«. Das war meine Welt. Ich badete in den Rhythmen, tanzte dazu in meinem Zimmer und vergaß wieder einmal alles um mich herum. In diese Zeit fielen auch Alan Parsons, Supertramp, Led Zeppelin, Birth Control und AC/DC und viele mehr. Ich schwankte immer zwischen Hippie und Rockerbraut und fing den Spitznamen Gamma Ray ein, weil ich auf der Tanzfläche zu dem gleichnamigen Song förmlich austickte. Mit Musik kann man wirklich alles rauslassen.
Mit fünfzehn bekam ich mein erstes Mofa und fuhr damit viele Kilometer, um in alternativen Diskotheken die Nächte durchzutanzen. Ich war immer alleine unterwegs. Es machte mir nichts aus. Nein, ich wollte es sogar so. Auf diese Weise lernte ich die interessantesten Leute kennen. Manchmal sprachen sie mich an, oft war es umgekehrt. Wenn mich ein Mensch interessierte, ging ich einfach hin und fragte ihn, was er so machte. Viele um mich herum kifften, aber ich habe noch nie in meinem Leben Haschisch oder andere Drogen angerührt. Warum es mich nicht reizte, kann ich nicht genau sagen. Ich trank gerne Bier, Charly oder Rotwein. Und ja, ich trank oft auch zu viel. Aber mehr an Drogen wollte ich nicht. Ich rauchte ja nicht einmal richtig. Allerdings hatte ich immer Tabak bei mir, weil auch darüber eine Kontaktaufnahme problemlos war.
In dieser Zeit habe ich das Gefühl von Freiheit genossen. Ich war gerne alleine, immer noch in meinem Zimmer. Habe dort Musik gehört, gelesen, mich einfach hinweggeträumt. Hin und wieder fragte ich mich natürlich schon, warum ich nicht wie andere war, die in ihren Cliquen durch die Gegend zogen. Manchmal schloss ich mich einer Gruppe an, wenn das Ziel interessant war. Mich allerdings fragte nie jemand, ob ich mitwollte. Das, wie gesagt, konnte ich mir nicht erklären. Vielleicht sah man es mir an, dass ich im Grunde genommen eine Einzelgängerin war. Vielleicht wirkte ich schwierig.
Natürlich gab es auch junge Männer, die versuchten, mich für sich zu gewinnen. Doch das waren meistens nicht die, in die ich heimlich verliebt war. Und ein bisschen verliebt war ich immer. Es reichte mir eigentlich, in der Disco zu stehen, in sicherer Entfernung zu dem Objekt meiner Begierde. Ich beobachtete und malte mir aus, wie es wäre, wenn wir uns unterhielten. Das war oft viel spannender als die spätere Wirklichkeit. Sicher, hin und wieder hatte ich sowas wie »mit dem geh ich jetzt«. Doch lange hielt es nicht, dann machte ich Schluss, um endlich wieder alleine zu sein. Mich abends auf den Weg machen, mit dem Mofa oder Fahrrad, nicht zu wissen, was der Abend bringt, das war das Gefühl, was mich in dieser Zeit am meisten reizte. Einmal, da sprach ich einen Motorradfahrer einfach an, weil ich ihn interessant fand. Er lud mich zu einer Spritztour ein. Und was soll ich sagen, dabei bin ich tausend Tode gestorben, weil er natürlich zeigen wollte, was seine Maschine so bringt. Es war der einzige Motorradfahrer auf meiner Liste.
Ich dachte mir während meiner einsamen Exkursionen, die ich selber alles andere als einsam empfand, immer Geschichten aus. Was wäre wenn ... ich zum Beispiel diesen oder jenen Menschen kennen lernen würde. Was machte er, wenn er alleine zu Hause war. Schon als kleines Mädchen habe ich abends oft in meinem Bett gesessen und eigene kleine selbst erdachte Theaterstücke mit verschiedenen Rollen gesprochen. Oft war ich Madame Dubary. Dann hatte ich noch einen ganzen Karton voller Menschen und Möbel, die ich aus Katalogen ausgeschnitten hatte. Damit baute ich ganze Wohnungen und setzte die Menschen ein und sie spielten das Leben nach. Vielleicht das Leben, das ich gerne gehabt hätte.
Wenn ich heute so darüber nachdenke, dann habe ich das vielleicht gebraucht, um die schrecklichen Dinge, die mir widerfuhren, zu verarbeiten. Auch verkleidete ich mich immer gerne mit den viel zu großen Kleidern und Schuhen meiner Mutter und schlüpfte in andere Rollen. Ich wollte einfach nicht nur ich sein. Oder ich wollte nicht mehr ich sein, sondern frei. Einfach aus dem eigenen Körper schlüpfen und in ein anderes Leben übergehen. Und desto älter ich wurde, umso mehr konnte ich natürlich das machen, was ich wollte. Ein großer Gewinn an Freiraum, den ich für eigene psychologische Studien nutzte. Im Grunde habe ich mich immer selber therapiert. Bis zu einem gewissen Punkt geht sowas auch immer. Doch ganz tief drinnen in mir, da war noch dieser böse Stachel, der vieles in mir vergiftete. Es heißt ja oft, dass die Menschen, die selber viele schreckliche Dinge erlebt haben, gerne anderen helfen. Bei mir war das sicher so. Deshalb wollte ich ja auch unbedingt einen sozialen Beruf ergreifen. Mein Traumziel wäre damals Psychologin gewesen, um Menschen, die Traumata in ihrer Kindheit erlebt haben, zu helfen.
Zurück zu meinen wilden Zeiten. Mit verschiedenen Menschen war ich auf Konzerten und Partys. Doch nirgendwo wurde ich wirklich sesshaft. Ich war immer auf der Suche. Wusste nur nicht genau, wonach eigentlich.
Und dann traf ich eher durch Zufall meine erste große Liebe. Es war kurz, bevor ich zur Fachoberschule wechseln wollte. Deshalb war ich auch so großartiger Stimmung. Er stand in der Disco auch bei einer Gruppe, mit der ich mich gerade über den Wechsel zur weitergehenden Schule unterhielt, und machte eine Bemerkung in die Richtung »oh, mit solchen intelligenten Leuten kann ich nichts anfangen« und wollte weiterziehen. Ich stoppte ihn und fragte, »was er denn Besonderes sei, dass er nicht mit uns reden wolle«. So fing alles an. Ab diesem Tag waren wir praktisch unzertrennlich.
Er verkörperte für mich den Menschen, nach dem ich wohl unbewusst so verzweifelt gesucht hatte. Er hatte nicht einmal die Hauptschule abgeschlossen und machte schon immer das, was er wollte. Diese Perspektiv- oder Planlosigkeit, sie gefiel mir. Ja, es zog mich magisch an, dass jemand einfach mal dem Leben die Leine gab, während bei mir immer alles durchgeplant war und auf jeden Fall zum Erfolg führen musste. Ich hatte bisher alles geschafft, was ich mir vorgenommen hatte. Er hingegen hatte nichts vor. Ließ sich überraschen, was der nächste Tag brachte. Und auch, wenn es manchmal schwierig war, weil er natürlich ohne Schulabschluss ständig an seine Grenzen stieß, war es nicht so, dass er einen unglücklichen Eindruck machte. Nein, der unglückliche Mensch, der war eindeutig ich.
Sie wurde mir praktisch ins Gesicht geklatscht, diese Erkenntnis, dass ich, obwohl ich schlau war, oft die Beste, doch im Grunde ein viel unerfüllteres Leben geführt hatte als er. Seine Familie, er hatte mehrere Geschwister und wunderbare Eltern, die viel lachten, sie beeindruckte mich ungemein. Ich war so gerne dort, dass es wehtat. Meine erste Liebe war praktisch mein Ausweg aus meiner Hölle. Er wunderte sich immer noch, was ich eigentlich von ihm wollte. Wie sollte ich ihm das erklären? Ich wollte mich auch endlich leicht fühlen. Nicht mehr beschwert durch die Finsternis, die mich mein Leben lang umgeben hatte. Er holte mich ins Licht.
Auch für ihn war ich die erste feste Freundin. Wir ließen uns treiben. Wir liebten uns bedingungslos. Es war wie im Rausch. Wir verstanden uns ohne Worte. Und ich war nicht bereit, in ihm den Dummkopf zu sehen, als den er sich gerne darstellte. Er hatte einfach keine guten Startbedingungen gehabt, aber dumm war er nicht. Es gibt in jeder Familie ein Manko, etwas, das Eltern nicht erfüllen können. Und wenn er die Schule schwänzte und sich lieber in der Stadt herumtrieb, dann kümmerte man sich nicht darum.
Als ich erfuhr, dass ich schwanger bin, da freute er sich. Und ich, irgendwie doch verunsichert, freute mich dann auch. Zusammen würden wir es schon irgendwie schaffen. Ich, mit Ausbildung und kurz vor dem Studium, und der Typ mit den Hilfsarbeiterjobs, wir wollten also mit Anfang zwanzig eine Familie gründen.
Oder besser gesagt, ich wollte es. Um jeden Preis. Deshalb kümmerte ich mich auch um alles. Eine Wohnung, die vom Sozialamt finanziert wurde, darum, was das Kind brauchen würde. Ich kümmerte mich den ganzen Tag. Er hatte ja den Vorschlag gemacht, dass ich lieber mit dem Kind bei meinen Eltern wohnen bleiben sollte. Doch dagegen wehrte sich alles in mir. Diese kleine Familie, die sich anbahnte, sie war doch endlich mein Weg aus diesem Haus heraus.
Wir waren unfertige Persönlichkeiten und es ging natürlich schief. Unser Sohn wurde geboren und ja, wir liebten ihn beide. Doch ich mit meiner zerstörten Psyche und er mit seinem Hang zur Verantwortungslosigkeit, wir mussten einfach scheitern. Kurz gesagt, ich kapitulierte. Wir zogen zu meinen Eltern zurück und ich suchte mir, als unser Sohn ein Jahr alt war, eine Arbeit.
Der Zufall war es wieder, der mich in die größte Behörde Deutschlands führte. Eine Schulfreundin erzählte mir davon, dass man im Arbeitsamt immer Quereinsteiger suche. Also schickte ich meine Bewerbung los und bekam einen Zeitvertrag. Meine Mutter kümmerte sich tagsüber um unseren Sohn, meine große Liebe, mittlerweile Ehemann, lebte weiter sorglos in den Tag hinein.
Ich wollte das so nicht hinnehmen und wagte einen weiteren Anlauf und suchte uns eine Wohnung in Leer. Schließlich arbeitete ich jetzt dort und verdiente unser Einkommen. Es musste einfach klappen.
Doch das tat es nicht. Es gab immer öfter Streit, auch ums Geld, das ich verdiente und er für Dinge ausgab, die ich als sinnlos empfand. Ja, das Geld fehlte uns einfach in der Haushaltskasse. Ich rede hier nicht von kleinen Beträgen.
Dann lernte ich bei der Arbeit jemanden kennen, der mir das Gefühl vermittelte, verstanden zu sein. Zuhause bröckelte die Familienidylle immer mehr, wir zogen wieder zu meinen Eltern. Da hatte ich mich schon längst entschieden, dass ich die Scheidung wollte. Auch wenn’s wehtat. Irgendwie war mir die Illusion abhandengekommen, eine Familie zu haben. Da war ich erst Mitte zwanzig.
Und in diese chaotischen Zustände, da passte dieser neue Mann, zehn Jahre älter, genau hinein. Endlich sollte Schluss sein mit dieser Ungewissheit, ob man am nächsten Tag noch etwas zu essen kaufen konnte. Nein, es hatte mir nichts ausgemacht, auch zeitweise von Sozialhilfe zu leben. Wir waren ja eine junge kleine Familie. Nur, dass der Vater meines Kindes sich so wenig dafür interessierte, sich an unserer Sicherheit zu beteiligen, das hatte mich ihm gegenüber kalt gemacht.
Das neue Leben mit dem zweiten Mann, der auch Kinder hatte, verlief in geordneten Bahnen. Wir waren eine von diesen neuen Patchworkfamilien. Und irgendwie gab ich alles, um für alle alles gut und richtig zu machen. Ich arbeitete weiter, kümmerte mich um den kompletten Haushalt, putzte und wusch Wäsche, als gebe es kein Morgen mehr. Nur in meiner knappen Freizeit kam ich überhaupt noch dazu, ein Buch in die Hand zu nehmen. Überwiegend im Sommer las ich draußen den ganzen Tag, jedenfalls am Wochenende. In dieser Zeit entdeckte ich meine Liebe zu den schwedischen Krimis. Hier zuerst die Reihe um Kurt Wallander von Henning Mankell. Da war ich Anfang dreißig. Fühlte mich in einem Alltagstrott mit Arbeit, Haushalt und Nachbarfesten gefangen und gelähmt zugleich. Mit Wallander konnte ich mich plötzlich wieder spüren. Mankell verstand es, so zu schreiben, dass ich mich in erster Linie für die Probleme seines Ermittlers interessierte. Und das Leben in Schweden. Bisher hatte ich immer eine Affinität für Frankreich gehabt, obwohl ich nur zweimal überhaupt einen Fuß über die Grenze gesetzt hatte. Doch Schweden, das war etwas ganz anderes. Das Düstere in den Büchern, ich spürte förmlich, wie sich der dunkle Himmel über Ystad senkte. Und vor meinen Augen wurde ein Schleier entfernt, den ich wohl zum Schutz, den Alltag nicht mehr spüren zu müssen, aufgehängt hatte. Nein, ich war nicht wunschlos glücklich. Auch, wenn wir ein eigenes Haus hatten, zwei Autos und in Urlaub fuhren. Es fehlte mir etwas im Leben, das ich damals noch nicht konkret beschreiben konnte. Ich fühlte mich so leer.
Endlich schreiben
Die Beschäftigung in der Behörde war mittlerweile in ein unbefristetes Angestelltenverhältnis übergegangen. Sollte ich mich darüber freuen? Über das Wissen, wo ich jetzt den Rest meines Lebens verbringen würde. Mir lag das einfach nicht. Es machte mir irgendwie Angst. Ein sicherer Job, eine sichere Familie. Mittlerweile war ich wieder verheiratet. Es schnürte mir praktisch die Kehle zu, dass jetzt alles immer so weitergehen würde.
Dazu kam, dass ich auch in der Behörde immer eine Außenseiterin geblieben war. Es lag mir einfach nicht, mich in eine Kette von Ja-Sagern einzureihen. Ich hatte grundsätzlich eine andere Meinung zu den Abläufen, was nicht unbedingt falsch war, aber nicht gewünscht. Es lief doch alles gut. Das hörte ich oft. Andere Menschen sind vielleicht zufrieden, wenn alles bleibt, wie es ist. Für mich ist das unerträglich, ich lebe im Fluss.
Und ich langweilte mich unendlich mit diesem Papierkram, den ich tagein tagaus zu erledigen hatte. Vieles kam mir überflüssig vor, aber wie gesagt, das wollte ja keiner wissen. In mir breitete sich das Gefühl aus, einer völlig sinnentleerten Tätigkeit nachzugehen. Ich verschwendete meine Tage, ja, mein ganzes Leben damit.
Und in dieser Phase des emotionalen Stillstands, da entdeckte ich eine Anzeige im Sonntagsreport Leer. Das war eine kostenlose Zeitung, die wöchentlich erschien. Man suchte freie Mitarbeiter, die Lust am Schreiben sowie Fotografien hatten. Oh ja, ich hatte beides. Immer wieder las ich diese Anzeige und träumte davon, bei dieser Zeitung zu arbeiten. Es verhieß Spannung, zu Terminen zu gehen, darüber zu berichten, was in der Region los war. Ich hatte mich ja schon nach der Schule bei der Ostfriesen-Zeitung als mögliche Volontärin vorgestellt, was leider nicht geklappt hatte.
Jetzt, mit Ende dreißig war ich aber soweit, dass ich es endlich machen wollte. Ich wollte schreiben. Für eine Zeitung. Unbedingt. Also schrieb ich schnell eine kurze Bewerbung und legte sie mit klopfendem Herzen aufs Fax. Was sollte schon passieren, außer, dass es nicht klappte. Aber ich hatte endlich mal wieder etwas gewagt, um meinem Leben eine Wende zu geben. Ich wollte Dinge tun, die mir wirklich Spaß machten, und nicht nur mein Leben abarbeiten.
Die Antwort kam schnell. Man lud mich zu einem Probetermin ein. Danach war ich im Team. Das war im Jahr 2000. Ausgerechnet nach der Jahrtausendwende hatte ich mein Leben noch einmal neu gestartet. Ja, so kann man das wirklich sagen. Ich blühte förmlich auf. Meine Artikel waren gut und wurden gerne gelesen. Ein Redakteur nannte sie »Leitartikeltauglich«. Ich nahm alles wahr, was ging und war oft abends in der Woche unterwegs. Manchmal natürlich auch an den Wochenenden, wenn die Termine so lagen.
Zuhause vernachlässigte ich meine Aufgaben keineswegs. Und im Nachhinein frage ich mich schon, woher ich diese Power genommen habe. Es schien mir oft so, als habe mein Tag achtundvierzig Stunden. Und ich fühlte mich wieder. Ich war wieder im Spiel. Ich lernte Persönlichkeiten kennen, an die man als Normalo nicht so einfach herankommt.
In der Behörde meldete ich den Nebenjob, der mein Leben fortan ausfüllte, natürlich an. Mein Treiben wurde eher mit Argusaugen beobachtet. Es gab Kollegen, die das toll fanden, andere tuschelten hinter meinem Rücken. Mir war es egal. Eine Einzelgängerin war ich immer gewesen und nun machte ich auch noch als Journalistin Karriere. Mal eben so nebenbei, während andere ihren Behördenalltag in Kaffeebecher füllten.
Plötzlich liebte ich mein Leben wieder. Und ja, es mag sein, dass durch meine vielen Aktivitäten irgendwann das Familienleben zu kurz kam. Es lief natürlich nicht alles rund. Und dass ich immer öfter unterwegs war, kam nicht gut an. Um es milde auszudrücken. Im Nachgang weiß ich, dass ich wohl die einzige war, die sich über den Umstand, dass ich wieder glücklich war, oder wenigstens ein bisschen, gefreut hat. Alle anderen dachten wahrscheinlich, dass ich spinne. Nun, vielleicht tue ich das ja auch. Und das mache ich gerne.
Mein Sohn war immer öfter bei meinen Eltern. Aber ich denke nicht, dass es mit meinem Job bei der Zeitung zu tun hatte. Nein, eigentlich weiß ich es. Er fühlte sich bei seinem Stiefvater nicht wohl. Und auch seinen richtigen Vater sah er kaum noch. Es war alles sehr verzwickt.
Auf der anderen Seite erfüllte meine Mutter meinem Sohn jeden Wunsch. Er brauchte nicht mehr auf Geburtstage oder Weihnachten zu warten, um das nächste Spielzeug zu bekommen. Alles wurde ihm gekauft, er brauchte es nur zu äußern. Es ist sicher unnötig zu erwähnen, dass er sich mir immer mehr entfremdete. Was hatte ich dem noch entgegenzusetzen? Sobald die Ferien kamen, war er weg. Selbst, wenn ich Urlaub hatte, wollte er dann nicht mehr nach Hause kommen. Er nannte unser Zuhause Horrorhaus und meine Mutter lachte darüber. Das war wirklich hart für mich. Meinen Vater hatte ich ja schon mein Leben lang gemieden, jetzt kam auch der endgültige Bruch zu meiner Mutter. Natürlich, ich habe ihre Unterstützung auch oft freiwillig in Anspruch genommen.
Aber rechtfertigt das wirklich, der eigenen Tochter und Mutter, also mir, das einzige Kind abspenstig zu machen? Ich glaube nicht.
Irgendwie habe ich die Zeit überlebt, obwohl ich oft sehr traurig war.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752104776
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (Juli)
- Schlagworte
- Autobiografie Glück Berufung Kochen Lebenserfahrung Selbstfindung Liebe Glücklichsein