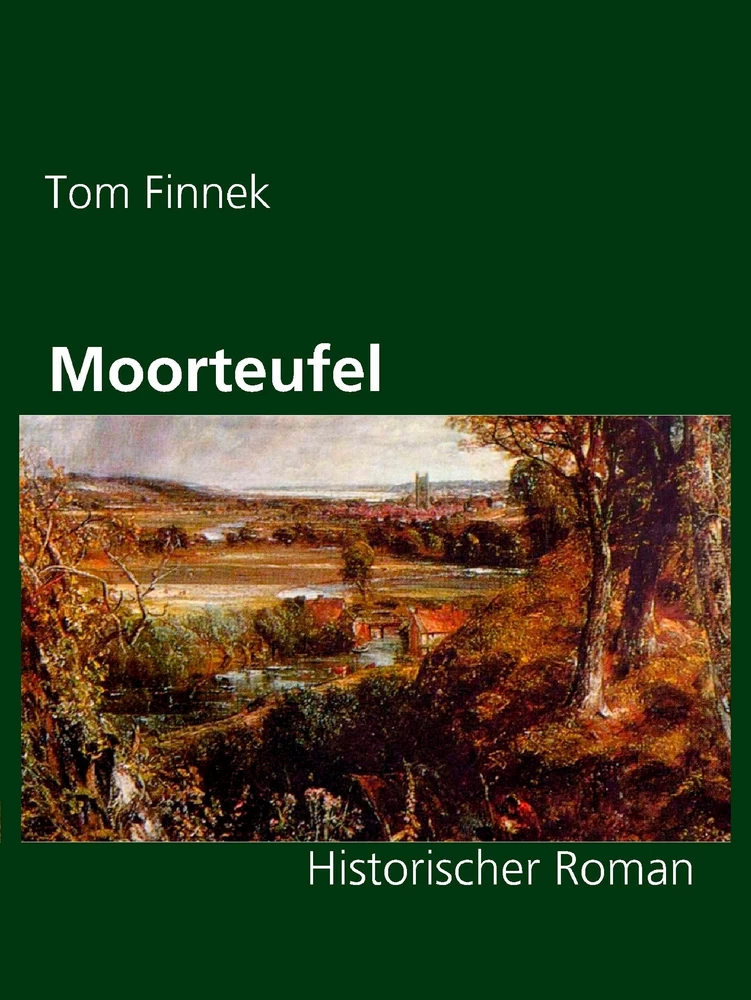Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Prolog
–
»Immerzu heißt es, erzähl und erzähl, und man kann sich nicht losmachen! Na schön, dann will ich erzählen, nur, bei Gott, das ist zum allerletzten Mal.«
Nikolai Gogol, »Der verhexte Platz«
–
Warum sitze ich hier bei flackerndem Kerzenschein in meiner Kammer und schreibe meine Geschichte nieder? Warum krame ich ohne jede Not in schmerzlichen Erinnerungen und gehe in Gedanken zurück in eine längst vergangene und verdrängte Zeit? Weshalb lasse ich die Toten nicht ruhen?
Ich wage nicht zu behaupten, dass der literarischen Welt etwas entgeht, wenn sie meine Erzählung nicht zu Gesicht bekommt, und ich bezweifle, dass sich die Historiker für das interessieren könnten, was ich zu berichten habe, dennoch drängt es mich, von den eigentümlichen und obskuren Ereignissen des Jahres 1814 zu erzählen. Ich bin ein alter Mann, meine Tage auf dieser Seite der Welt sind gezählt, und vielleicht ist mein naher Tod der eigentliche Grund, warum ich plötzlich den Mut aufbringe, diese Zeilen zu schreiben.
Beinahe sechs Jahrzehnte sind seit damals vergangen, wir schreiben mittlerweile das Jahr 1873, und kaum jemand erinnert sich noch an die Geschehnisse von einst. Weder an die Kriege gegen Napoleon*, an die blutigen Feldzüge, die ganz Europa fast zwanzig Jahre lang in Atem hielten, noch an die wilden und mörderischen Räuberbanden, die sich auf den Landstraßen und Handelswegen herumtrieben und für zusätzliche Aufregung und Angst sorgten. All das ist längst Geschichte und kann in historischen Büchern nachgelesen werden, zahlreiche Romane sind darüber geschrieben und lange Heldenepen verfasst worden. Napoleon wurde als glorreicher Führer verherrlicht oder als gottloser Dämon verdammt, und die Räuber wurden zu Volkshelden erkoren oder als Mördergesindel verteufelt. Meine Erlebnisse jedoch, obgleich eng mit diesen verbunden und kaum weniger zweischneidig, wird man vergebens in den Annalen suchen. Kein Mensch hat je von den Vorfällen der Stillen Woche des Jahres 1814 gelesen, niemand weiß, was sich tatsächlich in den Tagen vor Ostern in unserem kleinen westfälischen Dorfe Ahlbeck abgespielt hat.
Die unmittelbaren Zeugen der Vorfälle sind entweder tot oder nur bruchstückhaft, wenn nicht gar falsch unterrichtet. Einige sind seitdem verschollen oder untergetaucht, andere ziehen es aus gutem Grunde vor, sich nicht erinnern zu wollen. Den Nachgeborenen gegenüber habe ich mit keinem Wort etwas von den wahren Begebenheiten erwähnt, und nicht einmal meine Frau – Gott habe sie selig! – hat bis zu ihrem Tode vor wenigen Jahren die ganze Wahrheit erfahren (oder erfahren wollen). Niemand scheint sich für die tatsächlichen Umstände von damals zu interessieren. Wer sich Tag für Tag hart auf den Feldern abmüht und dennoch nicht weiß, wie er die zahlreichen Mäuler seiner Familie stopfen soll, der hat Besseres zu tun, als in der Vergangenheit zu wühlen und sich über weit Zurückliegendes den Kopf zu zerbrechen.
Natürlich gab und gibt es Gerüchte und überlieferte Erzählungen. Moritatensänger berichten von frevlerischen und ungesühnten Bluttaten, die alten Leute erzählen sich Spukgeschichten von ruhelosen Geistern im Moor, und die jungen Kerle singen in den Wirtshäusern Spottlieder auf den Krieg zweier Dörfer und einen übereifrigen und arg gedemütigten Amtmann. Erst gestern kam mir ein solches Verslein zu Gehör:
»In den Krieg mit hundert Knappen
zog der Amtmann stolz voraus.
Still und leise, auf gerettet’ Rappen,
kehrt er geschlagen bald nach Haus!«
Jene Spötter, die sich heute an solchen Liedern ergötzen, haben nicht die mindeste Ahnung, was sich damals vor sechzig Jahren tatsächlich zugetragen hat und welche unselige Rolle ich bei dieser Angelegenheit spielte.
Mein Name ist Jeremias Vogelsang, aber alle im Dorfe nennen mich den »Magisterbauern«, da ich mich beinahe ein halbes Jahrhundert lang als kleiner Kötterbauer wintertags, wenn die nicht so reichliche Arbeit auf dem Hof es zuließ, damit abgemüht habe, den Kindern in der Dorfschule das Alphabet, den Katechismus und das Einmaleins beizubringen. Bereits mein Vater und mein Großvater waren Magisterbauern gewesen und hatten es sich zur Aufgabe gemacht, für ein wenig Bildung unter den Dorfkindern zu sorgen, und ich habe diese Familientradition bereitwillig und mit Freude fortgeführt. Die freiwilligen Spenden, die die Eltern ihren Kindern, je nach Vermögen, zum Unterricht mitgaben, halfen mir, die spärlichen Erträge des Kottens aufzubessern, und die Arbeit mit den Jungen und Mädchen bereitete mir seit jeher großes Vergnügen. Aus den naseweisen Lümmeln wurden mit den Jahren wackere und tüchtige Landleute, und sie lüpfen heute ihre Hüte, wenn sie mich sehen, und wünschen dem »Herrn Magister« einen guten Tag.
Seit einigen Jahren bereits, seit es einen hauptberuflichen Lehrer an der Ahlbecker Schule gibt, unterrichte ich nicht mehr, und den Hof führt mittlerweile mein ältester Sohn, aber für alle im Dorfe werde ich der Magisterbauer bleiben, solange ich lebe. Ich bin mir nicht sicher, ob sie ebenso respektvoll und sogar dankbar von mir oder über mich reden würden, wenn sie wüssten, was sich damals in der Stillen Woche wirklich abgespielt hat. Wenn sie zu lesen bekämen, was ich hier niederschreibe.
Zu meiner Zeit als Magister habe ich den Schülern gern und häufig Geschichten erzählt, seien es Sagen des klassischen Altertums, Legenden der Heiligen oder Gleichnisse aus der Bibel. Dabei musste ich die traurige Feststellung machen, dass die Aufmerksamkeit der Kinder in gleichem Maße stieg, wie die Blutrünstigkeit der Geschichten zunahm. Die Tragödie des Ödipus oder die Ermordung Abels durch seinen Bruder Kain weckten weit mehr Interesse als die Hochzeit zu Kanaan oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Kreuzweg zum Hügel Golgatha fand weitaus mehr Anklang als die tröstlichen Worte der Bergpredigt. Verbrechen und Bluttaten, so scheint es, erfreuen sich ebenso ungebrochener wie unfasslicher Beliebtheit. Und wer weiß, vielleicht wäre auch meine Geschichte nach diesem schauerlichen Geschmack, denn auch sie ist die eines Verbrechens.
Ich bin mir durchaus bewusst, dass es nicht ganz einfach sein wird, mein heutiges Wissen zurückzuhalten und in der Erzählung nicht auf Dinge vorzugreifen, die ich damals noch nicht ahnen konnte. Dennoch möchte ich auf den folgenden Seiten versuchen, mich nur an die Tatsachen zu halten und die Geschehnisse so wiederzugeben, wie sie sich mir in der jeweiligen Situation darstellten. Ich werde mich bemühen, jedwede Schlussfolgerung zu unterlassen, die ich zwar aus heutiger Sicht ziehen kann, die ich in der damaligen Situation aber nicht zu ziehen in der Lage war. Um wirklich zu verstehen, was vor sechzig Jahren passiert ist, genügt es nicht, allein das wiederzugeben, was ich heute weiß. Es ist ebenfalls nötig, das zu erzählen, worin ich einst irreging. Denn nur so kann ich hoffen, dass meine traurige Geschichte – so sie denn jemals anderen zu Ohren kommt – mehr sein wird als blanker Nervenkitzel.
Doch genug nun der Vorrede und der Ausflüchte. Was ich zu erzählen habe, das soll erzählt werden – der Reihe nach und wahrheitsgemäß.
Erster Teil
–
»Es war einmal eine Frau, die so gern ein winzig kleines Kind haben wollte, aber sie wusste gar nicht, woher sie es bekommen sollte. Da ging sie zu einer alten Hexe und sagte zu ihr: ›Ich möchte so herzlich gern ein kleines Kind haben. Kannst du mir nicht sagen, woher ich das bekommen kann?‹«
Hans Christian Andersen, »Däumelinchen«
–
1
Es war der Dienstag vor Ostern, ein ungemütlicher, feuchtkalter Frühlingstag im April. Seit den frühen Morgenstunden war ein feiner, aber steter Nieselregen niedergegangen und hatte die Wiesen morastig und die sandigen Wege glitschig werden lassen. Der Himmel war düster und wolkenverhangen, und kurz nach Mittag hatte dichter Nebel eingesetzt, der nun wie Rauchschwaden über dem Boden hing und die Sicht zusätzlich behinderte. Die Wacholderheide lag wie ausgestorben da, sämtliche Tiere hatten sich verkrochen, keine Biene summte, kein Falter flatterte, und selbst die Frösche am Weiher hatten ihr Quaken eingestellt. Kein Mensch war weit und breit zu sehen, keiner außer mir!
In gebückter Haltung und gestützt auf einen morschen Knüttel machte ich meine Runden um den kleinen Teich, der am Fuße einer hohen und lang gestreckten Düne lag und vom Pfad aus nicht zu sehen war. Meine Filzmütze war mittlerweile vom Regen durchnässt, und der ebenfalls klamme Umhang aus dichtem schwarzen Drillich hielt mich nicht länger davon ab, vor Kälte und Nässe zu zittern. Ich bückte mich und beschaute mein Spiegelbild auf der Oberfläche des Wassers. Mein Gesicht war käsebleich, allein die Nase und die leicht abstehenden Ohren waren vor Kälte rot angelaufen.
»Wo bleibt sie nur?«, murmelte ich und blickte zum grauen Himmel, als könnte ich die dichten Wolken durchdringen und am Stand der Sonne erkennen, welche Tageszeit es mittlerweile sei. Es war bereits eine gute Stunde über die verabredete Zeit, schätzte ich, und diese Unpünktlichkeit sah Lotte gar nicht ähnlich. Seit einigen Wochen trafen wir uns nun jeden Dienstag um die gleiche Zeit am »Seerosenteich«, unternahmen lange Spaziergänge über die Sandflure und durch die Weidendickichte rings um den Weiher, und noch nie war sie zu spät gekommen. Wenn ihr nur nichts zugestoßen war!
Unheil ahnend verließ ich meinen bereits tief ausgetretenen Rundweg um den Teich und stapfte durch den weißen, rutschigen Dünensand, hielt mich an Wacholderheiden und gelb blühenden Ginsterbüschen fest, um die Anhöhe der Düne zu erreichen, von der aus ich sowohl den Weg als auch den Teich im Auge zu behalten glaubte. Als ich jedoch den Hügel erklommen hatte, musste ich ernüchtert feststellen, dass von meinem neuen Standpunkt aus weder der Pfad noch das Gewässer zu erblicken war. Nichts als Dunst und Nebel und Dunkelheit.
»Lotte!«, rief ich zaghaft und ängstlich, doch als Antwort rief mich lediglich ein Käuzchen an, das auf einem Kiefernzweig saß und auf Beute lauerte. Unverzagt schaute ich in die zunehmende Dunkelheit und wusste, dass ich nicht länger warten konnte. Wenn ich zum Melken der Kühe nicht zurück auf dem Bauernhof war, würden meine Eltern kaum Verständnis dafür aufbringen können. Was ich in den Nachmittagsstunden nach getaner Stall- oder Feldarbeit tat und zu welchem Zweck und mit wem ich mich in der Gegend herumtrieb, schien sie nicht weiter zu interessieren. Sie tauschten allenfalls vielsagende Blicke aus, als hätten sie einen bestimmten Verdacht. Aber nie fragten sie nach, wenn ich wortlos meinen Wanderstab ergriff und den Filzhut aufsetzte. Sollte ich jedoch meine Pflichten auf dem Hof vernachlässigen, so würde dies unweigerlich Ärger heraufbeschwören.
»Sie kommt nicht mehr«, murmelte ich und wischte mir die Nässe aus dem Gesicht. Ich schlotterte mittlerweile am ganzen Körper, mir war elend zumute, und eine Art Fieber hatte mich ergriffen. Ich spürte den Regen nicht mehr, auch die Kälte nicht. Und immer wieder murmelte ich: »Sie kommt nicht.«
Schweren Herzens machte ich mich schließlich auf den Heimweg, stiefelte mühsam durch die Heide in Richtung Ahlbeck und erkannte kaum den Boden zu meinen Füßen. Der Weg war lediglich ein Trampelpfad von wenigen Ellen Breite, hier und da von Heidekraut überwuchert und von Baumwurzeln der umstehenden Kiefern durchzogen, über die ich immer wieder stolperte. Es war inzwischen stockfinster, und es fiel mir schwer, mich zu orientieren.
Ich dachte ich an die Zeit zurück, als Lotte und ich uns kennengelernt hatten. Zu Beginn des Jahres hatte ich meine Mutter mit dem Einspänner zu dem etwa eine Meile entfernten Nachbarort Oldendorf chauffiert. Sie hatte von der Frau des Amtmannes Boomkamp den Auftrag erhalten, für deren Tochter ein Abendkleid zu nähen. Vor ihrer Heirat und bevor es sie ins Münsterland verschlagen hatte, war meine Mutter eine talentierte Schneiderin aus dem Hannoverschen gewesen, und sie nahm auch heute von Zeit zu Zeit noch Aufträge an, um zusätzliches Geld in die Haushaltskasse zu bekommen. Während meine Mutter bei dem »Fräulein Lieselotte« – wie sie uns vorgestellt worden war – Maß nahm, starrte ich die Amtmannstochter wie ein Wesen aus einer fremden Welt an. Ihre Augen waren leuchtend blau, die Nase gerade und spitz, die Lippen voll, und ihre lockigen hellblonden Haare umrahmten ein etwas blasses, aber unbeschreiblich anmutiges Gesicht. Sie lächelte mir verschämt zu und bekam rote Wangen, während sie sich gleichzeitig mit meiner Mutter über die belanglosesten Dinge unterhielt. Die ganze Zeit sprach ich kein Wort und stierte sie nur an, sodass meine Mutter mich anschließend rügte und fragte, warum ich so unhöflich gewesen sei.
Als das Abendkleid, ein leuchtend rotes, mit Spitzen besetztes Kleid aus Seide und Samt, nach drei Wochen fertiggestellt war, brachte ich es nach Oldendorf und hatte die Gelegenheit, das hübscheste und vornehmste aller mir bis dahin begegneten Mädchen ein zweites Mal zu sehen. Diesmal empfing mich das Fräulein Lieselotte bereits mit dem verschämten Blick und den roten Wangen, und wir hatten die Gelegenheit, einige Worte miteinander zu wechseln. Sie bat mich, sie »Lotte« zu nennen, das sei viel hübscher und im Übrigen habe sie vor kurzem ein fürchterlich trauriges Buch gelesen, in dem die arme Heldin ebenfalls Lotte geheißen habe. Ich war so aufgeregt, und mein Herz schlug derart wild, dass ich lediglich zusammenhangslos daherstammelte und ungelenk in der Gegend herumstand. Doch als ich mich wenig später anschickte, das Haus zu verlassen, und ihr die Hand reichte, schob sie mir einen Brief zu und lächelte ein reizendes und zugleich verschrecktes Lächeln, als wäre ihr selbst nicht geheuer, was sie gerade tat. Den Inhalt des ebenso zauberhaften wie kurzen Schreibens werde ich nie vergessen:
»Kommst du morgen um drei zum Seerosenteich?«, las ich, kaum dass ich mich auf den Heimweg gemacht hatte, und mein Herz hüpfte vor Freude. »Ich erwarte dich am Fuße der großen Düne. L.«
Zwar wunderte ich mich, dass Lotte nicht einfach mit mir gesprochen hatte, schließlich waren wir zu dem Zeitpunkt allein im Zimmer gewesen und niemand hätte uns belauschen können. Aber, so erklärte sie mir später, Briefe seien viel romantischer.
Aus dem einmaligen Treffen waren mittlerweile wöchentliche Stelldicheins geworden. Jeden Dienstag Nachmittag trafen wir uns am Teich, gingen spazieren, redeten flüsternd miteinander und hielten uns an der Hand. Ort und Zeit waren mit Bedacht gewählt. Die Heide lag genau in der Mitte zwischen den beiden Dörfern Ahlbeck und Oldendorf, und Lottes Eltern wähnten ihre Tochter zu diesem Zeitpunkt in der nahegelegenen Stadt Altheim bei einer alten Dame zum Musikunterricht. Niemand außer uns beiden kannte unser süßes Geheimnis.
Ich fuhr aus meinen Gedanken auf, blickte mich um und stellte mit Schrecken fest, dass ich vom Pfad abgekommen war und mich mitten in der Heide befand. Ringsum nichts als Wacholdergebüsch, Heidegras und Sand. Ich hatte Zeitgefühl und Orientierung verloren und wusste nicht, wie lange ich gedankenversunken dahergeirrt war und in welche Himmelrichtung ich meine Schritte nun lenken sollte. Kein Stern war zu sehen, der Nebel war undurchdringlicher denn je. Ich wollte bereits einen gotteslästerlichen Fluch gen Himmel schicken, als ich in einiger Entfernung ein Licht in der Heide sah. Ich näherte mich und erkannte ein Lagerfeuer. Ein Schäfer hatte es sich dort unter einem steinernen Unterstand gemütlich gemacht und röstete eine Kartoffel über dem Feuer. Er hatte einen breitkrempigen Lederhut tief ins Gesicht gezogen und war so mit sich und seiner Tätigkeit beschäftigt, dass er mich nicht wahrnahm. Sein schwarzer Schäferhund lag zu seinen Füßen, und die Schafe standen ringsum aneinandergedrängt und reglos im Nieselregen.
Plötzlich hörte ich Pferdegetrappel dicht hinter mir. Der Nebel und der weiche Heideboden hatten die Geräusche des herannahenden pechschwarzen Pferdes dermaßen gedämpft, dass ich es erst hörte, als es beinahe schon über mich hinweggaloppierte. Im letzten Moment konnte ich mich zu Boden werfen und hinter einen Ginsterbusch, rollen. Der Reiter schien mich nicht gesehen zu haben, er ritt schnurstracks weiter und gab seinem Gaul die Sporen. Als er jedoch das Lagerfeuer erblickte, zog er heftig an den Zügeln und rief: »Hü!« Das Pferd schnaubte und blieb schliddernd auf dem glitschigen Untergrund stehen.
»He, du da!«, rief der Reiter dem Schäfer zu, wartete einen Moment, bis dieser aufschaute, und stieg dann, da der Angesprochene nicht reagierte, von seinem Tier ab. Auf dem Kopf trug er einen Dreispitz mit einer riesigen Fasanenfeder, und seine rosigen Wangen zierte ein buschiger Backenbart. »Heda, Schäfer!«, rief der Mann. »Wie komme ich von hier aus nach Ahlbeck? Ich scheine vom Weg abgekommen zu sein.«
Der Schäfer antwortete nicht auf die Frage, schaute nicht einmal auf und war gerade mit Fleiß dabei, eine geröstete Kartoffel zu pellen. Nur der Hund zu seinen Füßen sprang auf, gab jedoch – wie sein Herrchen – keinen Laut von sich.
»Bist du taub?«, rief der Mann mit der Fasanenfeder. »Mach den Mund auf! Wie komme ich am schnellsten zum Ahlbecker Venn? Zum Bauern Schulze Lanvermann?«
Der Schäfer hob seinen Kopf, und unter der Krempe seines Hutes kam ein langer schwarzer Bart und eine riesige und runzlige Knollennase zum Vorschein. Im Gesicht des Bärtigen war ein listiges Grinsen zu erkennen, als er sagte: »Setz dich hin. Willst du einen Erdapfel haben?«
»Was soll ich denn damit?«, entgegnete der Reiter.
»Essen!«, lautete die Antwort des Schäfers.
»Ich habe keinen Hunger, ich will zum Bauern Lanvermann! Zu eurem Dorfschulzen! Kannst du mir sagen, wie ich auf den Weg zurückfinde?«
»Was bist du denn gleich so kiebig?« Der Mann am Lagerfeuer war nicht aus der Ruhe zu bringen, tätschelte seinem Hund den Rücken und lächelte ein ebenso zahnloses wie lausbübisches Lachen. Trotz der fehlenden Zähne schätzte ich den Mann auf höchstens fünfzig Jahre, vielleicht sogar jünger. Zwar war sein Gesicht wettergegerbt und die Haut welk, aber sein Blick war hellwach, und die Augen blitzten wie die eines jungen Mannes.
»Ich bin nicht kiebig, ich habe es nur sehr eilig!«, rief der Mann mit dem Dreispitz, stieg wieder auf sein Pferd und hantierte ungeduldig mit den Zügeln, sodass das Tier nervös auf der Stelle trat und die Nüstern aufblähte.
»Du bist ein Oldendorfscher, was? Hurtig wie die Bienen und ebenso reizbar.« Abermals zeigte der Schäfer seine zahnlosen Kiefer und lachte herzhaft. »In Ahlbeck sind wir nicht so flink.« Er untermalte seine Worte, indem er die Silben dehnte und anschließend gähnte.
Dem Mann auf dem Pferd wurde es nun zu bunt. Er richtete sich in seinem Sattel auf und posaunte: »Ich bin der Amtmann Boomkamp. Würdest du mir also bitte den Weg zur holländischen Grenze weisen?«
Bei diesen Worten fuhr es mir durch Mark und Bein. Ich zuckte zusammen und musste mir auf die Lippe beißen, um keinen Mucks von mir zu geben. Lottes Vater! Auf dem Weg zum Bauern Schulze Lanvermann! Es lief mir heiß und kalt über den Rücken.
»Was ist nun?« Majestätisch thronte er auf seinem Pferd und harrte stoisch einer Antwort. »Willst du dem Amtmann nicht antworten?«
»Was du nicht sagst«, antwortete der Schäfer, der ebenfalls zusammengezuckt war. »Amtmann Boomkamp!« Das schelmische Grinsen war mit einem Mal aus seinem Gesicht verschwunden, und stattdessen glaubte ich so etwas wie Vorsicht, wenn nicht gar Furcht darin lesen zu können. »Wenn Ihr wirklich der Amtmann seid«, sagte er schließlich zögerlich, »dann solltet Ihr den Weg zum Bauern Lanvermann eigentlich kennen.«
»Natürlich kenne ich den Weg«, wetterte Boomkamp, »aber ich habe dir doch gerade erklärt, dass ich vom Pfad abgekommen bin und mich verirrt habe. Ist das denn so schwer zu begreifen?«
»Schreckliches Wetter, nicht wahr?«, erwiderte der Schäfer, als hätte er die Worte des Amtmannes tatsächlich nicht verstanden. »Da schickt man keinen Hund vor die Haustür. Und schon gar keinen Amtmann!«
»Das Wetter?!«, unterbrach ihn der andere, der nun gänzlich die Geduld verlor und unruhig auf dem Sattel hin und her rutschte. »Willst du mich auf den Arm nehmen, oder bist du so dumm, wie du tust?!«
»Warum denn gleich brüllen? In Ahlbeck sind wir eben nicht so helle«, antwortete der Schäfer, betrachtete sein Gegenüber misstrauisch aus den Augenwinkeln, senkte aber sofort wieder den Blick, als wäre es ihm unangenehm, dem Amtmann in die Augen zu schauen. Er widmete sich erneut voller Inbrunst seiner Kartoffel. Auch der Hund legte sich wieder hin und schien den Mann mit dem Pferd nicht länger zu beachten.
Boomkamp spuckte gar nicht amtmännisch auf den Boden, gab seinem Rappen einen Tritt in die Seite und galoppierte verärgert davon. »Verdammtes Bauernpack«, hörte ich ihn noch keifen, als der Nebel ihn längst hatte unsichtbar werden lassen. »Das Moor soll euch schlucken! Ihr Ahlbecker werdet euch noch umschauen, das verspreche ich euch!«
Ich lag regungslos hinter meinem Ginsterbusch und versuchte, meiner Aufregung Herr zu werden. Mein Herz pochte wie wild, und der kalte Schweiß stand mir auf der Stirn. Ich bemühte mich, ruhig zu atmen und nachzudenken. Was hatte Boomkamp mit dem Ahlbecker Dorfschulzen zu schaffen? Warum galoppierte er deswegen bei Nacht und Nebel durch die Heide?! Und plötzlich wusste ich, warum Lotte nicht wie verabredet am Teich erschienen war. Man hatte sie ertappt! Das war die einzige Erklärung. Womöglich war der Amtmann durch Zufall der Musiklehrerin begegnet und hatte von ihr erfahren, dass seine Tochter seit Wochen nicht mehr zum Unterricht erschienen war, oder man hatte Lotte auf dem Weg zur Heide gesehen. Sie haben sie ertappt, schoss es mir durch den Kopf. Daran konnte für mich kein Zweifel bestehen. Und jetzt war ihr Vater auf dem Weg nach Ahlbeck.
»Und du brauchst dich auch nicht länger zu verstecken!«, rief der Schäfer plötzlich. »Kannst ruhig rauskommen!«
Wieder fuhr ich zusammen. Ich sah zu dem Mann am Lagerfeuer hinüber, der seine Haltung nicht geändert hatte. Doch obgleich er nicht zu mir herüber-, sondern unverwandt ins Feuer schaute, war offensichtlich, dass er mich mit seinen Worten gemeint hatte.
»Bist du bange?!«, fragte er und schaute auf. Sein Gesicht war nun wieder gänzlich ausdruckslos, weder grinste er noch blickte er finster drein.
Ich rappelte mich auf, klopfte den Dreck von meiner Kleidung und ging zögernd in Richtung des Schäfers, der mit seinem Stecken in der Glut herumstocherte.
»Setz dich hin!«, knurrte der Schäfer, wies auf einen Stein neben sich und hielt mir eine aufgespießte Röstkartoffel entgegen. »Willst du einen Erdapfel haben?«
»Danke«, sagte ich, nahm die Kartoffel, pellte sie und biss gierig hinein. Ich bibberte am ganzen Körper und war froh, mich am Feuer wärmen zu können. Der schwarze Hund nahm kurz Witterung auf, schnupperte an meinen Hosen und interessierte sich dann nicht weiter für mich.
»So gehört sich das«, sagte der Mann, lächelte nun wieder und fügte hinzu: »Wie heißt du?«
»Jeremias Vogelsang«, stellte ich mich vor.
»Vogelsang? Der Sohn vom Magisterbauern? Ich kenne deinen Vater«, erwiderte er und warf eine weitere Kartoffel in die Flammen. »Ich bin Kuckels Hermann.«
Wieder nickte ich und biss in meine Kartoffel. Sein Name war mir geläufig. Mein Vater hatte oft von dem »verrückten Kuckels Männsken« erzählt, der sich seit einigen Jahren mit seinen Schafen in der Gegend herumtrieb und dem allerhand merkwürdige und phantastische Geschichten angedichtet wurden. Es hieß, er lebe ein Einsiedlerleben in der Heide und im Moor, streiche einsam durch die Gegend und ziehe die Gesellschaft der Tiere denen der Menschen vor. Nie sei er länger als einen Tag am selben Ort und die Einsamkeit habe ihn zu einem seltsamen Kauz werden lassen. Im Winter verdinge er sich als Korbflechter oder ziehe von Hof zu Hof, um seine Dienste als Schlachter oder Abdecker anzubieten. Gesehen hatte ich dieses verschrobene Ahlbecker Original bislang jedoch noch nie und mitunter sogar angezweifelt, dass es ihn überhaupt gab.
Kuckels Hermann saß stoisch im Schneidersitz da, blickte ins Feuer, brummte zufrieden und kraulte abwechselnd seinen langen pechschwarzen Bart und das struppige Fell seines wohlig knurrenden Hundes. Er fragte nicht, warum ich mich vor dem Reiter hinter dem Gebüsch versteckt hatte. Er wollte nicht wissen, warum ich mich nächtens in der Heide herumtrieb. Es hatte beinahe den Anschein, als existierte ich für ihn gar nicht.
»Warum habt Ihr dem Amtmann den Weg nicht gewiesen?«, stellte ich schließlich die Frage, die mir die ganze Zeit auf der Zunge gelegen hatte.
Anstatt zu antworten, sah er mich unverwandt an, zog plötzlich die Stirn kraus und fragte: »Du bist einer von den Deserteuren, stimmt’s? Bist vor der preußischen Landwehr getürmt!« Er kicherte und setzte kopfschüttelnd hinzu: »Ja, ich habe davon gehört.«
Ich starrte ihn überrascht an, senkte dann den Blick und schwieg.
»Willst nicht darüber reden?«, setzte er nach, kicherte und gab mir einen Klaps auf den Rücken. »Kann ich verstehen.«
Ich zuckte mit den Schultern und sagte: »Die Preußischen haben Lose gezogen, um ihre Freiwilligenverbände aufzufüllen. Und ich habe verloren. Als die Truppe letzten Monat ausrückte, da habe ich mich nicht blicken lassen und etliche andere aus dem Dorf auch nicht!« Ich schnaufte ärgerlich und setzte hinzu: »Was ist denn das auch für eine Freiwilligkeit, zu der man per Losentscheid gezwungen wird!«
»Hast keine Lust auf den Krieg, was?«
»Soll ich etwa meine Eltern und den Hof im Stich lassen, nur um mit den Preußen gegen die Franzosen zu ziehen?«, erwiderte ich aufgebracht und fügte murmelnd hinzu: »Wir haben wahrlich andere Probleme!«
»Hast ja recht, mein Junge«, erwiderte der Schäfer und lächelte nachsichtig. »Was schert uns der Krieg gegen Napoleon? Sollen die feinen Herrschaften doch selbst ihre Kriege führen. Man weiß ohnehin kaum, wer gerade das Zepter schwingt. Ein einziges Kommen und Gehen.« Er wiegte den Kopf und setzte hinzu: »Da soll noch einer durchblicken.«
Den Worten des Schäfers konnte ich nur zustimmen. Im Münsterland hatten sich in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts die Herrscher die Klinke regelrecht in die Hand gegeben, die Revolutionen und Kriegswirren in Europa waren auch in unserem verschlafenen Bauernlande nicht ohne Folgen geblieben. Das einstige Fürstbistum Münster war im Jahre 1803 auf Drängen Napoleons säkularisiert worden und an weltliche Herrscher übergegangen. Das Sagen hatten fortan nicht mehr die Bischöfe gehabt, sondern die Fürsten zu Salm-Salm, diese waren zwar dem französischen Kaiser freundlich gesinnt gewesen, hatten allerdings nur wenige Jahre das fürstliche Zepter in der Hand halten dürfen. Im Jahre 1810 hatten die Franzosen dann kurzerhand das Münsterland annektiert und es sich in ihr großes und glorreiches Kaiserreich einverleibt. Sie hatten dem Landstrich ihre Verwaltung aufgepfropft und nach Gutdünken eigene Amtmänner eingesetzt. Ganze drei Jahre hatte dieses französische Zwischenspiel gedauert, bis Napoleon mit der Großen Armee den Feldzug gegen Russland gewagt, diesen schmählich verloren und sich schließlich auf die westliche Seite des Rheins zurückgezogen hatte. Den abziehenden Franzosen waren die siegreichen Preußen auf dem Fuße gefolgt. Abermals hatte sich die Herrschaft und der Name des Regenten geändert, und allmählich waren die münsterländischen Bauern dazu übergegangen, das Hin und Her der Fürsten, Könige und Kaiser wie das wechselhafte Wetter zu betrachten. Man nahm es als gottgegeben hin und versuchte, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen.
»Die Herrschaft wechselt nach Belieben«, sagte ich und wischte mir den Mund ab, nachdem ich den Rest der Kartoffel verschlungen hatte. »Aber für uns Kötterbauern ändert sich nicht das geringste. Was kümmert uns der Bischof Maximilian, Fürst Constantin, Kaiser Napoleon oder König Friedrich Wilhelm der soundsovielte? Der Grundherr und Landeigner bleibt doch immer der gleiche, und der heißt Schulze Lanvermann.«
»Schulze Lanvermann«, wiederholte der Schäfer und nickte mit dem Kopf. Das Lächeln verschwand aus seinem Gesicht, und seine Mundwinkel zuckten nervös. »Habe ich es doch gewusst!«, stieß er hervor, und damit schien für ihn alles Wesentliche gesagt. Mit einem Mal jedoch fuhr er auf, sah mich an, als erinnerte er sich an etwas, und sagte: »Du bist also der Vogelsang-Filius? Hast du gar keine Angst?«
»Angst?«, antwortete ich und schaute ihn verständnislos an. »Wieso?«
»Ich an deiner Stelle hätte Angst«, erwiderte der Schäfer, nickte wissend und setzte mit merkwürdig traurigem Unterton hinzu: »Ich habe auch einen Sohn, ungefähr in deinem Alter.« Er lächelte plötzlich entrückt und fragte: »Wie alt bist du?«
»Beinahe neunzehn.«
»Siehst du, das habe ich mir gedacht.« Er rieb sich die Runkelnase und setzte hinzu: »Alwin wird im nächsten Monat zwanzig Jahre alt. Ich muss mir ein Geschenk für ihn überlegen, er freut sich immer so, wenn ich ihm etwas mitbringe. Auch wenn er gar nicht weiß, wer ich bin. Er kennt mich ja gar nicht, weil ich ihm nie unter die Augen trete. Das darf ich nicht.«
Ich stutzte und wartete auf Weiteres, aber er konzentrierte sich wieder auf die Kartoffel im Feuer und murmelte: »Zwanzig Jahre, eine lange Zeit.« Dann blickte er auf, betrachtete mich nachdenklich und meinte: »Schulze Lanvermann ist dein Grundherr. Als hätte ich es gewusst.« Er neigte bedächtig den Kopf und wiederholte flüsternd: »Habe ich es mir doch gedacht.«
Mein Vater hatte, wie ich mich jetzt erinnerte, einmal behauptet, Kuckels Hermann sei ein Spökenkieker, ein Geisterseher, und habe das zweite Gesicht. Mir allerdings erschien der Schäfer im Moment nur wie ein verwirrter und höchst eigentümlicher Sonderling, der unsinniges und dummes Zeug daherredete. Ich ließ mich durch seine wunderliche Art nicht beirren und wiederholte meine Frage von vorhin: »Warum habt Ihr dem Amtmann Boomkamp nicht geantwortet?«
»Von Franzmännern da halte ich nicht viel von«, antwortete er schließlich und spuckte ins Feuer, dass es zischte. »Und die oldendorfschen Franzmänner sind die schlimmsten von allen. Alles Verbrecher!«
»Seit wann ist Amtmann Boomkamp denn Franzose?«
»Der Welsche hat ihn doch erst zum Amtmann gemacht! Das ist gerade mal drei Jahre her. Und jetzt? Jetzt jagt er den Kaiserlichen hinterher, als hätte er nie was anderes getan. Verdammter preußischer Büttel!« Wieder spuckte er ins Feuer und setzte grummelnd hinzu: »Das ist ein Teufel, der Amtmann! Dem ist nicht zu trauen. Der ganzen Sippe nicht. Alles Teufel! Man muss sich überhaupt vor den Gendarmen in Acht nehmen!«
»Was kann der Amtmann so spät noch vom Bauern Lanvermann wollen?«, dachte ich laut. »Das ist doch seltsam, oder?«
»Er kommt euch holen!«, rief er und funkelte mich an. »Das ist sein schlechtes Gewissen, das sage ich dir. Wie ein Fähnchen im Wind und immer zum eigenen Vorteil, mal französisch, dann preußisch, und darum kommt er euch jetzt holen.« Er beugte sich zu mir herüber und flüsterte mir ins Ohr: »Mit seinen Gendarmen.« Er nickte und schüttelte dann eifrig den Kopf. »Das tun sie immer! Dann jagen sie dich fort oder sperren dich ein!«
»Was meint Ihr damit?«
Statt einer Antwort zog er sich den Lederhut über die Augen, senkte den Kopf, stocherte wieder mit dem Stecken in der Glut des niedergebrannten Feuers und deutete mit einer Kopfbewegung nach links. »Der Weg nach Ahlbeck, der ist gleich da vorne.« Mit irrem Lächeln im Gesicht fügte er hinzu: »Nicht mal einen Steinwurf von hier entfernt! Kannst du gar nicht verfehlen.«
Ich stand schwerfällig auf, wusste nicht, was ich von all dem halten sollte, und sagte: »Danke für die Kartoffel. Ich muss jetzt nach Hause. Die Eltern machen sich gewiss schon Sorgen.«
»Aber pass gut auf!«, rief er mir nach. »Es treibt sich allerlei fremdes Gesindel in der Gegend herum. Sei auf der Hut!«
»Was denn für Gesindel?«, erwiderte ich und wandte mich um.
Er schüttelte nur langsam den Kopf, spuckte in die glühenden Holzscheite und schien mich im gleichen Augenblick bereits vergessen zu haben. Er holte eine völlig verkokelte Kartoffel aus der Glut und fluchte zischelnd: »Schiete! Das kommt davon!«
–
2
Unser Bauernhof bestand neben ein paar Morgen Weideland und einigen Äckern nur aus einem kleinen und altersschwachen Häuschen, dessen Spitzdach mit einfachen Holzschindeln gedeckt war und dessen Wände aus gehärtetem Lehm gefertigt waren. Im hinteren Teil des Hauses befand sich die Wohnstube, die zugleich als Küche, Waschkammer, Wohnraum und Schlafzimmer für die Eltern diente. Zwei kleinere und nicht beheizbare Kammern wurden von uns Kindern als Schlafräume genutzt. Da sich unter dem Dach der Getreidespeicher befand und hier viel Platz nötig war, um Heu und Stroh zu lagern, waren die darunter liegenden Kammern sehr niedrig. Der vordere Teil des Kottens wurde von der Tenne beherrscht, einer großen Diele aus gestampftem Lehmboden, auf dem im Sommer das Getreide gedroschen wurde. An der Längsseite der Tenne befanden sich die Stalltrakte, in dem wintertags die Rinder untergebracht waren. Auch das Pferd hatte hier seinen Holzverschlag. Allein die Schweine hatten einen eigenen Stall auf dem Hof, direkt neben einem kleinen Schuppen für die Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Unser Kotten sah aus wie die meisten Höfe der Ahlbecker Pachtbauern, viel zu klein und gänzlich schmucklos, die Beengtheit – vor allem in der Wohnstube – führte zu einem heillosen Durcheinander. Die Wände der Stube waren rußgeschwärzt, und da es damals noch keine Schornsteine gab, musste auch bei bitterer Kälte das Fenster geöffnet werden, um den Rauch abziehen zu lassen.
Wie oft hatte ich die klamme Kälte, die durchdringende Feuchtigkeit und die betäubende Räucherluft in den Kammern verwünscht, wie oft hatte ich davon geträumt, in einem herrschaftlichen Haus oder doch wenigstens auf einem größeren Bauernhof zu leben! Doch so armselig und winzig der Kotten auch war, ich vermag kaum zu beschreiben, wie mein Herz vor Freude hüpfte, als ich an jenem Abend auf meinem Weg aus der Heide endlich am elterlichen Haus anlangte. Der windschiefe Lehmbau erschien mir in diesem Moment wie ein königlicher Palast. Ich wusste nicht genau, wie lange ich in der Dunkelheit herumgeirrt war und wie ich überhaupt zum Kotten zurückgefunden hatte. Mein Kopf dröhnte und schien platzen zu wollen.
Mein Vater wartete bereits vor der Tenne auf mich und versperrte mir den Weg. »Wo kommst du denn jetzt her?«, rief er und packte mich am Schlafittchen. »Verdammtes Blag, weißt du nicht, wie spät es ist?!«
Er war ein großer und stämmiger Mann von knapp sechzig Jahren mit krausem, nur an den Schläfen ergrautem Haar und buschigen Augenbrauen, unter denen seine dunkelbraunen Augen mich böse fixierten.
Ich stand mit gesenktem Kopf vor ihm auf dem Hof, und die Tränen liefen mir über die Wangen, ohne dass ich recht wusste, wieso.
»Hör auf zu flennen!«, schrie er nur noch lauter. »Das kann dir auch nicht helfen! Godverdori!«
Dass mein Vater gotteslästerlich fluchte, hätte mich warnen müssen, doch die Ohrfeige, die seinem Wutausbruch folgte, kam so unerwartet und war so heftig, dass sie mich von den Beinen riss und zu Boden schickte.
»Aber Heinrich«, hörte ich die Stimme meiner Mutter, die nun ebenfalls im Tor erschien. »Bist du denn verrückt? Schlägst ihn ja tot!«
»Rede keinen Unsinn, Frau!«, antwortete mein Vater, schüttelte den Kopf und zog eine Grimasse. »Der Bursche soll sich nicht so anstellen. Nichtsnutziger Lausebengel!« Er packte mich am Kragen und hob mich in die Höhe, als wäre ich aus Papier. »Das Vieh kann verhungern und im eigenen Mist versinken«, sagte er und hielt sein Gesicht direkt vor meinem. »Hauptsache, der Herr Sohnemann hat seinen Spaß, was?!«
»Entschuldige, Vater«, sagte ich leise und flehentlich. »Ich habe mich … im Nebel verlaufen … ich war … ich bin …« Verwirrt hielt ich inne, wusste nicht mehr, was ich sagen wollte, und sah meine Eltern ratlos an. »Es tut mir leid.«
Meine Knie schlotterten, und auch das Zittern meines Unterkiefers hatte ich nicht mehr unter Kontrolle. Meine Nase lief und war eiskalt, und meine Augen brannten wie Feuer. Mir war hundeelend, vor Scham und vor Kälte.
»O Gott, Junge! Was ist mit dir?«, sagte meine Mutter, nahm mich in die Arme und führte mich über die Tenne. Der Stallgeruch und die dampfende Wärme der Tiere schlugen mir wohltuend entgegen, ich atmete tief ein, und im gleichen Moment lief mir ein Schauer über den Rücken.
»Du wirst mir doch hoffentlich nicht krank?!«, rief meine Mutter besorgt. »Hast ganz glasige Augen. Lass mal deine Stirn fühlen. Ist ja ganz heiß. Kein Wunder, bist ja klitschnass! Was machst du aber auch für Sachen? Rennst den ganzen Tag im Regen herum, als wärst du nicht ganz richtig im Kopf. Was ist bloß in dich gefahren, Jeremias?«
»Völlig verweichlicht, der Bursche«, lautete der Kommentar meines Vaters. Er knallte das Tennentor zu und schüttelte erneut den Kopf. »Rotzlöffel!« Erst jetzt bemerkte ich den beinahe erleichterten Unterton in seiner Stimme. Es schien, als wäre er nicht so sehr aus Ärger als vielmehr aus Sorge so böse mit mir. Noch nie war ich ohne Ankündigung so lange und bis weit nach Sonnenuntergang ausgeblieben, und dass ich meine Pflichten auf dem Hof vergaß, sah mir ebenfalls nicht ähnlich. Vermutlich hatten meine Eltern sich ernsthafte Sorgen gemacht, und dies war auch der Grund gewesen, warum mein Vater vor der Tennentür auf mich gewartet hatte.
»Du gehst sofort ins Bett«, befahl meine Mutter, mit strengem Seitenblick zu ihrem Mann, und schob mich in meine Kammer, die direkt neben der Wohnstube lag. »Ab unter die Decke! Ich komme gleich und bringe dir was Warmes. Dann geht es dir morgen schon wieder besser!«
Meine beiden kleinen Schwestern standen in der Tür zur Nachbarkammer und verfolgten die Szene mit einer Mischung aus Neugier und Schadenfreude. Als unsere Blicke sich trafen, kreischte Mechtild, die jüngere der beiden, laut auf und lief aufs Zimmer. Maria, die ältere, sah mich stirnrunzelnd und mitfühlend an, sie schien etwas sagen zu wollen, schwieg dann aber und folgte dem Beispiel ihrer Schwester.
»Und dass mir das nicht noch mal vorkommt«, rief mein Vater mir nach, nun schon merklich ruhiger. »Dann setzt es eine Tracht Prügel!«
»Ja, Vater«, sagte ich und verschwand in meiner Kammer. Nebenan hörte ich die Mädchen kichern und flüstern und erneut kichern. Doch ich nahm kaum noch etwas wahr oder nur wie durch Watte. Ich entzündete die Nachtkerze und warf mich heulend aufs Bett.
Als meine Mutter wenig später mit Milchsuppe und Kräutertee ins Zimmer trat, hatte ich die nassen Sachen ausgezogen, mich bibbernd unter die Wolldecke gelegt und meine Tränen getrocknet. Sonst war ich keine solche Heulsuse, aber im Moment war mir schlicht nach Weinen zumute. Auch als Mutter sich auf die Bettkante setzte und mir die Tasse mit dem Tee reichte, hatte ich Mühe, meine Tränen zurückzuhalten.
»Es ist dieses Mädchen, nicht wahr?«, sagte sie.
Ich stierte sie sekundenlang an, wusste nicht was ich sagen sollte, und nickte schließlich mit dem Kopf. »Woher weißt du?«
»Ich bin auch nicht ganz auf den Kopf gefallen.« Sie tätschelte meine Wange, gab mir einen Kuss auf die Stirn, schaute mich sorgenvoll an und fragte: »Seit wann geht das schon mit euch?«
»Seit ein paar Wochen«, antwortete ich. »Aber wir haben nichts getan, dessen wir uns hätten schämen müssen!«
»Und warum habt ihr es dann heimlich getan? Du bist achtzehn Jahre alt. Glaubst du, wir würden es dir verbieten, dich mit Mädchen zu treffen? Du bist alt genug, um selbst zu wissen, was du tust. Viele Jungs in deinem Alter sind längst verheiratet und haben Kinder.«
»Lotte ist nicht wie die anderen Mädchen«, sagte ich und hielt die Hand meiner Mutter. »Nicht so ein albernes Kicherweib wie die Ahlbecker Trinen. Sie liest Romane und schreibt Gedichte. Wir sind am See spazieren gegangen und haben geredet und uns aus Büchern vorgelesen.«
»Und ihr arrangiert heimliche Treffen in der Wildnis, als wärt ihr selbst aus einem Buch entfleucht«, erwiderte sie, tätschelte meine Hand und ließ sie dann los. »Das wirkliche Leben ist nun mal nicht so romantisch, wie es in den Büchern zu lesen ist. Händchenhalten ist gewiss eine schöne Sache, aber sie macht nicht satt.«
Wieder konnte ich sie nur verwundert anstarren. Schließlich brachen die Tränen wieder hervor, und ich rief: »Es ist nun ohnehin alles vorbei!«
Meine Mutter presste die Lippen aufeinander und sagte: »Wer weiß, vielleicht ist es besser so.«
»Nur weil sie eine Oldendorfsche ist?«, ereiferte ich mich, fuhr im Bett hoch und verschüttete dabei den Tee.
Meine Mutter sprang auf, da ich ihr einen Teil der Flüssigkeit über den Kittel geschüttet hatte. »Ach was, Jeremias, deswegen doch nicht«, sagte sie kopfschüttelnd, während sie sich gleichzeitig die Flecken mit einem Tuch abwischte. »Sie ist eine Boomkamp«, sagte sie mit ernster Miene und ging zur Tür. »Vergiss das nicht! Sie ist die Tochter des Amtmannes, und du weißt genau, was das heißt!«
Ich nickte und legte mich wieder hin. Ich wusste es nur zu gut. Boomkamp war in seiner Eigenschaft als Amtmann zugleich Hauptmann einer Landsturmkompanie. Anders als die im Felde kämpfende Landwehr blieben die Landsturmmänner in der Heimat und dienten dort als Hilfsgendarmen. Eine ihrer Aufgaben bestand darin, die Fahnenflüchtigen dingfest zu machen. So kam es, dass der einst von den Franzosen eingesetzte Amtmann nun dafür zuständig war, die Deserteure ins Gefängnis oder in den Krieg gegen Napoleon zu schicken. Das alles war mir durchaus bekannt, aber ich wollte es nicht wahrhaben.
»Der Krieg wird bald vorbei sein«, beharrte ich deshalb, »und dann wird niemand mehr von der Fahnenflucht reden!«
Diese Worte entstammten nicht nur reinem Wunschdenken, sondern beruhten auf dem, was allerorts zu hören war. Die preußischen Truppen waren längst in Frankreich eingefallen und hatten, wie es hieß, vor wenigen Tagen die Stadt Paris zur Kapitulation gezwungen. Die Niederlage Napoleons war so gut wie besiegelt, und die Abdankung des Kaisers wurde sozusagen stündlich erwartet. Schon in Kürze würden die Landwehrtruppen nach Hause geschickt werden und der Krieg in Europa beendet sein.
»Wenn die Franzosen erst einmal geschlagen sind«, sagte ich mit Nachdruck, »dann wird kein Hahn mehr nach uns Deserteuren krähen.«
»Umso mehr Grund, nicht in der Gegend herumzustreunen, sondern dich versteckt zu halten, bis der Krieg beendet ist«, sagte meine Mutter und trat erneut ans Bett. »Oder hast du Lust im Gefängnis zu enden?«
Ich schüttelte den Kopf und sagte kleinlaut: »Natürlich nicht.«
»Hast du deiner Lotte erzählt, dass ihr Vater nach dir fahndet?«, setzte sie hinzu. »Weiß sie, dass du ein Deserteur bist?«
Ich senkte den Blick und schwieg betreten. Nein, das hatte ich nicht. Es hatte sich nicht ergeben, ich hatte mich nicht getraut. Außerdem hatten wir über Poesie geredet, nicht über Politik. Ich schüttelte den Kopf.
»Siehst du«, sagte meine Mutter, »und selbst wenn sie es wüsste und dich deswegen nicht gering schätzen würde, ihr Vater sähe das sicherlich ganz anders. Er wird niemals einwilligen und dich als Freier akzeptieren. Du bist ein einfacher Köttersohn, und sie eine Tochter aus gutem Hause. Das wird er niemals zulassen. Schlag dir das Mädchen lieber aus dem Kopf! Es ist besser so, glaube mir! Solche Leute sind nichts für unsereins. Da gehören wir nicht hin. Kannst du dir deine Lotte als gewöhnliche Bäuerin vorstellen? Und kann sie sich das vorstellen? Weiß sie, was es heißt, von morgens bis abends zu arbeiten, tagaus, tagein in dreckigen Kitteln und Holzpantinen an den Füßen herumzulaufen und nachts in klammen Betten zu schlafen?«
»Aber wir haben uns doch lieb«, versuchte ich einzuwenden.
»Das ist schön, mein Junge, das ist sogar sehr schön. Aber es ist leider nicht entscheidend!«
Ich starrte sie ungläubig an und sagte: »Aber du hast Vater doch auch aus Liebe geheiratet.«
»Ich war eine stellungslose Näherin ohne Heimat«, erwiderte sie und seufzte schwermütig. »Wenn ich deinen Vater nicht geheiratet hätte, wäre ich wahrscheinlich als niedere Gesindefrau auf einem großen Hof gelandet. Ich habe Heinrich mit Liebe geheiratet, aber nicht aus Liebe.« Sie lächelte müde und blickte versonnen zur Wand. »Ich bin deinem Vater zutiefst dankbar.«
Dankbar?, wunderte ich mich und stierte sie überrascht an. Mein Vater war ein ungehobelter westfälischer Bauer gewesen, zwar der Sohn des Magisters, aber eher ein sittenstrenger und gläubiger als ein gebildeter Mann und nicht eben das, was man gemeinhin einen hübschen Kerl nennt. Meine Mutter hingegen war als junge Frau eine wirkliche Schönheit gewesen, mit auffallend dunklem Teint und rehbraunen Augen. Zwar waren die ehemals glänzendschwarzen Haare inzwischen ergraut und ihre Wangen ein wenig eingefallen, aber auch jetzt noch war Mutter eine schöne Frau, und die Männer in Ahlbeck ließen es ihr gegenüber nicht an Bewunderung fehlen. Warum redete sie also von Dankbarkeit? Nur weil sie eine Zugereiste war? Und keine begüterte Bauerntochter?
Sie kniff erneut die Lippen zusammen, deutete auf die Suppe auf dem Nachttisch und sagte: »Iss jetzt!« Und dann ging sie hinaus.
»Was ist mit Jeremias?«, hörte ich auf der Tenne die Stimme meiner Schwester Maria. »Ist er krank?«
»Ja, Maria«, antwortete meine Mutter, »das auch.«
Ich lag auf dem Bett, löffelte zaghaft meine Suppe, starrte ins Nichts und hörte dem Trippeln der Mäuse zu, die sich auf dem Dachboden am Getreide gütlich taten. Ich schloss die Augen und sah Lottes Gesicht vor mir, ihre blonden Locken, ihren verschämten Blick, ihre roten Wangen, und ich hörte sie erzählen, von romantischen Geschichten, aufregenden Abenteuern und immerwährender Liebe. Allmählich glitt ich hinüber ins schwerelose Land der Träume …
Ein lautes Klopfen und aufgeregtes Schreien an der Tür ließ mich mit einem Mal aufschrecken und zusammenfahren. Bevor ich mich recht gefasst hatte und wusste, wo ich mich befand, wurde die Tür aufgerissen, und der Amtmann stürzte in die Kammer. Er schäumte vor Wut, fiel über mich her und packte mich an der Gurgel, dass ich nur mehr röcheln konnte.
»Verdammter Lump!«, schrie er mich an. »Was fällt dir ein, Schande über meine Tochter zu bringen?! Das wirst du mir büßen! Jetzt geht es dir an den Kragen!«
Ich versuchte, mich aus seiner Umklammerung zu befreien, aber es war zwecklos. Ich wollte schreien, aber kein Ton kam mir über die Lippen. Immer fester drückte er zu, ich rang nach Luft, wirbelte hilflos mit meinen Armen umher und konnte mich doch nicht aus dem Würgegriff winden. Das einzige, was ich mit den Händen zu fassen bekam, war die brennende Kerze auf dem Nachttisch. Sie fiel um und landete auf dem Boden. Es wurde dunkel.
Und dann wachte ich auf.
Mein Herz raste, ich saß senkrecht und nass geschwitzt im Bett und starrte zum Nachttisch, auf dem die Kerze immer noch brannte und auch die leere Suppenschüssel stand. Ich hatte allerhöchstens ein paar Minuten geschlafen. Angestrengt horchte ich nach draußen und wusste plötzlich, was der Grund für meinen Alptraum gewesen war. Ein Poltern war zu vernehmen. Es hörte sich an, als würde von außen an das Tennentor gehämmert. Ich stand auf und ging mit wackligen Knien zur Tür, und wahrhaftig – ein zweites Mal war das Klopfen laut und deutlich zu vernehmen. Ein Mann rief den Namen meines Vaters, und das Vieh auf der Tenne wurde unruhig. Ich hörte Schritte auf der Diele, sie entfernten sich, eine Tür knarrte, dann Stille. Und schließlich kamen die Schritte zurück, zwei Männerstimmen waren zu erkennen, ohne dass ich hören konnte, worüber sie sich unterhielten. Die eine Stimme redete ruhig und schnell, die andere antwortete brummig und missgestimmt. Ein Besucher zu so später Stunde? Träumte ich etwa immer noch? Begann der Alptraum wieder von vorne?
Die Tür zur Wohnstube öffnete und schloss sich, und die Stimmen verstummten. Es war mit einem Mal so still im Haus, als wäre ich die einzige lebende Seele darin. Verwundert hielt ich inne, lauschte noch einen Moment und versank dann in düstere Gedanken. Meine Zukunft erschien mir wie ein tiefer schwarzer Abgrund, und nichts konnte mich davor retten hineinzustürzen.
Ein Klopfen an der Zimmertür ließ mich zusammenfahren.
»Ja?«, rief ich verschreckt und schlüpfte zurück ins Bett.
Meine Mutter schaute zur Tür herein und sagte: »Ich habe Licht in der Kammer gesehen. Warum schläfst du noch nicht? Hat die Suppe nicht gutgetan? Willst du noch Tee?«
»Doch, nein, schon gut«, antwortete ich und beeilte mich hinzuzufügen: »Mir geht es schon viel besser.«
»Das ist brav, mein Junge. Und jetzt schlaf schön.« Sie lächelte und wollte sich zurückziehen.
»Mutter?«, rief ich ihr nach. »Haben wir Besuch?«
Sie verharrte auf der Schwelle, nickte und sagte: »Es ist Hubertus Wessendorf. Der Knecht vom Bauern Lanvermann.«
Ich erschrak und fragte alarmiert: »Was will er?«
»Ich weiß es nicht, er sitzt mit deinem Vater in der Stube.«
»Kommen sie mich holen?«, flüsterte ich atemlos. »Werde ich verhaftet?«
»Rede keinen Unsinn, Jeremias. Hier kommt niemand dich holen. Und Hubertus schon gar nicht. Leg dich schlafen, du brauchst deine Ruhe. Gute Nacht.« Sie lächelte nachsichtig und schloss die Tür.
Sie führen etwas im Schilde, dachte ich Unheil ahnend, löschte das Licht und wiegte mich in einen unruhigen und wenig tröstlichen Schlaf.
–
3
Ich erwachte zur üblichen Zeit, um halb sechs, und fühlte mich wie ausgewrungen. Draußen dämmerte es bereits, und die Vögel zwitscherten, als freuten sie sich auf den kommenden Tag. Es war der Krumme Mittwoch, und zum ersten Mal glaubte ich zu wissen, woher dieser Tag seinen seltsamen Namen hatte. Mühsam rappelte ich mich auf, rieb mir den Schlaf aus den Augen und schlurfte zur Kammer hinaus. Als ich die Stube betrat, wunderte ich mich, dass meine Mutter bereits bei der Arbeit war. Sie hatte die Schürze vorgebunden, trug ihre Haube auf dem Kopf, hatte den Küchenherd mit Stroh und Holz gefüllt und legte gerade einige Brocken schwarzen Torfs, den sogenannten Klün, auf das Feuer. Schwarze Rauchwolken hingen in der Stube und ließen mich husten.
»Morgen, Junge«, sagte Mutter, als sie mich erblickte. »Geht es wieder?«
Ich zuckte mit den Schultern, schaute in den Alkoven hinter dem Ofen, bemerkte die gemachten Betten und sah sie fragend an. »Seit wann seid ihr wach?«
»Gib mir mal das Eisen«, sagte sie statt einer Antwort und deutete in die Ecke des Raums, wo ein schwarz angelaufenes Kanteisen auf dem Boden lag.
»Hat das Kalb wieder Durchfall?«, fragte ich und reichte ihr das Gewünschte.
Sie nickte und steckte das Eisen in den Ofen. Dann nahm sie einen halb mit Wasser gefüllten Topf und stellte ihn auf die Herdplatte.
»Wo ist Vater?«, wollte ich wissen.
»Beim Melken.«
»Schon?«, erwiderte ich und stutzte. »Warum so früh? Weshalb habt ihr mich nicht geweckt?«
Bevor meine Mutter antworten konnte, trat mein Vater in die Stube, in der Hand einen kleinen Eimer voll Frischmilch, den er ihr nun gab. »Für das Kalb«, sagte er. »Der Rest ist schon draußen im Pütt. Kommst du heute noch zum Buttern?«
»Wenn der Rahm soweit ist«, antwortete meine Mutter, nahm den Eimer und schüttete einen Teil der Milch in den Wassertopf und verrührte das Ganze mit einem Holzlöffel, anschließend prüfte sie, ob das Eisen im Ofen bereits glühte.
»Guten Morgen, Jeremias«, sagte mein Vater schmunzelnd. »Na, du Poussierstengel, gut geschlafen? Schön geträumt?«
»Heinrich!«, sagte meine Mutter tadelnd. »Schandmaul!«
Mein Vater lächelte nur als Antwort und schwieg.
Ich beschloss, seine anzügliche Andeutung zu überhören, wunderte mich über das geschäftige Treiben und fragte: »Warum seid ihr heute so früh auf den Beinen? Was ist hier eigentlich los?«
»Dein Vater muss zum Lanvermann«, antwortete meine Mutter, holte das glühende Eisen aus dem Feuer und hielt es in die mit Wasser verdünnte Milch, bis diese angebrannt roch. Dann nahm sie den Topf vom Herd und ging mit ihm zur Tenne. »Ich kümmere mich um das Kalb«, sagte sie. »Wenn es die Milch getrunken hat, sollte sich das mit dem Durchfall erledigt haben.«
»Warum musst du zum Schulzen?«, fragte ich und sah meinen Vater irritiert an. »Was will er von dir?«
»Johann will die Kartoffeln stecken.«
»In der Karwoche?«, wunderte ich mich. »Ich dachte, er will erst nach Ostern damit anfangen. Zusammen mit den Runkeln. Warum die plötzliche Eile?«
»Ich weiß es auch nicht. Er scheint es sich anders überlegt zu haben.« Er setzte sich an den Tisch, schüttete einen Löffel Kaffee in eine Tasse und fragte: »Willst du auch? Ist echter Bohnenkaffee.«
Ich nickte, reichte ihm eine Tasse und fragte: »Soll ich mitkommen?«
»Davon hat Hubertus nichts gesagt, er hat nur mich aufs Feld bestellt. Bleib du nur hier, irgendjemand muss sich ja um den Kotten kümmern. Es ist ohnehin besser, wenn du dich nicht in der Öffentlichkeit zeigst.«
»Warum lässt du dir das gefallen?«, erwiderte ich und goss uns heißes Wasser aus dem Kessel in die Tassen.
»Was soll ich tun? Er ist der Grundherr und kann machen, was er für richtig hält.« Er schnaufte abfällig und fügte hinzu: »Wir Kötter müssen springen! Ob wir wollen oder nicht. Als Heuerlinge können wir uns nicht aussuchen, wann und wie wir für den Großbauern arbeiten wollen.«
»Als hätten wir vor Ostern nichts Besseres zu tun«, sagte meine Mutter, die in diesem Augenblick wieder die Küche betrat. »Karwoche ist Reinemachezeit, das war schon immer so. Das sollte selbst Johann Lanvermann wissen, aber er schert sich einen Dreck darum und führt ständig neue Sitten ein. Ganz wie es ihm in den Kram passt.« Auch sie setzte sich an den Tisch, goss sich Kaffee ein und schmierte ein paar Schmalzbrote, die sie uns reichte. »Lanvermann sollte sich was schämen!«, lautete ihr unmissverständlicher Kommentar. »Wir wären alle besser dran, wenn sein Bruder noch da wäre.«
»Lass das Lamentieren, Frau!«, sagte mein Vater. »Wir sollten froh sein, dass der Mörder über alle Berge ist.« Er bekreuzigte sich und steckte sich einige Schmalzbrote in die Tasche. »Die arme Frau! Gott habe sie selig.«
»Mag ja sein«, erwiderte Mutter und machte ebenfalls ein Kreuzzeichen auf ihrer Brust. »Ich habe nicht vergessen, was er der armen Irmgard angetan hat. Aber als Bernhard noch Grundherr war, ging es uns sehr viel besser. Er hat wenigstens gewusst, wie ein so großer Bauernhof geführt werden muss und wie man mit seinen Leuten umzuspringen hat. Ein grober Klotz, das mag schon sein, aber ein patenter Kerl! Er hat auch selbst mit angepackt und war sich nicht zu schade, die Forke in die Hand zu nehmen und bis zu den Knien im Mist zu stehen. Johann ist dafür viel zu vornehm und spielt lieber den feinen Pinkel. Der macht sich die Hände nicht schmutzig, gibt stattdessen Befehle und stolziert wie ein Pfau herum. Der alte Lanvermann würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er wüsste, was sich auf dem Hof abspielt.«
»Was nützt das Jammern«, erwiderte mein Vater. »Davon wird es nicht besser. Der Alte ist tot, der Bruder verschwunden, und der jetzige Schulze wird sich gewiss nicht mehr ändern.«
»Was Johann Lanvermann auf dem Bauernhof treibt, ist eine Schande«, beharrte meine Mutter. Sie schüttelte energisch den Kopf und wiederholte: »Er sollte sich was schämen! In den letzten Jahren ist der Hof vollends auf den Hund gekommen. Ein einziges Sodom und Gomorra!«
»Ich muss los«, sagte mein Vater achselzuckend, stand auf, nahm seinen Hut und wandte sich an mich: »Kümmerst du dich um das Vieh? Und bringst die Tenne auf Vordermann? Ich nehme das Pferd und versuche, zum Melken heute Abend wieder da zu sein.«
Ich nickte nur und starrte auf die Tasse in meiner Hand. Ich hatte das Gespräch meiner Eltern nur halbherzig verfolgt und hing meinen eigenen Gedanken nach. Ich versuchte, mir einen Reim auf die Ereignisse der letzten beiden Tage zu machen. Erst reitet der Amtmann bei Regen und Dunkelheit im Galopp zum Dorfschulzen, dachte ich, und wenig später taucht der Knecht des Schulzen bei uns auf und kommandiert meinen Vater für den folgenden Tag zu Heuerlingsdiensten auf den Schulzenhof. »Er kommt euch holen«, gingen mir die Worte des Schäfers durch den Kopf. »Das tun sie immer!«
Als meine Schwestern lärmend über die Dielen polterten und türenschlagend die Stube betraten, fuhr ich wie aus einem Traum auf und bemerkte, dass Vater das Haus bereits verlassen hatte.
»Morgen, Jeremias«, rief die kleine Mechtild erfreut und setzte sich mir gegenüber an den Tisch. »Bist du wieder gesund?«
»Ich war gar nicht krank«, antwortete ich. »Nicht wirklich.«
»Das verstehe ich nicht«, sagte Mechtild.
»Dafür bist du noch zu klein«, erwiderte ihre Schwester. Maria nahm neben mir Platz, lächelte schüchtern und nickte stumm. Sie war nicht nur namentlich das genaue Abbild unserer Mutter. Ihr Haar war rabenschwarz und der Teint dunkel, und vermutlich würde aus ihr eine ebenso schöne Frau werden. Mechtild hingegen glich eher unserem Vater und hatte von ihm die buschigen Augenbrauen geerbt.
»Still jetzt, alle beide!«, befahl unsere Mutter, faltete die Hände und sprach das Tischgebet: »Aller Augen warten auf dich, o Herr; du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine milde Hand und erfüllest alles, was da lebt, mit Segen.«
»Amen«, antworteten wir.
Während die Mädchen sich über die Schwarzbrote, die warme Milch und den Zichorienkaffee hermachten und sich dabei unentwegt zankten und von Mutter zurechtgewiesen wurden, schlich ich mich aus der Stube, zog meine Holzschuhe über und gab den Tieren zu fressen. Außer den Kühen und Kälbern auf der Tenne warteten auch die Schweine im Stall und die Hühner auf dem Hof auf das Futter. Ich verrichtete die Arbeit wie im Dämmerzustand, als wäre ich immer noch nicht wach, als wäre das Fieber in meinem Kopf noch nicht ganz vorüber.
Draußen war von dem Regen und dem Nebel des gestrigen Tages nichts mehr übrig geblieben. Ein leichter Morgendunst hing noch über dem Boden, aber am Horizont ragte bereits die Spitze des Ahlbecker Kirchturms aus dem Nebel hervor. Und die ersten Sonnenstrahlen lugten im Osten über die Wipfel des Buchenwaldes. Auch die Vögel trällerten vor Freude. Aprilwetter!
Während ich den Kuhstall ausmistete, die Tiere mit frischem Heu versorgte und den Boden fegte, horchte ich immer wieder auf Geräusche und Stimmen von draußen und fuhr zusammen, wenn eines der Rinder sich muckte oder unruhig mit den Hufen scharrte. Vor dem Haus hörte ich Maria und Mechtild, die in den Beeten das Unkraut jäteten oder sonstige Gartenarbeiten verrichteten und sich gegenseitig triezten und über den Mund fuhren.
»Doofe Pute!«, rief die kleine Mechtild aufgebracht. »Das ist wohl der Blödian vom Pättenbauern! Wetten?!«
»›Blödian‹ sagt man nicht«, antwortete Maria ernst. »Er kann doch nichts dafür! Außerdem ist er ein Verwandter!«
»Blöd bleibt blöd«, beharrte Mechtild. »Der guckt immer so komisch. Und die Spucke läuft ihm aus dem Mund.«
Neugierig verließ ich die Tenne und schaute den Weg zum Dorf entlang. Ich sah einen Jungen, der auf unseren Kotten zulief und aufgeregt mit den Armen fuchtelte.
»Das ist Wenzel«, erklärte Maria, als sie mich sah, »der Pättensohn!«
»Der nicht ganz richtig im Kopf ist«, fügte Mechtild hinzu.
»Er scheint ganz außer sich zu sein«, bemerkte ich und ging dem Jungen entgegen. »Hallo, Wenzel, warum rennst du denn so?«
»Mias?«, rief der Junge. »Mias hier?« Er blieb keuchend vor mir stehen, rieb sich die Hände, grinste ein ziemlich verrücktes und zugleich freudiges Grinsen und schaute durch mich durch, als nähme er mich gar nicht wahr. »Mias hier?«, wiederholte er seine Frage.
»Ich bin Jeremias. Das weißt du doch, Wenzel! Was ist denn los?«
»Ja, du Mias! Ich weiß!« Wieder lachte er, als hätte er einen Schalk im Nacken. Er gluckste vor Freude und klatschte in die Hände.
»Blödian«, hörte ich Mechtild hinter mir leise wispern.
Wenzel war etwa zwölf Jahre alt, aber er hatte den Verstand eines Dreijährigen. Es hieß, bei seiner Geburt seien Schwierigkeiten aufgetreten, und deshalb sei er geistig so zurück. Vielleicht liege es eher daran, so wurde im Dorf gemunkelt, dass der Pättenbauer damals seine Base geheiratet habe, um die beiden Erbhöfe miteinander zu vereinen. Und das »bekloppte Blag« sei die Strafe Gottes für die Blutschande. Zur damaligen Zeit war eine Heirat innerhalb der Familie gar nicht unüblich, selbst Halbgeschwister sollen in Einzelfällen vor dem Altar gestanden haben. Ob dies nun der Grund war oder nicht, auf jeden Fall gab es etliche geistig zurückgebliebene oder körperlich missgestaltete Kinder in Ahlbeck. Die wenigsten von ihnen bekam man jedoch zu Gesicht. Wenn sie nicht schon als Säuglinge »gehimmelt« und durch Verwahrlosung ins Jenseits befördert wurden, saßen sie zumeist den ganzen Tag in der Stube oder auf der Tenne und wurden von den Eltern vor den Nachbarn und Durchreisenden versteckt. Einige der Dörfler glaubten immer noch, bei den Kindern handele es sich um Wechselbälger, die von dämonischen Unholden in der Krippe vertauscht wurden. Allein der Pättenbauer, ein Vetter meines Vaters, schien sich seines schwachsinnigen Sohnes nicht zu schämen und ließ ihn wie einen normalen Jungen mit den zahllosen anderen Bälgern draußen herumtollen.
»Mias muss weg! Mias weg!«, rief Wenzel nun und fuchtelte wieder mit den Armen. »Papa sagt: Mias muss weg! Schnell! Die anderen auch! Alle!«
»Warum soll ich weg?«, fragte ich und hielt seine Arme, um ihn zu beruhigen.
Er jedoch schüttelte sie ab und deutete zum Kirchturm. »Viele Pferde, viele Leute! Papa sagt: Sandmann holen. Alle weg! Mias auch!«
»Was denn für ein Sandmann?«, fragte Maria und schaute mich irritiert an.
Ich zuckte mit den Schultern und konnte mir zunächst keinen Reim auf Wenzels Gestammel machen.
»Sandmann!«, rief Wenzel freudig.
Plötzlich dämmerte mir, was er sagen wollte. »Amtmann?«, rief ich aufgeregt. »Meinst du den Amtmann?«
»Sandmann, ja! Viele Männer, viele Pferde. Kirche!« Abermals lachte er sein schalkhaftes Lachen und wieherte anschließend wie ein Pferd.
»Gibst du ihm etwas zu essen und zu trinken«, wandte ich mich an meine Mutter, die nun ebenfalls durchs Tor schaute. »Ich will mal sehen, was los ist!«
»Nein, nicht gehen. Mias weg!«, versuchte Wenzel mich von meinem Plan abzubringen, doch die Aussicht auf ein Glas Milch und ein Schmalzbrot schien ihn zu sehr zu verlocken. Er ließ sich zunächst unter Protest, dann bereitwillig von Mechtild ins Haus führen.
»Du solltest besser nicht hingehen«, wandte sich Maria an mich und legte ihre Hand auf meinen Unterarm. »Der Pättenbauer wird schon seine Gründe haben, warum er den Wenzel geschickt hat.« Ihrem Gesicht war anzusehen, dass sie sich wahrhaftig Sorgen machte. Mit ihren dunklen Augen schaute sie mich mitleidig an, wie sie es schon am Abend zuvor getan hatte. »Bleib lieber, wo du bist. Wer weiß, was der Amtmann im Sinn hat.«
Die Beziehung zwischen mir und meiner Schwester Maria war eine sehr innigliche und vertraute. Maria hatte von uns drei Kindern sicherlich die undankbarste Rolle in der Familie. Während ich als Ältester zugleich der Stammhalter und Erbsohn war und meine Eltern allein deshalb schon stolz auf mich waren und die kleine Mechtild als drolliges Nesthäkchen und vorlaute Possenreißerin stets für Freude im Haus sorgte, stand Maria mit ihrer Ernsthaftigkeit und Reserviertheit zumeist in unserem Schatten. Vielleicht war dies der Grund, dass ich sie so ins Herz geschlossen hatte. Während andere Leute sie verstockt oder sogar mürrisch und übellaunig fanden und hinter ihrem Rücken über sie tuschelten, wusste ich, dass man sich auf Maria stets verlassen und in ihr den besten Freund haben konnte. Sie strahlte für ihre sechzehn Jahre eine erstaunliche Melancholie aus, deren Ursache ich niemals ergründen konnte. Selten lachte sie, und sie redete nur das Nötigste, aber sie kümmerte sich und machte sich Gedanken. Und sie sorgte sich ebenso um mich, wie ich versuchte, auf sie aufzupassen.
»Keine Bange«, versuchte ich die Bedenken meiner Schwester zu zerstreuen. »Ich werde schon keine Dummheiten anstellen oder etwas Unvorsichtiges tun. Ich passe auf mich auf.«
»Ich weiß nicht«, antwortete sie und drückte meine Hand. »Ich habe ein ungutes Gefühl.«
»Ach was«, rief ich lachend und versuchte zu überspielen, dass auch mir mulmig zumute war. »Was soll denn schon passieren?«
Wir sahen uns an und wussten beide im selben Augenblick, was der jeweils andere dachte. Ich zögerte noch einen Moment, riss mich dann los und marschierte los, um im Dorf nach dem Rechten zu sehen.
–
4
Die Gemeinde Ahlbeck bestand aus einem alten Dorfkern und zahlreichen Bauernschaften, die sich wie ein Ring großflächig um das winzige Zentrum legten. Das eigentliche Dorf bestand nur aus wenigen Häusern und kleineren Bauernhöfen, die entlang einer kopfsteingepflasterten und buchengesäumten Straße um die Kirche herum gruppiert waren. Die erst vor wenigen Jahrzehnten neu gebaute Kirche aus rötlichem Backstein mit ihrem niedrigen Turm und dem gedrungen und klotzig wirkenden Hauptschiff war der örtliche wie gesellschaftliche Mittelpunkt des Dorfes. Der alte Kirchturm auf der Westseite stammte noch aus dem fünfzehnten Jahrhundert und war mit seinem auffälligen Stufengiebel und den schießschartenähnlichen Fensteröffnungen zum Wahrzeichen und Wappenbild Ahlbecks geworden.
Auf der Südseite der Kirche, direkt vor dem mächtigen Hauptportal und im Schatten einer riesigen alten Linde, befand sich der kleine Marktplatz, welcher von ebenfalls backsteinernen Häusern gesäumt war. Das zweistöckige Pfarrhaus und die Dorfschenke mit dem passenden Namen »Zur alten Linde« befanden sich hier ebenso wie der einzige Schmied des Dorfes und der örtliche Leineweber. Da die Dorfbewohner zumeist Bauern und damit Selbstversorger waren, gab es in Ahlbeck weder Metzger noch Bäcker oder sonstige Lebensmittelgeschäfte. Auch einen Zimmerer oder Schneider suchte man vergeblich, die Bauern verrichteten derlei Handwerksarbeiten selbst und tauschten Güter und Leistungen, die sie nicht aus eigener Kraft herstellen oder erbringen konnten, untereinander aus. So wurde der Marktplatz seinem Namen eigentlich nicht gerecht und war kaum mehr als ein karges, gepflastertes Quadrat, auf dem sich sonntags nach dem Hochamt die Gläubigen zum nachbarschaftlichen Klatsch unter der Linde trafen, bevor sie ins Wirtshaus einkehrten und bei einem kühlen Humpen Bier den lieben Gott einen guten Mann sein ließen.
Ich näherte mich dem Dorf auf einem Feldweg von Westen her, und bereits von weitem war der Tumult auf dem Marktplatz zu erkennen. Dutzende Dorfbewohner strömten auf der Straße zusammen und liefen gemeinsam zur Kirche. Aufgeregte Stimmen allenthalben, Frauen fragten ihre Kinder, was denn um alles in der Welt geschehen sei. Männer ballten die Fäuste und drohten den Oldendorfschen Keile an. Ich schloss mich ihnen unauffällig an und sah schließlich vor dem Kirchportal den Amtmann Boomkamp, hoch zu Ross, den Dreispitz mit der Fasanenfeder auf dem Kopf und umgeben von einer ebenfalls berittenen Handvoll Gendarmen. Sämtliche Reiter trugen Uniform, und einige von ihnen hielten Musketen im Anschlag.
Vorsichtig und in geduckter Haltung entfernte ich mich von der Schar und schlich mich auf der Nordseite um die Kirche herum, um mich dem Geschehen aus östlicher Richtung zu nähern. Hinter der Kirche befand sich, auf einer kleinen Anhöhe gelegen, der von einer hohen Mauer umgebene Friedhof. Wenn ich mich an der Sakristei vorbeischlich und mich hinter einem Grabstein verbarg, konnte ich die Ereignisse mühelos verfolgen, ohne selbst gesehen zu werden.
»Ihr solltet Euch lieber um die Holländische Bande kümmern, Herr Amtmann«, hörte ich den Wirt Tenhagen rufen, »anstatt anständigen Bauersleuten hinterherzujagen!«
»Genau!«, pflichtete ihm ein anderer bei. »Die gottlosen Räuber laufen frei und unbehelligt herum, aber unsereins muss dran glauben!«
Die Tür zur Sakristei war verschlossen, aus dem Inneren waren keinerlei Geräusche oder Stimmen zu vernehmen. Erleichtert atmete ich auf, betrat den Friedhof und arbeitete mich von Grabstein zu Grabstein vor. Ich erreichte schließlich das steinerne Kreuz am westlichen Ende des Friedhofs, direkt neben dem Platz, auf dem die Versammlung stattfand. Von hier aus konnte ich mühelos über die Mauer lugen und hatte einen ausreichenden Überblick über das Geschehen. Immer mehr Ahlbecker Männer versammelten sich im Schatten der Linde vor der Kirche und umringten den Amtmann. Die Musketiere hatten alle Hände voll zu tun, die Menge in gehörigem Abstand zu halten. Der Amtmann selbst posierte direkt vor dem Portal und war gesäumt von den vier lebensgroßen sandsteinernen Figuren, die den Kircheneingang schmückten und welche die vier lateinischen Kirchenväter darstellten. Er stand direkt unterhalb der Statue des heiligen Hieronymus, der einen Löwen zwischen seinen Beinen und einen Totenschädel auf seinem Unterarm liegen hatte und äußerst finster und gebieterisch dreinschaute.
»Was redet ihr Kerle denn da?«, erwiderte der Amtmann barsch auf die Zurufe der Bauern und schaute ebenso düster wie der Heilige über ihm. »Was denn für Räuber? Welche holländische Bande meint ihr?«
»Die Holländische Bande!«, entgegnete der Wirt. »Die Brabanter Rotte!«
»Die Bande vom Hauptmann Picard!«, rief ein dritter. Der Stimme nach war es Wenzels Vater, der Pättenbauer.
»Redet keinen Unsinn!« Der Amtmann winkte unwirsch ab und wandte sich ungehalten an sein Gegenüber: »Der Jude Abraham Picard ist seit Jahren tot. Das wisst ihr sehr wohl! Und der Rest der Bande sitzt im Kerker oder ist in alle Himmelsrichtungen verstreut! Versucht also nicht, vom Thema abzulenken. Es geht hier nicht um die Holländer, sondern um euch Ahlbecker! Um die Deserteure!«
»Und wer hat dann in der vergangenen Woche den Schmied in Ostwick ausgeraubt und gemeuchelt?«, schimpfte ein kleiner Mann mit Ziegenbart und stampfte dabei mit den Holzpantinen auf den Boden. »Die Brabanter waren es, sage ich!«
»Und ich sage: Ruhe, verdammt noch mal! Und kein Wort mehr von den Räubern!« Der Amtmann holte ein Papier aus seiner Satteltasche und rief mit hochrotem Kopf und sich überschlagender Stimme: »In Absprache mit eurem Dorfschulzen, dem Landeigner Johann Lanvermann, bin ich hier erschienen, um folgende sich im Dorfe Ahlbeck verschanzenden kriegsscheuen Elemente auf der Stelle zu verhaften und der königlich preußischen Gerichtsbarkeit zu übergeben.«
Das war also der Grund für das plötzliche Kartoffelpflanzen beim Großbauern! Der Schulze hatte seine Heuerlinge zu sich bestellt, um dem Amtmann die Möglichkeit zu geben, sich ungestört an die Söhne heranzumachen. Allein fünf der Ahlbecker Fahnenflüchtigen waren Sprösslinge von Lanvermannschen Kötterbauern. Und vor allem: Ich war ein Sohn eines Heuerlings.
Der Amtmann räusperte sich und wollte die Namen der Deserteure vorlesen, wurde jedoch von dem Ziegenbärtigen mit den Holzpantinen unterbrochen. »Wo ist denn der Lanvermann?«, wollte dieser wissen und verschränkte die Arme vor dem Leib. »Muss der Dorfschulze nicht zur Stelle sein, wenn seine Nachbarn verhaftet werden sollen?«
»Richtig«, pflichtete ihm ein anderer bei. »Wo ist denn unser Schulze?«
»Ich bin der Amtmann, das genügt vollauf!«
»Haltet Ihr Euch für Bonaparte?«, fragte der Wirt Tenhagen und spuckte zu Boden. »Der Welsche hat hier auch gewütet wie ein Vandale!«
»Noch eine solche Bemerkung und ich lass dich arretieren!«, geiferte der Amtmann und wedelte mit seinen Armen. »Hast du verstanden?!«
Der Wirt schmunzelte ironisch und zog allzu devot den Hut.
Im gleichen Augenblick trat Pastor Söbbing, der Geistliche des Dorfes, in seinem schwarzen Ornat aus der Kirche vor das Portal und stellte sich hinter den Amtmann. Er war ein alter Mann mit silbergrauem Haar und eingefallenem, stets kränklich aussehendem Gesicht, der sowohl aufgrund seines hohen Alters wie auch seiner geistlichen Stellung von allen im Dorfe geachtet wurde. Er sagte kein Wort, aber sein Erscheinen genügte, die Menge verstummen zu lassen.
Der Amtmann nickte dem Pastor zu, räusperte sich ein zweites Mal, hielt das Papier vor sich und begann zu lesen: »Auszuliefern sind: Rudolf Homölle, Sohn des Gerrit, genannt: der Pättenbauer.«
Die umgebende Menge, unterdessen hatten sich auch Frauen und Kinder hinzugesellt, murrte leise und spendete höhnischen Beifall. Der Pättenbauer zog den Hut und neigte seinen Kopf, wie ein Schauspieler auf der Bühne, dem nach der Vorstellung applaudiert wurde.
»Matthias Huesmann«, rief der Amtmann. »Sohn des Heinrich.«
Es folgten erneute und sogar gesteigerte Beifallsbekundungen, die den Amtmann sichtlich erzürnten.
»Noch ein solcher Ausbruch«, rief er und gestikulierte erneut aufgeregt mit den Armen, »und ich lass euch alle arretieren! Alle miteinander!«
Die Musketiere schauten sich überrascht an und schienen sich zu fragen, wie dies zu bewerkstelligen sei. Immerhin waren inzwischen an die fünfzig Leute auf dem Dorfplatz versammelt. Die Anwesenden jedoch nahmen die Drohung des Amtmannes ernst, murrten verdrießlich und verstummten dann.
»Wir wollen den Herrn Amtmann ausreden lassen«, ließ sich Pastor Söbbing vernehmen, »bevor wir Kommentare zu dem Gesagten abgeben.« Er bedachte den Amtmann mit einem ehrerbietigen, aber nicht eben freundlichen Blick und sagte: »Fahrt fort, Herr Amtmann.«
Der Angesprochene richtete sich im Sattel auf, wartete, bis alles ruhig war, und rief: »Jeremias, genannt: Vogelsang, Vater unbekannt!«
Ich erstarrte und glaubte, mich verhört zu haben. Auch einige Ahlbecker schauten sich verdutzt an. Der Wirt Tenhagen rief: »Was redet Ihr denn da für einen Unsinn?! Was heißt denn hier ›Vater unbekannt‹?«
»Das wisst ihr sehr gut«, antwortete der Amtmann und grinste provozierend. »Der Vogelsang-Bengel ist ein elternloser Bastard! Ein verdammtes Findel! Tut bloß nicht so, als hättet ihr davon keine Ahnung!«
»Und wenn schon!«, rief der Pättenbauer.
Ich weiß nicht, wie der Stein in meine Hand geriet, doch in dem Moment, da der Amtmann meinen und meines Vaters Namen in den Dreck zog, warf ich. Es war nur ein Reflex und gar nicht überlegt, aber der Wurf war dennoch wohlgezielt. Der Stein traf den Amtmann seitlich am Kopf und ließ ihn vom Pferd fallen. Er fiel genau zu Füßen der Statue des heiligen Augustinus, der – sein Herz in der Hand – mitfühlend auf ihn niederschaute.
Der Pastor sah sofort zum Friedhof herüber, und für einen kurzen Augenblick begegneten sich unsere Blicke. Ich duckte mich und verfolgte atemlos und wie unter Schock, was weiter geschah.
Die Ahlbecker waren zunächst starr vor Schreck, niemand wagte, sich zu rühren oder einen Ton von sich zu geben. Alle sahen sich schweigend an und schüttelten die Köpfe. Doch dann und mit einem Mal brach ringsum schallendes Gelächter aus. Während der Amtmann sich verwirrt aufrappelte und vom Pastor und einigen Musketieren wieder aufs Pferd gehoben wurde, tobte die belustigte Menge und schüttelte sich vor Lachen.
»Gestern zu tief ins Glas geschaut?«, rief ein Bauer im Blaukittel.
»Oder war der Ritt von Oldendorf so anstrengend, dass Ihr erst mal ein kleines Nickerchen machen müsst?«, setzte der Pättenbauer hinzu.
»Das werdet ihr mir büßen!«, rief der Amtmann, fasste sich an den schmerzenden Schädel und schickte funkelnde Blicke in die Runde.
Ich verkroch mich hinter dem Steinkreuz und wagte nicht, mich zu rühren. Die Leute jedoch lachten nun noch lauter und wischten sich die Tränen aus den Augenwinkeln. »Wir büßen bereits, seht Ihr das nicht?!«, riefen sie. »Wir müssen schon weinen vor lauter Buße!« Eine weitere Lachsalve erschallte.
»Aufrührerisches Bauernpack! Euch werde ich es zeigen! Das werdet ihr noch bitter bereuen!«, schrie der Amtmann, schien einen Moment unschlüssig, riss dann jedoch die Zügel herum und ritt im Galopp in Richtung Oldendorf davon. »Das war nicht das letzte Wort!«, rief er außer sich vor Wut. »Das verspreche ich euch! Wir sehen uns wieder.«
Die Gendarmen sahen sich verdutzt an, wussten nicht, ob sie nach dem Übeltäter suchen oder ruhig Haltung bewahren sollten, folgten dann aber dem Beispiel ihres Herrn und gaben ihren Gäulen die Sporen.
Die ganze Zeit hatte ich darauf gewartet, dass Pastor Söbbing zu mir herüber deuten und rufen würde: »Dort ist der Kerl! Auf dem Friedhof! Fasst ihn!«
Doch nichts geschah, und als ich jetzt wieder zum Portal hinüberschaute, sah ich, dass der Pastor seinen Platz verlassen hatte und verschwunden war. Ich sackte hinter meinem Kreuz zusammen, stierte auf meine Hände und konnte nicht fassen, was gerade geschehen war. Und was gesagt worden war. Der Vogelsang-Bengel ist ein elternloser Bastard! Ein verdammtes Findel! Die Worte des Amtmannes hallten in meinen Ohren und wollten nicht mehr verstummen. Wieder sah ich das provozierende Grinsen in seinem Gesicht und hörte ihn sagen: »Vater unbekannt!«
Eine gemeine Lüge! Das war die einzige Erklärung. Ich wusste doch, wer meine Eltern waren. Das war über jeden Zweifel erhaben!
Ein Lüge! Es konnte gar nicht anders sein. Aber warum hatte der Pättenbauer »Und wenn schon!« gerufen?
Ich rappelte mich mühsam auf, schlich mich an der Kirchenmauer entlang und an der Sakristei vorbei und wollte gerade den Friedhof verlassen, als ich eine Hand auf meiner Schulter spürte. Ich zuckte zusammen und fuhr herum.
Pastor Söbbing stand vor mir und schaute mich kopfschüttelnd an. Er war durch die Kirche gegangen, hatte den Hinterausgang der Sakristei benutzt und mich abgefangen, bevor ich mich davonstehlen konnte.
»Jeremias«, sagte er zugleich erstaunt und verärgert und setzte fragend hinzu: »Du?« Sogleich bekam sein ausgemergeltes Gesicht aber einen sanften, beinahe mitleidigen Ausdruck. Er ließ mich los, presste die Lippen aufeinander, neigte den Kopf und wiederholte dann leise: »Jeremias.«
Ich sagte kein Wort, riss mich von seinem Blick los und rannte davon.
Was hätte ich in diesem Moment darum gegeben, mich einfach in Luft auflösen zu können! Einfach nicht mehr da zu sein.
–
5
Es war bereits Mittag, als ich zum Kotten zurückkehrte. Auf dem Weg nach Hause hatte ich ängstlich darauf geachtet, von niemandem im Dorf gesehen oder gar angesprochen zu werden. Die Leute standen nach wie vor in kleinen Grüppchen auf den Straßen, machten sich über den Amtmann und seinen allzu plötzlichen Abgang lustig und fanden das Ganze eher komisch als bedenklich. Mir jedoch war keineswegs nach Lachen zumute, und schon gar nicht wollte ich Gegenstand der Witze und Frotzeleien sein oder mich als Steinewerfer zu erkennen geben, deshalb schlich ich mich hinter den Häusern an den Misthaufen vorbei, lief geduckt über die noch kahlen Felder und Wiesen und versteckte mich hinter Bäumen und in Entwässerungsgräben, sobald ich in Gefahr geriet, jemandem zu begegnen.
Auf dem Hof empfing mich Wenzel, der mittlerweile meinen Schwestern beim Jäten des Unkrauts half, mit den Worten: »Sandmann weg?«
»Ja«, antwortete ich, ohne ihn anzusehen. »Der Sandmann ist weg.«
Wenzel prustete vor Lachen und sagte: »Nicht Sandmann, sondern Amtmann!« Und er kicherte mit diebischem Vergnügen, da er mich so an der Nase herumgeführt hatte. »Mias dumm!«, rief er schadenfroh.
Das Lächeln, mit dem ich ihm antwortete, war nur gekünstelt, aber es fiel ihm nicht weiter auf. Ich ließ die drei in ihren Beeten und betrat eilends das Haus. Meine Mutter saß in der Stube und schälte Kartoffeln für den Eintopf. Sie schaute lächelnd zu mir auf, doch das Lächeln erstarb auf ihren Lippen, als sie meinen Gesichtsausdruck sah.
»Was ist passiert?«, rief sie. »Warum schaust du so finster?«
Ich setzte mich ihr gegenüber an den Tisch und berichtete in teils aufgeregt gestammelten, teils atemlos geflüsterten Worten, was sich auf dem Kirchplatz zugetragen hatte. Schließlich blickte ich meine Mutter flehentlich an und fragte: »Warum erzählt der Amtmann solche Lügen?«
Meine Mutter lächelte bitter und schüttelte langsam den Kopf. Die Tränen liefen ihr über die Wangen, und sie war nicht in der Lage, ein Wort herauszubringen.
»Hast du nichts dazu zu sagen? Willst du es zulassen, dass der Amtmann unseren Namen besudelt? Das kann nicht dein Ernst sein. Boomkamp macht mich zum Gespött der Leute, und du sagst keinen Ton!«
Sie schluckte und schwieg. Ihre Mundwinkel zuckten. Ihre Hände zitterten, und das Schälmesser glitt ihr aus den Fingern.
»Dann ist es also wahr?!«, rief ich, sprang auf und schlug mit der Hand auf die Tischplatte. »Ich bin ein Bastard? Ein verdammter Halbling! Und alle wissen davon, das ganze Dorf weiß Bescheid, nur ich nicht?!«
»Du bist unser Sohn, und das wirst du immer bleiben«, erwiderte sie und schaute mich nun ihrerseits flehentlich an. »Ich weiß, wir hätten es dir sagen sollen, aber wir haben anfangs keinen Grund gesehen. Du warst immer ein so lieber Junge, und warum sollten wir dir unnötig Kummer bereiten? Wir haben es einfach nicht übers Herz gebracht. Immer wieder haben wir es vor uns hergeschoben, Jahr um Jahr, und je länger wir geschwiegen haben, desto schwieriger wurde es. Und irgendwann haben wir einfach nicht mehr den Mut aufgebracht, weil wir wussten, dass du unser Schweigen nicht verstanden hättest. Außerdem sahen wir die Notwendigkeit nicht. Niemand im Dorf nennt dich anders als bei deinem rechten Namen, du wirst von allen als unser Sohn akzeptiert, dein Name ist Vogelsang, so steht es auch in den Papieren. Und niemand kann das anzweifeln. Auch der Amtmann nicht.«
»Aber ich bin nicht euer leibliches Kind! Ich bin ein verfluchtes Findel!«
Sie nickte und senkte erneut den Blick.
Die Gedanken schossen wie wild durch meinen Kopf. Plötzlich stimmte nichts mehr, nichts passte zusammen, alles war konfus, und was eben noch wahr gewesen war, entpuppte sich mit einem Mal als Lüge. Ich hatte das Gefühl, als besäße ich plötzlich keine Vergangenheit mehr, als wachte ich aus einem schönen Traum auf und fände mich in einem leeren Raum wieder.
»Warum habt ihr in all den Jahren nie ein Sterbenswörtchen darüber verloren? Ihr hättet doch wissen müssen, dass es früher oder später herauskommen würde. Dass ich durch irgendeinen dummen Zufall davon erfahren würde!« Ich hatte die Hände so zu Fäusten geballt, dass die Knöchel weiß hervortraten. Plötzlich kamen mir Situationen in den Kopf, die mir einst unverständlich gewesen waren. Beiläufige Andeutungen von Nachbarn und Verwandten, die ich nicht hatte begreifen können. Seltsame und ungewollt herausgerutschte Bemerkungen, bei denen meine Mutter einen roten Kopf bekommen hatte. Wissende Blicke und Gesten, deren Sinn ich erst jetzt verstand.
»Wie konntet ihr mich nur so hintergehen?«, fragte ich kopfschüttelnd.
Ich hörte sie schlucken und flüstern: »Wir lieben dich wie unseren eigenen Sohn, Jeremias. Du bist unser Erstgeborener und Stammhalter. Wenn wir tot sind, wird dir der Kotten gehören, wie es einem ältesten Sohn zusteht.«
»Na, danke schön!«, rief ich erbost. »Auf eure Almosen kann ich verzichten, ich will nichts, was mir nicht gehört! Ihr hättet mich damals totschlagen sollen, und meine verfluchten Eltern gleich mit!«
»Jeremias!«, war alles, was sie entgegnen konnte.
»Ist doch wahr!«, ereiferte ich mich. »Vielleicht ist meine leibliche Mutter eine ehrlose Dirne und mein Vater ein liederlicher Schurke. Wer vermag das zu sagen?! Womöglich sind sie gemeine und niederträchtige Ganoven, und ich habe das Gaunerblut ebenfalls in meinen Adern.«
Als ich das heftige Schluchzen meiner Mutter hörte – es war mir auch jetzt nicht möglich, sie in Gedanken anders zu nennen –, taten mir meine bösen und in Rage gesprochenen Worte leid. Ich hätte sie gern in den Arm genommen, aber auch das war mir nicht möglich. Ich war hin- und hergerissen zwischen Wut und Selbstmitleid, zwischen hässlichen Gedanken und dem Versuch, irgendetwas von all dem zu verstehen. Ich wusste nicht, was ich denken und sagen sollte. Ich fühlte mich hintergangen und ungerecht behandelt, mein ganzes Leben war mit einem Mal auf den Kopf gestellt. Ich wünschte, man hätte auch mich als Säugling gehimmelt. Ich glaubte, niemals wieder »Mutter« und »Vater« zu meinen Eltern sagen zu können, und dennoch wusste ich im gleichen Moment, dass Heinrich und Maria Vogelsang immer meine Eltern bleiben würden.
Ich dachte an meine Schulzeit im Ahlbecker Bruch, als mein Vater, der Magisterbauer, mir zusammen mit den anderen Kindern des Dorfes das Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht hatte. Ich erinnerte mich an die halb abfälligen, halb neidischen Bemerkungen meiner Mitschüler, weil ich der Sohn des Magisters war, und an das hinter vorgehaltener Hand geträllerte »Tirili« und »Piep-piep-piep« meiner Mitschüler, das jeder Nennung meines Namens auf dem Fuße folgte. All diese kindlichen Schmährufe hatte ich geduldig ertragen und mit stoischem Langmut über mich ergehen lassen, nur um jetzt zu erfahren, dass mein wahrer Name gar nicht Vogelsang war. Welch bittere Ironie! Als Kind hatte ich mir oft einen anderen Namen gewünscht, und jetzt, da ich mich an ihn gewöhnt und mich mit ihm ausgesöhnt hatte, wurde er mir vergällt. Zugleich meldete sich jedoch eine Art dickköpfiger Stolz und störrischer Trotz in mir, eben weil man mich getriezt und wegen meines Namens verspottet hatte. Nein, den Namen Vogelsang hatte ich mir redlich verdient! Was bildete sich der Amtmann ein, ihn mir jetzt absprechen zu wollen und mich einen namenlosen Bastard zu nennen?
Ich wischte mir die Tränen aus den Augenwinkeln, setzte mich wieder an den Tisch und reichte meiner Mutter die Hand. Sie nahm sie und murmelte: »Es tut mir leid, mein Kind. Wir wollten dir nicht wehtun, das wollten wir gewiss nicht. Wenn wir das gewusst hätten!« Sie sah mich liebevoll an und fügte hinzu: »Du warst doch ein Geschenk des Himmels. Eine Gottesgabe.«
»Wie und wo habt ihr mich gefunden?«
Sie sah mich lange nachdenklich an, schien mit sich zu ringen, lächelte entrückt, wurde aber plötzlich sehr ernst und begann: »Es war eine stürmische Frühlingsnacht im Jahr 1795.« Anstatt mir in die Augen zu schauen, senkte sie den Blick und fuhr, während sie erzählte, mechanisch fort, die Kartoffeln zu schälen. Allein die fast zwanghafte Verrichtung der Arbeit schien sie davon abzuhalten, wieder zu weinen. »Dein Vater und ich saßen hier in der Stube, ich am Spinnrad und er am Ofen, als wir plötzlich ein heftiges Klopfen an der Hintertür des Kottens hörten. Da wir zu so später Stunde keinen Besuch erwarteten und dem ersten Klopfen kein weiteres folgte, glaubten wir, ein Ast der Linde hinter dem Haus habe im Sturmwind gegen die Pforte geschlagen. Doch plötzlich war ein leises Wimmern und Winseln zu hören.«
»Das war ich?«, fragte ich gebannt und merkte, dass meine Hände schweißnass waren. »Hinter dem Haus habt ihr mich gefunden?«
»Ich dachte zunächst, es wäre eine streunende Katze«, sagte meine Mutter, stand auf, ging zur Feuerstelle und warf die Kartoffeln in den Topf. »Darum habe ich Heinrich gesagt, er soll sie verscheuchen, damit wir unsere Ruhe haben. ›Das ist aber eine eigenartige Katze‹, hat er gemeint, als er von Türe zurückkam. Im Arm hielt er ein wollenes Bündel, aus dem heraus es immer noch winselte. Ein Neugeborenes, erst wenige Stunden alt, noch ganz verknautscht im Gesicht und blau angelaufen vor Kälte und Wimmern. ›Jesus, Maria und Josef!‹, habe ich gerufen und bin sogleich aufgesprungen, um ihm das Kind aus dem Arm zu nehmen. ›Ist der Herd noch warm?‹, habe ich gefragt und geschimpft, als er nicht sogleich antwortete und stattdessen wie zur Salzsäule erstarrt dastand. ›Los, leg Torf nach und schaff mir Milch und Wasser herbei! Wird’s bald?!‹ Er lächelte, nickte dann und sputete sich.« Meine Mutter erzählte all dies mit einem sonderbar unbeteiligt klingenden Tonfall, so als fiele es ihr schwer, sich in die Zeit zurückzuversetzen, als widerstrebte es ihr, sich zu erinnern. Sie kam zurück an den Tisch, in der Hand einen Bund Petersilie, den sie nun kleinschnippelte.
Ich lehnte mich auf meinem Stuhl zurück, zog die Stirn kraus und überlegte. Meine Mutter war bereits weit in den Dreißigern gewesen, als ich geboren wurde. Sie hatte mir oft erzählt, dass ich das jahrelang herbeigesehnte Kind gewesen war. Dass allerdings nicht sie mich geboren hatte, war mir bislang verschwiegen worden. Obgleich meine Eltern seit langem verheiratet gewesen waren, war ihre Ehe kinderlos geblieben. Sie hatten sich nichts sehnlicher gewünscht, als Nachwuchs zu bekommen, doch mit den Jahren hatten sie alle Hoffnung aufgegeben. Die Mutter meines Vaters, die damals noch lebte, hatte bereits geunkt, das komme nun davon, dass Heinrich eine Zugereiste geheiratet habe. Da sei es ja nicht verwunderlich, wenn die Kinder ausblieben!
»Du kannst dir vorstellen, wie froh wir waren«, sagte meine Mutter, blickte dabei jedoch nicht mich an, sondern starrte auf das Messer in ihrer Hand. »Seit Jahren hatten wir versucht, ein Kind zu bekommen. Auf allen Nachbarhöfen kamen die Kinder in Scharen zur Welt, manche Bauern murrten gar, wenn mittlerweile das vierte oder fünfte Blag unterwegs war, aber bei Heinrich und mir wollte es einfach nicht klappen.« Sie seufzte, sah mich lange schweigend an und schien in meinem Gesicht lesen zu wollen, was sich in meinem Innern abspielte. Schließlich senkte sie wieder den Blick und fuhr fort: »Und dann lag eines Abends das innig Erflehte einfach so vor der Tür. Der Herrgott hat uns lange Zeit auf die Probe gestellt und endlich unsere flehentlichen Gebete erhört. Und wir haben dich freudigen Herzens als Mündel angenommen.« Abermals seufzte sie, und sie schien erleichtert, dass ihr die Worte über die Lippen gekommen waren. Aber immer noch vermochte sie nicht, mir offen in die Augen zu schauen.
»Warum habt ihr mich ausgerechnet Jeremias genannt?«
»Es war der …«, begann sie, unterbrach sich aber sofort, schüttelte leicht den Kopf und sagte: »Wir haben dich am ersten Tage im Mai gefunden, dem Namenstag des heiligen Propheten Jeremias.«
»Hat denn meine Mutter keine Nachricht hinzugefügt? Gab es keinen Hinweis, wessen Kind ich sein könnte?«
Sie zuckte zusammen, als sie mich die Worte »meine Mutter« aussprechen hörte und merkte, dass nicht sie damit gemeint war. Sie lächelte bitter und schüttelte den Kopf. »Nichts, kein Zettel, gar nichts.« Wieder bedachte sie mich mit diesem merkwürdig abtastenden und forschenden Blick, bevor sie hinzusetzte: »Nur ein kleines Medaillon an einer Kette hing um deinen Hals.«
Ich fuhr zusammen und rief: »Mit ihrem Bild?«
Meine Mutter schaute mich erschrocken an, nahm meine Hand und sagte: »Ein Bildnis der Jungfrau Maria. Warte, ich hole es dir.« Sie stand auf, ging zum Alkoven, holte eine kleine Schatulle hervor, in der sie ihre wenigen Schmuckstücke und Kleinode verwahrt hielt, kramte darin herum und kam mit einem kleinen Medaillon zurück an den Tisch. Sie reichte mir das Schmuckstück und streichelte dabei flüchtig meine Hand.
Das Medaillon war aus Silber und zeigte auf der Vorderseite unter einem aufklappbaren Glasdeckelchen ein Miniaturporträt der gramgebeugten Mutter Gottes. Die Mater dolorosa, die schmerzhafte Mutter!
»Sie hat dich nicht mit hartem Herzen weggegeben«, sagte meine Mutter. »Ich glaube, das ist es, was sie mit dem Medaillon sagen wollte. Es hat ihr wehgetan.« Abermals streichelte sie meine Hand, und uns beiden kamen die Tränen. »Wir wollten dir das Medaillon nicht vorenthalten, aber wie hätten wir es dir geben sollen, ohne dir die ganze Wahrheit zu erzählen.«
»Das war nicht recht von euch«, sagte ich schluchzend. »Ihr hättet die Wahrheit nicht verschweigen dürfen.«
»Ich weiß.«, Wieder zuckten ihre Mundwinkel. »Aber manchmal ist besser, mit der Lüge zu leben.«
Ich sah sie überrascht an und wartete auf eine Erklärung dieser seltsamen Worte, aber sie verstummte und widmete sich wieder ihrer Arbeit.
Minutenlang saßen wir schweigend am Tisch. Ich starrte auf das silberne Schmuckstück in meiner Hand, betrachtete es von allen Seiten und fuhr dann zärtlich mit dem Zeigefinger über den Glasdeckel. Ich öffnete das Medaillon und probierte, ob das Bildchen zu lösen und vielleicht auf der Rückseite irgendetwas zu lesen sei, aber der Karton war fest verleimt. Bei dem Porträt handelte es sich um einen billigen und etwas unscharfen Druck, die verkleinerte Kopie einer italienischen Madonna. Sieben kleine Schwerter steckten ihr in der Brust.
Meine Mutter starrte die ganze Zeit gebannt auf den Tisch und zerkleinerte in Windeseile und mit einer Heftigkeit die Petersilie, als hinge ihr Leben davon ab. Von draußen drang die Stimme des kleinen Wenzel zu uns, der lauthals irgendwelchen Schabernack trieb.
Schließlich klappte ich das Medaillon zu und fragte: »Hat denn sonst niemand etwas zu berichten gewusst? Es muss doch im Dorf darüber geredet worden sein.«
»Die Neuigkeit hat sich natürlich bald im Dorfe herumgesprochen«, sagte meine Mutter, nun wieder in ihrem natürlichen Tonfall, und blickte zu mir auf. »Überall wurde spekuliert, wer wohl die Mutter des ausgesetzten Findlings sein könnte. Und wie der Vater des kleines Kindes heiße. Du weißt ja, wie die Leute im Dorf tratschen und sich auf alles stürzen, was es an Klatsch gibt.«
Das wusste ich allerdings. Das Kirchspiel Ahlbeck war damals (und ist es heute noch) ein beschaulich und abgeschieden gelegenes Bauerndorf in unmittelbarer Nähe der holländischen Grenze, rings umgeben von unwirtlichem Gelände. Gen Norden, Richtung Holland, das dampfende Moor. Gen Süden, Richtung Oldendorf, die karge Wacholderheide. Die leidlich befestigten Wege durch Bruchlandschaft und Venn waren unsicher und strapaziös und luden nicht zur Durchreise ein. Und auch der sogenannte Hessenweg, der Handelsweg von Münster zum holländischen Städtchen Deventer, war zur Zeit meiner Geburt noch nicht so befahren, wie er es heutzutage ist. Da nur selten Moritatenerzähler, Scherenschleifer und anderes fahrendes Volk durch den Ort kamen und auf diese Weise nur spärlich Neuigkeiten von außerhalb ins Dorf drangen, wurden die nicht eben zahlreichen Vorkommnisse, die es innerhalb der Gemeinde gab, mit Fleiß und Eifer besprochen und kolportiert.
»Eine schwangere Frau«, sagte meine Mutter, »die sich auf solche Weise ihres Kindes entledigt hätte, wäre den Dorfbewohnern gewiss nicht entgangen. Niemand im Ort kannte eine Frau, die ihren schwangeren Bauch verloren hatte, ohne das entsprechende Kind präsentieren zu können oder zumindest ein Grab, in dem das Notgetaufte verscharrt war. Und deshalb waren sich alle sicher, dass die Frau unmöglich aus Ahlbeck stammen konnte.«
»Eine Wildfremde?«
»Wahrscheinlich.«
Ich überlegte und schüttelte dann den Kopf. »Ist es nicht merkwürdig, dass ich ausgerechnet vor eurer Tür abgelegt worden bin? Das kann doch kein Zufall gewesen sein.«
»Wie meinst du das?«, fragte meine Mutter, stand erneut auf und trat an die Herdstelle, diesmal fügte sie die Petersilie dem Eintopf zu und rührte mit einem Holzlöffel um.
»Weil die Frau gewusst haben muss, dass ihr keine Kinder bekommen konntet, euch aber sehnlich Nachwuchs gewünscht habt. Vermutlich hat sie euch gekannt.«
Sie fuhr herum und sah mich mit Schrecken im Gesicht und beinahe alarmiert an, dann aber lächelte sie müde und sagte: »Mag sein, mein Junge. Wer will das sagen? Wir werden es nie erfahren.«
»Keine Hiesige«, lautete meine Schlussfolgerung, »aber eine Frau, die sich in Ahlbeck auskannte.«
»Sosehr sich die Ahlbecker die Köpfe zerbrachen«, fuhr meine Mutter fort, »das Geheimnis blieb unergründlich. Da sich keine weiteren Hinweise auf deine Herkunft fanden, verlor das Thema als Gesprächsstoff seinen Reiz und wurde nicht weiter erörtert. Du wurdest stillschweigend und ein für alle Mal als unser Sohn akzeptiert und das Rätselraten um deine leiblichen Eltern nicht länger betrieben. Es wimmelte von Kindern auf den Höfen, eines mehr oder weniger fiel gar nicht weiter auf. Warum sich also Gedanken machen?«
Das war nur zu wahr. Nicht ein einziges Mal in all den Jahren war von den Leuten im Dorf in meiner Gegenwart irgendein direkter Hinweis auf meine zweifelhafte Herkunft gemacht worden, jedenfalls keiner, der mich in meiner unschuldigen und nichts ahnenden Unwissenheit irritiert hätte. Obgleich alle Erwachsenen von dem Fund des Kindes wissen mussten, schien es niemanden zu interessieren. Es gab Wichtigeres im Leben eines Kleinbauern als die Herkunft eines Nachbarbalges. Kinder wurden geboren und starben alsbald wieder, der Älteste übernahm den Hof, und der Rest musste sehen, wo er blieb. Was scherte die Dörfler ein Findelkind? Sie hatten mit der eigenen Brut wahrlich Sorgen genug. Und in dem Stillschweigen mir gegenüber zeigte sich wohl auch der Respekt der Ahlbecker für meine Eltern.
»Und ihr habt nie herausgefunden, wer mich vor eurer Tür abgelegt hat?«, wollte ich wissen. »Es gab keine sonstigen Spuren?«
Sie nickte und setzte sich neben mich an den Tisch. Sie hielt meine Hand, tätschelte sie, lächelte müde und schüttelte den Kopf. »Für uns warst du fortan und für immer unser Sohn und für alle anderen im Dorf ebenfalls. Vielleicht haben wir uns auch gar nicht recht angestrengt, Nachforschungen anzustellen, um das Geheimnis deiner Herkunft zu lösen. Wir wollten es gar nicht erfahren. Jahrelang hatten wir Angst, dein Vater könnte eines Tages vor unserer Tür stehen und dich zurückverlangen. Das ist nie passiert, und selbst wenn es jetzt selbstsüchtig und böswillig klingen mag: Wir sind Gott dankbar dafür.«
»Mein Vater?«, wunderte ich mich. »Was war denn mit meiner Mutter? War es nicht viel wahrscheinlicher, dass sie nach mir forschen würde?«
»Ja, natürlich«, sagte sie leise und räusperte sich. »Auf jeden Fall waren wir froh, dass nie wieder jemand nach dir gefragt hat.« Sie strich mir über den Kopf, nahm meine Hand, führte sie an ihren Mund und küsste sie, während ihr gleichzeitig die Tränen über die Wangen liefen.
Noch vor wenigen Minuten hatte ich nichts als schmerzliche Erniedrigung und sogar Hass empfunden, ich hatte mich tatsächlich wie ein Bastard gefühlt und meine Eltern als Lügner und Betrüger betrachtet, denen ich niemals würde verzeihen können. Doch jetzt krampfte sich mein Herz zusammen, und es war mir nicht möglich, ihnen böse zu sein oder ihnen gar Vorhaltungen zu machen. Sie hatten mich nicht geboren, das war leider wahr, aber sie hatten mich aufgenommen und wie einen Sohn geliebt und erzogen. Sie hatten mir die Wahrheit verschwiegen, aber sie hatten nur mein Bestes dabei im Sinn gehabt. Vielleicht hatten sie egoistisch gehandelt, als sie mir die einzige Mitgift meiner Mutter, das Marienmedaillon, vorenthalten hatten, aber ebenso hatten sie im Grunde nur das Wohl ihrer Kinder im Auge gehabt.
Plötzlich hielt ich irritiert inne und schaute meine Mutter unverwandt an. »Was ist mit Maria und Mechtild?«, wollte ich wissen. »Habt ihr sie auch gefunden?« Ich dachte an Mechtilds buschige Augenbrauen und Marias schwarzes Haar und fügte hinzu: »Das kann doch nicht sein.«
»Die Wege des Herrn sind unerforschlich«, antwortete meine Mutter. »Kaum ein Jahr nachdem du als Findelkind auf den Hof gekommen warst, befand ich mich plötzlich in anderen Umständen und brachte wenige Monate später deine Schwester Maria zur Welt. Und zwei Jahre später kam die kleine Mechtild noch hinzu. Trotz meines bereits hohen Alters. Es war, als wäre plötzlich ein Fluch von uns abgefallen.«
»Ich scheine euch Glück gebracht zu haben«, sagte ich schmunzelnd.
»Du bist unser Talisman, Jeremias!«, rief sie und küsste mich.
»Hoffen wir nur, dass ich mich jetzt nicht zu einem bösen Omen verkehre«, antwortete ich und versuchte mich an einem Lächeln, das mir jedoch gründlich misslang. »Hätte ich nur niemals diesen vermaledeiten Stein geworfen.«
»Du musst dich verstecken, zumindest eine Zeit lang! Auf dem Kotten kannst du nicht bleiben, du bist hier nicht mehr sicher!« Meine Mutter stand auf und ging zum Fenster. »Das wird er nicht auf sich sitzen lassen. Nie und nimmer wird der Amtmann das auf sich beruhen lassen!« Sie schaute hinaus, als erwartete sie, die Gendarmen bereits vor der Tür stehen zu sehen.
»Aber außer Pastor Söbbing hat mich niemand gesehen«, wandte ich ein. »Und der wird bestimmt nichts sagen, schließlich ist er Priester. Und er ist ein Ahlbecker. Keine sonstige Menschenseele weiß, dass ich den Stein geworfen habe. Außer Wenzel hat niemand gesehen, dass ich überhaupt im Dorf war.«
»Mag sein, dass Söbbing nichts sagt, aber verlassen kannst du dich nicht darauf«, antwortete sie und wandte sich zu mir um. »Boomkamp wird sich rächen, und du solltest nicht hier sein, wenn das geschieht!«
»Wo soll ich denn hin?«
»Ich habe da schon eine Idee«, sagte sie geheimnisvoll und neigte den Kopf, als wäre ihr der Gedanke selbst unheimlich. »Du musst ins Moor! Heute noch.«
Ich stierte sie nur an.
»Keine Bange, Junge«, sagte sie, kam auf mich zu und streichelte meine Wange. »Ich kenne einen Ort, an dem du sicher bist und an dem dich niemand suchen wird.«
»Im Venn?«
Sie nickte und sagte: »Sobald es dunkel wird.«
–
6
Seitdem wir den Hof verlassen hatten, war kein Wort mehr über die Lippen meines Vaters gekommen, und auch ich wagte nicht zu sprechen. Wir gingen gedankenversunken und in niedergeschlagener Stimmung auf der Landstraße in Richtung holländischer Grenze und schauten uns von Zeit zu Zeit um, um sicherzugehen, dass niemand uns sah oder folgte. Der Hessenweg war damals kaum mehr als ein leidlich ausgetretener Sandweg, der sich durch Wiesen und Wälder schlängelte und gerade bei feuchter Witterung nur mit Mühe zu bewältigen war. Zwar hatte es an jenem Mittwoch nicht mehr geregnet, aber der Weg war noch vom Vortag glitschig, und an einigen Stellen versank man knöcheltief im Schlamm. Aus Vorsicht hatte mein Vater beschlossen, nicht mit dem Einspänner zu fahren, sondern zu Fuß ins Moor zu gehen. Aus dem gleichen Grund hatten wir darauf verzichtet, die Laternen anzuzünden. In der Dunkelheit war kaum etwas zu erkennen, nur der Vollmond schaute von Zeit zu Zeit hinter den Wolken hervor, warf die gespenstisch wirkenden Schatten der Buchen und Birken zu unseren Füßen und leuchtete uns mehr schlecht als recht den Weg. In den Pfützen spiegelte sich der Himmel, an dem sich die Wolken schwärzlich türmten.
Als mein Vater kurz nach Sonnenuntergang vom Schulzenhof zurückgekommen war, war ich gerade damit beschäftigt gewesen, die Milch vom abendlichen Melken abzuseihen. Er hatte nur genickt, den Hut in die Hand genommen und müde gelächelt. Er schien einen sehr anstrengenden Tag hinter sich zu haben. Er sagte nichts und wurde sogleich von meiner Mutter in Empfang genommen, die ihn in die Stube führte und von den Vorfällen des Tages unterrichtete. Ich hörte die beiden aufgeregt aufeinander einreden, ohne die einzelnen Worte verstehen zu können, aber es hatte den Anschein, als klinge die Stimme meines Vaters zunehmend gereizt. An einer Stelle wurde er sehr laut und schrie meine Mutter regelrecht an. »Was soll denn das bezwecken?«, glaubte ich zu hören. »Das macht doch alles nur noch schlimmer!«
»Schrei doch nicht so«, erwiderte meine Mutter ebenso heftig. »Der Junge kann uns hören.« Den Rest der Unterredung führten sie im Flüsterton, und kein Wort drang mehr durch die Lehmwellerwände.
Ich versuchte, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, aber es wollte mir nicht gelingen. Mich beschlich das unangenehme Gefühl, dass weitere fürchterliche Enthüllungen auf mich warteten. Mir schien es, als wäre eine Lawine losgetreten, die mich nun mitzureißen drohte. Und ich hatte keine andere Wahl, als stillzuhalten, die Augen zu schließen und auf Beistand von oben zu hoffen. Ja, ich betete und wusste doch nicht, wofür.
»Na, dann los!«, war alles, was mein Vater sagte, als er zurück auf die Tenne kam. »Lass uns gehen!« Kein Wort über die Szene auf dem Kirchplatz, keine Bemerkung zu den gehässigen Worten des Amtmannes und der Geschichte meines Findeldaseins, keine Erklärung des Streites mit meiner Mutter. Nur ein leichtes Zucken um die Mundwinkel, das seine Anspannung verriet.
»Sollen wir nicht erst zu Abend essen? Die Pfannkuchen sind so gut wie fertig«, wandte meine Mutter ein und fasste meinem Vater von hinten an die Schulter, als müsste sie ihn stützen. Eine ungewohnte Geste. Sie selbst hatte Tränen in den Augenwinkeln und schien nur mit Mühe einen Weinkrampf zurückhalten zu können.
»Wenn ich mich jetzt setze«, antwortete mein Vater barsch, »dann komme ich anschließend nicht mehr hoch. Entweder wir gehen jetzt auf der Stelle, oder wir warten bis morgen.«
»Lass uns gehen, Vater«, sagte ich.
Er sah mich erstaunt an, blickte nachdenklich zu seiner Frau und befahl ihr: »Pack die Pfannkuchen ein, außerdem ein paar Eier, ein Stück Schinken und einen Laib Schwarzbrot.«
Der schroffe Ton, mit dem mein Vater meine Mutter anging, tat mir im Herzen weh, aber ich wagte nicht, irgendetwas zu sagen oder sogar eine Erklärung zu verlangen. Ich ging lediglich in die Stube, holte meine leinene Joppe und den Drillichumhang und setzte meinen Filzhut auf.
»Musst du jetzt gehen?« Meine Schwester Mechtild saß am Tisch, und schaute mich verstört an. Sie schien nicht zu begreifen, was gerade geschah und warum ich gezwungen war, mich im Moor zu verstecken.
»Sag Maria einen Gruß von mir«, antwortete ich ausweichend und streichelte ihr über den Kopf.
Maria hatte nach dem Mittagessen den kleinen Wenzel zurück zum Pättenbauer gebracht, und sich angeboten, den Rest des Tages im Dorf zu bleiben, dort als eine Art Spion auf der Lauer zu liegen und uns sogleich Bescheid zu geben, falls der Amtmann erneut mit den Gendarmen anrücken sollte. Sie wolle sich nützlich machen, hatte sie gemeint. Dumm herumsitzen, das sei nichts für sie, und im übrigen könne sie sich dabei im Dorf umhören und den neuesten Tratsch über den Vorfall auf dem Kirchplatz aufschnappen. Maria hatte sich seitdem nicht gemeldet und würde von unserer Mutter zurückgeholt werden, sobald ich den elterlichen Hof verlassen hatte.
»Kommst du bald zurück, Jeremias?«, fragte Mechtild.
»Sicher«, antwortete ich, »wir wollen doch Ostern gemeinsam Eier suchen.«
Während ich nun neben meinem Vater ging, war ich mir nicht mehr sicher, ob es zu dem versprochenen gemeinsamen Osterfest kommen würde. Der Amtmann würde alles unternehmen, das zu verhindern.
Eine knappe Meile hatten wir mittlerweile auf unserem Weg durchs Moor zurückgelegt, und zur Rechten tauchten die Lichter des Schulzenhofes auf. Er lag auf einer Anhöhe inmitten eines kleinen Busches unweit des Weges und war der letzte Bauernhof auf deutscher Seite. Direkt vor uns war im Mondlicht die sogenannte Landwehr, der Grenzwall zwischen Westfalen und Holland, zu erkennen. Ein Schlagbaum versperrte den Hessenweg, und wer die Grenze passieren wollte, musste sich den Schlüssel beim Lanvermann, dem »Landwehrmann«, besorgen und dafür einen Wegezoll zahlen.
Linker Hand des Weges befand sich die Kolkmühle, eine jahrhundertealte Wassermühle, die sich im Besitz der salmschen Fürsten befand und durch den Ahlbach gespeist wurde, jenem Flüsschen, das unserem Dorf seinen Namen gegeben hat. Benannt war die Mühle nach einem morastigen Tümpel, dem »Kolk«, dessen Wasser schwarz und faulig war. Der Pächter der Mühle, ein gewisser Lösing, der aber von allen nur Kolkmüller genannt wurde, hatte in einem Nebengebäude des Anwesens ein Gasthaus mit dem beredten Namen »Zum schwarzen Kolk« eingerichtet, in dem die Bauern die mitunter sehr langen Wartezeiten bei einem Schluck Bier verbrachten. Die Kolkmühle und das Gasthaus waren in der Dunkelheit nicht auszumachen, aber das Plätschern des Wassers und das Knarren der Mühlräder waren bis zu unserem Standort zu hören.
»Weißt du, wo der Galgenbülten ist?«, flüsterte mir mein Vater ins Ohr.
Ich fuhr zusammen und konnte ihn nur nickend anstarren.
»Fürchtest du dich, daran entlangzugehen?«, fragte er. »Wenn ja, dann müssen wir einen Umweg um den Schulzenhof herum machen.«
»Und wenn nein?«, erwiderte ich.
»Dann können wir direkt am Wall entlanglaufen.«
»Ich habe keine Angst«, log ich und folgte meinem Vater, der sich auf einem kleinen Trampelpfad durch die Büsche schlug.
»Pass auf, wo du hintrittst«, rief mir mein Vater zu. »Hier wimmelt es von Kreuzottern. Die Biester sind schwarz wie die Nacht und kaum zu erkennen.«
Wir schlichen uns durch Bruchwald und über sumpfiges Gelände direkt an der Landwehr entlang, bis wir einen kleinen Platz inmitten des Waldes erreicht hatten. Ein Hügel, der nicht von Gestrüpp, Schwarzerlen und Birken, sondern von niedrigem Gras und saftigem Klee bewachsen war, tat sich vor unseren Augen auf. Wie ein biblischer Kalvarienberg ragte der Bülten aus dem Wald heraus, auf seiner höchsten Stelle stand der aus schwerem Eichenholz gefertigte Galgen und warf einen unheimlichen Schatten auf das Gras. Zum Glück war in der letzten Zeit niemand hingerichtet worden, kein Leichnam hing am Galgen. Es war zur damaligen Zeit Sitte und Befehl, die Hingerichteten so lange am Strick baumeln zu lassen, bis der natürliche Werdegang sie aus ihrer grausamen Lage befreite. Erst dann wurden die verfaulten Überreste zu Füßen des Galgenbültens verscharrt. Die Obrigkeit versprach sich abschreckende Wirkung von diesem Vorgehen, und dies war auch der Grund, warum sich die Hinrichtungsstätten gern auf Hügeln und stets in der Nähe der befahrenen Handelswege befanden.
»Lass uns weitergehen«, bat ich und schluckte. Ich dachte an die Hinrichtung eines herumstreunenden Räubers, deren Zeuge ich vor etlichen Jahren gewesen war. Ein unwürdiges und makaberes Schauspiel, bei dem die begeisterte Menge umso ausgelassener gejubelt und gekreischt hatte, je flehentlicher und hilfloser der Verurteilte um sein Leben gewinselt hatte. Und ich erinnerte mich an die Galgenprozession nach dem Tode der Irmgard Lanvermann, als – in Abwesenheit des Täters – der Streckbrief des Mörders am Galgen befestigt worden war.
»Lass uns bitte weitergehen!«, wiederholte ich.
»Ist gut, mein Junge«, antwortete Vater, zog sich den Hut in die Stirn und nahm meine Hand. »Wir sind auch gleich da. Aber gib gut Obacht. Hier beginnt das Moor.«
Einige Planken, auf Pfählen befestigt, führten als Steg vom Galgenbülten über tiefes und morastiges Gelände zu einem Fußweg, der unmittelbar an der Landwehr entlangführte. Ich nahm einen faustgroßen Stein, der am Rande des Bültens gelegen hatte, und warf ihn in die sumpfige Lache. Der Stein verschwand mit einem seltsam gurgelnden Geräusch im Morast. Mit einem abgestorbenen Ast einer Birke versuchte ich das Moorloch zu ergründen, doch der Stab verschwand, ohne dass er festen Boden berührt hätte.
»O Gott!«, entfuhr es mir. Mit wackeligen Knien kroch ich über die Planken, in der einen Hand die nicht brennende Laterne, in der anderen meinen Proviant. Der Geruch von Moder und Fäulnis stieg mir in die Nase, unter dem feuchten Laub raschelte es von Sumpfasseln und sonstigem Getier, und mit mulmigem Gefühl in der Magengegend erreichte ich den Weg am Wall. Auch hier stand das Wasser knöcheltief, aber der Grund darunter gab nicht nach. Erst jetzt bemerkte ich, dass der Pfad direkt zum Anwesen des Moorbauern führte, oder zu dem, was davon noch übrig war. Wieder rief ich: »O Gott!«
Gespenstisch erstrahlte der ehemalige Bauernhof im Vollmondlicht, niedergebrannt bis auf die rußgeschwärzten Mauern, die verkohlten und mittlerweile verrotteten Reste des Dachstuhls lagen im Inneren des Hauses, und Unkraut wucherte ringsum. Wo einst Türen und Fenster gewesen waren, gähnten jetzt schwarze Löcher, und die Überreste eines Pflugs standen wie zum Spott an die niederbröckelnde Mauer gelehnt. Selbst die Hundehütte vor dem Haus war eine schwärzliche Ruine.
»Sieht schlimm aus«, sagte mein Vater auf seine treffend schlichte Art. »Kaum zu glauben, dass dies mal ein Ertrag bringender Hof war.«
»Allerdings«, pflichtete ich ihm bei und betrat den von Trümmern übersäten Platz vor dem Kotten. Nicht nur das Haupthaus, auch die Scheune und der Schweinestall waren bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Ein trauriger und unheimlicher, zugleich aber auch faszinierender Anblick, den ich zum ersten Mal aus der Nähe zu Gesicht bekam. Obgleich der Hof in unmittelbarer Nachbarschaft Ahlbecks lag, hatte ich ihn noch nie zuvor betreten. Meine Eltern hatten mir stets verboten, mich auch nur in die Nähe des Hofes zu begeben. Als ich noch ein Kind war, hieß es im Dorf, auf dem Kotten spuke es. Von Irrwischen und Moorteufeln war die Rede, und ein Junge wollte sogar einem Werwolf begegnet sein. Niemand traute sich, den Gespenstern unter die Augen zu treten, und obwohl meine Eltern sonst nicht viel von abergläubischem Hokuspokus und Spukgeschichten hielten, stimmten sie hinsichtlich des Moorbauernhofes mit der Meinung im Dorf überein und hielten uns Kinder von der Ruine fern.
Der Hof war vor etwa zwanzig Jahren, noch vor meiner Geburt, abgebrannt, und zahlreiche Gerüchte und abenteuerliche Erzählungen rankten sich seitdem um dieses schauerliche Ereignis. Eines der meistverbreiteten Gerüchte besagte, dass der damalige Besitzer Alois Lösing, der sogenannte Moorbauer oder Vennekötter, wie man ihn auf plattdeutsch nannte, ein Bruder des Pächters der benachbarten Kolkmühle, eines Nachts die Gebäude in Brand gesetzt und sich dann am Giebel seines Kottens erhängt habe. Die Knechte und Mägde seien glücklicherweise durch den Brandlärm aus dem Schlaf gerissen worden, hätten aber tatenlos mit ansehen müssen, wie der Hof den Flammen zum Opfer fiel. Und schließlich habe man die verkohlte Leiche des Bauern inmitten der Trümmer gefunden. Die Reste eines Stricks um den Hals geschlungen und den verbrannten Kadaver seines treuen Hundes zu seinen Füßen. Die Gemahlin des Bauern, eine angeblich äußerst schöne und im Vergleich zu ihrem Mann recht junge Frau, sei seit jener Schreckensnacht nicht mehr gesehen worden. Es wurde vermutet, sie sei ihm zuvor wegen eines anderen Mannes davongelaufen, und dies sei der Grund für den Selbstmord des Kötters gewesen. Die Ehe der Moorbauern war, ähnlich wie die meiner Eltern, über die Jahre kinderlos geblieben, und nach dem Verschwinden seiner Frau, so erzählte man sich, habe der Bauer wohl keinen Grund mehr zum Leben gewusst und sich im Alkoholrausch umgebracht. Andere, allerdings nicht so zahlreiche Stimmen behaupteten, die Bäuerin selbst habe das Feuer gelegt, nachdem sie die Leiche ihres Mannes auf dem Dachboden gefunden habe. Wieso sie das getan habe und weshalb sie plötzlich nach dem Brand verschwunden sei, das wussten diese Stimmen nicht zu sagen.
»Warum gehört das Land heute eigentlich dem Schulzen?«, fragte ich meinen Vater und deutete auf die Trümmer. »Weshalb ist der Hof nicht in den Besitz des Kolkmüllers übergegangen? Der war doch immerhin der Bruder vom Vennekötter.«
»Der Kolkmüller hat den abgebrannten Hof und das Land an den Schulzen verkauft«, antwortete mein Vater.« Was sollte er auch damit? Er konnte ja nicht Mühle, Gasthof und Kotten gleichzeitig betreiben. Und der alte Lanvermann scheint ihm einen guten Preis geboten zu haben. Er hat die Äcker und Feuchtwiesen übernommen und den Hof verfallen lassen.«
Ich schaute auf die verbrannten Bohlen und Kanthölzer im Innenraum des Kottens, und mir lief eine Gänsehaut bei dem Gedanken über den Rücken, an einem dieser Balken könnte der Moorbauer gehangen haben.
»Warum soll ich mich unbedingt hier vor den Gendarmen verstecken?«, rief ich meinem Vater zu, der gerade um die Ecke des Kottens lugte. »Hier ist es nicht eben gemütlich.«
»Komm«, sagte er als Antwort und deutete hinter das Haus. »Sieh selbst.«
Als ich bei ihm angelangt war, verstand ich, was er meinte und warum meine Mutter mir nahegelegt hatte, mich im Moor zu verbergen. In einiger Entfernung vom Kotten, direkt vor dem Wall der Landwehr und unmittelbar neben einem Kiefernwald, stand ein kleines, windschiefes und verwunschen aussehendes Häuschen. Das ehemalige Gesindehaus. Etwas verfallen und ebenfalls von Unkraut überwuchert, aber nicht verbrannt und sogar noch mit Schindeln auf dem Dach.
Ich schaute von dem Gesindehaus zum Kotten und wieder zurück, und erneut fühlte ich einen Schauder an mir emporkriechen. »War eigentlich damals kein Gesinde im Bauernhaus?«, wandte ich mich an meinen Vater. »Ist von denen niemand zu Schaden gekommen?«
»Natürlich waren Leute im Kotten«, erwiderte er zögernd, »aber man scheint sie rechtzeitig gewarnt zu haben.«
»Wer?«, entfuhr es mir. »Wer hat sie gewarnt?«
Er lächelte gequält und zuckte mit den Schultern.
Irritiert blickte ich zu den abgebrannten Nebengebäuden und stellte mir vor, wie der Moorbauer erst die Scheune, dann den Stall und zuletzt den Kotten angezündet hatte, um sich anschließend am Dachgiebel zu erhängen. Er musste flinke Beine gehabt haben, der Vennekötter! Oder war das Feuer von einem Haus aufs nächste übergesprungen? Warum aber hatte niemand den armen Hund davon abgehalten, seinem Herrchen in den Tod zu folgen?
Vater räusperte sich, deutete auf das Gesindehaus und fragte: »Was sagst du? Sieht doch annehmbar aus, oder?«
»Ein paar Tage werde ich es dort gewiss aushalten«, antwortete ich und folgte ihm zur Hütte. »Wenn es innen ähnlich einladend ausschaut.«
»Hinter dem Haus gibt es sogar einen Brunnen«, antwortete er und öffnete die Tür. »Aber mit dem Licht solltest du vorsichtig sein.«
Das Innere des Gesindehauses entsprach in etwa dem äußeren Eindruck. Verlassen und verlottert, aber keineswegs baufällig oder unbewohnbar. Spinnweben hingen überall, und der Staub lag in dicken Schichten auf Boden und Möbeln, aber die Türen und Fenster waren dicht und das Holz erstaunlicherweise nicht morsch. Das Häuschen bestand aus lediglich zwei Kammern, die eine war leer und hatte einst wohl einige Betten beherbergt, bei der anderen handelte es sich um die Stube, in der sich außer einem kleinen Ofen nur zwei wacklige Stühle und ein altersschwacher Tisch befanden. Eine kleine Leiter führte durch eine Luke auf den Dachboden. Ansonsten war sämtliches Mobiliar ausgeräumt oder entwendet worden, nur in dem Alkoven befand sich eine Bettstelle, auf der ein Strohsack und ein kleines Kopfkissen lagen.
Als wir die Stube betraten, raschelte es auf dem Dachboden.
»Ratten!«, sagte mein Vater. »Fürchtest du dich?«
Ich schaute mich um, schüttelte zufrieden den Kopf, nahm den Filzhut ab und sagte: »Kein bisschen.«
»Das ist gut, mein Sohn.« Mein Vater stand in der Tür, reichte mir die Wolldecke, die er in einem Sack auf dem Rücken getragen hatte, und schickte sich an, sich zu verabschieden. »Also dann …«
Überrascht drehte ich mich um und fragte: »Willst du schon gehen?«
»Du kommst auch allein zurecht«, erwiderte er, legte die Decke auf den Tisch und senkte den Kopf. »Und wahrscheinlich willst du noch über das eine oder andere nachdenken. Wir reden, wenn es Zeit zu reden ist.« Er lächelte bedächtig und fügte hinzu: »Der Proviant sollte bis morgen reichen. Maria kommt am Nachmittag und bringt dir Nachricht und weitere Verpflegung.«
Mein Vater war noch nie ein besonders gesprächiger Mann gewesen, und mit uns Kindern hatte er schon gar nicht viel geredet. Der tägliche Ablauf auf dem Hof war klar bestimmt, was gab es da zu besprechen? Hier ein kurzer Befehl, dort eine flüchtige Bemerkung. Und wenn er doch etwas zu sagen hatten, dann war dies zumeist unangenehmer Art. Er war ein schweigsamer Mann und wurde nur gesprächig, wenn es als Lehrer darum ging, die Kinder zu unterrichten. Die meisten Worte aus seinem Mund hatte ich nicht als sein Sohn, sondern als sein Schüler vernommen. Und es waren nicht seine Worte gewesen, sondern die der Bibel oder der Schulbücher. Er meinte diese Wortkargheit gar nicht böse, er hielt nur nicht viel vom Reden. Das war alles.
»Vater …«, wollte ich zu sprechen ansetzen, doch er schüttelte nur den Kopf.
»Jetzt nicht«, sagte er, »du wirst noch früh genug alles erfahren.«
»Sieh zu!«, rief ich ihm nach.
»Du auch, mein Sohn«, antwortete er, winkte kurz und ging.
Ich zuckte mit den Schultern und fühlte mich beinahe erleichtert. Ja, er hatte recht, es gab so viel, über das ich nachdenken und mit mir ins Reine kommen musste. Die Neuigkeiten des Tages, die überraschenden Enthüllungen, die aufwühlenden Ereignisse hatten mich kaum zur Ruhe und zum Sinnieren kommen lassen. Mir brummte immer noch der Schädel. Und so genoss ich es in gewisser Weise, endlich allein mit meinen Gedanken zu sein. »Das macht es alles nur noch schlimmer!«, schossen mir die in Rage gesprochenen Worte meines Vaters durch den Kopf. Als könnte es überhaupt noch schlimmer kommen!
Ich drehte mich um die eigene Achse und betrachtete das Häuschen, welches für die nächsten Tage mein Zuhause und meine Zuflucht sein würde. Mein Blick blieb auf der Bettstelle haften, auf dem Strohsack, auf dem Kopfkissen.
»Merkwürdig«, murmelte ich, trat näher, entzündete meine Laterne und untersuchte die Bettnische. Weder auf dem Strohsack, noch auf dem Kissen war auch nur die geringste Staubschicht zu erkennen. Im flackernden Schein des Lichts bemerkte ich zudem, dass in der hinteren Ecke des Raumes ein alter Mantel verstaut war, dem Anschein nach ein verschlissener französischer Armeemantel. Des Weiteren stand ein mit Rinderfell bezogener Tornister neben dem Bett, und zwei weiße Schultergurte, wie sie von Napoleons Soldaten getragen wurden, lagen auf dem Boden.
Ein leises Knarren schreckte mich auf. Ich fuhr herum und sah einen Schatten, der auf mich niedersauste. Ein Blitz entlud sich in meinem Kopf. Farben tanzten, Geräusche explodierten. Plötzliche Totenstille. Und dann wurde mir schwarz vor Augen.
Zweiter Teil
–
»Ich aber bin von Art ein Baur.
Mein Arbeit wird mir schwer und saur.
Ich muss ackern, säen und eggen,
schneiden, mähen, heuen dagegen,
holzen und einfahrn Heu und Getreid.
Geld und Steur macht mir viel Herzleid.
Trink Wasser und ess grobes Brot,
wie denn der Herr Adam gebot.«
Jost Amman, »Das Ständebuch«
–
1
Der Schmerz pochte an der Schläfe und hämmerte am Hinterkopf. Ich versuchte, mir an den Schädel zu fassen, musste aber feststellen, dass meine Hände hinter dem Rücken gefesselt waren. Ich lag seitlich auf dem Boden, und als ich die Augen aufschlug, sah ich in das bösartig grinsende Gesicht eines etwa fünfzigjährigen Mannes, der sich über mich beugte, meine Kleidung durchsuchte und mir dabei eine Pistole an die Brust setzte. Da ihn die auf dem Boden stehende Laterne von unten beleuchtete, sah er noch verwegener aus, als er es ohnehin schon war. Im wettergegerbten Gesicht präsentierte er einen graumelierten, buschigen Vollbart, und mit zusammengekniffenen, wachsamen Augen funkelte er mich an, wie ein Raubvogel eine Maus beäugt, bevor er sie verspeist. Der Mann war ein regelrechter Hüne mit breiten Schultern, Stiernacken, stattlichem Brustumfang und muskelbepackten Armen, mit denen er mich wie eine Laus hätte zerquetschen können. Er trug den dunkelblauen und an mehreren Stellen eingerissenen Rock der französischen Linien-Infanteristen und präsentierte auf seinem riesigen, kahlköpfigen und mit Narben übersäten Schädel eine Mütze mit blau-weiß-roter Kokarde.
»Non tirer«, stammelte ich in fehlerhaftem Französisch. »Ne tuer je pas!«
Der Soldat schaute mich überrascht an, hob die Augenbrauen und sagte: »Sieh mal einer an, der verlauste Bauernlump spricht französisch.« Er lachte höhnisch und fügte hinzu: »Aber mit der Grammatik hapert es noch ein wenig.«
Irgendetwas an der Sprache des Mannes kam mir bekannt vor, entweder war es seine nasale Stimme, das rollende R oder die gemächliche Betonung der Worte. Er stammte offenkundig aus dem Niederdeutschen, vermutlich sogar aus dem Münsterland. Erneut schaute ich ihm ins Gesicht, aber da sein wild wuchernder Bart die Hälfte davon verdeckte, war es mir unmöglich zu erkennen, ob mir dieser Mann zuvor schon einmal begegnet war. Ich fragte: »Wer seid Ihr? Was wollt Ihr von mir.«
Statt zu antworten, bediente er sich an meinem Proviant und verschlang die Pfannkuchen, als hätte er seit Tagen nichts mehr zu beißen zwischen den Zähnen gehabt. Er biss ein Stück von dem Schinken ab, spülte mit einem Schluck Milch nach und rülpste.
»Was soll die Maskerade?«, hakte ich nach. »Warum verkleidet Ihr Euch als französischer Infanterist?«
Er lachte laut, klopfte mir mit der Pistole auf die Brust und sagte: »Du bist komisch, mein Kleiner, wahrlich, du bist ein lustiger Vogel. Mach weiter deine Späße, dann lass ich dich vielleicht noch ein Weilchen leben.« Wieder kramte er in dem Beutel mit dem Proviant und fragte schließlich: »Hast du kein Bier dabei? Oder etwas Wein?«
Ich ließ nicht locker: »Warum kostümiert Ihr Euch mit der welschen Uniform?«
Das Lachen erstarb auf seinen Lippen, wieder starrte er mich an wie der Vogel Greif, fuchtelte mit der Pistole vor meiner Nase herum und sagte: »Hör mal zu, du kleiner Klugredner, in dieser verdammten Uniform sind mehr Deutsche gestorben, als du dir in deiner beschränkten bäuerlichen Phantasie überhaupt vorstellen kannst. Jeder zweite Soldat der Großen Armee hat kein Wort Französisch gesprochen! Komm mir also nicht mit deinem großspurigen preußischen Drecksgerede!« Er musterte mich lange, kniff eines seiner Raubvogelaugen zusammen und fragte: »Was treibt du eigentlich hier? Und wer war der Kerl, der vorhin bei dir war?«
»Das geht Euch gar nichts an!«
»Das ist wohl wahr«, erwiderte er, grinste und hielt mir die Mündung seiner Pistole direkt vor die Nase. »Und wenn ich gleich schieße, werde ich es auch niemals erfahren. Zu schade!«
Ich schielte auf die Mündung und wagte kaum zu atmen. Wie betäubt starrte ich auf die Pistole, eine alte und reich verzierte Steinschlosswaffe mit extravagantem doppeltem Lauf. Als der Mann den Hahn spannte, sprudelten die Worte nur so aus meinem Mund: »Ich muss mich verstecken, weil ich aus der Landwehr desertiert bin und die Gendarmen und der Amtmann mich suchen. Der Mann vorhin war mein Vater. Wir sind arme Leute und haben kein Geld, nichts zu holen für Euch. Bitte tut mir nichts, ich bitte Euch, lasst mich leben.«
Er lachte und schüttelte den Kopf: »Was glaubst du eigentlich, was ich bin? Ein Räuber? Warum sollte ich euch wohl überfallen wollen?«
Ich stierte auf den Doppellauf und brachte kein Wort heraus.
»Ein Deserteur also«, murmelte der Soldat und ließ den Hahn an seiner Waffe sachte zurückgleiten. »Nicht zu glauben … ausgerechnet«, murmelte er nachdenklich. »Kommst du hier aus dem Dorf?«
Ich nickte und sagte: »Mein Name ist …« Ich zögerte, sah den Mann unschlüssig an und ergänzte schließlich: »Vogelsang.«
»Sind die Gendarmen auf deiner Spur? Steht zu befürchten, dass sie hier auftauchen?« Er löschte das Licht, stand auf und trat ans Fenster.
»Nein, hier sucht mich niemand«, erwiderte ich und berichtete ihm von dem Vorfall auf dem Kirchplatz. Von den Ahlbecker Deserteuren, von meinem Steinwurf und von der Ankündigung des Amtmannes, in Kürze wiederzukommen. Von Lotte und dem persönlichen Groll des Amtmannes gegen mich erzählte ich nichts.
»Du bist ja ein echter Revolutionär, mein Kleiner! Nicht gerade ein Patriot, das nun nicht, aber ein wahrer Freigeist, das muss man dir lassen! Bist einfach vor den preußischen Sandhasen geflitzt.« Abermals schüttelte er sich vor Lachen. »Vogelsang war dein Name?«
»Jeremias Vogelsang«, antwortete ich.
Da er immer noch vor dem Fenster stand und mir nur seine Silhouette zeigte, konnte ich ihm nicht ins Gesicht sehen, aber er schien überrascht zu mir herüberzuschauen. »Jeremias?« Er kratzte sich den Bart und fragte: »Der Sohn vom Magisterbauern?«
»Ihr kennt meinen Vater?«
»Ein gescheiter und tüchtiger Mann«, antwortete er und kam zu mir herüber. »Sein Vater, also dein Opa, hat mir das Einmaleins beigebracht.« Er lachte und fügte hinzu: »Nun ja, ein gebildeter Mann ist nicht gerade aus mir geworden.« Er bückte sich und zückte ein Messer, das er in seinem Hosenbund getragen hatte. Da ich glaubte, mein letztes Stündlein habe geschlagen, schloss ich die Augen, dachte an das Silbermedaillon, das an der Kette um meinen Hals hing, und betete zur Mutter Gottes. Doch der seltsame Fremde durchtrennte lediglich meine Fesseln und schlug mir kameradschaftlich auf die Schultern. »Schau mich an«, sagte er. »Erkennst du mich nicht?«
Ich öffnete die Augen, betrachtete ihn eingehend und schüttelte den Kopf.
Er nickte zufrieden, öffnete seinen rindsledernen Tornister und holte ein Stück Papier heraus. Er zündete die Laterne wieder an, reichte mir das Blatt und sagte: »Mein Name ist Bernhard …«
»Lanvermann!«, vervollständigte ich den Satz.
Fassungslos starrte ich auf das Papier, es war datiert vom 1. Dezember 1811 und handelte sich um einen Steckbrief der damaligen französischen Besatzungsregierung, Das Bildnis des einstigen Dorfschulzen prangte auf dem Papier und darunter die Worte: »Gesucht wegen Mordes«.
»Kennst du den Wisch?«
»Wisch?«, fragte ich. »Was heißt das?«
Er stutzte, lächelte dann nachsichtig und sagte:«Ich meine den Steckbrief! Schon mal gesehen?«
»Und ob!«, antwortete ich. Der gleiche Steckbrief war vor gut zwei Jahren nach feierlicher Galgenprozession in Abwesenheit des Verurteilten, aber in Anwesenheit sämtlicher Dorfbewohner am Ahlbecker Blutgerüst befestigt worden. Ich verglich das gezeichnete Bildnis mit dem Mann, der neben mir kniete, und wunderte mich. Von dem wüsten Bart war auf der Zeichnung nichts zu sehen, und statt des kahl rasierten Schädels trug er auf dem Steckbrief eine zum Zopf gebundene Lockenpracht auf seinem Kopf. Auch von den Narben war noch nichts zu erkennen.
»Sieht mir nicht besonders ähnlich, was?« Er nahm mir das Papier aus der Hand und verstaute es wieder im Tornister. »Ich habe nicht immer so finster wie heute ausgesehen. Eine Schönheit war ich gewiss nie, aber so hässlich auch wieder nicht!« Er fuhr sich nachdenklich über das entstellte Gesicht und schmunzelte.
Ich hatte ihn zu seiner Zeit als Dorfschulze nur wenige Male und stets aus der Ferne zu Gesicht bekommen, weder war ich damals schon als Heuerling auf seinem Hof gewesen, noch war ich ihm aus sonstigen Gründen unter die Augen getreten. Lediglich im sonntäglichen Hochamt war ich ihm dann und wann begegnet. Ich vermochte mich nicht daran zu erinnern, jemals ein Wort mit ihm gewechselt zu haben. Man zog respektvoll den Hut, kam sich aber nicht zu nahe und ging seines Weges.
»Warum sei Ihr … ?«, stammelte ich und rieb mir die Unterarme. Die Fesseln hatten mir das Blut abgeschnürt. Anschließend fuhr ich mir über den Hinterkopf, betastete die riesige Beule, die sich dort gebildet hatte, und schrie vor Schmerz auf.
»Tut mir leid, dass ich dich niederschlagen musste«, sagte er schelmisch grinsend. »Ich wusste ja nicht, mit wem ich es zu tun habe.«
»Halb so schlimm«, log ich, schluckte den Schmerz hinunter und wiederholte meine Frage: »Was wollt Ihr hier? Wieso seid Ihr …«
»Warum ich zurückgekehrt bin?« Erneut lachte er, diesmal jedoch verächtlich und mit unverkennbarem Abscheu. »Weil noch eine Rechnung offen ist! Weil ich noch etwas zu erledigen habe!«
Mich fröstelte bei seinen Worten. Ich dachte an seine Gemahlin und an die Art und Weise, wie er sie »erledigt« hatte.
Er schien meine Gedanken lesen zu können, denn er fragte: »Was schaust du so, als wäre ich der leibhaftige Teufel? Was weißt du denn schon über mich?« Er steckte die Pistole in den Hosenbund und stand auf. »Sprich! Was weißt du?«
»Nur das, was man sich im Dorf erzählt hat«, erwiderte ich zaghaft und setzte mich auf die Bettstelle. »Was Euer Bruder der Gendarmerie berichtet hat und was die Zeugen zu Protokoll gegeben haben.«
Wieder lachte er sein verächtliches Lachen. »Lass mich raten: Der arme Kerl hat die blutüberströmte Leiche meiner Frau eines Nachts im Ehebett gefunden. Ich lag sturzbetrunken neben ihr, das triefende Messer noch in der Hand, meine Kleidung ebenfalls blutverschmiert. Als ich hochfuhr und ihn sah, floh ich Hals über Kopf und ward nie wieder gesehen. Ende der Geschichte.«
»So in etwa«, bestätigte ich. »Euer Bruder hat noch einen heftigen Streit erwähnt, den Ihr kurz zuvor mit Eurer Frau ausgefochten haben sollt.«
»Dieses Schwein!«, entfuhr es ihm. »Dieser verfluchte Gauner!«
»Entspricht die Geschichte nicht der Wahrheit?«
»Ganz wie man es nimmt.« Er kam nahe an mich heran und schaute mich mit seinen Habichtaugen an. »Als ich in jener Nacht aufwachte, hatte ich wahrhaftig das blutige Messer in der Hand, lag neben meiner toten Frau, und mein Bruder stand vor dem Bett. Soweit entspricht die Geschichte der Wahrheit.« Er lachte verächtlich und setzte hinzu: »Hat sich eigentlich nie irgendjemand gefragt, was der gute Johann mitten in der Nacht im Schlafzimmer seiner Schwägerin zu suchen hatte?«
»Wollt Ihr mir erzählen, dass Ihr Euch an die Tat nicht erinnern könnt?«
»Ich war so betrunken, dass ich mich an gar nichts erinnern kann. Ich habe keine Ahnung, wie das Messer in meine Hand gekommen ist und wieso meine Kleidung blutverschmiert war. Von dem Mord an meiner Frau weiß ich genauso viel wie du! Aber von meinem Bruder weiß ich einiges zu berichten.« Er setzte an, weitere Einzelheiten zu erzählen, hielt jedoch plötzlich inne und schüttelte verärgert den Kopf. »Ach, was soll das alles?«, rief er und wandte sich ab. »Vorbei ist vorbei!«
»Was meint Ihr damit?«
»Johann ist fünf Jahre jünger als ich«, sagte er mit einem Mal und stellte sich wieder ans Fenster. Das Mondlicht schien durch die Scheibe und warf seinen Schatten zu meinen Füßen. Er brummte etwas in seinen Bart, was ich jedoch nicht verstand, dann wandte er sich um und sagte laut und vernehmlich: »Das hat er mir nie verziehen.«
»Weil Ihr der Hoferbe wart?«
»Er war der Hübschere, der Klügere, der Beliebtere, aber ich war der Ältere.«
»Wollt Ihr behaupten, dass Euer Bruder der Mörder ist?«, fragte ich und gesellte mich zu ihm ans Fenster. »Und dass er Euch die Tat in die Schuhe geschoben hat? Warum sollte er das tun?«
»Um den Hof zu übernehmen und fortan Dorfschulze zu sein!«
Ich dachte an die beiden Kinder des Bernhard Lanvermann, die beide nicht mehr lebten. Der Erstgeborene war bereits als Säugling am Scharlach gestorben und der Zweitgeborene nur wenige Monate vor dem Tod der Mutter bei einem tragischen Reitunfall ums Leben gekommen. Da es keine direkten Erben gegeben hatte, waren der Hof und das Amt des Schulzen nach den schrecklichen Ereignissen an den jüngeren Bruder gegangen.
Lanvermann sah mich an, und sein mondbeschienenes Gesicht war aschfahl. Seine Mundwinkel zuckten, die Augen bohrten sich regelrecht in mein Gesicht. »Der Streit, den ich am Abend vor ihrem Tod mit meiner Frau hatte«, sagte er schließlich. »Hat Johann auch ausgesagt, was der Grund für diesen Streit war?«
»Davon weiß ich nichts«, erwiderte ich. »Was war der Grund?«
»Irmgard und mein Bruder waren … die beiden hatten ein … ich habe sie zusammen …« Er schluckte und konnte nicht weiterreden, eine Träne lief über seine schmutzigen Wangen und blieb in seinem Bart hängen.
»Eure Frau hat Euch mit Eurem Bruder hintergangen?«
»Johann war schon immer ein elendiger Hurenbock!«, sagte Bernhard Lanvermann und bat mich, ihm den Tornister zu reichen. Er kramte eine Pfeife aus der Tasche, füllte sie sich mit Tabak und fuhr fort: »Es gab kein Weibsbild in ganz Ahlbeck, dem er nicht schon unter den Rock gegangen war. Er war ja ein hübscher Bursche, und das Scharwenzeln beherrschte er wie kein anderer. Die Weiberröcke scharten sich nur so um sein Bett, und er hat sie alle der Reihe nach bestiegen, egal ob naive Jungfern oder frustrierte Eheweiber.«
»Aber die eigene Schwägerin?«, erwiderte ich ungläubig.
»Meine Frau scheint ihn ganz besonders gereizt zu haben, gerade weil sie seine Schwägerin war«, antwortete er und paffte den Rauch gegen die Scheibe. Das Rauchen schien ihn zu beruhigen, sein Gesicht sah plötzlich beinahe friedlich aus, als erzählte er etwas, an dem er gar nicht beteiligt gewesen war. »Johann hat es nie verwinden können, dass Irmgard sich für mich entschieden hat und nicht das Buhlen des Scharmeurs erhört hat. Schließlich war ich der künftige Schulze und damit die bessere Partie.«
Die Worte meiner Mutter kamen mir in den Sinn. Es sei eine Schande, was Johann Lanvermann auf dem Hof treibe, hatte sie am Morgen gesagt. Ein einziges Sodom und Gomorra! Der Schulzenbauer solle sich was schämen! Und wir alle wären besser dran, wenn sein Bruder noch da wäre.
»Weshalb seid Ihr dann geflohen? Weshalb habt Ihr dadurch Eure Schuld geradezu gestanden?« Mir wollte das Verhalten des Bernhard Lanvermann nicht einleuchten, und ich setzte hinzu: »Warum habt Ihr es nicht auf einen Prozess ankommen lassen?«
»Weil es gar nicht erst zum Prozess gekommen wäre«, antwortete er und legte seine Hand auf meine Schulter. »Als ich aufwachte, blickte ich in die Mündung einer Muskete. Mein Bruder stand vor mir und drohte, mich auf der Stelle zu erschießen, wenn ich auch nur einen Mucks von mir gäbe. Er hat mich gezwungen, die Beine in die Hände zu nehmen und niemals zurückzukehren. Wenn ich mich geweigert hätte, hätte man meine Leiche neben der meiner Frau gefunden und kein Mensch hätte ernsthaft bezweifelt, dass der Mörder seiner gerechten Strafe zugeführt worden wäre.« Er lächelte eigentümlich und nahm einen tiefen Zug aus seiner Pfeife. »Johann hat natürlich acht darauf gegeben, dass die Gesindeleute mich in blutverschmierter Kleidung fliehen sahen und dies anschließend vor dem Untersuchungsrichter bezeugen konnten. Eine klare Angelegenheit und ein Fall für den Galgen!«
»Weshalb seid Ihr nicht später zurückgekehrt, um die Intrige aufzudecken?«, hakte ich nach. »Wenn Ihr unschuldig wart, warum habt Ihr Euch dann nicht gegen die Vorwürfe gewehrt?«
»Ha! Wie denn?!«, entfuhr es ihm. »Ich hatte keine Beweise. Mein Wort hätte gegen das meines Bruders gestanden, und die Indizien sprachen eindeutig gegen mich. Niemand hätte mir geglaubt!« Er sah mich spöttisch an und setzte hinzu: »Genauso wenig, wie du mir jetzt glaubst. Ich sehe es deinem Gesicht an, und ich kann es dir nicht einmal verdenken.«
»Das ist eine ziemlich abenteuerliche Geschichte, die Ihr da erzählt«, erwiderte ich, »warum sollte ich sie wohl glauben?«
»Niemand zwingt dich, mir Glauben zu schenken, mein Junge«, antwortete er lächelnd und klopfte mir auf die Schulter. »Ich lege keinen Wert mehr auf die Meinung anderer Leute. Glaub mir, wenn du es für richtig hältst, oder lass es bleiben. Es kümmert mich nicht, was du denkst. Das macht ohnehin alles keinen Unterschied mehr.«
Als er mir die Pistole vor die Nase gehalten hatte, war ich mir sicher gewesen, einen hinterhältigen und feigen Mörder vor mir zu haben. Jetzt aber, da er seine Hand auf meiner Schulter liegen hatte und mir ebenso eindringlich wie offen in die Augen schaute, war mir das nicht mehr möglich. Mitleid war alles, was ich für ihn empfinden konnte, er wirkte wie eine gehetzte und gejagte Kreatur, und das Unruhige und Beunruhigende in seinem Wesen war dem Anschein nach mehr auf erlittenes Leid als auf eigene Böswilligkeit zurückzuführen. Zugleich aber war etwas an ihm, in seinem geschundenen Gesicht, in seinem entschlossenen Blick, das einen seltsamen Einfluss auf mich ausübte und wogegen ich mich kaum zu wehren wusste. Gewiss, er war ein verwegener, ungehobelter und – wie ich am eigenen Leib erfahren hatte – brutaler Kerl, und dennoch zwang er mich geradezu, ihm mit Achtung und sogar Vertrauen gegenüberzutreten. Und je weniger ihm an meiner guten Meinung zu liegen schien, desto mehr war ich geneigt, ihm zu glauben. Zwar wunderte ich mich, dass er mir, einem völlig Fremden, seine Geschichte so freimütig erzählte und sich damit der Gefahr aussetzte, von mir verraten zu werden, anderseits hatte er für diesen Fall immer noch die Pistole in seinem Besitz, und er würde sicherlich nicht zögern, von ihr Gebrauch zu machen.
»Wie seid Ihr zu der französischen Uniform gelangt?«, fragte ich.
»Ungefähr zu der Zeit, als ich mich im Moor versteckt hielt und von Gendarmen und Spürhunden gehetzt wurde, las ich einen Aufruf der Franzosen, in dem von der Aushebung einer riesigen Armee die Rede war. Napoleon war anscheinend mit dem Zaren aneinandergeraten, und nun brauchte er Truppen für seinen Russlandfeldzug.«
»Ihr wart tatsächlich in der Großen Armee?« Ich erinnerte mich noch gut an die endlosen Kolonnen, die vor gut zwei Jahren über die Straßen gezogen waren. Abertausende Soldaten auf ihrem Marsch nach Osten, die sich unterwegs nahmen, was ihnen vor die Flinte oder Lanze fiel. Während die französischen Truppen von überallher zusammenströmten und die Straßen unsicher machten, traute sich keine Ahlbecker Frau vor die Tür. Die Vorräte wurden größtenteils versteckt, nur ein kleiner Rest zur sofortigen Herausgabe bereitgehalten, damit die Soldaten nicht aus Ärger den ganzen Hof in Brand setzten. Mit einer Mischung aus kindischer Neugier und ehrlich empfundenem Respekt betrachtete ich den Mann, der es geschafft hatte, den zunächst so erfolgreichen und dann fürchterlich selbstmörderischen Krieg zu überleben. »Ihr wart also wirklich in Russland?«, fragte ich.
»Das war ich allerdings«, antwortete er mit einem Anflug von Ekel in der Stimme. »Vom ruhmreichen Anfang bis zum bitteren Ende. Ich war bei der Schlacht von Borodinó dabei, wo wir uns den Weg nach Moskau blutig freigekämpft haben, und ich habe dieses verfluchte Moskau brennen sehen, mein Junge. Kannst mir glauben, das war ein schofeler Anblick. Wir hatten einen menschenleeren Haufen Schutt und Asche erobert und durften uns auf dem Rückzug mit wild entschlossenen Partisanen und bis an die Halskrause bewaffneten Bauern herumprügeln.« Er lachte verächtlich und winkte mit der rechten Hand ab. »Den Hintern haben wir uns in diesem elenden Russland abgefroren, und der Matsch beim anschließenden Tauwetter machte alles nur noch schlimmer. Wer nicht in den Scharmützeln starb, den hat die Ruhr dahingerafft. Wie die Fliegen sind sie abgekratzt. Siehst du diese Wunden?« Er deutete auf zwei hässlich vernarbte Schmisse, die parallel von seiner Nase bis zum rechten Ohr gingen. »Diese Andenken habe ich von meinen eigenen Kameraden empfangen, als wir uns an der Beresina gegenseitig die Köpfe einschlugen, um auf dem Rückzug als erster durch die Furt und über den Fluss zu kommen. Ich habe Massel gehabt und lebend das andere Ufer erreicht. Wer weiß, wenn es nötig gewesen wäre, hätte auch ich meinem besten Freund den Schädel eingeschlagen, um die eigene Haut zu retten.« Er wurde plötzlich ganz nachdenklich und schaute durch mich hindurch, als wäre ich gar nicht im Raum, als redete er mit jemandem, den ich nicht sehen konnte. »Wenn ich keinen so guten Grund gehabt hätte, am leben zu bleiben, wäre ich vermutlich auch vor Hunger oder Erschöpfung krepiert oder hätte mich in Leipzig in einen der Degen der Verbündeten gestürzt.«
»In Leipzig habt Ihr auch gekämpft?«
»Mit dem schäbigen Rest der glorreichen Armee, jawohl!«, rief er plötzlich mit Begeisterung aus. »Wir haben uns vermöbeln lassen für Kaiser Napoleon! Die Große Armee einer Großen Nation hat von allen Seiten ordentlich Dresche bezogen.« Er lachte spöttisch, zog an seiner Pfeife und fuhr dann in seinem merkwürdig distanzierten Tonfall fort: »Nach der Katastrophe von Leipzig gab es keine französische Armee mehr, nur ein zerlumptes Häuflein Elend, das sich über den Rhein rettete.«
Ich starrte ihn an wie eine Erscheinung aus einer anderen Welt, und ich dachte an die hunderte von Meilen, die er quer durch Europa zu Fuß gezogen war, an die Städte, die er gesehen hatte, und die Menschen, denen er begegnet war. Ich selbst war noch nie weiter als eine Tagesreise von Ahlbeck entfernt gewesen, an den hohen Feiertagen zog ich mit den anderen Männern des Dorfes zu den Prozessionen am bischöflichen Schloss in Altheim, und vor etlichen Jahren war ich auf dem Markt im zwei Meilen entfernten holländischen Enschede gewesen. Was ich von der großen weiten Welt kannte, hatte ich in Büchern gelesen und in Atlanten nachgeschlagen. Immerzu hatte ich davon geträumt, einmal in meinem Leben den Dom in Münster zu sehen oder wenigstens die Messe in Deventer. Und dieser Mann war in Sachsen und in Russland gewesen, er hatte Leipzig und Moskau mit eigenen Augen gesehen!
»Wird in Frankreich nicht mehr gekämpft?«, wunderte ich mich. »Ich dachte, der Kampf wird jetzt auf französischem Boden weitergeführt.«
»Das schon«, antwortete er und lachte lausbübisch, »aber die Scharmützel müssen fortan wohl ohne mich stattfinden. Der Krieg ist ohnehin entschieden, Napoleon ist besiegt, und warum soll ich mich in den letzten Tagen noch niedermetzeln lassen? Alle fremdländischen Soldaten haben längst das Weite gesucht, die meisten sind bereits im Winter verschwunden. Ich war einer der letzten, die davongelaufen sind.« Er lachte abfällig und fügte hinzu: »Wo hätte ich auch hingehen sollen?«
»Seit wann seid Ihr wieder in Ahlbeck?«
»Seit heute Nachmittag. Ich habe mich vor wenigen Wochen von der Truppe abgesetzt, um hierher zurückzukehren und das zu vollenden, was ich vor Jahren nicht zustande brachte.« Er sah mich mit mildem Lächeln an und meinte: »Und wen treffe ich hier? Einen kleinen Deserteur, der sich weigert, gegen die Franzosen zu kämpfen. Wir sind beide Fahnenflüchtige. Wenn das keine Fügung des Schicksals ist! In gewisser Weise sind wir Verbündete, nicht wahr?«
»Ich schere mich nicht um Politik«, antwortete ich wahrheitsgemäß.
»Das ist ein Fehler, mein Kleiner«, erwiderte er schwermütig. »Denn die Politik schert sich um dich, ob du es willst oder nicht! Und wenn es soweit ist, solltest du wissen, auf welcher Seite du stehst. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du wissen solltest, für wen du kämpfst und ob sich das Kämpfen lohnt. Wenn du das nicht weißt, dann bist du eine erbärmliche Kreatur. Nicht besser als das Rindvieh auf der Tenne.«
»Ich bin lieber ein lebender Feigling als ein toter Held!«, erklärte ich mich. »Und ich habe gewiss keine Lust, für eine Sache zu sterben, die nicht die meine ist! Deshalb halte ich mich lieber aus allem heraus.«
Er schnaufte abfällig, zuckte mit den Schultern und nahm die Mütze ab. »Schau mich an!«, sagte er und fuhr sich mit der Hand über den kahlen Schädel. »Nicht immer hat man die Wahl, ob man feige oder heldenhaft sein will. Niemand fragt dich nach deinem Willen. Und ehe du dich versiehst, tust du Dinge, für die du dich normalerweise hassen würdest!« Wieder schaute er durch mich durch und redete gegen die Wand: »Ich habe für einen Kaiser geblutet, der nicht der meine war. Ich habe Tausende von braven Männern sterben sehen, die nicht die blasseste Ahnung hatten, für wen oder für was sie ihr Leben ließen! Und die meisten von diesen Burschen hatten sich auch aus allem heraushalten wollen, bis man sie schließlich zwang, die Waffe in die Hand zu nehmen und sich einzumischen.«
»Aber das ist einfach nicht gerecht!«
»Das hat auch niemand behauptet«, antwortete er und lächelte abwesend. »Das Leben hat nun wahrlich nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Wenn du das glaubst, kannst du dich auch gleich erschießen oder dir eine Narrenkappe aufsetzen und auf dem Jahrmarkt auftreten. Wenn Gott mit den Gerechten wäre, wie es so schön heißt, dann stände er allein auf weiter Flur da, das kannst du mir glauben. Vergiss das dumme Gerede der Pfaffen! Liebe deinen Nächsten! Ha, dass ich nicht lache!« Das Lächeln war längst aus seinem Gesicht verschwunden, und er fragte mit finsterer Miene: »Hast du ein Mädchen?«
Die unvermittelte Frage überraschte mich. Ich wusste nicht, ob und was ich antworten sollte, und sagte schließlich: »Ja … das heißt … nein!«
»Nicht einmal das weißt du?« Er lachte und klopfte mir aufmunternd auf den Rücken. »Du bist ein komischer Kerl, kleiner Vogelsang!«
»Bis gestern hatte ich ein Mädchen. Aber nun nicht mehr!«
»Sie ist dir davongelaufen, was?«
»Nicht wirklich. Sie wurde mir – in gewisser Weise – weggenommen.«
»Dann solltest du sie dir – in gewisser Weise – zurückholen«, antwortete er und klopfte mir erneut auf den Rücken. »Wenn du sie denn willst.«
»Ihr habt selbst gesagt«, erwiderte ich, »dass niemand einen nach seinem Willen fragt. Ich bin da keine Ausnahme von der Regel.«
Er nickte ernst, reichte mir die Hand und sagte: »Du darfst ruhig ›du‹ zu mir sagen, mein Kleiner. Ich heiße Bernhard.«
»Jeremias«, sagte ich, zögerte einen Moment und nahm dann seine Hand. »Du brauchst mich also nicht ›mein Kleiner‹ zu nennen.«
Er lachte schallend und sagte: »Die Freude ist ganz meinerseits.«
–
2
Noch keine Stunde befand ich mich in der Hütte, und schon wünschte ich mir, sie niemals betreten zu haben. Die altersschwachen Dielen knarrten, der Wind strich flüsternd um das Haus, die Bäume des benachbarten Kiefernwaldes ächzten und rauschten, und bei jedem noch so harmlosen Geraschel oder Vogelschrei fuhr ich auf und bekam Beklemmungen. Ich hatte versucht, einige wenige Bissen des übrig gebliebenen Proviants herunterzuwürgen, aber der Schinken blieb mir im Hals stecken, und das Schwarzbrot stieß mir säuerlich auf. Mein Magen rebellierte gegen das Essen. Ich legte mich auf den Lehmboden, wickelte mich in die Wolldecke und starrte durch das Fenster zum vollen Mond, der sich gerade hinter einer schwarzen Wolke verbarg. Ich fühlte mich einsam und verlassen in unwirtlicher Einöde. Vorhin noch hatte ich mich danach gesehnt, allein zu sein, doch nun hätte ich alles darum gegeben, jemanden neben mir zu wissen.
Bernhard Lanvermann war vor etwa einer halben Stunde verschwunden. Er war mit einem Mal und ohne irgendeine Ankündigung aufgesprungen, hatte sich den Militärmantel übergeworfen und war zur Tür geeilt, als hätte er etwas vergessen und müsste sich beeilen, es nachzuholen. Er habe noch etwas zu erledigen, hatte er lediglich gebrummt und sich die Mütze aufgesetzt.
»Was habt Ihr vor?«, hatte ich erschrocken gefragt.
»Wollten wir uns nicht duzen?«
»Wohin gehst du?«
»Das hat dich nicht zu kümmern«, hatte er mit finsterem Gesichtsausdruck erwidert. »Wenn es das wäre, wovor du offensichtlich Bammel hast, dann läge es gewiss nicht in deiner Macht, mich davon abzuhalten.«
»Ist es das, was ich befürchte?«
»Ich bin bald zurück«, hatte seine ausweichende Antwort gelautet. Und mit diesen Worten war er verschwunden und hatte mich mit meinen wirren und quälenden Gedanken allein gelassen. Plötzlich jedoch war er wieder im Türrahmen erschienen, hatte auf die Laterne gedeutet, sie an sich genommen und gefragt: »Du bist doch koscher, oder? Andernfalls würdest du es nämlich bitter bereuen.«
»Falls ich nicht koscher bin, wirst du es früh genug merken. Wenn du mir nicht traust, dann musst du mich eben fesseln.«
Er hatte lauthals gelacht, sich an die Stirn getippt und war hinaus in die Nacht getreten.
Ein merkwürdiger Tag!, dachte ich nun, während ich mich ruhelos auf dem Boden wälzte und doch keinen Schlaf finden konnte. Die Beule an meinem Hinterkopf hatte mittlerweile die Größe eines Taubeneis und ließ mich immer wieder zusammenzucken, wenn ich meinen Schädel zu heftig bewegte oder mit ihr den Boden berührte. Ein Tag voller Überraschungen! Kein koscherer Tag, wie Bernhard sagen würde. Eine seltsame Sprache hatte er sich bei den Franzosen angewöhnt. »Schofel«, hatte er vorhin gesagt und »Wisch« und »Bammel«. Wie ein Zigeuner oder Vagabund.
Meine Gedanken wanderten nach Oldendorf, zu meiner lieben Lotte, die nun nicht länger meine Lotte war. Es wahrscheinlich nie wirklich gewesen war. Insgeheim hatte ich gehofft, im Laufe des heutigen Tages irgendeine Nachricht von ihr zu erhalten, einen Brief, mit dem sie jemanden nach Ahlbeck schicken würde. Irgendetwas, um die Ungewissheit zu beenden. Aber ich hatte vergebens auf ein Zeichen aus Oldendorf gewartet. Vermutlich hatte sie ihrem Vater alles gebeichtet und ihm meinen Namen genannt, und er hatte ihr von meiner Fahnenflucht und meiner ungewissen Herkunft erzählt. Erst jetzt wurde mir vollends bewusst, wie ausweglos meine Situation war. Ich war nicht nur ein elternloser Bastard und landarmer Bauernlümmel, ich wurde zudem gejagt wie ein Vogelfreier und hatte jedweden Anspruch verwirkt, mich als ehrbarer und geachteter Bürger zu fühlen. Mit welchem Recht maßte ich mir an, um die Tochter des Amtmannes zu freien? Jenes Mannes, dessen Aufgabe es war, mich hinter Schloss und Riegel zu bringen! Ich befand mich in einer verfahrenen Lage, alles war schiefgelaufen, nichts passte mehr zusammen. Und was noch schlimmer war: Ich hatte keinerlei Möglichkeit, es wieder zurechtzurücken. Ich befand mich in einer Sackgasse, und der Weg zurück war mir versperrt. Ich saß in der Falle!
Ich starrte gebannt zur Decke und betrachtete mit stupider Ausdauer die Holzbalken und die kleine Luke in der Ecke des Raumes, die auf den Dachboden führte. Dort oben hatte sich Bernhard Lanvermann vorhin versteckt, als ich mit meinem Vater die Hütte betreten hatte. Zwischen den Balken sah ich einige Halme und Gräser hervorlugen, was darauf schließen ließ, dass auf dem Speicher noch Heu und Stroh gelagert war, das ich benutzen könnte, um mir eine etwas bequemere Bettstatt herzurichten und nicht länger auf dem harten Lehmboden liegen zu müssen. Mühsam rappelte ich mich auf, legte die Wolldecke beiseite und stieg auf der morschen Holzleiter durch die Luke. Abgesehen von ein wenig Stroh und Heu, das in kleinen Haufen auf dem Boden verteilt war, war auch der Dachboden leer. Die Tür im Giebel stand sperrangelweit auf, und ich hatte einen direkten Blick auf den Grenzwall und die Ruinen des Bauernhofes und glaubte sogar, in einiger Entfernung den Galgenbülten ausmachen zu können. Zwei Gestalten gingen auf der Landwehr auf das Gesindehaus zu. Die eine Gestalt war groß und stattlich und trug eine Laterne in der Hand, die andere war beinahe kugelrund und klein und ging dicht hinter der ersten. Sie schienen sich angeregt zu unterhalten, waren aber noch zu weit entfernt, als dass ich ihre Unterredung hätte verstehen können. Just in diesem Moment trat der Vollmond hinter einer Wolke hervor und beleuchtete silbrig die Szenerie und die beiden Figuren auf dem Wall. Bei dem Großen handelte es sich offensichtlich um Bernhard Lanvermann, sein dunkler Mantel und die Mütze auf dem Kopf waren unverkennbar. Der Kleine jedoch war mir unbekannt, am Leibe trug er eine im Mondlicht aufleuchtende weiße Uniform, wie sie von den ehemals holländischen Grenadieren der französischen Kaisergarde getragen wurden. Seine Beine steckten in schwarzen und kniehohen Stiefeln, und auf dem Kopf präsentierte er eine mit blau-weiß-roter Kokarde versehene Pelzmütze. Was hatte ein kaiserlicher Gardeoffizier mit einem Linien-Infanteristen zu schaffen?, wunderte ich mich. Stammte der kleine Dicke etwa auch aus der Gegend und hatte sich zusammen mit Bernhard von der napoleonischen Truppe abgesetzt?
Die beiden Männer hatten nun beinahe die Hütte erreicht, blieben aber weiterhin auf dem Wall stehen. Ich versteckte mich hinter einem Stützpfosten, schaute vorsichtig zur Tür hinaus und sah, wie sich Bernhard salutierend von dem Gardisten verabschiedete, dabei lauthals lachte und sich dennoch ehrerbietig verbeugte, als grüßte er einen Vorgesetzten. Der Kleine, dem Anschein nach ein bereits älterer Mann, der eine Brille mit winzigen Gläsern auf der Nase sitzen hatte, stimmte in das Lachen ein, wurde dann aber ernst und rief dem anderen hinterher: »Flessener?«
Bernhard, der bereits vom Wall heruntergesprungen war, wandte sich um.
»Keine Eigenmächtigkeiten, hast du verstanden?«, rief der Gardist, und es klang, als würde er lispeln oder zischeln. »Die Befehle kommen von mir, und hier geschieht nichts gegen meinen Willen.« Er legte, wie zur Untermalung seiner Worte, die rechte Hand auf den Säbel, der mittels einer blau-weiß-roten Schärpe an seiner Seite befestigt war und beinahe länger war als seine Beine. »Unternimm nichts auf eigene Faust und gib Bescheid, sobald du etwas Interessantes erfahren hast. Du weißt ja, wo du mich findest. Aber geh auf keinen Fall ein Risiko ein, Jackel wird schon auf seine Weise herausbringen, was wir wissen wollen. Er ist ein tüchtiger Bursche.«
Bernhard verbeugte sich erneut und antwortete dem Mann auf der Landwehr. Da er leiser als der Gardeoffizier sprach und dem Haus den Rücken zugewandt hatte, konnte ich seine Worte leider nicht verstehen.
»Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist?«, erwiderte der Gardist schließlich in unverminderter Lautstärke. »Ich hab nicht die geringste Lust, wegen einem Kaffer an der Feldglocke zu landen!«
Bernhard nickte. »Kannst dich auf mich verlassen, Simon!«
»Vermassele es nicht! Das würde dir teuer zu stehen kommen.« Der Kleine winkte kurz und energisch und sprang mit erstaunlicher Eleganz auf holländischer Seite von der Landwehr.
»Oui, mon capitaine«, erwiderte der ehemalige Ahlbecker Dorfschulze, tippte sich schmunzelnd mit dem Zeigefinger an die Mütze und trat beschwingten Schrittes auf das Haus zu. »Zu Befehl, Herr Hauptmann!«
Um nicht in Verdacht zu geraten, den beiden Männern zugehört zu haben, versuchte ich, so geschwind wie möglich wieder nach unten zu gelangen. Doch in der Eile und weil es auf dem Dachboden trotz der offen stehenden Giebeltür so finster war, stieß ich gegen einen Gegen-stand, der unter dem Heu versteckt war. Ich stolperte und schlug der Länge nach auf den Boden, dass der Staub ringsum aufwirbelte.
»Jeremias?«, hörte ich Bernhards Stimme von unten. »Was treibst du da?«
»Ich besorge mir etwas Heu zum Schlafen«, erwiderte ich, hustete und rieb mir das Schienbein. Auf den Dielen sitzend und in eine Wolke aus Heustaub gehüllt, sah ich nun auch, gegen welchen Gegenstand ich gestoßen war. Ein lederner, mit Holzleisten verstärkter Koffer lag vor mir auf den Balken.
Bernhard streckte seinen Kopf und die Laterne durch die Luke, sah mich vor der offenen Giebeltür auf dem Boden sitzen, schaute durch die Tür auf die vom Mondlicht beschienene Szenerie und sagte: »Du bist ein neugieriger Bursche! Hast du herumspioniert?«
»Ich wollte nur …«, begann ich bereits, eine Entschuldigung daherzustammeln, doch er winkte ab und wiederholte, wie für sich: »Wahrlich! Ein neugieriger Bengel!« Es schwang überhaupt kein Vorwurf in seinen Worten mit, er lächelte sogar und deutete mit einer Kopfbewegung auf den Koffer. »Was hast du denn da gefunden?«
»Keine Ahnung. Der war hier unter dem Heu versteckt.«
»Reich mal herüber«, sagte er und zog den Koffer zur Luke. »Wollen doch mal sehen, was das ist.« Er versuchte, den Deckel zu öffnen, doch der war verschlossen und ohne Schlüssel oder Werkzeuge nicht zu öffnen. Bernhard pfiff durch die Zähne und sagte: »Dieses Ding fängt an, mich zu interessieren.« Er bugsierte den Koffer durch die Luke und verschwand nach unten.
Ich klopfte mir den Staub und das Heu von der Kleidung und stieg ebenfalls die Leiter hinab. Als ich in der Stube ankam, lag der Koffer bereits auf dem Tisch, und Bernhard machte sich im Schein der Laterne mit einem Messer an den Schlössern zu schaffen.
»Wäre doch gelacht«, sagte er und hieß mich an seine Seite treten.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783739350325
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2016 (September)
- Schlagworte
- Räuberbande Moor Münsterland Abenteuer Westfalen Historisch Reise