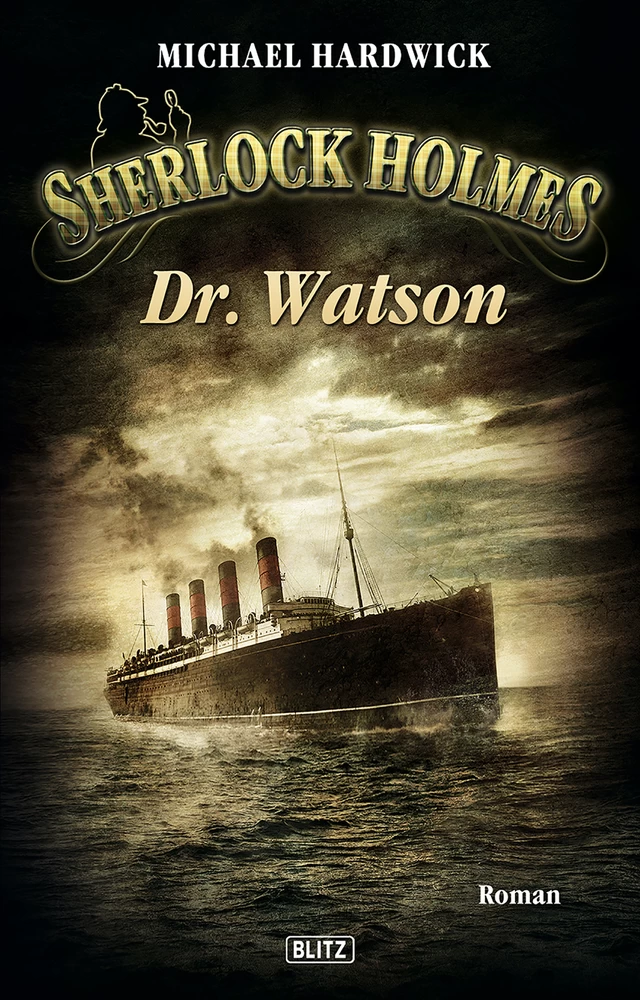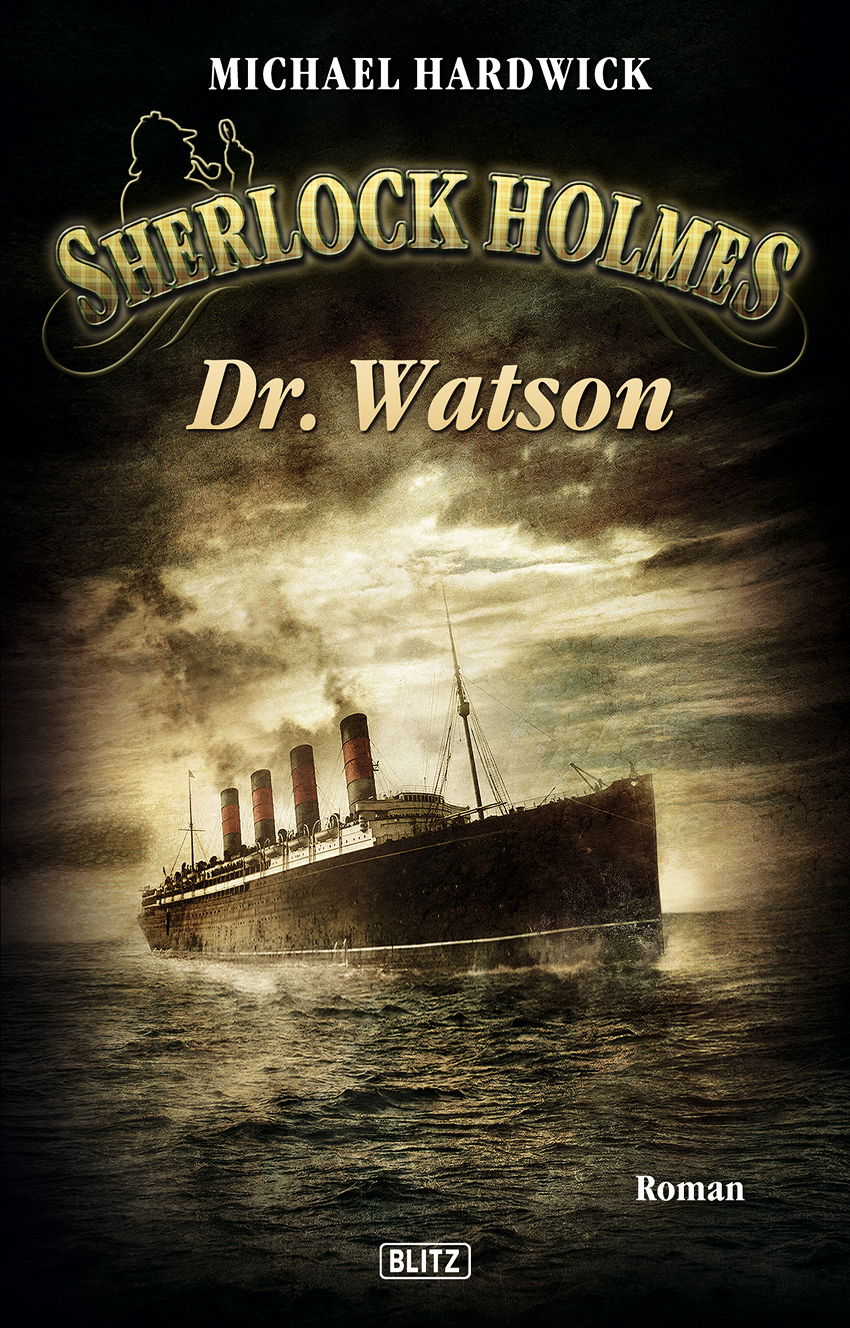Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Ohne meinen Boswell wäre ich verloren
„Wie geht es Ihnen? Sie waren in Afghanistan, wie ich sehe.“ So lauteten die ersten Worte, die Sherlock Holmes am 1. Januar 1881 im Chemielabor des St. Bartholomew’s Hospital an mich richtete. Zu jener Zeit fühlte ich mich in dreifacher Hinsicht schlecht. Ich war niedergeschlagen, plagte mich mit Zukunftsängsten und litt unter Katzenjammer. Dennoch hätte ich selbst auf der Höhe meiner Kräfte nicht vermutet, welche Folgen dieses Treffen nach sich ziehen sollte.
James Boswell berichtete über seine erste Begegnung mit dem großen Literaten Samuel Johnson folgendes.
Mr Davies stellte mich ihm vor. Da ich Johnsons tödliche Antipathie gegen die Schotten kannte, sagte ich zu Davies: „Erzählen Sie nicht, wo ich herstamme.“
Dennoch tat er es.
„Mister Johnson“, sagte ich also, „in der Tat komme ich von Schottland, aber ich kann nichts dagegen tun.“
„Sir“, antwortete er mir, „dagegen, finde ich, kann eine große Menge Ihrer Landsleute nichts tun.“
Unsere Unterhaltung hingegen verlief anders. Ich beschrieb meinen jüngsten Aufenthalt in Afghanistan nicht, sondern fragte Holmes, woher er überhaupt davon wisse. Er ging nicht darauf ein, und ich erhielt erst einige Wochen später Aufschluss, als er mir offenbarte, er verdinge sich als beratender Detektiv.
Sein Gedankengang war folgender gewesen, und er hatte ihn in Sekundenschnelle gefasst. Dieser Gentleman arbeitet im medizinischen Bereich, kann seine militärischen Dünkel aber nicht verhehlen, also muss er Feldarzt sein. Er ist gerade aus mindestens subtropischen Gefilden zurückgekehrt, woher auch sein dunkler Teint rühren muss. Es handelt sich um natürliche Bräune, denn die Haut oberhalb der Handgelenke bleibt davon ausgenommen. Er hat Strapazen und Krankheit hinter sich, wie man eindeutig an seinem Gesicht erkennt. Sein linker Arm wurde verletzt, weshalb er ihn verkrampft und starr von sich streckt. In welchem Land mit entsprechendem Klima kann sich ein britischer Armeedoktor im Zuge großer Anstrengungen in jüngster Zeit verletzt haben – außer Afghanistan?
Diesem ersten Zeugnis seiner Kombinationsgabe sollten noch viele weitere folgen, die ich mitvollziehen durfte. Zudem ward ich im Laufe unserer langjährigen Beziehung wiederholt dazu ermutigt, ihm darin nachzueifern. Meine bislang veröffentlichten Geschichten widmen sich seinen besonders denkwürdigen Fällen, derweil noch viele, die er darüber hinaus gelöst hat, niedergeschrieben werden müssen. Seine einzigartige Gabe überraschte mich immer wieder aufs Neue, obwohl er nicht immer ausschließlich ins Schwarze traf, wie die folgenden Memoiren offenlegen werden.
Holmes kam von selbst auf die Idee, mich als seinen Boswell zu bezeichnen, woraufhin sich nicht vermeiden ließ, dass ein Teil der Aufmerksamkeit und Huld, die ihm zuteil wurde, auf mich, seinen Chronisten und Mitstreiter bei zahlreichen Abenteuern, abstrahlte. Falls es nicht zu anmaßend klingt, will ich mich auch als seinen engen Freund bezeichnen, und zwar trotz seines strengen und reservierten Charakters, der Zweisamkeit nicht als zwingend notwendig erachtete. Über seine Persönlichkeit und Herkunft wurde viel – und nicht unbedingt richtig – spekuliert, genauso wie manche meiner Leser versuchten, von den Geschichten auf mein eigenes Leben und Wesen zu schließen, obwohl ich nicht beabsichtigte, viel von mir darin preiszugeben.
Indem ich nun eine ausführlichere Biografie meiner selbst folgen lasse, will ich keine Aufmerksamkeit heischen, sondern wünsche mir zweierlei. Erstens soll die breite Öffentlichkeit bislang nicht angesprochene Einzelheiten erfahren, zweitens muss ein für alle Mal Klarheit herrschen bezüglich der Sachverhalte, die meine besonders kritischen Leser bisher eigenartig beziehungsweise unzureichend erläutert fanden.
Sicherlich werden weder die Bekanntgabe meines Geburtsortes und vollen Namens noch Beschreibungen zu meiner Familie und Erziehung Erdbeben auslösen, genauso wenig wie die Fügungen, die mich Arzt werden ließen, die genaue Beschreibung meiner Kriegswunden oder eben der Zufall, durch den ich Holmes’ Bekanntschaft machte. Andererseits glaube ich nicht, dass die skurrileren Facetten meiner bisweilen aufregenden Reisen und Unternehmen ihr Ziel verfehlen werden. Wie viel Bedeutung man meiner beiläufigen, aber viel diskutierten Bemerkung zumisst, ich halte mir eine Bulldogge, und ob meine Bewunderung für Henry Ward Beecher, dessen Porträt ich mir ohne Rahmen aufgehängt habe, wirklich so sensationell ist, wie Holmes unsinnigerweise annahm, oder mit welchem Recht ich behaupte, in verschiedenen Ländern auf drei unterschiedlichen Kontinenten Frauen beglückt zu haben … nun, ich überlasse es dem Leser, seine Erwartungen bezüglich der Fakten, die er im Folgenden einsehen wird, herunterzuschrauben, oder nicht.
Ich gehe nicht davon aus, mein Ansehen bei den Menschen zu schmälern, die mir stets gewogen waren, indem ich alles über mich erzähle. Samuel Johnson meinte einmal, müsste er sich keine Gedanken über seinen zukünftigen Ruf machen, täte er nichts weiter in seinem Leben, als hübschen Frauen in rasenden Postkutschen Gesellschaft zu leisten. Wenn ich persönlich meine Flegeljahre Revue passieren lasse, kommt es mir vor, als hätte ich nichts weiter getan als ebendies.
John H. Watson
Kapitel 1
Die menschliche Natur ist doch ein recht wunderliches Gemisch
Dass wir unsere stolzen Kriegsschiffe seit Jahrhunderten auf Namen taufen, die eher zu Wirtshäusern passen, ist für die britische Seele bezeichnend, bloß weiß ich nicht, in welcher Hinsicht, auch wenn mir dieser Gedanke schon oft durch den Kopf gegangen ist. Rose, Distel oder Bär sind Stilblüten aus dem Elisabethanischen Zeitalter, falls sie nicht noch weiter zurückreichen, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass es einmal Ihrer Majestät Schiff Rose & Krone oder Edler Landwirt gegeben hat.
Keinen solchen Namen trug indes die Galeone, die in einer finsteren Septembernacht des Jahres 1588 von einem gnadenlosen Sturm bei tosender See in den Nordkanal zwischen Irland und der Westküste Schottlands getrieben wurde, an deren schroffen Klippen sie zerschellte. Ihr Name lautete Galeón del Gran Duque di Florencia del Nombre San Juan. Wie viele Passagiere überlebten, verschweigen uns die Historiker. Mr Ashby von der englischen Botschaft in Schottland schrieb seinem Herrn Sir Francis Walsingham, dem Chef des Geheimdienstes von Königin Elisabeth folgendes. Ein riesiges Schiff aus Spanien, das ein Soldatenheer beförderte, ist in der Nähe von Black Head an Eurer Küste gekentert. Es gibt große Verluste zu beklagen. Wir gehen davon aus, dass seine Fracht sehr wertvoll war.
Ich weiß noch, dass Vater an jener Küste oft mit mir und meinem Bruder Henry zu einer Bucht ein Stück nördlich vom Leuchtturm bei Black Head spazierte. Die Kulisse an sich sowie Gedanken an das tragische Unglück und die Verzweiflung der Opfer beflügelten unsere Phantasie. Im unaufhörlichen, obschon im Vergleich zum damaligen Unwetter wohl gediegeneren Rauschen des Meeres lauschte ich immerzu angestrengt nach den geisterhaften Hilfeschreien ertrinkender Spanier und dem Knarren der Planken, bis ich zu hören glaubte, wie der Schiffsrumpf an den erbarmungslosen Felsen zerbarst.
„Wird man es je bergen?“, wagte ich zu fragen. Ich konnte nicht glauben, dass mein alter Herr seelenruhig Pfeife schmauchend nach unten in die wirbelnde Gischt schaute, und verstand nicht, warum wir keine Wathosen, Schaufeln sowie andere Ausrüstungsgegenstände mitgebracht hatten, um nach Dublonen zu graben.
„Nein, nein“, antwortete Vater meistens in seinem unverkennbaren Tonfall, einem nahezu akzentfreien Englisch, das fast so rein war wie Single Malt Whisky und kaum erahnen ließ, dass er aus Schottland stammte. „Die See wird nicht zurückgeben, was sie in jener Nacht nahm. Es war ein Tribut, den sie einforderte und an sich riss.“
Mit seiner poetisch klingenden Begründung gaben wir Jungen uns allerdings nicht zufrieden. Von Zeit zu Zeit waren Münzen und andere kleine Gegenstände angespült worden, also wollte es der Zufall, dass man vielleicht irgendwann dort stand, wenn ein kleines Vermögen an Land schwappte. Gerade mein Bruder, der von jeher ein ungeduldiges Gemüt hatte, pochte ständig auf eine Ausgrabung, und so bemühten wir einmal tatsächlich unsere Blechspaten, während sich Vater auf die Felsen setzte und gemütlich weiterrauchte. Wir verstanden nicht, weshalb er völlig ruhig blieb, wo doch große Reichtümer auf uns warteten … oder auch nicht. Nach einer Weile gaben wir schließlich auf und kletterten zurück zu Vater. Nachdem wir uns links und rechts neben ihm niedergelassen hatten, starrten wir ebenso versonnen wie er auf das Wasser, das an jenem Tag sehr still blieb. Nie hätte man geglaubt, dass es an dieser Stelle einmal zu einer solchen Tragödie gekommen war.
„Falls wirklich ein Schatz an Bord war“, sagte Vater irgendwann, „hat er auf ewig ein nasses Grab gefunden. Wisst ihr, es gibt andere Dinge im Leben, die wertvoll sind. Was eines Nachts vor langer Zeit hier geschah, hat sich letztlich auch auf die Beschaffenheit des Blutes ausgewirkt, das in euren Adern fließt.“
Auf dem Kamin seines Arbeitszimmers in der Hanover Street stand ein hölzernes Modellschiff, eine spanische Galeone. Ein Matrose hatte es zum Zeitvertreib während einer langen Überfahrt gebaut, doch nach seinem Tod war es beim Ausräumen seines Hauses von den Hinterbliebenen weggeworfen worden. Vater, über dessen Maklerbüro das Anwesen weiterveräußert worden war, hatte das Modell aus dem Müll gerettet. Es stellte nicht die San Juan selbst dar, gab aber einen trefflichen Eindruck von ihr und allen anderen Schiffen jener mächtigen Flotte, die das formidable Dreigespann aus Sir Francis Drake, Lord Charles Howard Effingham und Gott allen Erwartungen zum Trotz bezwungen hatte.
Der Grund dafür, dass er es behalten hatte, ließ sich aus Vaters Zügen ablesen. Er hatte ein langes, schmales Gesicht mit hoch stehender Nase, pechschwarzes Haar und einen ebensolchen Schnurrbart sowie braune Augen, was ihm zusammengenommen ein melancholisches Erscheinungsbild verlieh. Ich bewunderte seine hochgeschossene, schlanke Figur, die er in einen schwarzen Zweireiher, Kniehosen und weiße Hemden mit dem damals üblichen Rüschenkragen kleidete. Dieser Aufzug stellte zugegebenermaßen einen Kontrast zu seinem Vornamen John Henry dar, der geschichtlich schon damals nicht wenige Assoziationen weckte.
Ich selbst habe mich über die Jahre hinweg körperlich kaum verändert, bin untersetzt und galt immer als durchschnittlich groß für mein jeweiliges Alter. Meine Augen sind eher grau, und ich habe ein kantiges Kinn, aber vom Gemüt her bin ich meiner Mutter nachgeschlagen, wohingegen mein Bruder Henry Vaters Sinnesart geerbt hat. Ich darf froh sein, keine seiner Neigungen mit auf den Weg bekommen zu haben, obschon ich ihn oft um sein anmutiges Aussehen beneidete.
Um auf seine Bemerkung über unser Blut zurückzukommen: Einer der Schiffbrüchigen lebte noch lange genug in der Gegend, um sich mit einer Schottin zu vermählen. Jene Seeleute und Soldaten, die an unserer Küste an Land gekrochen waren, konnten von Glück reden, dass die Einheimischen sie zu sich nahmen und aufpäppelten. Man betrachtete sie nicht als feindselige Fremdgläubige, sondern schlicht als arme Seelen, die den Turbulenzen der See entronnen waren. Wen es von ihnen hingegen nach Irland oder England verschlug, der wurde rigoros dahingerafft.
Auch weil sich unsere Ahnenbücher über jene frühe Zeit ausschwiegen, war ich fasziniert von meinem Stammbaum, weshalb ich Vater ständig dazu nötigte, die Familienlegende abermals zu erzählen.
„Ich bin mir ziemlich sicher, dass er zur Armee gehörte.“
„Als Admiral?“
„So hochrangig war er wohl leider nicht, eher ein einfacher Matrose.“
„Aber doch wenigstens General?“
„Diese Position war in der spanischen Marine zu jener Zeit nur Männern aus dem Hochadel vorbehalten, und als solcher hätte er sich nicht hier abgekapselt, sondern wäre in seine Heimat zurückgeführt worden.[1] Er hieß Henriques, soviel wir wissen.“
„Woher, Papa?“
„Der Name hielt sich ungefähr bis zum Anfang dieses Jahrhunderts in unserer Familie. Mein Großvater trug ihn zuletzt ebenfalls an zweiter Stelle. Ich glaube, er fand ihn zu ausgefallen für seinen eher verstockten Charakter, also anglisierte er ihn irgendwann zu Henry.“
„Ich hätte ihn gern getragen“, erwiderte ich, denn der Klang gefiel mir. „John Henriques Watson.“
Mein Vater lachte. „Du kannst immer noch einen deiner Söhne so taufen, obwohl er dir für einen so aparten Namen bestimmt nicht danken wird.“
„Ach was“, wiegelte ich ab. „Er klingt besser als Hamish. Pfui!“
„Jetzt ist aber gut, John! Du musst Mutters Mädchennamen achten.“
„Verzeihung, Papa. Was weißt du noch über den spanischen Matrosen?“
„Er muss beim Untergang des Schiffs arg in Mitleidenschaft gezogen worden sein, da er hinterher monatelang bettlägerig war, auf einer der Burgen in der Nähe, wie es heißt, möglicherweise Castle Kennedy. Die Tochter des Vogts pflegte ihn gesund, und wie es eben geschieht, traf Amors Pfeil auch diese beiden.“
„Was ist Amors Pfeil, Papa?“
„Das wirst du früh genug alleine herausfinden. Bald, mein Junge.“
„Tat es weh?“
„Nein. Sie heirateten und bekamen Kinder mit sowohl schottischem als auch spanischem Blut. Was glaubst du, bedeutet es, dass seine Nachfahren Watson heißen?“
„Darauf weiß ich keine Antwort, Papa.“
„Ach komm, dir ist doch klar, dass eine Lady den Nachnamen ihres Mannes annimmt, wenn sie ihn heiratet.“
„So wie Mama, die früher Miss Hamish war?“
„Richtig. Und als wir uns trauten, wurde sie Misses Watson. Zu welcher Annahme verleitet dich das?“
„Dass … eine Miss Henriques auch einen Mister Watson geheiratet hat?“
„Genau. Man muss bisweilen rückwärts denken, wenn man Herkunftsfragen erörtert. Falls du je einen Grabstein findest, auf dem etwas zum Gedenken an irgendeinen Henriques und seine Frau soundso steht, lasse ich einen halben Sovereign springen, wenn du meine Behauptung widerlegst, er und seine Gattin hätten nur Töchter gezeugt. Eine von ihnen heiratete eben einen Watson, woraufhin der Name Henriques so plötzlich aus dieser Gegend verschwand, wie er aufgetaucht war.“
„Klingt spannend, Papa.“
„Papperlapapp! Zeige mir einen oder eine Henriques in unserer Gegend, und du bekommst Geld.“
Während ich noch in Wigtownshire wohnte, begab ich mich wiederholt auf die Suche, indes stets ohne Erfolg. Die Spuren unseres Spaniers waren genauso gründlich verschwunden wie der Schatz, den sein Schiff möglicherweise befördert hatte. Sein Vermächtnis trugen nichtsdestoweniger sowohl Vater als auch Henry in ihren Zügen und Veranlagungen weiter.
Mutter stammte von Engländern und Schotten ab, die jeweils unterschiedlichen Gesellschaftsschichten angehört hatten und verschiedenen Berufen nachgegangen waren. Diese Sippe, die Hamishs aus Garbeg, brüstete sich als Nachkommen der MacKenzies von den Hebriden. Roderick MacKenzie, so hieß es, sei in der Schlacht bei Culloden ehrenvoll für seinen Prinzen in den Tod gegangen. In meiner Generation lebte noch ein Wildhüter aus jener Familie, der zwei gänzlich unterschiedliche Söhne hatte. Donald, der ältere, war Baumeister, wohingegen sein Bruder Angus in den häuslichen Dienst trat und sich zum Butler aufschwang, den die erlauchten Kreise der Londoner Gesellschaft kannten und schätzten.
Mutters Vorname lautete Violet. Ihr Vater hatte als Arzt in Bagshot in Surrey praktiziert. Als ich alt genug war, um mich in zunehmendem Maße für unser Paarungsverhalten sowie die Hintergründe zu interessieren, die zur Fortpflanzung führten, fragte ich, wie sie Vater kennengelernt hatte, auch weil ich wissen wollte, welche Rolle das Schicksal oder der Zufall (oder wie auch immer man es nennen wollte) dabei gespielt haben mochte.
Das Gespräch fand während der 1860er-Jahre statt, als Mutter und ich weit weg von Vater und Henry in Amerika weilten und einander infolgedessen näher denn je standen. Während wir uns unterhielten, saßen wir auf einer Bank im damals gerade fertig gestellten Central Park und schauten zu, wie die Eichhörnchen ihrem Tagewerk nachgingen, derweil reiche New Yorker Gentlemen mit ihren gewaltigen Hengsten eine Runde nach der anderen auf der Sandbahn drehten.
„Es war ziemlich romantisch, wenn ich heute darüber nachdenke“, gestand sie. „Deine Großeltern fuhren im Frühjahr ’46 mit uns Mädchen, also auch deinen Tanten Flora und Verbena, in den Urlaub. Wir sollten in Stranraer übernachten und tags darauf mit dem Dampfer nach Coleraine übersetzen.“
„Und Papa lebte schon in Stranraer?“
„Zum Glück für mich, ja. Ich machte einen Spaziergang am Ufer, um die Küstenluft zu genießen und die Boote zu beobachten. Da es sehr laut war, hörte ich nicht, dass jemand rief, ich solle aus dem Weg gehen. Ehe ich mich versah, stieß etwas gegen meine Kniekehlen, und ich taumelte vorwärts.“
„Um Himmels willen! Du wärst beinahe ins Hafenbecken gefallen?“
„Ja … aber vorher schlang jemand seine Arme um meine Taille. Ich befürchtete trotzdem, ins Wasser zu stürzen. Du kannst dir ja vorstellen, wie tief hinunter es ging. Umso froher war ich, dass ich rechtzeitig festgehalten und schließlich behutsam zurückgezogen wurde. Der Retter war dein Vater. Hätte er nicht gesehen, wie ich angerempelt wurde, und so rasch reagiert, wärst du wohl nie zur Welt gekommen, und ich könnte nicht davon erzählen.“
Ein religiöser Mensch mag glauben, Gott habe seine schützende Hand über Mutter gehalten, aber ich bezweifle stark, dass der Allmächtige sie bewahrt hatte, nur damit ich einmal auf seiner Erde wandeln würde.
„Papa ging ganz zufällig vorbei?“
„Kommt darauf an, was du mit zufällig meinst.“ Mutter war zu jener Zeit sehr gottesfürchtig. „Er kam zum Hafen, um eine Fahrkarte für denselben Dampfer zu lösen, den wir am nächsten Morgen nehmen wollten. Dann sah er, wie ein Gepäckträger auf dem Pflaster ausrutschte, wobei ihm sein Karren aus den Händen glitt und auf mich zurollte. Just als er mich erreichte, bekam mich dein Vater zu fassen. Andernfalls …“
Den Rest malte ich mir blumig aus. „Er bestand darauf, dich ins Hotel zurückzubringen, wo du ihn der Familie vorgestellt und erklärt hast, wie er dein Leben rettete. Großvater schüttelte seine Hand und gab zu, keine Worte zu finden, um ihm angemessen danken zu können. Am folgenden Tag habt ihr alle gemeinsam den Kanal überquert. Als ihr in Larne getrennter Wege gegangen seid, wart ihr schon eng miteinander befreundet.“
Mutter schaute mich lächelnd an. „Du bist auch sehr romantisch, mein Junge. Vielleicht wirst du später Schriftsteller … der nächste Walter Scott.“
Schließlich standen wir auf und flanierten weiter durch den Park, wobei andere Themen zur Sprache kamen. Die beiden heirateten im Herbst 1847. Mein Vater kam dazu nach Bagshot und nahm Mutter hinterher mit nach Stranraer, wo er zuvor zum jüngeren Teilhaber des Immobilienhandels gekürt worden war, in dem er Zeit seines Lebens arbeiten sollte. Mein Bruder kam zwei Jahre später zur Welt, ich selbst am 7. Juli 1852.
Unsere heitere kleine Familie lebte an einem hübschen Fleck gleich an der Spitze des Loch Ryan. Wir hatten ein bescheidenes Häuschen, in dem man Steine der Burgruine verbaut hatte, und zwei Diener, die bei uns wohnten. Unser Laufbursche hingegen kam aus dem örtlichen Waisenheim. Als Henry und ich alt genug waren, besuchten wir eine Privatschule, die von einer netten betagten Dame geleitet wurde, einer Engländerin durch und durch. Sie legte großen Wert auf gepflegte Aussprache und trieb uns den schottischen Akzent gänzlich aus, was ich heute mitunter als Verlust empfinde.
In einem Teil der Welt, wo die Menschen eher sesshaft waren und ihre Güter weitervererbten, florierten Geschäfte mit Grundstücken nicht unbedingt. Es gab keine Baulöwen, die Prachtvillen aus dem Boden stampften, und von Tourismus konnte noch keine Rede sein. Als ich ungefähr zehn war, bestand Vaters Arbeit größtenteils darin, sich um die Angelegenheiten von Grundbesitzern in Irland zu kümmern, die nicht ortsansässig waren. Mindestens einmal wöchentlich nahm er die Fähre nach Larne, wo er auf einigen Abstechern auch ein- oder zweimal übernachtete. In der Stadt gab es schöne Golfplätze, auf denen er gewissermaßen süchtig nach diesem Sport wurde.
Bedauerlicherweise entwickelte er auch andere Abhängigkeiten. Larne war berühmt für seine Brennerei, die einen bemerkenswerten Irish Whiskey herstellte, und einer der Leiter dort knüpfte freundschaftliche Bande mit Vater, sowohl beim Golfen als auch abseits der Grünflächen. Wie so oft darf man sich fragen: Musste es so kommen, war es Fügung oder etwas anderes?
Kapitel 2
Dass bei ihm schlimme Einflüsse am Werk sind – vermutlich Alkohol
„Klingt spannend, Papa.“
„Papperlapapp!“
Mein Freund Sherlock Holmes musste mir oft wieder vergegenwärtigen, dass man rückwärts denken muss, um Ursachenforschung zu betreiben. Diese Erinnerung war zugleich lehrreich und erheiternd, zumal ich nicht selten glaubte, hinter seinen schneidenden Worten den sanfteren Tonfall zu hören, mit dem mein Vater auf mich eingeredet hatte. Daraus zog ich für mich den unheimlichen Schluss, dass Vater in Holmes nachklang oder ihn vorwegnahm, je nachdem.
Denke ich genauer darüber nach, stelle ich fest, dass die beiden nicht nur auf ähnliche Weise argumentierten, sondern einander auch äußerlich glichen. Der hohe Wuchs und die schlanke Figur, eine spitze Nase und wachsame Augen in einem hellhäutigen, glatt rasierten Gesicht, darüber eine breite Stirn und schwarzes Haar, das nach den Seiten zurückwich. Zudem sah man Vater wie Holmes selten ohne Pfeife, wenn er die Seele baumeln ließ oder in meditativer Stimmung war. Morgens, bevor er ins Büro aufbrach, zog er einen nüchternen Cutaway an, wohingegen zum Ausgehen ein erdfarbener Überwurf sowie eine Mütze herhielten. Der Paletot und die karierte Schirmmütze mit zusätzlicher Krempe hinten, die Holmes auf vielen unserer Erkundungen außerhalb Londons trug, waren in meiner Kindheit noch nicht gebräuchlich gewesen, aber ich kann mir denken, wie trefflich beides meinem Vater gestanden hätte.
Weiterhin waren die Interessen der beiden breit gefächert. Sie trennten sich ungern von bestimmten Schriftstücken und Andenken jeglicher Art, bewahrten sie aber dennoch nur leidlich geordnet auf. Dazu führten sie Notizblöcke, auf deren Seiten sie allen möglichen Themen nachhingen, die sie gerade beschäftigten. Eine Zeit lang verfiel Vater einem Sammlertrieb, wobei er Muscheln, Blätter und andere Pflanzenteile bevorzugte. Vorübergehend pflegte er jede Kollektion mit großem Eifer, doch nicht lange, und er versteifte sich auf etwas anderes, genauso sprunghaft wie Holmes im ständigen Hadern mit der Langeweile, die ihm der Müßiggang verhieß.
Mittlerweile begreife ich, dass dieser auch Vaters größter Feind war, obgleich er immer sehr gelassen wirkte. Ich entsinne mich einer frühen Unterhaltung, die ich seinerzeit nicht richtig deuten konnte, weil mir die Reife dazu fehlte. Das Gespräch erfolgte während eines unserer vielen Besuche in jener kleinen Bucht nördlich von Black Head. Henry war davon überzeugt, er stoße diesmal auf Gold, und wir buddelten eine Weile in den Sandadern zwischen den Felsen. Ich warf meine Schaufel jedoch bald hin und kehrte zu Vater zurück. Er nippte gerade an einem Flachmann, aber als er mich kommen sah, verschraubte er ihn schnell, steckte ihn weg und klemmte stattdessen wieder seine Pfeife zwischen die Zähne.
Ich ließ mich neben ihm nieder und schaute zu, wie er sie anzündete. „Bist du je übers Meer gesegelt, Papa?“
„Du weißt doch, dass ich häufig nach Larne fahre.“
„Ich meinte nach Übersee. Ins Ausland.“
„Nein, ich habe noch keine weite Reise gemacht.“
„Willst du das irgendwann nachholen?“
„Dass sich eine Gelegenheit dazu auftut, bezweifle ich. Dieser Zug ist abgefahren. Aber früher spielte ich mit dem Gedanken. Bloß …“
„Was, Papa?“
Er trotzte sich ein kurzes Lachen ab, das für mich nicht gänzlich aufrichtig klang. „Ja, damals träumte ich davon, mich in der Welt herumzutreiben.“
„Das tue ich auch.“
„Bestimmt wirst du die Möglichkeit erhalten.“
„Du selbst hattest nie eine, oder?“
„Doch … aber sie war vertan, noch ehe ich sie ergreifen konnte.“
„Wie meinst du das?“
Er tätschelte eines meiner Knie, ohne die Augen von der See abzuwenden. „Sagen wir einfach, ich habe eine Frau kennengelernt und geheiratet. Dann traten zwei liebe Buben in Erscheinung, um sich zu uns zu gesellen, und für einen Mann, der auf seine Familie achtgeben muss, schickt es sich nicht, ein Dasein als Streuner zu wählen.“
Wäre er also nicht vorbeigekommen, als Mutter beinahe ums Leben kam, hätte Vater wohl einen völlig anderen Weg eingeschlagen. Er kam nie dazu, sich die Hörner abzustoßen, wie man so sagt, weil er die Chance dazu schon früh ausgeschlagen hatte, indem er heiratete und Nachkommen zeugte. Die Parallele zu Sherlock Holmes ist wiederum frappant. Als mein Freund noch Drogen nahm, schlug er meine Warnungen und Proteste vornehmlich mit dem Einwand in den Wind, er könne es nicht ertragen, auf der Stelle zu treten. „Das Leben ist banal, die Zeitungen sind geistlos, Wagemut und Romantik scheinen auf immer aus der Welt des Verbrechens entschwunden zu sein.“ Im Bann solch trister Erwägungen kam es dazu, dass er auf die Schatulle aus Saffianleder zurückgriff, in der er sein Spritzbesteck aufbewahrte, aber kaum erhielt er einen Brief, ein Telegramm oder Besuch von einem Klienten, verwandelte er sich wieder in einen Tatmenschen und konzentrierte seine herausragenden Fähigkeiten auf ein Rätsel, das zu lösen ihm die einzige Befriedigung verschaffte, die er in Wirklichkeit brauchte.
Mein Vater hatte keine Aussicht auf eine solche Art von Linderung. „Freiheit und Whiskey gehören zusammen“, frotzelte mein Landsmann Robert Burns dereinst, und dementsprechend suchte mein Erzeuger sein Heil in der Flasche.
Vielen Erwachsenen – und erst recht kleinen Jungen – entgeht, dass sie es mit einem Säufer zu tun haben, es sei denn, die Person stürzt vor ihren Augen, aber ich habe meinen Vater kein einziges Mal in der tragikomischen Rolle des betrunkenen Schotten erlebt, der abwechselnd aggressiv und weinerlich ist. Erst eines Morgens 1863, kurz vor meinem elften Geburtstag, fiel es mir auf, nachdem er von einem seiner Abstecher nach Larne zurückgekehrt war.
Er und Mutter stritten sich laut hinter verschlossener Wohnzimmertür. Ich verharrte auf dem Flur und wusste nicht, ob ich Mäuschen spielen oder weggehen sollte, damit ich das peinliche Wortgefecht nicht mitbekam. Wie ich noch mit mir haderte, flog plötzlich die Tür auf, und Mutter stürmte heraus. Sie hielt sich ein Küchentuch vor die verweinten Augen und lief laut schluchzend an mir vorbei, packte das Treppengeländer und eilte hinauf ins Schlafzimmer. Gleich darauf ließ sich Vater blicken. Sein ungewöhnlich rotes Gesicht war wie erstarrt, als er mich anschaute. Dann schüttelte er heftig den Kopf, wie um einen klaren Blick zu fassen, und verschwand ebenfalls ins Obergeschoss.
Jetzt erst bemerkte ich, dass mein Bruder hinter mir auf die Diele getreten war, unauffällig wie so oft. Er schnitt eine Grimasse und beschrieb eine ruckartige Geste mit einer geschlossenen Hand, als trinke er aus einem Becher. „Stinkbesoffen“, sagte er.
„Mama? Besoffen?“
„Nein, du Dummkopf! Der Alte.“
Henry war cleverer, nicht so naiv wie meine Wenigkeit. Immerzu nahm er in Kauf, dass ich handgreiflich wurde, wenn er sich darüber lustig machte, dass ich mich nicht für Musik erwärmen konnte und Abenteuergeschichten las, aber Shakespeares Stücke oder Byrons Gedichte verschmähte. Zudem befremdete ihn, dass ich mich nicht für griechische und römische Mythologie interessierte, also sah er geringschätzig auf mich herab, vermutlich genauso wie unser spanischer Urahn im Angesicht niederer Bauern.
„Du hattest keine Ahnung davon?“, höhnte er. „Mama meinte, ich solle die Klappe halten, aber eigentlich ging ich davon aus, du wärst von alleine daraufgekommen.“
Ich mochte drei Jahre jünger sein als Henry, doch körperlich nahm ich es spielend mit ihm auf und fackelte normalerweise nicht lange, seine Beleidigungen zu ahnden. Diese Situation stellte eine der wenigen Ausnahmen dar, denn ich war verwirrt und bekam Angst. „Ich glaube dir nicht. Der Schluckspecht Hudson benimmt sich ganz anders.“
Damit bezog ich mich auf einen bekannten Trinker, der am Hafen herumlungerte. Er war ein Seebär von echtem Schrot und Korn, den das Alter und eine Krankheit, über die ich nichts Genaueres wusste, heruntergewirtschaftet hatten. Er soff unverhohlen und zwanghaft, derweil sich seine Kumpane an aberwitzigen Liedern über die leichten Mädchen von Rio und Frisco, Sydney und anderen Küstenstädten erfreuten, in die es diese bedauernswerte Gestalt einst verschlagen hatte.
„Du bist so blöde, dass du als Engländer durchgehst“, entgegnete Henry. Er wähnte sich wohl im Vorteil, weil ich noch vor den Kopf gestoßen war, und erörterte Vaters Verfassung weiter. „Hast du nicht gesehen, wie er torkelt? Er ziert sich davor, fest aufzutreten, als würde er auf Eiern laufen.“
Ich fragte mich, wie ich meinem alten Herrn je wieder in die Augen schauen sollte. Als ich ihn danach traf, saß er im Wohnzimmer und frönte entspannt wie üblich dem Tabak. Er erwiderte meinen verhaltenen Gruß, als habe sich nichts zugetragen, aber in gewisser Weise war ja auch alles wieder normal. Allerdings erkannte ich nun, dass seine Stille nichts mit Gelassenheit zu tun hatte, sondern mit Stumpfsinn.
Als er am nächsten Tag im Büro war, während Mutter Besorgungen im Ort machte, weihte mich Henry gänzlich ein. Nie werde ich vergessen, wie mich der Rundgang entsetzte, den er mit mir machte; gut ein Dutzend Plätze im Haus zeigte er mir, an denen man nichts Böses wähnte, doch überall waren halbvolle Flaschen versteckt.
„Ich hätte Lust, sie kaputtzumachen!“, bekannte ich. „Machst du mit?“
„Was soll das bringen? Wo auch immer er sie gekauft hat, gibt es noch mehr.“ Wie er so sprach, war mir, als nähme mich Henry ernster als sonst. „Was weiß ich? Kann nicht sagen, was wird, aber lange wird das nicht mehr gut gehen.“
Er sollte recht behalten.
Noch im gleichen Monat verlor Vater seinen Posten. Da er als Partner fungiert hatte, konnte er wohl nicht gefeuert werden, weshalb man ihn bat, seinen Hut aus eigenen Stücken zu nehmen. Er erhielt eine Abfindung, also stürzte uns dieses Debakel nicht sofort ins Elend, wenngleich mich kalte Angst packte.
Mutter verbarg ihren Kummer wacker. Sie sah nicht besonders Ehrfurcht gebietend aus und war eher schmächtig gebaut, bewies aber innere Stärke. Eingedenk ihrer recht geringen Größe mutete sie fast schwerelos an, abgesehen von den bauschigen Röcken vielleicht, die sie wie alle Frauen gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts trug. Sie kämmte ihr sehr helles Haar stets an den Seiten zurück und flocht es manchmal auch zu mädchenhaften Zöpfen. Ihr schmaler Hals war außerordentlich lang und so weiß wie ihre zierlichen Hände. Die frische Luft in unserem Landstrich rötete ihre Wangen, was sich in makellos runden Flecken äußerte, die etwa so groß waren wie ein Penny und ihre leuchtend blauen Augen kontrastierten. Ihr Teint oder besser gesagt überhaupt ihr Aussehen und Auftreten hätte sie nicht drastischer von Vater und Henry abheben können. Mit knapp zwölf Jahren war ich nicht nur schon genauso groß wie Mutter, sondern auch breiter und bildete mir etwas darauf ein, dass ich ihr vom Gesicht her glich.
Mittlerweile wusste sie, dass ich von Vaters Sucht Wind bekommen hatte, aber zwischen uns fiel kein Satz darüber. Wenn wir allein waren, ging ich oft zu ihr und berührte sie in der Art eines treuen Hundes, der seinem Frauchen zur gegenseitigen Erbauung eine Pfote hinhält. Dann drückte sie mich an sich, und wir umarmten uns einige Momente lang schweigend, um Empfindungen zu teilen, die sich nicht mit Worten ausdrücken ließen.
Einmal nahm sie mich dabei mit ins Elternschlafzimmer und ließ mich neben sich auf der Bettkante Platz nehmen, bevor sie wieder einen Arm um mich legte. „John, du musst jetzt tapfer sein und Verständnis haben. Ich weiß, das kannst du.“
Ich bekam sofort Angst. „Was ist los, Mama? Bitte, sag schnell, auch wenn es schlimm ist.“
„Wir … wir wandern vielleicht nach Amerika aus.“
„Amerika!“
„Oh, mein armer Schatz!“ Sie klammerte sich an mich. „Verzeih, wenn ich dich erschreckt habe. Ich hätte es dir schonend beibringen müssen.“
Während sie mich in ihren Armen vor und zurück wiegte, schnaufte sie angestrengt. Ihre Sorge war jedoch umsonst, denn zum ersten Mal seit Wochen sah ich einen Lichtstreif am Horizont. Schon oft hatte ich mir den weiten Kontinent ausgemalt, von dem die Winde und Wellen herrührten, die für das Aussehen unserer Küstenlandschaft verantwortlich waren. Ich kannte die Geschichten von den ersten Reisen dorthin, hatte von den Siedlern gehört, Hinterwäldlern und Trappern, den Rothäuten und tapferen Rebellen, wie sich diejenigen nannten, die in Lexington, Bunker Hill, Yorktown und Saratoga gegen unsere Truppen antraten. Das Seemannsgarn der Leute am Hafen – ausgenommen die Räuberpistolen aus dem Munde des alten Hudson – hatte meine Sehnsucht nach diesem Land geschürt, in dem das Leben ein großes Wagnis darstellte, doch hier saß nun meine ahnungslose Mutter und weinte sich meinetwegen fast die Augen aus.
„Beruhige dich bitte, Mama.“
„Könnte ich es doch bloß vermeiden! Mein Ein und Alles einfach in die Fremde zu schleifen … Nein, du darfst nicht gehen. Du sollst hier in deiner Heimat bleiben, bei Opa und Oma Hamish.“
„Ich würde aber lieber Amerika sehen“, entgegnete ich.
Daraufhin verstummte Mutter eine Weile und geriet augenscheinlich ins Grübeln. Nachdem sie ein Mal tief durchgeatmet hatte, fuhr sie in ernstem Ton fort: „Den Grund dafür zu erfahren, ist dein gutes Recht. Weißt du, Papa … ging es eine Zeit lang schlecht. Er ist wieder ein wenig genesen, aber nachdem ihm Doktor Grieves zu einem Ortswechsel geraten hat, meint er leider, dazu über den Ozean reisen zu müssen.“
„Ich finde die Idee fabelhaft.“
„Der Doktor hatte aber wohl etwas anderes damit im Sinn.“
Ich wollte sie schnell zuversichtlich stimmen. „Die vielen Bilder, die ich von Amerika habe …“, begann ich und dachte sofort an deren Motive. Wagenburgen, die von mit Speeren bewaffneten Indianern belagert wurden, von Wölfen verfolgte Trapper in verschneiter Einöde und vergleichbare Szenen, die kaum zu Mutters Begeisterung beigetragen hätten. „Ich bin mir sicher, wir könnten dort glücklich werden.“
„Wir werden sehen, was am besten ist“, räumte sie ein. „Ich fahre nach Bagshot, um mit deinen Großeltern darüber zu sprechen.“
„Darf ich dich begleiten?“
„Nein, ich fürchte, das geht nicht, obwohl ich dich eigentlich mitnehmen sollte. Aber ich muss in Ruhe nachdenken.“
„Du weißt ja, dass sie in Amerika Gold gefunden haben.“
„Ja, man hört davon. Warten wir ab.“
So fand unsere Unterredung einen unverbindlichen Abschluss. Wie hätte ich damals vorhersehen können, dass Mutter diejenige war, die sich am meisten auf die Reise freute, als die Zeit kam, sie anzutreten?
Kapitel 3
„Wir streben nach etwas, wir ergreifen es.“
Um zu verdeutlichen, welche Einstellung Mutter zu jener Zeit vertrat und wie sie sich änderte, werde ich auszugsweise ihre Tagebücher zitieren, die mir nach ihrem Tod zukamen. Sie schrieb ohne literarische Vorüberlegungen und hatte demzufolge bestimmt keine Veröffentlichung im Sinn, also ist davon auszugehen, dass ihre Aufzeichnungen die unverschleierte Wahrheit widerspiegeln.
1. Juli. (1863) Kam schweißgebadet und erschöpft nach einer langen Zugfahrt in Bagshot an. Die Verpflegung war armselig und das Personal unfreundlich, aber es tut gut, Surrey wiederzusehen. Stranraer und die Probleme dort erscheinen mir weit weg, wiewohl ich beim Auspacken fast erwartete, einige von ihnen im Koffer zu finden. Gänzlich zurücklassen kann man solche Lasten nicht.
Nach dem Abendessen langes Gespräch mit Papa und Mama, Florie und Verbie. Alle zeigten sich bestürzt über H.s Alkoholismus (schlimm, dass ich so ein Wort schreiben muss!). Meine Schwestern waren besonders entsetzt, weil sie sich mittlerweile bei der Gesellschaft Band Of Hope für Abstinenz starkmachen. Demnächst wird in London eine Kundgebung dazu stattfinden, zu der ich sie unbedingt begleiten muss, wie sie meinen. Bin jetzt zu müde und bedrückt, überlege es mir aber noch.
Was Amerika angeht, glaubt Mama zu wissen, in einigen Staaten sei Alkohol verboten. Warum nimmt sich Schottland kein Beispiel daran? Papa macht sich Sorgen darüber, wie die Kinder den Umzug verkraften und was geschehen soll, falls sich H. nicht bessert. F. erzählte eine schaurige Geschichte von einem armen Mädchen aus Wales, das irgendwo dort in der Wildnis verwitwete und ihren Mann eigenhändig begraben musste. Außerdem herrscht Krieg in Amerika! Warum bloß bin ich damals nicht ins Hafenbecken gefallen und ertrunken?
2. Juli. Gut ausgeruht nach einer sehr erholsamen Nacht in meinem alten Zimmer. Begleitete Mama und Papa zu Base Heliotrope. Percy (ihr Mann) musste ausgerechnet wegen einer wichtigen Geschäftssache aufbrechen, als wir auf die Fortschritte des Verbandes der Church Of England für Enthaltsamkeit zu sprechen kamen, den es seit dem vergangenen Jahr gibt. Helio unterstützt die Bewegung ebenfalls und hat vor, das Treffen in der Hauptstadt zu besuchen. Ein komischer Gedanke, dass so viele aus unserer Familie dort sein werden. Sie wollten mich wieder zum Mitkommen überreden, aber ich glaube, das würde mich zu sehr belasten. Helio ist recht dick geworden; sie bekommt bald ihr vierzehntes Kind.
3. Juli. Kann die Kundgebung morgen Abend kaum erwarten! Heute Morgen war ich mit Mama bei Miss Dobbs, deren Vater einer der Mitbegründer der United Kingdom Alliance ist. Auch diese Verbindung ist darauf bedacht, die Produktion und den Verkauf von Alkohol zu verbieten. Sie helfen bei der Organisation des Treffens und haben Reverend Henry Ward Beecher für eine Ansprache gewonnen. Der berühmte Amerikaner weilt gerade in unseren Gefilden, um sich von seinem anstrengenden Amt in New York zu erholen. Base Pansy dient ihm ja dort. Er ist einer der größten Männer seines Landes und der Bruder von Harriet Stowe, die Onkel Toms Hütte geschrieben hat. Mein kleiner Schatz John weinte bitterlich, als ich ihm daraus vorlas.
Fand es immer schon schade, dass die Jungen Mr Beechers eigenes Werk nicht lesen wollten, sein Benimmbuch für junge Männer, das Pansy zu Henrys zehntem Geburtstag schickte.[2] Es war wohl noch ein bisschen schwierig für sie, aber vielleicht hätten sie sich doch noch dafür erwärmt, wäre es nicht ihres Vaters wegen im Kamin gelandet. Es gibt keinen Mann auf der Welt, den ich lieber anhören würde als Mr Beecher. Papa mag ihn einen schmierigen Yankee nennen; ich habe meinen eigenen Kopf.
5. Juli. Was ich gestern erlebte, lässt sich kaum in Worte fassen! Die Exeter Hall auf dem Strand, dieser umtriebigen Straße, platzte aus allen Nähten. Mir kam es vor, als sei der halbe Klerus Englands gekommen. Miss Dobbs meinte, die führenden Vertreter der Abstinenzbewegung hätten sich eingefunden.
Wie soll ich diese Lichtgestalt beschreiben? Er mag ungefähr fünfzig sein, strotzt aber noch vor Energie und frohem Mut. Darüber hinaus ist er mittelgroß und sieht stattlich aus, obwohl er recht wohlbeleibt ist und einen gedrungenen Hals hat, dazu eine hohe Stirn, die ihn erhaben aussehen lässt. Er hatte sich frisch rasiert, aber sein Gesicht neigt wohl generell zur Röte, während seine dunklen Haare auf die Schultern fallen und teilweise von grauen Strähnen durchzogen sind. Seine Augen bewegen sich forsch und scheinen alles zu erfassen, der Mund zeigt stets den Anflug eines Lächelns, das sich auch regelmäßig einstellt, aber all dies ist nichts im Vergleich zu seiner Stimme! Ich hatte damit gerechnet, dass er als einer von drüben nuschelt, aber stattdessen erklang die reinste Musik. So etwas habe ich bisher nur bei Sängern gehört.
Seine Gebärden entsprachen denen eines Schauspielers, der auf der Bühne den Ton angibt, anmutige Bewegungen, ausdrucksvolle Gesten, wechselhaftes Mienenspiel zwischen Sonnenschein und Donnerwetter, aber vor allem eben die Stimme. Er findet immerzu den perfekten Sprechrhythmus und Tonfall. Darum stellte ich hinterher fest, dass ich zu gebannt gelauscht hatte, um den Inhalt seiner Worte zu erfassen. Ich bin aber froh, am Ende doch mitgegangen zu sein.
Als Mutter nach Hause zurückkehrte, war sie immer noch unschlüssig darüber, was am besten zu tun sei. Überraschend traf ich sie im Schlafzimmer an, wo sie auf einem Stuhl vor dem Fenster saß und die Wolken betrachtete, die draußen am Himmel vorbeizogen. Dabei stützte sie das Kinn auf eine Hand und neigte den Kopf ein wenig zur Seite. Sie schien verbissen zu lauschen. Auch ich spitzte die Ohren, bemerkte aber nichts Außergewöhnliches. Wie ich mich räusperte und aufmerken wollte, schüttelte sie verärgert den Kopf, als hätte ich sie bei etwas unterbrochen. Also verschwand ich mit unbeantworteten Fragen auf den Lippen und wandte mich an Henry. „Was wird wohl passieren?“
Er schaute mich herablassend an. „Was tun, wenn Papa weggeht?“, erwiderte er zögerlich.
„Ohne Mama? Das würde er nie tun.“
„Ich glaube aber doch, falls sie sich nicht dazu durchringt.“
„Väter lassen ihre Frauen und Kinder nicht einfach so im Stich.“
„Und was ist mit Captain Buchanan?“
Dieser ehemalige Armeeoffizier aus Stranraer hatte seine Gattin mitsamt einer Schar Kinder zurückgelassen, um nach Australien zu segeln, und die Köchin der Familie mitgenommen, eine hagere Frau mit roter Nase, die gut zehn Jahre älter war als er. Selbst die Gerüchteküche hatte keine Affäre zwischen den beiden aufkochen können, aber der Mann war dafür bekannt gewesen, dass er großen Wert auf anständig zubereitetes Essen legte.
„Der gilt nicht“, widersprach ich. „Wenn es hart auf hart kommt, bleibe ich bei Mama und dir.“
„Das kannst du vergessen. Ich würde mich Vater anschließen.“
„Würdest du nicht!“
„Wir werden sehen.“
Ich spielte mit dem Gedanken, Vater ins Gebet zu nehmen, traute mich dann aber doch nicht. Nachdem die Frage, ob man auswandern solle, erstmalig zur Sprache gekommen war, hatte er sich vorübergehend umtriebig gezeigt, doch jetzt wirkte er lethargisch wie zuvor. Rückblickend zähle ich jene Zeit zu einer der unglücklichsten in meinem Leben.
Mit elf ging ich gemeinsam mit meinem Bruder zur Schule im Ort, wo der ehrenwerte Pastor P. J. Kennedy und seine Frau lehrten, ein einigermaßen angenehmes Paar, das sich um meine im Vergleich zu Henry eher durchschnittliche Begabung sorgte. Dass die beiden dies nicht in seinem Beisein anmerkten, dankte ich ihnen. Davon abgesehen war der Schulalltag trübe, weshalb ich mich umso mehr freute, Mutter mit ihrer glockenhellen Stimme singen zu hören, als ich eines Tages nach Hause kam. Sie hatte ein erbauliches Lied aus ihrem Fundus gewählt und strahlte über das ganze Gesicht.
„Du bist glücklich“, erkannte ich.
„Überglücklich, Schatz, oh ja!“, betonte sie und hüpfte geradezu von dannen und tirilierte dabei weiter.
Um dies zu erklären, kehre ich zu ihren Tagebüchern zurück.
2. Oktober. Wunderbare Neuigkeiten! Er ist zurück! Heute Morgen kam ein Brief von Miss Dobbs, die erzählt, er sei nach seinem Ausflug aufs Festland wieder in England und gedenke, eine Reihe öffentlicher Ansprachen zu halten. Am 13. tritt er im Glasgower Bürgerhaus auf, und ich habe gleich zurückgeschrieben, sie solle Karten für uns sichern. Will versuchen, H. zum Mitkommen zu überreden. Er braucht ihn nur zu hören und wird beeindruckt sein. Ich bete darum, dass Beecher ihn von seinen Nöten erlöst.
7. Oktober. Es hat keinen Zweck. H. lässt sich nicht überzeugen und beharrt darauf, dass kein Yankee ihm eine Gardinenpredigt halten wird. Gleichzeitig betont er, wir sollten nach Amerika fahren, um sein Problem in den Griff zu bekommen. Ich weiß nun, dass er es allein wagen wird oder hierbleibt und vor die Hunde geht, wenn ich nicht zustimme und mitkomme. Mein armer kleiner John sieht mich an, wie um zu sagen: Mama, ich würde dir gerne helfen, bin aber bloß ein Kind. So etwas bricht einer Mutter das Herz. Trotzdem will ich Mister Beecher sehen, auch wenn ich allein nach Glasgow fahren muss.
11. Oktober. Mein Liebling John macht mich sprachlos! Mama, ich begleite dich nach Glasgow, falls ich darf. Dieses wackere Kerlchen ist völlig anders als sein Bruder, der die Unterlippe vorschob, als ich ihn fragte, ob er mitkommen wolle. John und ich brechen gleich morgen früh auf.
Sofort als wir in Glasgow ankamen, war die Aufregung spürbar. Überall hörte man Beechers Namen, ich las ihn auf Spruchbändern und Plakaten in allen Größen. Schotten! Bereitet ihm einen gebührenden Empfang!, entdeckte ich auf einem, woraufhin ich Mutter anstieß, sie möge hinsehen. Der restliche Text darunter erwies sich jedoch als Schmähung. Man ächtete den Mann dafür, dass er den salbungsvollen Prediger mimte und die Bürger im Königreich zur gleichen Zeit gegeneinander aufstachelte, indem er sie dazu nötigte, für eine der beiden Seiten im amerikanischen Bürgerkrieg Partei zu ergreifen. Am Ende des Pamphlets stand: Kommt bewaffnet und zeigt ihm, was anständige Schotten von seinesgleichen halten!
Mein Interesse an der Versammlung wuchs weiter.
Vor dem Rathaus herrschte reges Gedränge, sodass es lange dauerte, bis wir auf unseren Plätzen saßen. Sie befanden sich in der dritten Reihe vor dem breiten Podium, und der Lärm hinter uns war ohrenbetäubend. Ein Teil der Menge stimmte Robert Burns’ patriotische Hymne über die Schlacht von Bannockburn auf eine Art an, die mir Jahre später wieder einfiel, wann immer ich die Zuschauer eines Rugby-Spiels grölen hörte. Als ein schlanker Gentleman im Gehrock mit Kollar erschien und versuchte, ein paar einleitende Worte an den Pulk zu richten, übertönten ihn Buhrufe und wütendes Zischeln. Letztlich winkte er verzweifelt ab und verwies auf die Seitenbühne, wie man es im Theater genannt hätte. Von dort trat prompt und voller Elan ein strahlender Mann hervor. Auch er trug Schwarz, aber kein Priestergewand, und eine dunkle Halsbinde, die kunstvoll um seinen aufgestellten weißen Kragen drapiert war. Er lief beinahe zum Pult, weshalb ich nicht überrascht gewesen wäre, hätte eine unsichtbare Kapelle einen kecken Tusch gespielt, um ein heiteres Gesangs- oder Tanzstück einzuleiten.
Doch im Gegenteil – die Begleitung, die ihm zuteil wurde, manifestierte sich als immenser Krach. Pfiffe und Schreie, Heulen und nachgestellte Tiergeräusche, Kläffen oder Quaken. Mutter hielt meine Hand fest, und ich wollte sie mit einem Blick ermutigen, aber ihre Augen waren wie verzaubert auf den Mann gerichtet, der sich vor allen Anwesenden verbeugte und jede Ecke des Hauses mit einem Nicken bedachte, als sei er ein Komödiant wie Dan Leno oder George Robey in späteren Jahren.
Inmitten dieser tumultartigen Zustände legte er einen Stoß Blätter auf dem Pult zurecht, wobei er gelegentlich kurz aufschaute, um die lautesten unter den Leuten breit grinsend mit einer neuerlichen Kopfbewegung zu bedenken.
„Atemberaubend!“, flüsterte mir Mutter ins Ohr.
Das Getöse flaute nicht ab, auch weil sich die feinere Gesellschaft auf ihren Plätzen umgedreht hatte und den Störenfrieden Paroli bot, indem sie ihrerseits schimpften und brüllten. Ich sah, wie Geistliche die Fäuste reckten, während ihre Frauen mit Taschentüchern herumfuchtelten. Ein Bischof, den ich an seinem purpurnen Talar zu erkennen glaubte, stocherte mit einem Schirm in der Luft.
Der Vorsitzende hatte Platz genommen und rutschte nun unruhig auf der Sitzfläche seines Stuhls, als müsse er gleich um sein Leben rennen. Er beugte sich nach vorn, um dem Redner etwas zu sagen, doch dieser legte ihm bloß eine Hand auf die Schulter und lächelte nachsichtig. Beecher wies den Vorschlag, zu kapitulieren, eindeutig ab. Wir in den ersten Reihen applaudierten vehement, was er noch einmal mit einem Nicken und hochgezogenen Mundwinkeln belohnte.
„Keine Sorge, Freunde“, flötete er, und Mutter musste sich mit beiden Händen an meinem Arm festklammern. „Ich werde mir heute Abend Gehör verschaffen.“ Dann erwies er sich tatsächlich eines Leno würdig, indem er so tat, als kippte er zur Seite um, bevor er einen Ellbogen auf dem Pult abstützte, den Kopf in die Hand legte und die Augen schloss. So imitierte er auf überzeugende Weise einen Mann, der schlagartig aus Langeweile eingeschlafen war, was so natürlich aussah, dass selbst die Rüpel im Saal einstweilen staunend die Luft anhielten. Genau zum richtigen Zeitpunkt öffnete Beecher ein Auge, verdrehte es und zeigte die Zähne. Dieser Gesichtsausdruck nahm die Menschen für ihn ein. Falls ich später je wieder so großen Jubel gehört habe wie in diesem Moment, kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
Den Vorteil, den er sich so verschafft hatte, nutzte er zur Gänze. Nachdem er in die Höhe geschnellt war, trat er ohne seine Notizen hinter dem Pult hervor und sagte mit einer Stimme, die so sanft klang, dass sofort alle an seinen Lippen hingen. „Niemand, der in Schottland geboren und großgezogen wurde, kann meine Gefühle nachvollziehen, da ich diese viel besungenen, geschichtsträchtigen Orte zum ersten Mal besuche.“
Dann verharrte er mit hängenden Armen und senkte das dicke Haupt wie in tiefer Demut. Zustimmendes Raunen ging durchs Publikum, und ich spürte, wie Mutter schauderte, während sie kurz aufstöhnte. Beecher gab sich sogleich einen Ruck und klang auf einmal wie ein heißblütiger Stier, als er sich an den Balkon weit hinten im Raum richtete. „Ich wuchs in einem vergleichsweise jungen Land auf. Es ist so groß, dass man eine Woche lang Tag und Nacht darin reisen kann, jedoch selten historischen Grund betritt. Jetzt lerne ich eures kennen, das so klein ist und doch voller Erinnerungen steckt, die zahlreich sind wie die Sterne am Himmel und nahezu genauso hell strahlen.“ Die letzten Worte unterstrich er dadurch, dass er weit mit einem Arm ausholte und an die Decke zeigte.
„Hört, hört!“, rief jemand aus dem respektableren Volk, aber Beecher ignorierte ihn.
„Hier geht mir das Herz selbst an vermeintlich unerheblichen Fleckchen Erde oder seichtesten Gewässern auf, wenn ich mich dabei an Heldenepen und unsterbliche Gedichte erinnere. Schottland darf sich nicht nur deshalb glücklich schätzen, weil seine Väter wussten, wie man heroisch in die Annalen eingeht, es brachte auch Barden hervor, die aufs Trefflichste davon kündeten. Ich suche dieses Land auf, um all jene Orte zu sehen, die mich seit frühester Jugend faszinieren, nachdem ich in Erzählungen von ihnen las. Ja, fast bin ich geneigt, mich mit einem Pilger zu vergleichen, der sich im prächtigen Jerusalem wiederfindet!“
Der Beifall, den er nun erhielt, brachte seine Gegner praktisch zum Schweigen, doch er hatte noch gar nicht alle Register gezogen. Jetzt senkte er die Stimme wie in einem vertrauten Gespräch unter vier Augen, nickte noch einmal hochachtungsvoll und fügte hinzu: „Mir fällt kein größeres Kompliment ein, als euch nun, da ich einen Teil Schottlands gesehen habe, meiner Zufriedenheit zu versichern.“ Verschmitzt zog er eine Augenbraue hoch, damit sein Blick und auch der Mund nicht verhehlten, dass ihm der Schalk im Nacken saß. „Sagen wir“, schloss er, „wenn ihr nur ansatzweise so zufrieden mit mir seid, sobald ihr mich richtig kennt, wie ich es schon jetzt mit euch bin, werden wir sehr gut miteinander auskommen.“
Vor lauter Juchzen, Lachen und Klatschen hörte ich nichts mehr. Beecher machte keine Anstalten, für Ruhe zu sorgen. Er schien wirklich froh zu sein, dort stehen zu dürfen, gestikulierte eifrig, verbeugte sich wieder und schenkte allen Zuhörern einen heiteren Gesichtsausdruck. Ich habe viele Bühnenkünstler gesehen, die sich gegen eine feindselige oder gleichgültige Klientel behaupten mussten, aber keiner von ihnen hat jemals mit solcher Bravour bestanden wie Henry Ward Beecher an jenem Abend. Ich bemerkte, dass Mutter auf mich einredete. Sie hatte wieder rote Bäckchen bekommen. Ihre Augen funkelten, die Brust hob und senkte sich beim Applaudieren schneller als notwendig, und jetzt weinte sie Freudentränen.
„Was ist, Mama?“, schrie ich. Meine Handballen taten allmählich weh vom Zusammenschlagen.
„Ich würde diesem Mann bis ans Ende der Welt folgen!“
Nun, dazu kam es zwar nicht, aber zuletzt brachen wir doch in die Staaten auf.
Kapitel 4
„Ich freue mich immer, wenn ich einen Amerikaner kennenlerne.“
Ich habe nie erfahren, ob wir rein zufällig mit demselben Schiff übersetzten wie Henry Ward Beecher. Mutter hatte selbst reserviert, aber ihre Aufzeichnungen dazu geben wenig Aufschluss. Erfuhr von Miss Dobbs, dass man am 30. Oktober in der St. James Hall in Liverpool ein Frühstück zu seiner Verabschiedung ausrichtet. Er segelt mit der Asia nach Boston, genauso wie wir. Möge uns Gott eine geruhsame Überfahrt gewähren.
Müßig zu erwähnen, dass nach der Rede in Glasgow kein Zweifel mehr daran bestand, dass wir die Reise antreten würden. Auf dem Rückweg nach Stranraer redeten wir nur darüber, und ich war begeistert, auch und gerade angesichts der Miene meines armen Vaters, just als Mutter ihre Entscheidung kundgab. Fortan war er ein anderer Mann. Noch einmal wurde er emsig, obwohl er während der ersten Tage erbärmlich schlotterte. Letztendlich zeigte er sich fest entschlossen. Seine ehemaligen Arbeitskollegen sorgten dafür, dass unser Haus und der Großteil des Inventars veräußert wurden. Um uns kurz von meinen Großeltern und Tanten zu verabschieden, fuhren wir gemeinsam nach Surrey. Der Besuch wuchs sich zu einem tränenreichen Trauerspiel aus, weshalb Henry und ich froh waren, als wir endlich im Zug nach Liverpool saßen.
„Sieh mal“, bemerkte er am Vortag unserer Abreise auf dem Weg zum Dock, wo die Asia vor Anker lag, und zeigte dabei auf mehrere gestapelte Holzkisten mit Strickschlaufen statt Griffen, die noch verladen werden mussten. „Gewehre!“
Ein Mann mit Farbeimer und Pinsel übermalte die schablonierte Schrift, die auf den Inhalt hindeutete, mit einem Hinweis, es handle sich um Ausrüstungsmittel für Bergbauarbeiten.
„Die sind für die Armee der Nordstaaten“, behauptete Henry. „So schleust man sie durch die Blockade der Leute im Süden.“
„Glaubst du, eines ihrer Kriegsschiffe könnte uns angreifen? Vielleicht bekommen wir einen Schuss vor den Bug.“
„Du machst dir in die Hosen, was?“
„Gar nicht! Falls der Kapitän Freiwillige rekrutiert, um enternde Soldaten aufzuhalten, darf er auf mich zählen.“
Die Bitte meiner Mutter um eine entspannte Reise wurde nicht erhört. Bevor wir in See stachen, stürmte es tagelang, und haushohe Wellen fluteten die Küste. Ich sehnte mich danach, dieses Wetter auch auf dem Meer zu erleben – wenigstens zum Teil. Für mich war es sinnlos, einen so riesigen Ozean wie den Atlantik zu befahren, ohne etwas von der Allmacht der Elemente zu erfahren. Als wir das Schiff bestiegen, war das Schlimmste vorbei, doch sobald die schützenden Gestade Irlands hinter uns lagen, schwankten wir heftig bei starkem Seegang. Die Passagiere flüchteten in finsterer Vorahnung eines Unheils scharenweise in ihre Kajüten oder die Gruppenschlafkammern.
Mir selbst machte es überhaupt nichts aus. In einem nahezu leergefegten Speisesaal frühstückte ich ausgiebig oder sprach herzhaftem Mittag- und Abendessen zu, nicht ohne dankbar den Nachschlag zu verzehren, den mir die Kellner auftischten. Einige von ihnen waren leicht grün im Gesicht, besonders wenn sie Schweinefleisch servierten. Schlemmte ich gerade nicht, fand man mich fast immer an Deck. Ich hatte einen Platz am Steuerbordbug unter der Brücke gefunden, wo die Reling von beiden Seiten zusammenlief. Dort stand ich stundenlang, trat mit beiden Füßen fest auf und hielt mich beidhändig am Schanzkleid fest, während ich jedes Aufbäumen und Senken nachvollzog. Wasser spritzte mir ins Gesicht, hinterließ einen salzigen Geschmack auf meinen Lippen. Ob mein spanischer Vorfahr auf der Galeone genauso aufgeregt gewesen war wie ich an jener Stelle? Falls ja, hatte mein Bruder diesen Zug nicht geerbt. Er kroch selten von seiner Pritsche in unserer engen Kabine, und ich durfte froh sein, dass er unter mir schlief. Auch Vater blieb weithin unsichtbar, und falls Mutter bewusst Beechers Schiff gebucht hatte, um ihm nahe zu kommen, wurde sie enttäuscht.
Nach dreizehn Tagen und Nächten landeten wir in Halifax, Nova Scotia. Nur langsam und kreidebleich trauten sich die Passagiere nach oben, darunter auch meine Mutter, um ihre ersten unsicheren Schritte seit fast zwei Wochen zu wagen.
„Gott sei Dank!“, ächzte sie. „Dein Vater ist so schwach, dass er kaum noch stehen kann.“
„Ich fand die Fahrt recht unterhaltsam“, entgegnete ich wenig mitfühlend. „Das Leben auf hoher See würde mir gefallen.“ Meine Zensuren in der Schule hätten mich aber wahrscheinlich nicht für einen wesentlichen Posten an Bord eines Schiffes empfohlen. „Schau, Mama, dort ist Mister Beecher!“
Sie fuhr herum. Beecher unterhielt sich gerade mit einem anderen Kirchenmann, während er gemächlich über das Deck herankam. Er sah nicht mehr so schmeichelhaft aus, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Seine Augen waren im Schädel zurückgewichen, die Wangen eingefallen. Er machte ein langes Gesicht und schien noch mehr graue Haare bekommen zu haben, wohingegen sein Teint an Schweineschmalz erinnerte.
Mutter schlug sich mit einer Hand auf den Mund. „Der arme Mann! Ihm muss sterbenselend zumute gewesen sein.“
Da sie mir sehr mitteilsam vorkam, merkte ich um ihretwillen auf, als uns die beiden Männer passierten. „Guten Abend, Mister Beecher, Sir.“
Sie hielten inne und schauten mich überrascht an.
„Du kennst mich, Junge?“, fragte der Reverend.
„Ich wohnte Ihrer Rede in Glasgow bei, Sir. Darf ich Ihnen meine Mutter vorstellen? Sie nahm mich dorthin mit.“
Beechers fahles Antlitz leuchtete vor Dankbarkeit darüber, erkannt worden zu sein. Er verneigte sich vor Mutter und nahm ihre Hand, bevor er meine schüttelte. Sein Kollege verabschiedete sich, machte ebenfalls eine Verbeugung und ließ ihn allein mit uns.
„Wir heißen Watson“, sprach Mutter verlegen und errötete. „Ich bin mit Miss Pansy Hamish verwandt, die in Ihrer Gemeinde dient.“
„Mit der guten Pansy? Na, so etwas! Ich hoffe, Sie hatten eine angenehmere Reise als ich, Ma’am.“
„Ich fürchte nein. Unser kleiner John scheint als einziges Familienmitglied zur Seefahrt geboren zu sein. Mein Gatte und sein Bruder haben sich noch nicht erholt.“
Beecher stöhnte geziert und fasste sich an die Stirn. „Wissen Sie, seit wir Queenstown verlassen hatten, lag ich ermattet auf dem Rücken in meiner Koje. Was für eine Überfahrt! Was aber, wenn ich fragen darf, führt Sie und Ihre Familie in die Neue Welt, Ma’am?“
Ich wartete gebannt darauf, wie Mutter antworten würde, aber ein junger Mann in Uniform unterbrach das Gespräch. Er entschuldigte sich und fragte, ob er es mit Mr Henry Ward Beecher zu tun habe. Das bisschen Farbe, das gerade erst ins Gesicht des Reverends zurückgekehrt war, verschwand mit einem Mal wieder, was ich sehr eigenartig fand. Er riss die Augen weit auf, schluckte und nickte mit bebenden Lippen. Sein Gegenüber hielt ihm einen gelbbraunen Umschlag hin, den er mit zitternder Hand entgegennahm. Nachdem sich der Uniformierte kurz und steif verbeugt hatte, verschwand er. Beecher stand nun da und drehte das Papier unaufhörlich um, als sträubte er sich dagegen, es zu öffnen. Schließlich reckte er den Hals, schloss die Augen und bewegte in stummer Rede den Mund. Bestimmt betete er. Dann schob er einen Daumen in die Lasche, riss den Umschlag auf und zog ein Blatt heraus.
Ich rechnete mit einer Hiobsbotschaft und machte mich darauf gefasst, diesen angesehenen Mann zu stützen, damit er nicht zusammenbrach. Mutter suchte meinen Blick, während wir angespannt ausharrten. Plötzlich aber lächelte Beecher wieder, und der Glanz kehrte in seine Pupillen zurück.
„Von meiner Frau“, erklärte er. „Sie heißt mich zu Hause willkommen.“
Ich fand es seltsam, dass sich ein Mann unverhohlen über eine Nachricht seiner Liebsten entsetzte, wusste zu jenem Zeitpunkt aber noch nicht, weshalb der Reverend erschrak, wenn ihn Amtspersonen aufsuchten.
Er hatte gute Gründe.
Die Fahrt nach Boston dauerte zwei weitere Tage, doch diesmal war uns das Meer gewogen, weshalb ich die Aufmerksamkeit der Kellner im Speisesaal nicht mehr allein beanspruchte. Vater, dem es aufgrund seiner Trunksucht wohl umso schlechter ging, steckte die lange Reise immer noch in den Knochen, also blieb er in der Kajüte. Henry hingegen war wieder auf der Höhe und hängte sich an mein Revers, um mit seinem Wissen über Amerika zu protzen, als wollte er mich dafür bestrafen, dass ich die beiden vergangenen Wochen besser überstanden hatte als er.
Beecher zeigte sich häufig an Deck und ging nie ohne ein aufmunterndes Augenzwinkern an mir vorbei. Begleitete mich Mutter, blieb er stehen und hielt einen kurzen Plausch. Einmal ließ ich die beiden an der Reling zurück, und als ich nach einer guten halben Stunde wiederkam, schwatzten sie immer noch, wobei sie fast Schulter an Schulter dastanden. Als sie mich bemerkten, schienen sie verlegen voneinander abzulassen.
„Ein so … außergewöhnlicher Mann“, sinnierte Mutter später. „Er ist unheimlich verständnisvoll und weiß sehr viel.“
„Worüber denn, Mama?“
„Ach, zu jedem Thema, das du dir vorstellen kannst. Wirklich alles.“
Vor dem Bostoner Hafen warf man der ungünstigen Flut wegen den Anker aus. Die Küste lag verführerisch nahe und glitzerte am frühen Abend von Myriaden von Lichtern. Ich lehnte wieder am Geländer, als sich jemand zu mir gesellte. Es war Beecher. Er hatte seinen Hut abgenommen, sodass die sanfte Brise mit seinen langen Haaren spielte. Er sah sich trotzdem nicht bemüßigt, es aus den Augen zu streichen.
„Nun, junger John“, begann er, „du fragst dich bestimmt, was unser unermessliches Land für dich bereithält, nicht wahr?“
Eigentlich hatte ich über die Gewehre nachgedacht, die in Halifax ausgeladen worden waren, und malte mir aus, welchen Aufwand man nun betrieb, um sie an ihre Bestimmungsorte zu schmuggeln, doch ich antwortete artig: „Richtig, Sir.“
Er kicherte leise und verdutzte mich mit seiner nächsten Bemerkung. „Du schnupperst also nicht nach Pulverdampf?“ Als ich sprachlos blieb, gackerte er erneut und schob einen Arm unter meinen, als sei er schon ewig mein bester Freund. „Weißt du“, fuhr er fort, während er hinaus gen Ufer schaute, „genau dies tat ich, als ich zum ersten Mal herkam. Ich war in deinem Alter, ein gesunder Junge vom Land mit wonnigem, rotem Gesicht wie du. In diesem Hafen sah ich zum ersten Mal ein großes Schiff. Ich stand dort drüben am Wasser und starrte es an. Also lass dir sagen, Johnnie, wie ich die Küstenluft einsog und den Blick weiter bis zum Horizont schweifen ließ, dachte auch ich an alles, was ich bis dato über Freibeuter gelesen hatte, über Seeschlachten und Erkundungsfahrten in fremde Gewässer. Hinterher begab ich mich fast jede Woche zur Marinewerft in Charlestown, wo ich zumeist die Wehr bestieg, um das Hafengelände zu überblicken. Ich stand hinter den Geschützen und wartete nur darauf, dass sich wieder einer von euch Briten in Sichtweite traute. Patriotismus war der Kommodore und meine Phantasie sein Kanonier. Fürwahr, Johnnie, im Hafen von Boston wurden große Schlachten ausgetragen, von denen niemand außer mir erfuhr.“
Ich lachte laut über seine bunten Vergleiche und entsann mich, in meiner Phantasie die gleichen Erfahrungen gemacht zu haben, als ich bei Black Head gestanden hatte.
„Wo ist deine nette Frau Mutter an diesem milden Abend?“, fragte Beecher wie beiläufig.
„Ich glaube, sie sitzt bei Vater. Ihm geht es immer noch schlecht.“
„Ich sollte unter Deck gehen und mich persönlich mit ihm unterhalten. Vielleicht gelingt es mir, ihn für ein gemeinsames Gebet zu begeistern. Es geht nichts über ein Gespräch mit Gott, Johnnie.“
Mir wäre es lieber gewesen, er hätte weiter über Schiffe und Kanonen geredet. Deshalb versuchte ich, ihn zurückzuhalten und wieder auf diese Themen zu stoßen. „Wie Sie diese Unruhestifter in Glasgow zum Schweigen brachten, Sir, fand ich großartig.“
„Glasgow? Eine Kleinigkeit, sage ich dir. Du hättest in Manchester oder Liverpool zugegen sein sollen, denn dort kam es einem Kraftakt gleich. Meine Freunde dort warteten wohl darauf, dass ich einknicken und meine Predigt absagen würde, aber ich machte deutlich, man müsse mich anhören, und legte alles Weitere in Gottes Hände. So wurde ich tatsächlich angehört und siegte zuletzt. Das nenne ich Tapferkeit, Johnnie, angewandt im Alltag. Scheue niemals Auseinandersetzungen, denn sie machen einen Großteil des Lebens aus, und je früher ein Jungspund wie du lernt, dass man der Masse ins Auge schauen muss, desto erfolgreicher wird er voranschreiten.“
„Verzeihung, Sir“, warf eine dunkle Stimme von hinten ein, und ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, Beecher sei beinahe aus der Haut gefahren vor Schreck. Er wirbelte herum, aber was ich dabei in seinem Gesicht sah, hatte nichts mit angewandter Tapferkeit im Alltag zu tun. Zwei Männer standen hinter uns, einer mit dunklem, bürgerlichem Anzug, der andere in Uniform. „Mister Henry Ward Beecher?“, fragte dieser.
Im Geiste hörte ich schon seine weiteren Worte, etwas in der Art von: Ich bin Detective Officer soundso von der Bostoner Polizei. Gleich mochte der Kerl vortreten und weitersprechen: Mister Beecher, es ist meine Pflicht, Sie im Namen des Präsidenten der Vereinigten Staaten unter Arrest zu stellen. Diese oder eine entsprechende Formel war dort wohl geläufig.
Die Miene des Reverends deutete an, dass er etwas Ähnliches befürchtete. Den Schritt nach vorn machte letztlich der andere Mann, der dabei allerdings eine Hand ausstreckte und gewogen lächelte. „Freut mich, Sie wohlbehalten daheim begrüßen zu dürfen, Sir.“
Beecher wischte sich nicht sichtbar über die Stirn, aber wahrscheinlich im übertragenen Sinn insgeheim.
„Sir“, fuhr der Mann fort, „die Presse und das Volk von Amerika gehen davon aus, dass Ihre Reden in Großbritannien die Einstellung der Menschen dort uns gegenüber verändert haben. Im Handumdrehen und ohne Drängen oder Unterstützung von oben knüpften und festigten Sie Bande zwischen dem Mutterland und unserem eigenen, die nicht durch geschriebene Verträge ratifiziert werden müssen. Amerika steht in Ihrer Schuld, Sir.“
Nichts lag hier ferner als Handschellen und eine Rechtsbelehrung.
„Morgen früh wird der obere Zollbeamte selbst Ihr Gepäck kontrollieren und Sie beim Ausfüllen der Dokumente betreuen, die zu Ihrer Einreise erforderlich sind. Nun wünsche ich Ihnen eine gute Nacht, Sir. Ich werde Sie in mein Gebet einschließen, auf dass Sie Amerika unter der Obhut des Herrn weiterhin gute Dienste erweisen.“
„Amen“, ergänzte der Uniformierte, bevor die beiden ihrer Wege gingen.
Die befremdlichen Anzeichen von Furcht, die Beecher nun schon zwei Mal an den Tag gelegt hatte, schob ich für den Augenblick beiseite. Wie Mutter stand ich unter seinem Bann.
„Frage dich doch“, plauderte er nun weiter, „was geschehen wäre, hätte ich mich den Drohgebärden dieser Radaubrüder gebeugt. Stell dir vor, ich wäre von der Bühne gestiegen, statt mir vorzunehmen, gehört zu werden. Ein solches Für und Wider kann den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Nun, junger Sir, muss ich meinen Freund Mister Henderson finden und ihm die guten Nachrichten vom Festland unterbreiten. Ihr fahrt auch nach New York, richtig?“
„Ja, wir wollen eine Weile bei Miss Pansy Hamish bleiben.“
„Dann wird sie dich bestimmt einladen, meinen Gottesdienst in der Plymouth Church zu besuchen. Sieh zu, dass du kommst, und bring deine liebe Frau Mutter mit.“
„Verlassen Sie sich darauf, Sir.“
Henry Ward Beecher drückte kurz meinen Arm und ließ mich allein.
Ich blieb noch lange an der Reling stehen, beobachtete das Spiel der Lichter von Boston und erfreute mich daran, den tollsten Mann der Welt zum Freund zu haben.
Kapitel 5
„Das Fehlen der üblichen weiblichen Gefühlsausbrüche.“
Viele Frauen niederer Herkunft, die weniger gut erzogen waren als Mutter, hätten meinen Vater in Gegenwart von Henry Ward Beecher instinktmäßig völlig anders behandelt. Einem Mann, der gerade zwei Wochen Seekrankheit hinter sich gebracht hatte und obendrein gegen ein chronisches Alkoholproblem kämpfte, während er noch matt in einer engen Kajüte lag und sich fragte, was er in seinem Leben beziehungsweise dem seiner Familie angerichtet hatte, half man sicherlich nicht auf die Beine, wenn man ihn wissen ließ, dass unter den quälenden Schritten, die er vom Deck oberhalb vernahm, auch jene eines ausgemachten Musterknaben widerhallten, der allwissend anmutete. Und genau dieser wollte ihn aufsuchen und kluge Ratschläge erteilen. Indem Mutter den besagten Parademenschen einlud, Vater aufzusuchen, bewies sie kein sonderliches Taktgefühl.
Beecher schickte sich an, uns alle vier in die positive Wirkung des Leidens auf die Seele einzuweihen. Er walzte das Thema eine ganze Stunde lang aus, wobei er sich direkt an Vater wandte, der wie hypnotisiert dalag. Mutter ließ das Gesicht des Reverends keine Sekunde aus den Augen, sondern starrte gleich jemandem, der einen Engel erblickte. Hinter Beecher saßen ich und Henry, der mir von Zeit zu Zeit verstohlen den Ellbogen in die Seite rammte und anzüglich grinste, zum Beispiel als der Gottesmann posaunte: „Seid ihr aber ohne Züchtigung, welcher sind alle teilhaftig geworden, so seid ihr Bastarde.“
Die Anspielung, kein Mensch sei je zu Wein gekommen, ohne vorher Trauben zerquetscht zu haben, fand ich im Hinblick auf Vaters Leiden ziemlich unglücklich gewählt. Ich musste mich anstrengen, um seinem Parforceritt durch den christlichen Wertekanon zu folgen. Davon ausgehend leitete er zum Aberglauben der alten Ägypter über, die er mit Schweinen am Trog verglich. Dann folgten die Ansichten eines deutschen Phrenologen zur Bereitschaft der Frau zur Ehe (auch dabei knuffte mich Henry) und schließlich ein zu kurzer Verweis auf Wellingtons Aufruf im Zuge der Schlacht am Gévora, sich freiwillig zu melden, um Badajoz einzunehmen. Kaum dass ich glaubte, den Faden aufgreifen zu können, nahm der Sermon eine neue Wendung, und ich verstand wieder nichts.
Am Ende erhob sich Beecher und mahnte Vater auf das Eindringlichste. „Bedenke all dies, Bruder, und sage dir: Ich danke dem Herrn der Gnaden für die Gebrechen, die er mir angedeihen ließ.“ Nachdem er sich wieder einmal vor Mutter verbeugt hatte, vollzog er einen flammenden Abgang.
Mutter himmelte ihn an, bis er verschwunden war, woraufhin Stille in der Kabine einkehrte und länger andauerte.
Vater brach sie letztendlich. „Violet.“
„Wie? Oh … was ist, mein Bester?“
„Bitte, läute nach einem Diener.“
„Ich kann doch einen der Buben schicken. Möchtest du Tee oder Kaffee?“
Vater schüttelte den Kopf. „Whiskey. Eine ganze Flasche.“
Mutter brach laut heulend in Tränen aus. Henry stieß mich erneut an und wir verzogen uns. Vater griff jedoch nicht ernsthaft wieder zur Flasche. Indem er Alkohol verlangte, begehrte er nur gegen die Nötigung auf, das bis zur Benommenheit langweiligste Geschwätz ertragen zu müssen, das ihm je untergekommen sei. Genau so formulierte er es.
Ein paar Tage später trafen wir in New York ein und kamen bei Tante Pansy unter. Genau so mussten wir sie ansprechen, obwohl unsere Beziehung unter keinem guten Stern stand. Sie war eine dürre, ewige Jungfer, die sich ein Haus mit ihrer Mutter teilte. Diese uralte Frau mit schneeweißer Haube lachte immerzu, egal was man zu ihr sagte, und verstand eindeutig kein Wort. Dies nutzte Henry zu einem vulgären Zeitvertreib, dem zu frönen er nie gewagt hätte, wären unsere Eltern oder Tante Pansy in Hörweite aufgetaucht.
Geplant war, dass wir dort verweilten, bis Vater vollständig genesen war und neue Arbeit gefunden hatte. Leider stimmte es zwischenmenschlich hinten und vorne nicht, denn unsere Tante machte keinen Hehl aus ihrer Abneigung gegen ihn. Beecher wurde zum ständigen Gegenstand ihrer Gespräche mit Mutter, was Vaters Zorn sichtlich anschwellen ließ, und Henry verstand es, ihn auf kunstvolle Weise weiter zu schüren.
Einem Ereignis in naher Zukunft sahen die beiden Frauen besonders erwartungsfroh entgegen, dem aufwendigen Empfang für den Reverend, der in seiner Plymouth Church stattfinden sollte. Ich ging zufällig über die Diele, als Mutter Vater davon erzählte. Die Wohnzimmertür stand einen Spaltbreit offen, und seine Antwort fiel dergestalt aus, dass ich innehalten und lauschen musste.
„Violet, ich wünschte, du hättest nichts mehr mit diesem Mann zu schaffen.“
„Warum?“
„Er ist ein Schwindler.“
„Geht es dir wieder schlechter, Henry, oder erlaubst du dir einen üblen Scherz mit mir, wie du es nach seinem erbaulichen Besuch auf dem Schiff getan hast?“
„Mir geht es gut und ich meine es ernst. Er ist ein elender Pharisäer, der jedem etwas vorgaukelt.“
„Er ist ein Mann Gottes!“
„Ein Männchen höchstens, ein Windbeutel. Auch wenn ich mittlerweile an der Welt verzweifle, bin ich doch weit genug herumgekommen, um seinesgleichen zu durchschauen. Ein flottes Mundwerk ist alles, was sie haben. Schaumschlagen können sie, um leichtgläubiges Volk auszunehmen wie Weihnachtsgänse.“
„Das stimmt einfach nicht. Tausende folgen ihm.“
„Einfaltspinsel von deiner Sorte und närrische alte Junggesellinnen wie Pansy.“
Ich hörte Mutter entrüstet keuchen. Im Zuge von Vaters Eskapaden war ihre Duldsamkeit ein kleines Wunder für mich, denn nie hatte sie ihn gemaßregelt oder ihn als Familienoberhaupt infrage gestellt. Doch nun tat sie beides. Ihre sonst so sanfte Stimme wurde laut, und für mich haftete ihr etwas von einer in die Enge getriebenen Raubkatze an, als sie Beecher einen Ausbund von Selbstlosigkeit nannte, der sein Leben sowohl Gott als auch seinen Mitmenschen gewidmet hatte, bevor sie behauptete, er stecke meinen Vater zehnmal in die Tasche.
„Hüte dich, Violet!“ Der Tonfall des Zurechtgewiesenen war schneidend wie nie.
„Nein, du bist es, der auf der Hut sein sollte. Nimm das Licht wahr, das er trägt, und lass dich davon leiten. Folge seinem Beispiel, und auch du wirst das Heil erfahren.“
Ich glaube, sie schloss mit einem Halleluja! ab, doch vielleicht verhörte ich mich auch nur, weil Vaters Stuhl über den Fußboden rutschte, als er ihn zurückstieß, um aufzuspringen. Ich nahm hastig und gerade rechtzeitig die Beine in die Hand. Vom oberen Treppenabsatz aus hörte ich dann, wie die Haustür aufgeworfen und zugeschlagen wurde.
„Was geht da vor sich?“, wollte Henry wissen. Er lag mit den Schuhen auf seinem Bett und las irgendeine dumme Zeitschrift. Während ich alles erzählte, steckte er die Nase flegelhaft wie immer in die Seiten. Allerdings fiel mir auf, dass seine Augen keinem Text folgten, also hörte er mir zu.
„Was sollen wir tun?“, fragte ich.
„Ignorieren, was uns nichts angeht“, antwortete er.
„Aber das geht uns etwas an.“
„Dann ignoriert jeder von uns einen Teil davon, das ist leichter.“
Am liebsten hätte ich sein dämliches Heft genommen und über ihm zerrissen, aber mir war zu elend zumute. So ging ich hinaus, um nach unten zurückzukehren und Mutter zu trösten. Auf halbem Weg die Treppe hinunter zuckte ich zusammen, als im Wohnzimmer Tante Pansys Harmonium wehmütig ächzend zum Leben erwachte. Sie und Mutter stimmten sogleich ein Kirchenlied an, weshalb ich in die Küche auswich, wo meine Großtante neben dem Ofen hockte. Ihr Kopf ging auf und nieder, während sie mich anstarrte.
Vater blieb schweigsam, als er nach einer Stunde oder etwas längerer Zeit zurückkam. Sein stinkender Atem verriet ihn bereits, als er durch die Haustür auf den Flur trat. Ich beobachtete, wie Mutter zögerte, als wisse sie nicht, wie sie mit ihm umgehen sollte. Tante Pansy rümpfte die Nase und zog ihre Base am Arm mit ins Wohnzimmer, wo sie die Tür hinter sich schloss. Vater sah mich ausdruckslos an, bevor er sich nach oben zurückzog. Als ich später nachging, hörte ich, dass er im Schlafzimmer meiner Eltern mit Henry redete. Ich konnte mir nichts vorstellen, worüber sich die beiden unbedingt unterhalten mussten, sah aber davon ab, an der Tür zu horchen. Meine Ohren waren für heute bedient.
Beechers Begrüßung in seiner Kirche, zu der mich Mutter und Tantchen mitnahmen, erwies sich als weit lebhafteres Unterfangen als erwartet, und das dramatische Nachspiel brannte alle Einzelheiten nachhaltig in mein Gedächtnis.
In den 1860ern gehörte Brooklyn noch nicht zu New York City, sondern war eine gesonderte Stadt auf Rhode Island und vor allem wegen seiner vielen Kirchen berühmt. Am Ende der Fulton Street gelangte man per Fähre über den East River, und jeder Fremde, der nach Beechers Kirche fragte, erhielt zur Antwort: „Einfach die Fulton Ferry nehmen, nach dem Aussteigen immer der Nase nach.“
Die Plymouth Church war ein gewaltiges Ziegelsteingebäude ohne Kirchturm oder Ornamentik. Der Empfang fand in den Räumlichkeiten der Sonntagsschule im Obergeschoss statt, die mehr Gäste als üblich fasste, nachdem man breite Türen zu anliegenden Versammlungssälen geöffnet hatte. Der Andrang war groß, doch dank Tante Pansys Beziehungen konnten wir schon früh reservierte Plätze in Bühnennähe einnehmen.
Das Ganze fiel auf einen trüben Dezembertag, zum Glück erhellten Gasbrenner den Raum. Kränze und Gestecke hingen an allen Trägern, während ein hübsches Mädchen, das mir zudem ein strahlendes Lächeln schenkte, Schnittblumen von einem großen Stoß verteilte. Ich wäre freiwillig zum Helfen geblieben, hätte ich nicht die beiden sehr langen Tafeln gesichtet, auf denen Erfrischungen aller Art bereitstanden, ausgenommen natürlich alkoholische Getränke. Die Gäste ließen sich von Damen bedienen, die nicht minder freundlich dreinschauten, also machte ich mich an Sandwiches und Kuchen zu schaffen, bevor ich zu Trifle und Eiscreme überging und einen Tee trank. Eine Gruppe von Musikern in einheitlichen Anzügen bot ein buntes Programm aus zeitgenössischen Tanzstücken. Für eine kirchliche Veranstaltung konnte ich mir kaum etwas Abwegigeres vorstellen.
Man rief mich zum Platz, wo ich mich mit vollem Bauch und leichtem Unwohlsein einfand. Bald darauf betrat der große Mann unter ausgiebigem Applaus und vereinzelten Jubelrufen den Saal. Die Leute stampften im Rhythmus des bekannten Marsches der Bostoner Germania Band mit den Füßen auf den Boden, während er dastand wie der Sieger eines Sportwettbewerbs, schnittig und überlegen, mit erhobenen Armen. Als der Lärm endlich abflaute, tat er ganz bescheiden, nahm Platz und hörte den Lobreden mehrerer Fürsprecher zu. Beim Antworten zeigte er sich in Bestform, abwechselnd witzig mit wenigen Worten beziehungsweise tiefsinnig und euphorisch. Seine Zuhörer reagierten wie ein Orchester vor einem meisterhaften Dirigenten, der exakt die Klangfarben aus seinen Musikern kitzelte, die ihm vorschwebten, alle sprangen auf, auch ich, um noch mehr Lärm zu schlagen als bei seinem Eintritt.
Daraufhin nahm die Feier ihren Lauf. Die Kapelle spielte eine Auswahl von Stücken, darunter auch, wie mir der gedruckte Programmzettel sagte, Galopps und Polkas sowie Walzerkönig Johann Strauss’ Tändelei. Niemand schwang das Tanzbein, aber mancher war bestimmt versucht.
Ich fand mich wieder vor dem Büfett ein und nahm noch eine Portion von allem zu mir, was ich vorher gegessen hatte. Als ich endlich satt war und selbst vor einem weiteren Eis die Waffen hätte strecken müssen, kehrte ich zu Mutter zurück, die alleine und ruhig dasaß, als sei sie aus allen Wolken gefallen, wie man so sagt. Ich freute mich, denn Beecher hatte sich zu ihr gesellt und hielt eine ihrer Hände in seinen beiden. Von Tante Pansy war weit und breit nichts zu sehen.
„Na, Johnnie“, begrüßte er mich, ohne aufzustehen, doch dafür machte er eine Hand los, um meine zu schütteln und mich gleich auf den Platz neben sich zu ziehen. „Gefällt es dir hier?“
„Sehr, Sir. Die Leute sind sichtlich froh, dass Sie wieder da sind.“
„Wir, mein Lieber“, berichtigte Mutter so vehement, dass ich zusammenzuckte. „Wir sind es, unzertrennlich nunmehr, ein Herz und eine Heimat, eine einzige, heitere Gemeinde.“
Beecher drückte ihre Hand an seine Brust. „Ich schätze, junger Mann“, sprach er, „wir werden einander fortan häufig zu Gesicht bekommen. Mit Gottes Hilfe passen wir zwei auf deine liebe Frau Mutter auf, damit sie ein friedliches, erfülltes Leben führen kann.“ Er hob ihren Arm und drückte rasch einen Kuss auf den Handrücken. Dann stand er auf und empfahl sich, um anderen Gästen aufzuwarten.
„Willst du nichts essen?“, fragte ich Mutter, aber sie murmelte bloß: „Was ist schon körperliche Nahrung?“
„Das Trifle schmeckt ausgesprochen gut“, erwiderte ich, und sie lächelte mir zu. Ihre Augen waren feucht, natürlich vor Freude, worüber ich mir nichts vormachen musste. Sie drückte meinen Arm und seufzte, wobei sie gleichzeitig offenbar ein Schauer durchzuckte.
„Also“, fuhr ich fort, „ich werde mir noch einen Teller nehmen, bevor nichts mehr übrig ist.“ Daraufhin ließ ich sie wieder allein und schlug mich zum letzten Mal ins Getümmel vor den Tafeln.
Die Rückfahrt mit der Fähre dauerte zwar nicht lange, erwies sich aber als peinlich für mich, weshalb ich froh war, als wir Tante Pansys Haus erreichten, wo ich geradewegs zum Abort auf dem Hinterhof lief. Als ich mich wieder imstande fühlte, nach drinnen zu gehen, ergingen sich Tante und Mutter gemeinsam zum asthmatischen Getöse des Harmoniums in dem Jubellied O du Liebe meiner Liebe. Ich trat ins Wohnzimmer und verhielt mich ruhig, weil ich es nicht für ratsam hielt, mit Verstopfungen zu singen.
Als sie fertig waren, führte mich Mutter zu einem Sessel und ließ sich neben mir nieder. Immer noch lächelte sie hinter einem Tränenschleier. „Schatz, du musst jetzt sehr tapfer sein.“
„Warum, Mama?“
„Dein … dein Vater und Henry …“
Plötzlich wurde mir beklommen zumute. Seit wir zurückgekehrt waren, hatte ich andere Probleme gehabt, als mich zu wundern, dass sich die beiden nicht blicken ließen.
„Sie sind gegangen.“
Kurz glaubte ich, der Satz sei Mutters Euphemismus für den Tod, aber Tante Pansy schritt zur Erklärung. Bevor sie sprach, hob sie wieder einmal ihre lange Nase und schnaubte verächtlich. „Nichts außer einer Nachricht auf dem Kaminsims hat dein Herr Papa hinterlassen. Furchtbar empörend, aber eigentlich absehbar.“
„Pansy, bitte nicht vor dem Kleinen!“
„Er soll nur die Wahrheit erfahren. Und hör auf, ihn klein zu nennen! Immerhin ist er größer als du.“ Sie peilte mich mit ihrem Riechkolben an, als sei er ein Geschütz auf einem Kriegsschiff. „Dein Vater ist mit deinem Bruder nach Kalifornien geflohen. Sie sind am frühen Abend aufgebrochen. Er muss es schon vor Tagen, wenn nicht gar Wochen geplant haben.“
„Sie wollen Gold schürfen.“
„Ja, so eine Narretei wird es sein.“
„Wieso konnten wir uns nicht anschließen?“, fragte ich Mutter.
„Weil er mich gar nicht eingeweiht hat“, antwortete sie. „Ich hätte mich sowieso geweigert, und du bleibst doch gern hier bei mir, nicht wahr?“
Ich konnte nur nicken, auch da ich genau dies Henry gegenüber beteuert hatte. In Wirklichkeit beneidete ich die beiden um ihr Abenteuer. Unter anderen Umständen hätte ich es liebend gern mit ihnen bestritten.
Meine Verdauungsbeschwerden beschäftigten mich in jener Nacht so sehr, dass ich die Folgeerscheinungen des Verschwindens von Vater und Henry nicht gänzlich vorhersehen konnte. Als ich am nächsten Morgen wach wurde und mich allein im Doppelzimmer wiederfand, empfand ich zuallererst Erleichterung. Die Sonne schien und es war belebend kalt. Tante Pansy sang wieder, diesmal in der Küche, und Mutter empfing mich lächelnd mit einer kräftigen Umarmung, während meine Großtante wie immer neben dem Ofen saß und grinste. Mein Bauch hatte sich beruhigt, weshalb ich mir Eier mit Schinkenspeck an Kartoffelbratlingen, Toast und Kaffee gefallen ließ. Alles in allem war mir das Leben so eigentlich recht angenehm.
Kapitel 6
„Sie riefen sich die einzelnen Stationen von Beechers Lebenslauf in Erinnerung.“
Der Reverend wurde schon früh vorstellig. Er hatte Mutter und mir eine Menge über richtige und falsche Entscheidungen zu erzählen, wahre Freiheit in der Verpflichtung und das mikroskopische Gewissen, bevor er die Theorien des Nicodemus ansprach und über Wiedergeburt schwadronierte. Mutter schien es gutzutun.
Bevor er wieder aufbrach, stutzte er und runzelte nachdenklich die Stirn. „Ma’am, ich habe eine Idee …“, begann er schließlich. „Miss Pansy wird Ihnen erklärt haben, wie viel Zeit mein literarisches Schaffen veranschlagt. Mister Bonner vom Ledger sitzt mir im Nacken, damit ich jede Woche einen Artikel für sein Blatt liefere, und drängt mich nun sogar zu einem Roman, den er in einer Serie abdrucken kann. Drittens muss ich mich um mein Pfarramt kümmern und alles, was dazugehört.“
„Eine schwere Bürde für Sie, Mister Beecher.“
„Gott hat sie mir auferlegt, und ich werde nicht murren, aber der Punkt ist folgender, Ma’am. Wären Sie bereit, mich ein wenig zu entlasten?“
„Ich? Wie sollte ich Ihnen schon helfen?“
„Als Mitarbeiterin. Sie könnten vieles für mich übernehmen. Lektorieren zum Beispiel, oder Sie werden meine Sekretärin, sondieren meine Verpflichtungen und dergleichen.“
„Aber mir fehlen die notwendigen Qualifikationen.“
„Durch die Liebe diene einer dem anderen. Liebe, Misses Watson, ist die einzige Qualifikation, die Sie brauchen.“
Ich sah, wie sich Mutters Zweifel verflüchtigten.
„Na gut“, entgegnete sie heiser. „Zeigen Sie mir, was ich tun soll, und ich werde Ihnen helfen.“
So wurde sie zu Beechers Assistentin. Sie wartete ihm täglich auf, oder besser gesagt umgekehrt, denn sie musste feststellen, dass sie in seinem Haus nicht willkommen war. Er hatte eine reizlose, strenge Frau, scharfzüngig und kalt wie ein Eiszapfen. Eunice, so ihr Name, behandelte den Mann, der Tausende mit seiner schieren Präsenz und Stimme mitreißen konnte, wie einen dahergelaufenen Köter und verweigerte seinen Bekannten Einlass, wie es schien. Ferner dämpfte sie seine Begeisterung, wachte über die Haushaltsgelder, von denen er nur einen kärglichen Betrag erhielt, und öffnete sogar all seine Post, um sie zuerst zu lesen. Dennoch hatten die beiden mehrere Kinder, was mir widersinnig erschien, bis ich alt genug war, um zu begreifen, wie es zwischen Männlein und Weiblein mitunter zugeht.
Folglich kam er zu Tante Pansy nach Hause. Mutter schloss sich stundenlang mit ihm ein, während ich eine Schule in der Nähe besuchte, wo meine Tante unterrichtete. Nachmittags lief ich stets eilig zurück und grüßte zuerst Mutter im Wohnzimmer. Oft war Beecher dann noch zugegen und unterhielt sich zwanglos mit uns beiden.
Einmal kam ich zur üblichen Zeit heim und fand die Wohnzimmertür geschlossen vor. Ich wollte öffnen, doch oh Wunder – sie war abgesperrt! Ich klopfte und rief nach Mutter, woraufhin sie erwiderte, ich möge warten. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie aufmachte. Ihr Gesicht war seltsam gerötet, und Beecher hatte mir den Rücken zugewandt, um ins Feuer zu schauen. Er drehte sich nicht um und sagte überschwänglich Hallo, wie er es normalerweise tat. Ich vermutete, er sei tief in Gedanken versunken.
„Warum war abgeschlossen?“, wollte ich wissen.
„Eigenartig …“, fand Mutter. „Wir müssen den Schlüssel zufällig umgedreht haben.“
Wenige Wochen später schürfte ich mir beim Toben in der Pause zwischen zwei Nachmittagsstunden ein Knie auf. Da Tante Pansy kein Blut sehen konnte, meinte sie, es sei am besten, nach Hause zu gehen und mich von meiner Mutter verarzten zu lassen. Ich war froh, vom Rest des Unterrichts verschont zu bleiben, und humpelte los. Um keine Blutflecke auf dem Teppich in der Stube zu hinterlassen, wollte ich die Hintertür nehmen. Sie war nicht verriegelt, obwohl Tante Pansy aus Prinzip keine Haushälterin einstellte, weshalb eigentlich jeder ein- und ausgehen konnte. New York war damals eine weit unschuldigere Stadt als heute. Meine senile Großtante am Ofen grüßte mich wie immer ohne Worte.
Nachdem ich meine Wunde gesäubert hatte, ging ich zum Wohnzimmer. Die Tür stand ein Stück weit offen, sodass ich das Feuer brennen sah. Davor lagen lose Blätter auf dem Boden, woran ich mich mittlerweile gewöhnt hatte. Die Stühle, auf denen Mutter und Beecher zumeist nebeneinander saßen, weil sie so besser arbeiten konnten, waren zurückgeschoben worden. Irgendwie herrschte eine eigenartige Stimmung. Wie ich so dastand und mich fragte, weshalb ich das Gefühl nicht loswurde, sie hätten den Raum, aus welchen Gründen auch immer, vorzeitig verlassen, hörte ich sie auf einmal sprechen. Ich drehte mich um, da kamen sie die Treppe herunter. Er hatte einen Arm um ihre Taille geschlungen.
Was die Geschichte mit Blümchen und Bienen betraf, so war ich nicht aufgeklärt, sah man von den wenigen Andeutungen ab, die Henry diesbezüglich gemacht hatte, wobei ich stets vermutet hatte, dass es sich um Humbug handelte, mit dem er mir Angst einjagen wollte. Jedenfalls beschlich mich der Gedanke, es schicke sich nicht für eine Lady und einen Gentleman, im Obergeschoss eines Hauses zu verschwinden, es sei denn, sie waren verheiratet. Weiter spann ich den Faden aber nicht, und als mich Mutter entsetzt anstarrte, deutete ich es als Sorge wegen meiner Verletzung.
„Hab mir das Knie aufgeschlagen“, erklärte ich. „Tante schickt mich.“
Mit mehr Lebenserfahrung hätte ich die Blicke, die sie austauschten, richtig interpretiert, als unausgesprochenen Wortwechsel. Was sollen wir tun? von Mutters Seite, und Lass mich nur machen! als Beechers Antwort.
„Armer Tropf“, jammerte er und kam gelaufen, bückte sich vor mir und untersuchte die Schramme. „Das sieht ja richtig übel aus. Aber es gibt nichts, was nicht wieder heilen würde, habe ich recht … äh … Misses Watson?“
Sie stützten mich, während ich zurück in die Küche hüpfte, wo Mutter mein Knie verband.
Dann sagte Beecher: „Gehen wir ins Wohnzimmer, Johnnie, und plauschen ein wenig. Deine liebe Mutter kocht uns inzwischen je ein Tässchen Kaffee.“
Dies schien ihr gelegen zu kommen.
Er nahm mich mit und pflanzte mich in einen Wohnzimmersessel, bevor er selbst am Kamin Platz nahm, sich fest die Hände rieb und sein warmherzigstes Lächeln aufsetzte. „Jawohl, Sir“, bemerkte er dabei. „Was für ein Anblick.“
„Welchen meinen Sie?“
„Na, oben … von der Treppe nach draußen. Deine Frau Mama und ich schauten gerade durchs Fenster. Sag bloß, du hast das noch nie getan?“
Ich vergegenwärtigte mir den Ausblick und sah dabei nur die Dächer der Nachbarhäuser. „Nein, tatsächlich nicht, Sir.“
„So was! Gebrauche deine Augen immer und überall. Wozu sonst hat sie der Herr dir geschenkt?“
Eine berechtigte Frage, wie ich fand. „Ich gehe nach oben und schaue nach“, entgegnete ich.
„Ach, das ist jetzt nicht unbedingt vonnöten“, meinte er. „Wie steht es um dein Knie?“
„Es pocht noch ein bisschen.“
„Siehst du? Das ist dein Lebenssaft, der in Wallung gerät. Wie gesagt, Johnnie, vom Fenster aus sieht die Stadt atemberaubend aus, obzwar du, wenn du selbst nachschaust, wohl denken wirst, es handle sich um nichts weiter als schnöde Hausdächer.“ Er kicherte. „Das tat auch deine Mutter, als ich sie nach oben führte. Kannst du dir vorstellen, warum ich das tat?“
„Nein, Sir.“
„Nun ja, wir waren in unsere Arbeit vertieft und kamen über Umwege auf die Gabe der Phantasie zu sprechen. Unsere Vorstellungskraft ist etwas Großartiges. Manche Leute behaupten, sie seien mehr oder weniger leer ausgegangen, als der Allmächtige dieses Geschenk unter seinen Schäfchen verteilte, aber sie irren sich. Jeder von uns ist in vollem Maße davon beseelt. Man muss eben nur Gebrauch davon machen. Nimm zum Beispiel das Harmonium … Ich behaupte, jeder Mensch auf Erden kann darauf spielen, wenn er lernt, aus dem Quell seiner selbst zu schöpfen. Wirklich, der wildeste Eingeborene aus dem afrikanischen Dschungel ist dazu in der Lage, dieses Instrument zu beherrschen, so er sich nur darum bemüht.“
Die Vorstellung von einem schwarzen Stammesmitglied in voller Kriegsbemalung, das beherzt auf die Pedale von Tante Pansys Harmonium trat und Bleib bei mir, Herr intonierte, hatte etwas für sich, auch wenn sie äußerst abwegig war. Beecher verstand es, seine Argumente überzeugend aufzubereiten, indem er Unvereinbares miteinander verschränkte.
„Mit der Phantasie verhält es sich genauso“, führte er weiter aus. „Niemand von uns hat mehr oder weniger davon abbekommen, bloß fördert nicht jeder sie. Betrachten Sie es nicht als Stadtkulisse, riet ich deiner Mutter. Sehen Sie keine Alltäglichkeiten darin, sondern stellen Sie sich vor, die Dächer zu überfliegen oder behutsam abzutragen, um nachzuschauen, was sich darunter abspielt: die Dramen und Zwiste, Szenen der Verzweiflung oder Freude.[3] Deshalb nahm ich deine Mama mit hinauf.“
Just als er ausgesprochen hatte, trat Mutter mit einem Tablett ein. Heute muss ich lächeln, wenn ich daran denke, dass wohl nicht viel gefehlt hätte, und das Porzellan wäre ihr entglitten. Beecher fasste kurz für sie zusammen, was er mir gesagt hatte, woraufhin ihr entgeisterter Blick verschwand. Schließlich schenkte sie uns ein.
Er sprach mich nach einer Weile wieder an. „Sag, Johnnie, weißt du schon, was du später einmal werden möchtest? Welcher Arbeit willst du nachgehen?“
Davon hatte ich noch keinen klaren Begriff. Wohl um ihm zu imponieren, platzte ich jedoch heraus: „Ich hätte nichts dagegen, Prediger zu werden.“
„Sag bloß! Und was würdest du predigen?“
„Das … äh … Wort Gottes.“
„Weißt du denn, was das ist, Junge?“
„Nun ja, ich …“ Ich versuchte, mich der Dinge zu entsinnen, die er bei seinen Reden und im Privaten geäußert hatte. Dabei wollte ich mir vorstellen, selbst in einer geräumigen Halle zu stehen und ein Riesenpublikum in meinen Bann zu ziehen, indem ich die metaphysische Bedeutung von Hausdächern wiederkäute. Leider blieb die Vision verschwommen.
Beecher lächelte wieder und schien sich nun an mich wie Mutter zu richten. „Was hältst du davon, jetzt tatsächlich nach oben zu gehen und einen Blick aus dem Fenster zu werfen? Komm danach wieder herunter und erzähle mir, wie du die Dächer gesehen hast.“
Ich nahm seinen Vorschlag an, fand aber wie erwartet nichts Inspirierendes an dem Bild, das sich mir bot. Die ebenen oder schrägen Flächen, das verwitterte Holz und Eisen gaben mir nichts von Interesse preis, also dauerte es nicht lange, bis ich aufgab und wieder nach unten ging. Mutter und Beecher bewegten sich ruckartig, als hätten sie dicht nebeneinander gestanden, und ihre Wangen waren erneut rot.
„Ich glaube, mit meiner Vorstellungskraft ist es nicht weit her, Sir“, gestand ich.
Der Reverend klopfte auf meine Schulter. „Es darf nicht zu viele Verkünder in der Stadt geben, ansonsten laufen mir meine Schützlinge davon.“
„Ich will Gutes auf dieser Welt bewirken“, beharrte ich in vollem Ernst.
Er sah mich mit einer hochgezogenen Augenbraue an. „Dann könntest du auch Arzt werden.“
„Muss man dazu nicht sehr schlau sein?“
„Viele schlagen sich gut dabei und sind keine Intelligenzbestien, aber Phantasie braucht man in der Tat nicht dazu, falls du das meinst.“
„Also gut“, beschloss ich. „Werde ich eben Arzt.“
Beecher strahlte. „Dann sind die Weichen gestellt. Was halten Sie davon, Ma’am?“
„Wenn Sie es ihm ans Herz legen, wird es schon richtig sein“, fand Mutter.
Ich glaube, hätte er behauptet, ich würde eines Tages lernen, wie man fliegt und aus hohen Fenstern segelt, wäre sie fest davon ausgegangen, es gelinge mir.
Es dauerte wiederum mehrere Wochen, bis es zu einem ausgewachsenen Debakel kam. Wie aus heiterem Himmel kündete man vom Sieg der Nordstaaten, der in die Geschichte eingehen sollte. Auf Geheiß des Schuldirektors durften wir für den Rest des Tages freimachen, also ging ich gemeinsam mit Tante Pansy nach Hause.
Wie neulich war der Arbeitstisch verlassen und niemand mehr im Wohnzimmer. Ich deutete an, Mutter und Beecher stünden zweifellos am Fenster auf dem Treppenabsatz, um sich von den Dächern New Yorks beflügeln zu lassen. Tante Pansy blickte überraschend finster drein und gebot, ich solle mich nicht vom Fleck rühren. Dann nahm sie geschwind die Stufen.
Was sie oben entdeckte, blieb mir in seiner Deutlichkeit vorenthalten. Es genügt sowieso, wenn ich sage, dass Beecher kurz darauf aus dem Haus eilte, aschfahl und sichtlich angespannt. Er nahm sich nicht einmal Zeit, mir wie üblich übertrieben rührselig Auf Wiedersehen zu sagen. Dann hörte ich Mutter wimmern, und Tante Pansy wurde laut. Noch am selben Abend packten wir unsere Koffer, verließen das Haus und kamen in einem Hotel unter.
Weder Beecher noch meine Tante ließen sich je wieder blicken. Mutter kündigte bloß an, wir würden zurück nach England reisen, um bei meinen Großeltern einzuziehen.
„Aber du arbeitest doch für Mister Beecher, Mama …“
„Ich will nichts mehr davon oder über ihn hören. Man sollte sich nicht verzehren lassen von … religiösem Eifer.“
Mutters kläglich kurzes Leben näherte sich seinem Ende, bevor es zum öffentlichen Skandal um den Reverend kam. 1875 stand er wegen Ehebruchs vor dem Stadtgericht Brooklyn. Angeblich hatte er fünf Jahre zuvor eine Affäre mit der Frau seines engen Freundes und Kollegen Theodore Tilton gehabt. Der Prozess dauerte nicht weniger als einhundertzwölf Tage. Am Ende fanden die Geschworenen kein eindeutiges Urteil, aber Beechers Ansehen hatte unweigerlich Schaden genommen. Die amerikanische Presse trat die Einzelheiten breit, ob mit Karikaturen, Spottschriften oder kritischen Kommentaren jeglicher Art.
Die Kunde drang bis nach Großbritannien vor und wurde ähnlich reißerisch aufgenommen, doch wir schafften es, sie von Mutter fernzuhalten, denn ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich zusehends. Was unser großer Dichter George Meredith dazu bemerkte, kann ich ungefähr sinngemäß wiedergeben: „Ob schuldig oder nicht, religiöses Pack ist auf widerwärtige Art unnahbar, was die Geschichte seiner Lüsternheit und Unzucht absolut unerträglich macht. Eine Chronik über die Liebschaften von Hausierern läse sich nicht haarsträubender.“
Zu der Zeit studierte ich bereits Medizin und wusste weit mehr über die Welt. Dass Beecher mit Mutter liebäugelte, bezweifelte ich nicht mehr, als ich erfuhr, dass er Großbritannien mitnichten bereist hatte, um sein anstrengendes Kirchenamt ruhen zu lassen, sondern weil unabdingbar geworden war, dass er sich in seinem eigenen Land rar machte. Elizabeth Bowen, die junge Frau eines seiner Vertrauten, hatte sich auf dem Sterbebett zu unanständigen Tätigkeiten mit Beecher bekannt. Da erst verstand ich, weshalb er an Bord des Schiffes so erschrocken war, von Männern angesprochen zu werden, die wie Amtspersonen aussahen.
Ich hielt ihn dennoch nicht für einen Lustmolch. Vielmehr schien es, als habe er sich von Frauen ermuntern und emotional stimulieren lassen, wobei er sich jedoch weiter aus dem Fenster lehnte, als es für einen Mann in seiner Rolle statthaft war. Wie viele große Redner neigte er zur Gefühlsduselei und verfiel rasch seinen eigenen Worten. Als er sich den Unsinn über die Aussicht von Tante Pansys Treppenfenster zusammenreimte, um meine Gutgläubigkeit auszunutzen, glaubte er wahrscheinlich selbst felsenfest daran. Beecher gehörte zu jener Sorte von Geistlichen, von denen es besonders viele in Amerika gibt. Sie sehen sich sozusagen als Hauptvertreter eines Großkonzerns, dessen Leiter zufällig der Herrgott ist. Die Ware, die sie an den Kunden bringen, heißt Liebe, und die Produktpalette fällt entsprechend breit aus. Folglich muss man sich nicht wundern, wenn sich Mitarbeiter anmaßen, selbst auszuprobieren, was sie feilbieten.
„Sie werden sich daran erinnern“, sprach Sherlock Holmes, „dass ich Ihnen vor nicht allzu langer Zeit jene Passage aus Poes Manuskripten vorgelesen habe, in der ein logischer Geist dem unausgesprochenen Gedanken seines Gefährten folgt, was Sie als Gewaltakt des Autors abtun wollten. Als ich Ihnen entgegenhielt, genau das sei eine meiner ständigen Gewohnheiten, zeigten Sie sich ungläubig. Wie ich nun sah, dass Sie die Zeitung niederlegten und ins Grübeln gerieten, freute ich mich umso mehr, in Ihren Kopf schauen zu können.“
„Wollen Sie damit sagen, Sie lesen aus meiner Miene, was ich denke?“
„Die Gesichtszüge sind dem Menschen verliehen worden, damit er seinen Gefühlen Ausdruck verleihen kann, und die Ihren versehen diesen Dienst durchaus getreulich. Wissen Sie noch, wie Ihr Tagtraum begann?“ Als ich verneinte, fuhr er gleich fort: „Dann will ich es Ihnen sagen. Nachdem Sie von dem Blatt abgelassen hatten, saßen Sie gut eine halbe Minute lang mit leerem Blick da. Dann klarte er auf, und Sie fassten das frisch gerahmte Bild von General Gordon ins Auge, wobei ich erkannte, dass es in Ihrem Oberstübchen rumorte. Sie sahen rasch zu Henry Ward Beechers Porträt hinüber, das immer noch ohne Rahmen auf Ihren Büchern steht. Als Sie dann an die kahle Wand schauten, war mir klar, was Sie dachten. Wäre der Prediger gerahmt, sähe die Wand weniger nackt aus, und die beiden Bilder passten optisch zusammen.“
„Wunderbar kombiniert!“
„Bis dorthin konnte ich kaum irren, aber danach widmeten Sie sich Beecher eingehender. Sie dachten an seinen Lebenslauf. Ich entsinne mich, wie Sie mir von Ihrer flammenden Entrüstung über die Art und Weise berichteten, wie unsere hitzigeren Landsleute ihn zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs empfingen. Als Sie kurz darauf von dem Porträt abließen, nahm ich an, Sie blickten just auf jenen Krieg zurück. Ihre angespannten Lippen, das Funkeln in Ihren Augen und die geballten Fäuste bedeuteten mir, dass Sie noch einmal den Heldenmut beider Parteien in diesem verzweifelten Kampf bewunderten. Schon sahen Sie wieder betrübter aus und schüttelten den Kopf, da Sie all dem Grauen und Entsetzen nachhingen, dem sinnlosen Verschleiß von Menschenleben. Sobald Sie jedoch mit einer Hand über Ihre Narbe fuhren, umspielte ein verächtliches Lächeln Ihren Mund, woraus ich schloss, dass sich Ihr Geist jener unbeholfenen Art, Konflikte zwischen großen Interessengruppen zu lösen, nicht länger verschließen konnte.“
„Absolut richtig“, lobte ich.
„Ein simpler Taschenspielertrick, mein lieber Watson.“
Dieses Paradebeispiel aus meiner Vita habe ich im Laufe der Jahre wiederholt herangezogen, um die einzigartige Beobachtungs- und Kombinationsgabe meines geschätzten Freundes zu unterstreichen. In Wahrheit gab es dafür zumindest von seiner Warte aus aber tatsächlich keinen besseren Ausdruck als Taschenspielertrick.
Solange wir zusammenlebten, waren Holmes und ich nie gänzlich offen zueinander, wenn es um unsere Vergangenheit ging. Hätte ich ihn in diesem Augenblick berichtigt, wäre ich gezwungen gewesen, die Details zu offenbaren, welche die vorigen Seiten einnahmen. So lief es jedoch nicht zwischen uns beiden, also ließ ich ihn glauben, sein Trugschluss sei keiner.
Bezüglich Henry Ward Beecher bleibt zu betonen, dass mein Leben ohne ihn einen gänzlich anderen Weg genommen hätte. Heute wäre ich nicht derselbe Mensch und hätte Sherlock Holmes aller Wahrscheinlichkeit nach niemals kennengelernt. Vielleicht wäre die Karriere des Meisterdetektivs nicht für die Nachwelt festgehalten worden, hätte ich es nicht getan – so angeberisch dies auch klingen mag. Dass ich mich hin und wieder zum Brüten über jenen erhabenen, aber fehlerhaften Amerikaner verleiten lasse, ist nicht weiter verwunderlich. Meine Augen glänzten beim Schwelgen in seiner Wortgewalt, die Hände verkrampften, weil ich seines Wagemuts im Angesicht der Glasgower Rotte gedachte, und zuletzt schaute ich betrübt drein wegen seines späteren Niedergangs.
Ohne Beecher und die Laufbahn, auf die er mich lotste, wäre ich zudem um eine Kriegsverletzung und andere Narben ärmer, die das Leben hinterlassen hat. Das Lächeln, das Holmes bemerkte, rührte indes von Erinnerungen an Wonnen wieder, die ich andernfalls möglicherweise ebenfalls nicht erfahren hätte.
Zum ersten Mal seit Jahren habe ich Beechers Porträt von seinem angestammten Platz auf meinen Büchern genommen, um es genauer zu betrachten. Es ist in keiner Weise wertvoll, ein Stahlstich von 1870, den die kleine religiöse Zeitschrift Christian Union jedem Abonnenten schenkte, der zwei weitere anwarb. Ich selbst stieß auf dem Trödel in der Charing Cross Road darauf. Jemand hatte sich die Mühe gemacht, es grob auf einen festen Bildträger zu spannen, dabei aber auf Glas und Rahmen verzichtet.
Als ich es kaufte, konnte ich mir keinen richtigen Aufhänger leisten, also stellte ich es, wie bei solchen Fundstücken üblich, zunächst auf den Kamin und später an alle möglichen Stellen, wo es sich anlehnen ließ. Jedes Mal, wenn ich mir vornahm, es einzurahmen und aufzuhängen, zauderte ich am Ende doch. Erst jetzt, nachdem ich diesen Teil meiner Memoiren fertiggestellt habe, kenne ich den Grund. Meine Meinung zu Henry Ward Beecher bleibt gespalten. Täte ich den eindeutigen Schritt und befestigte sein Bild an der Wand, würde ich ihm damit vorbehaltlosen Respekt erweisen, doch dazu sehe ich mich außerstande.
Na, Holmes? Wären Sie darauf gekommen, wenn ich Sie so weit eingeweiht hätte wie meine Leser jetzt?
Kapitel 7
„Nun, Watson, das schöne Geschlecht fällt in Ihr Fach.“
Die Liebelei meiner Mutter war also dafür verantwortlich, wie ich zu meinem Beruf fand. Dass ich ihre unglückliche Beziehung aufdeckte und von Beechers früheren Eskapaden erfuhr, schmälerte die Bedeutung seines Ratschlags keineswegs. Konsequenter denn je musste ich mich fortan um meinen weiteren Werdegang kümmern, um Mutter nicht ewig auf der Tasche zu liegen, und die ärztliche Laufbahn kam mir nicht besser oder schlechter vor als andere.
Ferner diente mein Großvater mütterlicherseits als Vorbild. Er besaß ein großes Haus an einer Allee im besten Wohnviertel von Bagshot mit einem breiten, halbrunden Vorhof, auf dem seine wohlhabenden Patienten ihre Kutschen neben seinem schicken Pferdewagen abstellten, wenn sie zur Sprechstunde kamen. Ich hatte stets den Eindruck, er verbringe mehr Zeit damit, seine Rosen zu schneiden und Zeitung zu lesen oder seine große Münzsammlung zu pflegen, die mehrere hohe Schränke in seinem Studierzimmer einnahm, als mit seinen eigentlichen Aufgaben als Mediziner, die er größtenteils auf Assistenten abwälzte. Trotzdem muss er ein mehr als angenehmes Einkommen erwirtschaftet haben, so man es an seinen verschwenderisch prachtvollen Möbeln festmachte. Außerdem lebten Großmutter und meine beiden ledigen Tanten nicht minder in Saus und Braus, während ein halbes Dutzend Bedienstete in verschiedenen Positionen alle erdenklichen Arbeiten im Haus erledigte.
Großvater war ein liebevoller, freundlicher alter Mann, korpulent und weltgewandt mit silbergrauem Haar, aber nach meinem Dafürhalten nicht überdurchschnittlich intelligent. Dennoch hatte er seinerzeit den gleichen Weg eingeschlagen, den ich beschreiten wollte. War er so zu einer blühenden Existenz gelangt, konnte ich das auch, wie ich dachte.
Diese Aussicht blieb die einzige positive, die ich auf der Rückreise in unsere Heimat hatte. Anders als auf dem Hinweg regte mich nun kein Prediger an, und Mutter verbrachte die meiste Zeit in ihrer Einzelkabine, die deutlich enger und düsterer war als ihre gemeinsame mit Vater zuvor, denn in jener hatte man vergleichsweise genug Platz gehabt. Viel aß sie nicht, und wenn ich bei ihr anklopfte, um sie zum Mitkommen in den Speisesaal zu überreden, waren ihre Augen rot. Sie las nie und schien sich auch nicht anderweitig zu zerstreuen, sondern hockte bloß herum und suhlte sich verschwiegen in ihrem Elend.
Dass wir zu meinen Großeltern zogen, war nur folgerichtig. Mutters Verfassung gab ihren Schwestern Anlass zur Empörung, aber ich glaube, sie erachteten Vaters Abkapselung nicht als das Schlechteste. Beecher wurde nie auch nur mit einer Silbe erwähnt, und Mutter wurde von Schuldzuweisungen verschont, also stand anzunehmen, dass Tante Pansy zumindest so gütig gewesen war, den Mantel des Schweigens über die Vorfälle in ihrem Haus zu legen. Nichtsdestoweniger fand ich die Atmosphäre im Haus bedrückend, weshalb ich mit einiger Erleichterung erfuhr, dass ich als Internatsschüler auf das noch relativ junge Royal Medical Benevolent College in Epsom gehen sollte. Von Bagshot aus waren es gut zwanzig Meilen bis dorthin.
„Eine ausgezeichnete Anstalt“, behauptete Großvater. „Sie wurde ’55 gegründet, als du noch in die Windeln gemacht hast, und dient als Heim für bedürftige alte Witwen von Medizinwissenschaftlern beziehungsweise Ärzten.“
„Aber ich bin weder das eine noch das andere, Opa!“
Er lächelte. „Zum Leibarzt eignest du dich auch gar nicht, aber falls du dir ein Beispiel an mir nimmst, wirst du im Alter keine Stütze brauchen. Im Ernst, die Schule wurde an die Stiftung gegliedert, damit die Söhne von Ärzten eine fundierte Ausbildung im Sinne ihrer Väter erhalten.“
„Vater ist kein Arzt.“
„Nun ja, ich … äh … kenne einen der Leiter des Instituts recht gut und ließ ihm eine der Silbermünzen von König Offa von Mercia zukommen. Achtes Jahrhundert, ein wunderschönes Stück, wie sie erst wieder unter Heinrich VII. geprägt wurden. Komm mit, ich zeige dir ein paar meiner übrigen Exemplare.“
Offensichtlich stand von vornherein fest, dass sein Sammlerkollege ein gutes Wort für mich beim Gremium der Gelehrten einlegte, und so kam es, dass ich noch im selben Jahr, also 1864, im Alter von zwölf Jahren auf dieser Schule landete. Es war eine sehr gefällige Anstalt auf einem ungefähr achtzehn Morgen großen Gelände für hundertfünfzig ansässige Schüler. Das Lehrpersonal kam seiner Pflicht mit Feuereifer nach, und auch ich gab mein Bestes, sodass ich 1869 die Anforderungen zur Immatrikulation an der Universität London erfüllte. Ich bestand in Englisch, angewandter Philosophie, Chemie und Mathematik, darüber hinaus sogar, wenn auch sehr knapp, in Französisch, Griechisch sowie Latein.
Insgesamt zogen sich die Jahre dort aber träge dahin, speziell mit der Aussicht auf weitere Plackerei während des anschließenden Medizinstudiums. Bisweilen beneidete ich Henry um sein Leben als Goldsucher, wenngleich man nichts von ihm und Vater hörte. Meinen Überschuss an Energie verbrauchte ich beim Rugby. Dank meiner kräftigen Statur wurde ich zum Stammspieler in der Position Scrum-half, wobei ich keine Hemmungen hatte, den Gegner ordentlich durch die Mangel zu drehen. Binnen kurzer Zeit schwang ich mich in die erste Mannschaft empor und war dort jüngstes Mitglied.
In Epsom entdeckte ich noch eine weitere Sportart, für die ich eine natürliche Neigung hatte. Ich frönte ihr im Laufe der Zeit regelmäßig, obschon mit Unterbrechungen. Schließlich sagte einst ein weiser Grieche, als man ihn fragte, in welchem Alter ein Mann aufhöre, sich für Frauen zu interessieren, er wisse noch keine Antwort darauf. Auch ich würde etwas in dieser Art entgegnen. Hinsichtlich meiner oft zitierten Behauptung, mit vielen Frauen auf drei Kontinenten – eigentlich waren es mehr – angebandelt zu haben, will ich nun zum Ende meiner Kindheitserinnerungen kommen, indem ich erzähle, wie ich zum Schürzenjäger wurde.
Auf der Schule gab es mehrere Dienstmädchen, die wir beim Vornamen ansprechen durften, und das hübscheste unter ihnen hieß Aggie. Sie war wohl nur ein paar Jahre jünger als meine Mutter, aber drall und robust gebaut, mit rosig glänzenden Wangen und schwarz schimmerndem Haar. Wie sie sich in ihrer bezaubernden schwarz-weißen Uniform bewegte, war sie für mich der Inbegriff von Anmut.
Eines Nachmittags, als ich am Schwarzen Brett auf einem der Gänge den Spielplan durchging, stach mich jemand von der Seite mit einem Finger. Ich fuhr reflexartig zur Verteidigung herum und staunte nicht schlecht, Aggie zu sehen. Sie strahlte mich an, sonst war niemand in der Nähe.
„Hab es gemerkt“, sagte sie leise. Die schnöde Wortwahl passte nicht zu ihrem Aussehen.
„Was meinst du?“
„Dass du mich anschaust.“
„Na ja, wo die … ich meine, wo der Blick hinfällt …“
„Es gibt Blicke und Blicke.“ Sie rückte mir dichter auf den Leib. „Bist ein feiner, großer Junge. Gehst bald ab, hab ich recht?“
„Leider nein, ich bin erst im vierten Semester.“
„Erzähl mir nichts!“
„Wie alt schätzt du mich, Aggie?“
„Achtzehn, vielleicht auch noch siebzehn.“
„Nein, ich bin fünfzehn.“
Sie musterte mich unverhohlen neugierig von Kopf bis Fuß. „Fünfzehn also … und hast noch nie geküsst, nehme ich an.“
Daraufhin warf sie mir einen Blick zu, bei dem sich meine Nackenhaare aufrichteten, dann verschwand sie mit einem Zwinkern. Da ich solches Turteln zwischen den Geschlechtern nicht gewohnt war, fiel mir die Reaktion meines Körpers umso drastischer auf.
Unsere Begegnung ging mir tagelang nicht aus dem Kopf. Wo ich lief oder stand, hielt ich Ausschau nach Aggie. Wann immer ich einen Blick auf ein schwarzes Dienstkleid mit weißen Bändern erhaschte, tat mein Herz einen Sprung. Als ich sie endlich wiedersah, stand ich bei zwei anderen Jungen. Ich suchte ihren Blick verbissen, aber sie ging achtlos an mir vorbei.
„Mit der würde ich einen Ringkampf wagen“, bemerkte Sturges, ein Flegel mit einem breiten Repertoire an zotigen Witzen.
„Sie könnte deine Mutter sein“, entgegnete sein Kumpan Williamson kichernd.
„Wenn dir nach einem Feuer ist, heizt du, egal was der Kalender sagt“, konterte Sturges, woraufhin die beiden albern gackernd herumtanzten und einander auf den Rücken klopften. Ich wollte nicht riskieren, dass man mein Interesse an Aggie erkannte, also verkniff ich mir, sie zu verteidigen.
Wenn der Nachmittagsunterricht vorbei war, wischten die Mädchen stets die Klassenräume, und zwar jeweils zwei auf einem Flur, aber nicht in ein und demselben Zimmer. Nachdem ich dies eingehend beobachtet hatte, wartete ich einmal, bis sich alle anderen aufgemacht hatten, und schlüpfte durch den Eingang, hinter dem Aggie wenige Minuten zuvor verschwunden war. Drinnen stieß ich die Tür nur leicht an, damit sie angelehnt offen stand.
Wie sich Aggie beim Putzen ins Zeug legte, war entzückend anzuschauen. Sie bemerkte mich jedoch schnell und drehte sich um.
„Oh, hallo Aggie!“, grüßte ich in gespielter Überraschung. „Ich habe ein paar Bücher vergessen. Entschuldigung, dass ich jetzt Fußabdrücke hinterlassen muss.“
Sie richtete sich auf, um ihren Mopp in den Eimer zu stellen. Dabei schob sie eine widerspenstige Strähne ihres seidig schwarzen Haares zurück. Ihre Wangen waren durch die Arbeit noch röter geworden. „Macht nichts. Wische ich eben hinterher noch einmal durch.“ Sie hielt den Stiel mit beiden Händen fest und stützte ihren Kopf darauf, während sie mich betrachtete. „Glaub bloß nicht, mir fällt nicht auf, dass du immer noch glotzt. Ich spüre deine Augen an meinem Hinterkopf.“
„Nicht nur dort, Aggie.“
„Ferkel! Immer noch ungeküsst?“
„Wohl nicht mehr lange.“
Auf diese Worte hin ließ sie den Mopp senkrecht im Eimer stehen und kam zu mir. Nachdem sie die Hände an ihrem Rock getrocknet hatte, nahm sie meine, legte sie um ihre Hüften und drückte mich noch in derselben Bewegung an sich. Dann hob sie die Arme, schlang sie um meinen Hals und gab mir einen Kuss direkt auf den Mund. Erregung, Staunen, sogar Angst empfand ich, und es kribbelte vom Schopf bis zu den Zehen wie ein Stromstoß. Ohne den Ladies auf die Füße treten zu wollen, die mein Leben später bereicherten, kein Schmatz hat je wieder eine solche Bandbreite von Gefühlen in mir heraufbeschworen wie der allererste von Aggie Brown.
„So“, sagte sie, nachdem sie von mir abgelassen und sich hinter ihr Putzzeug zurückgezogen hatte. „Jetzt bist du geküsst.“
„D… danke, Aggie.“
„Keine Ursache, Süßer. Gern jederzeit wieder.“
„Wirklich?“
„Mit einem niedlichen Bär wie dir immer … nur muss ich jetzt meine Arbeit machen, und du willst doch nicht erwischt werden, oder?“
„Gott bewahre, nein!“
„Gott bewahre, nein! Bist nicht auf den Mund gefallen. Jede Wette, dass du auch anderswo auf der Höhe bist.“
„Ja, ich spiele beim Rugby in der ersten Mannschaft.“
„Meinte ich nicht, Süßer. Mach dich jetzt vom Acker. Nimm deine Schmöker … und Abmarsch!“
„Schmöker?“
„Deswegen bist du doch hergekommen, oder … nein, meinetwegen, hab ich recht?“
„Tja …“
„Du spitzer, kleiner …! Wart nur ab, Freundchen!“
Sie putzte weiter, während ich zur Tür zurückging. Einmal noch blieb ich stehen, um mich an ihrer Figur zu weiden. Dann spähte ich hinaus und stahl mich davon.
Leser, die mit meiner Erzählung Der Flottenvertrag vertraut sind, in der Sherlock Holmes dafür sorgte, dass Außenminister Lord Holdhurst sein Amt niederlegte, mögen sich daran erinnern, dass Percy Phelps, der Neffe des Politikers, zum arglosen Spielball in der Affäre wurde. Er ging gemeinsam mit mir zur Schule und ließ sich einspannen, damit mein Abenteuer mit Aggie Brown weitergehen konnte, was ich bis jetzt verschwiegen habe.
Kaulquappe, wie wir ihn untereinander nannten, war kaum älter als ich, aber zwei Klassenstufen über mir. Er hatte sich als Musterschüler erwiesen, der lieber paukte als Spielchen trieb. Diese Vorliebe sowie die Tatsache, dass er mit dem Posten seines Onkels prahlte und behauptete, er hätte die Hochschulen in Eton, Harrow oder Winchester besuchen können, wäre er darauf aus gewesen, trugen verständlicherweise nicht zu seiner Beliebtheit bei. Sein Spitzname passte, und seine Hühnerbrust macht ihn zum willkommenen Opfer unserer derben Späße.
Eigentlich verabscheue ich Gewaltmenschen und ihre Einschüchterungsmanöver seit je. Da ich stark war und meine Fäuste gebrauchen konnte, blieb ich weithin verschont, aber dass ich meinen Kräftevorteil jemals zum Leidwesen eines schwächeren Jungen ausgenutzt hätte, muss ich mir wirklich nicht vorwerfen lassen. Vielmehr erlegte ich mir auf, Tyrannen zurechtzuweisen, damit sie ihre Prügelknaben verschonten. Nur falls sie sich weigerten, überzeugte ich sie mit Schlägen.
Eines Tages hörte ich tumultartigen Lärm und bog gleich darauf um eine Ecke der Kapelle, wo ich auf Phelps stieß. Er stand mit dem Rücken an der Mauer, vor ihm Sturges, Williamson und andere aus deren Bande. Sie bedrängten ihn und drohten, ihm die Hose auszuziehen, wenn er es nicht selbst tat, und ihn halbnackt über den Campus zu jagen.
„Bitte nicht!“, jammerte er. „Ich müsste mich schämen.“
„Strippe, Kaulquappe!“
„Nehmen wir ihm seinen anderen Kram auch ab!“
„Wir sollten ihn splitterfasernackt am Mädchenwohnheim vorbeilaufen lassen.“
„Ach, die könnten ihm nichts abgucken.“
Lachend und johlend näherten sie sich ihm, doch ich sprang dazwischen, packte zwei gleichzeitig an den Kragen ihrer Jacketts und wuchtete sie hinter mich. „Lass ihn in Ruhe, Sturges!“, gebot ich dem Rädelsführer, der sich mir mit zorniger Miene zuwandte.
„Was hast du, Watson? Ist doch bloß Kaulquappe.“
„Einer gegen sieben.“
„Der Kerl hat sich längst daran gewöhnt, dass man auf ihm herumhackt.“
„Er hat eine Heidenangst.“
„Armer Wicht. Will heim zu Mama, was?“
„Ich sage es nicht noch einmal, Sturges.“
„Mimst jetzt den großen Bruder, oder wie?“, stichelte Williamson, doch kaum hatte er die Frage gestellt, strömte Blut aus seiner Nase und er heulte.
„Kommt nur!“, forderte ich. „Wer will als Nächster?“
Sie wechselten Blicke und erwogen wohl, mich gemeinsam anzugreifen, aber niemand zeigte sich bereit zum ersten Schritt.
„Abmarsch!“, grollte ich vor Sturges. Als er sich zurückzog, drehte ich mich mit erhobenen Fäusten zu den Übrigen um, doch niemandem stand der Sinn nach einem Satz heißer Ohren. Sie gingen auseinander und verflüchtigten sich, Williamson taumelte und jammerte.
„Rührt ihn hinter meinem Rücken an, und ich prügle euch Mistkäfern die Seele aus dem Leib!“, rief ich ihnen nach. Sie erwiderten nichts.
„Mensch, vielen Dank, Watson!“, schnaufte Phelps hinter mir. „Das war wirklich verdammt nett von dir.“
„Du solltest ihresgleichen die Stirn bieten“, riet ich. „Je größer die Klappe, desto feiger sind sie, wenn es hart auf hart kommt.“
„Da geht es mir wohl nicht anders.“
„Zeige wenigstens, dass du dich wehren kannst, auch wenn du dabei ein paar Backpfeifen in Kauf nehmen musst. Nur so verschaffst du dir Respekt.“
„Ein Klotz wie du hat gut reden.“
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783957192059
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (Januar)
- Schlagworte
- Detektiv Spannung Sherlock Holmes Krimi Ermittler