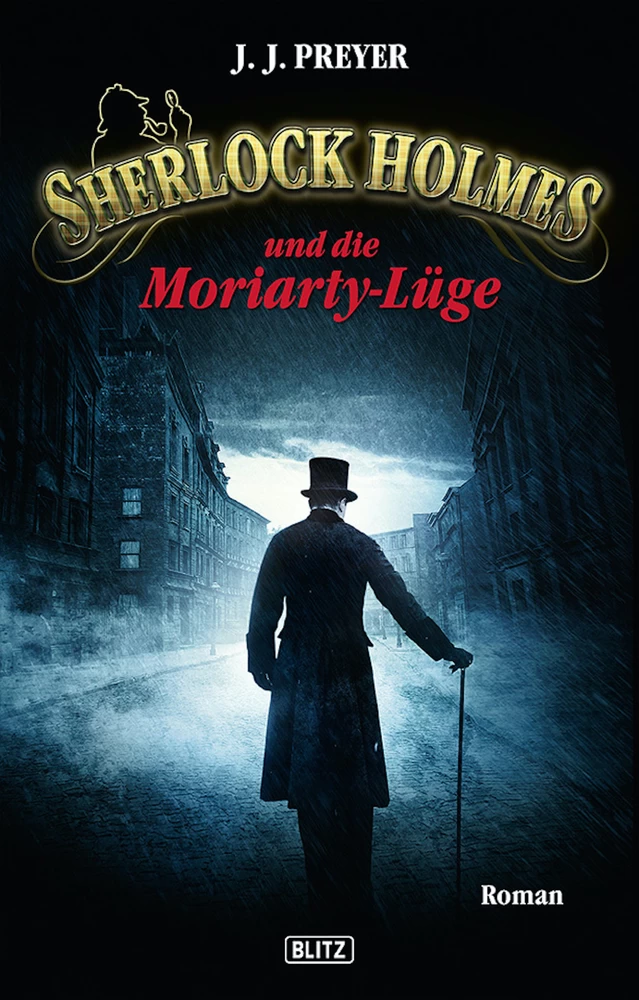Sherlock Holmes - Neue Fälle 02: Sherlock Holmes und die Moriarty-Lüge
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Der Autor
J. J. PREYER, geboren 1948 in Steyr, Österreich.
Ab dem 14. Lebensjahr literarische Veröffentlichungen. Studium Deutsch, Englisch in Wien. Lehrtätigkeit in der Jugend- und Erwachsenenbildung. 1976 Auslandsjahr in Swansea in Wales. 1982 Initiator des Marlen-Haushofer-Gedenkabends, der durch die Teilnahme des Wiener Kulturjournalisten Hans Weigel den Anstoß zur Wiederentdeckung der Autorin gab. Mitarbeit an der Kinderzeitschrift KLEX von Peter Michael Lingens.
1996 gründete J. J. Preyer den Oerindur Verlag, einen Verlag für lesbare Literatur und Krimis. Der Autor schreibt seit Jahresbeginn 2010 für die Romanserie JERRY COTTON im Bastei Verlag.
KAPITEL 1
Der Mann mit dem schweißnassen Gesicht schlief schlecht. Kaum schien er in einer Position Ruhe gefunden zu haben, wälzte er sich auf die andere Seite, wobei er zischende Laute von sich gab und von Zeit zu Zeit mit grollender Stimme unverständliche Wörter murmelte. Er träumte, und was er träumte, war unerfreulich.
Dr. Watson, denn um ihn handelte es sich bei dem Mann, lag allein in seinem Ehebett. In Fieberphantasien gefangen erlebte er in jener Nacht immer und immer wieder den Abschied von den wichtigsten Menschen in seinem Leben. Sowohl seine geliebte Frau Mary als auch sein Freund Sherlock Holmes entschwanden für immer. Er streckte die Hände aus, wollte sie zurückhalten, festhalten, sich an sie klammern, aber sie entfernten sich unaufhaltsam von ihm, stürzten mit Gewalt nach unten, wie die schäumenden Wasser der Reichenbach-Fälle, aus denen es kein Entrinnen gab.
Zunächst standen sie da wie Touristen, die das Naturspektakel bewunderten. Holmes hielt Marys linke Hand in seiner Rechten, freundschaftlich, beinahe liebevoll. Im nächsten Augenblick wurden sie von einer Woge des Gebirgsbaches erfasst und in den Abgrund gerissen.
Auch Watson spürte die eisige Kälte des Wassers, die Schmerzen im Oberkörper, am Herzen, auslöste. Es schüttelte ihn vor Kälte, obwohl ihm so unerträglich heiß war, dass er schwitzte.
Dann erwachte John Watson. Er hatte Fieber, musste das Hemd wechseln, das wie ein feuchtes Tuch an seinem glutheißen Körper klebte. Er durfte sich nicht gehen lassen, denn noch bestand Hoffnung. Hoffnung, dass seine Frau und sein Freund am Leben waren. Und wenn das so war, brauchten sie ihn. Er durfte nicht aufgeben, den beiden zuliebe.
Der Doktor erhob sich und wankte zum Wäscheschrank, dem er ein frisches Hemd entnahm, ging weiter zum Fenster, öffnete es, sog tief die frische Mailuft in die Lungen.
Es war still draußen. Die nächtliche Ruhe, die vom Regent's Park ausging, drang versöhnlich in die hohen Räume von Doktor Watsons Wohnung. Er begab sich wieder zu Bett und fand sich Minuten später in einem weiteren Traum, in dem ihn jemand anblickte.
Nein, diese Augen gehörten zu niemandem, den er kannte. Es handelte sich nicht um die hellen blauen Augen seiner Mary und nicht um Holmes' graue Augen, es waren glitzernde, kalte Augen, die ihn aus den Fluten des eisigen und doch so heißen Wassers anstarrten, die Augen eines Reptils, einer Schlange, die aus den Reichenbach-Fällen glitt, auf Watson zu, den ihr Blick gefangen hielt.
Ihr schmales Maul schien zu lächeln, auf schlaue, heimtückische Weise, ihre Zunge war blau und gespalten. Sie schien etwas zu sagen, aber Watson verstand sie nicht. Das Tosen der Fälle war zu laut, also kniete er nieder und näherte sein rechtes Ohr dem Schlangenhaupt.
»Du kannst einen von beiden retten«, zischte die Schlange, »indem du den anderen opferst.«
Nein. Niemals. Watson war sich klar, dass er weder Holmes für seine Frau noch Mary für den Detektiv opfern wollte.
»Dann sind sie beide tot«, sagte die Schlange.
»Sie leben nicht mehr. Ich weiß es«, stellte Watson fest.
»Du irrst«, ließ das Reptil nicht locker. »Sie haben sich verborgen und können wiederkehren, aber nur einer von ihnen.«
»Du lügst, deine Zunge ist gespalten.«
»Meine Zunge ist geformt wie bei allen Individuen meiner Art und ich spreche die Wahrheit. Die Entscheidung liegt bei dir.«
Watson verstummte. Er versuchte sich zu konzentrieren. Wer von beiden war ihm wichtiger? Mary, die er durch seinen Freund Holmes während einer seiner Fälle kennengelernt hatte, oder der Detektiv selbst? Er konnte sich nicht entscheiden. Wenn er versuchte, sich einen der beiden vorzustellen, sah er das Gesicht des anderen. Es gab keinen Unterschied zwischen ihnen, so sehr er sich auch bemühte, einen zu finden.
»Ich kann nicht. Es ist mir unmöglich. Ich muss auf beide verzichten«, sagte er zur Schlange.
»Es ist deine Wahl«, erwiderte diese und glitt in das Wasser zurück.
Als Watson erneut erwachte, schmerzte sein Kopf, er hatte Schüttelfrost und entschied sich, den Rest der Nacht sitzend in einem Lehnstuhl zu verbringen, um von weiteren Albträumen verschont zu bleiben. Am Morgen würde er einen Arztkollegen kommen lassen. Seine eigenen Versuche, das Fieber zu senken, waren gescheitert. Nicht einmal der sonst so wirksame Absud aus Weidenrinde hatte Wirkung gezeigt.
Bei seinen Patienten hätte Watson demzufolge auf seelische Gründe für die erhöhte Temperatur geschlossen, bei sich selbst vermutete er eine verborgene, geheimnisvolle Erkrankung, möglicherweise eine Vergiftung, da er sonst nicht zu solchen Gemütszuständen neigte. Er würde Doktor Solvay, einen Studienkollegen, heranziehen, um endlich wieder zur Ruhe zu kommen und von den qualvollen Phantasien und Träumen erlöst zu werden.
Wie würde sich Sherlock Holmes in einer solchen Situation verhalten, außer zu Kokain zu greifen? Diese Substanz war dem erfahrenen Mediziner zu gefährlich. Es hieß den Teufel mit Beelzebub auszutreiben.
Der Teufel. Die Schlange. Die Lüge. Erneut fand sich Watson in jenem Zustand des Halbschlafes, in dem ihn dunkle Bilder verfolgten.
Holmes würde seinen Verstand einsetzen, die Situation analysieren, Lösungen entwickeln.
»Mein lieber Watson«, würde er sagen, und allein die Erinnerung an diese Worte trieb dem Doktor Tränen in die Augen. »Mein lieber Watson. So verständlich auch die Verwirrung nach dem Verschwinden Ihrer geschätzten Frau ist ...«
»Vom Verlust Ihrer Person zu schweigen«, würde er selbst sagen.
»Danke, Watson. Sehr aufmerksam. Also, so verständlich Ihr beklagenswerter Zustand ist, er bedeutet keinen Fortschritt in der Sache selbst. Überlegen Sie. Gibt es Leichen? Nein. In beiden Fällen existiert kein objektiver Beweis für den Tod der betreffenden Person. Der methodisch vorgehende Denker fragt sich demnach, warum das so ist. Die Antwort: zwei merkwürdige Zufälle oder ein Plan dahinter. Und weil Sie wissen, was ich von Zufällen halte, suchen Sie nach dem Muster, dem Plan.«
»Aber ich weiß doch nicht ...«
»Und ob Sie es wissen, Watson. Sie müssen sich nur erinnern. Wie sind die letzten Minuten vor dem Verschwinden der geschätzten Mary Watson verlaufen, in welchem Zustand war sie? Ahnte sie etwas?«
»Wir waren in Meiringen, in der Schweiz.«
»Mit Mary?«, fragte Holmes, boshaft lächelnd.
»Sie und ich«, ließ sich Watson nicht beirren. »4. Mai 1891, Meiringen in der Schweiz. Eine Tour in die Berge, nach Rosenlaui, um die Reichenbach-Fälle zu besichtigen. Ein fürwahr beeindruckender Anblick. Das durch die Schneeschmelze angeschwollene Gewässer stürzte in einen Abgrund, von dem die Gischt nach oben rollte wie Rauch aus einem brennenden Gebäude.«
»Sie lassen sich schon wieder von Ihrer Phantasie mitreißen, Watson«, würde Holmes sagen. »Bleiben Sie bei den Fakten!«
»Aber das sind doch die Fakten«, würde er protestieren.
»Das sind Details, die Ihnen nicht weiterhelfen. Denken Sie an den Ausgangspunkt, folgen Sie der Linie und Sie werden das Ziel erreichen.«
»Reichenbach-Fälle«, wiederholte der Doktor. »Ein Diener brachte uns die Nachricht, dass im Hotel ein Arzt benötigt werde. Blutsturz einer englischen Lady, die an Schwindsucht litt. Ich eilte ins Hotel. Das war es.«
»Nein, es gab noch mehr«, widersprach Watson seinem Freund.
»Das war der Augenblick, in dem ich Sherlock Holmes zum letzten Mal sah.«
»Richtig. Bleiben Sie präzise!«
»Im Hotel wusste man nichts von dem Diener, auch existierte keine kranke englische Lady. Alles eine Lüge, um uns zu trennen und Sie zu verderben.«
»Und warum waren wir dort?«
»Weil, weil ...«
»Wegen Professor Moriarty, vor dem wir uns in Sicherheit brachten, nach mehreren Anschlägen hier in London.«
»Ja. So muss es gewesen sein.«
»Zweifel, Watson?«
»Nein, keine Zweifel.«
Watson erinnerte sich der letzten schriftlichen Worte, die sein Freund in einem silbernen Zigarettenetui auf drei Seiten seines Notizbuches hinterlassen hatte: Lassen Sie bitte Mrs. Watson grüßen, hieß es am Ende dieser Aufzeichnungen.
Und nun war auch Mrs. Watson verschwunden, auf eine ganz ähnliche Weise.
»Details, mein lieber Watson! Nur Exaktheit kann weiterhelfen. War Mrs. Watson irgendwie anders in letzter Zeit, besorgter, scheu?«
»Sie war noch liebevoller, noch wärmer als am Anfang. Die Beziehung zwischen uns hatte sich vertieft. Manches Mal schaute sie mich unendlich traurig an. Und auch das muss gesagt werden, auch wenn es nichts zur Sache beiträgt. Mary wurde schöner mit jedem Tag, ihr Ausdruck nahm an Kraft zu, obwohl ihr Körper der eines zarten und zerbrechlichen Wesens blieb. Ihre hellen blauen Augen erinnerten mich an das Schmelzwasser von Gebirgsbächen im Frühjahr, ihre Lippen waren heiß und weich, ihr Haar ...«
»Und der letzte Tag?«, würde Holmes ihn unterbrechen.
»Ganz einfach. Es war der siebente Februar, ein Donnerstag. Wir frühstückten gemeinsam, ich ging in die Praxis hinunter. Als ich gegen zwölf Uhr dreißig nach oben kam, war die Wohnung leer. Kein Brief, nichts.«
»Fehlte etwas aus der Wohnung?«
»Ihr Wintermantel. Sonst nichts.«
»Schuhe?«
»Ja.«
»Das heißt, sie war ausgegangen und nicht zurückgekehrt.« »Man sah sie in eine Droschke steigen. Schwarz, mit geschlossenen Vorhängen. Schwarze Rappen.« »Moriarty.« »Das heißt ...« »Nein, heißt es nicht. Ich bin sicher, Ihre Frau ist noch am Leben und Sie werden sie wiedersehen.«
Die geistige Anstrengung, die, wenn auch nur imaginierte, Begegnung mit Sherlock Holmes hatte den Doktor so erschöpft, dass er noch im Sessel in einen bleiernen Schlaf fiel, aus dem er am Morgen benommen, mit Gliederschmerzen, erwachte.
Er bat Mrs. Remington, die für ihn das Haus in Ordnung hielt, nach Dr. Solvay zu senden. Der Mann hatte zwar schwedische Vorfahren, war aber ein guter Diagnostiker.
Watson musste nach dem Frühstück, das er bis auf eine Tasse Tee ohne Milch kaum angerührt hatte, wieder eingeschlafen sein, jedenfalls weckte ihn von der Tür her die Stimme eines Mannes, die ihm bekannt vorkam, nur konnte er sie vorerst nicht einordnen. »Fieber, jenes interessante Phänomen, dessen Name sich vom lateinischen ferveo, brennen, ableitet, ist ein Körperzustand, der durch erhöhte Temperatur gekennzeichnet ist. Fieber begleitet viele Krankheiten und muss als Symptom und nicht als Ursache betrachtet werden. Fieber ...«
»Wenn es nicht völlig unmöglich wäre, so handelt es sich um meinen alten Freund Holmes. Aber es ist wohl nur ein weiterer Fiebertraum«, erwiderte Watson matt.
»Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben, meine Stimme der eines Arztes mit schwedischen Wurzeln anzugleichen. Das Fachwissen entstammt der Encyclopaedia Britannica.«
Nun zeigte sich der hochgewachsene, fast dürr zu nennende Mann, der an die vierzig Jahre alt sein mochte, dem im Krankenbett liegenden Watson, indem er den Schlafraum betrat. Es handelte sich dabei um ein Zimmer, das dem in der Baker Street auf verblüffende Weise glich, mit einem allerdings wesentlich breiteren Bett in der Mitte, zu dessen linker und rechter Seite je ein Tischchen mit einer Kerze stand. Das Fenster zum Park lag am Kopfende, sodass der Schlafende nicht von der Helligkeit des Morgens gestört wurde. Ein großer Kleiderschrank und ein offener Kamin in der Ecke rechts vom Eingang ergänzten die Einrichtung. Wie in der Baker Street war auch dieses Gemach mit einem Grammophon ausgestattet.
Die Hand der tüchtigen und liebenden Frau zeigte sich in der Auswahl der Textilien des Bettes und der Vorhangstoffe und vermutlich auch der Bilder an den tapezierten Wänden, die Szenen indischer Landschaften zeigten, jenem Land, in dem Mary Morstan ihre Kindheit verbracht hatte.
»Bleiben Sie liegen, guter Doktor. Sie sind krank«, sagte Holmes.
»Aber ... wie ...«, stammelte Watson.
»Ich lebe, ja, und ich dachte, ich zeige mich meinem Freund, in der Hoffnung, dass dies zu seiner Gesundung beitrage und wir gemeinsam nach seiner verschwundenen Frau suchen können.«
»Holmes, Mary«, murmelte der Doktor. Sein Gesicht glühte.
»Haben Sie es schon mit Chinarinde versucht? Ich habe einen Auszug davon mitgebracht. Nehmen Sie davon!« Der Detektiv reichte seinem Freund ein braunes Fläschchen. »Zehn Tropfen. Nicht mehr und nicht weniger.«
Watson mischte die Tinktur mit Wasser.
»Vorsicht, bitter«, warnte Holmes, aber Watson hatte das Glas schon geleert.
»Sie mit Ihren ...«
»Drogen wollten Sie sagen, nicht wahr, Doktor?«, meinte Holmes noch, aber da war Watson schon in einen tiefen Schlaf gesunken.
Holmes betrachtete noch einige Minuten das erschöpfte Gesicht des fünf Jahre älteren Freundes, der trotz seines noch immer athletischen Aussehens zunehmend zur Korpulenz neigte, dann erhob er sich, um die Haushälterin zu bitten, eine Geflügelsuppe zu kochen. Damit wollte er zur Gesundung des Mannes beitragen, dessen Erkrankung in Holmes' Augen jedoch im Wesentlichen auf die seelische Erschütterung durch den Verlust seiner Frau zurückzuführen war. Aber das machte nichts. Jede Form der Zuwendung würde die Genesung des armen Mannes fördern. Und irgendwie hatte auch Holmes in diesen vier Jahren seinen Gefährten vermisst.
Er unterhielt sich inzwischen mit Linda Remington, der Haushälterin, mit den vom Schrubben und Waschen roten, kräftigen Händen, bei einer Tasse Tee in der Küche des weißen, im Regency-Stil erbauten Hauses nahe der Paddington Station.
»Ein Jammer. Der Doktor ist nicht mehr er selbst, seitdem die gnädige Frau ...«
»Ich kenne Mary Watson von einem gemeinsamen Fall her.«
»Sie sind auch Arzt?«, fragte die Frau.
»Nein, etwas Ähnliches«, meinte der Detektiv und lenkte das Interesse der etwas überrascht blickenden Mrs. Remington auf ein anderes Thema. »Sie haben doch sicherlich Beobachtungen gemacht, das plötzliche Verschwinden Ihrer Dienstgeberin betreffend.«
»Furchtbar, eine Tragödie«, klagte die robuste Frau und suchte nach einem Taschentuch, das sie tatsächlich in ihrer dunklen, weiß getupften Schürze fand, aber schnell wegsteckte, weil es nicht mehr sauber war. »Sie war immer stiller geworden, bevor sie verschwand, und sie sah ihren Mann mit solcher Sehnsucht an. Bei den beiden handelte es sich um wahre Liebe, da kann man sagen, was man will. Echte und wahre Liebe, auch vonseiten des Doktors, was ja bei Männern eher selten ist.«
Holmes ließ sie reden, in der Hoffnung, in der Vielzahl der Worte das eine oder andere Brauchbare zu finden.
»Ich kam gerade vom Metzger und vom Bäcker zurück. Sie müssen wissen, ich kaufe jeden Donnerstag für das kommende Wochenende ein, denn der Doktor und die gnädige Frau haben immer wieder Gäste, und dieses Mal bekam ich etwas besonders Leckeres. Sie müssen wissen ...«
»Da sahen Sie etwas Überraschendes, nicht wahr, Mrs. Remington, als Sie vom Einkauf zurückkamen?«
»Ja, aber wieso wissen Sie das?«
»Instinkt, Mrs. Remington. Erfahrung und Beobachtung.«
»Sie verwirren mich.«
»Das liegt nicht in meiner Absicht.«
»Also ...«
»Also?«
»Also, da sah ich sie. Sie wirkte so traurig, als sie in diese schwarze Kutsche stieg. Die Szene erinnerte mich an ein Begräbnis. Alles schwarz. Die Pferde, die Droschke, die Männer an ihrer Seite.« »Zwei Männer begleiteten sie«, stellte Holmes fest. Die Frau verbesserte ihn. »Eigentlich drei Männer oder vier. Da war ja noch der Kutscher.« »Drei Männer, die sie zur Droschke brachten.« »Zwei stützten sie, einer ging hinter ihr her. Sie wirkte so traurig.« »Aber sie ging selbst, sie war nicht ohnmächtig.« »Jetzt, wo Sie es sagen. Sie wurde mehr getragen, als dass sie selbst ging. Aber sie hatte ihren Mantel an.« »Und Sie haben all das ihrem Mann erzählt?« »Meinem Mann? Nein, den geht das nichts an, der ...« »Nein, ich meinte den Mann von Mrs. Watson. Den Doktor.«
»Natürlich nicht. Ich wollte ihn nicht weiter beunruhigen und ich möchte die Stellung nicht verlieren.« »Warum befürchten Sie das?«, fragte Holmes freundlich.
»Ich habe nachgedacht in den letzten Wochen, und da habe ich mich schon gefragt, ob die gnädige Frau nicht entführt worden ist und ich das hätte verhindern können, indem ich geschrien hätte. Der Doktor war in seiner Praxis, ich hätte ihn alarmieren können. Aber Sie müssen wissen, als einfache Frau denkt man sich, dass die Herrschaften, für die man tätig ist, selbst alles besser wüssten, dass alles, was geschieht, auch so geschehen soll.«
»Jetzt aber haben Sie Zweifel«, stellte der Detektiv fest.
»Ich glaube ... ich war sehr dumm damals.«
»Seien Sie nicht zu streng mit sich selbst, Mrs. Remington. Sie sind eine gute Beobachterin, und Sie haben mir mit Ihren Hinweisen weitergeholfen. Eine Frage noch. Seit wann arbeiten Sie für die Watsons?«
»Seit Januar diesen Jahres. Ich bekam die Stelle auf Empfehlung meiner Vorgängerin, die sich um ihren kranken Mann kümmern muss.«
»Die kranken Männer«, murmelte Holmes. Etwas lauter fügte er hinzu: »Sie entschuldigen? Ich werde wieder nach dem Doktor sehen.«
Holmes leerte die Teetasse und verließ mit einer leichten Verbeugung die geräumige Küche. »Vergessen Sie nicht die Hühnersuppe. Sie wird den Doktor kräftigen«, sagte er noch.
»Erzählen Sie, was in Meiringen geschah, nachdem Sie mir die letzte Nachricht zukommen ließen«, bat Doktor Watson, dessen Augen schon viel klarer wirkten. »Was war der Grund für Ihr Verschwinden, das ich für endgültig hielt?«
»Der Grund hieß Moriarty. Mein Ziel war es, ihn und die Menschen, die ihn umgaben, endgültig auszuschalten.«
»Und das ist Ihnen gelungen?«
»Hören Sie zu! Ich erzähle Ihnen eine Geschichte.«
»Wie heißt sie?«, fragte Watson.
»Ist das nicht egal?«
»Ich gehe immer von einem Titel aus, wenn ich mit einem Roman beginne.«
»Tja, wie nennen wir sie?« Sherlock Holmes tat so, als ob er nachdächte, hob dann resigniert beide Schultern und stellte fest: »Es fällt mir nichts ein. Sie müssen vorerst mit der Erzählung vorlieb nehmen. Vielleicht ergibt sich später ein geeigneter Titel. Sie helfen mir doch dabei, mein lieber Watson?«
»Ich weiß, dass Vorsicht geboten ist, sobald Sie mich als Ihren lieben Watson bezeichnen.«
»So sarkastisch? Es scheint Ihnen ja wieder einigermaßen gut zu gehen.«
»Also los!«
»Sehr wohl. Ich beginne.«
Sherlock Holmes' Blick war in die Ferne gerichtet, zurück in eine Vergangenheit, an der sein Freund keinen Anteil gehabt hatte, denn der Detektiv hatte alles, was unmittelbar mit seinem Erzfeind, Professor Moriarty, zu tun gehabt hatte, von ihm ferngehalten. Ja, Watson hatte ihn nie persönlich getroffen.
»Wie sah er aus? Beschreiben Sie ihn mir!«
Unwillig kehrte Holmes aus den Tiefen der Vergangenheit in die Gegenwart des Krankenzimmers und des immer lebhafter werdenden Doktors zurück.
»Den Verlauf meines Berichtes müssen Sie mir überlassen«, meinte er knapp, dann fuhr er versöhnlicher fort: »Frühjahr 1891. Moriarty hatte mich aufgesucht und gewarnt. Ich müsse die Verfolgung seiner Person und seiner Organisation unverzüglich einstellen, sonst würde mir Vernichtung drohen. Ich ließ mich nicht einschüchtern, obwohl ich mir des Ernstes der Lage bewusst war. Ich hatte ein Ziel vor Augen, und dieses wollte ich erreichen. Aber zu welchem Preis, Watson. Zu welchem Preis!«
»Was ist geschehen?«
»Das wissen Sie selbst am besten.«
»Mary.«
Holmes nickte ernst. »Wie gefährlich Moriarty ist, spürte ich am eigenen Leib, kurz nach dem so unerfreulich verlaufenen Gespräch mit ihm.«
»Erzählen Sie, Holmes!«, bat Watson, der es sichtlich genoss, vom sicheren Bett aus unheimliche Begebenheiten der Vergangenheit zu erfahren. Wieder einmal erinnerte der Doktor Holmes an einen groß und dick gewordenen Jungen.
»Es gab mehrere Attacken. Die Erste auf dem Weg zur Oxford Street. Eine Droschke, die von zwei Pferden gezogen wurde ...«
»Wie bei Mary.«
»Das Fuhrwerk raste auf mich zu. Ein Sprung auf den Gehsteig in letzter Sekunde rettete mich. Genau dort ereilte mich der zweite Anschlag mit einem Dachziegel, der mich um wenige Zoll verfehlte, ganz abgesehen von einem Angriff mit einem Knüppel und dem Feuer in der Baker Street.«
»Feuer in der Baker Street?«
»Beruhigen Sie sich, Watson. Der Schaden war gering, alles ist noch so, wie es war.«
»Und das war der Professor?«
»Nicht er persönlich. Seine Mitläufer. Er war der Kopf, der Rest der Schlange existiert noch.«
»Das heißt, Sie konnten Moriarty zu Fall bringen.«
»Gedulden Sie sich, Watson. Alles der Reihe nach.«
»Beschreiben Sie den Mann, Holmes. Wie sah er aus, was waren seine Pläne?«
»Seine Art zu sprechen kann man als beinahe sanft bezeichnen. Er äußerte die heftigsten Drohungen im ruhigen Ton dessen, der die Macht besitzt, seine Anliegen durchzusetzen. Von der Statur her war Moriarty groß, mager, seine breite, stark gewölbte Stirn ließ auf einen überragenden Geist schließen, die Augen lagen tief in den Höhlen. Ein perfekt rasierter, bleicher, asketisch aussehender Mensch mit der leicht nach vorne gebeugten Haltung des Studierenden, des Professors. In der linken Hand hielt er meist seinen Rechenschieber, mit der Rechten notierte er Zahlen in steiler Handschrift.«
»Wobei eine gewisse Ähnlichkeit mit Ihnen nicht zu leugnen ist.«
»Sie haben ihn auch gesehen, mein lieber Watson? Ich denke, es ist an der Zeit, dass Sie die Rolle des Erzählers übernehmen«, sagte Holmes mit schneidender Stimme.
»Ihrer Erzählung nach ...«
Holmes unterbrach Watson ungeduldig. »Der Mann hatte etwas Schlangenartiges in seinem Wesen. Wie er mit seiner bläulichen Zunge prüfend über die Lippen fuhr, wie er ... Sie wollen doch nicht behaupten, ich hätte etwas von einem Reptil.«
»Aber nein. Bestimmt nicht«, versicherte Watson und versuchte den Detektiv durch eine Frage auf andere Gedanken zu bringen. »Und sein Wesen? Wie soll ich sagen, sein Charakter. Was für ein Mensch war er? Privat und beruflich.«
»Ich kannte ihn nicht privat. Aber ich konnte herausfinden, dass er ein Genie war. Ein mathematisches Genie. Schon in jungen Jahren verfasste er eine Abhandlung über das binomische Theorem.«
»Was immer das sein mag.«
»Mein lieber Watson. Ich schätze es nicht, wenn Sie Unwissenheit in Spott kleiden. Ich versichere Ihnen, dass es niemanden gibt, und ich betone das, niemanden außer Moriarty, der zu derart tief gehenden Überlegungen fähig ist.«
»Sie verteidigen ihn, als ob es um Sie selbst ginge.«
»Er ist etwas Besonderes. Ein Napoleon des Verbrechens, der Kopf einer großen Organisation, die hinter jedem bedeutenden Verbrechen in unserem Land steckt, das in den letzten Jahren begangen wurde.«
»Ein Mann, der Ihnen ebenbürtig ist.«
»So ist es.«
»Den Sie besiegt haben. In der Schweiz, an den Reichenbach-Fällen, wo wir uns das letzte Mal vor Ihrer Wiederkehr sahen.«
Der Detektiv schwieg.
»Eine Erzählung davon könnte etwa mit folgenden Worten beginnen«, überlegte der Doktor, die Wangen vor Aufregung gerötet. »Als Holmes den tödlichen Entschluss in den grauen Augen des Professors las ...«
»Sie kennen seine Augenfarbe?«
»Meine Vorstellungskraft. Aber machen Sie weiter, Holmes! Schildern Sie den Verlauf der Ereignisse doch selbst!«
»Ich werde mich bemühen, Ihrem schriftstellerischen Talent einigermaßen zu entsprechen. Der berühmte Autor John Watson würde es vermutlich so formulieren: Der große Detektiv bat den großen Kriminellen um einen kurzen Aufschub des dramatischen Geschehens, das in einem Duell zweier ebenbürtiger Männer münden, ja enden, sollte. Im Zweikampf zwischen Sherlock Holmes und Professor James Moriarty an den Reichenbach-Fällen zu Meiringen in der Schweiz. Es kam zu einem Handgemenge am Abgrund. Da aber besann sich der berühmte Detektiv seiner Fähigkeiten. Holmes wandte einen Griff an, den er von Baritsu, jener japanischen Kampfsportart her kannte, die ihm schon mehrmals in seiner Laufbahn das Leben gerettet hatte. So war es auch dieses Mal. Holmes konnte sich von der tödlichen Umklammerung des Professors frei machen, Moriarty griff ins Leere, schlug mit einem schrecklichen Schrei wild und hilflos um sich und stürzte den Wasserfall hinunter. Nach einem langen Fall, in dem sich der noch lebende Professor mehrmals um die eigene Achse drehte, schlug der Körper gegen einen Felsvorsprung, von wo er in das Wasser katapultiert wurde.«
»Recht eindrucksvoll, aber ich weiß nicht, warum Sie mich belügen, Holmes. Ist es, weil Sie in meiner momentanen Lage Mitleid mit mir haben, oder gibt es einen anderen Grund für die Moriarty-Lüge?«
»Was sagen Sie da, Watson! Wie kommen Sie dazu, mich der Lüge zu bezichtigen!«, protestierte der Detektiv. Sein Gesicht war bleich geworden, seine schmalen, langgliedrigen Hände zitterten leicht.
KAPITEL 2
»Ich wende die Methoden, die Sie mir beigebracht haben, nun zum ersten Mal gegen Sie an, Holmes. Und Sie müssen zugeben, dass Ihre Erzählung glaubwürdig wäre, würde sie aus meiner Feder stammen. Sein letzter Fall oder so.«
»Sparen Sie sich Ihren bösartigen Zynismus, Doktor. So kenne ich Sie nicht und so will ich Sie auch nicht kennen.«
»Entschuldigen Sie, Holmes. Mein Verlust, die Erkrankung, das macht bitter. Aber Sie müssen zugeben, dass Ihre Beschreibung des Professors als Ihnen ebenbürtig, als bedeutenden Mathematiker, als Napoleon des Verbrechens, in Widerspruch steht zu den konkreten Taten dieses Mannes, der Sie mit Pferdedroschken, Ziegelsteinen und einem Brand Ihrer Wohnung ausschalten will. Das sind doch, höflich gesagt, primitive Methoden, die so gar nicht zu einem Genie passen wollen.«
»Das haben Sie richtig erkannt, Watson«, sagte Holmes. »Es war ein Fehler, mich zu diesem Bericht hinreißen zu lassen, wie ich es mehr und mehr bedaure, überhaupt zu Ihnen ...«
»Geben Sie es zu, Holmes, Sie selbst sind dieser Moriarty. Er ist nur ein Spiegelbild Ihrer Person.«
»Nein«, stellte Holmes klar. »Ich bin nicht der Verbrecher, der dieses Land, diesen Kontinent, möglicherweise die Welt, negativ verändern wird, wenn ihn niemand stoppt. Und, Watson, hören Sie mir gut zu. Ich stecke auch nicht hinter dem Verschwinden Ihrer Frau, obwohl dieses beklagenswerte Geschehen natürlich mit meiner Jagd auf Moriarty zusammenhängt.«
»Wie, was?«, rief Watson und sprang aus dem Bett. Unruhig ging er im Zimmer auf und ab. »Marys Verschwinden hat mit Ihnen zu tun?«
»Es scheint Ihnen ja schon bedeutend besser zu gehen, mein lieber Watson«, sagte Holmes beruhigt, als er sah, dass es ihm gelungen war, das schwierige Gespräch mit seinem Freund unter Kontrolle zu bringen.
»Sagen Sie, was Sie wissen, Holmes!«
»Alles der Reihe nach. Zuerst ein Geständnis. Ja, Sie haben recht. Ich habe die kriminelle Energie dieses Mannes verharmlost dargestellt, wie es bisher mein größter Fehler war, ihn zu unterschätzen. Er ist, dabei bleibe ich, der größte Verbrecher der Welt. Er ist ein Genie des Bösen. Und er lebt noch!«
»Er lebt noch?«, wiederholte Watson. »Mein Gott, Mary!«
»Ja, er lebt. Ich habe ihn bisher nicht besiegen können.«
»Ich werde Sie von nun an dabei unterstützen«, versicherte der Doktor.
»Und ich werde alles daransetzen, Ihre Frau unversehrt wiederzufinden.«
»Sie haben diesbezüglich Hoffnung?«
Holmes nickte. »Nur darf mir der Fehler, Moriarty zu unterschätzen, kein zweites Mal unterlaufen. Sie haben völlig richtig erkannt, dass des Professors Methoden sich nicht in Attentaten, körperlichen Angriffen, Brandlegung und in der Verwendung eines merkwürdigen, in seinem Spazierstock verborgenen Luftgewehrs deutscher Herkunft erschöpfen.«
»Von Letzterem haben Sie noch nicht erzählt.«
»Weil es, wie gesagt, unwesentlich ist. Von Bedeutung ist die Analyse, warum ich Moriarty tatsächlich für den größten Verbrecher aller Zeiten halte. Und noch einmal: Ich versichere Ihnen, dass ich nicht identisch mit ihm bin. Mir ist durchaus nicht entgangen, dass Sie ihm dieselbe Augenfarbe zuschreiben wie mir.«
»Irre ich mit dieser Annahme?«
»Sie irren nicht. Aber jetzt zum Wesentlichen.«
»Einen Punkt noch, bitte«, meinte Watson beinahe flehentlich. »Sein Titel. Warum nennen Sie ihn Professor?«
Holmes reagierte etwas ungehalten, sodass er nur mehr in Stichworten sprach. »Unterricht an einer kleineren Universität, kurze Zeit.«
Dann schwieg der Detektiv eine Weile, denn er erwartete weitere lästige Fragen seines Freundes. Als diese ausblieben, entspannte er sich und begann: »Am deutlichsten, glaube ich, kann ich Ihnen die Art und Weise, wie dieser Mann arbeitet, am Beispiel Ihrer Frau zeigen. Moriarty verwendet Informationen, die ihm zugetragen werden. Dieses Wissen über menschliche Eigenheiten, Schwächen sowie Stärken, ermöglicht es ihm, die Reaktion von Menschen in bestimmten Situationen kalkulierbar zu machen. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das am besten erkläre.«
»Ich verstehe Sie, Holmes. Mir fällt ein Schachspiel ein.«
»Sie sind ein Genie, Watson«, meinte Holmes, ehrlich erfreut. »Genau das ist der Punkt. Die Menschen werden unter Moriartys Einfluss zu Figuren in einem Spiel, in dem sie gefangen sind, das sie nicht durchschauen, das von außen gelenkt wird.«
»Aber was hat das mit meiner Frau zu tun?«, fragte der Arzt.
»Mit Ihrer Frau und Ihnen selbst.«
»Wie meinen Sie das?«
»Der Professor erkannte eines Tages in mir den einzigen ebenbürtigen Gegner, der eventuell seine Kreise stören könnte. Also unternahm er die entsprechenden Schritte, um diese Gefahr zu mindern oder gar auszuschalten. Und Sie haben völlig recht. Er beschränkte sich dabei nicht auf primitive Mittel wie heranrasende Kutschen, Dachziegel und dergleichen, obwohl er sich auch dieser bediente. Diese Anschläge sind keine Erfindung meinerseits. Aber der Professor ging zugleich in die Tiefe. Menschliche Verhaltensweisen wie Freundschaft, Liebe oder Solidarität, die er selbst nicht kennt, reizen ihn. Er sieht in Ihnen eine Schwäche, die es gilt, für seine Zwecke zu nutzen.«
»Marys Liebe zu mir, unsere Freundschaft.«
»Unsere Freundschaft«, bestätigte Holmes, »und Ihre Liebe zu Mary.«
»Aber wie ...«
»Mary Watson, geborene Morstan, ist in Wirklichkeit die Tochter von Moriartys Stabschef Colonel Moran. Beachten Sie die Ähnlichkeit der Familiennamen. Man hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, viel zu verändern.«
Mit einer Behändigkeit, die selbst Holmes überraschte, hatte sich Watson beinahe drohend vor dem sitzenden Detektiv aufgepflanzt, sodass er ihn um zwei Haupteslängen überragte. Nur das kurze Nachthemd, das der Doktor trug, nahm der Situation etwas an Ernsthaftigkeit.
»Ich dulde es nicht, dass meine geliebte Mary in die Nähe gemeiner Verbrecher gerückt wird. Ich liebe sie und sie liebt mich. Außerdem habe ich sie über Sie kennengelernt, in dem Fall, den ich unter dem Titel Das Zeichen der Vier festgehalten habe.«
»Sie hätten meinen Rat befolgen sollen«, unterbrach ihn Holmes.
»Welchen Rat?«
»Ich hätte das Buch Im Zeichen der Vier genannt.«
»Lenken Sie nicht ab!«
»Nein«, fuhr Holmes ernst fort. »Das scheinbar elternlose Mädchen, das unsere Hilfe suchte, war von ihrem Vater Sebastian Moran ausgesandt worden, um über jeden unserer Schritte berichten zu können.«
»Mary ist keine Spionin.«
»Sie war es anfangs. Irgendwann jedoch bereute sie, was sie Ihnen und mir damit antat. Eines Tages musste ihr Herz über ihren Verstand gesiegt haben. Sie hatte Sie, mein lieber Watson, achten, schätzen gelernt und schließlich wirklich geliebt. Damit hatte Moriarty nicht gerechnet. Ja, gab es denn so etwas! Eine Schachfigur, die sich emanzipierte! In seinen Augen war das eine Anomalie, der man mit Gewalt begegnen musste, also wurde Mary Moran aus dem Spiel genommen. Ich vermute, sie lebt noch, weil sie für den Professor weiterhin nützlich sein könnte.«
»Sie meinen ...«, sagte der Doktor traurig.
»Als Lockmittel für Sie und mich, möglicherweise auch als Figur in einer Erpressung. Und wir werden in Moriartys Spiel bis zu einem gewissen Grad mitmachen. Es führt uns in seine Nähe und könnte Ihre geschätzte Frau retten.«
»Mary, meine gute Mary.«
»Verstehen Sie nun die Gefährlichkeit, die Infamie der Methoden Moriartys?«
Watson nickte schweigend, fragte aber: »Und wo liegt die Bedrohung durch diesen Mann für unser Land, oder gar die Welt, wie Sie meinen?«
»Er vergrößert seinen Einfluss auf dieses Land Schritt für Schritt auf beängstigend berechnende Weise. Es geht ihm um Handlungsspielraum, den er für große, vernichtende Pläne schaffen will. Ich verfolge seine Schachzüge – ja, Watson, Sie haben recht, es handelt sich um ein Spiel mathematischer Art –, indem ich Artikel in der Times lese, die mit Moriarty in Zusammenhang stehen. Die Schlange selbst sieht man lange nicht, aber man sieht ihre Bewegungen im Gras, die Spuren im Sand.«
»Sie machen es spannend. Welche Bewegungen, welche Spuren konnten Sie sehen, Holmes?«
»Er will Einfluss nehmen auf die höchsten Ämter des Staates und schreckt auch nicht davor zurück, Menschen, die diese Positionen bekleiden, ins Elend zu stürzen, um sie erpressbar, um sie lenkbar zu machen und schließlich durch Figuren, die ihm nahestehen, zu ersetzen.«
»Sie haben für diese Behauptung sicherlich Beweise.«
»Die habe ich unglücklicherweise.«
»Erzählen Sie, Holmes!«
»19. Oktober 1894. Francis Douglas, Viscount Drumlanrig, stirbt mit siebenundzwanzig Jahren durch einen Schuss in Wiltshire. Die Polizei kann nicht klären, ob es sich um einen Jagdunfall, um Selbstmord oder Mord handelt.«
»Warum?«, fragte Watson überrascht.
»Ja, Watson. Die Frage nach dem Grund, nach der Ursache, das ist die Königin aller Fragen, die zu den Wurzeln der Dinge dringt.«
»Und Ihre Antwort, Holmes?«
»Der junge Douglas war Privatsekretär unseres Premierministers.«
»Lord Rosebery.«
»Und die Times lässt sehr vorsichtig anklingen, dass eine besondere Nähe zwischen den beiden Männern bestand, die nichts mit ihrer beruflichen Verbundenheit zu tun hatte.«
»Die Times ist doch ein seriöses Blatt«, wandte Watson ein.
»Genau das dachte ich auch«, meinte Holmes. »Und doch stammt der einzige Hinweis in dieser Richtung aus der Times.«
»Und Moriarty?«
»Moriarty muss dieses Gerücht ebenfalls gekannt und die Beteiligten in die Enge getrieben haben, mit dem tragischen Ergebnis, dass einer der beiden nicht mehr lebt.«
»Mord oder Selbstmord«, stellte Watson fest.
»Mord oder Selbstmord. Und da die Polizei das offen lässt, vermutlich Mord, dem man nicht weiter nachgehen will, um den höchsten Mann im Staat nicht zu kompromittieren.«
»Der Premierminister ließ seinen ... äh ... Freund ... töten ...«
»Weil man ihn mit ihm erpresste. Das ist der logische Schluss aus den vorliegenden Fakten. Beweise habe ich keine. Auch nicht für die Verwicklung Moriartys. Ich bin mir aber sicher, seine Handschrift deutlich zu erkennen. Rosebery ist nun Wachs in seinen Händen und kann jederzeit durch einen von Moriarty genehmen Nachfolger ersetzt werden.«
»Ist Lord Rosebery verheiratet?«, fragte Watson.
»Er ist seit fünf Jahren Witwer. Der Tod seiner reichen Frau, einer Baronesse Rothschild, kurz nachdem seine Zusammenarbeit mit dem jungen Mann begonnen hatte, wäre ebenfalls zu untersuchen. Auf jeden Fall manipuliert Moriarty das Leben einzelner Menschen, schreckt aber auch nicht davor zurück, ganze Nationen ins Unheil zu stürzen, wenn es seinen Interessen dient. Seine Schwäche dabei ist, dass er als begnadeter Mathematiker das Irrationale im Verhalten der Menschen übersieht: Vertrauen, Sehnsucht, Liebe, Kunst, Musik.«
»Das klingt seltsam aus Ihrem Mund, Holmes.«
»So, finden Sie?«
»Nein, nicht wirklich. Ich weiß, was Sie meinen. Ich werde alles daransetzen, Mary zu finden. Mir geht es körperlich schon viel besser.«
»Ich sehe das, und es freut mich, Watson, aber exakt dieser ehrenwerte Vorsatz macht Sie berechenbar für Moriarty. Er weiß, dass die Schachfigur Watson auf diese Weise funktioniert. Also müssen wir einen anderen Weg gehen.«
»Ich weiß nicht ...«
»Was wäre wohl das Dümmste, was wir in der gegenwärtigen Situation machen könnten?«, fragte der Detektiv.
Watson dachte eine Weile nach, bis sich ein verschmitztes Lächeln auf sein Gesicht legte.
»Was ist Ihnen eingefallen, Doktor?«
»Das absolut Dümmste, das wir tun könnten, wäre, Scotland Yard um Hilfe zu bitten.«
»Gut, Watson. Und wen dort insbesondere?«
»Inspektor Lestrade.«
»Inspektor Lestrade«, bestätigte Holmes. »Damit rechnen weder Moriarty noch Moran, und das verschafft uns Bewegungsfreiheit für unsere wahren Ziele.«
»Die Befreiung Marys.«
»Die Befreiung Ihrer Frau und den Kampf gegen Moriarty und seine Organisation.«
»Noch eine Frage, Holmes. Warum haben Sie sich vier Jahre lang nicht bei mir gemeldet?«
»So lange dauert mein Kampf gegen Moriarty schon. Ich wollte Sie nicht durch meine Nähe gefährden. Als ich nun sah, dass Sie dennoch durch das Verschwinden Ihrer Frau in Mitleidenschaft gezogen wurden und dass es Ihnen gesundheitlich schlecht ging, entschied ich mich, direkt einzugreifen.«
»Und das mit dem Erfolg, dass ich mich schon viel besser fühle.«
»Das zu hören freut mich.«
»Auf zu neuen Taten!«, rief der Doktor beinahe fröhlich, dann besann er sich. »Wenn ich darüber schreiben soll, brauche ich Details. Menschliche Einzelheiten.«
»Einen Titel«, wandte Holmes ein.
Der Doktor hüllte sich in seinen Schlafrock, begab sich in sein Arbeitszimmer, nahm an seinem Schreibtisch Platz und begann zu schreiben.
»Die Moriarty-Lüge?«, zeigte sich der Detektiv skeptisch, als er die ersten Worte las. »Wäre ich der Schriftsteller, würde ich einen Titel wählen, der mehr Atmosphäre vermittelt.«
»Zum Beispiel?«, wollte Watson wissen.
»Nun, da gibt es viele Möglichkeiten. Im Banne ... nein ... Im Schatten Moriartys wäre viel geeigneter. Finden Sie nicht auch, Doktor?«
Watson schüttelte heftig den Kopf und unterstrich die Worte Die Moriarty-Lüge zweimal. »Wie haben Sie Moriarty kennengelernt?«, fragte er.
»Sie meinen den ersten Eindruck?«
»Ihr erstes Treffen mit ihm, Ihre erste Wahrnehmung.«
»Es gab da einen Gentlemen's Club in der King Street.«
»Sie meinen doch nicht etwa den unseligen Fielding Club?«
»So muss er wohl geheißen haben. Ein Club für jüngere Männer, der auch Unterhaltung bot.«
»Er wurde deswegen behördlich geschlossen.«
»Der Club gehörte Moriarty«, stellte Holmes fest. »Er benutzte ihn in erster Linie dazu, an Informationen über die Mitglieder heranzukommen und diese gegen sie zu benutzen.«
»Man sprach von Drogenkonsum und Unmoral.«
»All das gab es auf sehr diskrete Weise, bis die ersten Erpresserschreiben eintrafen. Mein Bruder ...«
»Mycroft ...«
»... der ebenso Mitglied war, verließ den Club damals und gründete den Diogenes Club, der tatsächlich seriös, ruhig, aber auch langweilig ist und er ließ den Fielding Club schließen. Doch da war es für einige Mitglieder schon zu spät. Sie waren Lastern verfallen, die sie gesundheitlich, finanziell und auch gesellschaftlich vernichteten.«
»Moriarty ließ sich in diesem Club sehen? Ging er von Tisch zu Tisch? Begrüßte er die Gäste?«
»Nein. Er saß bei seltenen Gelegenheiten im Zuschauerraum. Sie müssen wissen, Watson, der Club hatte auch ein kleines Theater, in dem Szenen aufgeführt wurden, die von Mitgliedern geschrieben wurden. Es waren viele Künstler unter den Gästen. Moriarty war immer dann anwesend, wenn eine bestimmte Varietékünstlerin mit ihrer Schlangennummer auftrat. Sie war nicht mehr die Jüngste, wirkte aber sehr geschmeidig, attraktiv und etwas unheimlich, denn ihre Zunge war gespalten wie die einer Schlange.«
»Ich habe eine solche Frau gesehen. In einem meiner Fieberträume«, stieß der Doktor atemlos hervor.
»Sie Ärmster«, meinte der Detektiv. »Es ist wirklich an der Zeit, dass ich mich um Sie kümmere.«
Als Watson weiterhin eifrig mitschrieb, setzte Holmes noch eins drauf. »Und Sie müssen wissen, Doktor, der Fielding Club war ein reiner Männerclub.«
»Wie fast alle Clubs«, bemerkte Watson.
»Nur die Schlangenbeschwörerin mischte sich bisweilen ins Publikum.«
»Die mit der gespaltenen Zunge.«
»Ich sehe, Sie können mir folgen, Watson. Sie war meist wie ein Mann gekleidet, trug Hosen und Gehrock. Moriarty war an ihrer Seite. Eines Abends sagte ein etwas feminin wirkender junger Mann zu ihr, ich denke, er war Dichter: Sie sehen fast aus wie ein Mann, Madame. Die Schlangenbeschwörerin entgegnete: Sie auch, mein Lieber.«
»Scharfe Zunge.«
»Schlangenzunge.«
»Aber damit kann ich gar nichts anfangen. Solche Scherze passen nicht in meine Romane.«
Holmes bedauerte dies, dann meinte er noch: »Außerdem haben wir nun genug geredet und geschrieben. Es ist an der Zeit, tätig zu werden. Sie wollten Lestrade aufsuchen.«
Während Watson sich zurechtmachte und dann noch unsicheren Schrittes das Haus Richtung Scotland Yard verließ, begann Holmes den Mikrokosmos der Park Lane zu studieren, in der Watsons Haus stand. Eine ruhige, saubere Straße, nicht weit vom Paddington Bahnhof entfernt. Eine Tatsache, die durch das große Einzugsgebiet die Zahl der möglichen Patienten des Arztes erheblich erweiterte.
Die Rückseite des Hauses blickte auf einen kleinen Garten und auf die weite Fläche des Regent's Parks. In der Straße selbst reihte sich ein helles Haus an das andere Gebäude, die Wohlhabenheit und Ruhe ausstrahlten.
Im Erdgeschoss eines der Häuser schräg gegenüber von Watsons Praxis war ein A.B.C.-Teashop untergebracht. Eine jener Institutionen, die vorgaben, britische Kultur zu verkörpern und dabei doch nur aus Lösungen hervorgegangen waren, die aufgrund eines Problems notwendig geworden waren. Mit der Qualität des Wassers in diesem so flachen Land war es nicht zum Besten bestellt. Die Folge waren Durchfälle bis hin zu Typhusepidemien. Was also lag näher, als das Wasser abzukochen, zum besseren Geschmack ein anregendes Kraut aus den Kolonien hinzuzufügen und mit Zucker und Milch oder weiß der Teufel was zu verbessern?
Die gelangweilten Frauen der Bewohner dieses Distrikts verbrachten Teile ihres Tages in diesem Lokal, in dem auch Süßspeisen und Sandwiches angeboten wurden. Sie tauschten den neuesten Klatsch aus oder lasen in den ausliegenden Zeitungen und Magazinen.
Und genau auf diesen Teashop steuerte Sherlock Holmes nun zu. Todesmutig, denn äußerst selten nur verirrten sich Männer dorthin. Er wollte mehr über Watsons Frau erfahren. Die Haushälterin war erst seit Beginn des Jahres für die beiden tätig. Möglicherweise wussten einige der Gäste des Lokals mehr als sie.
Ein helles Glöckchen, ausgelöst durch die sich nach innen öffnende Tür, war die Ursache, dass alle Damen, die an kleinen Tischchen saßen, aufblickten, als der Detektiv den Laden betrat. Eine der in weiße Schürzen gekleideten Kellnerinnen eilte ihm entgegen und führte ihn zu einem Tisch am Fenster zur Park Lane. »Sie wollen doch ein helles Plätzchen?«
»Natürlich«, erklärte Holmes und reichte ihr seinen Überzieher, den die junge Frau in der Garderobe ablegte.
»Ich bin Patient von Doktor Watson und wundere mich, dass seine Praxis geschlossen ist. Ich wusste nichts davon«, sagte Holmes mit so lauter Stimme, dass alle Anwesenden davon Kenntnis nehmen mussten.
»Er ist krank, soviel wir wissen«, erklärte eine andere Kellnerin, und einige der Gäste nickten zustimmend.
»Eine traurige Sache«, stellte eine der unmittelbaren Tischnachbarinnen des Detektivs fest.
»Inwiefern? Eine schwere Krankheit?«, erkundigte sich Holmes.
»Seine Frau hat ihn verlassen.«
»Nein, sie ist erkrankt.«
»Unsinn. Sie ist tot.«
»Entführt.«
Über das Schicksal von Doktor Watsons Frau, die Ursache der vorübergehenden Schließung seiner Praxis, herrschte Dissens bei den Tee trinkenden Damen.
Als sich eine beeindruckende Vertreterin des weiblichen Geschlechts dem kleinen, runden, weiß gedeckten Tisch des Detektivs näherte, verstummte alles. Miss Cornillac, die Inhaberin selbst, griff nur äußerst selten, und nur, wenn es unumgänglich war, in das Geschehen des von ihren Gehilfinnen so blitzblank gehaltenen Lokals mit den vierzehn Tischchen ein. In einer gläsernen Vitrine wurden die täglich frischen Köstlichkeiten verführerisch zur Schau gestellt. Der Tee wurde übrigens in einer angrenzenden Küche zubereitet, der der angenehm herbe Duft entströmte, der sich im Kundenraum mit den Parfüms der Kundinnen mischte.
»Was darf ich Ihnen bringen, Sir?«
»Eine Tasse Tee und ein Sandwich.«
»Zu den angebotenen Speisen beachten Sie bitte die Karte.« Mit diesen Worten öffnete sie ein kleines, handgeschriebenes Buch. »Beim Tee würde ich ein Kännchen empfehlen. Vielleicht besonders munter machenden schwarzen Tee. Sie können bei uns zwischen Keemun aus China, den mit Bergamotte versetzten Earl Grey oder Lapsang Souchong wählen, den wir ebenfalls aus China beziehen. Sein Aroma gestaltet sich durch den Rauch von Pinienzweigen besonders intensiv.«
Holmes entschied sich für die Spezialmischung des Hauses A.B.C., den Frühstückstee. Dazu wählte er eine gemischte Auswahl der angebotenen Sandwiches.
»Kleine Häppchen, von vielen Sorten etwas«, erklärte Miss Cornillac, die anschließend das Getränk und die Speise selbst servierte.
Als Holmes davon probiert hatte, fragte sie ihn, ob er zufrieden sei. Holmes bestätigte das und vermutete, dass die Frau auf seine Einladung wartete, am Tisch Platz zu nehmen. Sie wollte ihm etwas erzählen.
»Sie haben sicherlich sehr viel zu tun, dennoch frage ich mich, ob Sie eine Minute Zeit haben und mir die Ehre Ihrer Gesellschaft zuteilwerden lassen«, bat der Detektiv die Besitzerin des Teashop.
Kaum saß die Frau an seiner Seite, sprach sie mit gedämpfter Stimme: »Wir können auf weitere Höflichkeitsfloskeln verzichten. Ich möchte Ihnen etwas mitteilen, denn Sie wollen vermutlich etwas erfahren.«
»So ist es. Alle Achtung, Madame, Sie haben die Situation klar analysiert.«
»Man wird Menschenkenner in diesem Laden. Erstens bei der Auswahl des Personals, zweitens im Umgang mit den Kundinnen und wenn sich, was äußerst selten vorkommt, ein Mann zu uns verirrt, der nicht, wie soll ich es sagen, durch unglückliche Erziehung oder andere Umstände selbst beinahe eine Frau ist, bedeutet das etwas. Wenn er etwas behauptet, was offensichtlich nicht mit den Tatsachen übereinstimmt, ist es Zeit für ein Gespräch mit ihm«, sagte die Frau mit leiser, aber fester Stimme.
»Die Lüge dieses Mannes, worin besteht sie?«, erkundigte sich Holmes in eben derselben gedämpften Stimmlage.
»Von Lüge würde ich nicht sprechen. Nun, Ihre Behauptung, Sie wären Patient des Doktors, der von weither gekommen sei und die Praxis des Doktors aus unerklärlichen Gründen geschlossen vorgefunden hätte, stimmt nicht. Tatsächlich traten Sie aus dem Haus der Watsons, kurz nachdem der Besitzer, nach Tagen zum ersten Mal einigermaßen gesund wirkend, das Gebäude verlassen hatte. Sie sind also ein Freund des Doktors, dessen Besuch dem beklagenswerten Zustand des Mannes zumindest nicht abträglich war.«
»Alle Achtung, Madame, an Ihnen ist ein Detektiv verloren gegangen.«
»An Ihnen, wenn Sie mir diese Bemerkung erlauben, offenbar nicht.«
Lächelnd blickte Holmes der hübschen, aber herb wirkenden, großen Frau ins Gesicht, in die dunklen Augen, die sich von dem hellen Haar und der blassen Haut kontrastreich abhoben. Ihr Blick verriet Verstand und Energie.
»Ich bin Arzt, so wie Dr. Watson«, log Sherlock Holmes. »Also ein genauer Beobachter des körperlichen Zustands meiner Patienten. So wie Sie.«
»Ja, ich beobachte, aber ich weiß auch, dass das Hinsehen und das Beschreiben allein nichts ändert.«
»Da haben Sie recht, Madame. So ist es auch in der Medizin. Ein guter Arzt begnügt sich nicht mit der Diagnose, er fragt nach dem Warum. Was ist die Ursache für die Gesundheitsstörung? Handelt es sich um eine falsche Lebensweise? Trinkt der Erkrankte zu viel Alkohol, isst er zu fett?«
»Oder ist seine Seele erkrankt?«
»So ist es. Und erst dann kann er, mit Glück und der Mithilfe des Patienten, an eine Heilung herangehen.«
»Sein Zustand«, stellte die Frau fest, die etwa im Alter des Detektivs, also Anfang vierzig, war, »ist durch die Entführung seiner Frau beeinträchtigt.«
»Sie sprechen von einer Entführung. Haben Sie eine derartige Beobachtung gemacht?«
»Indirekt. Die schwarze Kutsche, von der meine Angestellten erzählten und in der Mrs. Watson weggebracht wurde, kam über zwei, drei Jahre monatlich vorbei, immer am Donnerstag. Und mit ihr ein Mann, den ich für einen Verwandten der Frau hielt. Seine Körperhaltung glich der ihren, auch seine Art zu gehen. Sie begaben sich meist Seite an Seite in den Park und kamen etwa nach einer Stunde zurück. Der Mann drückte der Frau einen Kuss auf eine der Wangen, dann verschwand er in der Kutsche.«
»Und Sie bemerkten in den letzten Monaten eine Abweichung von diesem Ritual.«
»Seit November, also seit etwa einem halben Jahr, kam die Kutsche nicht mehr, bis ...«
»... bis in ihr Mrs. Watson angeblich entführt wurde«, ergänzte Holmes. »Und Sie fragten sich natürlich nach dem Warum dieser Veränderung.«
»Ich frage immer nach den Ursachen.«
»Sie sind aber keine Mathematikerin.«
»Ich kann rechnen, das muss man in unserem Metier können.«
»Aber Sie sind keine Mathematikerin«, beharrte der Detektiv.
»Ich weiß nicht, worauf Sie hinauswollen, Sir.«
»Nirgendwohin. Ich stelle nur fest, dass die Mathematik sich damit begnügt, das festzuhalten, was ist, es auszubauen, sich in Details zu ergehen, um endlich zum Ganzen zu kommen. Mathematiker jedoch sind nicht so vermessen, nach den Gründen zu fragen.«
»Sie meinen, jeder sollte sich so verhalten?«
»Nein, ich meine, das wäre eine bedauerliche Beschränkung. Das Leben, die Kunst, funktioniert anders.«
»Dann wollten Sie von dem, was ich über die Frau Ihres Freundes sagte, ablenken.«
»Vielleicht.«
»Warum?«
»Weil das, was Sie mir erzählen, sehr tiefgründig ist und meine Gedankengänge anregt. Warum haben Sie diesen Beruf gewählt, Madame, wenn diese Frage nicht zu indiskret ist.«
»Weil ich unter Menschen sein will, ohne an der Enge von zu intimen Beziehungen zu ersticken und weil ich eine Frau bin und als solche nur eingeschränkte Möglichkeiten habe, einen Beruf zu wählen.«
»Auch ich werde die Gründe der Wahl meines Berufes hinterfragen«, versprach Holmes, einer weiteren Frage seiner Gesprächspartnerin in dieser Richtung zuvorkommend.
»Verraten Sie mir die Lösung des Rätsels, wenn Sie so weit sind?«, bat Miss Cornillac noch und erhob sich.
»Sie meinen ...«
»Den Grund für Doktor Watsons Erkrankung.«
»Versprochen.«
Holmes nutzte den strahlenden Maitag, um die Natur des Regent's Parks zu genießen. Er wanderte, in Gedanken versunken, den Outer Circle entlang.
Die Frage, warum er Detektiv geworden war, hatte er sich noch nie gestellt. In diesem Punkt war er Mathematiker gewesen, hatte sich mit Gegebenheiten abgefunden und diese möglichst perfektioniert.
Aber warum?
Es hatte zu tun mit seinem Wunsch, das Böse aufzuspüren, es sichtbar zu machen und es letztlich zu bekämpfen, zu besiegen. Weil ...
Weil er das als Kind so gemacht hatte, als ein Onkel die Familie zerstören wollte und tatsächlich schwer in Mitleidenschaft zog. Die Erinnerung an damals war Holmes so unangenehm, dass er rasch in die Gegenwart zurückkehrte. Der Gedanke an seinen Gegenspieler ermöglichte ihm das ohne Probleme.
Moriarty steckte hinter den perfidesten Verbrechen und Plänen, die das Land je gekannt hatte. Moriarty war Mathematiker. Er plante und verwirklichte. Aber er fragte nicht nach Gründen. Wollte man ihn besiegen, musste man nach dem WARUM forschen. Man musste die Muster erkennen.
Die Gedanken dieser klugen Frau hatten Holmes einen wichtigen Schritt weitergebracht.
Als er zum Hause Watsons zurückging, überlegte Holmes noch: Der Beruf. Eine Flucht vor der Leere, vor dem Vakuum? Oder gar dem Ur-Schmerz?
KAPITEL 3
Als Watson gegen fünf Uhr von seinem Gespräch mit Inspektor Lestrade von Scotland Yard zurückkam, befand sich Holmes in einem merkwürdigen Zustand der Agitation. Er saß in Watsons Arbeitszimmer, in dessen Mitte ein ausladender rechteckiger Tisch mit zwei Stühlen stand, auf dem der Detektiv mehrere Bände der Encyclopaedia Britannica aufgehäuft hatte, die er dem Bücherschrank entnommen hatte. Dieser nahm eine ganze Wand ein und enthielt neben dem Lexikon hauptsächlich medizinische Fachliteratur und historische Abhandlungen.
Holmes' Augen glichen zwei Tollkirschen, so dunkel waren sie.
»Sie haben wieder einmal Ihrer Sucht nachgegeben«, warf ihm der Doktor vor.
»Was haben Sie bei Scotland Yard ausgerichtet?«, fragte der Detektiv, ohne auf Watsons Äußerung einzugehen.
»Sie sollten das nicht tun. Es schadet Ihnen.«
»Welche Vorschläge hat Lestrade gemacht?«
»Ich frage mich«, erinnerte sich der Doktor des Gesprächs mit Holmes am Morgen, »ob für Ihre Abhängigkeit auch Moriarty verantwortlich ist.«
Als Holmes schwieg, fuhr der Doktor in seinen Überlegungen fort: »Ich könnte es mir vorstellen. Ein junger, noch unerfahrener Detektiv, der meint, seine beachtlichen geistigen Fähigkeiten noch weiter steigern zu können, indem er zum weißen Pulver greift. Im Hintergrund der teuflische Verbrecher, der ihn dabei beobachtet, der weiß, dass die Sucht dem Mann letzten Endes schaden wird.«
»Interessante Überlegungen, Watson. Sie müssen unbedingt darüber schreiben. Aber ich wiederhole meine Frage nach dem Ergebnis Ihres Besuches im Yard.«
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783957192011
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (Januar)
- Schlagworte
- Detektiv Spannung Sherlock Holmes Krimi Ermittler