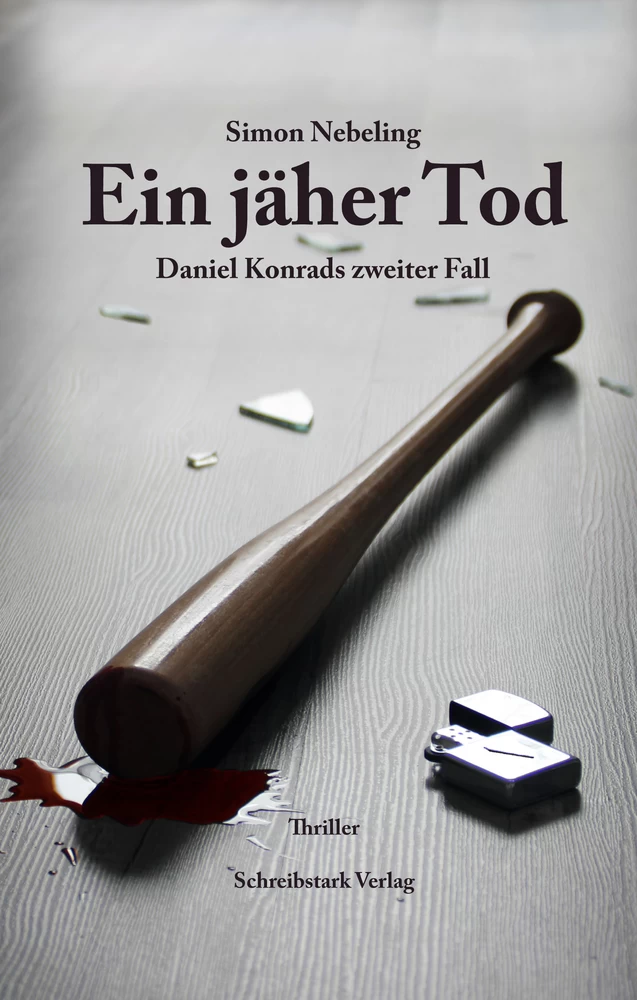Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kalter Angstschweiß stand ihm auf der Stirn. Daniel Konrad bemühte sich, Ruhe auszustrahlen, obwohl sein Körper zitterte.
»Beruhig dich erst mal«, sagte er und blieb in ausreichender Entfernung von dem Jungen stehen. »Tu jetzt bloß nichts Unüberlegtes!«
»Gehen Sie weg, Herr Konrad«, erwiderte der Schüler. »Das hat nix mit Ihnen zu tun.«
Einen Augenblick lang war der Beratungslehrer versucht, der Aufforderung zu folgen. Doch er konnte diesen Jugendlichen nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Er fühlte sich für ihn verantwortlich. Irgendwie musste er es schaffen, zu ihm durchzudringen.
»Hattest du so ein Ding überhaupt schon mal in der Hand?«, fragte er und schaute besorgt auf die Schrotflinte, die sein Gegenüber umklammerte.
Dessen Blick war starr und finster, während er kaum merklich nickte. Dabei kaute er auf dem Piercing an seiner Unterlippe herum.
»Ich weiß, wie man damit umgeht«, antwortete er. »Mein Vater hat's mir gezeigt.«
»Und hat er dir auch verraten, wie man mit der Schuld klarkommt, einen Menschen zu ermorden? Du wirfst dein ganzes Leben weg, wenn du abdrückst!«
Für einen Moment schien es, als wäre es ihm gelungen, Zweifel zu säen. Der Teenager senkte die Waffe ein Stück, schrie aber plötzlich: »Aufhören! Halten Sie den Mund!«
Mit neuer Entschlossenheit richtete er das Gewehr auf sein Ziel.
Daniel hatte die Arme hochgerissen, aus Angst, es fiele ein Schuss. Nun bewegte er sie behutsam wieder nach unten und schluckte. Derweil versuchte er fieberhaft, die richtigen Worte zu finden.
»Das kann ich nicht. Ich kümmere mich schon so lange um dich
und …«
Er wusste genau, was er sagen wollte, doch es kam ihm nicht so leicht über die Lippen.
»... ich mag dich wirklich gern. Deshalb kann ich jetzt nicht danebenstehen und schweigen, während du eine riesige Dummheit begehst.«
»Dann verschwinden Sie einfach«, schlug der Junge vor. Er klang beinahe flehend.
Obwohl sich jede Faser seines Körpers dagegen sträubte, trat Daniel einen Schritt auf ihn zu. »Nein, das tue ich nicht«, sagte er entschieden. »Gib mir die Waffe. Bitte.«
»Nein!«
In der Ferne heulte das Martinshorn eines näherkommenden Polizeiautos. Mit einem Mal wirkte der Jugendliche noch angespannter, ließ sich kurz hinreißen und sah zum Fenster hinüber.
Auf diese Gelegenheit hatte sein Gegenüber nur gewartet, sprang auf einmal nach vorn und ergriff den Lauf des Gewehrs. Der Junge schaute ihn erschrocken an und versuchte verzweifelt, die Gewalt über die Waffe zurückzugewinnen. Ein Schuss löste sich. Er schleuderte den Erwachsenen durch die Luft, während Blut, Knochensplitter und Hirnmasse an die Wand spritzten.
Kapitel 1
Montag, 29. November, 18.52 Uhr
Der Reißverschluss meiner Winterjacke ließ sich nicht mehr schließen. Dem fahlen Schein der Taschenlampe folgend, lief ich einen Waldweg entlang. Es war nur ein schmaler Pfad. Bei jedem Schritt raschelte das letzte Laub unter meinen Stiefeln. Das Geräusch erinnerte mich entfernt an die Wellen des Meeres. Der Wind wehte, und die Temperatur war eisig. Fröstelnd zog ich die beiden Teile meiner Jacke zusammen und ballte die rechte Hand zu einer Faust. Mehr als vier Wochen war ich jetzt wieder in Deutschland. Dennoch beschlich mich hin und wieder das Gefühl, Great Blasket Island gar nicht wirklich entkommen zu sein.
Unzählige Momente hatte es seither gegeben, die meine Erinnerungen an jene verfluchte Insel und die dortigen Ereignisse geweckt hatten. Doch diesmal war es anders. Zum ersten Mal fühlte ich mich regelrecht dorthin zurückversetzt. Mutterseelenallein in der Dunkelheit. Zwar mit einem klaren Ziel vor Augen, aber ohne die geringste Ahnung, was mich dort erwartete.
Ich empfand eine unerträgliche Beklommenheit, wodurch Bilder in meinem Kopf erschienen, die ich lieber verdrängen und vergessen wollte. Eine verfallene Siedlung im Schein der Flammen. Das Klicken einer Waffe hinter meinem Rücken. Die entstellte Leiche auf dem Bett. Der Überlebenskampf in den Fluten des Atlantiks.
»Was zur Hölle machst du hier? Du kennst die Kleine doch nicht mal richtig!«
Meine innere Stimme hatte, wie üblich, recht. Hier herumzulaufen war total verrückt. Es hatte nichts mit meiner Arbeit zu tun.
Ich war bereits zu Hause gewesen, als mir die Erkenntnis gekommen war. Trotzdem hatte ich keine Sekunde gezögert. Ich war hierhergekommen und hatte den Wald betreten, um Stunden nach Dienstschluss eine Schülerin zu suchen, die ich tatsächlich kaum kannte. Dabei hatte die Dämmerung schon eingesetzt, als ich losfuhr. Nun war es stockdunkel.
Ich fror in der Eiseskälte und spürte die Finger meiner linken Hand nicht mehr, die den Schaft der Lampe umklammerten. Je tiefer ich in den Wald eindrang, desto weniger Laub lag auf dem Boden. Das einzige, was blieb, war das dumpfe Stampfen meiner Schritte auf dem weichen Waldboden. Die Stille um mich herum wirkte beängstigend. Nur ab und zu hörte ich ein leises Knacken in der Ferne. Jedes Mal schossen mir die wildesten Vorstellungen durch den Kopf. Ich malte mir aus, wie ich von Wölfen oder Bären angegriffen wurde. Doch meine Sorge um Nancy war stärker, also ging ich weiter. Wenn ich, ein erwachsener Mann, schon solch eine Angst hatte – wie mochte es erst einem jungen Mädchen gehen? Was musste sie in den letzten Tagen durchgemacht haben?
»Vorausgesetzt, sie ist überhaupt hier draußen«, meldete sich erneut meine innere Stimme zu Wort.
»Sie ist hier!«, versicherte ich mir selbst. »Daran besteht absolut kein Zweifel.«
Die sonderbare Skizze, die ich heute Mittag in meinem Büro gefunden hatte, sollte mit Sicherheit eine Art Landkarte sein. Irgendwer hatte das zerknitterte Papier unter meiner Tür hindurchgeschoben, um mir einen Hinweis zu geben. Anfangs hatte ich nicht viel in dem Gekritzel erkannt. Die Karte hätte zu jeder Gegend gehören, das große rote Kreuz jeden beliebigen Ort markieren können.
Erst Stunden später, als ich zu Hause im Garderobenschrank meine Joggingschuhe gesehen hatte war mir klar geworden, wohin mich die Karte führen sollte: Die vereinzelt eingezeichneten Bäume stellten einen Wald dar – und zwar das Waldstück, in dem ich seit einiger Zeit wieder regelmäßiger zu joggen versuchte. Nachdem ich diesen Zusammenhang hergestellt hatte, war alles ganz einfach gewesen. Sofort hatte ich auf der Zeichnung den Parkplatz entdeckt, die Schranke und den kleinen Bachlauf. Die geheimnisvolle Markierung konnte daher nur die alte Grillhütte sein.
Jemand wollte, dass ich da hinging. Und mir fiel kein anderer Grund ein als das vermisste Mädchen. Sie versteckte sich mit Sicherheit dort. Ich brauchte bloß weiterzugehen. Schon etliche Male war ich zu der abgelegenen Hütte gelaufen, jedoch noch nie im Dunkeln. Der Weg kam mir um ein Vielfaches länger vor, und mir war nie zuvor aufgefallen, wie uneben er war. Ständig musste ich aufpassen, nicht über Steine oder Wurzeln zu stolpern. Ich tastete nach meinem Handy. Es war gottlob noch da!
Seit den Erlebnissen auf Great Blasket Island war der Griff nach diesem Gerät fast schon zu einer Manie geworden. Im Internet hatte ich mir sogar einen zweiten Akku gekauft, den ich sicherheitshalber in der Jackentasche aufbewahrte, um jederzeit telefonieren zu können. Wieso nur hatte ich es nicht getan, als mir klar geworden war, wo die Schülerin sich aufhielt? Genauso gut hätte die Polizei den Wald nach ihr durchsuchen können. Warum setzte ich mich einer solchen Gefahr aus?
Ich wusste es nicht genau, doch ich bezweifelte nicht, dass es meine Aufgabe war, das Mädchen zu finden. Vielleicht gab ich mir einen Teil der Schuld daran, dass Nancy abgehauen war. Irgendetwas hätte ich anders machen müssen. Ich erinnerte mich gut an den Moment, als das schüchterne Mädchen mein Büro betreten hatte. Sie wies in vielerlei Hinsicht große Ähnlichkeit mit Alexandra auf. Besonders die langen braunen Haare und ihre feinen Gesichtszüge, die sie jünger erscheinen ließen, verbanden sie. Der auffälligste Unterschied war die feste Zahnspange, die Nancy ein bisschen beim Sprechen behinderte.
Donnerstag, 25. November, 10.15 Uhr (1 Woche früher)
»Hallo, Konrad ist mein Name. Ich bin der Beratungslehrer dieser Schule.«
Ich hielt ihr meine Hand entgegen, die sie zaghaft ergriff.
»Hast du schon von mir gehört?«
Nancy nickte unsicher und schielte verstohlen zur Tür.
»Ist es dir unangenehm, jetzt hier zu sein?«, fragte ich.
»Nein«, antwortete sie.
Nun setzte sie sich auf den Stuhl, den ich vom Tisch abgerückt hatte.
»Es ist dir nicht unangenehm. Du wolltest dich nur versichern, ob die Tür noch da ist.«
Während ich das sagte, verzog ich mein Gesicht zu einer Grimasse, die meine Skepsis überdeutlich zum Ausdruck bringen sollte. Beim Anblick meines Gesichtsausdruckes zeigte die Schülerin ein kurzes Lächeln, das jedoch sofort wieder verschwand. Mir fiel auf, wie sehr ihre Hände zitterten.
»Ich will mich nur mit dir unterhalten«, versicherte ich. »Du brauchst nichts zu erzählen, was du lieber für dich behalten möchtest.«
»Und wenn ich gar nix erzählen will?«, erkundigte sie sich. Dabei schaute sie mich prüfend an.
»Dann ist das auch okay. Doch es ist deutlich zu sehen, dass es dir nicht gut geht. Du ziehst dich in letzter Zeit sehr zurück und beteiligst dich seltener am Unterricht. Was auch immer der Grund dafür ist, vielleicht hilft es ja, mit jemandem zu sprechen?«
»Vielleicht«, stimmte sie zu. »Aber …«
Für einen Moment hatte es gewirkt, als wäre das Eis gebrochen. Ich hatte auf eine Erklärung gehofft oder wenigstens eine Erwiderung, mit der ich arbeiten konnte. Nichts dergleichen kam. Nancy hatte nicht vor, ihren Satz zu beenden.
»Aber was?«, fragte ich deshalb.
»Egal«, antwortete sie und wich meinem Blick aus.
Meine einzige Chance bestand darin, ihren unausgesprochenen Gedanken zu erahnen, um von mir aus darauf zu antworten.
»Alles, was wir besprechen, bleibt hier im Raum«, sagte ich.
Ihr Gesichtsausdruck verriet, dass ich richtig geraten hatte. »Versprochen«, versicherte ich daher. »Ich habe eine Schweigepflicht.«
Es entstand eine kurze Pause, während Nancy über meine Aussage nachdachte.
»Sie können mir trotzdem nicht helfen«, erwiderte sie. Sie bemühte sich bei den folgenden Worten um eine feste Stimme. »Darf ich jetzt wieder in den Klassenraum gehen?«
Ich nickte. Sie war schon fast bis zur Tür gekommen, ehe ich etwas sagen konnte.
»Willst du mir nicht erzählen, wer dich geschlagen hat?«
Die Schülerin blieb wie angewurzelt stehen. Mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen drehte sie sich zu mir herum. Ihr Gesicht wirkte noch ein wenig blasser als zuvor. Auch ihr Zittern war stärker geworden.
»Woher wissen Sie das?«, fragte sie verunsichert.
Die Antwort auf ihre Frage war simpel. Vor ungefähr einer Woche hatte mich Nancys Klassenlehrerin angesprochen, weil sich das Mädchen im Unterricht immer mehr zurückzog. Vor den Herbstferien wäre diese schleichende Entwicklung zwischen Klassenarbeiten und Vertretungsstunden im alltäglichen Schulchaos untergegangen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Lehrerin es jedoch bemerkt. Ich hatte daraufhin eine Stunde in der Klasse hospitiert. Es war eine tolle Unterrichtsstunde gewesen, gut geplant mit einem motivierenden Quizspiel am Anfang. Nancy hatte der Siegergruppe angehört und sich mit ihrem Wissen beteiligt. Ansonsten war sie im Hintergrund geblieben. Gegen Ende des Spiels war mir eine unbewusste Reaktion der Schülerin aufgefallen. Als ihre Gruppe einen Punkt holte, hatte ein Mitschüler ausgeholt, um ihr die Hand zum
High five hinzuhalten. Das Mädchen war in dem Moment zusammengefahren, als erwarte sie einen Schlag ins Gesicht.
Diese Erklärung behielt ich lieber für mich. Es war nicht meine Art, mir von Schülern in die Karten schauen zu lassen. Es brachte in der Regel keinen Vorteil, so etwas zu verraten. Stattdessen galt es, das Eisen zu schmieden, solange es heiß war.
»Also liege ich falsch?«, fragte ich.
Schweigend kehrte Nancy zu dem Stuhl zurück und setzte sich wieder hin.
»Wenn ich jetzt was erzähle, sind Sie dann nicht verpflichtet ... na ja ... das Jugendamt anzurufen oder so?«
Vermutlich ahnte sie nicht einmal, dass sie dabei den schwierigsten Aspekt meiner Arbeit ansprach. Schweigepflicht hin oder her – bei einer akuten Kindeswohlgefährdung zuzuschauen war beinahe genauso fatal, wie ein Kind selbst zu schlagen. Mitunter musste ich in solchen Situationen handeln, obwohl ich dadurch das Vertrauensverhältnis zu dem jeweiligen Jugendlichen arg strapazierte.
Ich hielt es für besser, ihr die Sache aus einem anderen Blickwinkel zu erläutern. »Mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht.«
Ich legte eine kurze Pause ein, damit sie die Tragweite des Satzes begreifen konnte.
»Falls dir wirklich etwas Schlimmes angetan wird, wäre es doch auch in deinem Interesse, dass wir was unternehmen. Wichtig ist nur: Ich möchte nicht über dich hinweg Entscheidungen treffen, sondern mit dir zusammen überlegen, was zu tun ist. Hier geschieht nichts, was du nicht willst.«
Nancy schwieg eine Weile. Ich vermutete, dass sie über meine Worte nachdachte. Sie bewegte ihren Kopf hin und her, als wäge sie verschiedene Möglichkeiten gegeneinander ab. Endlich nickte sie.
»Es ist nicht so, dass mein Vater ständig schlägt oder so«, begann sie, »aber vor den Ferien ging es bei uns daheim echt Drunter und Drüber.«
»Was meinst du damit?«, fragte ich interessiert.
»Ach, meine Noten waren scheiße, und dann kam mein Bruder auch noch völlig besoffen vom Kalten Markt – das hat mächtig Stress gegeben!«
»Kann ich mir vorstellen. Und was ist dann passiert?«
»Als Mum und Dad eh schon total am Rumtoben waren, hat der Wichser ihnen gesagt, dass ich einen Freund habe!« Erschrocken schaute sie mich an. »Sorry, ich wollte nicht …«
»Kein Problem«, erwiderte ich lächelnd. »Ich habe schon viel schlimmere Wörter in meinem Büro gehört. Deine Eltern wollen nicht, dass du einen Freund hast?«
»Nicht, bevor ich 35 bin.«
»Verstehe. Dein Bruder verriet ihnen dein Geheimnis und du bekamst den Ärger?«
»Von wegen Geheimnis!«, rief die Schülerin und winkte ab. »Benni weiß doch überhaupt nix über mein Leben. Er hat einfach was erzählt, damit die auf mich gehen und nicht auf ihn.«
Nancy hatte die Sache mit ihrem Bruder ein bisschen zu schnell abgetan. Ich zweifelte daran, dass sie die Wahrheit sagte. Es brachte jedoch nichts, an dieser Stelle nachzuhaken.
»Und das hat funktioniert, oder? Ist dein Vater ausgerastet?«
Ängstlich sah sie sich um. »Das muss aber echt unter uns bleiben!«
»Keine Angst.«
»Es war das einzige Mal.«
Leicht gerötete Wangen, ein verlegener Blick zum Boden und ein auffälliges Blinzeln des Mädchens veranlassten mich, ihrem letzten Satz keinen Glauben zu schenken.
»An dem Tag bestimmt«, erwiderte ich daher.
»Scheiße, woher wissen Sie das?« Nancys Miene verriet eine aufsteigende Unsicherheit. Es passte ihr gar nicht, derart durchschaut zu werden. »Verstehen Sie das bitte nicht falsch …«
»Ich könnte es richtig verstehen, wenn du mir einfach erzählen würdest, was vorgefallen ist«, schlug ich vor.
Nancy nickte zögernd. »Als ich elf war, hatten wir eine schwierige Zeit«, begann sie. »Mein Dad hatte seinen Job verloren. Er war jeden Abend besoffen, aber das ist jetzt lange her. Er hat sich geändert. Nur das eine Mal hat er sich nicht im Griff gehabt … und … er hat sich bei mir entschuldigt. Das war's!«
Mein Bauchgefühl warnte mich in diesem Moment, dass sie vermutlich noch nicht die ganze Geschichte erzählt hatte. Irgendetwas verbarg das Mädchen vor mir. Ihr Bericht über den Vater schien aber der Wahrheit zu entsprechen.
»Also ist alles wieder im Lot bei euch?«
»Was heißt Lot?«
Ich erklärte es ihr, sie verstand das Bild und nickte. »Alles im Lot, ich schwör es Ihnen.«
Es handelte sich unverkennbar um eine Lüge. Ich spürte eindeutig, dass noch etwas Größeres im Hintergrund lauerte. »Aber irgendwas ist da doch noch …?«, fragte ich deshalb.
Die Schülerin schüttelte den Kopf. Dabei hielt sie die Hände abwehrend vor den Körper.
»Ich hab schon viel zu viel gesagt.«
Montag, 29. November, 19.06 Uhr
Unser Gespräch hatte natürlich ein ungutes Gefühl hinterlassen. Doch was hätte ich darüber hinaus tun sollen? Eine akute Gefährdung hatte offensichtlich nicht bestanden, und durch weitere bohrende Fragen hätte ich mit Sicherheit keine Informationen aus dem Mädchen herausbekommen. Mir war nichts übriggeblieben, als ihr eine Einverständniserklärung für meine Arbeit mitzugeben. Ich hatte ihr erklärt, dass sie jederzeit in mein Büro kommen durfte, wenn sie mit mir reden wollte. Dasselbe Angebot hatte ich bereits unzähligen Schülerinnen und Schülern gemacht.
In einigen Fällen half es, zu warten, bis genug Vertrauen gewachsen war. In diesem Fall jedoch nicht. Nancy war noch am selben Tag von zu Hause abgehauen. Sie hatte nach dem Mittagessen ein paar persönliche Dinge aus ihrem Zimmer geholt und war daraufhin unbemerkt verschwunden. Anfangs hatten ihre Eltern geglaubt, ihre Tochter übernachte nur bei einer Freundin und hätte vergessen, Bescheid zu sagen. Als auch der folgende Tag ereignislos verstrichen war, hatten sie schließlich die Polizei eingeschaltet.
Inzwischen hatten Nancys Familie, die Polizisten und eine Menge Freiwillige in der ganzen Gegend nach ihr gesucht. Schulfreundinnen hatten eine Vermisstenmeldung auf einem sozialen Netzwerk veröffentlicht, und sogar die lokale Zeitung war auf die Sache aufmerksam geworden. Alle Bemühungen waren bisher erfolglos geblieben. Rational wusste ich natürlich, dass mich keine Schuld am Weglaufen der Schülerin traf. Dennoch stellte ich mir wieder und wieder dieselben Fragen: Was hatte ich übersehen? Hatte ich die Situation falsch eingeschätzt? Hätte ich ihr Fortlaufen doch irgendwie verhindern können? Die Zweifel, die mit diesen Gedanken einhergingen, waren mir auf unheilvolle Art vertraut. Sie versetzten mich zurück auf jene verfluchte Insel im Atlantik. Zurück in das Zelt, neben die Leiche von Alexandra Peters.
Erneut war ein Geräusch zu hören, als sei jemand auf einen morschen Ast getreten. Nur kam das Knirschen diesmal aus meiner unmittelbaren Umgebung. Erschrocken riss ich die Taschenlampe hoch und leuchtete in die Dunkelheit. Um mich herum war alles ruhig. Der Lichtkegel erfasste einen der Bäume am Wegrand. Die Schatten seiner Zweige gaukelten mir eine Bewegung im Unterholz vor. Unwillkürlich lief ich schneller und malte mir dabei die unmöglichsten Bedrohungen aus, die mich aus dem finsteren Dickicht anspringen konnten. Die wirkliche Gefahr, einen Stein oder eine Wurzel direkt vor meinem Fuß, bemerkte ich nicht. Ich stolperte und fiel der Länge nach in den Dreck. Meine Lampe flog in hohem Bogen durch die Luft, ehe sie mit einem Knall auf den Boden krachte und erlosch.
»Scheiße!«, brüllte ich und betastete vorsichtig mein Knie. Es brannte wie Feuer.
Meine Jeans hatten wohl einen Riss abbekommen. Die Fransen des kaputten Stoffes fühlten sich feucht an. Ich kam mir unglaublich alt vor, wie ich da so keuchend am Waldboden entlang robbte und die verlorene Taschenlampe suchte. Eine halbe Ewigkeit schien zu vergehen, bis ich sie endlich fand. Mit zitternden Fingern drückte ich auf den Schalter. Doch nichts geschah.
Eigentlich war mir schon klar gewesen, dass die Lampe nicht angehen würde, denn das Ding lag viel zu leicht in der Hand. Der Deckel hatte sich gelöst, und beide Batterien waren herausgefallen. Wieder knackte es ganz in meiner Nähe. Voller Panik begann ich, den dunklen Weg nach den Batterien abzusuchen. Ich entdeckte die erste und schob sie in den Schaft der Lampe, nachdem ich den Pluspol ertastet hatte. Es brachte mir wenig, dass ich auch die zweite Batterie recht schnell fand, denn die Verschlusskappe blieb verschwunden. So sehr ich mich auch bemühte, das Teil war nirgends zu finden.
Schließlich kam mir eine Idee. Eilig griff ich nach meinem Handy. Das Fotolicht des Telefons leuchtete bei Weitem nicht so stark wie das Licht der Taschenlampe, aber sicher hell genug, um den Batteriedeckel zu suchen. Ehe ich die Funktion einschalten konnte, hörte ich auf einmal Schritte. Ein wildes Tier vielleicht? Ich wagte kaum zu atmen, aus Angst, meinen Aufenthaltsort zu verraten. Einen Moment lang hockte ich da und lauschte. Es waren eindeutig Schritte, die rasch näherkamen. Mit aller Kraft stemmte ich mich auf die Beine und lief los. Durch die Schmerzen in meinem Knie kam ich nur langsam voran. Ich konnte hören, wie mein Verfolger immer näher und näher kam.
»Herr Konrad!«, rief plötzlich eine Stimme, die mir vertraut vorkam. Es dauerte eine Weile, bis mir einfiel, woher ich sie kannte.
»Ricky?«, fragte ich und starrte in die Finsternis.
»Ja«, antwortete der Junge. Es klang so, als stehe er direkt neben mir. »Haben Sie sich verletzt?«
»Es geht schon«, erwiderte ich. »Hast du eine Lampe dabei?«
»Nee, die brauche ich nicht. Ich sehe auch so ganz gut.«
»Ich verstehe nicht recht?«
»Vermutlich hilft Ihnen das hier.«
Ich spürte, wie ich am Arm berührt wurde. Ricky hielt mir den Deckel meiner Taschenlampe entgegen. Ich brauchte eine gefühlte Ewigkeit, bis ich die zweite Batterie eingesetzt und den Verschluss aufgeschraubt hatte. Endlich leuchtete die Lampe auf. Ich erschrak, als ich ihren Schein auf mein Gegenüber richtete. Er trug ein sonderbares Gestell, das aussah wie ein Fernglas. Es war mit mehreren Riemen an seinem Kopf befestigt. Mit einem Schrei drehte er sein Gesicht zur Seite und schirmte das merkwürdige Gerät mit dem Unterarm gegen mein Licht ab. Jeder Atemzug des Jungen war gut an einer kleinen Nebelwolke zu erkennen.
»Was ist das?«, fragte ich.
»Ein Nachtsichtgerät. War ein Geschenk von meinem Dad«, antwortete er.
»Aha«, sagte ich knapp. »Und was in drei Teufels Namen machst du damit hier im Wald?«
»Na, ich wollte sichergehen, dass Sie sie auch finden.«
»Du meinst Nancy?« Mit einem Schlag wurde mir alles klar. »Also hast du mir die Zeichnung unter der Tür durchgeschoben?«
Rickys Stimme wurde jetzt ungewohnt kleinlaut. »Ja«, murmelte er.
»Aber wieso? Wenn du wusstest, wo sie sich aufhält, konntest du doch einfach ihren Eltern oder der Polizei einen Hinweis geben.«
»Und warum hätte ich das tun sollen?«, erwiderte Ricky. »Sie wäre doch sofort wieder abgehauen. Aber mit Ihnen wird sie sprechen, da bin ich mir sicher.«
»Vielen Dank für dein Vertrauen«, brummte ich mürrisch. Dabei richtete ich den Lichtstrahl auf die Verletzung an meinem Knie. Meine Hose war dahin. Blut quoll aus einer kleinen Wunde. Ich tastete danach. Es brannte wie Feuer, und ich sog geräuschvoll Luft durch meine Zähne ein.
»Stellen Sie sich nicht so an. Das ist doch nur ne Schramme!«, rief der Junge trotzig. »Nancy braucht Ihre Hilfe.«
»Und die hätte sie garantiert viel schneller bekommen, wenn du mir einfach gesagt hättest, wo sie ist.«
»Nancy wollte nicht, dass irgendwer erfährt, wo sie sich versteckt. Ich musste ihr fest versprechen, nix zu sagen.« In seiner eigenen Weltsicht hatte Ricky dieses Versprechen wahrscheinlich nicht einmal gebrochen. Schließlich hatte er tatsächlich nichts gesagt. »Aber in den letzten Tagen ist es verdammt kalt geworden.«
Damit hatte er recht. Die Temperaturen waren über das Wochenende gefallen, und laut des Wetterberichts stand uns eine längere Kältewelle bevor.
»Und wieso hast du eine Schatzkarte gezeichnet, anstatt einen Brief zu schreiben? Den hätte ich doch viel sicherer verstanden.«
»Ich kenne Ihre Tricks ganz gut, Herr Konrad. Sie hätten mich bestimmt an der Schrift erkannt, wenn ich die Nachricht aufgeschrieben hätte … So wie bei Elisa.« Nun schaute er sich um, als wollte er sichergehen, dass niemand zuhörte. »Nancy darf auf keinen Fall erfahren, dass Sie das von mir haben. Die bringt mich um!«
»Und warum hast du es nicht mit einem offenen Gespräch versucht? Zum Beispiel mit: Herr Konrad, bitte verraten Sie nicht, dass ich es gesagt habe, aber Nancy ist in der Waldhütte und braucht Ihre Hilfe?«
Ein bisschen ärgerte es mich, dass der Schüler mir nicht genug Vertrauen entgegengebracht hatte, um einfach mit mir zu sprechen.
»Das war Plan B, falls Sie die Zeichnung nicht kapieren.«
Als ich den verlegenen Blick des Jungen sah, verrauchte mein Ärger. Ich schmunzelte.
»Na super«, sagte ich. »Lass uns jetzt lieber nach Nancy schauen.«
»I-ich komme nicht mit!«, schoss es aus ihm heraus. »Ich hab doch gesagt, sie darf nicht wissen, dass …«
»Ist schon klar«, antwortete ich mit beruhigender Stimme. »Aber wenn sie wirklich in Gefahr ist entgeht dir die Chance, der große Retter zu sein.« Es war zu sehen, dass meine Worte Eindruck auf den Jugendlichen machten. Schließlich nickte er langsam. Gemeinsam setzten wir uns wieder in Bewegung. So jung mein Begleiter auch sein mochte, er gab mir ein Gefühl der Sicherheit. Es dauerte etwa fünf Minuten, bis wir die alte Grillhütte erreichten.
»Nancy?«, rief ich. »Bist du hier?«
Keine Antwort. Ich leuchtete die Holzläden ab, mit denen die Fenster der Hütte verriegelt waren. Dann richtete ich die Taschenlampe auf Ricky, der inzwischen das Gestell von seinem Kopf genommen hatte. Ich bedeutete ihm, auch etwas zu rufen.
»Es ist okay, Nance! Er will bloß helfen.«
Noch immer keine Antwort. Die Stille wirkte mit einem Mal bedrohlich. Ich beschloss, nicht länger zu warten, ging zu der Tür und öffnete sie. Es war stockdunkel und eisig im Inneren des Häuschens. Der Geruch von kaltem Rauch hing in der Luft. Falls das Mädchen sich ein wärmendes Feuer angemacht hatte, war es schon seit geraumer Zeit heruntergebrannt.
»Hey, Nancy!«, rief ich erneut. »Bist du hier drin?«
Meine Schritte hallten auf dem Betonboden. In dem Vorraum waren leere Verpackungen verstreut: Toastbrot, Salami, Joghurtbecher und einige Plastiktütchen mit Ketchup. Daneben stand eine halb volle Wasserflasche aus Plastik. Ich folgte einem schmalen Durchgang in die eigentliche Grillhütte. Hier reihten sich etliche Tische und Bänke aneinander. Am Ende des Raumes erkannte ich den großen, gemauerten Grill. Nicht einmal die Glut war darin zu sehen. Davor lag eine reglose Gestalt. Ich leuchtete direkt in ihr blasses, lebloses Gesicht. Sie steckte in einem dünnen Schlafsack. Ihre Augen waren geschlossen, die Lippen blau vor Kälte.
»Oh mein Gott«, stieß ich aus und stürzte zu ihr. »Alles okay bei dir?«
Ich konnte schreien, so laut ich wollte. Das Mädchen zeigte keinerlei Reaktion. Nichts deutete darauf hin, dass sie am Leben war. Ich beugte mich über sie und hielt mein Ohr an ihren Mund. Wenn sie noch atmete, konnte ich es nicht hören.
»Hast du ein Handy dabei?«, fragte ich Ricky, der hinter mir in die Hütte kam.
»Ja.«
»Ruf den Krankenwagen, sofort!«, befahl ich.
»Ich weiß doch gar nicht, wie das geht«, jammerte er.
Ich hatte mich neben die Schülerin gehockt und ihren Oberkörper in eine aufrechte Position gebracht.
»Einfach 112 eintippen und sagen, wo wir sind«, erklärte ich, während ich meine Jacke auszog und über Nancys Schultern hängte. Mit zitternden Fingern tastete ich nach ihrem Hals. Ich spürte keinen Puls. Meine Hände waren jedoch so kalt, dass es auch daran liegen konnte. Entschlossen legte ich meinen Arm um das Mädchen. Ich versuchte, ihr etwas von meiner eigenen Körperwärme abzugeben. Aus dem Vorraum hörte ich Rickys Stimme, der aufgeregt angab, wo wir die Vermisste gefunden hatten: »In der Grillhütte im Wald …«
Wenige Augenblicke später kam er wieder in den Hauptraum gestürmt.
»Hilfe ist unterwegs«, rief er hektisch. »Wie geht es ihr? Ist sie …«
Er sprach den Gedanken nicht aus, aber ich wusste trotzdem, was er befürchtete. Dieselbe Angst nagte an mir.
»Ich weiß es nicht«, sagte ich. »Hilf mir, sie warmzuhalten!«
Der Junge verlor keine Zeit und hockte sich neben uns. So saßen wir dort, im Schein der Taschenlampe, und taten das einzige, was wir in diesem Moment tun konnten.
Uns war nur die Hoffnung geblieben, dass der Krankenwagen schnell kommen und die Ärzte Nancy retten würden.
Montag, 29. November, 21.34 Uhr
Einundzwanzig Stufen führten zu meiner Wohnung. Jede einzelne kam mir jetzt vor wie eine unüberwindliche Hürde. Es war ohne Zweifel der längste Arbeitstag meines Lebens – sofern man das Suchen einer Schülerin überhaupt zur Arbeitszeit zählen durfte. Der Rettungswagen war in Rekordzeit bei der Grillhütte angekommen. Die Sanitäter hatten Nancy mit professioneller Eile erstversorgt und anschließend für den Transport ins Krankenhaus verladen.
»Ist sie tot? Da war kein Puls, und ich habe nicht hören können, ob sie atmet«, hatte ich besorgt den jüngeren Helfer gefragt.
Der hatte bloß den Kopf geschüttelt. »Niemand ist tot, solange er das nicht in einer warmen Umgebung ist.«
Ricky hatte darauf bestanden, bei seiner Freundin zu bleiben. So war den Rettungssanitätern keine andere Wahl geblieben, als ihn wohl oder übel im Krankenwagen mitzunehmen. Doch danach musste er ja auch wieder nach Hause kommen. Also war ich eilig zu meinem Auto zurückgekehrt und ebenfalls ins Klinikum gefahren.
Ricky war nicht von Nancys Seite gewichen, bis sie gut versorgt in einem Bett der Klinik lag. Erst, als er mit absoluter Sicherheit nichts mehr für sie tun konnte war der Jugendliche bereit gewesen, mit mir zu meinem Wagen zu gehen.
Mit letzter Kraft drehte ich den Schlüssel herum und öffnete die Haustür. Es brannte Licht in meiner Wohnung. Der Geruch gebratener Zwiebeln verriet mir, dass Marie gerade kochte.
»Ich bin daheim!«, rief ich.
»Sag nicht, du kommst jetzt von der Arbeit?« Die Stimme aus der Küche klang amüsiert.
»Irgendwie schon.«
»Und da heißt es immer, Lehrer hätten jeden Tag um 13.00 Uhr Feierabend.« Meine Freundin erschien mit einem breiten Grinsen im Flur, das jedoch augenblicklich verschwand. »Scheiße, Daniel, wie siehst du denn aus?«
»Ich habe das vermisste Mädchen gefunden«, erklärte ich. »Du weißt schon, Nancy. Die Schülerin, die von zu Hause abgehauen war.«
Marie kam ein paar Schritte auf mich zu und küsste mich, bevor sie begann, mir die Jacke auszuziehen.
»Und? Hast du dich mit ihr geprügelt?«, fragte sie währenddessen. »So wirkt es jedenfalls.«
»Nein. Sie hatte sich in einer Grillhütte im Wald versteckt.«
»Und da musstest du im Dunkeln hingehen?« Sie hängte meine dreckige Jacke ordentlich auf einen Bügel und klopfte mit einem vorwurfsvollen Blick den Staub ab. »Mal darüber nachgedacht, so was der Polizei zu überlassen?«
Ich nickte widerstrebend. »Du hast ja recht«, entgegnete ich beschwichtigend, obwohl ich ihre Meinung nicht teilte. Nancy zu finden, war ohne den geringsten Zweifel meine Aufgabe gewesen.
Meine Freundin seufzte und beließ es dabei. Vermutlich, weil sie ohnehin nichts mehr daran ändern konnte.
»Wie geht es der Kleinen denn?«
»Der Arzt meinte, sie sei stark unterkühlt. Morgen früh will ich noch einmal im Krankenhaus vorbeifahren. Dann erfahre ich bestimmt mehr.« Erneut stieg mir der Duft des Essens in die Nase. »Riecht gut«, sagte ich mit entsprechender Geste. »Was gibt es Leckeres?«
»Serbische Bohnensuppe aus der Dose«, antwortete Marie. Das war seit der Reise zu den Blasket Islands eine Art wiederkehrender Scherz zwischen uns. Wir hatten uns nach der Rückkehr aus Irland einen heiligen Eid geschworen, nie wieder zu campen, auf einer Insel zu übernachten oder eine Suppe aus der Blechdose zu kochen.
»Super, ich hole meinen Napf«, gab ich grinsend zurück.
Ich freute mich auf einen netten Abend und bemerkte erst in diesem Moment, wie hungrig ich war. Ich hätte gegessen, was immer in der Küche auf mich wartete, selbst wenn es tatsächlich serbische Bohnensuppe gewesen wäre. Marie nahm mich bei der Hand und ging den Flur entlang. Wir kamen nur bis zur Küchentür, ehe ein schrilles Geräusch uns stoppte. Ich erkannte den Klingelton ihres Handys. Sie ließ meine Hand los und lief zur Garderobe, wo das Gerät lag.
»Marie Körbel«, sagte sie, nachdem sie eine Sekunde lang irritiert auf das Display geschaut und schließlich den Anruf angenommen hatte. Eine Palette unterschiedlicher Gefühle erschien der Reihe nach auf ihrem Gesicht. Neugier, gefolgt von Unbehagen und letztlich Verlegenheit.
»Einen Augenblick, bitte!«, bat sie ihren Gesprächspartner und hielt das Telefon ein Stück vom Ohr weg.
»Das dauert eine Weile – hat mit der Arbeit zu tun«, erklärte sie mir. »Geh schon mal rein, ich komme gleich nach.«
Gelegentlich fühlte ich mich wie ein menschlicher Lügendetektor. In solchen Situationen wünschte ich mir oft, all dies nicht erkennen zu können. Wer immer der Anrufer war – wegen Maries Arbeit hatte er garantiert nicht angerufen. Sofort war meine Neugierde geweckt, doch ich nickte nur knapp und verschwand mit einem Lächeln in der Küche. Nach den Ereignissen der Vergangenheit hatte ich beschlossen, meiner Freundin zu vertrauen.
»Manchmal haben Menschen eben ihre kleinen Geheimnisse voreinander«, erinnerte ich mich selbst, um meine innere Stimme zu übertönen, die lauthals die Wahrheit verlangte. »Nicht hinter jeder unbedeutenden Lüge steckt unbedingt eine Verschwörung zu Mord und Totschlag!«
Kapitel 2
Dienstag, 30. November, 06.42 Uhr
»Möchtest du noch?«, fragte Marie und hielt mir die halb volle Kaffeekanne entgegen. Ich deutete ein Nicken an, während ich in der Morgenzeitung blätterte, die vor mir auf dem Tisch lag. Frischer Kaffee ergoss sich in meine Tasse. Der Duft des kräftigen Getränks stieg mir in die Nase. »Es wurde auch langsam Zeit, dass die den Typ endlich erwischen.«
Irritiert schaute ich meine Freundin an. »Wovon sprichst du?«
»Na, von dem Artikel da«, antwortete sie und zeigte auf die Lokalseite meiner Zeitung.
»Heiße Spur bei Einbruchserie«, stand dort als Überschrift.
Weitere Hinweise, worum es ging, brauchte der Reporter in der Schlagzeile nicht zu geben. Neben Nancys Verschwinden war die immer größer werdende Reihe von Einbrüchen in den vergangenen Wochen das Gesprächsthema schlechthin gewesen. Neugierig las ich die Zeilen. Der Verfasser gab einen kurzen Rückblick auf die zurückliegenden Ereignisse. Mehrere Wohnungen waren in den letzten Monaten geplündert worden. Meist waren die Einbrecher durch eingeworfene Fenster eingedrungen. Sie hatten dabei nicht nur unzählige Wertgegenstände gestohlen. Es waren auch die Einrichtungen verwüstet und aggressive Graffiti an die Wände gesprüht worden.
Bei ihren Beutezügen hatten die Täter nicht einmal vor dem vornehmen Villenviertel unserer Stadt zurückgeschreckt. Der dortige Einbruchversuch war jedoch kläglich an einer Alarmanlage gescheitert, sodass sie unverrichteter Dinge abziehen mussten. Erst am Ende des Berichts kam der Zeitungsreporter auf die besagte heiße Spur aus der Titelzeile zu sprechen. Die Polizei befasse sich derzeit mit einer Jugendbande, die auf den Kinderspielplatz an der Seewiese ähnliche Graffiti geschmiert hatte wie die Vandalen an den Tatorten. Die Polizei hoffe nun, die Täter ausfindig machen und das Diebesgut sicherstellen zu können. Der Hinweis auf die Seewiese ließ mich hellhörig werden, denn dieser lang gezogene Park unterhalb der Altstadt war nicht weit von meiner Beratungsschule entfernt.
»Das ist nicht gut«, sagte ich in Gedanken, nachdem ich den gesamten Text gelesen hatte.
»Was ist los?«, fragte Marie.
»Sie verdächtigen eine Gruppe von Jugendlichen aus der Gegend«, erklärte ich. »Das riecht verdammt nach Arbeit.«
»Denkst du, die Kids sind auf deiner Schule?«
»Könnte schon sein«, gab ich zurück und betrachtete dabei das Foto des Artikels näher. Es zeigte einen der Schriftzüge, den die Täter hinterlassen hatten. Das Bild war offenbar am Ort eines der Einbrüche aufgenommen worden. »ACAB« stand dort in schwarzen krakeligen Buchstaben – eine Abkürzung für »All cops are bastards«. Ursprünglich kam diese Parole aus dem Sprachgebrauch radikaler Gruppierungen. Autonome, Neonazis oder Punks brachten so ihre Abneigung gegen die staatliche Exekutive zum Ausdruck. Mittlerweile war die Buchstabenfolge jedoch in der Jugendkultur salonfähig geworden. Ihre öffentliche Verwendung galt selbst unter normalen Teenagern als ein Beweis für Mut und Männlichkeit. Pubertierende Jungen versuchten sich dadurch als harte Kerle darzustellen. Ich kannte sogar einige Schüler, die ihr Profil in sozialen Netzwerken damit verzierten.
Außerdem wusste ich genau, welche dieser Schüler ihre Freizeit normalerweise an der Seewiese verbrachten. Deshalb hatte ich mir sofort vorstellen können, von welcher Jugendbande hier die Rede war und ahnte, in wessen Büro die verzweifelten Eltern landen würden, wenn sich mein Verdacht bestätigte.
»Ich rufe nachher auf dem Weg zur Arbeit Herrn Lehmann an«, sagte ich schließlich, während ich die Zeitung sorgfältig zusammenfaltete. Dann widmete ich mich endlich meiner zweiten Tasse Kaffee, die inzwischen nur noch lauwarm war. Dabei bemerkte ich den skeptischen Blick meiner Freundin.
»Was ist los?«, fragte ich.
»Lehmann? Ist das nicht dieser Typ von der Polizei?«
Ich nickte. »Er ist Kommissar und gehört zu einer Arbeitsgruppe, die sich mit Gewalt an Schulen beschäftigt«, erklärte ich. Seit vielen Jahren pflegte ich eine enge Zusammenarbeit mit ihm. Natürlich durfte er mir keine Auskünfte über laufende Ermittlungen geben. Fragen kostete jedoch nichts. Manchmal hatte ich Glück, und Herr Lehmann gab mir die eine oder andere Information im Vertrauen weiter.
»Wieso um alles in der Welt musst du dich unbedingt in diese Sache einmischen?«, wollte Marie wissen. »Du weißt doch gar nicht, ob wirklich ein Schüler von dir beteiligt ist.«
»Deswegen will ich ja anrufen.«
»Hat es dir nicht gereicht, gestern bis in die späten Abendstunden hinein Detektiv zu spielen?« Ihre Wortwahl provozierte mich bis aufs Blut. Warum sollte ich mich jetzt dafür rechtfertigen, dass ich das Mädchen gerettet hatte?
»Das war ja wohl etwas völlig anderes!«, rief ich empört. »Ich versuche nur, rechtzeitig mitzukriegen, wenn sich Probleme anbahnen.«
»Wie du meinst«, seufzte sie. Mit einem Kopfschütteln erhob sie sich vom Tisch und brachte ihren Teller und die Tasse zur Spülmaschine.
Mittlerweile hatte ich schon einige Erfahrung mit ihrem Verhalten in Konflikten gesammelt. Ich wusste, dass ich mit Argumentieren nicht weiterkommen würde. »Wie du meinst« hieß übersetzt »Ich erwarte Verständnis«, und nicht »Überzeug mich«. Deshalb stand ich ebenfalls auf, ging zu ihr und legte besänftigend meinen Arm um ihre Schulter.
»Hey«, sagte ich dabei, »was ist eigentlich dein Problem?«
»Ist das nicht offensichtlich?«, fragte sie barsch. Mit einer Bewegung fegte sie meine Hand von ihrem Arm. Dann knallte sie das Geschirr ein wenig zu heftig in die Maschine.
»Nicht wirklich«, gab ich zurück.
Daraufhin drehte sie sich abrupt zu mir herum. »Ich mache mir Sorgen um dich«, erklärte sie überdeutlich betont, als spreche sie mit einem dummen, kleinen Jungen. »Überlass solche Sachen bitte der Polizei – ich finde, wir haben in diesem Jahr genug Kriminalgeschichten erlebt.«
»Was hat das denn damit zu tun?«, verteidigte ich mich. »Ich möchte doch bloß auf dem Laufenden bleiben, wenn es um meine Schüler geht.«
»Das ist mir schon klar, aber ich will nicht, dass du …« Weiter kam Marie nicht, bevor sie vom Klingeln ihres Handys unterbrochen wurde. Eilig schlug sie die Klappe der Spülmaschine zu und stürmte in den Flur. Der verlegene Blick, den sie mir dabei zuwarf, erinnerte mich an eine schuldbewusste Schülerin. Sie schloss die Küchentür sorgfältig, ehe sie den Anruf annahm, sodass ich nicht hören konnte, worum es bei ihrem Telefonat ging. Das weckte mein Misstrauen, denn es war das zweite Mal, dass sie angerufen wurde und nicht wollte, dass ich mitbekam, von wem. Wenige Minuten später kam sie in die Küche zurück.
»Wieder die Arbeit?«, fragte ich.
»Wie?« Marie wirkte geistesabwesend. »Ach so, ja. Wieder dieselbe Sache.«
»Scheint ja eine dringende Angelegenheit zu sein, wenn man dich spät abends und früh morgens deswegen anruft«, erwiderte ich. Dabei achtete ich darauf, die Feststellung möglichst beiläufig klingen zu lassen.
»Ist es auch«, antwortete sie. »Genau deshalb muss ich gleich losfahren.« Es war mehr als offensichtlich, dass sie etwas vor mir verbarg. Hatte sie Ärger mit ihrem Arbeitgeber? Oder steckte etwas anderes hinter den ständigen Telefonanrufen? Bevor ich dazu kam, ihr meine Fragen zu stellen, war sie schon in den Flur gestürmt. Ich hörte, wie sie den Garderobenschrank öffnete und folgte ihr dorthin. Sie hatte bereits ihren Mantel angezogen und kramte im Schuhschrank nach passenden Schuhen. Sie entschied sich für die halbhohen Stiefel. Eilig arbeitete sie ihre Füße hinein.
»Wir sehen uns heute Nachmittag«, murmelte sie, ohne mich anzuschauen.
»Was ist los?«, fragte ich. »Mit dir stimmt doch irgendetwas nicht.«
»Bitte nicht jetzt, Daniel.«
»Ich meine ja nur. Wenn du irgendwelchen Stress hast, möchte ich das gerne wissen.«
Marie kam ein Stück auf mich zu. Sie nahm mich in den Arm.
»Es ist alles in Ordnung«, sagte sie und küsste mich auf die Wange. Danach zog sie die Reißverschlüsse der Stiefel zu und verschwand mit einem knappen Abschiedsgruß aus der Wohnung.
Marie
Nichts war in Ordnung. Dadurch, dass Joachim sich bei ihr gemeldet hatte, war ihr Leben mit einem Mal auf den Kopf gestellt worden. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, wie sie all das hinkriegen sollte, was vor ihr lag.
»Einen Schritt nach dem anderen«, riet sie sich selbst. »Es wird der richtige Zeitpunkt kommen, Daniel die Wahrheit zu sagen.«
Ein bisschen bedauerte sie es, ihn so hintergehen zu müssen. Sie war jedoch davon überzeugt, dass er genug mit seinen eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Der Moment schien ihr denkbar schlecht, jetzt auch noch mit ihrer Geschichte herauszuplatzen.
Seit ihrer Rückkehr nach Deutschland verhielt ihr Freund sich wie ein Hamster im Laufrad, der ohne Sinn und Verstand rannte. Egal, wohin, egal, weshalb – Hauptsache, in Bewegung. Marie vermutete, dass er im Grunde nur vor seinen Gefühlen davonlief und es vermied, über die Verluste der vergangenen Wochen nachzudenken. Die Sache mit dem Mädchen im Wald war das beste Beispiel dafür. Wie konnte man bloß so leichtsinnig sein und blindlings in eine gefährliche Situation hineinlaufen? Irgendwie hatte sie gehofft, er würde danach endlich zur Ruhe kommen, doch schon beim Frühstück hatte er sich das nächste Hamsterrad gesucht und war losgerannt. Nein, Daniel ging es definitiv nicht gut. Und Marie hatte beschlossen, auf den geeigneten Augenblick zu warten, ehe sie ihm die Ereignisse der letzten Tage verriet. Sie schwieg zu seinem eigenen Schutz, wie sie sich jetzt einzureden versuchte.
Eilig lief sie die Stufen zur Haustür hinunter und blickte dabei flüchtig auf ihre Armbanduhr. Durch ihr übereiltes Aufbrechen kam sie voraussichtlich viel zu früh zur Arbeit. Daniel witterte Geheimnisse, als hätte er einen siebten Sinn dafür und ließ dann nicht locker, bis er die Wahrheit kannte. Auf keinen Fall wollte sie ihm die Möglichkeit geben, weitere Fragen über Joachims Anrufe zu stellen. Joachim. Es war nun schon das zweite Mal in ihrem Leben, dass sie ihn vor einer anderen Person verheimlichte.
Bei diesem Gedanken kam ihr die Erinnerung daran, wie sie vor Jahren die Bombe bei ihrer Mutter platzen gelassen hatte. Marie war damals gerade 17 Jahre alt, und Joachim war ihr erster Lover gewesen.
Freitag, 31. Juli, 18.45 Uhr (12 Jahre zuvor)
Sein Bart kratzte immer ein wenig beim Küssen, doch das interessierte sie in diesem Moment nicht. Genauso egal war die Tatsache, dass die Hexe sie mit Sicherheit längst entdeckt hatte. Wahrscheinlich beobachtete sie das Geschehen schon mit Argusaugen durch das Fenster.
Marie schlang ihre Arme noch fester um Joachim und küsste ihn wild und leidenschaftlich. Jetzt gab es ohnehin kein Zurück mehr. Der alte, hellblaue Pick-up stand direkt vor der Einfahrt. Es trennten sie nur noch das spießige Gartentor und der langweilige Schotterweg von ihrem Glück. Und nicht zu vergessen ihre Mutter. Die garantiert nichts unversucht lassen würde, um sie aufzuhalten. Sie löste ihre Lippen von seinen und beachtete den Speichelfaden nicht, der sich zwischen ihnen langzog. Dann schaute sie ihm tief in die Augen. Seine strahlenden blauen Augen.
»Ich bin gleich wieder da«, sagte sie und fühlte dabei deutlich, wie sich ihr Puls vor Aufregung beschleunigte. »Dauert nur eine Minute.«
»Lass dir Zeit, Babe«, antwortete Joachim lächelnd. »Damit du nix vergisst.«
Marie schüttelte den Kopf. »Werd ich nicht. Ist alles fertig gepackt. Meine Sachen stehen seit gestern Abend bereit.«
Sie öffnete die Seitentür. Während sie ihren schlanken Körper elegant aus dem Fahrzeug schwang, spürte sie Joachims Blick auf ihrem Hintern. Sein Interesse war schmeichelhaft. Nicht so aufdringlich und nervtötend wie bei den kindischen Jungs in der Schule. Marie warf ihm ein Lächeln zu. Seine Aufmerksamkeit kam ihr vor wie ein Geschenk. Ihr Herz schlug jedes Mal vor Freude schneller, wenn sie ihn traf. Doch diesmal schlug es nicht nur, weil er in der Nähe war. Diesmal schlug es auch, weil sie kurz davor war, endlich ihre unsichtbaren Fesseln zu sprengen. Sie war im Begriff, das Gefängnis zu verlassen, das ihr Elternhaus für sie darstellte.
Die Steine knirschten unter ihren Sandalen, als sie zur Haustür hinüberlief. Einen Augenblick lang stand sie dort und starrte auf das Schild, das sie vor Jahren in der Grundschule aus Ton modelliert hatte. »Becker« war in großen, etwas ungleichmäßigen Buchstaben darauf geschrieben. Mit einem Ruck wurde die Tür aufgerissen, sodass das Namensschild gegen das Holz klackerte. In dem Türspalt erschien ihre Mutter mit finsterer Miene. Sie würdigte Marie keines Blickes. Ihre Augen waren starr auf den Fahrer des Autos gerichtet.
»Wer ist das?«, fragte sie.
»Mein Freund«, antwortete Marie und quetschte sich an ihr vorbei ins Haus. Sie hätte am liebsten laut aufgeschrien, so gut fühlte sich dieser längst überfällige Befreiungsschlag an.
»Der ist nichts für dich«, sagte ihre Mutter trocken. »Du wirst ihn nicht wiedersehen.«
Es handelte sich nicht um eine Aufforderung oder einen Befehl, bloß um eine Feststellung. Marie kannte solche endgültigen Aussagen von ihr viel zu gut. Sie duldeten keinen Widerspruch und erwarteten hundertprozentigen Gehorsam. Um ein Haar wäre sie sogar wieder in die Rolle der kleinen, braven Tochter gefallen und hätte ein frustriertes »Ja, Mum« geantwortet. Es kostete eine ungeheure Überwindung, sich aus dem Sog jahrelang antrainierter Unterordnung zu befreien. Sie schaffte es irgendwie und ging erhobenen Hauptes zu ihrem Zimmer.
»Hast du mich verstanden, junge Dame?«, giftete ihre Mutter, während sie die Haustür zuschlug.
Marie gab keine Antwort. Mit zitternden, schweißnassen Händen griff sie nach dem gepackten Koffer, den sie nur halbherzig unter ihrem Bett versteckt hatte. Sie zog ihn hervor und prüfte erneut seinen Inhalt.
»Was ist das?« Marie erschrak, denn ihre Mutter stand näher hinter ihr, als sie vermutet hatte.
»Mein Koffer. Ich gehe«, gab sie zurück.
Enttäuscht bemerkte sie, wie schwach und zittrig ihre Stimme klang.
»Du gehst nirgendwohin!« Wieder dieser Ton. Wieder diese Endgültigkeit in der Stimme. Wieder die seelenruhige Erwartung vollständiger Anpassung.
Marie atmete tief ein und ging einen Schritt auf die Tür zu. Die ältere Frau packte nach ihrem Arm und zog brutal daran. Eine Flut von Erinnerungen brach über das Mädchen herein. Sie erinnerte sich an die zwei Wochen Hausarrest, als sie mit sieben Jahren eine ihrer Puppen nicht ordentlich in den Schrank geräumt hatte. An die vielen, endlosen Stunden, die sie am Küchentisch gesessen hatte, während sie zum wiederholten Mal ihre dämlichen Hausaufgaben abschreiben musste. Oft genug war es nur ein unbedeutender Rechtschreibfehler gewesen, den ihre Mutter entdeckt hatte.
Und nicht zuletzt an den Schlag ins Gesicht, den sie mit fast 13 bekommen hatte. Unter Tränen hatte sie damals berichtet, dass ein fremder Junge von der Albert-Schweitzer-Schule sie gegen ihren Willen geküsst hatte. Wut glomm in ihren Augen. Ehe sie realisierte, was sie tat, hatte sie sich losgerissen und ihre Mutter von sich gestoßen. Marie war in den letzten Monaten etliche Zentimeter gewachsen. Zum ersten Mal konnte sie es nun mit ihr aufnehmen.
»Was fällt dir ein …« Ihrem Gegenüber fehlten die Worte. Das war etwas völlig Neues. Nie zuvor hatte Marie erlebt, dass es ihrer Mutter die Sprache verschlug, und das verlieh ihr eine ungeheure Kraft.
»Der einzige Mensch, den ich niemals wiedersehen werde, bist du«, sagte sie – nicht als Drohung, nicht als trotzigen Ausruf. Es war bloß eine Feststellung. Und bevor die vollkommen perplexe Frau etwas erwidern konnte, war ihre Tochter schon zur Tür hinausgegangen. Eilig lief das Mädchen zum Wagen ihres Freundes hinüber. Er war ausgestiegen und half ihr mit dem Koffer. Zum Dank schlang sie erneut ihre Arme um seinen Hals, schloss ihre Augen und küsste ihn.
Sie wusste nicht, ob ihre Mutter immer noch sprachlos in ihrem Zimmer stand oder schon an die Haustür gelaufen war. Es war ihr auch egal. Alles, was jetzt zählte, war ihre Liebe zu diesem Jungen. Heute würde es passieren, das spürte sie mit einem Mal genau. Seit Wochen fragte Joachim fast täglich, ob sie endlich bereit dafür wäre. Nun war sie es.
Es fühlte sich an, als wäre sie mit einem Mal erwachsen geworden.
Dienstag, 30. November, 06.59 Uhr
Die kindliche Naivität ihres jüngeren Ichs brachte Marie zum Grinsen. Joachim war keineswegs der Märchenprinz in glänzender Rüstung gewesen, den sie als unerfahrenes Mädchen in ihm gesehen hatte. Ihr einziger Gedanke war damals die Flucht vor der bösen Hexe gewesen.
Doch Märchen endeten in der Wirklichkeit nicht mit »... und wenn sie nicht gestorben sind«. Das wusste Marie inzwischen. Trotzdem verband sie mehr gute Erinnerungen mit ihrem Ex-Mann als schlechte. Die Zeit mit ihm war das aufregendste Abenteuer ihres gesamten Lebens gewesen – zumindest, wenn sie die Ereignisse der Herbstferien nicht mitzählte. Und die zählte sie nicht mit, denn der Urlaub war weniger aufregend als vielmehr furchteinflößend gewesen.
Die Monate mit Joachim hingegen … rückblickend betrachtet erschienen sie intensiv und lebendig, farbenfroh und zärtlich. Sie hatte die schwierigen Momente mit ihm nicht vergessen, doch waren ihr nur die positiven Bilder lebhaft im Gedächtnis geblieben. Sie erreichte die Haustür, öffnete sie und griff in ihrer Manteltasche nach dem Schlüssel. Marie stöhnte genervt auf, als sie bemerkte, was sie in der Wohnung liegengelassen hatte.
Daniel
Mein Blick fiel auf den Garderobenschrank, wo noch immer das Handy meiner Freundin lag. Nur ein paar Stunden zuvor hatte ich mir vorgenommen, ihr zu vertrauen. Doch die Versuchung war einfach zu groß.
Ich drückte die Taste an der Seite des Smartphones und wischte mit dem Finger über den Sperrbildschirm. Marie hatte das gleiche Handymodell wie ich, sodass ich ohne Probleme in die Anruferliste gelangte. Eine Mobilfunknummer war dort als letzter Anrufer verzeichnet. Es stand nur ein Vorname darüber, der mir sonderbar bekannt vorkam: Joachim.
Ich versuchte, mir die Ziffernfolge einzuprägen, obwohl ich nicht wusste, was ich überhaupt damit anfangen wollte.
»Joachim«, wiederholte ich in Gedanken. Ich war mir sicher, dass ich den Namen schon einmal gehört hatte.
Fieberhaft überlegte ich, wo und wann mir dieser Name bereits untergekommen war. Es dauerte ein bisschen, doch dann erinnerte ich mich. Der Name war am Tag von Maries Rückkehr nach Deutschland gefallen, während ich sie mit dem Auto vom Flughafen abgeholt hatte. Wegen eines Auffahrunfalles waren wir in den größten Verkehrsstau meines Lebens geraten. Wir hatten die Zeit genutzt, jeweils etwas mehr über den anderen zu erfahren. Ich kramte in meinem Gehirn, um mich an den Verlauf des Gesprächs zu erinnern.
Freitag, 12. November, 13.46 Uhr (3 Wochen früher)
Die Autoschlange schien endlos zu sein. Unzählige Fahrzeuge reihten sich Stoßstange an Stoßstange. Mein Autoradio lief leise im Hintergrund. Ich erinnerte mich zwar entfernt an die Nachrichtensendung mit den anschließenden Staumeldungen vor ein paar Minuten. Trotzdem hatte ich die Warnung vor dieser Verkehrsbehinderung anscheinend überhört, weil ich in das Gespräch vertieft gewesen war.
Vereinzelt wurden Autotüren geöffnet. Menschen stiegen aus ihren Autos. Das machte mir klar, dass der Stau noch eine ganze Weile andauern würde. Aussteigende Fahrer waren ein deutliches Zeichen dafür, dass eine Vollsperrung vorlag. Ich rechnete nicht damit, dass der Verkehr allzu bald wieder ins Rollen kommen würde. Mir war das egal, denn ich saß neben der Frau, die ich liebte.
Es war der erste vertraute Moment seit einer gefühlten Ewigkeit. Marie war direkt ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem wir dem Wahnsinn auf Great Blasket Island entkommen waren. Sonderlich viel Privatsphäre hatten die dortigen Besuchszeiten nicht zugelassen. Außerdem war ich schon bald, im Anschluss an die Befragungen durch die irische Polizei, nach Deutschland zurückgekehrt. Die wenigen Telefonate mit Marie waren in dieser Zeit unsere einzige Kontaktmöglichkeit gewesen.
Sie jetzt leibhaftig bei mir zu haben und mit ihr zu sprechen, war jedoch etwas völlig anderes. Es fühlte sich unwahrscheinlich gut an. Wir hatten eine Menge aufzuholen und sprachen über Gott und die Welt. Anfangs hatte Marie mich zu meiner Arbeit ausgefragt. Wo ich beschäftigt war, was genau meine Aufgaben wären und was das für Kinder seien, um die ich mich kümmerte. Geduldig hatte ich all ihre Fragen beantwortet, und irgendwie war unser Gespräch dann generell auf Eltern und schließlich explizit auf Maries Mutter gekommen. Ich hatte mich dabei an unser Gespräch im Krankenhaus in Tralee erinnert. Marie hatte erzählt, dass sie ihretwegen weggelaufen war und sogar als junges Mädchen irgendeinen Typ geheiratet hatte. Nun wollte ich es genauer wissen.
»Wie war die Gute denn so?«, fragte ich.
»Ist. Die Gute ist noch«, korrigierte sie mich. »Schwer zu sagen. Diese Frau ist schlicht und ergreifend unbeschreiblich.«
»Muss sie wohl, wenn sie dich in die Flucht geschlagen hat und du ihretwegen mit dem Erstbesten durchgebrannt bist, um ihr zu entkommen.«
»Oh ja. Mein Ex-Mann ist in vielerlei Hinsicht das exakte Gegenteil meiner Erzeugerin.«
Ihre Wortwahl weckte mein Interesse. »Jetzt will ich es aber genau wissen. Wie ist sie und wie ist er?«, bohrte ich.
Marie holte tief Luft. »Meine Mutter ist der totale Ordnungsfreak«, erklärte sie schließlich. »Jedem Ding seinen Platz und jedes Ding an seinem Platz – das ist ihr absoluter Lieblingsspruch. Zwei Wochen Hausarrest, wenn ich ein Blatt nicht ordentlich abgeheftet oder ein Spielzeug nicht sofort weggeräumt hatte.«
»Und ich vermute, dein Ex …«
»Joachim kannte Ordnung nur vom Hörensagen. Lange Haare, stets unrasiert und eine Wohnung, in der du jederzeit vom Boden essen konntest.«
Bei den letzten Worten schaute ich irritiert zu ihr hinüber. Sie schienen so gar nicht zum Inhalt ihrer Erzählung zu passen.
»Es lag genug herum«, fügte sie hinzu. Erst jetzt bemerkte ich ihr schelmisches Grinsen.
Ich musste lachen. »Aber mal ehrlich. Ist wegzulaufen und zu heiraten nicht eine etwas zu extreme Reaktion auf einen übertriebenen Ordnungssinn?«
»Das war ja beileibe nicht alles. Die Dame ist einfach eine Perfektionistin. Sie hatte meinen Beruf schon ausgewählt, als ich gerade in die Schule kam. Und niemand durfte dem im Wege stehen. Nicht einmal ich.«
»Also arbeitest du nicht gern in der Werbebranche?«
»Ich liebe die Werbebranche. Wäre es nach ihr gegangen, wäre ich Anwältin geworden.«
»Verstehe.«
Marie starrte mit einem finsteren Blick aus dem Seitenfenster. Ich spürte, dass sie keine Lust hatte, weiter über ihre Mutter zu sprechen. Ich entschied mich daher, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken.
»Und hast du noch Kontakt zu deinem Ex-Mann?«
»Ab und zu. Wir sind Freunde geblieben und versuchen, füreinander da zu sein.«
Aus irgendeinem Grund weckte die Art, wie sie die letzten Worte sagte ein Gefühl in mir, dass ich nie zuvor gespürt hatte: Eifersucht. Es kostete einiges an Kraft, die damit verbundenen Gedanken zur Seite zu schieben. Ich wollte meiner Freundin gerne vertrauen, doch es war nicht einfach, nach den Ereignissen auf dieser verfluchten Insel irgendwem zu vertrauen.
Dienstag, 30. November, 07.02 Uhr
Rückblickend erschien es mir total dämlich, dass ich damals nicht nachgefragt hatte. Jetzt bereute ich mein vertrauensseliges Verhalten. Ich war sogar versucht, die Nummer auf dem Display anzurufen. Zu gern hätte ich herausgefunden, was dieser Kerl mit der Liebe meines Lebens besprochen hatte. Ehe ich jedoch eine Entscheidung treffen konnte, hörte ich, wie ein Schlüssel von außen in das Schloss gesteckt wurde.
»Liegt mein Handy noch hier?«, rief Marie von der Eingangstür aus.
»Äh ... ja, hier«, antwortete ich und drückte rasch den Eintrag weg. Dann brachte ich das Gerät zur Tür. Ich bemühte mich darum, mir mein wachsendes Misstrauen nicht anmerken zu lassen, als ich ihr einen Abschiedskuss gab. Am liebsten hätte ich sie am Gehen gehindert und sie solange mit Fragen bombardiert, bis sie mir die Wahrheit verriet. Trotzdem schwieg ich, auch wenn es mich innerlich beinahe auffraß.
Das Schrillen des Handyweckers riss mich schließlich aus meinen Gedanken. Ich neigte dazu, morgens zu spät loszufahren und dadurch in den dicksten Berufsverkehr zu kommen. Deshalb hatte ich den Wecker so eingestellt, dass er mich an die Abfahrtszeit zur Schule erinnerte. Ich beendete den Alarm und holte meine Schuhe aus dem Schrank.
Wenige Minuten später saß ich in meinem Auto. An der großen Kreuzung blieb ich stehen, weil die Verkehrsampel Rot zeigte. Dies gab mir die Zeit, das Kabel an mein Mobiltelefon anzuschließen und mir die Hörer in die Ohren zu stecken. Ich schaffte es gerade noch, die Nummer von Herrn Lehmanns Handy aus dem Telefonbuch herauszusuchen, bevor die Ampel auf Grün schaltete und der Verkehr wieder in Bewegung kam.
»K33, Lehmann, guten Morgen«, meldete sich der Polizist.
»Hallo, Herr Lehmann. Daniel Konrad hier.«
»Oh, hallo, Herr Konrad.« Seine Stimme klang für die Uhrzeit ungewöhnlich gut gelaunt. »Wie geht es Ihnen?«
»Soweit ganz gut, danke. Ich hätte da mal ein paar Fragen an Sie«, begann ich ohne Umschweife. Wir kannten uns lange genug, um nicht um den heißen Brei herumreden zu müssen.
Die folgenden Worte des Kommissars kamen überraschend: »Ja und nein!«
»Bitte wie?«, brachte ich irritiert hervor.
»Das sind die Antworten auf Ihre Fragen, mein lieber Herr Konrad.«
»Ich verstehe nicht recht …?«
»Ja, ich weiß über die neuen Spuren im Fall der Einbrüche Bescheid. Und nein, ich kann Ihnen keine Details darüber verraten.«
»Bin ich denn schon so berechenbar geworden?«, fragte ich kleinlaut. Natürlich hatte ich mit genau diesen Antworten gerechnet – nur eben nicht so schnell.
»Das war nicht besonders schwer«, antwortete der Polizist lachend. »Im Ernst, Herr Konrad. Das sind laufende Ermittlungen. Da kann ich nicht einfach aus dem Nähkästchen plaudern.«
So leicht wollte ich mich nicht geschlagen geben. »Ich mache mir nur Sorgen, dass meine Schüler betroffen sein könnten«, erklärte ich in der Hoffnung, doch noch etwas aus ihm herauszubekommen.
»Das ist vollkommen verständlich, aber …«
»Sie könnten mir ja vielleicht wenigstens sagen, ob ich mir zu Recht Sorgen mache. Ich habe Ihnen ja auch schon oft genug Hinweise gegeben, oder?«
In der Tat bestand seit Jahren ein reger Austausch zwischen uns, der meist zum gegenseitigen Vorteil diente. Es schadete mit Sicherheit nicht, ihn an diese enge Zusammenarbeit zu erinnern.
Erneut lachte der Kommissar. »Sie lassen niemals locker, wie?« Er seufzte. »Also schön. Ihre Sorge ist nicht ganz unberechtigt, Herr Konrad. Wir haben auch einen oder zwei Schüler aus Ihrer Schule im Blick.«
»Punks, nehme ich an?« Ein längeres Rauschen in der Leitung machte mehr als deutlich, dass der Polizist die Vermutung nicht kommentieren wollte. »Ich meine wegen des ACAB-Schriftzugs?«
Herr Lehmann schwieg weiterhin. Ich hatte den Eindruck, als ringe er mit seinem Gewissen, ob er antworten sollte oder nicht. Schließlich gab er einen zögerlichen Laut von sich, den man als Zustimmung werten konnte. »Ich muss mich aber wirklich darauf verlassen, dass das unter uns bleibt. Haben Sie mich verstanden?«
»Ja natürlich«, versicherte ich feierlich. »Ich würde doch nie im Leben so etwas weitererzählen.«
»Dann ist es ja gut.«
Ich beeilte mich mit der nächsten Frage. »Haben Sie denn Rickys Eltern schon kontaktiert?«
»Ja, aber die sind anscheinend nicht in der Stadt.« Erst, nachdem es raus war bemerkte mein Gesprächspartner, was er gerade gesagt hatte und gab einen Fluch von sich, der eines Polizisten nicht würdig war. Ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen.
»Ich sollte Sie verhaften, Herr Konrad!«
»Lebend kriegst du mich nie, Bulle!«, antwortete ich schmunzelnd.
Kapitel 3
Dienstag, 30. November, 07.36 Uhr
Ich drückte den Netzschalter meines Computers. Es war ein fester Teil meines morgendlichen Rituals in der Schule: Allen einen guten Morgen wünschen, ins Fach greifen, um aktuelle Post herauszuholen, und dann sofort den Rechner einschalten. Dieses Gerät fuhr so langsam hoch, dass man schon frühzeitig den Knopf benutzen musste, wenn man am Vormittag noch daran arbeiten wollte.
Während es erste Lebenszeichen von sich gab, blätterte ich die Papiere durch, die ich in meinem Ablagefach gefunden hatte. Ich überflog die Aktennotizen über das Fehlverhalten verschiedener Kinder, war aber mit meinen Gedanken gar nicht bei der Sache. Nach wie vor ging mir das Telefonat mit Herrn Lehmann durch den Kopf. Nur allzu gern hätte ich ihm gesagt, dass er mit dem Verdacht gegen Ricky auf dem Holzweg war.
Leider hielt ich eine Beteiligung meines Beratungsschülers an den Einbrüchen für sehr wahrscheinlich – nicht ohne Grund war ich ebenfalls auf seinen Namen gekommen. Es passte alles zusammen, und ich hätte vermutlich viel früher hellhörig werden müssen. Den auffälligsten Hinweis hatte ich anderthalb Wochen vor den Herbstferien selbst miterlebt.
Mittwoch, 06. Oktober, 09.41 Uhr (8 Wochen früher)
»Herr Burkhard sagt, Sie sollen bitte raus ans Fußballfeld kommen!«, rief der übergewichtige Junge.
Hörbar schnappte der Kleine nach Luft. Sein Gesicht war knallrot angelaufen, und Schweißperlen liefen ihm über die Stirn. Er war offenbar so schnell zu meinem Büro gerannt, wie seine Beine es zugelassen hatten.
»Was ist denn passiert?«, fragte ich und setzte mich in Bewegung.
Der Schüler versuchte, mitzuhalten. »Irgend so ein Typ macht wohl Stress!«, keuchte er, während der Abstand zwischen uns immer größer wurde.
Ich durchquerte die Pausenhalle im Laufschritt und erreichte die Außentür. Schon von Weitem konnte ich den Sportlehrer in der Nähe des Fußballplatzes erkennen. Er redete mit einem hochgewachsenen, blonden Jugendlichen, den er wütend anstarrte.
»Du verlässt jetzt sofort das Schulgelände!«, schrie er.
Sein Gegenüber war wenig beeindruckt.
»Pass lieber auf deinen Blutdruck auf, Alter!«, erwiderte er, ohne mit der Wimper zu zucken. »Du hast mir gar nichts zu sagen.«
»So eine Unverschämtheit …«
Ich verlangsamte meinen Schritt. Hinter Herrn Burkhard stand Ricky mit einem besorgten Gesicht. Der Lehrer hatte ihn am Kragen gepackt, mit der anderen Hand fuchtelte er aufgeregt herum. »Das werden wir ja sehen. Wenn ich mit der Schulleitung spreche, bekommst du hier Hausverbot! Und beim nächsten Mal rufen wir einfach die Polizei!«
»Guten Morgen«, sagte ich freundlich und bemühte mich um einen unbekümmerten Gesichtsausdruck. »Darf ich fragen, was hier los ist?«
Niemand schien mich zu beachten.
»Na und? Dann komme ich halt nicht mehr her.« Der Halbstarke näherte sich meinem Kollegen, sodass ihre Nasen nur noch Millimeter voneinander entfernt waren. »Aber ich weiß, wo du wohnst, alter Mann! Vielleicht komme ich mal rüber.«
»Soll mir deine Drohung Angst machen?«
»Keine Ahnung! Hast du schon Angst?«
»Okay, Leute! Bevor ihr euch jetzt mit spitzen Stöcken und Keulen bekämpft«, schlug ich vor, »gehen wir doch lieber in die Höhle und besprechen das am Lagerfeuer wie vernünftige Neandertaler.«
Zwei fassungslose Blicke trafen mich. Endlich hatte ich die volle Aufmerksamkeit der Streitenden. Erst in diesem Moment erkannte ich den Jugendlichen. Es war Benjamin Wagner, Nancys Bruder. Er hatte vor ungefähr fünf Jahren die Schule verlassen. Während Herrn Burkhards Miene vollkommen humorlos blieb, war Benjamin offensichtlich damit beschäftigt, nicht zu lachen.
»Hallo, Herr Konrad«, sagte er schließlich.
»Hallo, Benjamin«, antwortete ich. Dabei grinste ich ihn breit an, denn nichts entspannte eine explosive Situation so gut wie Humor.
Als er mein Grinsen sah, konnte auch er sich nicht länger beherrschen.
»Spitze Stöcke und Keulen?«, fragte er schmunzelnd.
»Na, wenn wir uns schon wie Höhlenmenschen benehmen, dann bitte schön richtig«, erwiderte ich.
Nun wandte ich mich dem Kollegen zu. »Was ist hier eigentlich passiert?«
»Ich kam dazwischen, als die zwei sich schlagen wollten«, erklärte der Sportlehrer. Er schaute zu Ricky, als bemerke er erst jetzt, dass er ihn noch immer festhielt. »Ich musste sie auseinanderhalten, um Schlimmeres zu verhindern.«
»Ich denke jedoch, dass im Augenblick keine Gefahr mehr droht, oder?« Zuerst sah ich den Schüler eindringlich an, der schuldbewusst seinen Kopf schüttelte. Erst danach wanderte mein Blick zu Benjamin. Auch der versicherte mir mit einem Kopfschütteln, dass er sich zusammenreißen würde. Beide Jugendliche kannten mich lange genug, um ihr Versprechen einzuhalten.
»Sie können den Jungen jetzt loslassen.«
Nur widerwillig folgte der Lehrer meiner Aufforderung. Er gehörte nicht unbedingt zu jenen, die es verstanden, einen Konflikt mit Worten zu klären. Er schien dem neu entstandenen Frieden nicht zu trauen.
»Worum ging es bei eurem Streit eigentlich?«, fragte ich Ricky.
»Ist doch egal«, brummte der und vermied es, mir direkt in die Augen zu schauen.
»Mir ist das aber nicht egal«, erwiderte ich.
»Es ging mit Sicherheit um Drogen!«, rief Herr Burkhard. »Ich habe nur einen Teil ihres Gesprächs mitbekommen. Der Kleine hier hat gesagt, er wolle irgendetwas nicht machen. Darauf hat dieser Schlägertyp ihm geantwortet, er wüsste ja wohl auch, was dann passierte.«
»Pass bloß auf, wie du über mich sprichst«, drohte Benjamin. Ich trat einen Schritt nach vorn, sodass ich genau zwischen ihm und meinem Kollegen stand. Dadurch verhinderte ich weiteren Blickkontakt.
»Was wollte er nicht machen?«, erkundigte ich mich.
»Das ist eine Sache zwischen ihm und mir. Aber mit Drogen hab ich nix zu tun! Sie können mich gerne durchsuchen, wenn Sie wollen!«
»Ich glaube dir«, antwortete ich nach einem flüchtigen Blick in seine Augen. Nun richtete ich mich auf, um meinen folgenden Worten Nachdruck zu verleihen. »Trotzdem geht es natürlich nicht, dass du herkommst und unsere Schüler bedrohst. Und das weißt du eigentlich auch, oder?«
Meine Ermahnung hatte Erfolg. Von einem Moment auf den anderen war Benjamin wieder der kleine Junge, den ich vor Jahren kennengelernt hatte.
»Ja, ich weiß«, sagte er schuldbewusst. »Es kommt nicht noch mal vor, versprochen.«
Daraufhin drehte er sich um und verließ eilig das Schulgelände.
Ich wandte mich Ricky zu. »Was hat er von dir verlangt?«, fragte ich eindringlich. »Solltest du ihm irgendwas geben?«
»Das war echt alles total harmlos«, versicherte er. Sein Gesichtsausdruck ließ keinen Zweifel aufkommen, dass ihm die Angelegenheit peinlich war. »Der Einzige, der hier gewalttätig geworden ist, war Herr Burkhard.«
»Du hältst jetzt deinen Mund, junger Mann. In diesem Ton lasse ich nicht mit mir sprechen«, ermahnte der Kollege ernst. Von Weitem hörten wir den Schulgong, der die nächste Stunde einläutete. Ich war sehr dankbar für das nahende Ende des Konflikts.
»Ich denke auch, für einen Tag hatten wir genug Stress«, sagte ich rasch. »Wenn du dich noch entschließt, etwas zu dem Streit sagen zu wollen, dann weißt du ja, wo mein Büro ist.«
Ricky nickte knapp und rannte so schnell weg, als wäre der Teufel hinter ihm her.
Dienstag, 30. November, 07.52 Uhr
Natürlich hätte ich an diesem Morgen mehr Druck auf Ricky ausüben können, um herauszufinden, worüber er sich mit Benjamin gestritten hatte. Rückblickend bereute ich, nicht hartnäckiger gewesen zu sein. Doch ich konnte mir meine Nachlässigkeit leicht verzeihen, weil ich damals nicht über das Wissen verfügte, das ich jetzt hatte. Nie im Leben hätte ich bei den unzusammenhängenden Gesprächsfetzen, die Herr Burkhard aufgeschnappt hatte, an die Einbruchsserie gedacht. Nun aber fügte sich der Vorfall hervorragend in das Gesamtbild. Hatte mein Schüler nicht weiter mitmachen wollen und war von Benjamin gezwungen worden? Ich musste der Sache auf den Grund gehen.
Das Klingeln des Telefons riss mich aus meinen Gedanken. Bevor ich zum Hörer griff, nahm ich mir fest vor, heute noch mit Ricky zu sprechen und nach Unterrichtsende vielleicht auch Familie Wagner einen Besuch abzustatten. Ein Blick auf das Display der Telefonanlage verriet mir, dass die Anruferin meine Chefin war. Die breite Streuung der Beratungslehrkräfte an die einzelnen Schulen des Kreises machte den Austausch über das Telefon wichtiger denn je.
»Konrad?«, sagte ich.
»Ja, und hier ist Claudia Brehm. Haben Sie einen Moment Zeit, Herr Konrad?«
»Klar, worum geht es?«, antwortete ich und kramte in der Schublade meines Schreibtisches nach einem Stift, falls ich mir etwas notieren müsste.
»Wie Sie wissen, bekommen wir immer in den Wochen nach den Herbstferien neue Referendare«, erklärte Frau Brehm. »Und die sollen ja möglichst auch in die Beratungsarbeit reinschnuppern.«
»Und da haben Sie beschlossen, dass ich mal wieder dran bin, beschnuppert zu werden?«
»So in etwa.« Sie lachte. »Bei mir im Büro sitzt ein vielversprechender junger Mann, der sich sehr für die emotionale und soziale Entwicklung von Kindern interessiert. Wäre es in Ordnung, dass ich ihn mal vorbeischicke?«
»Das können Sie tun.« Unmittelbar, nachdem ich den Satz gesagt hatte fiel mir siedend heiß ein, dass der heutige Tag ganz anders verplant war. »Aber bitte erst morgen, wenn das okay ist«, ergänzte ich daher. Das Zögern meiner Vorgesetzten machte klar, dass ich ihre Planung durcheinanderwarf. Ihr Schweigen zwang mich zu einer weiteren Erklärung. »Ich habe heute auch Termine außerhalb.«
»Einen Augenblick«, sagte Frau Brehm. »Herr Keller, wir müssen Ihren Hospitationsplan etwas abändern.« Diese Worte konnte ich noch verstehen, ehe die Stimmen dumpf und unverständlich wurden. Offenbar hielt sie mit der Hand die Sprechmuschel zu. Eine Minute später wurde die Verbindung wieder deutlich. »Hören Sie? Wir machen es wie besprochen. Der Referendar meldet sich morgen gegen halb elf bei Ihnen im Büro. Sein Name ist Manuel Keller.«
»In Ordnung«, antwortete ich. »Auf Wiederhören.«
Ich beendete das Gespräch und schrieb den Namen auf eine Haftnotiz, bevor ich ihn vergessen konnte. Den kleinen gelben Zettel klebte ich an meinen Monitor. Bei der Gelegenheit setzte ich an, das Passwort in den Computer einzugeben, doch ich kam nicht dazu. Es klopfte ein paarmal heftig an der Tür.
»Ja, bitte!«, rief ich. Nichts geschah. So hellhörig die Wände in meiner Schule auch waren, die Tür schirmte den Schall sehr gut ab. Ich hatte keine andere Wahl, als zu brüllen: »Herein!«
Die Tür wurde geöffnet. Ricky steckte seinen kahlrasierten Kopf, auf dem sich bloß noch ein schmaler Streifen roter Haare befand, in mein Arbeitszimmer.
»Kann ich Sie kurz sprechen?«, fragte er. »Herr Burkhard hat gesagt, es ist okay, wenn ich im Sportunterricht fehle.«
Ich nickte. »Das war Gedankenübertragung. Ich wollte mich sowieso mit dir unterhalten.«
Sofort stand ihm das schlechte Gewissen ins Gesicht geschrieben. »Hab ich was angestellt?«, erkundigte er sich unsicher.
»Das weiß ich nicht«, antwortete ich wahrheitsgemäß. Ich verließ meinen Bürostuhl, um mich zu dem Schüler an den Besprechungstisch zu setzen. »Aber warum wolltest du denn mit mir reden?«
»Ich wollte fragen, ob Sie was von Nance gehört haben?«
»Nein, bis jetzt nicht. Ich hatte vor, nachher mal ins Krankenhaus gehen.«
»Darf ich mitkommen?« Der Satz kam wie aus der Pistole geschossen.
»Ich würde dich gern mitnehmen. Aber ich glaube, du schreibst heute eine Mathearbeit, oder?«
»Ja, leider«, gestand Ricky widerwillig ein.
Ich hatte ein wenig Mitleid mit ihm. Mathematikarbeiten waren auch für mich immer das Schlimmste an der Schule gewesen.
»Du kannst sie ja nach dem Unterricht besuchen«, sagte ich aufmunternd.
Er nickte zögernd. »Ja, mal schauen. Ich muss eigentlich noch ... ach, egal!« Unsicher schaute er zu mir, als wollte er prüfen, ob ich auch nicht seine Gedanken gelesen hatte. »Und worüber wollten Sie mit mir sprechen?«
Ich hatte mir bisher keinen Plan zurechtgelegt, wie ich das heikle Thema ansprechen sollte, also musste ich improvisieren. »Ich hatte vorhin ein Telefonat«, begann ich und machte eine kurze Pause, um die richtigen Worte zu finden.
Dies schien Ricky zu lange zu dauern. »Aha … mit wem?«
»Mit Herrn Lehmann.«
»Sie meinen den Bullen, nicht?«
»Ja, ich meine den Polizisten.« Es war gut zu erkennen, dass der Blutdruck des Jungen in die Höhe schoss. Ich bemühte mich daher, ruhig und sachlich fortzufahren. »Wir haben über die Einbruchserie gesprochen, die momentan alle in der Stadt beunruhigt.«
»Und was wollen Sie da von mir?« Blick, Haltung und Stimme – der Jugendliche hätte sich auch gleich ein Schild mit der Aufschrift »Ich fühle mich ertappt« um den Hals hängen können. »Ich bin bestimmt nirgendwo eingebrochen!«, rief er.
Ich entschloss mich, ihn ein wenig in Sicherheit zu wiegen. »Das behauptet auch niemand. Ich habe mich nur gefragt, ob du irgendetwas gehört hast. Wird in der Schule über die Einbrüche geredet?«
»Klar, Herr Konrad«, sagte Ricky mit unüberhörbarem Misstrauen. »Sie telefonieren mit einem Bullen und fragen dann nur mal nach, was so gequatscht wird. Halten Sie mich für blöd?«
Ich musste mir eingestehen, dass ich den Jungen unterschätzt hatte.
»Ich halte dich nicht für blöd«, antwortete ich zögernd.
»Nur für einen Einbrecher, was?« Der Schüler war aufgesprungen. Er schaute mich finster an. Ich machte eine beruhigende Geste, obwohl ich ahnte, dass es nicht viel bringen würde.
»Nein, ich wollte doch nur …«
»Sie sind genau wie alle anderen!«, schrie er und rannte aus meinem Arbeitszimmer. Einen Moment lang überlegte ich, ob ich ihm nachlaufen sollte, entschied mich aber dagegen. Es war vermutlich besser, mit Ricky zu sprechen, wenn er sich beruhigt hatte. Ich hielt es ohnehin für unwahrscheinlich, dass ich ihn jetzt einholen würde, geschweige denn, dass er nach einer Verfolgungsjagd noch freiwillig mit mir sprechen würde. Außerdem hatte das Gespräch meine Befürchtungen bestätigt. Von der allerersten Reaktion bis hin zu diesem etwas unpassenden Wutausbruch deutete alles darauf hin, dass er in die Einbrüche verwickelt war.
Ich ging zum Fenster, weil ich sicherstellen wollte, dass er nicht das Schulgelände verließ. Ich schob die Jalousie zur Seite und ließ meinen Blick über den Schulhof schweifen. In der Nähe der Türen stand er mit einigen weiteren Schülern, die eigentlich im Unterricht sein sollten. Leise kippte ich das Fenster und lauschte angestrengt, was in der Gruppe besprochen wurde. Ein kräftiger Junge schaute Ricky vorwurfsvoll an.
»Und was hast du ihm erzählt?«, fragte er mit ungewöhnlich tiefer und rauer Stimme.
»Nix, ich schwör!«
»Psst, seid still«, sagte ein anderer, nachdem er mich entdeckt hatte.
Eilig rannten die Jungen weg, wobei der Stärkste von ihnen Ricky am Arm festhielt. Ich seufzte. In was für Schwierigkeiten war er da hineingeraten? Konnte ich ihm jetzt noch helfen? Oder hatte ich sein Vertrauen für immer verloren? Diese Vorstellung betrübte mich, denn ich musste mir eingestehen, dass mir wirklich etwas an dem verrückten Kerl lag.
Der Gong zur nächsten Stunde beendete meine Gedanken. Es war an der Zeit, mich wieder meiner Arbeit zu widmen. Ich hatte einige Termine für diesen Morgen vereinbart. Das kam mir nicht ungelegen, weil ich dadurch nicht in Versuchung kam, über das verpatzte Gespräch nachzugrübeln.
Dienstag, 30. November, 12.10 Uhr
Zwei Klärungsgespräche wegen irgendwelcher Schlägereien, eine Hospitationsstunde im Fach Mathematik, ein spontanes Elterngespräch und ein Konzentrationstraining später lief ich durch den Flur im dritten Stock des städtischen Krankenhauses. Es lag in der gleichen Straße wie meine Beratungsschule, sodass ich mein Auto auf dem Lehrerparkplatz stehengelassen und einen kleinen Spaziergang gemacht hatte.
Mit jedem Schritt war dabei ein mulmiges Gefühl in mir aufgestiegen. In dieser Klinik hatte Alexandra gearbeitet. Das eine oder andere Mal hatte sie mich in der Vergangenheit angerufen, wenn es Ärger mit Marc gab. Dann war ich meistens in ihrer Mittagspause hinübergelaufen, hatte mit ihr einen Kaffee getrunken und über die Probleme gequatscht. Fast erwartete ich, dass sie plötzlich um die nächste Ecke biegen und mich mit ihrem gewinnenden Lächeln anstrahlen würde. Doch ich wusste, dass das nicht geschehen konnte.
Der Gedanke, sie niemals wiederzusehen, stimmte mich unsagbar traurig. Eine ganze Flut von Erinnerungen brach über mich herein. Ich bemühte mich, schneller zu laufen. Es fühlte sich beinahe an, als wäre ich auf der Flucht. So erreichte ich das Krankenzimmer meiner Schülerin, bevor mich meine Empfindungen übermannen konnten. Ich holte tief Luft und trat in das Zimmer.
Nancy schlief. Sie wachte nicht einmal von dem Lärm auf, den die zufallende Zimmertür machte. So stand ich einen Moment lang an ihrem Krankenbett und starrte in ihr kreidebleiches Gesicht. Sie atmete – das war die Hauptsache. Ansonsten sah sie genauso blass und schwach aus wie am Vortag, als der Krankenwagen sie abgeholt hatte. Sofort schwirrten mir dieselben Fragen durch den Kopf, die mich zu der Hütte im Wald begleitet hatten.
Wieso war sie abgehauen? Hatte ich irgendetwas übersehen? Hätte ich es vielleicht sogar verhindern können? Ich hatte mich stets für meine Schülerinnen und Schüler eingesetzt. Die bloße Möglichkeit, dass dieses Kind in einem Krankenhaus lag, weil mir etwas entgangen war, erschien mir unerträglich. Ich musste herausfinden, was passiert war und räusperte mich. Endlich öffnete sie die Augen und schaute mich schlaftrunken an.
»Oh!«, rief sie verlegen und versuchte sich aufzusetzen. Ihre Decke zog sie verstohlen bis ans Kinn hoch. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man einen Lehrer trifft, während man im Bett liegt. »Herr Konrad, was machen Sie denn hier?«
»Ich wollte schauen, wie es dir geht«, sagte ich.
Sie antwortete nicht, wodurch eine unangenehme Pause entstand. Offensichtlich war Nancy noch immer mit der Situation überfordert. Also wiederholte ich die Frage deutlicher betont.
»Und, wie geht es dir?«
Sie lächelte. »Viel besser. Mir ist nur noch ein bisschen schlecht.«
»Wir waren alle ziemlich besorgt um dich«, begann ich ein Gespräch über ihr Verschwinden.
»Ich wollte niemandem Angst machen«, murmelte sie kleinlaut.
»Das bleibt halt nicht aus, wenn man einfach so abhaut.«
Das Mädchen zuckte mit den Schultern. »Ich weiß, aber ich wusste
nicht …«
Sie unterbrach sich mitten im Satz, schaute mich unsicher an. Schließlich wendete sie ihren Blick von mir ab. Ich konnte erkennen, dass sie nicht vorhatte, weiterzusprechen.
»Was wusstest du nicht?«, fragte ich daher.
»Ist doch egal.«
»Ich glaube nicht. Wie ich dir schon sagte, ich würde dir gerne helfen.«
»Sie können aber gar nix für mich tun«, erwiderte sie. »Ich muss das alleine regeln.«
»Trotzdem wüsste ich gern, weshalb du weggelaufen bist.« Ich zögerte, bevor ich die nächsten Worte aussprach. »Wegen deines Vaters?«
Mir war sofort klar, dass es ein Fehler gewesen war, dieses Thema anzusprechen. Es war jedoch nicht mehr möglich, es ungeschehen zu machen.
»Nein!«, brach es aus dem Mädchen heraus. Wut glomm in ihren Augen. »Da ist überhaupt nichts mit meinem Vater! Ich dachte, Sie hätten das begriffen.«
Nancy sagte die Wahrheit, soweit ich das beurteilen konnte. Benjamin kam mir in den Sinn. Möglicherweise hatte er etwas mit ihrem Verschwinden zu tun. »Gab es vielleicht Stress mit deinem Bruder?«, fragte ich daher.
»Wieso fragen mich alle ständig nach meinem Bruder? Klar, er müsste ab und zu seine Klappe halten, aber so schlimm ist er gar nicht. Benni ist eigentlich ein toller Kerl.«
»Aber weshalb bist du dann weggelaufen?«
»Ist doch egal. Ich wusste nicht mehr weiter, da bin ich halt einfach durchgedreht. Es kommt nie wieder vor«, erwiderte sie knapp und drehte ihren Kopf zu Seite.
»Ich bin müde. Würden Sie mich bitte allein lassen?«
In Windeseile versuchte ich, meine Möglichkeiten abzuwägen. Meine innere Stimme drängte mich, nicht aufzuhören. Zu gern hätte ich die Antwort erfahren. Ich wusste jedoch, dass es dabei um meine eigene Befindlichkeit ging und nicht um das Wohlergehen des Mädchens. Ich kann einfach schlecht mit Geheimnissen leben. Ich ahnte, dass es überflüssig war, weiter nachzubohren. Damit würde ich Nancy total verschrecken, ähnlich wie Ricky in meinem ersten gescheiterten Gespräch dieses Tages. Außerdem war ich nicht in der Verantwortung, handeln zu müssen, schließlich war sie im Krankenhaus und nicht in der Schule. Ich konnte der Sache ruhigen Gewissens Zeit geben. Trotzdem musste ich klarstellen, dass ich weiterhin bereit war, ihr zu helfen.
»Na gut, ich gehe jetzt. Aber eins muss ich dir unbedingt noch sagen.« Ich sprach erst weiter, als sie zu mir hochschaute. »Was immer das Problem ist, es wird nicht von alleine verschwinden. Such dir eine Vertrauensperson zum Reden. Egal, ob ich das bin oder ein anderer.«
Das Kind war kurz davor, zu weinen. Meine Worte hatten ihr Ziel erreicht. Irgendetwas lastete schwer auf ihr, doch sie wusste nicht, wie sie es ansprechen sollte. Ich wartete noch einen Augenblick. Es gelang ihr jedoch nicht, sich dazu durchzuringen, etwas preiszugeben.
»Gute Besserung«, sagte ich und ging zur Tür hinaus.
Während ich den menschenleeren Flur entlangschritt, dachte ich darüber nach, was zur Hölle ich übersehen hatte.
»Na los«, befahl ich mir. »Tu, was du am besten kannst.«
Meine Gedanken rasten dahin. Hier und da versuchten sie, in den Erinnerungen der letzten Tage einzuhaken. Es war aussichtslos, irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen zu wollen. Es fehlte mir mindestens eine wichtige Information, um Nancys Verhalten verstehen zu können.
»Daniel?«, rief eine Stimme aus dem Schwersternzimmer, als ich daran vorbeilief. »Daniel Konrad?«
Irritiert schaute ich zu der Krankenschwester hinüber, die mich begeistert anstrahlte. Sie war etwa einen Kopf kleiner als ich, hatte schulterlange braune Haare und war für ihre Größe ein bisschen zu kräftig. Es brauchte einen Moment, bis ich sie erkannte und noch länger, bis mir der Name einfiel.
»Janina, nicht wahr?«, fragte ich unsicher.
Sie nickte. Es war eine Arbeitskollegin von Alexandra, die ich vor Jahren auf einer Geburtstagsfeier kennengelernt hatte. Schon damals war mir ihr übertriebener Gebrauch von Make-up aufgefallen, doch hier im Krankenhaus wirkte es absolut fehl am Platz.
»Ist ja eine Ewigkeit her«, sagte sie. »Was treibst du denn hier?«
»Ihr habt eine Schülerin von mir auf der Nachbarstation.«
»Ach so?« Verwirrt schaute sie den Gang hinunter. »Ich dachte, du arbeitest mit Behinderten oder so? Alexandra hat mal so was erzählt.«
Ich sah keinen Sinn darin, den kompletten Wandel meines Berufsbildes in einem kurzen Flurgespräch zu erläutern.
»Das ist lange her«, antwortete ich deshalb knapp.
»Dann bist du bestimmt wegen der Kleinen hier, die im Wald geschlafen hat?«
Ich nickte. »Kannst du mir was über ihren Zustand sagen?«
»Sie hatte Glück, dass man sie rechtzeitig gefunden hat«, erklärte Janina jetzt. »Es geht ihr schon viel besser – wir behalten sie nur noch zur Beobachtung hier.«
Ich kehrte mit meinen Gedanken zu Nancy zurück und versuchte erneut, das Geheimnis ihres Weglaufens zu lüften. Die Krankenschwester wertete mein Schweigen offenbar als Besorgnis.
»Mach dir keine Sorgen. Das Mädchen ist in den besten Händen. Der Chefarzt Doktor Berger kümmert sich persönlich um sie.«
Ich verspürte den Drang, das Thema zu wechseln.
»Und«, sagte ich daher schnell, »wie geht es dir sonst so?«
»Ach … Ich bin immer noch total traurig. Du weißt schon, weil Alexandra tot ist und so. Jedes Mal, wenn ich an meinen Spind gehe, sehe ich ihr Lächeln auf unserem letzten gemeinsamen Foto. Dann ist es wieder, als hätte ich gestern erst von ihrem Tod erfahren. Wie kommst du damit zurecht?«
»Ach, ich schaffe es irgendwie«, gab ich knapp zurück, denn dabei ging es um Gefühle, die ich nicht mit einer flüchtigen Bekanntschaft besprechen wollte. »Ist dieses Foto, das du erwähnt hast, ein neueres?«
Sie nickte. »Ja, wir haben es am Tag vor Alexandras Urlaub aufgenommen. Warum fragst du?«
»Ich habe versucht, ein schönes Bild von ihr zu finden. Aber sie war ziemlich kamerascheu. Denkst du, du kannst mir einen Abzug besorgen?«
»Klar kann ich das.« Es entstand eine kurze Pause. »Um ehrlich zu sein, weckt es auch immer ein paar Schuldgefühle in mir.«
»Wieso das?«
»Na ja, wir haben uns direkt nach der Aufnahme ganz schön heftig gestritten.«
»Man konnte sich mit Alexandra streiten?« Ich tat so, als hörte ich zum ersten Mal von dem Streit, obwohl das nicht stimmte. Tatsächlich hatte ich am Morgen unseres Abflugs zu den Blasket Islands mit Alexandra darüber gesprochen, jedoch nie erfahren, was wirklich vorgefallen war.
»Worum ging es denn?«
»So ganz genau weiß ich das selbst nicht mehr«, antwortete sie und zuckte mit der Schulter.
»Es war einfach ein total stressiger Tag gewesen. Alex und ich sind nach der Arbeit was trinken gegangen, um wieder runterzukommen. Ein Wort ergab das andere, und sie hat dann …«
Janina unterbrach ihren Erzählfluss jäh. Mit einem Anflug von Scham schüttelte sie den Kopf. Es war ihr sichtlich unangenehm, über den Kern der damaligen Ereignisse zu sprechen.
»Ist ja auch egal. Ich besorge dir gerne einen Abzug des Bildes.« In Gedanken schien sie noch immer die Auseinandersetzung mit ihrer Kollegin durchzugehen.
»Wenn es dich tröstet«, sagte ich deshalb und bemühte mich um eine aufmunternde Stimme. Ich musste ernsthaft überlegen, was ich ihr Tröstendes sagen konnte. »Alexandra hat auf der Reise nichts von einem Streit erwähnt. Anscheinend ist es für sie kein Drama gewesen.«
»Danke dir.« Janina lächelte verlegen. »Tja… ich muss dann auch mal los. Ich habe gleich Dienstschluss.« Sie begleitete ihre Worte mit einer ausladenden Geste in Richtung des Schwesternzimmers. »War aber nett, dich wiederzusehen. Vielleicht schaust du ja irgendwann noch mal rein?«
»Ganz bestimmt«, antwortete ich. »Ich bin wirklich sehr an einem Abzug des Fotos interessiert.«
Sie nickte. »Ich kümmere mich noch heute darum.«
Marie
Marie stellte ihren Wagen am äußersten Rand des Parkplatzes, unmittelbar hinter einem Gebüsch, ab. Es gefiel ihr überhaupt nicht, sich ausgerechnet an diesem Ort mit Joachim zu treffen. Sie stieg aus, wobei sie ihren Blick über die Autoreihen schweifen ließ. Dann schloss sie die Fahrertür und verriegelte sie mit der Fernbedienung. Zügig ging sie zu dem anderen Auto hinüber, schaute sich dabei mehrfach unsicher um und fühlte sich beinahe wie eine Schwerverbrecherin. Ihre Vorsicht war nicht bloß Paranoia, das wusste sie genau. Es war schwer, irgendetwas vor Daniel zu verheimlichen.
Zu gut erinnerte sie sich an den ersten gemeinsamen Abend in ihrer Wohnung.
Freitag, 19. November, 20.10 Uhr (2 Wochen früher)
Es klingelte an der Haustür. Marie kontrollierte noch einmal im Spiegel, ob ihre Haare richtig lagen. Unwillkürlich wanderte ihre Hand zu der Narbe am Hinterkopf. Die Wunde war gut verheilt und nur noch ganz selten erinnerten leichte Kopfschmerzen an die schwere Gehirnerschütterung. Marie verdrängte die damit verbundenen Erinnerungen und ging zur Tür hinüber.
»Bin ich zu spät?«, fragte Daniel. Er trug ein legeres Hemd zu einer schwarzen Jeans und darüber einen langen dunklen Mantel. Marie fand, dass er umwerfend aussah.
»Nein, nein«, sagte sie. »Ich bin gerade erst mit dem Essen fertig geworden. Komm doch rein.«
»Gern«, antwortete er und trat sich die Füße ab. Neugierig ließ er seinen Blick durch den Hausflur schweifen.
»Wenn du ablegen möchtest?«, bot Marie mit einer Handbewegung in Richtung der Garderobe an. Sie überlegte, warum zur Hölle sie so nervös war. Dann wurde ihr klar, dass dies streng genommen ihr erstes Date war. Ihre Beziehung hatte unter ungewöhnlichen Umständen auf einer einsamen Insel im Atlantik begonnen. Zeit für den üblichen Kennenlernprozess war ihnen nicht geblieben.
Dennoch liebte sie Daniel und hoffte, dass ihre Liebe auch im wirklichen Leben funktionieren konnte.
Selbst, wenn er die ganze Wahrheit über mich erfährt. Sie verdrängte diesen Gedanken rasch wieder. Heute war definitiv nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen.
»Geh doch schon mal ins Wohnzimmer und mach den Wein auf«, sagte sie nun. »Ich muss schnell mal nach dem Fleisch schauen.«
»Wie?«, fragte ihr Freund enttäuscht. »Gibt es keine serbische Bohnensuppe?«
»Wollte ich dir zuerst vorsetzen. Aber ich hatte keine Dose mehr im Schrank«, antwortete sie schmunzelnd. Mit diesen Worten verschwand sie in der Küche.
»Verdammt!«, rief sie, als sie den Qualm sah, der aus der Pfanne hervorquoll. Panisch wendete sie das Steak und verbrannte sich dabei die linke Hand am Pfannenstiel. Das Fleisch war dunkel, aber glücklicherweise noch genießbar.
Gott sei Dank, dachte sie und griff nach der Servierplatte.
Daniel hatte die Weinfalsche bereits geöffnet und auf den Tisch gestellt. Als sie das Wohnzimmer betrat, stand er mit den Händen in den Taschen vor der halbhohen Kommode und betrachtete die Fotos, die dort aufgereiht waren. Ihr Herz setzte vor Schreck einen Schlag aus.
Alles gut, beruhigte sie sich selbst. Das Bild ist in der Schublade verstaut, und da hat er bestimmt nicht hineingeguckt.
»Essen ist fertig«, sagte sie lächelnd. Ihr Freund bemerkte erst jetzt, dass sie im Zimmer war.
»Interessante Familienbilder«, kommentierte er sein offensichtliches Interesse. »Du kannst deine Mutter echt nicht leiden, wie?«
»Äh, ja«, antwortete sie und schaute irritiert zu den Fotografien. Auf mehreren davon war Marie auch mit ihrer Mutter abgebildet, und sie lächelte auf all diesen Bildern. Sie konnte sich nicht erklären, wie Daniel da eine Abneigung erkannt haben wollte.
»Wie kommst du darauf?«, fragte sie, obwohl sie eigentlich gar nicht über ihre Mutter sprechen wollte.
»Verschränkte Arme«, erklärte er. »Jedes Mal, wenn sie neben dir steht.«
Tatsächlich hatte sie auf allen Bildern, auf denen ihre Mutter zu sehen war, die Arme vor der Brust verschränkt, was trotz ihres Lächelns ein bisschen nach schmollendem Kind aussah. Sie musste grinsen.
»Du hast recht«, stimmte sie überrascht zu. »Das ist mir so noch nie aufgefallen.«
»Ist dir das fehlende Bild beim Aufräumen runtergefallen?«
Ihr wurde zeitgleich heiß und kalt. Marie hatte Daniels Kombinationsgabe schon häufig bewundert. Heute fürchtete sie diese zum ersten Mal. Sie räusperte sich.
»Wie... Wieso fragst du?«
Er bemerkte ihre Verunsicherung und trat demonstrativ einen Schritt vom Schrank weg.
»Entschuldigung«, sagte er dabei lächelnd. »Ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen.«
»Nein, im Ernst. Wie kommst du darauf, dass da ein Bild fehlt?«, fragte sie, bereute jedoch sofort, seine Steilvorlage für einen Themenwechsel nicht angenommen zu haben.
»Ist doch ganz egal«, antwortete er und ging zum Esstisch hinüber. Er warf einen Blick auf den Fleischteller in ihrer Hand. »Das sieht wirklich lecker aus.«
Das gespielte Desinteresse sollte sie vermutlich beruhigen, erreichte aber genau das Gegenteil. Wie konnte Daniel wissen, dass sie eine der Fotografien weggenommen hatte? Was hatte er sonst noch erkannt? Wusste er, was auf dem Bild zu sehen war? Und welche Schlussfolgerungen hatte er daraus gezogen? Marie stellte das Fleisch in die Mitte des Tisches. Sie bemühte sich, den folgenden Satz beiläufig klingen zu lassen.
»Willst du es mir nicht verraten?«
»Es tut mir echt leid, wenn ich dich verunsichert habe«, begann er. Sein Lächeln wirkte gequält.
»Es ist nur ...« Es passte so gar nicht zu ihm, derart um den heißen Brei herumzureden.
»Was denn?«, fragte sie und bemerkte, dass ihre Stimme fast ein bisschen gereizt klang.
»Die Anzahl der Staubränder auf der Kommode stimmt nicht mit der Anzahl der Bilderrahmen überein«, erklärte Daniel nun kleinlaut. Offenbar war ihm die Antwort peinlich, schließlich kritisierte er damit praktisch ihre Haushaltsführung. »Essen wir jetzt?«
Diesmal nahm Marie den angebotenen Themenwechsel dankbar an. Es beruhigte sie, dass Daniel nichts über den Inhalt des fehlenden Bildes wusste. Erleichtert griff sie nach der Fleischgabel.
»Ja, gerne«, sagte sie.
Dienstag, 30. November, 13.09 Uhr
»Hi, Babe!«, rief Joachim ihr aus dem geöffneten Seitenfenster zu. So unangemessen diese Begrüßung auch war, es wirkte auf sie vertraut. Wie ein altes Kleidungsstück, das man anzieht und sofort in Erinnerungen versinkt.
»Hallo, Joachim«, erwiderte Marie. »Hat alles geklappt?«
Er nickte. »Alles lief wie am Schnürchen.«
»Lass uns hier verschwinden.« Sie schwang sich auf den Beifahrersitz des Autos, während ihr Ex-Mann den Motor startete. An der Ausfahrt des Parkplatzes erkannte sie gerade noch rechtzeitig Daniels Silhouette, um sich schnell zur Seite zu drehen. Dann fuhren sie auf die Straße und verschwanden aus seinem Sichtfeld.
Daniel
Nachdem ich zum Lehrerparkplatz zurückgekehrt war, stieg ich sofort in mein Auto. Meine Tasche lag zwar noch in meinem Arbeitszimmer, doch ich fürchtete, dass mich irgendwer ansprechen würde. Dazu hatte ich jetzt keine Zeit, und erst recht keine Lust. Stattdessen wollte ich unbedingt zu Familie Wagner fahren. Nancys Bruder war an der Einbruchserie beteiligt – da war ich mir ziemlich sicher. Außerdem hatte mich ihre Beteuerung, was für ein toller Kerl Benjamin sei, nicht wirklich überzeugt. Nach ihrer Erzählung in meinem Büro ahnte ich, dass sie sehr unter ihm litt. Es war gut möglich, dass er der Grund für das Weglaufen des Mädchens war. Möglicherweise hingen sogar Ricky, die Einbrüche und Nancys Nächte im Wald zusammen – wie auch immer dieser Zusammenhang aussehen mochte.
Ich startete den Motor und legte den Rückwärtsgang ein, kam jedoch kaum zwei Meter weit. Die Lenkung reagierte zäh, und ein sonderbares Fahrgeräusch ließ mich aufhorchen. Ich hatte den Eindruck, als klemmte irgendetwas am Unterboden des Autos fest. Ich zog die Handbremse und stieg aus.
»Was für eine Scheiße!«, rief ich, als ich den Schaden an meinem Wagen bemerkte.
Alle vier Reifen waren zerstochen. Wer es auch gewesen war, er hatte ganze Arbeit geleistet. In der Nähe des rechten Vorderrades entdeckte ich einen alten Schraubenzieher, vermutlich das Werkzeug des Vandalen. Ich richtete ein Stoßgebet zum Himmel, dass nicht Ricky dahintersteckte, denn das würde unser angespanntes Verhältnis noch mehr belasten.
»Das ist wieder mal typisch«, tadelte ich mich daraufhin selbst. »Dein Auto wird beschädigt und du machst dir Sorgen um deine Beziehung zu einem Schüler!«
Seufzend zog ich mein Handy aus der Innentasche der Jacke. Anfangs überlegte ich, die Polizei zu informieren, doch ich entschied mich dagegen. Falls Ricky hinter dieser Sache steckte, konnte ich dies auch regeln, ohne ihn in Schwierigkeiten mit der Polizei zu bringen. Stattdessen wählte ich die Nummer meiner Autowerkstatt.
Der Mechaniker versprach, innerhalb der nächsten Stunde einen Abschleppwagen zu schicken. Ich vereinbarte mit ihm, meinen Autoschlüssel im Sekretariat zu hinterlegen. Ich hatte keine Lust, untätig in der Kälte zu warten. Mein Plan war es nach wie vor, Benjamin Wagner einen Besuch abzustatten. Jetzt musste ich eben mit dem Stadtbus in das Nachbardörfchen fahren. Wenn die Beschädigung meines Autos darauf abgezielt hatte, mich von weiteren Untersuchungen zu der Einbruchsserie abzuhalten, war dies gründlich danebengegangen.
Im Gegenteil: Ich war motivierter denn je, der Sache auf den Grund zu gehen.
Dienstag, 30. November, 13.22 Uhr
Familie Wagner wohnte in einem Vorort der Stadt, den ich gut kannte. Alexandras Mutter lebte hier. Ich hatte sie seit der Beerdigung ihrer Tochter mehrfach besucht. Die Busfahrt mit der Linie 9 war wenig erfreulich. Um diese Zeit, kurz vor halb zwei, fuhren unzählige Schulkinder mit dem Bus nach Hause. Sie schrien und zankten, redeten über die »scheiß Lehrer« oder den »Penner aus der Nachbarklasse« und sprangen im Bus umher.
Dabei bewunderte ich den Fahrer für die Gelassenheit, mit der er zum x-ten Mal über die Lautsprecheranlage des Busses darum bat, sich vernünftig hinzusetzen. Ich fühlte mich während der gesamten Fahrt wie eine Busaufsicht, nicht wie ein Fahrgast. Um so erleichterter war ich, als ich fünfzehn Minuten später endlich aussteigen und das Tohuwabohu hinter mir lassen konnte.
Die Hauptstraße des kleinen Nachbarortes war gerade erst aufwendig saniert worden. Die breiten Bürgersteige waren mit roten Pflastersteinen verziert. Die Bushaltestellen und Straßenlaternen wirkten modern und ordentlich. Je weiter man von der Hauptverkehrsstraße in Richtung Ortskern lief, desto dörflicher und verfallener wurde die Gegend.
Mein Ziel war nur einen kurzen Fußweg von der Buslinie entfernt. Es lag in einer schmalen Seitenstraße. Hier reihte sich ein altes, unansehnliches Gemäuer an das nächste. Zwischen den Gebäuden waren große hölzerne Tore angebracht. Sie erinnerten unverkennbar an die landwirtschaftliche Vergangenheit der Siedlung. Das Haus der Familie Wagner war grau und verwittert. Hier und da bröckelte der Putz von der Fassade. Am Hoftor des Grundstücks hing eine Klingel, die einen fiesen, lauten Summton von sich gab. Ich wartete vergeblich auf eine Reaktion.
Zwei Schulkinder mit knallbunten Ranzen kamen vorbei. Die Jungen beäugten mich neugierig. Sie waren noch viel zu klein, um meine Beratungsschule zu besuchen, gingen vermutlich auf die örtliche Grundschule. Als auch beim zweiten und dritten Klingeln niemand die Tür öffnete, wollte ich mich schließlich auf den Rückweg zur Haltestelle machen.
Die Fenster des unteren Stockwerks waren so angelegt, dass jeder vom Bürgersteig aus hineinblicken konnte, was ich unwillkürlich tat. Sofort blieb ich wie angewurzelt stehen. In dem unaufgeräumten Wohnzimmer erkannte ich die Umrisse eines Menschen. Er lag auf dem Fußboden, in der Nähe des Fernsehers. Um besser sehen zu können, drückte ich die Nase an die Scheibe und schirmte dabei meine Augen gegen das Tageslicht ab.
Es bestand kein Zweifel: Dort lag Benjamin Wagner, mit dem Gesicht nach unten. Der Körper des jungen Mannes war sonderbar verdreht. An seinem Kopf klaffte eine riesige Wunde. Neben ihm lag ein Baseballschläger, der offenbar dazu benutzt worden war, dem Jugendlichen den Schädel zu zertrümmern. Darunter hatte sich eine gewaltige Blutlache gebildet.
Kapitel 4
Dienstag, 30. November, 13.48 Uhr
Einen Moment lang hatte ich vor dem Fenster gestanden und wie gelähmt auf das Horrorszenario im Inneren der Wohnung gestarrt. Ich hatte keine Sekunde darüber nachgedacht, dem Jungen zu helfen, denn niemand hätte eine solche Kopfverletzung überleben können. Trotzdem war mein erster und einziger Gedanke, als ich meinen Schock überwunden hatte, irgendwie ins Haus zu gelangen.
Ich lief zu dem schweren hölzernen Hoftor und drückte die Klinke der darin eingebauten Tür. Sie war unverschlossen. Der dahinterliegende, kopfsteingepflasterte Hof war viel größer, als ich von außen erwartet hatte. Einige Meter verlief er zwischen der Hauswand und einer schlecht verputzten Außenmauer des Nachbarhauses, um ab der Hausecke dann wesentlich breiter zu werden. Wenn man rechts um die Ecke ging, kam man vermutlich zur Haustür von Familie Wagner. Nach hinten wurde der Hof von einer alten Scheune begrenzt, die ebenfalls ein gewaltiges Holztor hatte. Zögerlich ging ich einige Schritte und zuckte erschrocken zusammen, als hinter mir die hölzerne Tür ins Schloss fiel. Ich war noch ein ganzes Stück von der Ecke des Hauses entfernt, als ich vor mir eine Bewegung ausmachte. Ich blieb abrupt stehen.
»Ist da jemand?«, fragte ich. Sofort bereute ich diese dämliche Frage. Wie oft hatte ich mich schon über Figuren in Horrorfilmen geärgert, die diese Frage leichtfertig in dunkle Hausflure riefen, um dann plötzlich eines gewaltsamen Todes zu sterben? Mein Rufen war keinen Deut besser gewesen, denn immerhin bestand die Möglichkeit, dass der Mörder noch auf dem Grundstück war.
Und jetzt wusste er auch genau, wo ich mich befand. Eindeutig konnte ich nun hören, wie jemand davonrannte. Vorsichtig setzte ich mich wieder in Bewegung. Als ich an das Ende der Hauswand kam, hörte ich einen Knall, ähnlich dem der zufallenden Tür. Wer immer mit mir in diesem Hof gewesen war, er war in die Scheune geflohen.
Ohne weiter nachzudenken, stürzte ich los. Ich riss die Tür auf und stolperte über einen Absatz, den ich nicht bemerkt hatte. Das alte Gemäuer war dunkel und staubig. Direkt vor mir stand ein Traktor, der seinem Aussehen nach seit Jahren nicht mehr benutzt worden war. Irgendwo dahinter knarzten jetzt Holzbalken unter dem Gewicht des Flüchtenden.
»Stehenbleiben!«, rief ich und zwängte mich an dem Trecker vorbei.
Ich entdeckte eine Holzleiter, die nach oben auf den Heuboden führte. Etliche Meter über mir erkannte ich den Schatten eines Mannes. Entschlossen griff ich nach einer Sprosse der Leiter und begann, hinaufzuklettern. Das Holz ächzte bedrohlich unter der Last. Ich fürchtete jeden Moment, einzubrechen und hinunterzufallen.
Als ich die obere Plattform fast erreicht hatte, traf mich aus dem Nichts ein heftiger Tritt gegen meine Schulter. Ich verlor das Gleichgewicht, rutschte von der Leiter ab und bekam gerade noch eine der Sprossen zu fassen. Sie ächzte nicht nur, sondern knirschte sogar. Ich wagte kaum zu atmen, aus Angst, das alte Holz würde brechen. Panisch wartete ich auf den nächsten Fußtritt, der mich in die Tiefe stürzen ließ.
Stattdessen hörte ich nur das Heu rascheln, als mein Angreifer in Richtung der hinteren Scheunenwand davonlief. Es gelang mir, meinen Fuß auf eine der unteren Leitersprossen zu stellen. So konnte ich wieder nach oben steigen.
Meine Schulter schmerzte höllisch, doch ich schaffte es, auf den Heuboden zu klettern. Riesige Ballen waren hier aufgetürmt. Sie waren alt und rochen modrig. Ich rannte blindlings hinter dem Fremden her, ohne die geringste Ahnung, was ich eigentlich vorhatte. Wenn ich tatsächlich den Mörder jagte, würde er sich bestimmt nicht freiwillig ergeben.
»Hier kommen Sie nicht mehr raus! Besser, Sie geben auf!«, rief ich. Dabei vermied ich es, nach links in die Tiefe zu schauen. Grelles Tageslicht fiel durch ein unförmiges Loch in der Außenwand der Scheune. Ich erreichte den Durchbruch und schaute hinaus. Einige Meter unter mir begann der Garten des Nachbargrundstücks. Direkt unterhalb der Öffnung war ein Geräteschuppen. Der Unbekannte hatte einen größeren Vorsprung, als ich vermutet hatte. Er war durch das Loch geklettert, auf den Schuppen gesprungen und rannte bereits durch den Garten. Mir blieb keine andere Wahl.
Ich musste ebenfalls springen, wenn ich den Kerl erwischen wollte. Ich kletterte nach draußen auf eine schmale Holzleiste, die an der Scheunenwand befestigt war. Mit einem Blick vergewisserte ich mich noch einmal, dass ich auch wirklich auf dem Dach der Hütte landen würde. Dann sprang ich. Der Aufprall fuhr mir schmerzhaft in alle Glieder, doch ich versuchte, es zu ignorieren. Ich setzte mich wieder in Bewegung und ließ mich von dem Schuppendach gleiten.
In der Mitte des Grundstücks standen mehrere Büsche. So schnell ich konnte, lief ich um diese herum. Wie aus dem Nichts tauchte eine Gestalt vor mir auf. Ich wollte noch abbremsen, doch es war zu spät. In vollem Lauf prallte ich mit der anderen Person zusammen. Wir gingen beide zu Boden.
Der Unbekannte stieß mich von sich herunter. Ich rollte mich zur Seite, bereit, sofort aufzuspringen und mich gegen einen Angriff zu verteidigen. Doch der andere Mann griff mich nicht an.
»Herr Konrad?«, fragte er nur verwundert und rang dabei nach Luft.
»Herr Burkhard?«, erwiderte ich atemlos, nachdem ich erkannt hatte, wer da neben mir im Gras lag. »Was machen Sie denn hier?«
»Was ich hier mache?«, wiederholte der Sportlehrer meine Frage. »Ich wohne hier! Das ist mein Garten! Und was haben Sie hier zu suchen?«
Seine Worte erinnerten mich an den eigentlichen Grund, der mich hierhergeführt hatte. »Haben Sie jemanden hier entlanglaufen sehen?«, fragte ich und schaute mich suchend um, obwohl ich bereits wusste, dass es längst zu spät war.
»Sie meinen den anderen Kerl?« Herr Burkhard deutete beiläufig zur Straße. »Der ist über alle Berge. Wieso?«
Dienstag, 30. November, 14.23 Uhr
Ich hatte meinen Kollegen gebeten, die Polizei zu verständigen, und war zum Haus von Familie Wagner zurückgelaufen. Kurz darauf war Benjamins Mutter vom Einkaufen gekommen.
Ihre Plastiktüten lagen noch immer auf dem Bürgersteig vor dem Hoftor. Sie hatte sie einfach fallen gelassen und war panisch zur Haustür gestürmt, nachdem ich ihr von meiner Entdeckung berichtet hatte. Ich hatte sie gerade noch rechtzeitig daran hindern können, den Tatort zu verändern. Bestimmt hätte es sie für den Augenblick getröstet, ihren Jungen aus seiner unnatürlichen Körperhaltung zu heben und in den Arm zu nehmen. Ich ahnte jedoch, dass sie es sich niemals verzeihen könnte, wenn sie dadurch Hinweise vernichten und der Mörder ungeschoren davonkommen würde.
Anfangs hatte sie sich mit aller Kraft gegen mein Eingreifen gewehrt, war dann aber in sich zusammengesackt und hatte sich haltsuchend an mich geklammert. So standen wir schweigend, inmitten des Grauens. Der Moment schien ewig zu dauern. Ich konnte nichts tun, als Halt und Trost zu spenden. Jedes Wort wäre zu viel gewesen, also schwieg ich. Erst nach etlichen Minuten wurde mir klar, dass ich dabei die Leiche anstarrte, und wendete meinen Blick ab.
Doch wo sollte ich hinschauen? Wohin ich auch sah, überall umgaben mich die Spuren des furchtbaren Verbrechens. Den Blutfleck auf dem Holzboden und den verschmierten Baseballschläger wollte ich genauso wenig sehen wie die Graffiti an der Wand oder den blutigen Handabdruck auf der Spraydose, mit der sie gesprüht worden waren.
Die Flecken ließen erahnen, dass der Täter versucht hatte, seine Fingerabdrücke zu verwischen. Diese Erkenntnis minderte meine Hoffnung auf eine baldige Aufklärung des Mordes.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783946922803
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (August)
- Schlagworte
- Thriller Krimi Daniel Konrad Ermittler