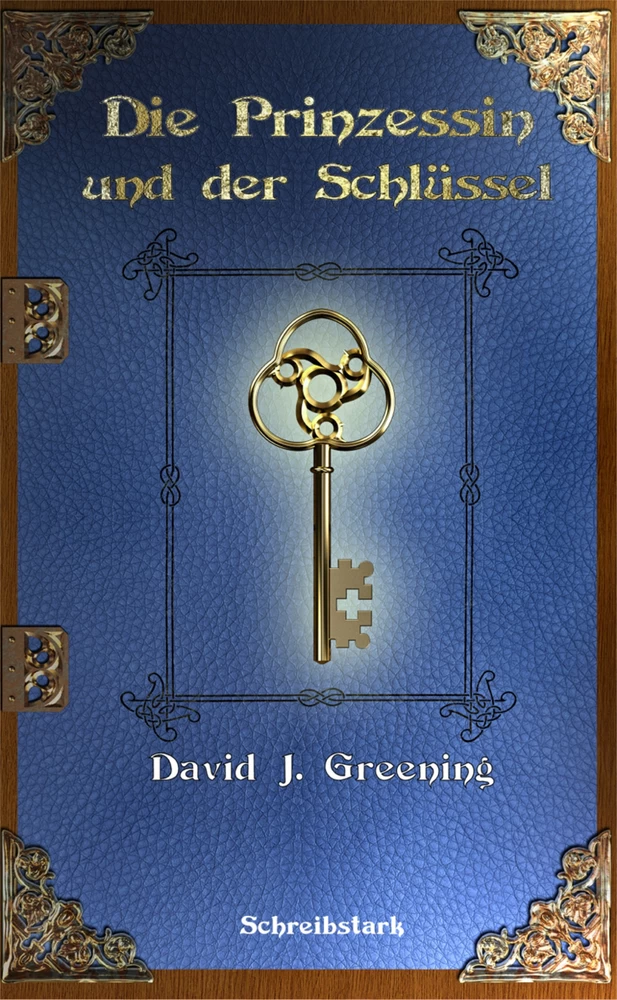Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Der Ring und der Drache
Es waren einmal drei Brüder, die lebten zusammen mit ihrem Vater an einem See. Ihre Mutter war früh gestorben und so hatte der Vater sie alleine großgezogen. Gabha, dessen Name in unserer Sprache „Schmied“ bedeutet, war ein Schmied, der alles, was er herstellte, verzaubern konnte. Er war sich jedoch nie sicher gewesen, ob er sein Handwerk und seine Magie an seine drei Söhne weitergeben sollte, denn von ihnen war nur der Mittlere, Mhadra, wohlgeraten. Die anderen beiden, Brí, der Älteste, und Fáinne, der Jüngste, waren hinterlistig und hatten stets Böses im Sinn. Und so kam es, dass nur Mhadra von ihm lernen durfte. Obwohl er nun von ihren Schwächen wusste, so liebte er trotzdem alle drei Söhne gleich, denn sie waren die Einzigen, die ihm von seiner Familie noch geblieben waren.
Eines Tages ging Gabha in seine Schmiede und entschloss sich, etwas ganz Besonderes zu erschaffen.
„Meine Söhne“, sagte er zu seinen drei Söhnen, „heute werde ich etwas schmieden, was ich noch nie zuvor geschmiedet habe. Ich brauche die Schmiede und das Haus für mich alleine, um meine Zauber zu vollbringen.“
Daraufhin nickte Mhadra und ging zum Fischen an den See, doch Brí und Fáinne murrten und wollten der Bitte ihres Vaters nicht nachgeben.
„Kann ich nicht bleiben?“, fragte Fáinne, dessen Name „der Einkreisende“ bedeutet, doch sein Vater schüttelte den Kopf.
„Kann ich Euch helfen, Vater?“, fragte Brí, dessen Name in unserer Sprache „Macht“ bedeutet, listig.
„Du möchtest meine Magie nur erlernen, damit Du sie zu Deinen eigenen Zwecken missbrauchen kannst.“, antwortete der Vater traurig. „Also muss ich auch Dich abweisen. Und nun geht, denn dies ist immer noch mein Haus.“
„Hoffentlich nicht mehr allzu lange.“, murmelte Fáinne und erhob sich, um zu gehen.
„Nur, solange er lebt.“, fügte Brí hinzu, und die beiden Brüder verließen grollend das Haus, um ihren Vater sich selbst und seinen Geschäften zu überlassen.
Gabha befeuerte seine Esse und machte sich an die Arbeit. Er arbeitete den ganzen Morgen und den ganzen Mittag, unaufhörlich und ohne zu ermüden; beständig trieb und formte er das Metall. Als die Sonne unterging, arbeitete er immer noch, und die ganze Nacht über widmete er sich seinem Werkstück und dessen Verzauberung.
Als die Sonne am nächsten Tag endlich aufging, war die Arbeit vollendet. Es zischte und kochte, als er das Werkstück in einen Wasserbottich tauchte und füllte die ganze Schmiede mit Dampf. Als das Metall schließlich abgekühlt war, hielt er das Objekt, das er geschaffen hatte, gegen das Licht, um es zu begutachten. Es war ein Ring; ein Meisterstück, und Gabha wusste, dass nichts, was er von nun an schmieden würde, diesem Ring gleichkommen würde, den er in einem Tag und einer Nacht geschaffen hatte. Er war perfekt. Weich und golden schimmerte er, als ob der Schmied das Licht der Sonne selbst in ihn hineingeschmiedet hätte.
Gabha nahm ihn in die Hand und wog ihn. Er war leicht und schwer zugleich, wie ein goldenes Band, schön in seiner Schlichtheit, und strahlte trotzdem die Komplexität der Magie aus, die er in den Ring hineingewoben hatte. Er streifte ihn über jeden seiner Finger, und jedes Mal passte er perfekt, als ob er für genau diesen Finger gemacht worden wäre. Müde ließ der Schmied den Ring an seinem Finger, beschloss, sich von der harten Arbeit auszuruhen und legte sich auf das Lager, welches genau zu diesem Zweck in der Schmiede stand. Er ahnte nicht, dass er beobachtet worden war.
„Er ist so schön.“, rief Fáinne aus.
„In der Tat, es ist ein Meisterstück.“, stimmte Brí ihm zu und nickte.
Es war nicht das erste Mal gewesen, dass ihr Vater sie gebeten hatte, die Schmiede zu verlassen, solange er arbeitete, und so hatten sie sich über die Zeit einen Ausguck eingerichtet, von wo aus sie ungestört ihren Vater bei der Arbeit beobachten konnten. Und als sie nun den Ring sahen, wussten beide, dass sie ihn besitzen mussten.
„Ich muss ihn haben“, sagte Fáinne, „er ist perfekt.“
„In der Tat.“, stimmte Brí zu, der sowohl tüchtiger als auch hinterlistiger als sein Bruder war, und wünschte sich, den Ring selbst in seine Hände zu bringen. „Vater wird ihn uns jedoch niemals überlassen, weder mir, noch Dir. Wenigstens nicht, solange er lebt.“
„Er ist schon alt“, antwortete Fáinne und grinste bösartig, „und alles stirbt einmal.“
Sein Bruder grinste verständnisvoll zurück und sagte:
„Vielleicht sollten wir der Sache ein wenig auf die Sprünge helfen.“
Und so kamen die beiden Brüder überein, ihren Vater zu ermorden, damit sie Hand an den magischen Ring legen konnten. In den folgenden Wochen schmiedeten sie Ränke und machten einen Plan nach dem anderen. Doch hatten sie nie den Mut, zur Tat zu schreiten, bis zu dem Tag, an dem Mhadra wieder einmal ausgegangen war. Fáinne konnte seine Gier nicht länger zügeln, und sagte:
„Ich werde ihn mir jetzt nehmen! Du kannst mir entweder helfen, oder es sein lassen, ich jedoch werde nicht länger warten!“
„Ich werde Dir helfen, Bruder.“, antwortete Brí, und hob beschwichtigend seine Hände, da er wollte, dass sein Bruder die Tat vollbrächte, sodass er selbst sich nicht die Hände besudeln musste.
„So sind wir uns einig.“, sagte Fáinne, und ging voraus zur Schmiede.
Sie gingen hinein, und jeder nahm sich eines der Schwerter, die ihr Vater hergestellt hatte, und sie gingen zu Gabha, der an seinem Amboss beschäftigt war und sie so weder kommen sah noch hörte. Ohne zu zögern erstach der jüngste Bruder den Vater von hinten, während der älteste danebenstand. Als der Schmied dort im Sterben lag, drehte Brí ihn um, so dass er Hand an den Ring legen konnte, doch er fand jeden einzelnen der Finger seines Vaters bloß und ohne Schmuck.
„Er hat ihn nicht!“, rief er aus. Sofort warf er seinem Bruder einen misstrauischen Blick zu. „Du hast ihn genommen!“
„Ich habe ihn nicht!“, fauchte Fáinne zurück und hielt sein Schwert noch fester in der Hand. „Mhadra, dieser Wicht, muss ihn irgendwie gestohlen haben!“
Dies war tatsächlich nicht weit von der Wahrheit entfernt. Wissend, dass Brí und Fáinne nichts Gutes im Schilde führten, sollten sie Hand an den Ring legen, hatte der Schmied ihn an seinen mittleren Sohn gegeben, bevor er am Morgen zur Arbeit in der Schmiede aufgebrochen war.
„Bringe ihn zu unserem Nachbarn Cúramach!“, hatte der Schmied gesagt. „Er versteht sich auf die Magie und wird ihn weise verwenden.“
Und so war Mhadra ausgegangen und hatte den Ring mitgenommen, ohne zu ahnen, dass er damit den letzten Wunsch seines Vaters erfüllte.
„Dieser Ring besitzt eine große magische Kraft.“, hatte Cúramach gesagt, als Mhadra ihm den Ring seines Vaters überreichte. „Ich werde ihn annehmen, jedoch nicht als Geschenk. Ich werde ihn als Symbol Eures Vertrauens und Eures guten Willens annehmen.“ Und dann, als er bemerkte, wie der junge Mann seine Tochter anblickte, sprach er „Ihr habt den Ring freiwillig zu mir gebracht, ohne daran zu denken, ihn für Euch zu behalten. So will ich Euch im Gegenzug meine Tochter Feírín zur Braut geben.“
Und tatsächlich war Mhadra schon lange in Cúramachs Tochter verliebt, doch hatte er nie ein Geschenk besessen, welches der Tochter eines Zauberers zur Ehre gereicht hätte.
„Willst Du diesen Sohn des Gabha zu Deinem Mann nehmen, Feírín?“, fragte er seine Tochter, deren Name in unserer Sprache „Geschenk“ bedeutet.
„Das will ich, Vater, denn ich liebe Mhadra schon lange.“, antwortete seine Tochter.
„So bin ich Dein, und Du bist mein.“, sprach der Sohn des Schmiedes lächelnd.
„Und so wird Euch dieser Ring, gebunden mit schwarzer Magie, von allen Fesseln befreien.“ sagte Cúramach, dessen Name in unserer Sprache „der Vorsichtige“ bedeutet. „Doch nun müsst Ihr gehen.“
„Darf ich Mhadra nach Hause begleiten, Vater?“, fragte seine Tochter, doch ihr Vater schüttelte den Kopf.
„Können wir dann hierbleiben?“, fragte der Sohn des Schmieds, doch sein Schwiegervater schüttelte erneut den Kopf, und sprach:
„Dieser Ring ist ein Bote des Bösen. Und auch wenn Ihr dies nicht wisst, so ist jeder, der ihn besitzt, zu einem vorzeitigen Ende verdammt. Ihr jedoch nicht“, fügte er rasch hinzu, als Mhadra ihn entsetzt ansah, „denn Ihr wart nur sein Träger, nicht sein Besitzer. Und nun, hinfort!“, befahl er.
Daraufhin fanden sich Mhadra und seine Angetraute Feírín hinweggeweht, aus der Tür hinaus über das Tal, den See und darüber hinweg, dank der Magie des Cúramach, der Ring beiden für immer verloren. Sie würden glücklich sein und viele Kinder haben, von denen eines den Ring zum letzten Mal an seinen Finger stecken würde, doch dies ist eine andere Geschichte.
Gerade, als die beiden in Sicherheit gebracht worden waren, erschienen Brí und Fáinne auf der Türschwelle.
„Gib uns den Ring“, forderte der jüngste der Brüder, „oder Du wirst es noch heute bereuen!“, woraufhin Brí nickte.
„Ich bereue es bereits jetzt“, antwortete Cúramach und nahm den Ring aus seiner Tasche, „denn nichts Gutes wird von ihm kommen.“
Als er ihn hochhielt, entflammte der Hass und die Gier in den Augen der beiden Brüder, und Mordlust durchfloss ihre Adern. Wie immer der Vorsichtigere der Beiden, hielt sich Brí zurück, während sein Bruder nach vorn stürmte und einen langen, bösartig gekrümmten Dolch aus seinem Gürtel zog. Ohne zu zögern stieß er die Klinge in Cúramachs Brust und tötete ihn auf der Stelle.
„Schnell, nimm alle Schätze, die Du finden kannst.“, sagte der Ältere und wandte sich rasch nach links, um der Klinge seines Bruders auszuweichen. „Ich werde den Ring von seinem Finger nehmen!“
„Glaubst Du wirklich, dass ich ein solcher Dummkopf bin, Brí?“, antwortete der jüngere Bruder, „Das bin ich nicht!“
Und, bevor sein Bruder ihn davon abhalten konnte, nahm er den Ring von Cúramachs Finger und streifte ihn sich über. Fáinnes Grinsen wurde immer breiter und grausamer, während sich sein Körper verwandelte und immer größer wuchs. Und als Brí hinsah, bemerkte er, dass der Ring seinen Bruder in einen Drachen verwandelt hatte.
„Ich war es, der getötet hat, also werde auch ich es sein, der die Früchte dieser Arbeit erntet!“, sagte der Drache, dessen Verwandlung immer noch nicht abgeschlossen war.
Aus seiner Haut wurden Schuppen, aus seinen Zähnen Fänge und aus seinen Fingern Klauen.
„Und nun: Hinfort!“, brüllte das Monster, und seine Stimme war so gewaltig, dass sie Brí beinahe von den Füßen fegte.
Da ihm anderweitig nur noch die Möglichkeit blieb, auf der Stelle zu sterben, rannte der älteste Bruder davon, um sein Leben zu retten. Er rannte, bis er nicht mehr rennen konnte, und doch rannte er weiter und weiter, bis er schließlich anhielt, um zurückzublicken. Rauch drang aus dem Hause des Zauberers am See, und Brí schwor sich, zurückzukehren und dem Ungeheuer, in das sich sein Bruder verwandelt hatte, den Ring zu entreißen, doch dies ist eine andere Geschichte.
Kura-Kura und der Korua Raksasa
Es war einmal ein Mädchen. Ihre Leute wurden Shardana genannt, was in unserer Sprache „Seevolk“ bedeutet. Sie lebten als Fischer und Händler im Stillen Ozean, weit drüben im Osten. Das Mädchen hatte ihre Eltern in einem Sturm verloren und war so zur Waise geworden, doch obwohl sie von vielen Familien aufgenommen worden war, hatte sie nie ein echtes Zuhause gefunden. Und so wurde sie schweigsam und zog sich in sich zurück, und ihr echter Name, den ich euch nicht verraten werde, weil dies eine andere Geschichte ist, geriet in Vergessenheit. Und schon bald nannte jeder sie Kura-Kura, was in unserer Sprache „Schildkrötenmädchen“ bedeutet.
Tawhito und Tua waren ein altes Paar, das selbst nie Kinder gehabt hatte. Eines Tages sagte Tawhito zu seiner Frau:
„Kura-Kura hat keine Eltern, und wir haben keine Kinder. Das ist nicht richtig. Wir sollten sie adoptieren, Weib.“
„Sie ist ein wildes Kind“, antwortete Tua, „und ist schon so lange alleine. Werden wir ein solches Mädchen jemals zähmen können?“
„Du hast recht, Weib!“, sagte Tawhito nachdenklich. „Wir sollten besser gar nicht versuchen, sie zu zähmen. Vielmehr sollten wir sie so akzeptieren, wie sie ist, wild und frei. Denn“, so fuhr er fort, „wenn wir sie lieben wollen wie unser eigenes Kind, so müssen wir sie so lieben, wie sie ist.“
Tua stimmte zu und so geschah es. Kura-Kura wurde von Tawhito und Tua adoptiert, und sie gaben ihr den Namen Tamaiti, was in unserer Sprache „Kind“ bedeutet. Doch weil sie so viel verloren hatte, plagte sie des Nachts die Angst, also kam ihr Vater zu ihr, um ihr Geschichten zu erzählen. Tamaitis Lieblingsgeschichte war die über den Korua Raksasa.
„Kannst Du nicht schlafen, Tamaiti?“, würde Tawhito dann fragen.
„Nein, Ayah.“, antwortete sie dann, und Ayah bedeutet „Vater“ in unserer Sprache. „Erzählst Du mir eine Geschichte?“
Und ihr Vater würde seufzen und vorgeben, beschäftigt oder müde zu sein, oder gar beides. Doch er würde sich immer neben sie auf das Bett setzen und ihr eine Geschichte erzählen.
„Zu Anbeginn der Zeit“, sagte er dann, „gab es nur das Meer, Kete-Tamaiti.“, was „mein liebes Kind“ in unserer Sprache bedeutet. „Und die Geschöpfe des Meeres waren allein auf der Welt, ohne einem Himmel über sich, oder einer Sonne, die auf sie herabschien und ihnen Licht spendete.“
„Gab es dort kein Festland?“, fragte sie, und sie sagte das Wort in einem, da es in der Sprache der Shardana nur eine Art von Land gab und für sie alles Land trocken war.
„Nein“, antwortete Tawhito, „am Anfang gab es kein Festland.“
„Und gab es dort Menschen, Ayah, gab es Shardana?“, fragte sie weiter.
„Nicht wie wir, Tamaiti, nein. Doch es gab andere Leute, Leute, die nichts von der Sonne und nichts vom Himmel wussten. Und sie lebten im Meer; ähnlich wie wir, aber nicht genau wie wir.“, sagte er und Tamaiti nickte dann ernst. „Und dann, eines Tages, entschlossen sich diese Leute, das größte und gefährlichste Tier des Meeres zu töten.“
„Den Korua Raksasa.“, sagte Tamaiti und zog die Decke bis zur Nasenspitze nach oben.
„Genau“, sagte ihr Vater. „Den Korua Raksasa.“ In unserer Sprache bedeutet das „Ahnherr aller Monster“, oder Leviathan. „Und so jagten sie ihn, so lange, wie ein Monat Tage hat…“
„Und so lange, wie ein Monat Nächte hat.“, fügte dann die kleine Tamaiti hinzu.
„Bis sie ihn endlich fanden.“, nickte er. „Das größte Geschöpf des Meeres. Und sie versuchten ihn mit ihren Netzen zu fangen, doch der Korua Raksasa lachte nur über ihre Bemühungen. ‚Ihr könnt mich nicht einfangen‘, sagte er, ‚denn ich bin der Korua Raksasa‘, und er zerfetzte ihre Netze und zerschmetterte ein Drittel ihrer Boote und tötete ein Drittel ihrer Leute. Und dann versuchten die Harpuniere ihn mit ihren mächtigen Harpunen zu durchbohren, die sie aus den Knochen seiner eigenen Söhne und Töchter gefertigt hatten.“
„Aber sie konnten ihn dennoch nicht töten, Ayah.“, sagte Tamaiti.
„Nein, das konnten sie nicht.“, stimmte ihr Vater zu. „Und der Korua Raksasa sprach: ‚Ich bin der Korua Raksasa; Eure Waffen können mir keinen Schaden zufügen, auch wenn sie aus den Knochen und Häuten meiner eigenen Söhne und Töchter sind‘, und er lachte wiederum und zerbrach ein weiteres Drittel ihrer Harpunen und ihrer Boote und tötete ein weiteres Drittel ihrer Leute.“
„Und dann kam die Schamanin.“, sagte Tamaiti, die zu aufgeregt war, um darauf warten zu können, dass ihr Vater fortfuhr.
„Und dann kam die Schamanin.“, stimmte ihr Vater erneut zu. „Und da die Menschen versucht hatten, den Korua Raksasa einzufangen und zu töten – erst mithilfe von Netzen, die aus den Sehnen seiner Söhne und Töchter gemacht waren, und dann mit den Harpunen, die aus den Knochen seiner Kinder gemacht waren – sang die Schamanin zu ihm.“, sagte Tawhito und lächelte seine Tochter an.
„Und welches Lied hat sie für ihn gesungen, Ayah?“
„Das weiß niemand, denn es waren nicht unsere Lieder, und es waren nicht unsere Leute. Viele Lieder, alle, die man kannte, niemand weiß es. Doch der Korua Raksasa hatte noch nie einen Menschen singen gehört, denn die Geschöpfe des Meeres können nicht singen, wie ja jeder weiß.“, fuhr ihr Vater fort. „Und so hörte er auf, den Rest der Menschen zu töten, und ihre Netze und Harpunen zu zerstören und hörte stattdessen dem Lied der Schamanin zu. Und sie sang so lange, wie ein Monat Tage hat…“
„Und so lange, wie ein Monat Nächte hat…“, setzte seine Tochter den Satz fort,
„Bis der Korua Raksasa müde wurde.“, stimmte ihr Vater zu. „Und er sagte: ‚Ich bin so müde, wie ich es noch nie zuvor gewesen bin.‘ ‚Das ist, weil Du alt bist‘, sagte die Schamanin, ‚und alles, was alt ist, muss sich einmal zur Ruhe setzen und zu seiner Zeit sterben.‘ ‚Also hat Dein Lied das erreicht, was Eure Netze und Harpunen nie erreicht haben?‘, fragte der Korua Raksasa die Schamanin. ‚Nein, Korua Raksasa, wir können Dich nicht töten. Wir können Deine Söhne und Deine Töchter töten, Dich jedoch nicht. Und es war ein Fehler, es überhaupt zu versuchen. Doch was ich sagte, ist wahr.‘ ‚Ich bin müde, doch möchte ich nicht sterben, Schamanin‘, sagte der Korua Raksasa zu ihr. ‚Dann solltest Du vielleicht einfach einen Augenblick ruhen?‘ sagte die Schamanin, ‚Ja, ich werde mich ausruhen‘, sagte der Korua Raksasa. Und so ruhte er.“
„Und was geschah dann, Ayah?“, fragte Tamaiti, obwohl sie die Antwort natürlich bereits wusste. „Ist der Korua Raksasa dann gestorben?“
„Nein, Tamaiti.“, antwortete Tawhito und fuhr ihr sanft übers Haar. „Jeder weiß, dass er nicht sterben kann. Er ruht seit jeher, auf den Wellen des Ozeans treibend, sodass er atmen kann. Und mit der Zeit begannen Bäume und Gras auf seinem Rücken zu wachsen. Und genauso wie er, legten sich auch seine ältesten Töchter und Söhne zur Ruhe, nicht gewillt, zu sterben.“
„Und so ist das Festland entstanden?“, fragte sie erneut.
„Ja, Tamaiti, so ist das Festland entstanden. Es ist der Rücken, der Kopf, und es sind die Flossen des Korua Raksasa und seiner größten Söhne und Töchter. Wenn sie müde sind, sterben sie nicht, sondern ruhen nur, und werden zu Stein. Doch manchmal erwacht der alte Korua Raksasa, und dann beben Erde, See und der Himmel, bis er sich wieder zur Ruhe legt.
„Und woher kommen die Shardana, Ayah?“
„Ach, Tamaiti, dies ist eine Geschichte für eine weitere Nacht.“, sagte ihr Vater.
Und er küsste seine kleine Tochter und deckte sie sanft zu. Tamaiti seufzte zufrieden und konnte nun endlich einschlafen.
Das Einhorn und die Elster
Im Grünen Land, weit hinter den Blauen Bergen lebte einmal eine Herde Einhörner. Ich weiß; die meisten Leute denken, dass Einhörner alle leuchtend und weiß sind, doch das ist natürlich nicht wahr. Denn diese Einhörner waren echte Einhörner, und so gab es sie in allen Farben: Es gab schwarze Einhörner, deren Fell so dunkel war, dass es blau schimmerte, gefleckte, rötlich-braune, kastanienfarbene und fuchsrote Einhörner, sowie gescheckte, braune und sandfarbene Einhörner. Und sie lebten auf den Wiesen des Grünen Landes, wild und frei.
Eines Tages gebar eine Stute namens Láir ein Fohlen. Da das Fell ihres Kindes kastanienfarben war, gab die Mutter ihr den Namen Rua, was in unserer Sprache „rot“ bedeutet. Rua war genauso wild und frei wie ihre Brüder und Schwestern, Cousins und Cousinen, Onkeln und Tanten und zog mit den anderen Einhörnern über die Wiesen des Grünen Landes. Wenn nun aber Einhörnern geboren werden, haben sie noch kein Horn, und so war es für die anderen nicht ungewöhnlich, dass Rua noch keines auf der Stirn trug. Doch als sie ein Jahr alt wurde, wuchs allen ihren Freunden, Geschwistern und Verwandten bereits ein Horn. Alle waren unterschiedlich: Manche lang und stolz, manche anmutig und fein, manche robust, andere zerbrechlich. Doch auf Ruas Stirn war immer noch kein Horn zu sehen.
Zunächst wunderte sich niemand darüber, und Rua war einfach nur ein Einhorn unter vielen. Doch eines Tages hörte sie, wie eines der anderen Fohlen, Capall, sich über sie lustig machte.
„Du bist kein richtiges Einhorn.“, ärgerte er sie. „Schau Dich nur einmal an!“ Er wieherte belustigt, und viele stimmten in seinen Hohn ein.
„Natürlich bin ich ein richtiges Einhorn!“, gab Rua zurück.
„Und wo ist dann Dein Horn?“, warf eines der anderen Fohlen namens Beithíoch ein. „Du bist doch nur ein Pferd!“
Wieder brachen die anderen in Gelächter aus. Rua galoppierte davon, und vor Scham traten ihr Tränen in die Augen.
Es dauerte nicht lange, da kam sie an einen Teich. Sie blickte in das Wasser unter sich und betrachtete ihre Stirn. Natürlich war sie ein Einhorn, da musste also auch ein Horn sein! Doch sie fand nichts, was nach einem Horn aussah, auch nicht den kleinsten Ansatz eines Höckers. Rua weinte, und ihre Tränen tropften in das Wasser unter ihr. Sie schlugen kleine Wellen auf seiner Oberfläche, sodass das Bild des Pferdes, das von dort aus zu ihr zurückblickte, verschwamm. Das war es also; sie war nichts weiter als ein gewöhnliches Pferd. Als sie keine Tränen mehr hatte, schnaubte sie. Was konnte sie tun? Was war ein Einhorn schon ohne sein Horn?
Und dann bemerkte Rua, dass etwas ihren Rücken berührte, knapp über ihrer Schulter. Irritiert schaute sie sich um, und sah, dass ein Vogel sich auf ihr niedergelassen hatte. Es war eine Elster.
„Hoppla, Vorsicht!“, krähte die Elster. „Du wirfst mich ja herunter!“
„Wer bist Du?“, fragte Rua, durch das seltsame Zusammentreffen für einen Moment aus ihrer Verzweiflung gerissen.
„Ich? Nun, ich bin Meaige, und ich bin eine Elster.“, antwortete die Elster, und Meaige bedeutet „Elster“ in unserer Sprache. „Und wer bist Du, meine traurige vierbeinige kleine Freundin?“
„Ich bin Rua. Ich bin ein…“, begann sie, doch verstummte wieder und schaute zu Boden. „Ich bin ein Pferd.“, schloss sie traurig.
„Du siehst für mich aber gar nicht aus wie ein Pferd.“, antwortete Meaige. „Pferde sind, naja… groß und kräftig. Für mich siehst Du eher aus wie ein Einhorn, um ehrlich zu sein.“, fuhr die Elster fort. „Aber ich nehme an, dass Du ein Horn hättest, wenn Du ein Einhorn wärst! Du bist mir ja ein seltsames Wesen.“
„Ich bin ein Einhorn. Es ist jedoch so, dass ich immer noch kein Horn habe.“, sagte Rua.
„Nun, das erklärt natürlich einiges.“, sagte Meaige und zuckte mit den Flügeln. „Ein Einhorn ohne Horn. Ich muss zugeben, dass alle Einhörner, die ich bis jetzt gesehen habe, auch ein Horn hatten. Was ist denn mit Deinem geschehen?“
„Ich habe einfach keines!“, sagte sie. „Alle anderen Einhörner haben ein Horn. Nur ich nicht…“, fügte Rua unglücklich hinzu.
„Naja, das kann so aber nicht bleiben!“, rief die Elster aus. „Wir müssen eines für Dich finden! Oder Dir eines besorgen! Und dabei könnten wir auch eines für mich besorgen. Eine Elster mit Horn, das wäre doch mal was!“, krähte sie begeistert.
„Wie meinst Du das, eines finden?“, fragte Rua, und in ihrem Herzen keimte Hoffnung auf.
„Wir werden natürlich herumfragen! Wir werden alle so lange belästigen, bis wir Dein Horn bekommen. Auf geht’s!“ Und sie brach in krächzendes Lachen aus und hüpfte dabei auf Ruas Rücken auf und ab.
Und so fragten die Elster und das Einhorn jeden im Grünen Land, ob sie das Horn des Einhorns gesehen und vielleicht eins für Meaige übrighätten. Sie fragten Brádan, den weisen alten Lachs, der in Loch Gorm lebte, doch dieser wusste nichts davon und riet ihnen, Gabhar zu fragen, die Königin der Ziegen, die in den Tälern lebten.
„Sie kennt sich ja aus mit Hörnern; sie selbst besitzt schließlich zwei davon.“, sagte Brádan zu ihnen. „Wenn Euch jemand bei Eurer Suche helfen kann, dann ist sie es.“
Und so suchten sie Gabhar auf, doch die konnte ihnen auch nicht weiterhelfen, und sie riet ihnen, Fia Rua aufzusuchen, den König der Hirsche, die im Wald hinter den Bergen lebten. „Seine Hörner sind weitaus größer als meine.“, sagte Gabhar voll gutem Willen. „Wenn Euch jemand auf Eurer Suche behilflich sein kann, dann ist er es.
„Das sind keine Hörner, das ist ein Geweih.“, sagte Fia Rua, als sie ihn endlich gefunden und ihn nach dem verlorenen Horn gefragt hatten. „Ich mag zwar das größte aller Tiere hier sein, doch ich bin nicht das mächtigste. Ihr solltet Euch aufmachen und nach Símag Tíre suchen, der Königin der Wölfe, die in den Blauen Bergen leben. Wenn Euch jemand beim Suchen helfen kann, dann ist sie es. Doch nehmt Euch in Acht und besucht sie nur bei Tag, denn immerhin ist sie eine Wölfin.“, fügte der mächtige Hirsch hinzu.
Rua und Meaige reisten in die Berge, und gingen mal hierhin, mal dorthin, um nach den Wölfen zu suchen. Und dann, als die Sonne plötzlich untergegangen war, war es dunkel, und sie fanden sich auf einer Lichtung wieder, die von Bäumen umgeben war. Doch nicht nur von Bäumen.
„Ich kann Augen im Dunkeln sehen, Rua.“, flüsterte Meaige ängstlich, und schmiegte sich an ihre Freundin.
„Ich kann sie auch sehen.“, antwortete das Einhorn ohne Horn, und die Angst ließ sie frösteln. „Das sind die Wölfe, vor denen uns Fia Rua gewarnt hat!“
Und so war es auch. Immer mehr Augen glommen im fahlen Schein von Frau Mond auf, bis sie vollkommen von ihnen umringt waren. Da trat einer der Wölfe vor.
„Ich bin Símag Tíre und habe gehört, dass Ihr nach mir sucht.“, sprach das mächtige, graupelzige Tier, und bleckte die Zähne.
Noch bevor Rua antworten konnten, hatte ihre gefiederte Freundin bereits begonnen, zu sprechen:
„Wir sind froh, Dich gefunden zu haben!“, krähte sie, und flatterte auf und ab. „Schön, dass gleich so viele von Euch gekommen sind, das macht es uns einfacher. Wir haben eine Frage!“
„Eine Frage! Wie interessant“, sprach Símag Tíre, „die meisten Leute kommen eigentlich, um mir etwas zu essen zu bringen.“
Daraufhin lächelte sie, und entblößte noch mehr von ihren Zähnen, was das Rudel hinter ihr in lautes Gelächter ausbrechen ließ.
„Nun denn, so fragt.“
„Dieses Einhorn hier“, begann Meaige, „hat sein Horn verloren. Wir haben schon den Lachs aus dem See, die Ziege aus den Tälern und den Hirsch aus dem Wald danach gefragt, doch keiner von ihnen konnte uns helfen. Sie verneigen sich jedoch vor Deiner Weisheit und sind sich einig, dass nur Du, Símag Tíre, Königin der Blauen Berge und wildestes aller Tiere, es wissen kann.“
„Das haben sie gesagt?“, fragte Símag Tíre erstaunt.
„Wahrlich, das haben sie.“, antwortete Meaige und zwinkerte Rua zu, damit sie ihr nicht widersprechen möge. „Und sie sagten auch, dass Du Rätsel magst, und niemandem etwas zu Leide tun würdest, der ein gutes Rätsel für Dich im Gepäck hat.“
„Auch das haben sie gesagt?“, fragte die Königin entzückt.
„In der Tat, das haben sie.“, behauptete die Elster. „Dies ist also das Rätsel: Was ist mit ihrem Horn geschehen?“
Interessiert blickte Símag Tíre zu Rua hinüber und leckte sich die Lippen.
„Ich weiß es nicht.“, sagte die Wölfin schließlich und schüttelte den Kopf. „Doch wie Du schon sagtest; ich liebe Rätsel. Vielleicht möchtet ihr mit uns gemeinsam den Abend verbringen, liebe Freunde, sodass wir uns gemeinsam an die Lösung des Problems wagen können.“
„Zu gerne würden wir bleiben, doch wie jeder weiß, brauchen die Einhörner das Mondlicht, damit ihr Fell schön glänzend bleibt.“, sprach die Elster, und spannte ihre Flügel.
„Das ist wohl wahr.“, stimmte Símag Tíre zu. „So geht nun, verlasst den Wald, damit ihr noch etwas vom Mondlicht abbekommt. Kommt morgen wieder, und ich werde das Rätsel für Euch lösen.“, sprach sie, und Rua glaubte, das Knurren eines Magens von irgendwoher vernommen zu haben.
Sie verabschiedeten sich und versprachen, am nächsten Tag wieder zur Lichtung zurückzukehren. Sobald sie das Rudel hinter sich gelassen hatten, rannten und flogen die beiden, so schnell ihre Beine und Flügel sie tragen konnten, bis sie wieder im Hügelland in Sicherheit waren.
„Das war… unbehaglich.“, sagte Meaige, ganz außer Atem, und Rua nickte nur, schnaubend und keuchend vor Anstrengung. „Wir sind der Lösung des Rätsels um Dein verschwundenes Horn aber immer noch keinen Schritt nähergekommen.“, sagte die Elster, und wieder nickte Rua nur, diesmal jedoch traurig. „Aber morgen! Morgen werden wir es erneut versuchen!“, rief sie laut. „Wer haben noch lange nicht alle Tiere des Grünen Landes befragt, und…“, doch Rua, das Einhorn ohne Horn, unterbrach ihre Freundin:
„Es nützt nichts, ich bin einfach nur ein Pferd. Es gibt kein Horn, das gesucht und gefunden werden könnte.“
Und wieder weinte sie, wähnte sie doch alle Hoffnung verloren, und Meaige konnte nichts tun, als schweigend auf ihrem Rücken zu sitzen. Nach einiger Zeit hatte Rua, die ja immerhin noch ein sehr junges Einhorn war, alle Tränen vergossen, die sie zu vergießen hatte, und fühlte sich müde. Und so legte sie sich unter einen Baum und schlief ein. Doch Meaige konnte nicht schlafen. Sie war zwar müde, doch war sie auch wütend und traurig, dass sie ihrer Freundin nicht hatte helfen können. Sie trottete im Gras umher und gab sich alle Mühe, leise zu sein, sodass sie Rua nicht aufwecken würde, und fragte sich, was zu tun sei, als plötzlich ein riesiger Schatten hinter ihr auftauchte und das Licht von Frau Mond über ihr verdunkelte. Mit einem Flügelschlag, der so leise war wie der Atem des Windes, landete ein riesiger Vogel neben den beiden.
„Ich kenne Dich nicht! Verschwinde von hier und lass uns in Frieden!“, krähte Meaige aufgeregt. „Wir haben mächtige Freunde; nur ein Ruf, und Símag Tíre wird aus den Bergen herunterkommen und…“ Sie unterbrach ihre Tirade und legte den Kopf schief. „Was bist Du?“, fragte sie neugierig.
„Ich bin Ulchabhán“, antwortete der Vogel. „Es gibt da einen Lachs, der Herr des Sees ist, und eine Ziege, die Gebieterin über die Täler ist, und einen Hirsch, der König des Waldes ist, und Símag Tíre ist Königin der Berge. Doch ihre Herrschaftsgebiete existieren nur bei Tag. Aber ich bin Ulchabhán“, was in unserer Sprache „Eule“ bedeutet, „und ich herrsche über all diese Ländereien bei Nacht.“
Während Meaige unruhig gewesen war, als sie die Königin der Wölfe ausgetrickst hatten, hätte sie immer noch einfach davonfliegen können. Jetzt aber fürchtete sie sich wirklich. Dies war der mächtigste, stärkste, größte und gefährlichste Vogel, den sie je gesehen hatte.
„Ich verneige mich vor Dir.“, antwortete die Elster, und senkte ihr Haupt.
„Das solltest Du auch.“, sagte die Eule nur, und nickte. „Doch das ist nicht der Grund, warum ich hier bin. Überall im Grünen Land erzählt man sich nun Geschichten über ein seltsames Paar: ein hornloses Einhorn und eine hirnlose Elster, beide auf der Suche nach einem verschwundenen Horn. Sind diese Geschichten wahr?“
„Ja das sind sie.“, stimmte Meaige missmutig zu, die Spitze gegen sie geflissentlich ignorierend.
„Niemand wird ihr ein Horn beschaffen können.“, sagte Ulchabhán.
„Das hatte ich befürchtet.“, antwortete die Elster, niedergeschlagen ob dieser Enthüllung.
„Doch ich weiß von Magie, die Euch helfen könnte.“, fuhr die Eule fort.
„Bestimmt kann sie das! Ich wusste es, ich…“, rief Meaige, doch hielt sie inne, als die Eule einen ihrer mächtigen Schwingen hob.
„Aber es gibt einen Preis, den es zu bezahlen gilt.“, mahnte Ulchabhán.
„Alles, was Du willst, Königin der Nacht“, versprach die Elster, „solange ich ihr helfen kann!“, und sie wies mit ihrem Flügel auf Rua, die immer noch schlief.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783946922537
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (Juni)
- Schlagworte
- Vorlesegeschichte Märchen Sagen Kinderbuch Jugendbuch