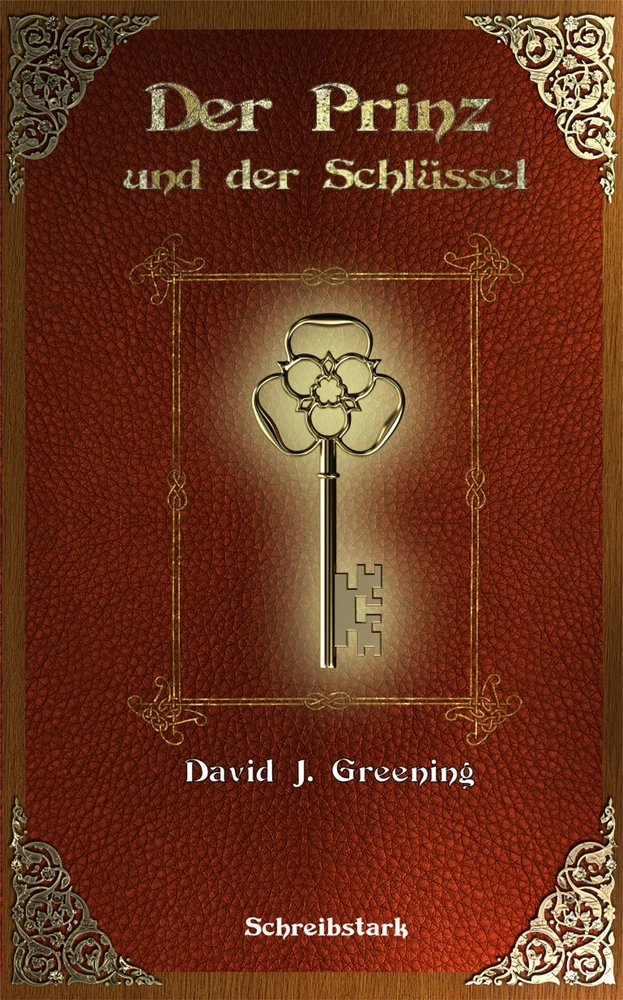Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Der Zauberer und der Dschinn
Es war einmal ein böser Zauberer. Er lebte in einem Dorf namens P’tol in der Mitte der Welt, weit im Osten des Grünen Landes, aber genauso weit entfernt vom Lautan Tedau, dem Friedlichen Meer im Westen, und so wurde das Land ‚Reiche der Mitte‘ genannt. Jedes von ihnen wurde von einem König oder einer Königin regiert, die sich manches Mal im Frieden, manches Mal im Krieg gegeneinander befanden. Obwohl er zutiefst böse war, hatte der Zauberer keine wirkliche Macht andere zu unterwerfen oder ihnen etwa seinen Willen aufzuzwingen. Zumindest bis er eines Tages eine Lampe auf dem Basar seiner Heimatstadt kaufte.
Sie war aus Messing, schmucklos und billig, da er arm war, keine Macht besaß und lediglich Liebestränke, Amulette und anderen Tand verkaufen konnte. Er nahm die Lampe mit nach Hause und begann sie zu polieren, da er sogar zu arm war, um sich einen Diener leisten zu können. Als er jedoch an dem Metall rieb, geschah etwas Seltsames: Zu seiner Überraschung begann ein Dschinn aus dem Reich der Geister wie Rauch aus dem Ausguss der Lampe zu strömen! Voller Furcht ließ der Zauberer die Lampe fallen und kroch auf allen Vieren rückwärts davon, bis er mit dem Hinterkopf gegen die Rückwand seiner jämmerlichen Hütte stieß.
„Wer hat es gewagt mich zu wecken?“, dröhnte die Kreatur, die inzwischen begonnen hatte, den Raum in seiner Gesamtheit zu füllen, in einer Stimme, die so tief und laut wie eine Glocke war. „Deinen Namen, nenne ihn mir sofort!“, forderte sie.
„Ha-Hazin“, stotterte der Zauberer.
„Hahazin, du hast mich geweckt! Nenne mir deinen Grund dafür!“, dröhnte daraufhin die Antwort des Dschinns.
„Äh, eigentlich heiße ich nur Hazin.“, antwortete der Zauberer zurückhaltend und hielt seine Hände über dem Kopf in Erwartung einer drastischen Form der Rüge, die allerdings nicht kam.
„Dann eben Hazin. Oh Hazin, so höre mich an!“, sagte der Dschinn. „Ich habe hundertmal hundert Jahre in dieser Lampe geschlafen. Die ersten fünftausend Jahre schwor ich dem Mann, der mich befreit, jeden Wunsch zu erfüllen, aber während der zweiten fünftausend Jahre war ich mit Zorn erfüllt von meiner Gefangenschaft, und so habe ich geschworen, den Mann zu vernichten, der mich befreit! So mache dich nun bereit zu sterben, Hazin!“
Zitternd schloss der Zauberer fest die Augen und hielt furchterfüllt seine Hände hoch, in der Hoffnung, den mächtigen Dschinn irgendwie daran zu hindern, seine abscheuliche Tat auszuführen. Aber zu seiner eigenen Überraschung geschah nichts und der Dschinn hatte plötzlich innegehalten. Langsam öffnete der Zauberer zuerst ein Auge, dann das andere. Und er sah, dass der Dschinn, dessen Form sich durch den dicken Rauch, der aus der Lampe gequollen war, verfestigt hatte, sich hingehockt hatte und mit seinem Körper das kleine Haus fast vollständig ausfüllte.
„Wenn ihr mich töten wollt, dann tut es schnell!“, sagte der Zauberer schließlich, aber zu seiner völligen Überraschung verbeugte sich nun stattdessen der Dschinn, bis seine Stirn den gestampften Lehmboden berührte. Hazin schüttelte ungläubig den Kopf und sagte: „Ich dachte, ihr wolltet mich töten? Warum habt ihr innegehalten?“
„Meine aufrichtige Entschuldigung, oh Meister der Zauberei!“, antwortete der Dschinn. „Ich sah euer Amulett und wusste, dass ihr ein Mann seid, der sich mit der Weisheit der Magie auskennt. Ich wünsche nicht einen so mächtigen Zauberer herauszufordern.“
Verblüfft blickte der Zauberer auf seine Hände: Und tatsächlich hing an seinem linken Handgelenk ein Liebesamulett, das er Anfang der Woche angefertigt, aber nicht hatte verkaufen können, da die meisten Menschen in der Stadt inzwischen gehört hatten, dass seine Zaubersprüche und Objekte nichts anderes waren als Tand, um die Leichtgläubigen zu täuschen.
„Ich bin ein Zauberer!“, rief Hazin daraufhin aus und schwenkte das aus Glas- und Silberperlen, Federn und Pelzstückchen gefertigte Armband herum. „Der Mächtigste!“
„Ich bitte um Entschuldigung, Meister!“, antwortete der Dschinn und verbeugte sich noch tiefer. „Dein Wille soll meiner sein, mein Arm gehört dir, dein Wunsch ist der Meinige.“
„Ich kann dir befehlen?“
„Das könnt ihr, Meister.“, antwortete der Dschinn.
Der Zauberer rieb sich das Kinn. Das war alles zu einfach gewesen, dachte er bei sich. Dieser Dschinn war in der Tat ein mächtiger Geist und hätte ihn vor wenigen Augenblicken fast getötet. Er musste ihn an sich binden, damit nur er alleine über seine Kräfte verfügen konnte! Schnell wich seine anfängliche Angst seiner üblichen Bosheit, und so sagte Hazin: „Ich befehle dir, mir hundert Jahre lang zu gehorchen, bis mir weitere Dinge einfallen, die ich von dir fordern werde!“
„Ich höre und gehorche, Meister.“, antwortete der Dschinn mit gedämpfter Stimme und verbeugte sich noch einmal tief.
Und so erfüllte der Dschinn alle Wünsche des Zauberers. Innerhalb kurzer Zeit erlangte Hazin die Kontrolle über P’tol und unterjochte alle Bürger, um sie seine finsteren Pläne ausführen zu lassen. Mit Hilfe des Dschinns unterwarf er sodann in nur wenigen Jahren alle Städte von Padjis, dem Teil der mittleren Königreiche, in dem er lebte. Und so regierte Hazin seine Untertanen mit eiserner Faust und duldete keinen Ungehorsam und keine Infragestellung seiner Autorität. Dank des Dschinns blieb er im Alter gesund und rüstig, ohne dass sein Körper oder sein Wille nachließen. Doch dann, bevor Hazin es bemerkte, war die Spanne von hundert Jahren vorbei und der Dschinn sprach bei seinem Herrn vor.
„Seit hundert Jahren diene ich euch nun, mein Meister, nicht einen Tag mehr, nicht einen Tag weniger. Und jetzt sage ich Lebewohl und verabschiede mich von euch.“, sagte er und verneigte sich tief.
„Lebewohl?“, lachte Hazin, der sich inzwischen nicht mehr nur als Zauberer, sondern als ‚eure Majestät‘ oder ‚Herr‘ oder mit ähnlichen Titeln ansprechen ließ, hämisch. „Ich werde dich nicht gehen lassen, Dschinn! Ganz im Gegenteil! Ich habe immer noch Pläne, und du wirst mir damit helfen!“, und er lachte freudlos über den Ausdruck von Enttäuschung und Verzweiflung auf dem Gesicht des Dschinns.
„Ich werde ehrlich zu euch sein, Meister: Ich habe zehn Mal zehn Jahre lang jede eurer Launen umgesetzt. Aber ein Dschinn muss umherstreifen, sonst verliert er seine Kräfte. Und welchen Nutzen hätte ich wohl ohne sie für euch?“
Während er sich über Ersteres nicht sicher war, war Letzteres nur allzu wahr, dachte sich Hazin und strich sich zerstreut über das Kinn. Was wäre er ohne den mächtigen Dschinn? Zurück in seiner Hütte, wo er dann wahrscheinlich wieder Schmuck und Liebestränke verkaufen müsste, wurde ihm klar. Er brauchte schnell mehr Macht, und bald, bevor der Dschinn ihn verließ!
„Nun gut, ich werde zustimmen, dich gehen zu lassen.“, begann er und was den Dschinn lächeln ließ. „Unter einer Bedingung!“, fügte er hinzu, woraufhin das Lächeln genauso schnell verflog, wie es erschienen war. „Ich brauche einen neuen Untergebenen, der mir dient. Wenn du einen findest, dann sollst du frei sein!“
Zu seiner Überraschung lächelte der Dschinn als er sich daraufhin tief verbeugte, nur um sich dann wiederaufzurichten und eine Feder vor sich in der Hand zu halten. Sie war so lang wie der Arm des Zauberers, und er war beeindruckt beim Gedanken an das Tier, von dem sie wohl stammte, aber er schaffte es schnell, jeden Anschein von Besorgnis zu überwinden.
„Eine Feder?“, fragte der Zauberer. „Was soll ich mit so etwas machen?“
„Dies ist nicht irgendeine Feder, Meister“, antwortete der Dschinn, „so groß sie auch erscheinen mag, so ist sie nur eine der kleinsten Federn vom Flügel des mächtigen Roc.“
„Der Roc?“, kam die Antwort, „Ich dachte, der Vogel sei nur ein Märchen!“
„Nein, Meister, der Vogel ist so echt und lebendig wie ich selbst.“, antwortete der Dschinn mit leisem Spott, der aber zu seinem Glück vom Zauberer unbemerkt blieb. „Der Roc verliert jedes Jahr nur eine einzige Feder. Mit den richtigen Zaubersprüchen, die sich in meinem Besitz befinden, kann derjenige, der sie findet, Macht über die magischen Fähigkeiten des Vogels erlangen.“
„Gib sie mir, sofort!“, befahl Hazin und streckte seine krallenartige Hand nach ihr aus.
„Obwohl ich dies natürlich tun könnte, kann der Zauber, der notwendig ist, um den Roc eurem Willen zu beugen, nur aus freien Stücken und freien Willens übergeben werden, den ich natürlich nicht mehr habe.“, fügte er hinzu und verbeugte sich tief, um das breite Grinsen, das sich auf seinem Gesicht ausbreitete, zu verbergen.
Hazin blickte seinen Diener finster an und nickte allmählich, als er die List hinter dem Plan des Dschinns erkannte. Er gab dem Unausweichlichen nach und sagte: „So sei es, Sklave. Ich werde dich freilassen, wenn du mir den Zauber gibst, um den Roc zu bändigen.“
„Ich würde euch darum bitten, dies zu schwören, damit ihr euer Versprechen nicht zufällig wieder vergesst.“, antwortete der Dschinn.
„Ein böser Geist bist du, oh Dschinn!“, antwortete der Zauberer. „So sei es also, bei allen Geistern des Landes, des Meeres und des Himmels, ich schwöre, dich freizulassen, um den Preis, dass ich den Roc befehligen mag! Und jetzt gib mir die Feder und den Zauber!“, forderte er.
„Ich danke euch dafür, dass ihr mich endlich befreit habt.“, begann der Dschinn, wobei auf einmal jeglicher Respekt aus seiner Stimme wich. „Jetzt werde ich meinen Teil der Abmachung einhalten.“, fuhr er fort und überreichte Hazin in einer eleganten Geste, wie es einem Wesen aus Rauch gebührte, die Feder. „Um den mächtigen Roc eurem Willen zu unterwerfen, müsst ihr die Feder in einem Feuer aus Bernstein verbrennen und die folgenden Worte sagen: Unterwerfe dich mir, oh Roc, und sei mein auf hundert Mal hundert Jahre!“
„Nur hundert mal hundert Jahre?“, wiederholte der Zauberer.
„Oder weniger. Früher oder später wird auch die Kraft des Rocs verbraucht sein, obwohl sie viel größer ist als die meine. Aber ich bin sicher, dass ihr mit der Zeit einen neuen Diener finden werdet.“
Und ohne ein weiteres Wort lachte der Dschinn über seine neu gewonnene Freiheit und verflüchtigte sich vor Hazins Augen, bis er sich buchstäblich in Rauch aufgelöst hatte. Der Zauberer spielte mit der riesigen Feder, machte eine wegwerfende Geste in Richtung seines einstigen Dieners und fragte sich, was genau Bernstein sein mochte und wo er ihn wohl herbekommen könne.
Der Steingötze und das Momo’e
Es war einmal ein Mädchen mit dem Namen Kura-Kura. Ihr Volk, die Schardana, was in unserer Sprache ‚Das Seevolk‘ bedeutet, lebte als Fischer und Händler auf dem Friedlichen Ozean, weit im Osten der Welt. Nachdem sie ihre Eltern durch einen Sturm verloren hatte, war sie von Tawhito und Tua adoptiert worden, einem alten Paar, das keine eigenen Kinder hatte. Manchmal, wenn Kura-Kura nachts nicht schlafen konnte, bat sie ihren Vater, ihr eine Geschichte zu erzählen.
„Kannst du nicht schlafen, Tamaiti?“, sagte Tawhito dann manchmal zu ihr, und Tamaiti bedeutet ‚Kind‘ in unserer Sprache.
„Nein, Ayah“, antwortete sie, und ‚Ayah‘ bedeutet natürlich ‚Vater‘. „Erzählst du mir eine Geschichte?“
Ihr Vater seufzte dann und tat so, als sei er beschäftigt oder müde oder beides. Aber dann setzte er sich immer neben sie und erzählte ihr eine Geschichte.
„Welche Geschichte möchtest du hören, Tamaiti? Vielleicht die Geschichte vom Korua Raksasa?“, fragte er und lächelte, denn er wusste, dass dies ihre Lieblingsgeschichte war.
„Nein, eine andere.“, antwortete sie. „Ich habe mich gefragt: Woher kennen die Schamanen das Momo’e?“
Die Schamanen waren gelehrte Männer und Frauen an Bord der mächtigen Schiffe des Seevolkes, die alles wussten, was es zu wissen gab, oder zumindest alles, was die Schardana wussten. Aber das Momo’e, das war eine Macht, die nur wenige von ihnen besaßen, nämlich die Macht die Geisterwelt zu betreten. Tawhito kratzte sich bei dieser Bitte am Kopf, denn die Geschichte vom Ursprung des Momo’e war alt und fast vergessen, selbst von ihm. Aber nachdem er einen Augenblick nachgedacht hatte, nickte er und sagte:
„Es gab einmal einen Daimon, einen Geist namens Kohatu. Er gehörte zur Familie der Geister des Trockenlandes, die nicht direkt Mutter Ozean oder Vater Himmel unterworfen sind, sondern sich selbst regieren.“
Kura-Kura nickte, sie hatte natürlich von den Geistern des Landes, den Wairua Whenua, gehört, aber als Volk des Meeres hatten ihre Leute nicht viel mit ihnen zu tun.
„Nun, dieser Kohatu war ein schlechter Kerl.“, fuhr ihr Vater fort. „Er liebte es, den Männern und Frauen im Trockenland Streiche zu spielen, ihre Milch sauer werden zu lassen, ihnen die Ernte zu verhageln und manchmal sogar Freunde gegeneinander aufzuwiegeln, alles nur aus Gemeinheit und Liebe zur Boshaftigkeit.“
„Das ist schlecht.“, sagte Kura-Kura ernst.
„Das ist es in der Tat, Tamaiti.“, erwiderte ihr Vater und nickte. „Aber während wir Schardana einfach weitersegeln können, wenn wir entdecken, dass sich ein Teil des Meeres unter dem Einfluss eines bösen Geistes befindet, so können die Männer und Frauen auf dem Trockenland das natürlich nicht. Sie müssen bleiben und sich um ihre Felder, Obstgärten und Tiere kümmern. Nach einem besonders bösen Streich, bei dem der Kohatu so viele Ernten verhagelt hatte, dass die Menschen auf dem Trockenland ein Jahr lang hungern mussten, beschlossen die anderen Geister des Festlandes, ihn zu bestrafen.“
„Kann man einen Geist bestrafen?“, fragte Kura-Kura überrascht.
„Oh ja, Tamaiti.“, antwortete ihr Vater. „Während wir Wesen der stofflichen Welt sind, sind die Geister natürlich Wesen der nicht-stofflichen Welt. Was glaubst du, wäre wohl die schlimmste Strafe für einen von ihnen?“, fragte er seine Tochter.
„Hm… vielleicht ihn stofflich zu machen?“, sagte sie, und ihr Vater nickte, erfreut darüber, dass er eine so kluge Tochter hatte.
„In der Tat; und so wurde es entschieden und so wurde es gemacht. Die anderen Wairua Whenua versammelten sich und setzen den bösen Kohatu mit einem Zauber in einen riesigen Steingötzen gefangen, den sie dann in ein abgelegenes Tal in einem abgelegenen Teil vom Trockenland brachten. Und so schlief er in seinem Stein.“
„Und der Kohatu, der war da ganz allein?“, fragte Kura-Kura.
„Ja, das war er, und zwar mehrere Menschenleben lang, so wie wir Schardana solche Dinge messen. Aber dann, eines Tages, wurde das Tal von einem Stamm von Pirumbi entdeckt.“, so heißen die dunkelhäutigen Menschen auf dem Trockenland, die Verwandten der Schardana. „Die Pflanzen gediehen üppig und es gab viele Tiere, die man jagen oder zähmen konnte, und so ließen sie sich dort nieder.“
„Aber was war mit dem Kohatu im Steingötzen?“, wollte seine Tochter wissen.
„Oh, er war noch da. Und als die Pirumbi den Ort zu ihrer Heimat gemacht hatten und ihre Pflanzen und Tiere gediehen, erwachte der Kohatu vom Lärm um ihn herum. Er fing an, ihre Gedanken von der steinernen Statue aus zu beeinflussen, die er ja nun bewohnte, und spielte den Männern und Frauen erneut seine bösen Streiche, auch wenn er natürlich viel weniger Macht besaß, als bevor man ihn im Stein gefangengesetzt hatte.“
„Hat er denn viel Schaden angerichtet?“, fragte Kura-Kura.
„So viel er konnte.“, zuckte Tawhito mit den Achseln. „Er war so lange im Stein gefangen, dass er nur daran dachte, böse Taten zu vollbringen.“
„Das ist traurig. Der Kohatu tut mir leid.“, sagte seine Tochter.
„Es war eine traurige Zeit.“, sagte ihr Vater und streichelte ihr liebevoll über das Haar. „Seit einiger Zeit liefen die Dinge im Dorf nicht mehr gut, und es war den Männern und Frauen allmählich klar geworden, dass dies etwas mit dem Steingötzen zu tun haben musste. Aber wie ich schon sagte, die Menschen auf dem Trockenland können nicht einfach weggehen…“
„Wegen ihrer Felder und Tiere.“, vervollständigte seine Tochter den Gedanken.
„Genau.“, stimmte ihr Tawhito zu. „Und der Steingötze war riesig, so groß wie mehrere Männer, wenn nicht sogar größer. Und da sie weder weggehen noch die steinerne Statue bewegen konnten, versuchten sie diese mit Geschenken und Opfern zu besänftigen.“
„Hat das geholfen?“, wollte Kura-Kura wissen.
„Leider nein. Es machte den Kohatu nur noch mächtiger. Und er nutzte seine Kräfte sofort, um noch mehr Unheil und Böses anzurichten. Aber dann kam der Tanzende Narr.“
„Der Tanzende Narr?“, sagte Kura-Kura und lächelte über einen derart seltsamen Namen.
„Genau, der Tanzende Narr. Niemand weiß, ob er ein Kersang, ein Pirumbi oder sogar ein Schardana war.“, sagte Tawhito. „Einige behaupten dies, wieder andere jenes, aber niemand weiß es wirklich. Was man jedoch weiß ist, dass er die ganze Zeit über tanzte, wenn er nicht gegessen oder geschlafen hat.“
„Wie ein Narr?“, fragte seine Tochter grinsend.
„Wie ein Besessener.“, erwiderte Tawhito und grinste zurück. „Das Interessante ist aber, dass der Tanzende Narr, wenn er tanzte, die stoffliche Welt verlassen…“
„Und die nicht-stoffliche betreten konnte.“, vervollständigte Kura-Kura den Satz.
„Ja.“, stimmte ihr Vater ihr nickend zu. „So kam der Tanzende Narr ins Dorf getanzt, sehr zur Überraschung und Verwunderung der Einwohner. Und dann beschloss einer der dort lebenden Männer oder Frauen, ihn zum Steingötzen zu führen, in der Hoffnung… nun, in der Hoffnung, die steinerne Statue zu besänftigen, nehme ich an.“
„Hat sich der böse Geist im Stein zum Besseren verändert?“, fragte seine Tochter.
„Nein, es ist sogar genau das Gegenteil passiert. Der Kohatu wurde wütend und eifersüchtig auf die Fähigkeit des Tanzenden Narren, das Geisterreich zu betreten, das ihm verschlossen war. Und so beschwor er die ganze Macht, die er aus den Opfern und Gaben der Dorfbewohner gewonnen hatte, verließ den steinernen Götzen, in dem er gefangen war, und besetzte den Körper des Narren.“
Kura-Kuras Augen wurden bei dieser Beschreibung groß: Ein Mann, dessen Körper von einem Geist übernommen worden war, und von einem bösen noch dazu!
„Das war schlecht.“, sagte sie mit gedämpfter Stimme.
„Das war es in der Tat“, stimmte ihr Vater ihr ernsthaft zu, nur um dann zu lächeln, „aber nicht für den Tanzenden Narren! Er tanzte einfach weiter, wirbelte selig umher und drehte sich, sein Geist der Welt um ihn herum entrückt, während seine glasigen Augen nur noch die Welt der Geister wahrnahmen. Aber der Kohatu war natürlich nicht an so viel Bewegung gewöhnt.“
„Weil er im Steingötzen gefangen war.“, meinte seine Tochter.
„Genau, denn er hatte viele Menschenleben lang bewegungslos dagestanden. Und da der Kohatu nach kurzer Zeit nicht mehr in der Lage war, wieder in die Geisterwelt zurückzukehren oder zumindest einen menschlichen Körper zu besetzen, um ihn seinem Willen zu unterwerfen, wurde ihm schnell ziemlich übel vom Springen und Hüpfen des Tanzenden Narren. Er versuchte, den Narren dazu zu zwingen aufzuhören, aber der Tanz ging einfach weiter, einen ganzen Monat voller Tage lang…“
„Und einen Monat voller Nächte.“, sagte Kura-Kura. „Aber hat der Kohatu nicht versucht, in seine steinerne Statue zurückzukehren?“, fragte sie.
„Das hat er, aber er fand schnell heraus, dass er all seine Kraft damit verbraucht hatte, um in den Körper des Narren zu gelangen, in dem er nun gefangen war.“
„Was ist mit dem Tanzenden Narren passiert, wo doch jetzt der Kohatu in ihm war?“, wollte seine Tochter wissen.
„Am Ende warf er den Kohatu ab.“, antwortete Tawhito lächelnd.
„Er warf den Kohatu ab?“, fragte Kura-Kura, „Wie denn?“
„Das weiß niemand mit Sicherheit, Tamaiti. kam die Antwort. „Es war wohl etwas, das mit der Kombination des Tanzes und der Tatsache zu tun hat, dass der Tanzende Narr Teil der nicht-stofflichen Welt war, genauso wie der Kohatu Teil der stofflichen Welt geworden war, nehme ich an. Und dann, als der Tanzende Narr seinen Tanz fast beendet hatte und er ein letztes Mal herumwirbelte und sich drehte, fing eine Art Nebel an seinen Körper zu umgeben, und ein junger Mann stand plötzlich neben ihm.“
„Der Kohatu!“, sagte Kura-Kura aufgeregt.
„In der Tat.“, stimmte ihr Vater ihr zu. „Nachdem er den Steingötzen verlassen hatte, hatte ihn der Tanz des Narren vollständig in die stoffliche Welt gezogen und er wurde ein Mensch.“
„Was hat er dann gemacht?“, fragte seine Tochter, beeindruckt von diesem Wandel der Ereignisse.
„Der Tanzende Narr?“, erwiderte Tawhito. „Er fiel in einen tiefen Schlaf, und nachdem er erwachte, gaben die Dorfbewohner ein großes Fest zu seinen Ehren, weil er sie von der Macht des Steingötzen befreit hatte. Und dann ging er seiner Wege und tanzte einfach davon.“
„Und der Kohatu?”
„Nun, er war ja jetzt ein Mensch. Und obwohl die Männer und Frauen des Dorfes etwas Ehrfurcht vor ihm hatten, musste er jetzt arbeiten, wenn er essen wollte. Nach all dem Tanzen war alle Boshaftigkeit, die einmal in ihm gewesen war, aus ihm gewichen und auch alle seine niederträchtigen Gedanken. Aber weil er schon so lange ein Geist des Landes gewesen war, konnte er die Ernte auf den Feldern und die Tiere in ihren Ställen beeinflussen. Und so blühte das Dorf im Tal auf. Niemand musste mehr hungern solange er lebte, durch sein Wissen über Kräuter und Pflanzen heilte er Mensch und Tier, wenn sie krank waren und half den Menschen im Dorf, wo immer er konnte.“
„Also waren alle glücklich?“, fragte seine Tochter.
„Ich nehme es an.“, sagte Tawhito und streichelte ihr Haar. „Er heiratete ein Mädchen aus dem Dorf und sie hatten viele Kinder. Aber das Wichtigste ist, diese Jungen und Mädchen hatten das Blut der Geisterwelt in sich, das Blut des Kohatu. Und so hatten alle seine Nachkommen die Macht, Schamanen zu werden und durch Momo’e die Geisterwelt zu betreten.“
„Wie es der Tanzende Narr mit dem Tanzen gemacht hat.“, sagte Kura-Kura.
„Genau.“, stimmte ihr Vater ihr zu. „Aber weil der Kohatu nun ein Mensch war, brauchte er einen Männernamen und keinen Geisternamen, und so nannten ihn die Leute des Dorfes ‚Saudeleur‘, was ‚großer Schamane‘ in unserer Sprache bedeutet. Und so wurde der Kohatu der erste Schamane der Welt.“
„Wenn seine Kinder die Geisterwelt betreten konnten, konnte er es denn auch?“, fragte seine Tochter und gähnte, denn es war schon spät.
„Ja und nein“, antwortete Tawhito geheimnisvoll, „zumindest nicht durch Momo’e. Aber das ist eine andere Geschichte für eine andere Nacht, Tamaiti.“, sagte ihr Vater und er küsste seine kleine Tochter und deckte sie zu.
Und daraufhin seufzte seine Tochter zufrieden, denn jetzt konnte sie schlafen.
Der Prinz und der Schlüssel
Einst gab es im Königreich Réimse einen König, der zwei Söhne hatte. Sie waren Zwillinge und ihre Namen lauteten Chéad und Dara, was in unserer Sprache ‚Der Erste‘ und ‚Der Zweite‘ bedeutet, und ihre Mutter starb, als sie noch Kinder waren. Sie glichen einander äußerlich bis aufs Haar und nur wer sie sehr gut kannte, konnte sie zunächst unterscheiden. Es wurde jedoch schnell klar, dass sie ansonsten sehr unterschiedlich waren. Denn wo Dara geduldig und nachdenklich war, nur langsam zornig wurde und schnell Freunde fand, da war Chéad ungeduldig und achtlos und schnell beleidigt. Und doch würde eines Tages einer der beiden regieren, wenn ihr Vater, König Rialóir, schließlich starb.
Und so verging die Zeit und die beiden Knaben wurden zu Männern, während ihr Vater das Königreich weise und gerecht regierte, wie es gute Könige so tun. Aber alle wussten, dass er nicht ewig leben würde und so begann das Volk von Réimse über seinen Nachfolger zu diskutieren. Die meisten waren der Meinung, dass Dara König werden solle, da er der Bessere von beiden zu sein schien.
„Er ist gut und er ist friedliebend.“, sagten manche Leute. „Wer könnte wohl besser regieren als einer, der denkt, bevor er handelt und gute Berater um sich versammelt?“
Andere hingegen wollten, dass Chéad regiert.
„In der Tat, er ist manchmal schnell erzürnt.“, sagten sie dann. „Aber wir brauchen einen König, der nicht nur spricht und zuhört, um dann endlos nachzudenken, sondern der bereit ist zu handeln, wenn es nötig ist!“
Als nun König Rialóir allmählich alt und müde wurde, wurde es klar, dass es keinen Nachfolger gab, mit dem alle zufrieden sein würden. Dara hätte Chéad liebend gerne den Thron überlassen, aber seine Freunde und Berater bestanden darauf, dass er König werde und wiesen auf die Fehler seines Bruders hin. Und so durchstöberte er oft die Bibliothek des Schlosses nach einer Lösung für das Problem. Schließlich fand er eines Tages schließlich eine alte Handschrift mit dem Titel ‚Die Prinzessin und der Schlüssel‘.
Sie enthielt eine Geschichte über einen tapferen Prinzen, der einen Berggipfel bestieg, auf dem eine Prinzessin lebte, die den Schlüssel zum Glück in der Hand hielt. Sie heirateten und hatten Kinder, und ihre Nachkommen und die Nachkommen ihrer Nachkommen ließen sich in allen Teilen des Grünen Landes nieder und gründeten ihre eigenen Königreiche. Und einer von diesen hatte den Schlüssel mitgenommen und ihn unter dem Schlussstein seines eigenen Schlosses versteckt! Der Handschrift zufolge befand sich am Grundstein des Schlosses ein Raum, dessen Tür nur durch diesen geheimnisvollen Schlüssel geöffnet werden konnte. Und der Raum wurde ‚die Kammer der Wünsche‘ genannt, in der alle Wünsche Wirklichkeit wurden.
Dara nickte bei sich: Das war es, was er sich wünschte, das war es, was das Königreich brauchte. Sein größter Wunsch war es, dass das Reich seines Vaters nicht durch eine Auseinandersetzung der Brüder und ihrer Anhänger um die Krone geteilt würde. Und so wandte er sich an seinen Bruder und erzählte ihm von seiner Entdeckung.
„Und alle unsere Wünsche werden erfüllt werden?“, fragte Chéad, „Denn du weißt, dass ich mir wünsche, dass der Bessere von uns König werden möge.“, aber eigentlich wollte er seinem Vater auf den Thron nachfolgen, da er sich selbst für den Besseren der beiden hielt.
„So steht es geschrieben.“, antwortete Dara und hielt die alte Pergamentrolle hoch. „Wir sollen gemeinsam Schlüssel und Kammer finden, Bruder.“, sagte er und bot ihm die Hand.
„Das sollten wir.“, erwiderte Chéad und nahm die dargebotene Hand.
Doch während Dara wollte, dass ihre Suche gemeinsam erfolgreich verlief, wollte Chéad sich lediglich davor schützen, von seinem Bruder um den Thron betrogen zu werden, ohne ein Wort dieser seltsamen alten Geschichte zu glauben. Ihr Vater, König Rialóir, war durch sein hohes Alter schon bettlägerig und wollte die Nachfolge friedlich regeln. Daher beschwor er die beiden zusammenzuarbeiten.
Und so durchsuchten sie das Schloss. Der Schlussstein würde irgendwo oben sein, während die Kammer sich ganz unten befinden müsste. Tagelang erkundeten die beiden Brüder neue Gewölbe und geheime Kammern, aber sie fanden den Schlüssel nicht. Dies ging mehrere Wochen so, bis Chéad schließlich genug davon hatte. Er war nun überzeugt, dass sein Bruder die ganze Geschichte nur erfunden hatte, um ihn davon abzuhalten, mehr Unterstützer und Anhänger um sich zu scharen. Er hatte allerdings auch Angst, dass die Geschichte wahr sein könnte, sein Bruder den Schlüssel finden und somit die Kammer entdecken würde. Und so sah er schließlich keinen anderen Ausweg, als Dara zu töten.
Sie einigten sich darauf einen letzten Tag gemeinsam mit der Suche zu verbringen. Dann würden sie diese aufgeben und sich darauf konzentrieren, zu entscheiden, wer König werden sollte, jetzt da ihr Vater an der Tür des Todes stand. Insgeheim jedoch plante Chéad, einen der Steine über ihnen aus dem Mauerwerk zu lösen und seinen Bruder damit zu erschlagen, um dann die Angelegenheit als tragischen Unfall darzustellen. Dara hingegen wurde klar, dass sie einen Teil des obersten Teils des Schlosses noch nicht durchsucht hatten und war immer noch guter Hoffnung, dass sie den Schlüssel finden würden.
Sie bestiegen die oberen Wehrmauern und durchkämmten alles, aber bei Einbruch der Dunkelheit hatten sie immer noch nichts gefunden. Und dann, gerade als die Sonne begann unterzugehen, beleuchtete ein Lichtstrahl einen steinernen Giebel auf einem der Dächer über ihnen, und sie sahen, dass sich dort ein Riss im Mauerwerk befand.
„Der Tag ist vorüber“, sagte Chéad und schüttelte den Kopf, „und damit auch unsere Suche, Bruder.“
„Ist sie nicht.“, antwortete Dara und zeigte auf die Sonne. „Lass uns noch ein letztes Mal unter diesem Stein nachsehen, darum bitte ich dich.“
Achselzuckend nickte er, und Dara kletterte auf das Dach. Über ihnen waren die Steine tatsächlich lose, und so entfernte er den obersten und gab ihn seinem Bruder. Chéad lächelte: Sein eigener Bruder hatte ihm nun die Mittel an die Hand gegeben, um ihn zu beseitigen. Und so stellte er sich hinter Dara und erhob den Stein, um seinen eigenen Bruder niederzustrecken. Aber genau in diesem Augenblick entschied sich die Sonne dazu auf das Mauerwerk zu scheinen und etwas Glitzerndes darin blendete ihn, so dass er nicht in der Lage war, seinen bösen Plan durchzusetzen. Und siehe da, Dara hielt auf einmal einen Schlüssel hoch!
Sie hatten den Schlüssel gefunden, die Geschichte war wahr, erkannte Chéad und legte sorgfältig den Schlussstein der Burg nieder. Und so musste es die Kammer ebenfalls geben! Seine Wünsche würden sich erfüllen und er würde König werden! Dara gab ihm den Schlüssel: Er war viel kleiner als er erwartet hätte, sein goldenes Äußeres schien zerkratzt und staubig, aber trotzdem schön. Am Griffteil befanden sich mehrere Öffnungen, so dass er aussah wie einer der steinernen Fensterrahmen im großen Saal des Schlosses.
„Und jetzt lass uns die Kammer finden!“, sagte Dara begeistert, und diesmal nickte sein Bruder eifrig und gab ihm den Schlüssel zurück.
Wie es so geschah, schien ihnen der Schlüssel selbst den Weg zu weisen. Von Kräften bewegt, die ihnen unbekannt waren, zog er sie nun voran. Er spürte, wenn sie eine falsche Abzweigung nahmen und zerrte sie erst hierhin, dann dorthin, um die beiden in die richtige Richtung zu lenken. Nachdem sie in die tiefsten Tiefen der Schlossgewölbe hinabgestiegen waren, befanden sich die beiden schließlich in einem zugemauerten Gang.
„Hier ist nichts“, sagte Chéad ungeduldig, „los, gib ihn mir!“, fügte er hinzu, nahm den Schlüssel aus der Hand seines Bruders und reichte ihm die Fackel, mit der sie ihren Weg beleuchtet hatten.
Aber sie hatten ihr Ziel erreicht. Der Schlüssel zerrte und zog sie zurück, wenn sie versuchten, den zugemauerten Korridor zu verlassen. Am Ende warf Chéad den Schlüssel wütend gegen die Wand, unwillig weiter seine Zeit mit ihrem lächerlichen Unterfangen zu verschwenden. Zur Überraschung der beiden Brüder blieb der Schlüssel nicht nur an der Wand kleben, sondern auch in ihr stecken. Und plötzlich war aus dem, was noch zuvor unpassierbares Mauerwerk gewesen war, eine massive steinerne Tür geworden.
Dara blickte zu seinem Bruder, der einfach nur verblüfft dastand. Achselzuckend trat er vor und drehte den Schlüssel um. Knarrend und ächzend öffnete sich die Tür nach innen und sie erblickten dahinter einen beleuchteten Raum. Gerade als er die Schwelle überschreiten wollte, riss Chéad ihn zur Seite und ging hastig hinein. Sofort knallte die Tür vor Daras Augen zu, der Schlüssel drehte sich im Schloss, fiel auf den Boden und blieb dort liegen. Sein Bruder war weg, und nur der Schlüssel, der auf den Pflastersteinen zu seinen Füßen lag, gab einen Hinweis darauf, was geschehen war.
Eine Zeitlang stand Dara da und wartete, aber es passierte nichts. Schließlich setzte er sich hin und schlief nach kurzer Zeit ein. Seine Fackel verblasste allmählich und ließ ihn im Dunkeln zurück, bis auf das schwache Licht, das vom goldenen Schlüssel ausging. Und dann, urplötzlich, öffnete sich die Tür und Chéad erschien wieder. Als Dara versuchte, seinen Bruder zu umarmen, wurde er grob beiseitegeschoben. Und dann begann Chéad zu lachen: Aber es war kein Lachen des Glücks oder der Freude, der Gelassenheit oder Zufriedenheit, sondern ein Lachen des Wahnsinns. Sein Bruder hatte in der Kammer der Wünsche seinen Verstand verloren.
Dara schüttelte erstaunt den Kopf. Chéad brach zu seinen Füßen zusammen und wurde schnell bewusstlos, was sein wahnsinniges Lachen abrupt verstummen ließ. Er schluckte hart, blickte hinunter auf den Schlüssel und schaute dann wieder auf die offene Tür. Er nickte entschlossen und entschied sich herauszufinden, was sich hinter der Tür und in der Kammer befand. Und so nahm er all seinen Mut zusammen, ergriff den Schlüssel und ging hinein.
Sofort schlug die Tür laut hinter ihm zu, so wie zuvor hinter seinem Bruder, und setzte ihn gefangen. Er steckte den Schlüssel vorsichtig in seine Tasche, damit er ihn immer zur Hand hatte und sah sich um. Er war in einem Raum, weder klein noch groß, einfach nur eine Kammer. Es gab keine Fenster, da sie sich tief unter der Erde befanden, und keine Türen oder andere Öffnungen. Er ging langsam in die Mitte des Raumes, aber da war immer noch nichts. Einen Moment lang wartete er einfach und dann fühlte er plötzlich, wie sich der Schlüssel in seiner Tasche erhitzte. Er nahm ihn schnell heraus, nur um festzustellen, dass er plötzlich schwer geworden war und heiß genug, um ihm die Finger zu verbrennen. Und so ließ Dara ihn hastig auf den Boden fallen.
Zu seiner völligen Überraschung stieg auf einmal Nebel vom Boden auf, der sich zur Gestalt eines jungen Mädchens verfestigte.
„Ich bin die Prinzessin des Schlüssels.“, sagte sie lächelnd. „Und dein Wunsch wurde dir erfüllt.“
Hierauf blickte Dara überrascht zurück. Wie konnte das sein? Er hatte um nichts gebeten, niemandem von seinen Wünschen erzählt, erst recht nicht dieser seltsamen nebulösen Erscheinung. Und wie lauteten eigentlich seine Wünsche, was hatte er sich überhaupt gewünscht?
„Du kennst die Antwort auf derlei Fragen, mein Prinz.“, sagte sie, ganz so, als ob sie seine Gedanken lesen konnte.
Da sie nicht weitersprach, dachte Dara über die Sache nach. Er blickte auf seine Hand hinunter, sah jedoch, dass sie unversehrt war. So war ihm also sein Wunsch erfüllt worden, oder so behauptete sie zumindest.
„Ich will, dass das Königreich einen guten Herrscher hat.“, sagte er schließlich.
„Das hat es.“, antwortete die Prinzessin. „Du bist es.“
„Aber was ist mit meinem Bruder?“, fragte er, „Wenn ihm sein Wunsch erfüllt wurde, warum liegt er dann draußen auf dem Boden, wahnsinnig geworden von dem, was er hier gesehen haben muss?“
„Weil es das ist, was er wollte.“, kam die Antwort. „Er wollte Boshaftigkeit und Macht und die Fähigkeit, andere seinen Wünschen zu unterwerfen.“
„Aber warum ist er dann krank?“, wollte Dara wissen.
„Wer könnte wohl so viel Bosheit in sich aufnehmen, ohne verrückt zu werden?“, antwortete die Prinzessin traurig. „Er sehnte sich nach Niederträchtigem und Bösem, und so wurde es ihm zuteil. Es ist nicht die Schuld der Kammer, dass er nicht damit umgehen konnte.“
Hierauf ließ Dara den Kopf hängen. Sein Bruder, dessen Fehler ihm immer nur zu offensichtlich gewesen waren, war gebrochen. Er setzte sich auf den Steinboden der Kammer und weinte um Chéad, denn er hatte immer gehofft, sein Bruder würde mit der Zeit ein besserer Mensch werden.
„Warum weinst du?“, fragte die Prinzessin.
„Er ist mein Bruder.“, antwortete er, „Wenn du Recht hast, dann wird er nie wieder er selbst sein.“
„Nein, das wird er nicht.“, sagte sie und schüttelte den Kopf.
„Ich kann nicht König werden, wenn mein Bruder sich in diesem Zustand befindet. Er wird mich brauchen, wenn er leben soll. Ich werde abdanken.“, erwiderte Dara ernsthaft.
„Das ist traurig. Denn dann wird das Königreich zerfallen, zerrissen zwischen den Männern deines Bruders und deinen eigenen.“, sagte die Prinzessin mit unglücklicher Stimme. „Und das Erbe deines Vaters wird für immer verloren sein. So wie auch der Schlüssel.“, fügte sie hinzu.
„Aber gibt es denn nichts, was ich tun kann?“, fragte Dara.
„Doch, das gibt es.“, antwortete sie. „Aber dafür muss dein Bruder die Kammer nochmals betreten.“
„Ich werde ihn nicht dazu überreden können.“, antwortete er.
„Dann wird er so bleiben, wie er ist.“, sagte die Prinzessin.
„Nun denn, so sei es.“, nickte Dara. „Wenn dies also der einzige Weg ist.“, und er stand auf, rieb sich das Gesicht und die Tür öffnete sich, um ihn hinauszulassen.
Er hob seinen Bruder auf, der wie ein Säugling vor sich hinplapperte und dessen Hände und Füße sich ganz so bewegten als ob er schliefe, und trug ihn in die Kammer. Sofort änderte sich sein Verhalten. Als er erkannte, wo er war, fing er an zu weinen, er lag auf dem Boden und hielt die Hände über die Augen. Die Prinzessin näherte sich ihm und berührte sanft seine Schulter. Innerhalb weniger Augenblicke beruhigte er sich und begann friedlich und ruhig zu schlafen.
„Er ist geheilt“, sagte die Prinzessin „ganz wie du es dir gewünscht hast. Aber wie ich dir sagte: Er wird nicht derselbe sein.“
„Ich danke euch, meine Dame.“, sagte Dara und verbeugte sich vor ihr. „Er ist ein Mann mit vielen Fehlern, aber er wird immer mein Bruder sein. Aber was soll nun aus Réimse werden? Wer soll nach dem Tod meines Vaters regieren?“
„Du kennst die Antwort auf derlei Fragen, mein Prinz.“, sagte sie und lachte sanft. „Und nun muss ich gehen.“
„Werde ich euch wiedersehen?“, fragte Dara hoffnungsvoll.
„Nein, mich nicht“, antwortete sie und schüttelte den Kopf, „aber eine meiner Töchter oder Enkelinnen oder Urenkelinnen.“
„Werden wir glücklich sein? Wird das Königreich gedeihen?“, fragte er, als sie vor seinen Augen zu verblassen begann.
„Wenn es das ist, was du begehrst, mein Prinz.“, sagte sie und war verschwunden.
Dara schaute nach unten, und die Kammer schien ihm vom Glanz des Schlüssels erleuchtet. Sie war nun leer, mit Ausnahme von ihm und seinem Bruder, der stöhnte und versuchte, aufzustehen. Er half ihm auf die Beine und die beiden sahen einander an. Und Chéad umarmte ihn und weinte.
„Ich war ein Narr“, sagte er, „bei allem, was ich wollte, hatte ich nur meinen eigenen Vorteil im Sinn, und jedes Mittel war mir recht dafür.“
„Das liegt jetzt in der Vergangenheit.“, sagte Dara und schüttelte den Kopf.
Und so kehrten die beiden zurück ins Licht, schlossen vorsichtig die Kammer der Wünsche hinter sich und legten den Schlüssel wieder unter den Schlussstein auf der Spitze des Schlosses. Nachdem sie dies vollbracht hatten, dieses Mal ohne zu streiten, kehrten sie an die Seite ihres Vaters zurück. Und als sie sich näherten, sahen sie, dass er schon bald sterben würde. Dara wollte mit seinem Vater sprechen, aber sein Bruder trat schnell vor.
„Dara muss König sein!“, sagte Chéad unvermittelt und kniete sich neben König Rialóir hin. „Ich tauge nicht dafür, dies weiß ich jetzt.“
Und der König lächelte und umarmte seinen Sohn.
„Es gab eine Zeit, da hätte ich deinen Bruder dir gegenüber bevorzugt. Aber da ich euch beide liebe, konnte ich nie zwischen euch beiden entscheiden.“, sagte der König mit müder Stimme. „Aber mit diesen Worten hast du dich als würdiger Nachfolger erwiesen.“
Dara trat vor, kniete nieder und sagte: „Ich stimme zu, Chéad muss König werden. Dies wünschte ich mir Vater, nämlich dass der Bessere von uns beiden König werden möge.“
„Oh, aber da liegst du falsch, mein Sohn!“, sagte König Rialóir, und nun erkannten sie, dass es mit ihm zu Ende ging. „Denn es wird zwei Könige geben.“, und nach diesen Worten umarmte er die beiden ein letztes Mal und starb.
Und so bekam das Königreich Réimse zwei Könige. Der eine wurde später als König Dara der Weise bekannt, während der andere als König Chéad der Unerschütterliche geachtet wurde. Und wie die Prinzessin des Schlüssels vorhergesagt hatte, traf Dara auf eine ihrer Enkelinnen. Sie heirateten und waren glücklich und hatten zusammen drei Töchter, aber das ist eine andere Geschichte.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783946922599
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (Juni)
- Schlagworte
- Kinder und Jugendbücher Fabeln Fantastische Erzählungen Märchen Sagen Legenden Kinderbuch