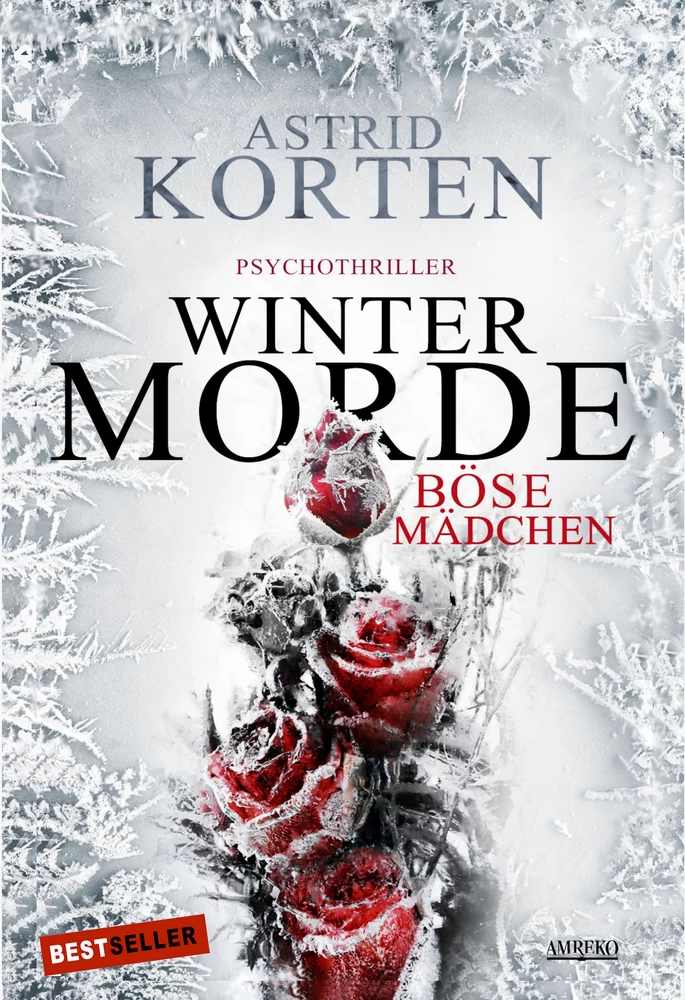Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Website: www.astrid-korten.com
Twitter: https://twitter.com/charbrontee
Google: Astrid Korten
Copyright 2017 Astrid Korten
Lektorat: Buchreif, Christine Hochberger
Bildnachweis: Shutterstock /PicFine
Covergestaltung ZERO Werbeagentur München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung der Autorin wiedergegeben werden.
WUT
„Wut gleicht einem vorübergehenden Wahnsinn, denn er ist,
ebenso wenig wie dieser, Herr über sich selbst.
Lucius Annaeus Seneca
Über das Buch
WUT * HASS * RACHE *
Was wir taten, war unvorstellbar.
Verlegerin Alma, erdrückt von Beruf, Familie und dem Desinteresse ihres Mannes, sucht nach radikaler Veränderung. Sie will ihren Mann loswerden. Alma sucht nach Gleichgesinnten und findet sie in einem Chatroom. Vier Frauen, ein gemeinsamer Nenner: Wut. Doch dann geschieht ein heimtückischer Mord, der wie ein Albtraum auf Almas Brust lastet. Als sie begreift, dass sie die Hauptfigur in einem perfiden Rachespiel ist, ist es zu spät.
Ein packender Psychothriller, in dem nichts so ist, wie es scheint, und der den Leser fassungslos zurücklässt.
Erste Buchkritiken:
Als hätte Gillian Flynn (Gone Girl) die Desperate Housewives ersonnen, so liest sich der neue Thriller von Astrid Korten, der mit dem verzweifelten Entschluss einer betrogenen Ehefrau beginnt und in einen packenden Strudel aus Tod und Täuschung mündet.
Wolfgang Brandner, Kulturreferent
Wenn man denkt, dass es gar nicht mehr böser geht, setzt Astrid Korten noch einen drauf! Chapeau! Wer Psychothriller mit Tiefgang, Wendungen und Überraschungen mag, wird "Wintermorde" lieben! Ein gut durchdachter und hervorragend erzählter Psychothriller!
Alexandra Hoffmann
Gegenwart
Tagebuch eines Häftlings
Ich bekomme keinen Besuch. Sie kommt nicht. Ich habe ihr einen Brief geschrieben, aber keine Antwort erhalten. Offenbar glaubt sie mir immer noch nicht.
„Alle Täter behaupten, dass sie unschuldig sind“, hat sie gesagt, als ich das letzte Mal mit ihr gesprochen habe. Ich rief, ich sei kein Verbrecher, und dass sie wüsste, dass ich so etwas nie tun würde. „Wenn du weiterhin oft genug wiederholst, dass du unschuldig bist, glaubst du es zum Schluss selbst“, hatte sie nur geantwortet.
Nachts, wenn ich nicht schlafen kann, kommen mir Zweifel. Ich starre dann die Decke an und komme zu der Erkenntnis, etwas Schreckliches getan zu haben, ohne es selbst zu wissen. In einem Anfall von Wahn?
Ich habe das Gefühl, dass ich allmählich meinen Verstand verliere. Vielleicht leide ich an einer Psychose. Vielleicht werde ich aber eines Tages mit einem klaren Kopf aufwachen und feststellen, dass ich es mir eingebildet habe, in einer Zelle eingesperrt gewesen zu sein. Wenn das möglich ist, könnte es sein, dass ich während einer Psychose gewalttätig geworden bin. Jemand, der seinen Verstand verliert, ist zu allem fähig.
*
Ich kann nicht. Selbst auf dem Papier kann ich es nicht sagen.
Neuer Versuch.
Wenn das möglich ist, kann es sein, dass ich einen Mord begangen habe.
Jetzt aber.
Dann kann es sein, dass ich ein Mörder bin.
*
Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, was ich getan habe und was nicht. Ich habe beschlossen, ihren Namen nicht mehr zu erwähnen.
Den Namen meiner Frau.
Gottverdammt.
Ich wünsche mir einen Brief von ihr.
Aber sie wird mir sicher bald die Scheidungspapiere zukommen lassen, mit dem Vermerk „Bitte nur unterschreiben.“
Wie lange muss ich mich denn noch in dieser verdammten Zelle zwischen diesem Pack einreihen? Gottvergessene Idioten, die ihren niedrigen IQ mit Krafttraining kompensieren, nackenlose Zuchtbullen, die brüllen, statt zu reden. Glauben, sie seien Alpha-Männchen, zumindest, wenn das Wort in ihrem Sprachschatz vorkommt. Wenn sie ihr Gehirn benutzt hätten, hätten sie nicht lebenslänglich bekommen. Dann hätten sie eine Ausbildung abgeschlossen, statt Drogen zu verkaufen, Frauen zu vergewaltigen oder bewaffnete Raubüberfälle zu begehen.
Ich bin hier noch keinem Wirtschaftskriminellen begegnet. In meinem Zellentrakt bin ich von harten Jungs umgeben, nicht von solchen, die der Steuerfahndung zum Opfer gefallen sind. Die sind in Trakt A untergebracht. Allerdings behaupten alle Inhaftierten ausnahmslos, sie wurden von Freund und Feind über den Tisch gezogen.
Wo sind meine Freunde?
Zum Glück sind meine Eltern tot, zumindest müssen sie nicht erleben, was gerade mit mir geschieht.
Ich bin nicht dumm, aber ich war nicht in der Lage, draußen zu bleiben. Es lag an den frustrierten Kripobeamten, die zu bequem waren, einen anderen Täter zu benennen.
Mir ist übel. Das Essen ist von mäßiger Qualität und ich habe bereits drei Kilo verloren, mein Liebling.
Ich brauche Hilfe. Ich muss meine Unschuld beweisen. Selbst mein Anwalt glaubt, dass ich lüge, ich sehe es ihm an. Seine Empfehlung lautet, mich schuldig zu bekennen, mein Bedauern zum Ausdruck zu bringen und auf Strafmilderung zu hoffen.
Nein! Das werde ich nicht tun.
Niemals!
Ich lege das Tagebuch des Häftlings beiseite und starre auf meine weiße Bürowand. Das Läuten des Telefons passt nicht zu dieser Situation. Ich schließe die Augen und warte, bis es aufhört. Als es im Raum wieder still ist, atme ich langsam und sehr bewusst aus. Es klingt wie ein flüchtiges Seufzen, vielleicht, weil mein Unterbewusstsein zu beschäftigt ist und mir merkwürdige und verstörende Szenen zeigt.
Stille.
Schweigen.
Ich werde Stillschweigen bewahren. Lange Zeit habe ich mich innerlich gegen diesen Kampf meines Lebens abgeschottet und die Ereignisse weit unten in den dunklen Tiefen meines Gedächtnisses vergraben. Das mag wohl daran liegen, dass ich fortan allen anderen etwas vormachen muss. Deshalb habe ich mich entschieden, meine Geschichte aufzuschreiben – und die des Häftlings, die mit meiner eigenen verknüpft ist. Mein Tagebuch ist der einzige Ort, an dem ich ehrlich sein kann. Ich brauche ein Ventil.
Ich nehme meinen Stift in die Hand und schreibe:
MÄNNER sind MÖRDER, Serientäter, und sie entkommen zu oft ihrer Strafe.
Hm … Diese Erkenntnis hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin: eine Serientäterin, eine Frau mit einem dunklen Geheimnis, mit einem erhöhten Puls, einem arrhythmischen Herzpochen, eine Frau, die ihre Augen irrlichtern lässt, hektisch und unsicher.
Mir ist bewusst, dass mein Zorn noch nicht verebbt ist – noch nicht richtig. Er liegt auf der Lauer, versteckt im Schatten, bereit, sich hinterrücks auf mich zu stürzen, wie eine Möwe, die im Sturzflug auf die See hinabstürzt. Ohne auch nur im Geringsten zu zögern, taucht sie kopfüber mit Höchstgeschwindigkeit ein, wenn sie ein Objekt ihrer Begierde unter der Wasseroberfläche ausmacht. Ihre heiseren Schreie – der möwische Gleichwert zu hinterhältiger Freude – verjagt ihre Beute nicht, die sie am Stück runterschlingt, ehe sie überhaupt weiß, wie ihr geschieht. So ähnlich erging es mir, als eine der Frauen möwengleich wieder aus dem Nichts auftauchte – ein Freitagmorgen im Februar, und diese Frau, die kalte Umarmung eines anderen Winters. Ich habe es gespürt – das Gefühl, dass jemand mich beobachtete, als ob mir eine Feder über die Haut im Nacken strich und mich zwischen den Schulterblättern frösteln ließ. Die Wolken teilten sich in dem Moment und der gleißende Schein der Wintersonne brach hervor und fiel auf den Schnee, wie ein Vorbote.
Der Schmerz, den sie mir zufügte, ist noch da – er ist nie weg gewesen, aber seine scharfen Kanten sind stumpf geworden. Ein Geheimnis zu hüten, ist schwieriger als ich geglaubt habe. Das Schweigen ist manchmal unerträglich. Schweigen übermannt mich mit Traurigkeit und lässt die Quelle der Melancholie sprudeln. Ich verstehe mittlerweile, warum Menschen betrügen und danach so töricht sind, den Betrug zu gestehen. Vielleicht ist das auf Dauer doch besser, als allein mit einem Geheimnis leben zu müssen.
Reue ist nicht das treffende Wort für das, was ich heute empfinde. Reue ist etwas für Feiglinge, die es nicht wagen, sich zu ihren Taten zu bekennen. Serienmörder verspüren tief in ihrem Inneren das Bedürfnis, gefasst zu werden. Sie suchen weniger Anerkennung als Aufmerksamkeit, das Rampenlicht, die Bühne – Schaut mich an, ich habe die Macht. Sie hinterlassen Spuren wie eine Unterschrift: Ich war hier. Die Tat selbst ist nicht genug, die Welt muss wissen, wie brillant sie sind. Serientäter sind intelligent und führen die Polizei an der Nase herum. Aber ihre Eitelkeit wird ihnen letztlich zum Verhängnis.
Ich muss mein Schweigen brechen, damit ich nicht wieder in die stählerne Falle der Vergangenheit tappe. Ein Tagebuch ist ein geeignetes Mittel für meine geheimen Wunden. Ich werde meine Geschichte aufschreiben, weil ich zu verstehen versuche, was vor einem Jahr geschehen ist. Mein Tagebuch wird niemand lesen, weder Greta, Marie und Sophie noch der Häftling, obwohl er ein Recht dazu hätte. Es gab eine Zeit – für alle – da waren wir glücklich. Ein Wort, das ich heute nicht mehr verwenden mag.
Marie, Sophie, Greta und ich.
Unser Lächeln war eine Kleinigkeit.
Was wir taten, war unvorstellbar.
Kapitel 1
Ein Jahr zuvor - Wie alles begann
Auszüge aus meinem Tagebuch.
Ich möchte ein schlechter Mensch werden.
Die Chance ist groß, dass ich, Alma Rösler, demnächst sterben werde. Besonders in der Nacht, sobald der Himmel mir auf den Kopf fällt und Gott gleich mit ihm, weil ich nur noch einen, höchstens zwei Tage unter den Wolken weile. Wenn ich wieder einmal schweißgebadet aufwache, kommt mir dieser Gedanke in den Sinn.
Seit meiner Geburt laufe ich Gefahr zu sterben. Also kann ich durchaus sagen, es hat sich kaum etwas verändert. Außer, dass mein Herz jetzt eine tickende Zeitbombe ist. Ich hatte einen Herzinfarkt, der meine Mitralklappe geschädigt hat. Morgen soll sie durch eine neue ersetzt werden.
Mein Arzt meinte, ich hätte Glück gehabt und sollte ihm vertrauen. Dr. Schäfer saß hinter einem weiß lackierten Tisch, als er mich über die Mitralklappe aufklärte, auf einem Stuhl mit einer hohen Lehne, die seinen Kopf mit dem gegelten, grau melierten Haar überragte. Ich habe mich damals gefragt, welchen Zweck dieser Stuhl wohl erfüllt. Die Lehne passt eher zu einem Gelehrten, der den ganzen Tag in starrer Haltung an einem wissenschaftlichen Durchbruch arbeitet. Solche Typen glauben, dass der Austausch einer Herzklappe einem Schnupfen gleichkommt. Schnupfen. Unheilbar. Endstadium. Die Viren platzen aus allen Nähten, brauchen Frischluft. Operation gleich Exitus. Hm ... Dr. Schäfer (= Schaf) kann also nicht viel tun. Er ist ja Arzt. Er kann nur die Klappe austauschen. Aber sein Stuhl soll vermutlich ausdrücken: Hier arbeitet eine Koryphäe. Ob es im Himmel auch Möbel gibt? Ich würde dann dort auf einem ähnlichen Möbelstück Platz nehmen, aber das wird gewiss von Gott belegt.
Dr. Schäfer trägt unter seinem weißen Kittel diese bestimmte Art von Pullovern, diese weichen, die Ehefrauen ihren Männern kaufen. Dadurch werde ich daran erinnert, dass er noch ein anderes Leben hat. In diesem anderen Leben segelt er an den Wochenenden mit einem alten Schulfreund – das hat er mir anvertraut. Ich gönne ihm seine Entspannung, aber nicht, wenn ich seine Patientin bin. Der Arzt, den ich mir erträume, hat kein Leben außerhalb der Krankenhausmauern, dies hier ist sein Leben. Wenn ich mir ausmale, dass er mich aufschneidet, während er seinem OP-Assistenten erzählt, dass er am Wochenende segeln war, bricht mir der Schweiß aus allen Poren. Warum hütet Dr. Schäfer keine Schafe? Darüber spricht man wenigstens nicht.
„Vertrauen“, wiederholte er leise, den Blick auf irgendetwas unten auf dem Boden gerichtet, was ich nicht sehen konnte. Ich lauschte damals seinen Worten, hörte die Diagnose und stand abrupt auf. Der Arzt auch. Ich glaubte, eine gewisse Erleichterung in seinem Gesicht zu sehen, schwer erkennbar, da sein selbstgerechter Ausdruck andere Emotionen plattwalzte. Männer wie er zeigen keine mimische Regung. Nicht nach dem Sex, nicht auf der Beerdigung der Mutter. Ich ging um seinen Schreibtisch herum, was er stirnrunzelnd zur Kenntnis nahm, sah ihm in die Augen. Sie nennen es Glück, wenn ich jeden Moment sterben kann? Ich glaube, es ist wohl eher Pech.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich wollte es sagen. Stattdessen dankte ich ihm. Nur wofür? Dass er mir zwei Minuten seiner kostbaren Zeit gewidmet hatte? Er reichte mir zum Abschied die Hand und ich befürchte, ich habe mich nochmals bei ihm bedankt.
Ich bin eine schlechte Nachricht
Ich bin mir bewusst, dass mein Herz jeden Moment seine Arbeit einstellen kann. Das Herz ist ein essenzielles Organ. Ohne Herz stirbt der Mensch. Sie werden mich aufschneiden, meine Rippen zersägen und mein Herz stilllegen. Dabei kann alles Mögliche schiefgehen. Vielleicht werde ich danach nicht mehr aufwachen. Jedes Jahr sterben eintausendsiebenhundert Patienten an einem Kunstfehler. Sie wurden krank eingeliefert und tot entlassen. Wenn ich meinem Mann die Fakten unter die Nase halte, findet er das morbid.
Der Tod kommt näher, so nah, dass er seinen Arm um meine Schulter legt. Dabei spüre ich sein Zittern. Und meinen Widerwillen. „Zu jung“, sagt das Leben. Doch der Tod widerspricht. „Alma, dies ist deine Chance. Dein Code lautet: Du bist eine Ausnahme.“
Selbst in dem Moment, in dem meine Mitralklappe undicht ist, zeige ich ein sozial wünschenswertes Benehmen. Ich belasse meine Hand auf dem Oberarm von Mister Tod, lächle freundlich. Ja, wir beide haben einen Deal: Ich sterbe, und du wirst leben. Machen wir.
Gute Vorsätze
Ich möchte ein schlechter Mensch werden. So, jetzt steht es hier. Schwarz auf weiß.
Nach meiner Operation habe ich verschiedene Optionen, falls ich noch lebe. Im Netz wimmelt es nur so von Schicksalsgefährten. Manche Herzpatienten trainieren für einen Marathon, obwohl sie vorher kaum einen Schritt zu Fuß gegangen sind. Andere fahren mit dem Fahrrad den Berg rauf und runter, möglichst in der Nähe einer Klinik. Manche gründen eine Stiftung. Fast alle möchten ein besserer Mensch werden. Das Ruder herumwerfen, nennen sie es. Fürs Erste verspüre ich nicht das geringste Bedürfnis nach Sport oder guten Taten.
Ich war schon immer ein wenig anmaßend und eingebildet und ich befürchte, dass der Zustand meines Herzens mich nicht davon heilen wird. Vielleicht bin ich eitel, aber ich versuche, Klischees zu vermeiden. Ich möchte kein besserer Mensch werden, nur weil mein Herz auf der Kippe steht und sich und mich womöglich aufgeben wird.
Wenn ich zurückblicke, was ich momentan ununterbrochen tue, habe ich mir mein ganzes Leben Gedanken darüber gemacht, was andere von mir halten. Die Anthropologie, die mein Verhalten der vergangenen Jahre zu erklären versucht, kommt zu dem Ergebnis, dass ich nur das getan habe, was andere von mir erwartet haben. Oder wovon ich glaubte, dass es von mir erwartet wurde. Ich begründete mein Verhalten, wusste fantastische Motivationen und Analysen aus dem Hut zu zaubern, aber letztlich war meine stärkste Triebfeder die Angst vor der sozialen Isolation. Es bedurfte einer defekten Mitralklappe für diese Erkenntnis.
Ich möchte eine Banane
Paul hat mir früher vorgeworfen, dass ich meine vermeintlich moralische Überlegenheit raushängen lasse. Meine Vernunft macht ihn verrückt und ich kann es ihm nicht mal verübeln. Folglich führe ich eine mentale Diskussion mit ihm, die ich schon längst hätte führen sollen. „Ich weiß, dass du es nicht leicht hast, aber das gibt dir nicht das Recht, mich wie einen Punchingball zu benutzen.“
Oder so ähnlich.
Ich möchte ein schlechter Mensch werden, und daran werde ich hart arbeiten. Der erste Schritt wäre, in Situationen, in denen alles Sinn ergibt, meine Missbilligung und meinen Unmut kundzutun. Wenn mir ein Pferd auf den Fuß tritt, krümme ich mich lieber vor Schmerz, als das edle Tier darauf hinzuweisen, dass es meine Zehe zerschmettert hat.
Der zweite Schritt bestünde darin, in Situationen, in denen es unpassend wäre, dennoch den Mund aufzumachen.
Es sind Situationen, mit denen Männer in der Regel keine Probleme haben. Sie glauben, alle Ansprüche wären ihnen bereits in die Wiege gelegt worden. Erfüllt sich das nicht, werden sie böse.
Affe möchte eine Banane.
Keine Banane im Haus.
Affe wird böse.
Der dritte Schritt bereitet mir schon jetzt eine ungeheuerliche Vorfreude auf das, was kommen wird. Diejenige zu sein, die wie ein Marktweib schreit. Diejenige zu sein, die sagt, dass es für dich heute keine Banane gibt. Den roten Knopf zu drücken, wann immer mir danach ist, ohne dass es mir etwas ausmacht, was andere davon halten.
Der Weißwurstmoment
Ich bin mir absolut der Tatsache bewusst, dass ich mich mit zweiundvierzig Jahren auf dem Höhepunkt meines Lebens befinde. Meine Unverwüstlichkeit hat meine zwanzigjährige Ehe mit Paul langsam erschöpft. Wie zwei Katzen schleichen wir beide in einem fremden Territorium umeinander, denn ich will dem endgültigen Verfall ein wenig entgegensteuern. Seit Jennys Geburt vor fünf Jahren gehen wir uns aus dem Weg. Wir sind zu sehr mit dem Mädchen beschäftigt, und deshalb kommt es uns vor, als bemühten wir uns auch um uns. Wir plaudern miteinander, oh ja, man höre und staune. Paul rumort in der Küche und ich sitze am Tisch, gebe gemurmelte Satzfetzen von mir und Bestätigungen in Form von Lautäußerungen wie Hm-hm, ja, aha.
Dann starrt Paul ins Leere, als hätte er meine Antwort nicht gehört. Er hat neuerdings diese Aussetzer, und sie häufen sich. Gerade noch hier bei mir, im nächsten Augenblick weit weg, als würde er auf einem Fluss aus Gedanken dahingleiten. Dann ist er wieder entspannt und unbekümmert. Ich verstehe, worum es hier geht, und schweige – wie immer. Paul erwähnte heute eine Versammlung, die bereits eine Woche zurücklag und zu der er hauptsächlich gegangen war, um sich zu ärgern. Dann erzählte er mir den Plot eines Kinofilms, den wir nicht zusammen gesehen haben. Ich habe nicht gefragt, wer ihn begleitet hat. Es gibt zu viele Karins, Chelseas oder Susannes. Schließlich sprach er von einem Kollegen mit einem todkranken Hund. Ich dachte an mein Herz und hatte Mitleid mit dem Hund.
Während Paul Kaffee kochte und erzählte, ging mir ein Spaziergang durch den Kopf. Ich meine einen richtigen Spaziergang, gänzlich ohne Ziel.
Wenn ich eine Gruppe mit Nordic-Walking-Stöcken an meinem Küchenfenster vorbeilaufen sehe, gehen mir die Bewohner der Dritten Welt durch den Kopf, die für eine Karaffe Wasser unzählige Kilometer pro Tag laufen. Versuch denen mal zu erklären, dass es Menschen gibt, die sich freiwillig mit Stöcken fortbewegen, vollkommen ohne Ziel.
Trotz meiner Aversion gegen wahlloses Walken ging ich heute vor die Tür. Ich hatte meinen freien Tag und die Decke fiel mir auf den Kopf. Ich musste etwas unternehmen und überlegte, was ich mir kaufen könnte, etwas, was ich brauchte, aber mir fiel nichts ein. Außerdem wollte ich nicht unbedingt in das nahe gelegene Einkaufscenter, wo mir Bekannte über den Weg laufen konnten. Ich entschied mich für eine andere Route und kam in eine Gegend, die ich nicht kannte: Ein kleiner Platz mit einem Café, einer traditionellen Bäckerei und einer Imbissbude. Plötzlich sah ich eine Person, die eine mir vertraute Jacke trug. Tatsächlich, sie gehörte Paul, der aus einem Wandautomaten eine dampfende Weißwurst zog und sie in kürzester Zeit verschlang, ohne sich auch nur ein einziges Mal umzusehen. Ich kam mir vor, als hätte ich ihn in dem Moment erwischt, in dem er mit einer Hure ein Bordell verließ.
Mein Mann scheint sein Leben ohne mich zu führen. Das weiß ich natürlich, aber es bleibt eine abstrakte Vorstellung, wenn ich ihn dabei nicht in einer Imbissbude erwische. Bis heute wusste ich nicht, dass er Weißwurst mag. Ich habe auch keine Ahnung, was er um diese Uhrzeit in dieser Gegend macht.
Plötzlich geriet mein ganzes Leben ins Wanken. Im Grunde habe ich keine Ahnung, wer Paul überhaupt ist, dieser Mann, den ich meinen Ehemann nenne. Ich erkannte seine Jacke, nicht mehr. Wahrscheinlich wäre er genauso erstaunt darüber gewesen, mich hier zu sehen.
Paul weiß nicht, was sich in meinem Kopf abspielt, und ich kann von meinem Ehemann nicht erwarten, dass er mich und meine wortreiche Stille versteht. Er interpretiert und analysiert stattdessen scharfsinnig meine achtlosen Bemerkungen, versucht, mich auf eine Art und Weise zu beruhigen, die mich nicht beruhigt.
Ich habe vor geraumer Zeit damit aufgehört, ihm zu erzählen, was ich fühle. Er hat keine Ahnung, dass ich in der Nacht stundenlang wach liege und seinem Schnarchen lausche. Ich liste ihm dabei flüsternd auf, was während der Operation alles schiefgehen könnte. Dass ich Angst vor dem Eingriff habe und mich vor dem Sterben fürchte, erwähne ich nicht.
Wie er jetzt seine Weißwurst hinunterschlang, kam er mir wie eine Person vor, in die ich mich niemals hätte verlieben können. Seine Schultern waren nach vorn gebeugt, seine Jacke wirkte verwaschen und aus der Mode. Er machte den Eindruck eines niedergeschlagenen Mannes, der sich mit seinem Schicksal abgefunden hatte.
Vielleicht isst er wöchentlich eine Weißwurst. Vielleicht macht er das schon länger. Vielleicht habe ich mich auf die Frage fixiert, ob er mich noch liebt, weil ich nicht darüber nachdenken möchte, ob ich ihn noch liebe. Es macht mir zu schaffen, und ebenfalls die Tatsache, dass meine Vorstellung, wer ich bin und wie ich mich zu verhalten habe, sehr viel instabiler ist, als ich bisher vermutet habe.
Ich eilte über den Platz, wollte ihn doch nicht kompromittieren.
Fiktive Gespräche
In meinem Kopf unterhalte ich mich mit anderen Menschen, führe vollständige Konversationen mit ihnen. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob diese Gespräche nicht doch stattgefunden haben. Das habe ich doch schon einmal erzählt, schießt es mir immer häufiger durch den Kopf. Ich habe keine Ahnung, ob es anderen Menschen ähnlich ergeht.
Während meiner inneren Monologe bin ich lebendig und eloquent. Ich erzähle bis ins Detail, was mir auffällt und bin erstaunt, dass es amüsant ist, und ich lache laut auf.
Paul hat mir einst versprochen, dass er mich warnt, wenn ich meinen Verstand verliere. Aber ich denke nicht im Traum daran, ihn an sein Versprechen zu erinnern.
Freier Fall
Ich liege wieder in einem Zimmer, das Menschen in weißer Kleidung betreten. Weder dieses Zimmer noch die Aussicht aus dem Fenster kommen mir bekannt vor. Draußen wird es dunkel. Ich liege schon ziemlich lange dort und frage mich, ob der Körper unter dem Laken mir gehört.
In den vergangenen Stunden habe ich mich in Gedanken mit Paul unterhalten und nicht einmal gelacht. Man kann das als einen Versuch auffassen, auf das Pflegepersonal geistig gesund und fit zu wirken. Aber im Grunde gibt es nichts zu lachen.
Unsere Unterhaltung?
„Paul, wo bleibst du?“
„...“
„Antworte gefälligst. Wo bleibst du?“
In Erwartung
Die Besuchszeit ist vorüber. Paul ist nicht gekommen. Er hat auch nicht angerufen oder mir eine SMS geschickt. Morgen werde ich operiert. Ich gerate in Panik. Falsch! Ich bin in Panik. Ich rufe ihn an. Es läutet. Der Anrufbeantworter springt an. Seltsam. Paul schaltet niemals den Anrufbeantworter ein und ganz gewiss nicht heute, da ich jeden Moment sterben könnte. Er muss doch erreichbar sein.
Ich habe keine Lust, seine Mutter anzurufen, mache es dennoch. Sie hat keine Ahnung, wo Paul ist. Seine Freunde wissen auch nichts. Sie versuchen, mich zu beruhigen, aber ich entnehme ihren Stimmen, dass auch sie es komisch finden. Hatte er einen Autounfall und sein Wagen liegt irgendwo in einem Graben? Oder ist dies der Moment, in dem Paul mich offiziell verlässt?
Schmerzen
Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen.
Ich habe Schmerzen.
Mein Name ist Alma Schmerz.
Schafe grasen auf meiner Weide – meinem Körper, ich warte auf das endgültige Signal des Todes. Darauf, dass das Licht schwächer wird. Das ist nicht gut.
Die künstliche Klappe befindet sich in meinem Herzen, und ich muss den Rest meines Lebens Medikamente einnehmen. Ich höre die Klappe ticken. Laut Dr. Schäfer gewöhnt man sich an das Geräusch. Wenn ich die Kraft hätte, Paul einen schweren Gegenstand an den Kopf zu werfen, würde ich es tun. Dr. Schäfer hat mich gestern operiert, erst heute sitzt Paul an meinem Bett. Vielleicht war er gestern auch schon dort und ich habe es nicht mitbekommen. Ehemann gleich Feigling.
Er sitzt weinend auf dem Stuhl neben meinem Bett. Das einzig Sinnvolle, das er von sich gibt, ist: „Ich konnte es nicht.“
Seine wortkarge Erklärung hätte von mir stammen können.
Aber ich will jedes Detail hören.
„Du stellst mir aber seltsame Fragen. Haben sie dir Medikamente gegeben?“, will er auf mein beharrliches Erkunden hin wissen.
Haben sie nicht, du feige Sau.
Er hat sich um mich keine Sorgen gemacht und nicht im Krankenhaus angerufen, um sich nach mir zu erkundigen. Stattdessen ist er nach Dienstschluss nach Hause gefahren, hat den Anrufbeantworter eingeschaltet und sich in die Badewanne gelegt, bis seine Haut aufgeweicht und faltig war. Er hat mich für viele Stunden aus seiner Lebenswelt gerissen, wie man sich einen Splitter aus der Haut zieht.
Geruch
Meine Tochter hat mir zwei Bilder gemalt, die über meinem Bett hängen. Paul hat sie mit Datum und Namen versehen, als würde ich nicht wissen, dass sie von meiner Tochter stammen. Jenny mag keine kranke Mutter, rümpft ihre Nase beim Betreten des Krankenzimmers.
„Es stinkt hier nach Krankheit und Tod“, hat sie gesagt und dabei ihren Vater angelächelt. Dann haben sie beide das Krankenzimmer verlassen. Egal.
Ich nehme den Geruch der Desinfektionsmittel nicht mehr wahr. Ich rieche nicht, was ich nicht mag. Ich weigere mich, Bestandteil von schwächlichem, krankhaftem und widerlichem Chaos zu sein.
Die Folge
Ich stehe momentan auf dem geistigen Niveau einer Sechsjährigen. Ein Buch zu lesen, strengt mich an. Ich blättere lieber in Zeitschriften mit jeder Menge Bilder und wenig Text und erfahre so einiges über berühmte Persönlichkeiten ohne nennenswertes Talent. Ich fand es schon immer seltsam, dass Topmodels als Popstars angeschmachtet werden, nur weil sie schön sind. Jetzt habe ich es begriffen. Sie werden bewundert, weil sie mit ihrer strahlenden Haut, ihrem faltenfreien Lächeln und ihren cellulitefreien Beinen den Mythos von Unsterblichkeit aufrechterhalten. Wenn ich heute das Foto eines Models betrachte, bin ich nicht mehr eifersüchtig, sehe nur die gesunde Frau. Keine Makel, kein Fältchen, keine defekte Mitralklappe, die das Fest der Oberflächlichkeit stören. Ich liege hier und atme und blättere. Das sollte genügen. Nebenbei entledige ich mich einiger Illusionen. Wie meiner Wahnvorstellung, dass ich lebe, um zu altern.
Die erste Falte gefiel mir. Mit ihr war ich nicht mehr das leicht naive Mädchen, sondern eine erwachsene Frau. Dennoch habe ich immer auf die eine oder andere Weise an dem Erwachsenendasein gezweifelt. Ich habe das Kindsein abgelegt, aber niemals wirklich den Großen angehört. Jetzt – hier in diesem Zimmer, in diesem Bett – denke ich anders darüber. Die erste Falte war der Anfang, die Herzklappe die Folge.
Der Arzt wird in wenigen Minuten kommen. Er will überprüfen, ob ich noch immer krank bin. Sie ängstigen sich in dieser Klinik vor Hypochondern. Kostendämpfung.
Reprise (Belebung)
„Du warst nicht da.“
„...“
Die imaginären Unterhaltungen zwischen Paul und mir sind momentan recht kurz. Was soll ich ihm antworten? Es beschäftigt mich. Ich bin ein Weichei. Er – der Waschlappen – beschäftigt mich.
Ich bin sehr freundlich zu ihm und er ist erleichtert. Wir unterhalten uns – über unsere Tochter. Worüber auch sonst? Wir überlegen, was das Beste für Jenny ist. Ich behalte meine finsteren Gedanken für mich, äußere mich nur hin und wieder dahingehend, dass ich nie wieder gesund werde. Er widerspricht brav. Ich lehne mich auf und er spielt, in der Reprise, die Rolle des unterstützenden Ehemannes.
Eines Tages werde ich dieses Zimmer verlassen. Ich male mir aus, dass ein anderer Paul mich abholt, in Begleitung unserer Tochter. Ein Mann, der während meiner Abwesenheit in den Körper meines Ehemannes geschlüpft ist, einer, der während der kurzen Spanne meiner Abwesenheit ein anderer geworden ist. Das schuldet mir Paul, das Geschenk des Lebens, das ich in den Gefühlen wiederentdeckt habe, das eine Frau wie mich wieder menschlich macht und nicht nur Gefühle wie Liebe, sondern auch Gier, Lust, Begehren ... das mich das ganze Spektrum der wimmelnden, explosiven Gefühle wieder spüren lässt. Die Ungeduld, mit ihm zusammen zu sein, die mich den ganzen Tag quält, selbst für ein Gefühl wie Eifersucht wäre ich dankbar. Das mochte schmerzhaft sein, aber wenigstens war ich dann wieder im Reich der Lebenden. Wir fahren in meiner Vorstellung zu dritt nach Hause und feiern das Fest meiner Heimkehr.
Jeder wird sterben, die Frage ist nur, woran. Hatte ich das schon erwähnt, Paul? Ich werde in einer dunklen Nacht bei abnehmendem Mond vor deinem Bett stehen, dein kuscheliges Schlafkissen mit dem Porsche nehmen und es so lange auf dein Gesicht drücken, bis dein letzter Atemzug in einem zitternden Rasseln verklingt.
Ich könnte aber auch eine Anzeige aufgeben: Austausch erwünscht. Alter Paul gegen neuen! Dumm gegen klug. Trockenes Brötchen gegen Apfelkuchen mit Sahne.
Sei also auf der Hut!
Wasserdichtes Fass
Ich bin ein wasserdichtes Fass. Ich fühle mich nur gut, wenn mein Fass kein Loch hat, durch das die Realität hineinsickern kann. Auch habe ich keine Lust, meine armselige Geschichte ständig zu wiederholen. Meine Verwandten und meine Freunde kennen sie, das sollte genügen. Ihre mitfühlenden Gesichter mit dem sorgenvollen Runzeln auf der Stirn ertrage ich kaum noch. Selbst ihre Stimmen ändern sich, wenn sie sich nach meinem Befinden erkundigen. Sie sind so leise, als würden sie mich nach einer illegalen Aktion aushorchen. Ich antworte, es gehe mir gut, wechsele das Thema und bemühe mich, ihre Erleichterung zu ignorieren. Eine geglückte Herzoperation bedarf keines weiteren Kommentars. Ich möchte wieder an die Arbeit.
Ich habe mir vorgenommen, niemandem mehr von meiner neuen Herzklappe zu erzählen. Die Erinnerungen an die Zeit vor und nach der Operation fließen in mein wasserdichtes Fass. Deckel drauf. Fertig.
Fast zu Ende
Es scheint mir geradezu fantastisch, mich in die Gesellschaft von Menschen zu begeben, die nicht wissen, dass ich im Krankenhaus nur knapp dem Tod entkommen konnte. Dass ich fast tot war, ohne dass ich es wusste. Dass ich Todesangst hatte.
Ich blicke jetzt nach vorn, nicht zurück! Mein Herz arbeitet perfekt und mein Leben hat sich verändert. Ich trinke jetzt Espresso mit George Clooney, statt mit Gott Malkovich auf dem Koryphäenstuhl Händchen zu halten. Vor einigen Tagen hatte ich gerade die neue Espressomaschine eingeschaltet, als Paul in die Küche kam. Er blieb an der Tür stehen, die Hände in den Taschen, und blickte mich verlegen an. Ich kannte diesen Gesichtsausdruck – eine Frau war mal wieder im Spiel. Mit seinem zerzausten Haar und dem unsteten Blick, der durch die Küche huschte, war er wieder ein kleiner Junge, der bereit war sich zu entschuldigen, und der auf Vergebung hoffte.
„Ich habe nachgedacht“, begann ich, während ich zwei Tassen unter die Maschine stellte. „Wir sollten ein paar neue Grundregeln aufstellen, finde ich.“
„Grundregeln?“, fragte Paul verwirrt.
„Ja!“
Plötzlich wurde mir klar, dass er gar nicht verlegen wirkte, sondern verschlagen. Durchtrieben. Wut stieg in mir hoch wie Quecksilber in einem Thermometer.
„Ich brauche meinen Freiraum, Paul. Ich brauche Ungestörtheit, um Manuskripte zu lesen. Du kannst nicht einfach auf einen Plausch reinspaziert kommen, wenn du dich langweilst oder gerne Gesellschaft hättest.“
„Und wie sollte ich mich in Zukunft deiner Meinung nach verhalten, Alma?“
Mir fiel auf, dass Paul sich kaum beherrschen konnte, obwohl er sich bemühte, kühl und gelassen zu wirken, doch ich kannte ihn zu gut.
„Soll ich vorher anklopfen?“, fauchte er. „Mich auf einen Kaffee mit dir verabreden? Auf Zehenspitzen in meinem eigenen Haus herumschleichen?“
„Hör mal, ich verlange lediglich, dass du meinen Arbeitsbereich hier ebenso behandelst wie dein ... Allerheiligstes in der Stadt.“
„Reg dich nicht so auf, Alma.“
Die Espressomaschine spuckte und zischte. Ich drehte mich um und knallte die beiden Tassen auf den Tisch.
„Wieso habe ich keinen Schlüssel für unsere Stadtwohnung?“
„Was?“ Er blickte mich misstrauisch und verwirrt an.
„Du hast mir nie einen Schlüssel gegeben.“
„Wieso hättest du einen Schlüssel ...“
„Sabine hat einen.“
Paul starrte mich an. „Wieso tust du das? Wieso sagst du so was?“
„Übrigens, der Schuhputzkasten steht jetzt in der Garage auf deiner Werkbank. Mir fehlt nach der Herzoperation einfach die Spucke zum Polieren.“ Die brauche ich für dich!
Ich spürte, wie die Worte und die Kälte, die in ihnen mitschwang, wie eine einzige Giftwolke in die Luft freigesetzt wurden. Paul fiel vor Schreck die Kaffeetasse aus der Hand. Meine Augen scannten emotionslos den Verlauf des Kaffees – ein sanftes Braun auf Blütenweiß.
Es gelingt mir ausgezeichnet, ein schlechter Mensch zu werden.
Es ist wie ein eisiger Wind, der mir die Tränen in die Augen bläst und mich trotzdem lächeln lässt.
Es fühlt sich verdammt gut an.
Kapitel 2
Entkorkt
Greta, Marie und Sophie lernte ich in einem Chatroom für Frauen um die vierzig kennen und wir verstanden uns dort auf Anhieb. Ich habe Vertrauen immer für eine merkwürdige Sache gehalten – eine kuriose Sache –, die Bedeutung, die die Leute dem beimessen. Zum Beispiel, wie ungeheuer wichtig sie in einer Beziehung genommen wird. Ich vermute, dass wir Frauen ein großes Verlangen danach haben. Im Chatroom fassten wir von Anfang an Vertrauen. Unsere erste Begegnung im realen Leben könnte man dagegen ein wenig seltsam nennen.
Ich nippte bereits seit zwanzig Minuten an einem Glas Wein, als die drei kurz nacheinander das Café Lila betraten, mit einer Zeitung als Erkennungszeichen unter den Arm geklemmt. Ich ging nicht gern in ein überfülltes Café wie dieses, in dem das Stimmengewirr und die Geräusche von klirrendem Geschirr von den Wänden widerhallten und in dem es nicht immer gut roch, dafür aber Hochmut, Zorn, Völlerei, Neid und Trägheit anzutreffen waren. Ein Ort voller Menschen, voller Leben, voller Blech und Beton – und ohne Weißwurst. Für unseren Zweck war es perfekt: neutral, groß, anonym.
Es war sonderbar, so im Halbdunkel zu sitzen, mit dem Weinglas in der Hand und sie zu beobachten, während draußen der Feierabend langsam in die Gänge kam, Züge mit Pendlern den Bahnhof verließen, Menschen nach Hause hasteten und der Wind den Regen gegen die Fensterfront des Cafés peitschte. Ich hatte in der vergangenen Nacht kaum geschlafen und mein Körper schrie vor Müdigkeit, und doch sprudelte heute eine Art verrückte Energie durch mich hindurch – die Vorfreude auf dieses erste Treffen.
Greta, Sophie, Marie.
Blond, brünett, schwarz.
Ihr Äußeres entsprach nicht ganz meiner Vorstellung. Obwohl sie in meinem Alter waren, wirkten sie jünger als Mitte vierzig. Sie begrüßten sich freundlich, reichten sich die Hand und machten sich über die Zeitung lustig. Dann sahen sie sich um, zweifellos nach mir, aber ich ließ meine Zeitung auf der Theke liegen und wartete, um sie mir noch aus der Ferne anzusehen. Als sie ihre Getränke bestellten, hielt ich die Zeitung hoch, ging auf sie zu. „Ich bin Alma.“
Ein paar letzte Reste meiner nervösen Energie brodelten noch immer in mir. Ich wusste, ich sollte nach Hause fahren und versuchen, mich mit Paul zu arrangieren, vielleicht mich mit ihm zu versöhnen. Aber ich wusste nicht, wie ich diesen Frauen mein Verhalten erklären sollte, also blieb ich und fragte mich, ob sie sich auch von mir ein anderes Bild gemacht hatten.
„Ihr müsst mein verheerendes Aussehen entschuldigen. Der Regen.“
Verdammt. Warum entschuldigte ich mich? Als ich noch ein junges Mädchen war, wirkte der Regen immer so erfrischend. Er machte mir nichts aus. Die Regentropfen ließen mich in der Sonne funkeln. Heute ging ich ohne Regenschirm nicht mehr aus dem Haus und falls doch, dann kam ich mir wie ein triefender Aufnehmer vor.
Ich schlug vor, unser erstes Gespräch im ersten Stock zu führen, weil es dort ruhiger war.
Wir rückten an einem schmalen, blank polierten Holztisch eng zusammen und ich empfand unmittelbar jene gewisse Intimität, die sonst nur ein Computerbildschirm vor mir hervorrief, weil er Wärme und Licht ausstrahlt, mich aber nie ansieht und von dem ich keine Antwort erwarte. Ich spürte, dass die anderen ähnlich empfanden und sich bemühten, ihr Unbehagen nicht zu zeigen.
Den wahren Grund unserer Zusammenkunft rührten wir zunächst nicht an. Stattdessen führten wir eine lockere Unterhaltung über die mangelnden Parkplätze in Münchens Innenstadt und über den anhaltenden Regen. Wir grinsten wie Schimpansen oder schnurrten wie divenhafte Katzen, die jeden Moment zum Angriff übergehen konnten.
Sophie, die sich im Chatroom hinter dem illustren Namen SW – Superweib versteckte, winkte den Ober herbei und bestellte eine Flasche Weißwein. Sie besaß die natürliche Autorität einer Führungskraft. Eine große, schlanke Gestalt mit breiten Schultern, die sie ihrem morgendlichen Schwimmtraining verdankte. Man sah ihrer Figur nicht an, dass sie bereits zwei Kinder zur Welt gebracht hatte. Das kurz geschnittene brünette Haar betonte das ebenmäßige Gesicht; sie war eine der wenigen Frauen, bei denen eine Kurzhaarfrisur nicht geschlechtslos, sondern elegant wirkte. Wie kühl und ungerührt sie ist, dachte ich, majestätisch und würdevoll. Ich kannte kaum eine Frau, die auch nur halb so viel Klasse ausstrahlte wie Sophie. Ich wusste, dass sie Assistenzärztin in der Notaufnahme war und – dass sie einsam war. Mehr hatte sie im Chatroom nicht preisgegeben. Ihre perfekte Erscheinung brachte ihr vermutlich nur wenige Freundschaften mit ihresgleichen ein.
„Mach drei Flaschen draus“, sagte Marie und lächelte den Kellner an. „Wird heute gebraucht. Wir wollen eine Totenmesse abhalten und all das beerdigen, was uns zuwider ist.“
Wir lachten laut auf. Wenigstens gab es etwas, worüber wir lachen konnten. Die ersten Zeichen der realen Annäherung flammten auf. Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug.
Marie war das absolute Gegenteil von Sophie. Sie hatte kein Feingefühl, keinen Stil und keinen Geschmack; sie gab sich auch keine Mühe, das vor uns zu verbergen. Ihr unförmiger Körper steckte in einem Anorak und einer Hose ohne Bügelfalte, eine Kombination, die die Bezeichnung Hosenanzug nicht verdiente, ihre Füße in bequemen Turnschuhen. Ihr dichtes, dunkles Haar hätte mithilfe eines Friseurs prächtig sein können. Wäre ich Marie auf der Straße begegnet, ich hätte sie für eine schlampige Hausfrau gehalten. Allerdings wusste ich, dass sie Anwältin in einer renommierten Sozietät war und sich auf Strafrecht spezialisiert hatte.
Als der Kellner den Tisch verlassen hatte, gab sie vollständige Sätze von sich, mit denen sie ihre Zuhörerinnen angeregt unterhielt. Sie war Publikum gewohnt. Ich wusste nicht, ob sie mir sonderlich sympathisch war. Es spielte keine Rolle, auch sie saß nur aus einem einzigen Grund an diesem Tisch. Wenig später brachte der Kellner drei Flaschen Wein und überließ uns unserem Schicksal.
Ich fühlte mich immer noch unbehaglich.
Wir wussten Dinge voneinander, von denen niemand sonst Kenntnis hatte, und dennoch kannten wir uns nicht. Vielleicht leerten wir deshalb im Nu die erste Flasche.
„Entkorkt“, sagte Greta und hielt uns die zweite Flasche hin. Sie war die Dritte im Bunde, die im Chatroom unter dem Nickname „Fee“ operierte und die mit ihrem langen, unordentlichen Zopf, der ihr über die Schulter hing, eine mädchenhafte Ausstrahlung besaß, als wäre sie gerade einem englischen TV-Drama entsprungen. Bei näherer Betrachtung fiel mir ein Netz feiner Linien auf, die sich um ihre großen Augen verzweigten. Mit ihrer leisen Stimme kam sie mir schüchtern vor, ihr lautes Lachen hingegen überraschte mich ein wenig. Ich fragte mich, wie sie wohl in einer Uniform aussehen würde, aber mir fiel ein, dass man als Bürokraft in der Poststelle der Kripo München vermutlich keine Uniform trug. Wir füllten unsere Gläser.
Sophie sah Greta spöttisch an. „Du bist also Fee.“
„Es war der Name des Pferdes, das ich früher unbedingt haben wollte“, antwortete Greta scheu. „Mittlerweile hasse ich Pferde. Aber ich zeige mich gerne dümmer als ich tatsächlich bin.“ Sie grinste. „Im Netz vertippe ich mich ständig. Google, Facebook & Co. besitzen aber Programme, die dein Plastikdeutsch und dein Genuschel erkennen können. Fähigkeiten, die heute als eher mäßig gelten, werden in zwanzig Jahren als sehr intelligent wahrgenommen werden. Intelligent heute bedeutet morgen Genie. Nach dem Motto: Stagnieren Ihre Fähigkeiten? Halten Sie wenigstens das Niveau Ihrer Legosprache. In der Zukunft betrachten dich dann die jüngeren Menschen als weisen Zen-Meister! Warum also noch den Keller verlassen und eine Niederlage riskieren?“
Erst wenige Sekunden später wurde mir klar, was sie da und wie sie es gesagt hatte. Gehörte diese schüchterne Stimme auch zu ihrer Tarnung als einfältige Person? Mein erster Eindruck des Quartetts am Holztisch: merkwürdig und unsympathisch. Ich überlegte, ob es ein Fehler gewesen war, diesen Frauen im wahren Leben entgegenzutreten. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, es bei den Begegnungen im Chatroom zu belassen, die mich jeden Abend eine Menge Zeit und Energie kosteten. Schließlich war ich verheiratet, hatte einen anstrengenden Job als Verlagsleiterin, eine fünfjährige Tochter, ein riesiges Haus, einen vernachlässigten Freundeskreis, anspruchsvolle Eltern, eine aufdringliche Schwiegermutter, zwei betagte Katzen, Tanzunterricht, ein Jahresabonnement fürs Theater und ein permanent schlechtes Gewissen. „Warum“, stand immer zwischen den Zeilen. Ich hatte immer perfekte Tagesabläufe gestrickt. Aber durch das stundenlange Chatten waren es nicht mehr die Maschen, die fielen, sondern mein Leben ähnelte einem ruinierten Strickmuster: Auseinanderziehen, eine neue erste Masche, die Anfangsschlinge, und mein Pullover Leben würde wieder über die obere Stricknadel gelegt. Weitermachen lautete die Devise.
Ich sollte mich wegen meiner Online-Aktivitäten elend fühlen, aber ich tat es nicht, freute mich darauf und ließ dafür alles stehen und liegen. War ich eigentlich noch bei klarem Verstand, dass ich mein komfortables Leben dermaßen sabotierte? Ich wusste es nicht. Aber was wusste ich neuerdings schon?
Marie sah mich lächelnd an.
„Barbie?“
Marie kam mir angriffslustig vor, als demontierte sie in einem Gerichtssaal eine wichtige Zeugenaussage. Ich nickte kühl. „Dann musst du DJ – Dicke Justitia sein.“
„Richtig. Ein Hinweis auf meinen Beruf und meinen Körper.“
Wir lächelten verlegen. In ihren Worten steckte zu viel Wahrheit. Vielleicht hasste sie ihren Körper wie es viele dicke Frauen taten.
„Hm ... Dicke Justitia“, sagte Greta. „Was soll das? Ein üppiger Körper steht für Lebenskraft, Weiblichkeit, freie Gestaltung ohne Hemmungen und Konventionen, er vereinigt alle Frauen in sich, ist eine umfassende Reflexion der weiblichen Existenz.“
Marie blickte erstaunt auf. Ein langer Seufzer entfuhr ihr. Ich wusste nicht warum, aber ich musste lächeln. Greta hatte mit ihrem Statement das Eis gebrochen. Es wurde Zeit, den wahren Grund dieser Zusammenkunft offen auszusprechen, und ich fühlte mich plötzlich seltsam beschwingt.
Sophie schien meine Gedanken zu lesen und zuckte mit den Schultern. „Ich dachte, wir würden hier offen und ehrlich miteinander umgehen, würden uns austauschen. Wenn ich mich allerdings getäuscht habe, werde ich nichts mehr sagen und verzieh mich nach diesem Glas.“
„Du siehst aber auch wirklich zum Anbeißen aus, Greta“, meinte Marie und schloss ein paar Sekunden lang fest die Augen. Als sie sie wieder öffnete, wirkte sie konzentrierter, kälter vielleicht. Sie nahm einen Schluck Wein und wartete auf Gretas Reaktion.
Gretas Mundwinkel zitterten leicht, als würde sie jeden Moment einen Lachkrampf bekommen oder in Tränen ausbrechen. Sie schwang ihren Zopf über ihre Schulter und lachte, erfreut über die Anerkennung. „Ich bin lieb, viel zu lieb. Ich benehme mich jedenfalls der Außenwelt gegenüber so.“
„Ich weiß nicht, wie es um euch steht, aber ich stehe kurz vor einem Schweißausbruch“, sagte ich, angespornt durch ihre Offenheit. „Im Chat lasse ich euch an meinen Gedanken teilhaben, ohne eine Sekunde darüber nachzugrübeln.“ Meine Stimme hob sich mit wachsender Erregung. Die Worte sprudelten nur so aus mir heraus, wie ein wilder rauschender Wasserfall. „Paul bläst Trübsal, und er ist meines Erachtens schwer depressiv, was er allerdings leugnet. Früher haben wir uns wenigstens gestritten, heute gehen wir uns nur noch aus dem Weg. Wenn unsere Tochter Jenny in der Nähe ist, sind wir höflich zueinander. Ich weiß nicht, was ich gegen die Sprachlosigkeit zwischen uns unternehmen kann. Er hasst Diskussionen.“
„Macht er auch auf andere diesen Eindruck?“, wollte Greta wissen.
„Du möchtest wissen, ob er nur bei mir trübselig ist? Keine Ahnung. Ich kann ihn jedenfalls nicht dazu bewegen, das Haus mit mir zu verlassen. Wir haben selbst das Mindestmaß an Konversation an den Nagel gehängt. Wenn er etwas unternimmt, dann nur mit seinen Freunden.“
„NSM nennt Troddel das“, sagte Marie und zuckte mit den Schultern. „Nette Sachen machen. Für Troddel der blanke Horror.“
Greta grinste, als würde sie sich über etwas amüsieren. „Ach ja? Für Tom besteht das Leben nur aus NSMs. Sobald etwas nach Verantwortung riecht, wird ihm übel.“
„Mein Jonas hat in der vergangenen Nacht dermaßen laut geschnarcht, dass ich ihm liebend gerne ein Kissen auf seinen schlecht rasierten Kopf gedrückt hätte, um ihm das Lebenslicht auszublasen“, sagte Sophie, ohne mit der Wimper zu zucken.
Im Chat hatten wir unsere Eheprobleme erwähnt. Zuerst zurückhaltend, aber dann hatten wir unseren ärgsten Fantasien und Frustrationen freien Lauf gelassen. Ich war immer davon ausgegangen, dass Menschen, die chatten, sich einsam fühlen. Das stimmte nur zum Teil. Wir hatten uns gefunden, weil wir erfolgreiche, selbstbewusste Frauen waren – so zeigten wir uns der Umwelt. Aber wir wussten es besser. Wir waren tief in unserem Inneren unsicher, mutlos, ohne Hoffnung, depressiv und voller Selbstzweifel. Ich hatte einen Mann, Freundinnen, mit denen ich mich austauschen konnte, aber nur dieser fremden Tischrunde vertraute ich meine intimsten Gedanken an. Ich hatte bis zu meinem dreißigsten Lebensjahr geglaubt, dass ich kommunikativ und extrovertiert wäre. Meine Freunde bekamen eine wohldosierte Alma-Portion und ich erzeugte das Bild einer offenen und ehrlichen Person, aber in Wahrheit war ich verschlossen. Dass ich unglücklich war – ich muss mir angewöhnen zu sagen: Ich führe eine miserable Ehe – wussten nur Greta, Sophie und Marie. Sie waren keine Freundinnen, nur Vertraute. Partners in Crime. Es fühlte sich wie ein Verbrechen an, meine Gedanken mit ihnen zu teilen, und sie meiner Familie und meinen Freunden vorzuenthalten. Wenn ich mit ihnen chattete, fühlte ich mich wegen des Verrats an meinem Ehemann ein wenig elend. Ich wartete auf den Moment, in dem ich vor Schuldgefühlen troff, aber nichts dergleichen war bisher geschehen. Jeden Abend erzählte ich den Damen im Chat, was sich in meinem Kopf abspielte. Der Stein in meinem Herzen begann zu bröckeln, wie ein Nierenstein, der allmählich zerbröselte, und eine Leichtigkeit, die ich nur als Kind gekannt hatte, trat an die Oberfläche. Ich fühlte mich wie eine Schlafwandlerin, die endlich aufwachte. Was ich nach dem Aufwachen sah, beunruhigte mich, aber nur ein wenig.
„Es geht mir viel besser, seit ich mit euch chatte“, gestand ich und lächelte.
Durch den Alkohol fielen unsere Hemmungen, und eine halbe Stunde später übertrafen wir uns gegenseitig mit verbalen Saltos und ironischen Kommentaren. Wir hatten unser Unbehagen überwunden und sahen uns mit den feurigen Augen der Verbündeten an und empfanden keine Scham, denn wir hatten bereits im Chat unseren grausamen Fantasien und Mordgelüsten freien Lauf gelassen.
Mit großem Vergnügen begannen wir, uns die Bälle zuzuspielen – ein verbales Pingpong-Spiel aufgestauter Frustrationen. Marie gestand, dass sie ihren Ehemann Casper konsequent „Troddel“ nannte. „Er nimmt es einfach so hin“, sagte sie entrüstet. „Anfangs hat es ihn amüsiert und heute hat er sich damit abgefunden. Wenn ich mich bei den Kindern nach Troddel erkundige, dann holen sie ihn.“
Dass der Schein trog, wusste ich. Casper/Troddel schien nur ein harmloser Trottel zu sein, denn für ihn lief alles nach Plan. Den Haushalt und die Kindererziehung überließ er Marie. Er widmete sich seinen Hobbys, woran Marie nicht teilhaben konnte, weil ihr dafür wiederum die Zeit fehlte. Dieser Mann glich nur äußerlich einem Teddybären, auch wenn die Frauen behaupteten, er hätte einen hohen Knuddelfaktor. Dabei besaß er die doppelte Moral eines modernen Machos. Für Casper war es selbstverständlich, dass seine Frau für den Unterhalt der Familie hart arbeitete, während er sich dem Vergnügen hingab. Er war kein Hund, der Pfötchen gab, wenn Marie ihn darum bat. Er kümmerte sich nur um sich.
„Im Job ist er ein ganzer Mann. Aber sein Testosteron legt er an der Haustür ab, als würde er sich die Schuhe ausziehen, und spielt Papa. Ich könnte ihn deswegen um ...“
Marie schwieg. Sie schüttelte den Kopf, als wollte sie eine lästige Fliege vertreiben. Dass sie ihren Wunsch – was immer es auch gewesen war – nicht ausgesprochen hatte, verstand ich nur allzu gut.
„Warum konfrontierst du ihn nicht mit seinem Verhalten?“, fragte Greta. „Wenn es jemand kann, dann doch wohl du.“
Marie lächelte. „Darin täuschst du dich, wie der Rest der Welt.“
Greta hob eine Augenbraue. „Ach ja. Das sagt sich auch so leicht. Ich bin dazu auch nicht in der Lage.“
„So kommst du mir aber nicht vor, Greta“, warf ich ein.
„Aber ist es nicht genau das?“, fragte Sophie. „Dass wir in diesem Moment ehrlicher und anders sind als im Leben außerhalb dieser Runde und des Chatrooms?“
Greta nahm ihren Zopf und konzentrierte sich auf seine fusselige Spitze. „Ich hasse das sogenannte normale Leben. Ich halte mich am liebsten im Chatroom auf.“
Chorgesang: „Ich auch.“
„Ist das nun tieftraurig oder ein Grund zur Freude?“, fragte ich.
„Beides“, antwortete Sophie spontan. „Auf uns trifft beides zu.“ Sie nahm einen Schluck und drehte das Glas. Ein wenig Wein schwappte über. „Ich hatte immer eine Abneigung gegen Frauen, die Männer verachten. Ihr wisst schon. Diese Typen, die keinen netten Mann auftreiben können und ihren Lebensinhalt darin sehen, anderen Frauen neidisch oder verbittert zu begegnen. Ich befürchte allerdings, dass ich auf dem besten Weg bin, mich auch in diese Richtung zu entwickeln.“
„Dein Mann arbeitet doch neunzig Stunden die Woche. Wie kannst du Abscheu vor jemandem haben, den du nie zu Gesicht bekommst?“ Ich wunderte mich.
„Mein Mann ist äußerst charmant. Er ist groß, schlank, hat grau melierte Schläfen, im Gespräch brilliert er, geübt ...“, sagte Sophie.
„Ich spüre ein Aber“, warf ich ein.
Sophie nickte. „Er ist perfekt. Der ideale Ehemann, außer du bist mit ihm verheiratet. Ein Stein strahlt mehr Wärme aus.“ Sie seufzte. „Er behauptet, ich sei die Kälte in Person, im Bett wie eine kalte Portion Porridge. Dabei glaube ich, wir tun einander einfach nicht gut.“ Ihre Mundwinkel zuckten. Sie leerte ihr Glas in einem Zug. Ich konnte mir einen Tränenausbruch bei Sophie kaum vorstellen, dennoch stand sie kurz davor. Ihre Augen glänzten verdächtig feucht. „Was macht denn dein Mann beruflich, Greta?“, wollte Sophie wissen.
„Er betreibt ein gewinnbringendes IT-Portal. Aber das darf ich nicht erwähnen. Er nennt sich lieber Unternehmer. Tom gehört zu diesen Internetmillionären, die sich der Wahnvorstellung hingeben, sie seien immer noch pubertierende Pioniere. Verschossene T-Shirts, ausgewaschene Jeans, abgelatschte Turnschuhe.“ Greta lachte. „Er plant, den Laden zu verkaufen und eine Weltreise zu machen. Hört, hört! Rucksack und billige, schmutzige Hotels. Das passt doch nur, wenn man keinen Pfennig besitzt.“
„Und welche Rolle wirst du dabei spielen?“, fragte ich.
„Gar keine. Ohne mich! Tom gibt sich enttäuscht, aber ich glaube, er ist erleichtert. Endlich kann er den Junggesellen raushängen lassen.“ Greta spielte wieder mit ihrem Zopf. „Er macht mir ständig Vorwürfe, ich sei zu materialistisch. Aber ich frage mich, ob er auf sein komfortables Leben verzichten könnte.“
Es gefiel mir, wie Greta, Sophie und Marie in einem leichten Plauderton ihre Beobachtungen miteinander teilten, als würde jede von ihnen mit einem Fernglas die Wohnung der anderen ausspionieren und die kleinen häuslichen Dramen genießen.
Ich erwähnte, dass ich in Pauls Augen nichts richtig machen konnte. Seine tägliche Maßregelung löste aber mittlerweile nur noch ein Kribbeln in meinen Fingerspitzen aus, die wenig später über die Tastatur rasten. Fußnoten einer Ehe nannte ich meine abendlichen Glossen an meine Chatgenossinnen. Wenn ich sie mir am nächsten Tag noch einmal zu Gemüte führte, erfasste mich dennoch ein Gefühl von Traurigkeit. Die Trennlinie zwischen Ironie und Groll war dünn. War ich wirklich eine so schlechte Mutter, wie Paul immer behauptete, oder sagte er das nur, weil er mich damit zutiefst treffen konnte? Welche Option war denn schlimmer? Ich war davon überzeugt, dass wir uns noch immer liebten, dass wir Fehler machten, aber wir als Paar waren kein Fehler. Die Geschichten der anderen schürten allerdings meine Wut. Nicht, weil sie mir schlimmer vorkamen als meine eigenen Erlebnisse, sondern weil ich die gleichen Erfahrungen gemacht hatte. Ich war auch nicht schockiert, denn es waren lediglich die endlosen Variationen ein und derselben Geschichte. Zwei Menschen, die einander einst das Glück versprochen hatten und einander heute nur noch unglücklich machten.
Nach der dritten Flasche Wein stand fest, dass Greta, Sophie und Marie mir nicht mehr fremd waren. Ihr Äußeres, ihr Gang, ihre Stimmen, daran musste ich mich gewöhnen, aber ihre Wesen waren mir nur allzu vertraut.
Kurz vor Mitternacht schlug Marie vor, uns in die Anwaltskanzlei einzuladen, um uns ein Dossier zu zeigen. Das Wort „zeigen“ schien in der Stille zwischen uns widerzuhallen. Sie blickte uns dabei mit ernster Miene an und ich erkannte in den harten kleinen Augen etwas Gefährliches.
„Ich brauche euren Rat“, sagte Marie leise. Ihre Augen schimmerten in dem Moment metallisch blaugrau, eiskalt. „Café Lila kommt als Treffpunkt sowieso nicht mehr infrage. Deshalb möchte ich euch für die Zusammenkünfte mein Büro anbieten.“
Das war das Stichwort. Rat bedeutete Aktion. Aktion bedeutete Eingreifen. Eingreifen bedeutete, Einfluss auf das Leben eines anderen Menschen zu nehmen, es zu ändern, es womöglich sogar auszulöschen.
Eine Stunde später verabschiedeten wir uns. Sophie und Marie tuschelten am Eingang. Ich konnte nicht hören, was sie sagten. Der Regen verschluckte ihr Flüstern, aber ich sah die kalte funkelnde Drohung und die Entschlossenheit, die in ihren Blicken lagen. Wir küssten uns – nur einmal, eine intime Berührung zwischen Lippen und Wange, der Code einer stillen Übereinkunft, uns nächsten Freitag in Maries Kanzlei wieder zu treffen. Draußen trennten sich unsere Wege. Der Himmel war schwarz, es regnete noch immer, aber ich öffnete den Regenschirm nicht, sondern rannte mit hochrotem Gesicht zu meinem Wagen. Du hast dich nicht unter Kontrolle, Alma Rösler, du hast nichts mehr unter Kontrolle. Aber es gefällt dir.
Kapitel 3
Ehefront
Mein Kopf arbeitete wie ein fehlgesteuertes Spielzeugauto. Nur gelegentlich empfing ich neuerdings das richtige Signal. Die Bereitwilligkeit der Mikrowelle, die Minuten ihrer Digitalanzeige, die verstrichen und die halb neun Sommerzeit zeigte – in Wirklichkeit war es aber erst halb acht und Winter – die Unmittelbarkeit eines falschen Ergebnisses. Ich war mir der Stille jenseits der Küche bewusst, und alles steuerte zielsicher auf den Zeitpunkt zu, wenn ich seinen Schlüssel im Schloss hörte. Das war der Moment, an dem mein Herz heftig pochte. Nicht vor Freude, sondern weil mir bewusst wurde, dass ich mal wieder einen Abend mit Paul überstehen musste. Als ich ihn hereinkommen hörte, schaltete ich die Deckenbeleuchtung aus, sodass nur die versenkten Strahler den Esstisch beleuchteten. Dabei lauschte ich permanent seinen Bewegungen im Flur.
Er kam in die Küche und streifte mit seinen Lippen meine Stirn. Dann hob er den Deckel von dem Kochtopf, sah hinein, stieß gegen mich, warf etwas um, stand mir im Weg. Ich mochte es nicht, ihn in der Küche um mich zu haben und seinen Körper zu spüren. Ich nahm den Geruch seines Tages auf – das Büro, den Hauch eines süßlichen Dufts einer Geliebten. Eine heiße Dusche konnte verräterische Körpergerüche eliminieren, aber die Seife, die der Betrüger im Badezimmer des Hotels benutzte, würde eine andere sein als die, die er zu Hause vorfand. Manchmal waren es die seltsamen Anrufe, die unerklärlichen Spuren am Körper ... nicht zu vergessen das neue Aftershave, das aus dem Nichts auftauchte – besonders gern nach dem Valentinstag. Aber Paul gab sich die Mühe, diskret zu sein, und befolgte die Regel, sich nicht an meine Freundinnen heranzumachen. Dennoch bedeutete nichts von alldem irgendetwas. Es bedeutete nichts, er suchte lediglich Ablenkung vom Ehealltag und ich bewahrte den Schein, die Illusion, dass alles in Ordnung sei und nichts etwas zu bedeuten hatte. Männer verloren beim Anblick schöner Frauen oft den Verstand.
Wir saßen mit Jenny am Küchentisch, auf unseren Tellern ein von mir in Windeseile zubereitetes Fertiggericht.
„Wie war dein Tag?“, fragte er und lud sich die Gabel voll.
Es dauerte einige Sekunden, bis Pauls Frage zu mir durchdrang. „Hektisch“, antwortete ich. „Und bei dir?“
Paul arbeitete als Analytiker bei einer großen Kommunikationsagentur und ich wusste, dass er nur gefragt hatte, weil er seine Geschichte loswerden wollte. Er fing an, mir in allen Einzelheiten von seiner Arbeit zu berichten, und ich versuchte, mich zu konzentrieren.
„Ich mag nicht mehr, Mama“, sagte Jenny, als Paul eine Verschnaufpause einlegte und sich das Fleisch mit Konzentration in den Mund schaufelte, ohne vom Teller aufzublicken. Jenny hatte das Hähnchen in Currysoße kaum angerührt. Auch egal.
„Natürlich, mein Schatz.“ Ich strich ihr kurz über das braune Haar, das sie nicht von uns, sondern von einem Vorfahren geerbt hatte. Jenny neigte ihren Kopf nach links und rechts, als wollte sie meine Geste abschütteln, schob ihren Stuhl zurück und lief ins Wohnzimmer.
Paul fuhr fort mit seinen Ausführungen, in denen er die Namen seiner Kollegen ständig wiederholte, als könnte ich sie mir nicht merken. Paul stach mit seiner Gabel in eine Kartoffel. „Hörst du mir eigentlich zu?“
Lynchjustiz.
„Ja, ja. Ich bin nur ein wenig müde.“ Warum hatte ich das gesagt? Ich fühlte mich keineswegs abgehetzt oder ermattet. Ich konnte nur mit Mühe still auf einem Stuhl ausharren. In mir tobte die Unruhe und mir war nach einer Kissenschlacht mit Jenny.
Pauls Gabel schabte über seinen Teller. „Wir sind alle müde, wir können uns auch eine Runde anschweigen, wenn dir das mehr Spaß bereitet.“
„Paul, bitte ...“
Er kratzte sich den Dreitagebart. „Bist du schon wieder zu spät ins Bett gegangen?“
„Ich habe unruhig geschlafen“, murmelte ich.
Paul ärgerte sich, dass ich bis spät in die Nacht vor dem Computerbildschirm saß – angeblich, um geschäftliche E-Mails zu beantworten, wozu ich im Laufe des Tages nicht gekommen war – und ich wollte vermeiden, dass er wieder davon anfing. In Wirklichkeit hatte ich mich mit Sophie, Greta und Marie im Chat ausgetauscht, wie fast jede Nacht.
Seit unserem Treffen befand ich mich in einem Zustand höchster Euphorie und Erregung, die ich mit niemandem teilte. Ich spürte, dass etwas Großes geschehen würde und war überrascht, dass Paul nichts davon mitbekam – außer, dass er mich für geistig abwesend hielt.
Paul stellte keine Fragen, und ich wäre auch nicht bereit gewesen, sie zu beantworten. Gleichzeitig beunruhigte mich aber die Tatsache, dass er offenbar keine Ahnung hatte, was mit mir los war. Die etwas niedergeschlagene Alma von vor wenigen Tagen ähnelte kaum der leicht ekstatischen Alma von heute, die gerne eine Lady Gaga wäre, den Mount Everest erklimmen und ein ganzes Jahr in völliger Abgeschiedenheit auf einer karibischen Insel verbringen wollte. Aber zunächst begnügte ich mich erst einmal mit einer Liste der Dinge, die mich an der Ehefront störten und die ich ändern wollte.
Ich bin diejenige, die die meiste Hausarbeit erledigt.
Ich bin diejenige, die einen Babysitter für Jenny engagiert.
Paul trifft oft aushäusig Verabredungen, ohne sie mit mir abzusprechen, während er sich unmöglich aufführt, wenn ich einmal ausgehe.
Ich nehme mir einen Urlaubstag, wenn Jenny krank ist.
Ich rase über die Straßen, um Jenny pünktlich vom Kindergarten abzuholen, weil Paul fast immer Überstunden macht.
Paul und ich führen ständig einen Kampf, sobald ich versuche, Abhilfe zu schaffen und etwas zu ändern.
Ich wünsche mir seine Treue.
Ich kam zu dem Schluss, dass fast alle Frauen, die ich kannte, mühelos dieselbe Liste erstellen könnten. Man brauchte nur die Namen auszutauschen. Statt Paul hießen sie Dirk, Sven, Bruno, Leo, Patrick. Ich befand mich also keineswegs in einer Ausnahmesituation, ich war nur ein klassisches Beispiel für den momentanen Zustand der Emanzipation. Beruflich erfolgreich, als Ehefrau und Mutter eine absolute Versagerin. Mädchen um die zwanzig glaubten, sie wären den Männern gleichgestellt und somit chancengleich. Mit Erstaunen beobachtete ich die blutjungen Dinger, die ihr Praktikum mit gelangweilter Arroganz begannen, als würden sie dem Verlag einen Dienst erweisen und nicht umgekehrt. Frauen über dreißig wussten es besser.
Ich hatte nach Jennys Geburt zurückstecken müssen, ich wollte sie nicht zum Gegenstand eines Ehekampfes machen. Dafür liebte ich Jenny zu sehr. Der Punkt war, dass Paul tat, wozu er Lust hatte und ich diejenige war, die sich das nicht leisten konnte.
Seit dem Treffen im Café Lila spürte ich eine geballte Ladung Energie in mir, die sich zunehmend in unbändiger Wut bündelte. Ich ertappte mich dabei, dass ich in Gedanken eine Gruppe Männer verfluchte, die im Café lauthals ihre Meinung kundtaten. Im Supermarkt fuhr ich mit meinem Einkaufswagen gegen die Fersen eines Mannes, der seine Bedeutung mit einem lauten Telefonat zu betonen versuchte. Ich brachte auch kaum noch Geduld für die männlichen Kollegen auf, die während einer Sitzung die meiste Zeit redeten, aber nur wenig zu sagen hatten.
Ich fragte mich, wie es Sophie, Greta und Marie erging oder ob ich die Einzige war, die sich in einem permanenten Zustand zorniger Aufruhr befand. Im Chat unterhielt ich mich nicht mit ihnen darüber, denn ich war zu verwirrt. Ich wollte wissen, was mit mir geschah und was es zu bedeuten hatte. Stand ich am Rande eines Nervenzusammenbruchs? War ich im Begriff, eine große Entscheidung zu treffen? Meinen Job zu kündigen und mit Jenny die karibischen Sonnenuntergänge zu bestaunen? Ich malte mir die verrücktesten Sachen aus und fragte mich, ob es meine labile, imaginäre Zwillingsschwester war, die dieses merkwürdige Verhalten an den Tag legte, und nicht ich.
Ich tat mein Bestes, um wieder zu meinem alten Ich zurückzukehren und wie ein Stein im Eheschlamm zu versinken. Während der Woche beschloss ich, zu Hause nicht mehr zu trinken, da meine Wut nach ein paar Gläsern Wein zunahm. Außerdem hatte ich vor einigen Tagen mit dem Joggen angefangen, obwohl ich die Ausschüttung von Endorphinen hasste. Aber bislang verspürte ich keine Besserung. Laufen ist hirn- und sinnlos!
Paul stand auf und stellte seinen Teller auf die Spüle. „Ich habe morgen eine Präsentation und muss noch daran arbeiten. Es könnte eine Weile dauern. Bringst du Jenny ins Bett?“
Warum schaffte er es nicht, den Teller in die Spülmaschine zu stellen? War das zu viel verlangt? Ich brachte unsere Tochter fast jeden Abend ins Bett, aber ich sagte nichts. Während ich mit den Tellern klapperte, es war ein Wunder, dass sie es überstanden, versuchte ich, an etwas Fröhliches zu denken. Ich näherte mich dem Siedepunkt. Ich spielte eine Frau, die einen Verlag leitete, Meetings abhielt, die Entscheidungen traf, welche Manuskripte ins Verlagsprogramm aufgenommen wurden und nebenbei zum Supermarkt raste, zumeist gesunde Mahlzeiten zubereitete und Jenny vor dem Schlafengehen vorlas, bis sie einschlief.
Während ich die Küche aufräumte, dachte ich an Sophie, Greta und Marie. Da ich sie nun persönlich kannte, hatte ich ein klareres Bild von ihrem Leben vor Augen. Wenn wir uns im Chat unterhielten, hörte ich fast den Klang ihrer Stimmen. Ich malte mir aus, wie ihre Häuser aussahen, ihre Ehepartner, ihre Kinder, und ich fragte mich, warum Greta keine Kinder hatte. Ich sah meine Freundinnen vor mir, wie sie abends am Tisch saßen, während ihre Gedanken in jene Welt wanderten, die wir uns geschaffen hatten.
Ich fühlte mich dem Geheimnis und Geräusch verbunden, die diese Treffen auslösten. Sie waren wie eine Erlösung und ich brauchte sie nur anzunehmen.
„Wir alle sind die Medien eigener Grundwahrheiten“, hatte Marie neulich gesagt. „Alles, was wir wirklich haben im Leben, ist die Urkraft, die uns durch den Tag treibt. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, und in der Zwischenzeit passiert nicht genug. Das sollten wir ändern.“
In meiner Einsamkeit war ich dazu übergegangen, mir mögliche zukünftige Szenarien auszumalen, die mich mehr ängstigten, je länger ich darüber grübelte. Vielleicht erschienen mir deshalb meine Nächte unerklärlicherweise lang, obwohl sie völlig leer waren. Es gab Momente, in denen ich einfach wegdämmerte, aber dann fing ich an zu träumen, und in diesen Träumen herrschte großer Tumult und Verwirrung. Ich wusste, dass meine Kraft nachlassen würde, und ich wusste, dass ich nicht mehr allzu lange durchhalten würde. Dass es nur noch eine Frage der Zeit sein würde, bis er wie ein Stein vom Himmel fallen und den alten Gefühlen neuen Platz machen würde: Der Gedanke an Mord.
„Und es wäre besser für dich, Paul, wenn du dann ganz weit weg bist“, flüsterte ich.
„Mama?“ Jenny stand in der Küchentür. Bis auf ihr T-Shirt und ihre Unterhose hatte sie sich ausgezogen. Sie fixierte mich mit ihrem Blick und ich spürte, wie kalte Furcht mein Herz stocken ließ.
„Was machst du denn, Jenny? Du erkältest dich noch.“
„Ich möchte Kissenschlacht spielen. Ja ...?“
„Mama hat keine Zeit, mit dir zu spielen.“
Enttäuschung machte sich auf dem kleinen Gesicht breit und ich bedauerte meine Ablehnung. „Okay, zehn Minuten dann. Hol schon mal die Sofakissen. Ich bin gleich bei dir.“
Paul behauptete immer, ich wäre nicht konsequent. Heute Abend lieferte ich ihm wieder den Beweis.
Kapitel 4
Eine Horde unverfälschter Feministinnen
Die Freitagabende waren meine Befreiung. In Erwartung des alltäglichen Grals lebte ich auf unsere gemeinsamen Abende hin. Ich brauchte sie wie Flaubert seinen Schreiraum.
Heute bewunderte ich lauthals die Aussicht in Maries Büro. Danach konnte ich meine Neugierde kaum noch im Zaum halten und blieb vor dem Schreibtisch stehen. Zwei Kinder mit großen, auseinanderstehenden Zähnen und blonden Haaren starrten mich aus den Bilderrahmen an. Dann warf ich einen Blick auf Casper und fragte mich, warum sie diesen Mann Troddel nannte. Er war eine imposante Erscheinung und attraktiver als ich erwartet hatte, ein großer, kräftiger Mann mit dunklen Augen, die schön gewesen wären, hätte er nicht so berechnend in die Kamera gesehen. Ich hatte plötzlich eine andere Marie vor Augen, schlanker und jugendlicher, perfekt neben dem Mann auf dem Foto. Mit ihrem dicken Haar und dem ebenmäßigen Gesicht war das nicht so schwer, vorausgesetzt, man sah von den dreißig Kilo Übergewicht, dem leicht grau melierten dunklen Haar und den erschöpften Gesichtszügen ab. Ich erkannte, dass sie einst eine gut aussehende Frau gewesen sein musste. Energisch und selbstbewusst, eine Frau, die nicht im Traum daran dachte, eine fürsorgliche Frau für einen Mann zu sein, der ihr den ehelichen Sex nach der Geburt der Kinder entsagte.
„Wenn wir nebeneinander liegen, wünsche ich mir, ich hätte einen anderen Körper, einen, den Troddel begehrt. Schlank, mit großen Brüsten.“ Marie sprach im Plauderton, so, als würde sie über ein Gerichtsverfahren berichten. Aber ich wusste es besser.
„Wenn ich es in zwei Worten zusammenfasse: Pamela Anderson. Darüber hinaus reicht die Fantasie von Troddel nicht“, betonte Marie. Sie glaubte, dass wir die Botschaft nicht verstanden.
Niemand sagte „Du siehst gut aus“ oder „Du bist nicht zu dick.“ Wir hielten uns an unsere Vereinbarung, nicht zu lobhudeln, um die Gefühle des anderen nicht zu verletzen. Wir waren ehrlich, wie falsch das Wort auch war. Im täglichen Leben sprachen wir unsere Gedanken oft nicht aus und bedienten uns lieber kleiner Lügen. Wir respektierten nicht nur den sozialen Code, wir hatten ihn quasi erfunden. Er wurde zur verbissenen Gewohnheit, um zu lächeln, wenn es nichts zu lachen gab, um nach der gröbsten Beleidigung höflich zu bleiben, doch vor allem, um nicht die Kontrolle über unsere Emotionen zu verlieren. Eine Funktionsüberlebensstrategie, um in dieser grausamen Welt bestehen zu können, meinte Sophie. Diese Welt ließen wir hinter uns, wenn wir uns in der Kanzlei trafen. Dann galten die Regeln der Ehrlichkeit. Wer vorgab, mehr zu sein als er darstellte, dem wurde von den anderen auf die Finger geklopft, vorsichtig, aber fest. Doch hartnäckige Gewohnheiten schob man nicht einfach beiseite.
Marie sprach heute zum ersten Mal über ihren voluminösen Körper. Sie zeigte nach unten, als hätte sie sich soeben versehentlich kopfabwärts einen Satz Gliedmaßen angeschraubt. „Es mag euch seltsam vorkommen, aber ich fühle mich wohl mit dem hier“, sagte sie. „Ich fühle mich nicht unsicher, auch nicht, weil ihr für keine Millionen mit mir tauschen wollt. Ich wünsche mir nur, dass Troddel mich attraktiv findet. Dass er mir dieselben Blicke zuwirft wie neulich dieser Hure, die drei Häuser von uns entfernt wohnt.“
Plötzlich überfiel mich ein tiefes Schamgefühl, weil ich Marie bei unserer ersten Begegnung völlig falsch eingeschätzt hatte. Sie posaunte ihre Unsicherheit nicht in die weite Welt hinaus. Sie hasste nicht einmal ihren unförmigen Körper.
„Das ist eine durchaus vernünftige Überlegung“, sagte Greta, den Kopf leicht geneigt, als wiege sie die Vor- und Nachteile gegeneinander auf. „Aber stehst du immer noch auf ihn?“
„Ich will hemmungslosen Sex, möchte begehrt werden, wie jede andere Frau. Und da ich mit Troddel verheiratet bin, treibe ich es mit ihm.“
„Wieso das denn?“, fragte Sophie. „Du kannst dir doch auch einen Liebhaber zulegen.“
„Kannst du mir einen empfehlen?“
Sophie zog ihre wohlgeformte Augenbraue hoch, sagte aber nichts.
„Wirklich? Hast du einen Liebhaber, Sophie?“ Aus Gretas Stimme klang Bewunderung.
Sophie seufzte.
„Nein, dafür bin ich zu brav und zu solide. Und ich bin auch nicht die Person, für die mich alle halten: Der robuste Ast, der sich im Wind biegt und nicht bricht. Die Frau, die mit einem Lächeln alles abschüttelt und die ein absoluter Profi ist, wenn es darum geht, anderen zu helfen. In der Vergangenheit bin ich meinen Freundinnen gegenüber immer offen gewesen, aber das war eine Zeit, als ich obenauf war. Die Sophie, die mit dem Leben nicht klarkommt, braucht niemand zu sehen ...“ Sie sah uns mit traurigen Augen an. „Jonas ist bei uns der Fremdgänger.“
„Du bist eine so schöne Frau“, sagte Greta. „Ich verstehe nicht ...“
Sophie blickte betreten in die Runde. „Das hat mit Schönheit nichts zu tun, Liebes. Er glaubt, ich sei kalt. Im Suff hat er mir an den Kopf geworfen, ich sei mumifiziert, nannte mich eine Ice Queen. Er glaubt, dass seine Worte mich nicht verletzen, weil ich nicht in Tränen ausbreche und schluchze wie eine von seinen Bienen.“
„Das ist ja schrecklich, Sophie“, flüsterte Greta.
Das ist süß von ihr, dachte ich, und auch Sophie gefiel Gretas Mitgefühl.
Wir trafen uns heute zum vierten Mal, und ich hatte gelernt, die Regungen in den Gesichtern meiner Vertrauten zu deuten. Auch wenn Sophies Emotionen nicht allzu offensichtlich waren, erkannte ich sie – es war, als würde sie bei jedem Treffen einen alten Mantel ablegen und ich eine neue Schicht durchbrechen.
„Nicht, dass Tom und ich es noch treiben“, plapperte Greta munter drauflos. „Er denkt, ich sei frigide. Eine Frage der Projektion, sage ich euch. Für ihn bin ich eine Art Heilige Maria. Er respektiert mich als solche.“
Aus Gretas Mund klang „respektiert“ wie verdorbenes Gemüse, und ich musste lachen.
„Deshalb wollte er mich unbedingt heiraten, ordentlich, wie es sich gehört. Jetzt bin ich seine brave Ehefrau, seine Maria, und er projiziert seine perversen Neigungen bequem auf andere Frauen. Schon angenehm.“
„Würdest du denn gerne diese Rolle übernehmen?“, fragte Marie.
„Ja, ich möchte diese Schlampe sein, mit Hüften und Brüsten und einem Hinterteil wie die rothaarige Sekretärin aus Mad Men. So richtig verdorben und geil, damit Tom mich ohne Skrupel ins Bett zerrt.“
„Eine Frau, die Sex als Waffe benutzt“, sagte ich. „Ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist.“
„Pah“, rief Greta, „es ist mein Körper, der spricht. Nicht meine Moral. Ich glaube, es ist ganz nett, weniger tugendhaft zu sein.“
„Du bist nicht tugendhaft“, protestierte Marie. „Du tust nur so. Darin sind wir alle Meister. Mit fragwürdigen Ergebnissen.“
Marie erweckte den Eindruck einer Tyrannin, die ihren Ehemann dominierte, aber die Frage war, wer letztlich die Macht hatte. Sie erinnerte mich an ein Kind, das in negativer Art und Weise Aufmerksamkeit forderte. Wie geschliffen ihr Auftreten auch war und wie gut sie als Anwältin im Gerichtssaal auch sein mochte, außerhalb davon war sie eine liebenswürdige Frau, die nicht in der Lage war, für sich selbst aufzukommen. Ich wusste, dass sie alles für ihren Mann und ihre Kinder tat und dass ihre Familie das schamlos ausnutzte.
Ich lehnte mich zurück und versuchte, mich zu entspannen. Es war wie immer. Wir redeten unaufhörlich, tranken zu viel und lachten laut. Und doch gab es etwas, das mich störte. „Wenn unsere Männer so schrecklich sind, warum trennen wir uns nicht von ihnen?“
„Gute Frage“, meinte Sophie. „Ich schlage vor, du beantwortest die Frage zuerst.“
Ich setzte mich auf und kämpfte gegen den Drang, das Weinglas in die Hand zu nehmen. „Ehrlichkeit lautet unser Bestreben. Wir wollen uns offenbaren. In gewisser Weise ist es uns gelungen, weil wir einander die intimsten und schmerzhaftesten Details aus dem Eheleben erzählen. Aber etwas fehlt.“
„Weiter“, ermutigte mich Greta.
Ich machte einen tiefen Atemzug. „Ich liebe Paul noch immer, aber manchmal habe ich Mordgelüste. Er fehlt mir, und ich bin einsam, obwohl wir gemeinsam unter einem Dach leben. Ich sehne mich nach ein wenig Glück, aber für Paul existiert kein Glück und deshalb bin ich in seinen Augen schwach.“
Eine Stille trat ein, in der die Geräusche, die von unten heraufdrangen, mir immer lauter vorkamen.
„Ich hasse ihn nicht“, fuhr ich fort, „auch wenn es vielleicht den Anschein hat. Ich hasse nur, wie ich mich in seinem Beisein verhalte und werfe ihm zutiefst vor, dass ich in seiner Nähe nicht die Person bin, die ich sein möchte.“
„Ich habe mich reichlich der Selbstprüfung hingegeben“, sagte Greta zynisch. „Es ist manchmal ganz nett, meinem Mann die Schuld zu geben, und mich dabei nicht unwohl zu fühlen.“
„Unsere Diskussionen verlaufen im Sande“, fuhr ich fort, „wir machen uns zum Opfer, wie man es dreht und wendet.“
„Und das geht dir gegen den Strich“, stellte Sophie fest.
„Ja. Wenn ich eine Außenseiterin wäre, würde ich sagen, ändere deine Situation oder mach das Beste daraus.“
Marie schlug die Arme übereinander, die Schulterpolster ihrer Jacke drückten nach oben und sie sah aus, als hätte sie keinen Hals. „Nicht alle Männer sind Arschlöcher. Davon muss ich mich jetzt erholen, Alma.“
Ich rutschte auf der Bank hin und her und spürte den harten Holzhandlauf an meinen Sitzknochen. „Doch, das sind sie. Zumindest laufen eine Menge Arschgeigen herum. Aber ich vermute, dass wir nicht mit den größten Arschlöchern verheiratet sind. Sonst wären wir bereits geschieden.“
Marie starrte mich an. „Tut mir leid, aber das ist naiv. Frauen sind in der Lage, mit den größten Arschlöchern verheiratet zu sein und zu bleiben. Ihre Akten landen täglich in der Postdienststelle der Kripo.“
„Stimmt“, warf Greta ein.
„Wir reden hier nicht über Frauen im Allgemeinen, sondern über uns“, fuhr ich fort. „Oder würdet ihr euch mit jenen Frauen vergleichen, die zur Polizei gehen, weil sie von ihren Ehemännern verprügelt oder missbraucht werden?“
Sophie schenkte mir einen kalten Blick. „Du möchtest uns weismachen, dass wir uns bemitleiden. Jammern dürfen wir nur, sobald ein Mann uns krankenhausreif geschlagen oder vergewaltigt hat, oder ...“
„Nein!“ Meine Stimme schoss in die Höhe. „Ich sage nur, dass wir unsere Situation ändern sollten.“
„Vielleicht nicht unsere eigene Situation“, meinte Greta. „Vielleicht sollten wir etwas unternehmen, um die Situation der Frauen zu ändern, von denen hier die Rede ist.“
„Durch eine Art Therapie?“, fragte Marie spöttisch. „Die heilende Kraft durch die Heilung anderer. Sorry, aber damit verbringe ich im Gericht schon genügend Zeit.“
„Und“, fragte Greta, „bekommen diese Bastarde ihre gerechte Strafe?“
„Die Frauen dieser Bastarde kommen zu uns in die Notaufnahme“, sagte Sophie. „Mit Rippenprellungen, Knochenbrüchen, geschwollenen Augenlidern, inneren Blutungen. Wir flicken sie zusammen und dann gehen sie wieder mit dem Schwanz nach Hause, der sie zusammengeschlagen hat. So gut funktioniert unser Rechtssystem.“
Ich nickte hektisch. „Der Verlag plant eine Serie über diese Frauen. Wenn du die Manuskripte liest, wird dir übel. Es ist unglaublich, wie sehr Männer Frauen quälen. Dass sie ihre Macht missbrauchen, ist noch milde ausgedrückt. Es geht nicht nur um Frauen aus den Entwicklungsländern, auch in unserer Gesellschaft kommt Machtmissbrauch sehr häufig vor.“
Greta nickte. „Männer, die Frauen hassen. Die Stieg-Larsson-Trilogie ist nicht ohne Grund so erfolgreich. Wir sind fasziniert von der Gewalt der Männer gegen Frauen. Und dem Unterschied sowohl in der physischen als auch in der wirtschaftlichen Ausübung von Macht.“
„Jesus, wer hätte das gedacht?“, sagte Marie. „Ich sitze hier an einem Tisch mit einer Horde unverfälschter Feministinnen.“
Sophie gähnte. „Mädels, es ist halb eins. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich fahre nach Hause.“
Marie stand auf. „Geh nur. Jonas wird wissen wollen, wo du bleibst.“
Während ich meinen Mantel anzog, gingen mir Maries Worte nicht aus dem Kopf. Irgendwie sehnten wir uns alle nach einem Mann, der auf uns wartete, wie unabhängig wir uns auch an diesen Abenden gaben. Aber in uns schlummerte noch ein weiteres Bedürfnis, der Wunsch nach Rache. In uns steckte eine geballte Ladung Wut, die vermutlich viele Frauen in sich tragen – und von der Männer keine Ahnung haben.
Auf dem Bürgersteig gab ich Sophie und Marie zum Abschied einen Kuss und wünschte ihnen eine gute Nacht. Greta umarmte mich ein wenig länger. „Wir müssen reden“, flüsterte sie mir ins Ohr. „Der zornige Geist hat die Flasche verlassen.“
Kapitel 5
Der Name des Mädchens
Mittlerweile trafen wir uns im zweiwöchigen Rhythmus, immer an einem Freitag und immer gleich nach Dienstschluss, wohlbehütet und umgeben von der Anonymität der Kanzlei. Dort setzten wir uns an den runden Konferenztisch, an dem Marie tagsüber ihre Klienten empfing. Dieser Tag war uns heilig. Nichts konnte uns davon abhalten, keine Kinderkrankheit, kein nörgelnder Ehemann, nicht der Geburtstag der Schwiegermutter oder ein Wasserrohrbruch. Wir trafen uns erst gegen halb neun, nur so waren wir sicher, keinem von Maries Kollegen zu begegnen.
Wir stritten uns um die Beweise, als würden wir das Verfahren schlechthin gegen den Mann vorbereiten. Für Marie war das als Anwältin ein vertrautes Terrain. Sie schickte uns regelmäßig per E-Mail spitzfindig formulierte Schriftsätze, als wären sie die Grundlage für ein Plädoyer vor Gericht. Ihre Argumente liefen im Grunde auf eine einfache Feststellung hinaus. Der Mann war schlecht. Warum sollte die Frau dafür büßen? Aber Marie gab dem Ganzen einen intellektuellen Touch.
Greta schrieb mir: Ehemänner halten ihren Frauen die wackligen Hormone vor. Du bekommst bestimmt deine Tage, Schatz. Dein Eisprung macht dir zu schaffen, Schatz. Im Vergleich zu ihnen sind wir harmlos, Alma, während sie sich zu Hormonmonstern mutieren können.
Sophies Fazit lautete: Penis oder kein Penis. Das ist hier die Frage.
Wir vereinbarten, keine Ausrufezeichen mehr zu verwenden, da jeder Kommentar, jede Beobachtung ohnehin ein Ausrufezeichen verdiente. So setzten wir jetzt einen zivilisierten Punkt.
Ich kannte Sophie mittlerweile recht gut und spürte, dass sie etwas bedrückte. Anfangs hielt sie mit dem, was sie offensichtlich belastete, hinterm Berg und erzählte von ihrem Klinikalltag. Sie brachte die Geschichte nicht über ihre Lippen. Stattdessen erzählte sie von ihrer Arbeit in der Notaufnahme des Klinikums „rechts der Isar“, von der Flut von Anrufen, die sie pausenlos auf den Beinen hielt: eine Hirnblutung, ein Autounfall.
Wie ich aus den Chats wusste, war Sophie als Assistenzärztin versiert, aber manchmal war das nicht genug. Manchmal kamen die Patienten zu spät. Aber Sophie mochte diese Nächte. Sie brachten das Adrenalin, das sie in Stresssituationen stärkte. Sie behielt immer einen klaren Kopf und war hoch konzentriert, besonders dann, wenn ihre Kollegen hektisch wurden. Dies war der Ort, an dem sie die Kontrolle hatte und Anweisungen gab, ohne autoritär zu wirken. Ihr Mann Jonas nahm wegen der unregelmäßigen Arbeitszeiten keine Rücksicht auf sie. Sobald sie von einer anstrengenden Nachtschicht nach Hause kam und neben ihm eingeschlafen war, terrorisierte er sie: Er stand auf und machte jede Menge Lärm, ließ die Kinder durch die Wohnung tollen, knallte mit den Türen oder sang lautstark unter der Dusche, als hätte sie keinen Anspruch auf Schlaf. Schließlich stand sie doch auf und brachte die Kinder in die Schule.
Während Sophie uns von dem Dilemma berichtete, aßen wir Thai-Curry aus Plastikschalen, eine freundschaftliche Geste eines dankbaren Mandanten, der in der Nähe der Kanzlei ein kleines Restaurant besaß. Wir hätten aber auch eine Suppe aus der Dose löffeln können, so sehr waren wir in unsere Unterhaltung vertieft.
Plötzlich dachte ich an Paul. Ob er vor seiner Pizza saß und fernsah? Er wähnte mich beim Tanzkurs in der Volkshochschule. Er fragte nicht, warum ich an diesen Abenden sehr spät nach Hause kam. Er ging davon aus, dass ich im Anschluss ein Lokal aufsuchte, um mit meinen Mitstreitern etwas zu trinken. Oder es war ihm egal, wo ich mich jeden zweiten Freitag aufhielt, ein Gedanke, der mich wie ein Blitz traf. Ich verschluckte mich und hustete krampfhaft.
„Bist du okay?“, fragte mich Marie.
Sophie stocherte im Reis. „Das Mädchen ...“
Niemand fragte „Was für ein Mädchen?“
„Die Kleine war völlig verkrampft“, fuhr sie nach kurzem Zögern fort. „Wir konnten ihre Beine nur mit Mühe spreizen. Ich schätzte sie auf acht Jahre, aber sie war zehn. Sie war sehr klein für ihr Alter.“
„Was hatte sie denn?“, fragte Greta vorsichtig.
„Vergewaltigt. Sie wurde missbraucht. Ihre Mutter weigerte sich, das Verbrechen beim Namen zu nennen. Anfangs bin ich davon ausgegangen, dass sie dem Mädchen die Konfrontation mit der Polizei ersparen wollte, aber das war nicht der Fall. Sie schämte sich. Die schweren Verletzungen des Mädchens waren nicht zu übersehen, sonst hätte die Mutter sie heruntergespielt. Sie benahm sich seltsam, kümmerte sich nicht um ihre Tochter, umarmte sie nicht ein einziges Mal, als widerte das Mädchen sie an.“
„Liegt sie im Krankenhaus?“, fragte ich.
„Nein, obwohl der behandelnde Arzt für eine stationäre Aufnahme war. Aber die Mutter war strikt dagegen. Wir können die Eltern nicht zwingen, ihr Kind in unsere Obhut zu geben. Und das wusste die Mutter.“
„Ist es denn so ein abwegiger Gedanke?“, fragte Marie. „Das Kind hat genug durchgemacht. Eine vertraute Umgebung wäre doch sinnvoller als die kühle Krankenhausatmosphäre ...“
Sophie verlor die Fassung. „Das Mädchen fühlte sich schmutzig und gab sich die Schuld. Sie war tief beschämt. Und ihre Mutter verstärkte durch ihr Verhalten diese Gefühle. Sie weigerte sich, uns von dem Missbrauch zu erzählen.“
„Habt ihr herausgefunden, wer es war?“, wollte Marie wissen. „Sie ist nicht dazu verpflichtet, eure Fragen zu beantworten. In vielen Fällen nimmt eine Mutter ihren Ehemann in Schutz, der ...“
„Es war der Babysitter“, unterbrach Sophie sie schroff. „Das Mädchen sagte kein einziges Wort, aber die Mutter hat es uns dann doch erzählt. Allerdings erst, nachdem ich erklärt habe, dass der Täter oft im unmittelbaren Umfeld der Familie zu finden sei. Onkel oder Vater. Ich vermute, sie hat es uns nur gesagt, weil sie einen solchen Verdacht schnellstens ausräumen wollte.“
Greta seufzte. „Und dann?“
„Wir haben das Mädchen zusammengeflickt. Die Mutter hat sie mit nach Hause genommen.“ Ich erkannte, dass Sophie uns weitere medizinische Details ersparen wollte.
„Der Vater des Mädchens hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, in die Klinik zu kommen“, fuhr Sophie fort. „Der Kerl hat angerufen und gefragt, ob alles in Ordnung sei.“
Ich hatte das Gefühl, mich übergeben zu müssen und atmete tief ein und aus.
„Haben die Eltern Anzeige erstattet?“, fragte Greta.
Sophie schob ihren Teller beiseite. „Nein, die Mutter war dagegen. Sie wolle dem Kind ein weiteres Trauma ersparen und möchte den Missbrauch unter den Tisch kehren.“
„Wie lautet der Name des Mädchens?“, fragte ich.
Sophie sah mich an. „Ist das wichtig? Ich kenne den Namen des Babysitters. Darauf kommt es an!“
„Wow“, warf Marie ein. „Wie hast du das geschafft?“
Sophie konzentrierte sich auf ihre manikürten Nägel, die weiß lackiert waren und nie Risse zeigten. „Ich hab die Mutter gefragt. Sie war müde und wollte die Klinik so schnell wie möglich verlassen. Ich versicherte ihr, dass alles, was sie sagte, vertraulich sei. Aber der Name hat sich in mein Hirn eingebrannt. Hermann Wagner.“
Greta streckte ihren Rücken. „Damit kann ich etwas anfangen. Ich werde mich über das Schwein erkundigen. Vielleicht hat er ja noch mehr auf dem Kerbholz.“
Die jähe Gewalt des Ganzen schockierte mich zutiefst. „Der kann einfach so weitermachen?“, fragte ich entsetzt.
Sophie nickte. „Ein Arzt hat immer ein Interesse an der Schutzwürdigkeit eines Kindes. Grundsätzlich besteht aber bei kleinen Kindern immer eine Schweigepflicht. Die Entbindung davon können nur die Sorgeberechtigten aussprechen. Beide müssen dem zustimmen und hier hat die Mutter ...“
„Die Verletzung der Schweigepflicht stellt eine Straftat dar“, warf Marie trocken ein.
Ich kochte vor Wut.
„Hermann Wagner spielt also irgendwo anders weiter Kindermädchen?“
„Wer weiß, was er mit dem Mädchen sonst noch angestellt hat“, sagte Marie und seufzte. In ihren Augen lag Verzweiflung. „Vielleicht hat er sie gefilmt.“
„Lass uns bitte das Thema wechseln“, sagte Sophie leise. „Erzählt mir von eurem Tag.“
Wir plauderten ein wenig, aber nach fünf Minuten sprachen wir abermals über das missbrauchte Mädchen. Der Gedanke, dass der Täter seiner Bestrafung entging, war für uns unerträglich.