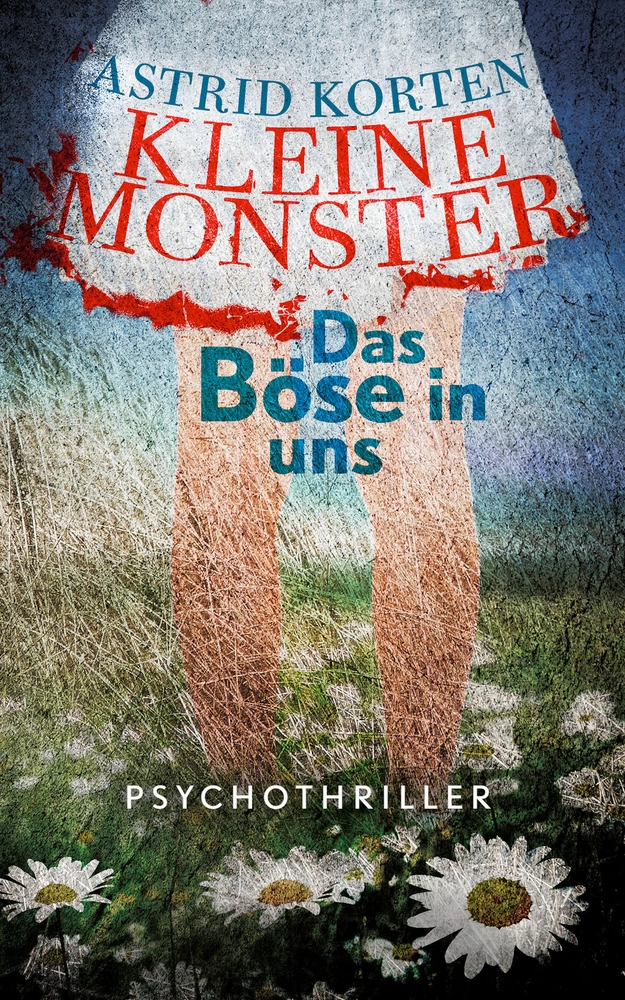Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
KLEINE MONSTER
DOPPELBAND
LILITH – EISKALTER ENGEL
GLEIS DER VERGELTUNG
LILITH – EISKALTER ENGEL
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2017 Astrid Korten
http://www.facebook.com/Astrid.Korten.Autorin
Website: www.astrid-korten.com
Twitter: https://twitter.com/charbrontee
Google: Astrid Korten
Lektorat: Susanne Zeyse
Korrektorat: Susanne Zeyse, Melanie Hinterreiter
Bildnachweis: ©Shutterstock /PicFine
Covergestaltung ©ZERO Werbeagentur München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung der Autorin wiedergegeben werden.
Über das Buch
„Aus jedem Kätzchen wird mal eine Katze. Sie wirken immer so harmlos am Anfang: winzig und ruhig, schlabbern ihr Tellerchen Milch. Aber sind ihre Krallen lang und scharf geworden, dann fließt Blut.“
Vincent Coccotti
Das Leben von Anna und Max Gavaldo könnte so schön sein. Sie sind glücklich miteinander und freuen sich auf ihr zweites Kind. Doch dann geschieht ein grausames Verbrechen und auch Anna wird bedroht. Ihre 16-jährige Tochter Katharina hat das zweite Gesicht und benimmt sich äußerst seltsam. Immer wieder führen ihre Visionen sie in die Vergangenheit und in das Reich der Toten – eine Faszination, der das junge Mädchen sich kaum entziehen kann.
Eines Tages taucht der mysteriöse Baan in Katharinas Leben auf. Sie ahnt nicht, dass damit das Böse seinen Einzug in ihr Leben und das ihrer Familie hält …
Ein atemberaubender Thriller über Wut und Rache,
Wahn und Machtlosigkeit.
Astrid Korten
L I L I T H
EISKALTER ENGEL
Psychothriller
ANGST
„Es gibt keine Grenzen. Weder für Gedanken, noch für Gefühle. Es ist die Angst, die immer Grenzen setzt.“
Ingmar Bergman
Polizeipräsidium München, Verhörraum 21
28. Dezember 2016
Es war ein langer Tag gewesen. Bemerkenswert, auf eine dunkle, beunruhigende Weise. Für den Leiter der Kripo München, Benedikt van Cleef, und seine Kollegin, Claire Schirow, die zusammen die Ermittlungen leiteten, war er noch lange nicht vorüber.
„Glaubst du das?“, fragte Claire.
Benedikt van Cleef, müde, aber wohl wissend, dass seine Familie und das Bett noch ein paar Stunden warten mussten, zuckte mit den Schultern.
„Die Sache ist irre. Ich meine, ernsthaft krank“, fuhr Claire fort.
Sie standen einander im Korridor gegenüber, jeder mit einem Plastikbecher lauwarmem Automatenkaffee in der Hand. Benedikt sah seine Kollegin aufmerksam an. Ihr messerscharfer Verstand hatte ihn schon einige Male vor schwerwiegenden Fehlern bewahrt.
Er war sich nur über eine Sache im Klaren: Wenn er mit der Beschuldigten fertig war, würde sie ihn nie wieder mit diesem strahlenden Lächeln anschauen. Keiner der Beteiligten in diesem Fall sollte je wieder von dem Grauen in der Nacht geweckt werden, darin waren Claire und er sich einig.
Er hatte seine Kollegin während seiner Ausbildung zum Polizisten kennengelernt und damals eine kurze Affäre mit ihr gehabt. Allerdings hatte die hormonell bedingte Besessenheit nur vier Monate angehalten. Claire war beim Drogendezernat gewesen und seit einigen Jahren bei der Kripo. Sie war wie er verheiratet und hatte zwei Söhne. Seit ihrer ersten Begegnung hatte sie dreißig Kilo mehr auf den Rippen, was ihren Faible für Schlabberhosen und weite, grauenvolle Pullis erklärte. Ihr braunes Haar war kurz geschnitten und ihr ovales Gesicht schmückte eine farbenfrohe Brille. Sie war eine exzellente Ermittlerin und eine loyale Kollegin. Ihren Schlabberlook mochte er nicht besonders, dafür aber ihren Humor umso mehr.
Claire zündete sich eine Zigarette an. „Was ist mit dir, Benedikt? Glaubst du es? Könnte unsere Beschuldigte auch sie getötet haben?“
„Keine voreiligen Schlüsse, Claire. Im Moment jedenfalls.“
„Ich wette, die Medien sind anderer Meinung. Vorhin haben schon wieder zwei Presseheinis im Präsidium angerufen und wollten Informationen. Die werden aus dieser Sauerei einen verdammten Zirkus machen.“ Sie blies Rauch in die Luft. „Kann man ihnen nicht verdenken, oder? Es ist eine große Story und sie müssen ihren Job machen.“
„Das müssen wir auch.“ Benedikt deutete auf die Tür am Ende des Korridors. „Lass uns wieder reingehen. Ich vernehme und du schaltest dich ein, wenn es nötig ist.“
Claire drückte ihre Zigarette aus. „Good cop, bad cop?“
„Nein!“, sagte er empört. „Sie wird niemals gestehen. Wir müssen es anders angehen.“
Claire zuckte mit den Schultern. „Du meinst, weil wir diesen Brief gelesen haben, sollten wir unkonventioneller vorgehen und gegen die Regeln verstoßen?“
Van Cleef nickte. „Absolut!“
„Wie du meinst.“
Sie betraten den Vernehmungsraum. Er war spartanisch: weiße Wände, eine grelle Deckenlampe und ein Tisch mit einem Tonbandgerät. Benedikt hatte es hier immer deprimierend gefunden. Wie eine Zelle in der Klapsmühle, nur ohne Gummiwände. Als er jetzt an die düstere Geschichte dachte, die sich hier offenbarte, fand er den Vergleich beängstigend angemessen.
Sie saß mit ihrem Anwalt am Tisch. Sie flüsterten, verstummten aber sofort, als sie den Raum betraten.
Vielleicht ein Zeichen der Schuld, dachte Benedikt. Er war lange genug in diesem Beruf, um zu wissen, dass schon die bloße Anwesenheit eines Polizisten selbst bei dem unschuldigsten Menschen das Gefühl erwecken konnte, dass er etwas zu verbergen hätte. Das gehörte zu den Widrigkeiten dieses Berufs. Aber es war sein Beruf. Und er würde ihn ausüben, selbst wenn es ihm im Moment besonders schwer fiel.
Fünf Minuten später war die Vernehmung wieder im Gange.
„So war es nicht“, wiederholte die Beschuldigte zum zweiten Mal. „Ich schwöre, so war es nicht!“
„Nicht? Aber für mich sieht es so aus und so stellt es sich auch für das Gericht dar. Das begreifen Sie doch, oder?“, fragte Claire.
Schweigen. Die Beschuldigte starrte zu Boden. Sie sah blass aus, verängstigt und plötzlich viel jünger. Eher ein Kind, als ein erwachsener Mensch. So war es oft bei Tatverdächtigen, wenn ihnen die Ungeheuerlichkeit dessen klar wurde, womit sie es zu tun hatten. Einen Augenblick lang empfand Benedikt Mitgefühl. Dann dachte er an die Einzelheiten des Falls, und das Gefühl verschwand so schnell, wie es gekommen war.
„Fangen wir von vorn an. Lassen Sie uns ganz zum Anfang zurückkehren. Und denken Sie daran, ich will alles wissen …“
Aber alles würde er niemals wissen. Auch nicht, wie es wirklich begonnen hatte. Stopp! Er wusste wie alles begonnen hatte. Vor vielen Jahren, als ein Psychopath, der sich Jakob nannte, blutjungen Frauen die Fingernägel himmelblau lackierte.
Als er sie danach missbraucht und getötet hatte.
Als er Anna Gavaldos Schwester Katharina im Visier hatte.
Und sie tötete.
Als Anna zehn Jahre später von dem Mörder ihrer Schwester vergewaltigt wurde.
Als …
Ein Verbrechen war wie ein Teppich aus Emotionen. Tausend verschiedene Gefühle an tausend verschiedenen Tagen miteinander verwoben.
Und der Ursprung dieses Verbrechens lag so viele Jahre zurück, und die Leute, die an den ersten Akten beteiligt gewesen waren, trugen eine enorme Schuld, selbst die Unschuldigen.
„Ich habe sie nicht getötet.“ Ein Wimmern. „Ich habe sie gehasst, aber ich habe sie nicht umgebracht!“
Jakob …
Die Toten schlafen mit offenen Augen. Sie beobachten uns aus der Vergangenheit.
Vincent Coccotti
Kapitel 1
Starnberg, Oktober 2016
Die sechzehnjährige Katharina Gavaldo spürte, wie sich die Schwere des Schlafes langsam löste. Auf dem Nachttisch leuchtete der Wecker, der beim Aufwachen normalerweise ihre Wutausbrüche abbekam. Die blauen Ziffern sagten ihr, dass sie noch einige Stunden weiterschlafen durfte und obwohl die Tür ihres Zimmers einen Spalt offenstand, sah sie nichts als Dunkelheit. Natürlich. Die Nacht war gnädig. Zu ihr – und ihren Dämonen, von denen niemand eine Ahnung hatte.
Katharina wusste, warum sie aufgewacht war: Heute Nacht war es soweit. Da war sie ganz sicher. Wer würde denn auch zweifeln, wenn nicht einmal die seltsame Gestalt, die sie seit einigen Wochen immer in ihren Visionen heimsuchte, es tat. Ein junger Mann, der ihr sagte, dass sie eins waren; dass sie zusammengehörten. Dass er sie liebte, obwohl er sie noch nie gesehen hatte.
„Im Dunkeln werden wir uns eines Tages begegnen und uns danach nie mehr trennen“, hatte er gesagt. Katharina glaubte ihm. Seine Worte hallten wieder und wieder in ihren Gedanken nach. „Wir beide handeln. Zur selben Zeit. Zur selben Stunde. So werden wir uns nah sein.“
Als Katharina elf Jahre alt war, hatte ihre Mutter manchmal gesagt, sie sei ein „anstrengendes“ Kind. Sie hatte nie so richtig verstanden, was ihre Mutter damit meinte. Sie selbst fand sich überhaupt nicht schwierig. Sie warf keine Gegenstände auf den Küchenboden wie ihre Mutter und bekam auch keine Wutanfälle, selbst wenn sie gelegentlich mit dem Gedanken spielte. Bis auf Fisch und Käse aß sie alles, was auf den Tisch kam. Sie war weder lauter noch dümmer als andere Kinder, die sie kannte. Ihr Name war leicht auszusprechen und leicht zu buchstabieren. Sie hatte ein hübsches Gesicht, blass und voller Sommersprossen, blaue Augen und langes, blondes Haar. Sie ging jeden Tag zur Schule wie andere Kinder auch und machte nie viel Wind darum. Zu ihrer Mutter war sie nicht gemeiner als ihre Mutter zu ihr war. Nie klopften Polizisten an die Haustür, um sie zu verhaften. Nie drohten Ärzte in weißen Kitteln, sie ins Irrenhaus zu schaffen, wie ihr Vater es vor Jahren mal mit ihrer Mutter getan hatte.
Sie fand sich eigentlich ziemlich pflegeleicht.
Erst jetzt hatte Katharina verstanden, was ihre Mutter damit meinte. Anna fand sie deswegen schwierig, weil sie so still war und wegen dieser Geschichte mit dem Köter des Nachbarn. Das machte ihr offenbar zu schaffen. Ein weiteres Problem bestand darin, dass sie gern allein war. Natürlich nicht die ganze Zeit. Nicht einmal jeden Tag. Aber an den meisten Tagen zog sie sich gern auf eine Stunde in ihr Zimmer oder in den Garten hinter der Villa zurück, um ungestört ihren Gedanken nachzuhängen.
Seit dem Vorfall mit dem Hund glaubte ihre Mutter, dass sie ein mit Vorsicht zu genießendes Kind war. Dabei war es dieses Viech gewesen. Katharina hatte damals darauf geachtet, dass sie keine plötzliche Bewegung machte, als der Hund sie entdeckte, bis sie mit dem Rücken gegen das Garagentor stand. So konnte das Tier sie nicht umkreisen. Dann nahm sie aus der Jackentasche das Taschenmesser ihres Vaters und eine Streichholzschachtel. Schon schlich der Hunde schwanzwedelnd heran, geiferte und knurrte und heulte.
Zu Katharinas Füßen lagen ein paar trockene Blätter und Zweige. Rasch und geschickt formte sie sie zu einem kleinen Häufchen. Der Hund kam näher. In der Schachtel befanden sich nur noch fünf Zündholzer. Sie konnte den Atem des Tieres riechen – ein schrecklicher Gestank nach fauligem Fleisch. Rasch bückte sie sich und versuchte, das Streichholz hinter vorgehaltener Hand anzuzünden. Ein Windstoß, die Flamme flackerte, doch Katharina hielt sie dicht an den Haufen, ein Blatt fing Feuer, dann ein zweites, dann das Ende eines Zweigs, und bald brannte der ganze Haufen lichterloh. Sie schichtete noch mehr Laub, Zweige und größere Äste aufeinander. Der Hund wich zurück. Tiere fürchteten sich vor Feuer. Die Flammen züngelten höher, und der Wind trieb den Rauch genau auf den sabbernden Rachen zu. Da griff Katharina nach dem Taschenmesser und ging auf den Hund zu …
Katharina hatte sich mittlerweile an die Dunkelheit gewöhnt. Unzählige Augen starrten ihr entgegen, die zu den Stofftieren gehörten, die fein säuberlich aufgereiht im Regal saßen. Es machte ihr Spaß, nachts im Halbschlaf in diese starren Gesichter zu sehen. In der Dunkelheit blitzte hinter deren Niedlichkeit etwas Böses hervor. Von ihr besiegt – abgefackelt und niedergestochen wie der blöde Köter des Nachbarn.
Sie seufzte und kämpfte eine Weile mit sich, bis sie schließlich das Laken zur Seite warf, die Beine aus dem Bett schwang und mit nackten Füßen in ihre Schuhe schlüpfte.
Sie nahm ihr Tagebuch aus dem Geheimfach in der Schreibtischschublade und schrieb …
„Es gibt gute Neuigkeiten, Katharina“, hat Mom gesagt und mir den Brief der Schlampe Wagenknecht gezeigt. „Du darfst jetzt wieder am Kunstunterricht teilnehmen, weil du dich so kooperativ angestellt hast, dass deine Lehrerin dich wieder dabeihaben will. Reiß dich also in Zukunft zusammen!“
Bla, bla, bla. Der Mensch wird als Sünder geboren, Mom! Wusstest du das nicht?
Ich bin momentan den ganzen Tag wütend. Auf meine Mutter, die überall herumschnüffelt, auf dieses Haus – mein Gefängnis. Ich bin wütend auf dich, weil du mich zur Weißglut bringst, weil du schwanger bist, weil ich bald nicht mehr ein Einzelkind sein werde, weil mein Vater …
Ich hätte Lust dir die Luft zu nehmen, Mom, dir die Kehle durchzuschneiden wie bei deiner Schwester. Oh … wie unartig. Das ist nicht sehr nett, was ich hier schreibe.
Reg dich nicht auf, Mom. Ich hab dich trotz allem lieb.
Aber in meinem Kopf hat sich eine Kammer geöffnet, die brechend voll ist mit Wut, und ich kriege die Tür nicht mehr zu. Tagsüber gelingt es mir noch ganz gut, meine Gedanken an irgendeiner Hirnwindung zu parken, doch nachts …
Katharina legte den Stift beiseite. Die Tür zum Zimmer ihrer Eltern knarrte, als sie sich vergewisserte, dass sie schliefen. Auf Zehenspitzen ging sie die Treppe hinunter.
Im Wohnzimmer war niemand. Alles war noch genauso, wie vor dem Schlafengehen und ein Lächeln schlich sich auf ihre Lippen. Sie schloss leise die Tür hinter sich und ging direkt auf den Wohnzimmerschrank zu, in dem ihre Mutter die zarten Kristallgläser aufbewahrte, die noch ihrer Großmutter gehört hatten. Nur zu besonderen Anlässen wurde aus diesen Gläsern getrunken. Und nur ihrer Mutter war es erlaubt, sie zu berühren. Gespült wurden sie mit der Hand, sie durften keinesfalls in die Spülmaschine.
Katharina nahm ein Glas nach dem anderen aus dem Schrankregal, legte es auf den Boden und trat darauf. Sie wirkte dabei gelassen, aber in ihr brodelte unbändige Wut. Das zerbrochene Kristall bildete einen schimmernden Teppich, der mit jedem ihrer Tritte größer wurde. Dabei wanderte ihr Blick immer wieder kurz zur Wohnzimmertür, doch hinter der war kein Mucks zu hören.
Es dauerte fünf Minuten, bis die Regale leer waren. Nur wenige Geräusche begleiteten ihr Wüten. Danach huschte sie wieder die Treppe hinauf, kroch in ihr Bett und starrte ihre Stofftiere an.
Als sie die Augen schloss, tauchte wieder die Vision vor ihrem inneren Auge auf. „Meine große Katharina, meine mutige Katharina, meine starke Katharina.“ Sein Flüstern in ihrem Kopf war gedämpft. Er war so stolz auf sie.
Sie nickte, lächelte glücklich. Niemand ahnte, dass sie beide eine gemeinsame Zukunft erwartete. Nur wann das sein würde, wusste Katharina nicht.
Max Gavaldo entdeckte die Verwüstung, als er am Morgen die Treppe herunterkam. Katharinas Vater war in der Regel der Erste der Familie, der die Küche betrat. Meist verließ er das Haus, bevor die anderen aufwachten.
Katharina hörte, wie er am unteren Ende der Treppe den Namen ihrer Mutter rief. „Anna! Steh bitte auf! Verdammt, was ist das hier für eine Scheiße?“
Katharina hörte den Schrei ihrer Mutter.
Einen Moment später wurde sie von ihrem Vater aus dem Bett ins Wohnzimmer gezerrt.
„Ist es wahr, was deine Mutter da behauptet?“, wollte er wissen. „Dass du das warst? Raus damit, warst du das?“
Katharina nickte.
„Warum?“
„Darum.“
„Das ist keine Antwort, Katharina.“
Kein Wort kam über ihre Lippen.
„Was ist passiert?“, fragte er wütend. „Es muss einen Grund geben, warum du das getan hast.“ Er packte seine Tochter an beiden Schultern und schüttelte sie. „Schau mich an! Warum? Was ist passiert?“
„Mom hat Jasper weggeworfen“, antwortete Katharina.
Jasper war ein Geschenk gewesen und sie liebte den getupften Teddybären innig, hatte ihm schon als Kind ihre Sorgen und Wünsche anvertraut. Mittlerweile fehlte dem Stofftier ein Ohr und es wurde von vielen Nähten zusammengehalten, was ihrer Liebe zu dem Spielzeug keinen Abbruch getan hatte.
Ihre Mutter betrat das Wohnzimmer. „Ich habe immer gesagt, dass dein Schatz zum Monster mutiert, Max. Mit pubertären Allüren hat das nichts mehr zu tun!“
„Anna! Bitte!“
Sie sah ihre Mutter an, ihr müdes, blasses Gesicht. Und fühlte ihre Wut.
Einen Augenblick lang hatte Katharina das Gefühl, dass ihre Mutter auf sie losgehen würde, ihr Gesicht war hassverzerrt. Und sie spürte noch etwas, das sie erschaudern ließ: Schadenfreude, süße Schadenfreude. Zu dem Hohngelächter, das in ihrem Kopf ertönte.
Sie zuckte mit den Schultern.
Vielleicht war der frühe Morgen daran schuld, aber plötzlich fiel ihr wieder ein, dass sie Hunger hatte. Sie drehte sich um, als wäre die Sache damit erledigt, und lief erhobenen Hauptes an ihren Eltern vorbei. Wutentbrannt folgten sie ihr. In der Küche trat Katharina an den Küchenschrank und nahm eine unangebrochene Packung Schokoladenkekse heraus. Sie riss die Packung auf und stopfte mehrere Kekse in sich hinein.
Ihre Mutter atmete schwer. Sie sah aus, als wäre sie drauf und dran, ihre Tochter windelweich zu prügeln.
Katharina sah sie hasserfüllt an. „Das war nicht fair, Mama“, sagte sie mit eisiger Stimme und nahm weitere Kekse aus der Packung. „Ich musste Jasper aus der Mülltonne fischen!“
Entsetzt sah ihr Vater sie an. „Das Leben ist nicht fair, Kind“, sagte er. „War es nur wegen Jasper …?“ Seine Stimme versagte.
„Ja“, log Katharina.
Kapitel 2
Bundesstaat Amazonas, Oktober 2016
Während der Semesterferien erkundete der einundzwanzigjährige Baan immer wieder die Höhle an der Wasserscheide zwischen dem Orinoko-Fluss und dem Amazonas. Er glaubte fest daran, dass er dort die Antwort auf die Frage finden würde, wie sein Vater in Europa ums Leben gekommen war und wie er mit dem Verstorbenen Kontakt aufnehmen konnte. Er hoffte, einen Jivaro in der Höhle anzutreffen. Die kleinen, seltsamen Männer galten zwar als gefährlich und mordlustig, aber nur die Jivaro beherrschten die Kunst, die Geister der Vergangenheit heraufzubeschwören. Aus diesem Grund hatte Baan auch ihre Sprache erlernt und sich genauso mit ihren Ritualen vertraut gemacht wie einst sein Vater Jakob.
Außerdem fand Baan es spannend, in den kühlen Wänden der Höhle nach Zeichen der Dämonen zu forschen – viel spannender, als an der Universität von Salvador da Bahía Medizin zu studieren. Selbst ein gemeinsamer Ausritt mit Raimundo, dem Verwalter der Fazenda, konnte nicht mit einem Streifzug durch die finstere Höhle mithalten. Für Baan war sie eine Quelle der brasilianischen Kultur.
Heute wird etwas Ungewöhnliches passieren, dachte Baan, denn in der vergangenen Nacht hatte er zum dritten Mal eine Vision gehabt. Bei dem Gedanken an das junge Mädchen mit den langen, blonden Haaren und den blauen Augen, das ihm aus der Ferne zugewinkt hatte, spürte er ein Kribbeln im Nacken und hörte das laute Pochen seines Herzens. Sie war von atemberaubender Schönheit, aber der Ausdruck in ihren eisblauen Augen hatte etwas Unheilvolles, ja, sogar etwas Bedrohliches.
Seit er von den Visionen heimgesucht wurde, fand er Geschmack am Tod und hatte keine Angst mehr davor, erstickte jeden noch so leisen Zweifel daran. Er genoss es, eine sechs Meter lange Anakonda dabei zu beobachten, wie sie im Wasser ein kleines Tier umschlang und es tötete, oder die Piranhas dabei zu verfolgen, wie sie einem verletzten Tapir das Fleisch von den Knochen rissen. Er war furchtlos wie sein Vater. Deshalb hatten die Jivaro seinen Vater, ihren weißen Freund aus München, den Furchtlosen genannt. Und er, Baan, war Jakobs Sohn.
Während er seinen Weg fortsetzte, drehte er sich um und warf einen Blick auf sein Zuhause, das sein Vater ihm vermacht hatte: die Fazenda Giacomo. Rauch stieg aus dem Schornstein des Außengrills auf. Die großen Fenster waren dunkel, aber vertraut. Raimundo bereitete ein Churrasco für die Arbeiter zu. Niemand folgte ihm. Die Luft war rein.
Raimundo, ein Afroindianer aus Salvador da Bahía, verwaltete nicht nur die Fazenda Giacomo, sondern war auch sein Vormund. Alles, was Baan über seinen Vater wusste, hatte Raimundo ihm erzählt, der Jakobs engster Freund und Vertrauter gewesen war. Baan selbst hatte kaum noch Erinnerungen an seinen Vater. Er war erst drei Jahre alt gewesen, als Jakob nach Deutschland gegangen und nie von dort zurückgekehrt war.
Seine Mutter hatte in den vergangenen Jahren kaum Zeit für ihn gehabt. Er sah sie nur selten, denn seit Jakobs Tod lebte sie im zweihundert Kilometer entfernten Recife und musste vier weitere Kinder ernähren. Dennoch mochte Baan sie. Sie hatte die typischen funkelnden Augen einer Brasilianerin, dunkle Haut und eine schwarze Lockenmähne. Baan kam mehr nach seinem Vater. Mit seinen dunklen Locken, den großen braunen Augen, einer fein geschnittenen Nase und den vollen Lippen sei er ein schönes Kind gewesen und heute ein attraktiver Mann, behauptete seine Mutter. Deshalb nannten sie und Raimundo ihn manchmal nur Jakobs Sohn. Das wiederum erfüllte ihn mit Stolz.
Nach dem Mittagessen an diesem Tag hatte Baan sich wütend davongeschlichen, nachdem er Raimundo in der Küche dabei beobachtet hatte, wie er die Bluse von Gabriela aufgeknöpft hatte. Mit seinen Händen hatte er die kleinen, festen Brüste der Hausangestellten berührt, ein Bein zwischen ihre geschoben und das Becken der Mulattin kreisen lassen. Es hatte Baan überhaupt nicht gefallen, dabei Raimundos dunkles Lachen zu hören und zu sehen, wie der Verwalter Gabrielas Körper liebkoste. Schließlich war sie dreißig Jahre jünger als Raimundo.
Innerhalb weniger Minuten hatte sich seine Seele verdunkelt und alles, was vorher hell gewesen war, wurde als Dämon nach außen gestülpt. Baan geriet neuerdings immer öfter in dumpfe, sinnlose Wut, sobald er mit der Zügellosigkeit von Raimundo konfrontiert wurde. Dann rannte er durch imaginäre Schatten davon, mit großen, dunklen, gehetzten, blutunterlaufenen Augen.
Auch jetzt lief er zur Höhle, das Gesicht gerötet, weil er seine Gedanken nicht verstand und warum er neuerdings immer voller Zorn war, sobald er sich selbst befriedigte. Er liebte die Unschuld einer Blüte, die Vollkommenheit einer Amazonaslilie, auf der sich höchstens einmal ein Schmetterling niederließ. Das abgründige Tier der Lust mochte er überhaupt nicht, denn dann nagten Dämonen genussvoll geifernd an seinem Fleisch.
Die langen, dunklen Haare klebten ihm am Rücken. Er lief zu schnell, der Atem stach ihm in die Brust – von der Anstrengung, noch schneller zu laufen, seine Beine noch schneller zu bewegen, als könnte er etwas durchbrechen, etwas, das niemand sehen durfte: seine abgrundtief bösen Gedanken hinter seinem Unschuldsgesicht.
Er beugte mehrmals den Kopf und wich den tiefhängenden Ästen der Regenwaldbäume aus, um deren Stämme sich die wild wachsenden Lianen ineinander verflochten. Dazwischen drängten sich seltsame Pflanzen, die ihre Farbe im wechselnden Licht veränderten. Der Pfad war von modrigem Laub und Moos überwuchert und so glitschig, dass Baan ein paar Mal fast gestürzt wäre. An der Stelle, an der ein Abhang den lichtundurchlässigen Baldachin der Baumwipfel durchbrach, drang Sonnenschein bis in die mittleren Lagen des Regenwaldes vor. Beim Anblick der uralten schwarzen Felsen, die vor ihm lagen, verspürte er ein Gefühl von Unheil, einen Sumpf von Albträumen. Der Wald schien ihm zuzuflüstern, dass ein Mensch hier nicht willkommen war.
Er fühlte sich schwach und zittrig, als er mit klopfendem Herzen vor dem Eingang der Höhle stand. Hängende und kletternde Pflanzen in unterschiedlichen Grünschattierungen kämpften hier ums Überleben und umschlangen den Eingang der Höhle mit ihren feinen Wurzeln. Es tobte eine lautlose Schlacht um Licht und Platz.
Baan bahnte sich einen Weg durch die Öffnung. Seine Neugier war stärker als der Zorn, den er auf Raimundos Triebe verspürte. Er schob mehrere Lianen beiseite.
Baan war nicht fähig, sich zu bewegen, und starrte auf die kleine, furchteinflößende, greisenhafte Gestalt vor ihm, die auf etwas einschlug, das auf dem Boden lag. Ein Bündel vielleicht oder eine Macumba-Puppe, dachte er. Er erkannte nur das lange, helle Haar in der Farbe einer Mondblume.
Der Jivaro war bis auf einen Lendenschurz nackt, sein Körper mit dem Saft der Urucu-Frucht rot gefärbt und mit schwarzen Kreisen bemalt. Baan musste sich entscheiden: umkehren oder sich mutig erheben. Der Gedanke, dass der Moment gekommen war, in dem er Antworten auf seine Fragen bekommen würde, siegte über sein Misstrauen und seine Vorsicht. Er war erstaunt über seine Fähigkeit, mögliche Skrupel einfach beiseitezuschieben, sich von sich selbst zu lösen und die Lage kühl zu analysieren.
Baan ging einen Schritt weiter, blieb aber stehen, als der Indianer ihn bemerkte. Taumelnd drehte er sich um und sah Baan an.
Es war ein gegenseitiges Erkennen und die stille, aber spontane Übereinkunft, die nächsten Stunden gemeinsam zu verbringen. Baan starrte den Jivaro an, musterte das kleine Gesicht, das ebenfalls blutrot bemalt war, sah die dunklen Schatten unter den Augen, deren Lider so zart waren, dass die Iriden durchschimmerten, die nun gefährlich aufblitzten. Ein Glühen wie im Fieberwahn, vermutlich von einer Portion Peyote-Pilze, nach deren Einnahme die Welt trotz der Finsternis grell und intensiv in allen erdenklichen Farben leuchtete.
Ein Luftzug wirbelte Staub auf und wehte Baan einen abscheulichen Geruch entgegen. Brühe, die ihn an die Suppe mit den Fettaugen und dem widerlich stinkenden Knochenmark erinnerte, die seine Mutter immer für ihn zubereitet hatte, wenn er krank war.
Plötzlich drang grelles Licht von draußen durch den Eingang und erhellte das Etwas auf dem Boden. Baan hielt inne, als er lose Stofffetzen erkannte, die eine Tsantsa, einen Schrumpfkopf, teilweise umhüllten. Er wich zurück. Die Haut war samt Haaren vom Schädelknochen abgezogen, die Lippen zusammengenäht und die Augäpfel herausgeschält. Der violettblaue Faden bildete einen gespenstischen Kontrast zu dem blassen Mund. All das nahm Baan im Bruchteil einer Sekunde wahr, er fühlte jedoch keinen Impuls, wegzulaufen. Seine Faszination und seine Neugierde waren größer.
Baan glaubte eine Gefühlsregung in den Augen des Jivaro zu sehen, als der kleine Mann nickte und ihn herbeiwinkte.
„Du bist furchtlos. Du bist unverkennbar Jakobs Sohn“, wisperte er.
Sein Anblick schien dem Jivaro-Häuptling Freude zu bereiten, aber Baan war dennoch auf der Hut. Der Jivaro schaute ihn unverwandt an und dann verschwamm die Wirklichkeit und verrutschte am Rand von Baans Blickfeld. Er hielt den Kopf schräg und betrat Sekunden später eine andere Welt, eine dunkle Welt, die nach Schmutz und Fäulnis roch und in der der Indianer ihm das Ritual erklärte und Baan von seinem Vater Jakob berichtete.
Stöhnend schloss Baan die Augen. Endlich fügte sich alles zusammen. Seine nächtlichen Visionen, seine Verachtung für die zügellose Lust, sein Gefallen am Tod. Die Wahrheit über seinen Vater bahnte sich auf schwarzen Schwingen ihren Weg durch die Höhle – geradewegs in sein Hirn.
Danach war Baan nicht mehr der Mann, der am Tag zuvor noch an ein unbeschwertes Studentenleben an der Universität in Salvador da Bahía geglaubt hatte. Seine Visionen waren so wahr wie der uralte Jivaro, der in der Höhle aufgrund seiner Bejahrtheit und seines geschwächten Herzens dem Tod entgegensah.
Baan lief hinaus, dem gleißenden Rot des Abendhimmels entgegen, den Farben des Feuers, wie sie nur die Hölle entsenden konnte. Er versank im wirbelnden Strom der vergangenen Eindrücke, um an diesem Ort mit wakan, der allumfassenden Seele, zu verschmelzen. In seinem Kopf war ein leises, konstantes Sirren. Ich werde die Menschen finden, die meinen Vater auf dem Gewissen haben. Ich werde sie suchen, sie finden, sie töten …
Kapitel 3
München, Oktober 2016
Es gelang Anna Gavaldo, den Raum des Hotels „Bayrischer Hof“, in dem die Benefizveranstaltung der Organisation Terre de femme für die Opfer von häuslicher Gewalt gegen Frauen soeben ihren Höhepunkt erreichte, ungesehen zu verlassen. Ihre Freundin Mathilda van Cleef setzte zu einer Rede an. Das Reden und Lachen der rund einhundert geladenen Gäste, das den Raum mit einem Dröhnen erfüllte, verstummte. Alle Blicke waren auf Mathilda gerichtet, die in diesem Moment ihren Entschluss nicht bereute, die Laudatio für die Präsidentin der Organisation Terre de femme zu halten und sich bei dem Publikum für die großzügigen Spenden zu bedanken.
Mathilda zog mit ihrem gekonnten Auftritt die gesamte Aufmerksamkeit auf sich. Witz, Charme und ihre rote Lockenmähne taten ein Übriges.
Anna kannte Mathilda seit ihrer Kindheit. Ihre erste Begegnung hatte auf dem Schulhof der Grundschule stattgefunden, wo sie Mathilda schüchtern nach dem Weg zum Klassenraum gefragt hatte. Mathilda hatte – wie sie selbst – einen leicht nordischen Akzent, deshalb war da gleich eine Vertrautheit zwischen ihnen gewesen. Weil Anna als Kind so dünn und blass gewesen war und im Allgemeinen so zerbrechlich gewirkt hatte, hatte sie im Augenblick ihres Aufeinandertreffens Mathildas Schutzinstinkt geweckt, der sich auch nicht legte, als Mathilda später feststellte, dass Anna sehr gut für sich selbst sorgen konnte und einen eisernen Willen besaß.
Anna liebte Mathildas Fantasie und ihre Leichtigkeit, ihre ansteckende fröhliche Art. Ihre Ehemänner waren miteinander befreundet, und Max und sie waren die Paten der van-Cleefs-Zwillinge, Cox und Samu.
Anna seufzte. Jeder im Saal schien den Abend zu genießen – überall schöne Kleider, Schmuck, Parfüm, ausgelassenes Lachen. Und sie inmitten des Geschehens und doch getrennt von allen anderen wie durch eine unsichtbare Wand. Sie lächelte mechanisch, antwortete nur, wenn sie etwas gefragt wurde, nickte oder schüttelte den Kopf und trank von ihrem Champagner.
Sie fühlte sich wie eine Marionette, die an Fäden hing und von irgendjemandem geführt wurde, ohne zu einer einzigen eigenständigen Bewegung fähig zu sein. Seit Tagen ging das so. Es war eine eigentümliche Angst in ihr, seit Anna erfahren hatte, dass sie wieder ein Kind erwartete.
Ich trage die Verantwortung für ein ungeborenes Baby, dachte sie. Ich darf nie wieder nach Jakobs Willen leben. Was sie aber gerade tat, hatte mit Leben und Verantwortung kaum was zu tun: Sie hatte eine Panikattacke.
Der Moment war gar nicht so ungünstig. Es gelang ihr, den Saal ungesehen zu verlassen. Sie hatte sich während der letzten Minuten bereits in die Nähe des Ausgangs vorgearbeitet und so waren es nur noch wenige Schritte, bis sie draußen war.
Anna schloss die schwere Tür hinter sich und lehnte sich für einen Moment tief atmend gegen die Wand. Wie ruhig es hier draußen war, wie kühl! Verdammt, reiß dich zusammen, Anna Gavaldo!
Eine Angestellte des eleganten Hotels kam vorbei und verharrte einen Moment, unschlüssig, ob die an der Wand lehnende Frau vielleicht Hilfe brauchte. Anna vermutete, dass sie ziemlich mitgenommen wirkte, wenn sie ungefähr so aussah wie sie sich fühlte. Sie richtete sich auf und versuchte zu lächeln.
„Alles in Ordnung?“, erkundigte sich die Angestellte.
Anna nickte. „Ja. Es ist nur … es ist ziemlich heiß da drinnen!“ Sie machte eine Kopfbewegung in Richtung Tür. „Mir ist ein wenig übel.“
Die junge Frau sah sie mitleidig an, ging aber dann weiter.
Anna begriff, dass sie unbedingt die Toilette aufsuchen und einen Blick in den Spiegel werfen sollte. So, wie die junge Frau sie gerade angesehen hatte, musste sie ziemlich derangiert aussehen. Kein Wunder, dachte sie, nach dem, was eben geschehen ist. Was zuhause in unserem Haus geschieht …
Zuerst war es nur ein Gefühl gewesen. Doch inzwischen war Anna sich sicher, dass eine Bedrohung sie umkreiste, wie damals, als die Bestie Jakob ihr Leben bestimmt hatte.
Der marmorgeflieste Raum empfing sie mit sanftem Licht und einer leisen, beruhigenden Musik, die aus verborgenen Lautsprechern erklang. In den Toilettenkabinen hielt sich gerade niemand auf. Aber bei weit über hundert Gästen, die sich im Hotel aufhielten, konnte dieser Zustand nicht von langer Dauer sein. Jede Sekunde konnte jemand hereinkommen. Ihr blieb nicht viel Zeit.
Sie stützte sich auf eines der luxuriösen Waschbecken und blickte in den hohen Spiegel darüber, aber erkannte die Frau kaum, die sie da sah. Ihre hellblonden Haare hingen wirr hinunter. Ihr Lippenstift war offenbar am Rand eines Champagnerglases gelandet, jedenfalls war nichts mehr davon auf ihrem Mund zu sehen. Ihre Nase glänzte, und ihr Make-up war verschmiert.
Sie hatte es gespürt. Geahnt, dass ihr Geist sich noch immer nicht von Jakob befreit hatte. In Gedanken umkreiste er sie noch immer, und sie ihn. Für sie beide gab es keinen Frieden. Vorhin hatte sie sein Flüstern vernommen und danach nichts so sehr gebraucht, wie diesen Raum verlassen zu können. Irgendjemand hatte sie im Saal beobachtet, um ihr schließlich im Vorbeigehen die Worte ins Ohr zu flüstern: „Ich werde dich töten.“
Sie musste sich jetzt schnell frisch machen und danach versuchen, irgendwie diesen Abend zu überstehen. Er konnte nicht ewig dauern. Die Veranstaltung war praktisch vorüber, die Spenden eingesammelt. Als Nächstes würde das Buffet eröffnet werden und dann konnte sie sicher rasch und diskret verschwinden.
Sie stellte ihre Handtasche auf die Marmorplatte.
Was für ein entsetzlicher Abend!
Plötzlich kullerten die Tränen aus ihren Augen, einfach so und sie konnte nichts dagegen machen. Entsetzt hob sie den Kopf, sah ihr fremdes Gesicht an. Und die Panik der Vergangenheit darin.
Kopflos riss sie ein ganzes Bündel seidenweicher Kosmetiktücher aus dem Behälter an der Wand und versuchte, die Tränenflut zu stoppen.
Ich muss nach Hause. Sofort!
Da! Hinter ihr war ein Geräusch. Die Tür, die zum Gang führte, wurde geöffnet. Spitze Absätze klapperten auf dem Marmor. Schemenhaft, verschwommen durch den Tränenschleier, nahm Anna eine Gestalt im Spiegel hinter sich wahr, eine Frau, die den Raum in Richtung der Toiletten durchquerte.
Anna presste die Kosmetiktücher gegen ihr Gesicht und tat so als putzte sie sich die Nase.
Beeil dich, ermahnte ihre innere Stimme sie, verschwinde!
Die Schritte hielten inne. Einen kurzen Augenblick lang herrschte völlige Stille. Dann drehte die Fremde sich um und kam auf Anna zu. Legte ihre Hand auf ihre leise bebende Schulter.
Anna hob den Blick und sah die andere hinter sich im Spiegel. Ein besorgtes Gesicht. Fragende Augen. Anna kannte sie nicht, aber nach ihrer Garderobe zu schließen gehörte sie ebenfalls zu den Gästen.
„Kann ich Ihnen helfen?“, fragte die Frau. „Ich möchte nicht aufdringlich sein, aber …“
Die Freundlichkeit, die Sorge, die aus der ruhigen Stimme sprach, waren mehr, als Anna ertragen konnte. Sie ließ die Tücher sinken und versuchte nicht mehr, den Strom ihrer Tränen aufzuhalten.
„Da drinnen … da ist jemand …“, schluchzte Anna. „Er hat gesagt, dass er mich töten will. Mich und meine Familie.“
Kapitel 4
Starnberg – In derselben Nacht
Max Gavaldo schenkte sich ein Glas Wein ein und beobachtete das Feuer im Kamin. Mit seinen Gedanken in der Nacht zu sitzen, erschien ihm irgendwie erträglicher als ruhig im Bett neben Anna liegen zu müssen, die sich mittlerweile wieder beruhigt hatte.
Völlig aufgelöst war sie von der Benefizveranstaltung nach Hause gekommen und hatte ihm unter Tränen berichtet, dass irgendjemand sie mal wieder bedroht hatte.
Verdammt, dachte er. Ging das schon wieder los? Wer oder was hatte den Schalter umgedreht, um dem Irrsinn mal wieder einen Blick durch die Tür zu gewähren? Vielleicht Annas Schwangerschaft?
Max liebte seine Frau, sie war für ihn von unwiderstehlichem Zauber. Er kannte nur zwei Empfindungen: innige Liebe und unbändigen Ehrgeiz. Er war ein brillanter Manager mit einem todsicheren Gespür für Neuerungen, steckte voller Ehrgeiz und wollte noch immer die Welt erobern. Aber nur mit Anna und seiner Tochter an seiner Seite.
Er gestattete sich zum ersten Mal, seine Gedanken der Angelegenheit zuzuwenden, die er die vergangenen Jahre aus seinem Bewusstsein verdrängt hatte. Er hatte an alles denken wollen, nur an eines nicht – an den Mann, der für Annas desolaten Zustand verantwortlich war und der seine Frau fast zerstört hatte: Jakob.
Der Wohnraum lag im Halbdunkel, die Dämmerung sickerte schwach durch die zugezogenen Baumwollvorhänge. Aus den Boxen, die sich im Regal zwischen seinen Büchern versteckten, klang leise Jazzmusik. Kenny G improvisierte mit seinem Tenorsaxofon im rauchigen Timbre das Thema von Hearts of Soul. Die CD-Hülle lag geöffnet neben einer zusammengeknüllten Wolldecke auf dem Sofa. Vor der Couch, auf einem teuren Perserteppich, stand ein niedriger Sofatisch aus dunklem Wurzelholz. Er fügte sich gut ein in das avantgardistische Ambiente des Zimmers. Auch der Duft nach Annas Parfüm, den sie im Zimmer verströmt hatte, passte gut.
Anna lag seit Stunden im Schlafzimmer und schlief tief und fest. Auf dem Tisch lag ihr in Leder gebundenes Tagebuch, das er vor Jahren zufällig im Keller hinter dem Weinregal gefunden hatte. Es war mit grauenvollen Zeichnungen und handschriftlichen Eintragungen vollgekritzelt. Er hatte bis heute keine Zeile darin gelesen, sondern es seit Jahren in seinem Safe unter Verschluss gehalten. Doch nach dem heutigen Vorfall hatte er beschlossen, dass er sich das Tagebuch doch ansehen musste. Vielleicht fand er darin einen Lösungsansatz für Annas Konflikte, etwas anderes fiel ihm nicht ein. Er musste sie schützen, denn schließlich erwartete sie ein Kind. Endlich, dachte er. Sein Kind!
Er nahm das Tagebuch in die Hand. Blätterte vor und zurück und landete schließlich bei Annas letzten Eintragungen.
Dezember 1999
Bin ich in einem Keller?
Eine Dunkelheit wie diese habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Ich glaube gefesselt auf einem Stuhl über einem lichtlosen Abgrund zu schweben. Nur allmählich kehrt das Gefühl wieder in Arme und Beine zurück. Ich bewege meine Hand vor den Augen. Obwohl ich spüre, dass die Handfläche leicht meine Nase berührt, sehe ich sie nicht. Ich umklammere die Stuhllehne. Irgendwo klappert Besteck. Mein Herz rast.
Jakob wird mich töten. So wie er meine Schwester Katharina getötet hat.
Gestern hat er mir eine weiße Paste ins Gesicht geschmiert, damit ich für einen Tag und eine Nacht die Blässe einer Toten habe. Nein! Jakob hat es als „fahle Aura“ bezeichnet und die Worte gesprochen: „Quando a vida perde o seu sentido, a morte nao mais assustara.“
Ich kenne ihre Bedeutung nicht.
Plötzlich ist seine Stimme dunkel und tief geworden, seine Augen riesig und hohl. Er sieht dem Mann meiner Albträume so ähnlich.
„Ich werde dich töten“, hat er gesagt.
Dienstagnachmittag?
Als er das erste Mal zu mir kommt, herrscht in dem Raum noch schwache Helligkeit. Es muss Dienstagnachmittag sein. Er bringt Wasser und gibt mir etwas zu trinken. Danach geht er wieder und kommt erst nach Stunden wieder. Im Raum ist es jetzt völlig dunkel, es ist also Nacht. Er berührt mich, streichelt meine Brüste. Ich kann nicht schreien und mich nicht bewegen. Mein Atem stockt unter seiner Berührung.
Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag?
Ich versuche vorsichtig, meine Hände und Füße zu bewegen. Das dumpfe Pochen verwandelt sich sofort in einen stechenden Schmerz. Meine Gedanken werden klarer. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Es muss Mittwochmorgen sein. Man wird nach mir suchen. Diese hauchdünne Hoffnung ist das Einzige, was mir bleibt. Ich flüstere Max’ Namen und flehe ihn aus dem Dunkel an, mich zu retten.
Max schluckte heftig und schenkte sich ein zweites Glas an. Verdammt! Verdammt! War es ein Fehler das alles zu lesen? Er spürte einen Kloß in seinem Hals, als er weiterlas.
Jakob betrachtet mich. Ich liege auf dem Tisch im Keller seines alten Hauses. Er hat mir die Hand- und Fußgelenke gefesselt und meinen Mund mit einem Knebel verschlossen. Er muss die Dosis der Drogen erhöhen, denn ich bin aufgewacht.
„Deine Gesichtszüge müssen für mein Vorhaben völlig entspannt sein“, sagt er. „Nur wenn du schläfst, kann ich mich an dir sattsehen und dich streicheln.“
Er legt eine Wolldecke über meinen nackten Körper. Unter der Decke streichelt er mich sanft und zärtlich. Er hat schöne, zarte Hände.
Die Nacht im dunklen Keller, gefesselt an einen Stuhl, hat meinen Widerstand gebrochen. Er sagt, dass er mir einen Vorgeschmack auf den Tod geben will, indem er einen Spiegel mit einer Kerzenflamme anrußt und ihn mir vorhält. Nur so kann ich beim Sterben mein Gesicht sehen. Er ist vollkommen wahnsinnig.
Donnerstag
Ganz allmählich tauche ich aus einem tiefen, traumschweren Schlaf auf. Mein Kopf fühlt sich an wie mit Watte gefüllt. Hinter meinen Lidern wirbeln seltsame Traumbilder. Ich spüre eine Plastikplane unter meinem Körper. Der Raum erscheint mir diesmal nicht so dunkel und kalt. Ein merkwürdig verbrannter Geruch liegt in der Luft.
„Deine Schwester zu töten, war ein besonderes Ereignis. Ich habe es genossen“, zischt er. „Dein Tod wird vollkommener und ohne jegliche Störung sein. Du wirst mich danach ein ganzes Leben begleiten.“
Ich hebe die Lider und sehe in seinen Augen den Wahnsinn aufflackern. Sein Kopf ist gesenkt und die Arme sind hinter dem Rücken verschränkt, als wolle er etwas vor mir verstecken.
„Sieh mal, Anna. Das werde ich in wenigen Stunden mit dir machen“, flüstert er.
Mit der einen Hand hält er mir den Spiegel vors Gesicht, mit der anderen zeigte er mir einen geöffneten, blutverschmierten Schädel, aus dem eine Hirnhälfte herausquillt.
Er stellt den blutigen Schädel so hin, dass ich ihn immer beim Aufwachen unmittelbar vor Augen habe. Ich verliere das Bewusstsein.
Freitag
Er hat es sich anders überlegt, sagt er. Ich habe mich in ein gewaltiges Schweigen zurückgezogen. Das diffuse Licht des Mondes, das durch das kleine Fenster fällt, taucht den Kellerraum in dunkelgraue Schatten. Jakobs schwach beleuchtetes Gesicht ist ein verschwommenes Profil, in dem die Augen spukhaft in den Höhlen liegen.
Ich liege jetzt auf dem Boden und kann nur schemenhaft erkennen, wie er eine Lampe einschaltet. Eine lange Kette baumelt an einem Haken.
Er sagt, dass ich eine weitere Lektion zu erlernen, einen weiteren Schritt auf unserer gemeinsamen Reise zu gehen hätte. Er verstellt die Kette und kürzt sie, dann befestigt er einen Panikverschluss daran und hängt eine Ledervorrichtung an den Haken. Oben befindet sich eine Metallstange, an der zwei breite schwarze Lederstreifen an mehreren Klammern hängen.
Mein von Drogen umnebeltes Gehirn gaukelt mir mittlerweile leuchtende Farben vor: Sonnengelb, Azurblau, Smaragdgrün, doch vor allem Tizianrot.
„Die anderen waren hierfür nicht zu haben“, höre ich ihn sagen, „im Gegensatz zu dir.“
Er wirft mir einen flackernden Blick zu. Im Raum wird es plötzlich still. Jakob knöpft sich langsam das Hemd auf, zieht es aus und wirft es auf den Boden. Seine Härte presst sich gegen den Stoff seiner Jeans. Dann kommt er zu mir.
„Ich kann mit dir machen, was ich will“, haucht er mir ins Ohr. „Ich habe es schon lange gewusst: Im Grunde hast du nur auf mich gewartet.“
Er kniet nieder, schiebt meinen Slip herunter und streift ihn ab. Ich trage jetzt nur noch das Goldkettchen um meinen Knöchel. Ein Geschenk vom Stamm der Jivaros, hat er gesagt.
Er küsst die Innenseite meiner Oberschenkel. Dann spüre ich einen scharfen Schmerz, als er zubeißt. Ich zucke zusammen, doch er hält mich an der Taille fest und beißt noch fester. Es durchschauert mich, vor Erregung und Schmerz. Er erhebt sich, greift in die Jeanstasche, zieht eine Spritze mit einer langen Nadel heraus und injiziert mir eine goldgelbe Flüssigkeit.
„Reiß dich zusammen“, sagt er und schlägt mir ins Gesicht.
Bevor ich das Bewusstsein verliere, schmecke ich Blut.
Max legte das Tagebuch für einen Moment zur Seite. Sein Herz raste. Er dachte an Anna und an all das, was ihn für immer mit ihr verband. Ihre gemeinsam verbrachten Jahre mit den unzähligen Erinnerungen. Das Liebesgeflüster am späten Abend, die kleinen Witze, die nur sie verstanden, ihre Amnesie, ihre schrecklichen Erlebnisse – das alles hatte sich zu einer gemeinsamen Geschichte verwoben.
Schon damals, nach einem Gespräch mit seinem besten Freund Benedikt van Cleef, dem Leiter der Kripo München, war die Ungewissheit von ihm abgefallen. Er hatte sicheren Schrittes die richtige Entscheidung getroffen und Anna geheiratet.
Wenn Benedikt van Cleef nicht gewesen wäre … Er wollte nicht daran denken. Anna hatte ihr Leben nur der Hartnäckigkeit dieses Mannes zu verdanken.
Er las weiter …
Später machte er einen Spaziergang durch die dunkle Nacht. Der Neumond ließ das Wasser des Starnberger Sees verführerisch glitzern. Aber es war kalt und Kälte hatte immer etwas Bedrohliches. Dennoch verweilte er ein wenig am Ufer des Sees.
Ich muss aufhören, Annas Tagebuch zu lesen, dachte er. Jede Zeile war ein Stich mitten in sein Herz. Und dennoch konnte er nicht anders.
Er blickte sich um. Kein Jakob weit und breit. Er war allein. „Er kommt nicht“, würde Anna jetzt sagen. Er dachte schon wie seine Frau. Schluss jetzt!
Der Teppich aus Unkraut und vermoderten Blättern knisterte leise unter den Schuhsohlen, als er zurücklief zur Villa. Plötzlich stockte er. Irgendetwas war anders als sonst. Aber was? Er blieb stehen, starrte in die Dunkelheit. Nichts. Die Straße war menschenleer. Kein kalter und farbloser Schatten wanderte umher. Alles war ruhig, bis auf den Wind, der durch die Bäume rauschte. Warum hatte er dann das Gefühl, beobachtet zu werden? Dieses verdammte Tagebuch!
Er schlug die entgegengesetzte Richtung ein. Immer weiter weg von der Villa. Jeder Schritt half ihm dabei, seine Gedanken zu ordnen, die Schwere abzuschütteln. Ab und an tauchten Nachtschwärmer aus dem Dunkel der Straße vor ihm auf, taumelten an ihm vorbei, ein paar einsame Wölfe, einige eng umschlungene Pärchen. Eine Kneipe tauchte vor ihm auf, ein Licht in der Dunkelheit. Sie gefiel ihm, weil sie leer war. Er trat ein.
Hinter dem Tresen stand ein kräftiger Mann mit blasser Gesichtshaut und Glatze. Er nickte ihm zu. „Was darf’s sein?“, fragte er.
„Ein Bier.“
Das Bier kam prompt und Max nahm einen Schluck.
„Harte Nacht?“
„Es gab schon schlimmere“, antwortete er. „Aber: ja, harte Nacht.“
„Hat sie dich verlassen, Kumpel?“
Max hob die Schultern, trank. Er hatte keine Lust, sich zu unterhalten, nahm die Flasche und setzte sich damit ans Fenster. Durch die schmutzigen Scheiben eröffnete sich ihm der Blick auf die nächtliche Straße.
Er dachte an Anna und sofort war da dieses Achterbahngefühl in seinem Magen. Seine Augen füllen sich mit Tränen und er dachte: Ja, verdammt. Ich liebe sie. Immer noch und trotz allem.
Er zahlte sein Bier und ging zurück zur Villa. Unterwegs blieb er einen Moment lang stehen, um zu den Sternen hinauf zu starren, an gar nichts zu denken, ein wenig die Augen auszuruhen, hier, auf der Straße, unweit seiner Haustür. Einfach zu warten, im Dunkeln, an der Schwelle zum Morgengrauen. Dann ging er weiter, so langsam, dass der kalte Wind all seine Emotionen davontrug und sein Schmerz schließlich außer Sichtweite war. Jetzt war er nur noch zu müde, zu vernarbt und wieder zu verwundet.
Plötzlich hörte er Schritte hinter sich. Er drehte sich um, hielt den Atem an, lauschte. Weit und breit war niemand zu sehen. Nur die Villa vor ihm. Geh hinein! Worauf wartest du denn noch?
Da! Ganz deutlich war es zu hören. Klack … klack … klack. In der Ferne hallten Schritte wider. Jetzt war er sich sicher, dass er längst nicht mehr allein war und dass jemand ihn tatsächlich im Visier hatte.
Er hatte lange darüber nachgedacht, ob er jemanden ins Vertrauen ziehen sollte. Es wäre das Vernünftigste. Jeder normale Mensch würde einfach die Polizei rufen und von seinem Verdacht berichten. Er könnte Benedikt van Cleef einweihen und um Hilfe bitten. Benedikt würde ihm Glauben schenken, aber Anna? Im besten Fall würde er sie beide zunächst einmal befragen. Vielleicht erfuhr er dann die ganze Wahrheit. Vielleicht erfuhr er dann, was damals geschehen war.
Er musste mit Benedikt sprechen. Für Anna. Für Katharina. Es ging nicht anders. Er musste ihm Fragen stellen und ihm dabei in die Augen sehen. Keine höflichen Fragen, die ein besorgter Ehemann in einem längst kalten Fall einem Polizisten stellte, der über jeden Zweifel erhaben war.
Es mussten die richtigen Fragen sein. Das konnte nur er, da er jetzt Annas Tagebuch kannte. Und er konnte es nur allein. Überhaupt – wenn er jemandem von seinem und Annas Verdacht erzählen würde, dann nur aus Angst vor einer neuen Bedrohung. Anna und er waren auf sich selbst gestellt. Er musste das ändern und Benedikt sein Geheimnis anvertrauen. Das war er Anna schuldig. Und seiner kleinen Familie.
In der Villa kletterte er aus den Trümmern seiner Seele hervor, setzte sich Stück für Stück wieder zusammen.
Und weinte.
Kapitel 5
Salvador da Bahía – Oktober 2016
Seit Baan wieder im brasilianischen Salvador da Bahía war und angefangen hatte, über Anna Gavaldo zu recherchieren, ertappte er sich immer wieder bei dem Wunsch, das ganze Tun dieser Frau aus seinem Gedächtnis zu löschen. So wie man das mit einem Text am Rechner machte, der einem nicht gefiel. Einfach die Delete-Taste drücken.
Leerer Bildschirm.
Angenehm leer.
Überraschend wohltuend leer.
Baan führte seine Fantasien jedoch immer noch weiter fort, wollte Anna und ihre Sippschaft aus seinem Leben löschen. So stellte er sich vor, wie er ihrem Körper einen kleinen Delete-Schubs gab. Und weg war sie.
Weg war Anna Gavaldo.
Auf ewig aus seinem Gedächtnis und seiner Erinnerung verschwunden.
Zur Hölle gefahren, wo sie hingehörte.
Doch wenn er sich diesen Gedanken hingab, fühlte er sich merkwürdig schuldig. Sie schaffte es aus der Ferne, ungesunde Schuldgefühle in ihm aufsteigen zu lassen.
Wie machte sie das bloß?
Er musste etwas dagegen unternehmen. Immerhin konnte er nach den Tumulten der vergangenen Tage heute das Haus verlassen. Die Menschen trauten sich wieder auf die Straßen, denn die Polizisten hatten ihren Streik beendet. Der Alltag war zurück in Salvador da Bahía – das bedeutete nur drei Mordopfer pro Tag statt dreizehn. Nur einige hundert Raubüberfälle, Schießereien, Einbrüche statt der Tausenden der vergangenen Tage. Auch die Busse fuhren wieder. Das Militär kam nur, wenn die Stadt im Ausnahmezustand war. Dennoch waren die 2500 Soldaten und 500 Elitepolizisten erst einmal geblieben und patrouillierten in der Stadt der „ewigen Schönheit“.
Baan schloss gewissenhaft die Eingangs- und die Seitentür ab und steckte den Schlüssel in seine Hosentasche, bevor er den Weg hinunterging. Das Wetter war unbeständig. Kleine Wolken drängten rastlos über den Himmel. Die Sonne blitzte auf und verschwand wieder, immer wieder gab es vereinzelte Regenschauer. Vor der Hafeneinfahrt am Ende der malerischen Bucht ging Baan an einer Reihe von Festungen vorbei, die früher zum Schutz der Stadt gedient hatten.
Er war unterwegs zur Nosso Senhor do Bonfim, einer volkstümlichen Kirche im Süden der Stadt und einer der Wahrzeichen von Salvador da Bahía. Seit Baan in Salvador Medizin studierte, hatte die barocke Kirche von 1746 ihn immer wieder magisch angezogen. Vermutlich weil hier neben dem christlichen Gott auch Oxala, der höchste Candomblé-Gott, verehrt wurde. Viele Nachfahren der schwarzen Sklaven zelebrierten Candomblé, die Religion ihrer afrikanischen Vorväter. Und auch Baan ließ sich oft inspirieren vom afrikanischen Rhythmus in Salvadors bunten Straßen.
An der großen Treppe vor der Kirche boten ihm Salvadors Straßenkinder Fitinhas an. Als er ein Mädchen auf den Stufen erblickte, überraschte es ihn keineswegs, dass er in diesem Augenblick sein Tun und Handeln sofort auf sie ausrichtete. Er hatte sie schon öfter dort gesehen. Baan fand es faszinierend zu beobachten, wie sich die verbitterten Gesichtszüge des kleinen Mädchens schrittweise entspannten, als es auch ihn von weitem erspähte und eine Hand mit bunten Fitinhas ausstreckte.
Dieses Mal war es das kleine Mädchen, das das blaue Fitinhas-Bändchen um sein Handgelenk knotete. Spucke rann ihm dabei als Rinnsal übers Kinn. Wieder fing er den trostlosen Blick des Straßenkindes auf. Alles an ihm wirkte vertrocknet: die verkrusteten, aufgeplatzten Lippen, die braune, schuppige Haut an Gesicht und Armen, die verschmutzte Kleidung, die Storchenbeine unter den Shorts. Der Kampf ums Überleben war dem Mädchen anzusehen: In grimmiger Entschlossenheit, die in seinen braunen Augen loderte. Die Augen einer angehenden Kriminellen, dachte Baan. Dennoch war das Mädchen unter dem Schmutz von Salvadors Favelas wunderschön.
„Für jeden Knoten darfst du dir etwas wünschen, Senhor“, sagte es. „Aber das Band darf nicht mehr entfernt werden. Wenn es von alleine abfällt, sind deine drei Wünsche erfüllt.“
Danach setzte sich das Mädchen wieder auf eine Treppenstufe und schenkte ihm ein kurzes, geheimnisvolles Lächeln. Schnell lief er die verbleibenden Stufen hinauf und betrat einen bizarren Raum, in dem die Zeugnisse der augenscheinlichen Wirkung der Fitinhas zu finden waren: der Sala dos Milagros. Im „Wunderzimmer“ hingen unzählige Votivtafeln, Wunschzettel und kleine Nachbildungen von Körperteilen, um sich für deren Heilung zu bedanken. Dazwischen befanden sich aber auch die „verbotenen Wünsche.“ Dort brachte Baan seine drei Wünsche für den Candomblé-Gott Oxala, an.
Oxala soll dir ins Gesicht spucken.
Oxala soll sich über dir ausleeren.
Ich will, dass du daran erstickst!
Kapitel 6
Starnberg, November 2016
Hey,
irgendetwas geschieht mit mir. Ich genieße es neuerdings, in den Tierpark zu gehen und die Tiere dabei zu beobachten, wie sie das rohe Fleisch von den Knochen reißen, die der Tierpfleger ihnen zum Fraß hinwirft. Mir gefällt die Vorstellung. Das ist cool.
Im Tierpark Hellabrunn, umgeben von einer riesigen, undurchdringlichen, schweigenden Vegetation, kann ich meiner Fantasie freien Lauf lassen. Also finde ich mich dort in Gedanken in einer Welt wieder, die sich vollkommen ihren Gesetzen anpasst, und mich immer tiefer in die Geheimnisse meines eigenen Wesens verstrickt.
Ich finde Geschmack am Tod. Dass ich dabei exotische Tiere vor Augen habe, muss eine besondere Bedeutung haben. Da bin ich mir absolut sicher. Vielleicht liegt es daran, dass ich Dinge voraussehe, denn ich habe das, was die Menschen das zweite Gesicht nennen. In meinen Visionen finde ich mich in tropischen Gebieten wieder und bin von einer einzigartigen Tierwelt umgeben. Papageien und Affen schreien um die Wette, Tukane lassen sich auf den Grüntönen nieder und scharlachrote Ibisse und Löffler starren mich an, als wären sie meine Wächter.
Der Gedanke, irgendwann selbst ein Tier zu töten, hat mich schon seit meiner Kindheit fasziniert. Genaugenommen, seit ich den alten Teddy von Mom zerfetzt habe. Niemand weiß davon, nicht einmal meine Mutter. Es geschah, nachdem Jörg Kreiler, ein Freund meiner Mutter, mir Jasper geschenkt hatte. Aber mit ihm kamen die Dämonen.
Jasper ist ein getupfter Teddybär mit recht seltsamen Angewohnheiten, getupft wie die anderen Biester von Jörg auch, die Mom nach seinem Tod alle weggeworfen hat.
„Getupft müssen die Stofftiere sein, Kleines“, hatte Jörg immer gesagt.
Getupft! Ein seltsames Wort, das eine gewisse Kraft zu haben scheint, sofern das überhaupt möglich ist, und wenn ja, dann steht diese Kraft nicht nur für das Gute. Gefleckt ist gut, gesprenkelt schon ein wenig hässlicher, aber getupft ist irgendwie anders, obwohl ich nicht sagen kann, warum.
„Getupft, getupft“, flüsterte sie, während sie weiterschrieb.
Komisch … auch Jörg wurde getötet, wie die Schwester meiner Mutter, die ebenfalls Katharina hieß. Ein bisschen viel Tod, finde ich.
Zurück zu Jörg. Ich mochte ihn. Und er stand auf Mom. Er hat sie förmlich angeschmachtet. Na, wer tut das nicht. Sie sieht ja auch klasse aus mit ihrem langen, blonden Engelshaar und den blauen Augen.
Von Jasper wollte ich mich nie trennen, ebenso wenig wie von meinen Kinderbüchern. Der Teddybär ist mein Freund und hat einen festen Platz in meinem Zimmer. Er lehnt an der Schreibtischlampe, mustert mich mit seinen dunklen Augen. Er lotst mich in der Dunkelheit durch meine Träume.
Nun … ich finde es jedenfalls faszinierend und abscheulich zugleich, einem Tier beim Sterben zuzusehen. Ich weiß, ein Mädchen in meinem Alter – ich bin sechzehn Jahre – sollte an anderen Dingen Gefallen finden. Aber es ist, wie es ist.
Ich stecke voller Marotten, behauptet mein Vater Max und schiebt es auf die Pubertät. Was sind schon Marotten? Zum Beispiel verabscheue ich Schmutz und hasse Unsauberkeit. Mir wird übel beim Anblick von fettigen Fingerabdrücken an Türen, einer Explosion aus silbrigen Staubpartikeln auf dem Fernseher oder Essensresten in einem Kochtopf. Ich hasse den Unrat, den Hausmüll, faulendes Obst oder den Schimmel im Keller. Ich liebe die Farbe Weiß. Mein Zimmer ist in meiner Lieblingsfarbe gestrichen und auf meinem Bett liegt eine faltenfreie, blütenweiße Decke. Weiß ist steril und steht für Sauberkeit. Deshalb ist sie die Farbe des Todes. Und der Tod ist nun mal rein.
Eine Leiche beispielsweise ist immer weiß und nach dem Waschen frei von Schmutz. Ich ekle mich nicht vor Leichen. Ein toter Körper ist nur eine Hülle. Wenn der Geist den Körper verlässt, reduziert sich der Mensch auf diese Hülle. Ein toter Körper ist weniger als nichts. Er hat keinen Wert mehr und gleichzeitig ist für den Körper nichts mehr von Bedeutung. Deshalb mag ich meinen Aushilfsjob im Beerdigungsinstitut von Herrn Käfer.
Lukas Käfer mag ich auch. Er ist mindestens fünfzig Jahre, vielleicht älter und trägt immer einen dunklen Anzug. Die tiefschwarze Krawatte hängt auf eine Weise schief, die vermuten lässt, dass er sich immer in Windeseile umzieht. Seine rosige Haut strahlt vor Gesundheit. Sein volles Haar hat unter der grauen Beleuchtung etwas dämonisch Imposantes. Nach einem Todesfall gibt es für Herrn Käfer immer viel zu tun und deshalb überlässt er mir das Waschen und Aufhübschen der Leichen.
Mein Vater findet meine Arbeit ein wenig makaber, aber Mom sagt, sie sei in Ordnung. Außerdem bin ich gut im Aufhübschen der Toten. Ich arbeite immer sehr sorgfältig, wenn ich eine Leiche wasche und sie anschließend schminke. Ich nehme mir die Zeit. Ich rede, ich schaue zu, ich rieche.
Übrigens … mein Name ist Katharina. Ich bin die Tochter von Anna und Max Gavaldo und irgendetwas geschieht mit mir. Deshalb habe ich mich entschieden, ein Tagebuch zu führen. Das ist mein zweiter Eintrag.
Katharina legte den Stift für einen Moment beiseite. Trotz der kalten Jahreszeit drang Vogelgekreische durch das gekippte Küchenfenster. Vielleicht eine Krähe, die sich verirrt hatte? Ihr Blick glitt nach draußen. Eine blasse, durch die Sonne zum Leben erweckte Winterlandschaft erinnerte sie an eine Geschichte, die ihre Mutter ihr in der Kindheit vorgelesen hatte. Eine Geschichte über einen Kristall, der in Tausende kleine Splitter zersprang, und die Landschaft darunter wie einen Brillanten funkeln ließ, oder wie die zerbrochenen Kristallgläser auf dem Parkettboden im Wohnzimmer. Ihre Mutter hatte sich mittlerweile wieder beruhigt, aber ihr Vater nicht so richtig. Er nannte sie seit dem Vorfall Lilith, und nicht mehr „meine Kate“.
Hm … Lilith gefiel ihr besser. Lilith bedeutete „Zweig des Dämonenbaums, eine Albträume verursachende nachtaktive Dämonin, ein sich herumtreibender Waldgeist“. Ja, das traf es wohl ziemlich genau und reflektierte ihre Veränderung.
Katharina warf einen Blick auf die Küchenuhr. Es war schon drei Uhr nachmittags und ihre Mutter war immer noch nicht zuhause. Sie nahm ihren Stift wieder in die Hand.
Mom … sie ist siebenunddreißig Jahre und eine kluge, intelligente Frau. Das habe ich immer geglaubt. Aber in all den Jahren habe ich noch nie gesehen, dass sie sich so seltsam benommen hat wie heute Morgen. Früher war sie ja oft komisch, aber da hat sie noch ihre rosa Pillen geschluckt und ist ständig zum Psychiater gerannt.
Heute Morgen jedenfalls stand Mom auf der Terrasse unserer Villa und sie stand so komisch da, als hätte sie im Garten ein Gespenst gesehen. Unmittelbar anschließend an unsere Terrasse wachsen Silberbirken wie eine Reihe geisterhaft-weißer Gestalten. Und dahinter stehen endlos dichtstehende Bäume mit dürren Ästen. Da war nichts Besonderes, aber ihr Mund stand offen, ihr Gesicht war kreidebleich, ihre Augen weit aufgerissen. Auf der anderen Seite des Gartens hatte die Wintersonne die Baumkronen in blassgraues Licht getaucht, als wären sie Teil eines winterlichen Monet-Gemäldes. So eine Kopie hängt im Büro meines Vaters.
Mom rannte in den Garten und steuerte schnurstracks auf die Baumgruppe zu. Doch plötzlich torkelte sie wie eine Marionette, deren Fäden durchtrennt wurden. Schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp.
Dann hob sie ihre Hände in die Luft. „Verschwinde! Wie kannst du es wagen?“, hörte ich sie schreien. „Max! Er ist wieder da. Max! Er ist wieder da.“
Ich verstehe nicht, was meine Mutter da gemacht und mit wem sie gesprochen hat. Und Max hätte ihr gar nicht helfen können. Mein Vater hatte das Haus bereits verlassen und war auf dem Weg in die Firma.
Auf unserem Grundstück war niemand zu sehen, aber Mom ist seit Stunden verschwunden. Das geschieht neuerdings oft. Bis heute habe ich mir deswegen keine großen Sorgen gemacht, denn Mom geht oft stundenlang spazieren. Mittlerweile mache ich mir aber Gedanken, denn es häufen sich die merkwürdigen Vorkommnisse.
Es fing damit an, als Mom neulich sagte, dass irgendetwas im Haus sich verändert hätte. Seitdem stellt sie meine Schuhe nicht mehr in den schwarzlackierten Dielenschrank, sondern lässt sie im Flur stehen. Sie will die Schranktür nicht mehr öffnen. Sie glaubt, quietschende Geräusche zu hören, als ob sich im Schrank etwas rege …
Katharina blickte auf und erinnerte sich.
„Mom, was ist los mit dir?“ Katharina stand gegen die Küchenzeile gelehnt.
Ihre Mutter blätterte in einem Kochbuch. „Jemand hat meine Witterung aufgenommen, Katharina“, antwortete sie leise. Sie sah sie dabei mit ihren blauen Augen an, die dunkel schimmerten, fast schwarz. Augen, die Katharina förmlich hypnotisierten. „Vielleicht ist es Jakob, der im Schrank die gelben Zähne zu einem bösen Grinsen fletscht.“
Im ersten Moment wusste Katharina nicht, was sie antworten sollte. „Tiere nehmen eine Witterung auf, Mom. Was ist Jakob? Ein Wolf?“
„Niemand. Entschuldigung, ich rede Blödsinn. Es sind diese Albträume.“
Katharina wurde hellhörig. „Was für Albträume, Mom?“
„Das möchtest du nicht wissen, mein Schatz“, antwortete sie und legte das Kochbuch zur Seite.
Mit überbordender Heftigkeit überflutete Katharina ein einziger Gedanke: Du verheimlichst mir etwas, Mom! „Mom, ich bin sechzehn Jahre! Komm, erzähl mir davon!“
Katharina sah, dass ihre Mutter kurz zögerte und tief durchatmete.
„Ich träume, dass sich in der Nacht alle Türen weit öffnen und jemand kleine getupfte Teddybären nach mir wirft, die mich würgen“, begann ihre Mutter. „Dann höre ich neben dem Quietschen knochige alte Hände, die sich über das Treppengeländer hinauf in mein Schlafzimmer schieben. Es war schon schlimm genug, es zu hören, aber es vor meinem inneren Auge zu sehen …“
Katharina spürte den Hauch einer Lüge. In solchen Momenten hatte ihr Leben mit ihrer Mutter etwas Nervtötendes. Sie hasste Unwahrheiten. Sie waren wie Staub, der in der Nase kitzelte.
Mom berührte ihre Schulter. „Eines Tages werde ich dir meine Geschichte erzählen, Katharina. Nur nicht heute. Es ist nur ein Traum.“
Erstaunt merkte Katharina, dass sie lächelte.
Ich habe nicht weiter nachgehakt, sondern in der Nacht das rote Klatschmohnkleid aus ihrem Schrank genommen, es zerrissen und in die Mülltonne geworfen. Es hat mir einfach Spaß gemacht, etwas zu zerstören, woran ihr Herz hängt. Ich habe geschwiegen und meine Eindrücke nicht erwähnt: das Knarren im ersten Stock, die offengelassene Tür, das fehlende Foto von der Pinnwand, die Griffspuren an der Außenseite der Terrassentür oder die nächtlichen Schritte übers Pflaster.
Neulich habe ich mich nach der Schule in meinem Zimmer ausgeruht. Ich bin von einem Geräusch im Schlafzimmer nebenan aufgewacht. Ein seltsames, undefinierbares Geräusch. Ein … Poltern?
Ich habe mein Ohr fest an die Wand gepresst und gelauscht, ganz intensiv, und geglaubt, ein Kichern zu hören, das so schnell verhallte, wie es erklungen war. Sofort war ich auf den Füßen. Vorsichtig öffnete ich die Tür. Blieb stehen. Lauschte. Alle meine Sinne waren geschärft.
Ich habe im Gästezimmer nachgesehen. Nichts. Nur mein eigener Atem und die vertrauten Geräusche des Hauses um mich herum. Der Raum hinter der Tür war leer und still. Totenstill. Wieder in meinem Zimmer konnte ich mich nicht mehr auf die Hausaufgaben konzentrieren, beunruhigt und verfolgt von …
Ja, wovon denn? Seltsam.
Katharina legte den Stift beiseite, steckte den Block in ihre Tasche und sagte sich, dass es der Wind gewesen sein musste. Der Wind. Oder die Katze, die etwas umgeworfen hatte. Nichts Schlimmes. In dem Moment blitzte ein Gedanke auf: Du machst dir etwas vor.
Aber es brachte nichts, über eine Sache zu grübeln, die sie sich nicht erklären konnte. Sie war spät dran. Lukas Käfer erwartete sie im Beerdigungsinstitut.
Kapitel 7
Starnberg, November 2016
Die Begräbnisstätte an der Hügelflanke des Nachbarorts lag unmittelbar hinter dem Beerdigungsunternehmen Käfer inmitten eines Kiefernwaldes und wirkte finster und bedrohlich, als kündigte sich nach dem Tod weiteres Unheil an. Vielleicht lag es daran, dass die Urnenanlagen, Grüfte und Mausoleen schlicht waren und die umgebenden Bäume tänzelnde Schatten auf die Gräber warfen. Unter den Tausenden Ruhestätten lag auch das Grab ihrer ermordeten Tante.
Es war kalt. Jeden Tag gab es neue Wettervorhersagen, die eisige Temperaturen ankündigten. Die Waldpfade waren mit einer dünnen Schicht Schnee überzogen, als Katharina ihr Fahrrad an dem Ständer hinter der Friedhofskapelle ankettete.
Unten fuhr ein Auto vorbei. Sie nahm nur die Schatten wahr, welche die Bäume durch das Scheinwerferlicht warfen. An der Hügelflanke spiegelten die polierten Grabsteine das Licht des Nachmittags wider. Die Vorbotin des Jenseits lockte sie mit dem Lichtspiel auf den quecksilbrigen Schattenrissen.
„Herrgott noch mal! Ich habe keine Zeit für die Verlockungen des Totenreichs“, murmelte sie.
Plötzlich hörte sie ein Geräusch, ein Rascheln, und sah sich um. Das Friedhofstor stand offen. Eine Frau lief auf ein einsames, ziemlich verwahrlostes Grab zu. Doch dann ging sie um die Grabstelle herum auf einen hohen Ahornbaum zu und befestigte ein blaues Seidentuch an einem Zweig, sodass der Wind damit spielen konnte.
Völlig abgedreht, dachte Katharina. Die Menschen wurden immer sonderbarer.
Einige Gräber weiter entdeckte sie ihren Boss, den Beerdigungsunternehmer Lukas Käfer. Neben ihm nahm eine ältere Frau Beileidsbezeugungen aufrecht und beinahe trotzig entgegen und zeigte eine Fassade, die Katharina an ihre Großmutter erinnerte. Der Wind spielte mit ihrem Mantel. Darunter war ihr schwarzes Kleid zu sehen: altmodisch, ein Tribut an die 80er Jahre in schwarzer Spitze, vermutlich mit Ärmeln wie eine zweite Haut. Das schwere, graumelierte Haar hatte sie im Nacken zu einem Dutt gebändigt. Die Frau blickte auf ihre gefalteten Hände.
Katharina schloss für einen Moment ihre Augen. Plötzlich glaubte sie Antonín Dvoráks Symphonie aus der Neuen Welt zu hören, die im Hintergrund leise aus einer Anlage ertönte, während ihre ermordete Tante im Grab betrauert wurde. Es war eine Vision aus der Vergangenheit, die sich sekundenschnell vor ihrem inneren Auge abspielte. An dieser Stelle öffnete sie wieder die Augen. Sie konnte die Dinge nicht nur voraussehen, sondern manchmal fand sie sich auch in der Vergangenheit wieder.
Als die Frau mit dem Seidentuch sich umdrehte, erkannte Katharina ihre Mutter und stutzte. Sie trug einen Mantel, den Katharina noch nie an ihr gesehen hatte. Auch ihr Gang hatte etwas Befremdliches, als ihre Mutter wenig später mit versteinerter Miene vor dem verwahrlosten Grab stand.
Was macht sie da? Katharina wurde klar, dass diese Grabstelle etwas mit ihrer Mutter machte, denn sie begann zu weinen, und von Weitem schien es, als würden die Tränen ihre Mutter mit aller Gewalt schütteln und sie könnte einfach nicht mehr damit aufhören.
Katharina versteckte sich hinter dem Stamm einer dicken Eiche, wo ihre Mutter sie nicht sehen konnte, und sah ihr einfach zu. Der Anblick war so banal, so alltäglich, dass Katharina im ersten Moment nicht begriff, was das Ganze bedeutete.
Plötzlich presste ihre Mutter, von Kummer überwältigt, die Hände vors Gesicht. In dem Moment gingen ihr die Worte von Herrn Käfer durch den Kopf: „Wir verzweifeln, obwohl der Tod das Tor zu Freude und Herrlichkeit ist.“
In der Regel verachtete Katharina die Unbeherrschtheit, aber ihre Mutter musste die Person, die in diesem Grab lag, wohl sehr geliebt haben, dass ihre Trauer so groß war.
Dann verstehe ich allerdings nicht, warum sie dieses namenlose Grab verwahrlosen lässt, dachte sie.
Unweit von der Grabstelle befand sich auch das Grab ihrer verstorbenen Tante. Warum hatte sie mit einem Mal das Gefühl, dass zwischen den beiden Toten eine Verbindung bestehen musste? Sie wusste es nicht.
Für einen Moment stand ihre Welt still. Sie blickte zu Boden und dachte, dass sie mehr über die Ermordung ihrer Tante erfahren wollte. In Gedanken sprach sie deren Namen aus: Katharina … Vernichtet, niedergetreten, vergewaltigt, ermordet, genau wie die junge Frau, die jetzt im Kühlraum des Beerdigungsunternehmens auf ihre zarten Hände wartete.
„Die ganze Welt ist kalt, Katharina, eiskalt“, flüsterte eine Stimme ihr ins Ohr.
Katharina schüttelte sich. Sie entschied sich ihre Mutter nicht zu stören und blickte ein letztes Mal hinüber zu der Grabstelle. Doch sie war nirgends mehr zu sehen.
Kapitel 8
Starnberg, November 2016
Ihre Welt versank in Dunkelheit, als Katharina die Tür aufschloss und das Beerdigungsinstitut von Lukas Käfer betrat. Sie hörte ihren leisen, kontrollierten Atem, als wollte sie auf diese Weise ihre finsteren Gedanken abschütteln: Meine Mutter hat ein Geheimnis!
Katharina versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. Mom hat sich wie eine Verrückte aufgeführt.
Vielleicht gab es da tief unter der Erde etwas, das ihre Mutter in den Wahnsinn trieb? Aber sie selbst machte ja auch irre Dinge und sie war sicher nicht verrückt.
Sie sah sich um. Ein schlichtes Bild mit einem Muschelmotiv hing an der weißen Wand, ein einfacher Schreibtisch aus Nussbaum stand rechts in einer Ecke, ein grauer Teppichboden dämpfte die Schritte der Besucher.
Die Schreibtischlampe unterstrich mit ihrem kalten Licht die neutrale Atmosphäre des elegant eingerichteten Büros. Sie konnte ein Frösteln nicht unterdrücken, als sie einige Urnen auf dem Schreibtisch bemerkte. Sie hasste die Asche der Toten. Eine Leiche in der kalten Erde ihrer Verwesung zu überlassen, fühlte sich für sie richtig an, eine Einäscherung nicht. Nach einer gewissen Zeit blieben nur die von Würmern gereinigten, weißen Skelettknochen übrig. So sollte es sein.
Sie ging durch einen langen, fensterlosen, nur vom trüben Licht einiger Glühbirnen erhellten Gang, der zum Kühlraum führte. Ihre Schritte hallten von den kahlen Wänden wider. Vor einer unscheinbaren, aber massiven Stahltür blieb sie stehen. Ihr Herz pochte vor Aufregung, als sie den Raum der Toten betrat.
Der Kühlraum war gewiss kein Ort für ängstliche Menschen. Für die meisten repräsentierte er das Gruselkabinett schlechthin, doch für Katharina war er nur ihr Arbeitsplatz, an dem sie mittels Thanatopraxie den Körper eines Verstorbenen derart vorbereitete, dass seine Angehörigen unbesorgt von ihm Abschied nehmen konnten.
Im Raum der Toten war es sauber und es roch immer nach Desinfektionsmitteln. Heute jedoch hing ein Hauch von Formaldehyd in der Luft. Es musste an der soeben eingetroffenen Leiche liegen, die gestern Nachmittag von der Rechtsmedizin zur Beerdigung freigegeben worden war. Lukas Käfer hatte sie bereits aus dem Kühlfach geholt und für sie auf den Stahltisch gelegt. Auf dem Beistelltisch lagen Waschlappen, Plastikschüssel, Theaterschminke und diverse Pinsel bereit. An ihrem Fuß hing ein rosafarbener Zettel: Lea Berger.
Katharina brachte sich vor dem Tisch in Position und zog mit einem Ruck das Laken von Leas Körper. Sie zuckte kurz zusammen beim Anblick des wunderschönen, jungen Mädchens, dessen Oberkörper eine hässliche Obduktionsnaht vom Schlüssel- bis zum Schambein, verunstaltete. Sie zog ihre Nasenflügel hoch, schnupperte. Der Körper verströmte nicht den geringsten Geruch, als wäre ihr junges Fleisch für solche Ausdünstungen noch zu rein. Ihre Haut war so glatt, als wäre sie soeben der Badewanne entstiegen. An ihren Armen, Knien und Fußgelenken jedoch waren tiefe Schrunden zu erkennen, die auf eine Fesselung hinwiesen. Ihr blutleerer Körper war kalt und der Hauch von Formaldehyd, den Katharina gleich wahrgenommen hatte, haftete nur dem Laken an.
Sie muss in meinem Alter sein.
Katharina fiel auf, dass Lea ihr sehr ähnlich sah: das lange, blonde Haar, der zierliche Körperbau, die feinen Gesichtszüge. Sie hob mit ihrem Finger eines der Augenlider. Lea hatte dunkelblaue, fast schwarze Augen – genau wie sie.
Für einen Moment schloss Katharina ihre Augen und holte kaum wahrnehmbar Luft. Dann streckte sie eine Hand nach der Toten aus und wurde eins mit ihr, entrückt in der Oase des Todes. Die Gesetze von Zeit und Raum galten nicht mehr. Alles drehte sich mit ihr. In blitzartigen Sequenzen lief der Akt ihres Todes vor ihrem inneren Auge ab.
Lea liegt auf einer Pritsche in einem Keller. Ihr Mörder hat vorher häufiger vom Angesicht des Todes geträumt. Es ist das schmerzverzerrte Gesicht der jungen Frau, die er demnächst töten wird. Er hört, wie ihr Atem sich verheddert, hört ihre qualvollen Schreie, die sein Herz höherschlagen und ihn in der Nacht aufwachen lassen. Er ist dann verschwitzt, sein Kissen ist nass, die Bettdecke zeigt ihm seine Träume, irgendetwas mit Tod, Nässe.
Jetzt liegt Lea gefesselt, geknebelt und entkleidet da. Auch der Mann ist nackt. Mit seinem Zeigefinger streicht er behutsam über ihre Haut, so zart wie mit einer Feder. Er zittert vor Erregung, spürt, wie die Wellen kommen und ihn wegspülen. Verkrampft hält er die Luft an, bis er glaubt, zu zerplatzen. Er speit den Atem aus; die animalische Intimität seines Röchelns beruhigt ihn.
Lea schließt die Augen. Sie will den Mann nicht ansehen. Ihre Augenlider zucken.
Seine Blicke brennen sich in Leas Fleisch. Er umschließt ihre Taille mit beiden Händen und hält sie fest.
Lea öffnet ihre Augen.
Der Mann beugte sich vor und leckt ihre Brüste. Er beißt zu. Schmerz und blankes Entsetzen sind in Leas aufgerissenen Augen zu sehen. Sein Blick wandert zurück zu den Abdrücken seiner Zähne auf ihrer blassen Haut. Noch ist kein Blut zu sehen, sein Biss war sanft. Erst lecken, dann beißen, jetzt ein wenig fester. Dann kommen die Tränen, nur wenige, ein stiller Protest. Er labt sich an ihrem Salz. Ein Teil von ihm will nicht aufhören, Leas Schönheit zu bewundern, doch ein anderer, entscheidenderer Teil von ihm liebt die Wahrheit. Und die ist hässlich. Eine Begierde, dunkel und mächtig, erfasst ihn wie eine Welle: Töte sie!
Er hört sie stöhnen, lang, nicht enden wollend. Lea harmoniert mit seinem misstönenden Geheul. Es ist dämonisch. Er beugt sich noch einmal hinab und bringt den Mund an ihr Ohr. Er flüstert ihr etwas zu und legt die Macht seines ganzen Ichs in seine Stimme, seinen eigenen Schmerz. Dann wird er zum Engel mit bleiernen Flügeln.
Er zuckt ein wenig, als er das erste Mal mit dem Messer auf Lea einsticht. Ihre Haut platzt auf, ein roter Fleck erblüht auf ihrer Haut, wie eine Rose. Der Fleck ist wunderbar. Ein zweiter, erbarmungsloser Stich in Leas Unterleib, ein dritter in den Bauch. Ihr Blut spritzt aus den Wunden, trifft rot auf sein Gesicht und seine Brust. Die Wärme gleitet an seiner Wange hinab, tropft auf den Boden. Klebt an seinen Fersen.
Er legt das Messer beiseite. Sprüht Leas Scham mit Rasierschaum ein, rasiert sie, schneidet sie, tupft das Blut mit weißem Toilettenpapier ab. Dann dringt er in sie ein, defloriert ihr Hymen. Badet in Rot. Er kann das Blut riechen. Streckt seine Zunge heraus, schmeckt die eisenhaltige Trübe. Alles vor seinen Augen verfärbt sich. Sie beide bluten aus Wunden, die nicht heilen wollen.
Er umarmt sie ein letztes Mal. Machtgier durchströmt ihn warm und schwer wie dunkler Wein. Immer wieder sagt er ihr, dass er der Stärkere von ihnen ist.
Lea ist still. Sie ist keine Heulsuse mehr. Ihre Augen sind geschlossen, kein Zucken hinter den Lidern …
Die Welt schoss wieder auf Katharina zu. Sie kam hart auf, taumelte. Auf der Stelle zog sie ihre Hand zurück. Ihre Streifzüge durch die teuflische Welt von Täter und Opfer bereiteten ihr nicht immer Vergnügen.
Katharina hatte Leas schmerzverzerrtes Gesicht deutlich vor Augen gehabt. Das Gesicht des Täters war jedoch von Nebel umhüllt gewesen. Sie war sich sicher, dass Lea nicht sein einziges Opfer war und dass sie den Täter eines Tages deutlicher vor Augen haben würde. So war es immer.
„Ein junges Leben auszulöschen, das noch nicht begonnen hat, ist eine Todsünde“, hatte ihre Mutter einmal gesagt. Katharina hatte nach diesen Worten in sich hineingehorcht und festgestellt, dass sie anders darüber dachte. War der Tod nach einem brutalen Akt von Gewalt nicht vielmehr eine Erlösung?, fragte sie sich. Wenn ein Opfer überlebte, trug es sein ganzes Leben lang die Last der Erinnerung an die körperlichen und seelischen Qualen. Sie konnte sich nichts Schlimmeres vorstellen.
Katharina nahm den Waschlappen, befeuchtete ihn und begann mit der Körperreinigung. Lea hatte einst einen schönen und makellosen Körper gehabt, bis auf den winzigen Leberfleck über dem Ellbogen, hinten auf dem linken Arm. Ihre Wunden, die der Täter Lea zugefügt hatte, waren von der Rechtsmedizin bereits sorgfältig gereinigt worden.
Nachdem sie die Leiche gewaschen hatte, blickte sie eine Weile auf Leas zierlichen Körper hinab, ihre kleinen festen Brüste mit den Bissspuren, das lange seidenweiche Haar. Katharina verspürte den Drang, noch einmal ein Messer in die Öffnungen gleiten zu lassen, weil sie wissen wollte, ob nach einer Obduktion noch Blut im Körper vorhanden war.
Ein ruchloser Drang, dachte sie. Eine zwanghafte Lust, der sie nicht entkommen konnte. Ihr wurde bewusst, dass ihre Lust sie früher oder später zu Handlungen zwingen würde, über die sie danach nicht nachdenken wollte. Wozu auch? Aus Angst vor Entdeckung? Sie verspürte weder hier noch woanders Angst.
Katharina zog Lea ein hellblaues Kleid an, das Leas Vater vorbeigebracht hatte, und schminkte sie. Als sie fertig war, sah Lea wunderschön aus. Sie strich ihr ein letztes Mal übers Gesicht, küsste ihre Stirn.
Plötzlich verspürte sie Unbehagen. Irgendetwas stimmte nicht. Aber was? Ihr Herz galoppierte. Sie nahm Leas Hand und schloss noch einmal die Augen. Ihr Körper wurde sehr leicht und sie war gefangen in einem grotesken Albtraum. Aber ihrem Gehirn wollte es einfach nicht gelingen, einen Sinn hinter dem Geschehen zu erkennen.
Sie ließ Leas Hand los und betrat wieder die Realität. Fast hätte sie die Kontrolle verloren. Sie hatte gesehen, wie Ärger Wut wich, und aus Zorn maliziöser Hass wurde. In dieser Deutlichkeit hatte sie das Böse noch nie vor Augen gehabt. Zitternd drehte sie sich um und ließ Lea allein zurück.
Kapitel 9
Starnberg, November 2016
In der Kapelle nahm sie am äußersten Ende einer Reihe von Klappstühlen Platz. Tief in ihrem Inneren spürte Katharina das Zittern, von dem sie gehofft hatte, es würde nachlassen, wenn sie sich einen Moment hinsetzte und sich sammelte.
Lukas Käfer betrat in Begleitung eines Ehepaars die Kapelle. Sie blickte auf, sah ihn an und nickte. So wusste er, dass Lea gewaschen und geschminkt war.
Die Eheleute blieben plötzlich stehen und sahen sich unruhig um. Katharina hörte, wie sie mit Herrn Käfer sprachen. Im bleichen, fluoreszierenden Licht der Kapelle wirkten sie unendlich traurig. Für einen Moment schloss sie die Augen und konzentrierte sich auf die flüsternden Geräusche. Sie konnte nicht hören, was Leas Eltern sagten, aber sie ahnte, worum es ging. Wenige Minuten später gingen sie schluchzend an ihr vorbei.
Lukas Käfer kam auf sie zu. „Das waren die Eltern des Mordopfers. Sie schaffen es noch nicht, sich ihre Tochter anzusehen.“
„Sie werden wiederkommen, Herr Käfer“, antwortete sie. „Sie sieht so friedlich aus und so wunderschön.“
Lukas Käfer dankte ihr mit einem stillen Blick. Doch dann siegte seine Neugierde. Er hob die Augenbrauen. „Konntest du sehen, was mit ihr geschehen ist, Katharina?“
Sie nickte.
Er sah sie voller Mitgefühl an. „Arme Katharina!“
Wieder nickte sie. Wenn er wüsste …
„Das zweite Gesicht zu haben, ist nicht immer berauschend, Herr Käfer.“ Sie stieß einen tiefen Seufzer aus. „Es war eine finstere Gestalt, aber ich habe sie nur verschwommen gesehen. Und er wird es wieder tun.“
„Er?“
„Ich glaube, es war ein Mann, aber wie gesagt …“
Lukas Käfer nahm seine schwarz geränderte Brille ab und säuberte sie mit einem weißen Papiertaschentuch aus seiner Hosentasche. „Vielleicht solltest du zur Polizei gehen, Katharina.“
Jetzt musste sie laut lachen. „Die halten mich doch für verrückt, Herr Käfer. Das wissen Sie doch.“
Käfer setzte seine Brille wieder auf, lachte und zeigte dabei seine vom Zigarettenrauch vergilbten Zähne. „Vermutlich. Es sind aber auch selten dämliche Idioten auf dem Revier.“ Er nahm seine Brieftasche aus seiner Jacke und reichte ihr einen Einhunderteuroschein.
Katharina protestierte, doch Käfer winkte ab. „Ich hatte noch nie so eine hervorragende Assistentin.“
„Vielen Dank, Herr Käfer.“ Sie schaffte es nicht, ihre Gedanken zum Stillstand zu bringen. Sie wollte nach Hause und nachsehen, ob alles in Ordnung war. „Ich muss los. Meine Eltern warten mit dem Essen auf mich.“
Käfer nickte. „Bis nächste Woche, mein Kind.“
Draußen erwartete sie der frühe Abend wie eine stille, finstere Bedrohung. Der Regen bedeckte ihr Gesicht mit eisigen Küssen. Windböen erhoben sich.
Ihre Jacke wärmte sie kaum, aber es war ihre innere Unruhe, die Katharina schaudern ließ. Sie spürte, dass etwas Schreckliches geschehen würde, aber sie hatte keine deutliche Vision und konnte es an nichts Konkretem festmachen; an keiner unmittelbaren Bedrohung, nicht einmal an einem bestimmten Verdacht.
Aber seit sie das Mädchen auf dem Stahltisch hatte liegen sehen, war das so. Beim Schminken ihres Gesichts war es gewesen als würde sie ihr undeutliche Worte ins Ohr flüstern: einen Namen, eine Warnung?
Vielleicht war die Ähnlichkeit mit ihr selbst die Ursache für Katharinas beklemmendes Gefühl. Sie erweckte Erinnerungen an Schatten und Gespenster aus ihrer eigenen Vergangenheit, die sie seit Jahren versuchte zu verdrängen. Immer war sie bemüht, innerhalb ihres Alltags ein größtmögliches Maß an Ordnung zu bewahren, seit ihre Mutter angefangen hatte, lange Spaziergänge zu machen und manchmal zu viel trank, und ihre Eltern sich deswegen häufiger stritten.
Katharina nahm ihr Smartphone und wählte die Rufnummer ihres Vaters, doch er hatte das Telefon ausgeschaltet. Das war gut, denn dann war ihr Vater bereits zuhause. Und wenn er zuhause war, herrschte Ordnung.
Als sie auf ihr Fahrrad stieg, wurde ihre Aufmerksamkeit plötzlich auf einen Mann gelenkt. Er stand bei der Kapelle unter einer Laterne regungslos da und beobachtete sie. Sie war es gewohnt, dass Männer sie anstarrten. Wer wusste schon, wie lange er dort in der Dunkelheit dagestanden hatte. Wie ein Schatten. Aber nichts an seiner Körperhaltung machte Katharina nervös oder beunruhigte sie. Vielleicht lag es daran, dass er so vollkommen entspannt wirkte.
Als sie an ihm vorbeiradelte, lächelte er und sprach leise ihren Namen.
„Hey Katharina …“
Unbeschreibliche Liebe lag dabei in seinem Blick. Der Moment dauerte nur wenige Sekunden, und doch würde sie sich später an jedes Detail und ihre Reaktion darauf erinnern. Sie radelte weiter, schneller. Ihr Herz klopfte wild. Bäume rauschten und wie ein Lufthauch umfing sie die Vision der Nacht.
Noch einmal drehte sie sich nach dem Mann um.
Er hob seine Hand zum Gruß.
Kapitel 10
Starnberg, Dezember 2016
Funktionieren. Das tun, was zu tun ist.
Baan ballte eine Faust. Der Kampf hatte begonnen. Alles, was nicht der Situation diente, hielt er außen vor.
In diesem Zustand hatte nichts und niemand eine Chance gegen ihn.
Nach seiner Ankunft hatte er eine Münchener Detektei beauftragt, um alles über einen gewissen Benedikt van Cleef in Erfahrung zu bringen. Der Leiter der Kripo hatte vor Jahren die Ermittlungen gegen seinen Vater geleitet und ihn schließlich getötet. In dem Bericht der Detektei tauchte der Name „Anna Gavaldo“ auf, mit der die Familie van Cleef eng befreundet war. Er hatte das Miststück gefunden.
Als er sich am Morgen vor den Computer gesetzt hatte, um noch mehr über die Familie Gavaldo in Erfahrung zu bringen, hatte er ein Kribbeln im Bauch gespürt. Das gleiche Kribbeln, das er immer verspürte, wenn er das Mädchen in seinen Visionen vor Augen hatte. An der Kapelle hatte er bei ihrem Anblick auch ein Spannen der Lenden gespürt. Das Gefühl war übermäßig stark, so stark, dass seine Finger beinahe von selbst die entsprechenden Tasten drückten, die ihn immer wieder zu Katharina Gavaldo und ihrer Familie brachten.
Sein Herz schlug schneller, als er die neuesten Bilder aufrief. Sie zeigten Max und Anna Gavaldo. Als das Mädchen dann auf dem Bildschirm erschien, nahm das Kribbeln augenblicklich zu. Sein Herz fing an zu pochen. Er zoomte das Gesicht heran.
Eisige Kälte lag in ihren blauen Augen. Katharina Gavaldo, langes blondes Haar, eine heranwachsende Göttin, ein kalter Engel. Seine Erregung wuchs mit jedem Mausklick. Er erfuhr alles über sie. War sie wirklich das Mädchen aus seinen Träumen?
Sicher konnte er natürlich nicht sein – noch nicht.
Doch!
Er war sicher, dass sie es war!
Sein Mädchen! Er hatte es bereits beim ersten Blick in ihre Augen gewusst! Und nun war er davon überzeugt, weil er sich die Fotos im Netz so oft angesehen hatte, dass er sich an jedes kleinste Detail erinnerte. Selbst jetzt hatte er sie vor Augen, wie sie auf ihr Fahrrad stieg, an ihm vorbei radelte und sich zum Schluss nach ihm umdrehte.
Er würde sie berühren.
Sie riechen.
Oh ja – sie war das Mädchen aus seiner Vision.
Aber er durfte nichts übereilen.
Da gab es noch die andere Gavaldo-Frau: Anna. Was immer diese Frau auch tun würde, er würde sich nicht von seinem Plan abbringen lassen. Gewiss nicht, weil sie die Mutter von Katharina war.
Nichts überstürzen.
Zurückhaltung üben.
Sich zur Geduld zwingen.
Seine Aufregung zügeln.
Aber es war so verflucht schwer, nicht gleich in seinen Wagen zu springen und zu dieser perfekten Gavaldo-Villa zu fahren. Zu Katharina, die ihn anzog wie ein Magnet die Eisenspäne. Und doch musste er warten. Zuerst musste die Mutter von der Bildfläche verschwinden.
Einen Teenager dazu zu bringen ihn zu mögen, war einfach. Damit kannte er sich aus: ein flehender Blick, ein schüchternes Lächeln, eine zärtliche Geste, eine zufällige Berührung. In Salvador hatten seine Kommilitoninnen ihn angeschmachtet.
Nach ein paar Tagen war Katharina sicher auch soweit … aber er war nicht daran gewöhnt, zu warten, geduldig zu sein.
Er schluckte. Dachte nach.
Bald … bald würde er sie wiedersehen, sie berühren, sie riechen.
Aber noch war er allein. Vielleicht um seinen Energiespeicher aufzufüllen. Um Kraft zu schöpfen.
Er trat ans Fenster und wartete. Geduld. Disziplin. Funktionieren. Tun, was zu tun ist. Er war bereit. Morgen würde er wieder an der Kapelle auf sie warten. Oder vor der Schule. Mal sehen.
Aber dieses Mal würde es anders sein.
Diesmal würde Katharina mit ihm sprechen.
In der Nacht hatte Baan wieder eine Vision.
Gut gelaunt und höchst zufrieden mit sich selbst – war das Warten auf das Mädchen vorbei. Während seine Freunde eine Blonde in der Nähe anglotzten, starrte er das Mädchen an, das auf der anderen Seite des Partykellers stand und sich mit zwei Freundinnen unterhielt. Baan hatte etwas übrig für große, elegante Mädchen mit langen Mähnen, und dieses erfüllte alle Kriterien. Er zog an seiner Zigarette und bereitete sich auf den Einsatz vor.
Aber das war unnötig. Sie drehte sich um und bemerkte seinen Blick. Er zwinkerte ihr zu. Einen Moment lang tat sie herablassend. Spielte die Unerreichbare. Er blies eine Rauchwolke in die Luft und zwinkerte wieder. Sie lächelte, sagte etwas zu ihren Freundinnen und kam herüber, drängte sich zwischen den Tanzenden hindurch, die ihr Platz machten. Er beobachtete sie dabei, verschlang sie mit seinen Blicken. Ihre Figur war fabelhaft und sie bewegte sich wie eine Göttin.
„Hey“, sagte er, als sie ihn erreicht hatte.
„Selber hey.“ Ihre Stimme klang dunkel und kehlig. Auch das törnte ihn an.
„Genießt du den Abend?“
„Nicht übermäßig“, antwortete sie.
„Dann erlaube mir, dass ich ihn interessanter mache.“
„Glaubst du, das kannst du?“
„Ich bin sogar sicher.“
„Wie wundervoll.“ Sie deutete auf seine Zigarette. „Darf ich?“
Er bot ihr eine an. Sie nahm die Schachtel, wandte sich ab und ging zurück zu ihren Freundinnen. Ihre Freundinnen fingen an zu lachen. Er lachte auch.
Zwei Minuten vergingen. Zu seiner Überraschung kam sie mit der halbleeren Zigarettenschachtel zurück.
Er grinste. „Du konntest meinem Charme also nicht widerstehen?“
Sie sah amüsiert aus. „Danke für die Zigaretten. Meine Freundinnen und ich sind dir sehr dankbar.“
„Ich heiße Baan.“
„Wie schön für dich.“
„Ist es. Du wirst mich lieben.“ Er wollte, dass sie beeindruckt war, aber sie wirkte immer noch amüsiert. Sie hatte hübsche Augen, aber ihre Gesichtszüge waren nicht weiter bemerkenswert. Nicht dass es ihm etwas ausmachte. Sie erweckte die Illusion von Schönheit so mühelos wie sie atmete.
„Wie heißt du?“, fragte er.
„Katharina.“
„Schöner Name. Passt zu dir. Sag mal, Katharina, warum ist eine so hinreißende Frau wie du allein hier?“
„Sag mal, Baan, arbeitest du nebenbei als Schnüffler?“
„Wie kommst du denn darauf?“
„Weil du nach Neugierde riechst.“
Wieder schmunzelte er. „Das ist keine Neugierde, sondern Wissbegierde.“
„Ich bin nicht allein. Ich bin mit Freunden hier.“
„Du weißt genau, was ich meine, Katharina.“
„Ob ich keinen Freund habe?“
Er nickte.
„Er muss noch arbeiten.“
„Was arbeitet er?“
„Warum fragst du? Jedenfalls hat er die Entdeckerfreude gepachtet … In jeder Hinsicht. Sonst noch was?“
„Warum bist du so kratzbürstig?“ Er bemühte sich, nicht zu klingen, als sei er in der Defensive.
„Bin ich nicht. Ich muss wieder rübergehen. Bye, Baan. Einen schönen Abend noch.“
Sie wandte sich ab. Er wollte seine Niederlage nicht eingestehen und hielt ihren Arm fest. Ihre Augen wurden schmal, und sofort ließ er sie los. Sie hatte Präsenz. Kraft, Selbstbeherrschung, einen Hauch von Bedrohlichkeit. Er geriet zusehends ins Schwimmen. In dem schmerzlichen Bewusstsein, dass ihre Freunde ihn beobachteten, versuchte er Boden zu gewinnen. „Warum bleibst du nicht? Ich hab Lust auf Champagner, aber ich trinke ihn nicht gern allein.“
„Du armer alter, reicher Mann.“
„Wenn du keinen Champagner magst, könnte ich auch was Besseres besorgen.“
„Was denn?“
Er legte einen Finger an den Nasenflügel und machte ein schnüffelndes Geräusch.
„Schnupftabak? Sehr cool. Und ist deine Pfeife farblich abgestimmt auf deine Pantoffeln und den Rollator?“
„Du weißt, was ich meine“, sagte er gereizt.
„Koks? Entschuldige. Bei deinem Nasenbluten hätte ich’s mir ja denken können.“
Er griff sich an die Nase, aber er fühlte nichts. „Jetzt hast du mich reingelegt.“
Katharina schaute zu ihren Freundinnen rüber. „Du klingst beeindruckt.“
„Sollte ich das nicht sein?“, fragte Baan.
„Nicht, wenn du es mir so leicht machst.“
Allmählich ärgerte er sich. „Du findest, ich bin leicht zu durchschauen?“
„Bist du es nicht?“
„Du weißt gar nichts über mich, du dämliche Kuh.“
„Oh … Schlechte Wortwahl. Du hast ein hübsches Gesicht, womöglich eine dicke Brieftasche, schlechte Manieren und ein Ego anstelle einer Persönlichkeit. Was gibt’s sonst noch zu wissen?“
Sein Ärger nahm zu. „Und was macht dich so besonders? Führst dich auf wie ein dummes Küken, das gerne eine schöne Henne sein möchte!“
„Eine ganze Menge. Koksen und Ficken auf Klubtoiletten gehört allerdings nicht dazu. Aber nimm es dir nicht so zu Herzen. Mit deinem ganz speziellen Charme wirst du sicher nicht lange allein sein.“
Er ließ sie ziehen. „Nicht schlecht“, johlten ihre Freunde. „Schon wieder ein gebrochenes Herz für deine Sammlung, Katharina.“
„Fick sie“, flüsterte seine innere Stimme.
„Das möchtest du wohl“, nuschelte Baan. „Fick dich selbst. Ich brauche jetzt etwas zu trinken.“
An der Bar bemerkte er ein hübsches, dunkelhaariges Mädchen, das ihn anstarrte. Er zwinkerte ihr zu. Sie kicherte, und er winkte sie heran. „Hey, ich bin Baan.“
„Ich bin Ellen.“
„Ein schöner Name. Er passt zu dir. Sag mal, Ellen, warum ist eine so hinreißende Frau wie du allein hier?“
Ellen kicherte wieder.
Er machte einen Scherz.
Sie lachte und das Geräusch war Balsam für sein gekränktes Ego.
Während sie sich unterhielten, schaute er immer wieder über ihre Schulter hinweg zu der hochgewachsenen Katharina, die dort mit ihren Freundinnen plauderte und von ihm so wenig Notiz nahm, als hätten sie nie miteinander gesprochen …
Am nächsten Morgen wachte er schweißgebadet auf.
Nein, dachte er. Das ist so gewöhnlich und banal.
So würde es niemals zwischen Katharina und ihm sein.
Kapitel 11
Starnberg
Benedikt van Cleef rappelte sich hoch, schwang die Beine über die Bettkante, stand auf. Jedenfalls hatte er das vor, aber in Wahrheit rührte er sich keinen Zentimeter. Er fragte sich, ob er gelähmt sei, weil er überhaupt keine Kraft in Armen und Beinen hatte. Die schwachen Befehle seines Gehirns kamen nicht bei seinen Gliedmaßen an, als er es noch einmal versuchte. Vielleicht ist es in Ordnung, wenn ich einen Augenblick liegen bleibe, dachte er. Sein Körper fühlte sich seltsam schwer an. Er blieb liegen und schlief wieder ein.
Die Stimme seiner Frau riss ihn aus dem Schlaf. „Aufstehen, Benedikt! Frühstück ist fertig!“, rief Mathilda von unten an der Treppe herauf. „Und du sollst Max Gavaldo anrufen. Es klang dringend.“
Van Cleef hob verblüfft die Augenbrauen und fragte sich, was Max auf dem Herzen hatte. Wenn sein Freund sich frühmorgens bei ihm meldete, musste das einen triftigen Grund haben.
Er versuchte, die Benommenheit abzuschütteln, richtete sich in seinem Bett auf, griff zum Handy und wählte Max’ Nummer. „Hey Max, was gibt es denn so Dringendes, dass du mich um diese Zeit aus dem Bett scheuchst? Weißt du eigentlich, wie spät es ist?“
„Entschuldige, Benedikt. Es ist wichtig“, antwortete sein Freund am anderen Ende der Leitung. „Ich muss dich unbedingt treffen. Ich hätte es schon längst tun sollen, aber es fällt mir verdammt schwer über mein Problem zu sprechen. Am Telefon schon gar nicht. Es betrifft Anna.“
Ein ahnungsvolles Stöhnen drang über Benedikts Lippen. Es war nicht das erste Mal, dass so etwas geschah. Anna wurde zu oft mit den Dämonen ihrer Vergangenheit konfrontiert. Aber Max Gavaldo war noch niemals damit zu ihm gekommen. Es musste etwas vorgefallen sein.
„Sie fühlt sich wieder bedroht. Ich habe aber den Verdacht, dass es um viel mehr geht, Benedikt. Irgendetwas stimmt nicht. Können wir uns bei dir im Präsidium treffen? Es gibt da noch etwas anderes, was von Bedeutung sein könnte. Es ist sehr wichtig!“
Benedikt runzelte die Stirn. Max Gavaldo würde die Worte nicht in den Mund nehmen, wenn nicht etwas wirklich Übles in sein Leben getreten wäre.
„Okay. Komm doch heute Nachmittag gegen vier Uhr vorbei. Passt das für dich, Max?“
Max stimmte zu.
„Bis dann.“ Er fühlte das Gewicht des Telefons in seiner Hand. Atmete tief ein, legte auf. Blinzelnd blieb er noch einen Moment liegen, sammelte seine Gedanken und wehrte sich gegen den Drang, weiterzuschlafen. Das Ziffernblatt seines Weckers zeigte Viertel nach acht. Die vergangene Nacht hatte ihm nur fünf Stunden Schlaf beschert. Er holte tief Luft, nahm alle Kraft zusammen, schwang sich aus dem Bett und ging ins Badezimmer.
Dort schaute er in den Spiegel. Für meine einundfünfzig Jahre sehe ich gar nicht so übel aus, dachte er. Das sonnengebräunte Gesicht, die Lachfalten, sanfte braune Augen, das dunkelblonde, kurze, gewellte Haar, ein Vollbart und der sinnliche Mund blickten ihm entgegen. Er verzog sein Gesicht zu einer Grimasse und warf seine Shorts achtlos auf den Boden. Sei nicht so eitel, van Cleef, mahnte ihn seine innere Stimme.
Nach der Dusche fühlte er sich besser und halbwegs frisch. Dennoch blieb er im Schlafzimmer noch einen Moment stehen und starrte geistesabwesend vor sich hin. Max’ Anruf beunruhigte ihn. Die Gavaldos hatten so viel Leid erfahren und selbst er hatte, nachdem er Annas Peiniger erschossen hatte, eine Zeitlang Albträume gehabt. Ihre Schwester ermordet, Anna mehr tot als lebendig und hochgradig traumatisiert. Das war ihr Leben, das war Anna. Er wollte eigentlich nicht daran denken. Das Entsetzen, das die Fotos der Opfer damals in ihm hervorgerufen hatten, war selbst 16 Jahre danach noch auf Abruf präsent. Wären seine Frau und seine Familie nicht gewesen …
Er kannte die möglichen Folgen nur zu gut, die zermürbende Fälle, bestialische Morde, Kindesmissbrauch, oder Menschenhandel hervorriefen. Einige Kollegen verkrafteten die Bilder der Gräueltaten nicht und mutierten zu Alkoholikern, manche wurden drogensüchtig oder entwickelten Psychosen.
„Benedikt van Cleef!“, hörte er Mathilda rufen. „Hat deine Duschorgie zu einer Minderung deiner körperlichen Leistungsfähigkeit geführt? Ich warte auf dich!“
Benedikt lächelte und ging die Treppe hinunter. In deinem Alter ist Schlafmangel eine mittlere Katastrophe, dachte er.
Als er die Küche betrat und seine Frau auf ihn zukam, vergaß er einen Moment seine Müdigkeit. Mathilda war immer noch atemberaubend. Ihr Haar von einem leuchtenden Tizianrot, das reinste Flammenmeer, das sich in wilden Locken über ihre Schultern ergoss. Ihr Gesicht bestand aus lauter Sommersprossen: Ansichtspunkte, die geküsst werden wollen, fand er. Ihre rostrot geschminkten Lippen hoben sich zu einem kleinen wissenden Lächeln, als sie vor ihm stehen blieb, so nah, dass er das winzige Muttermal sehen konnte, das direkt über der rechten Oberlippe saß. Sie küsste ihn zärtlich.
„Guten Morgen, Liebling.“
Mathildas Mal war ihm bei ihrer ersten Begegnung vor Jahren sofort aufgefallen, und er hatte es schon damals im Krankenhaus auf der Stelle küssen wollen.
Er hatte seine Frau auf der Intensivstation kennengelernt, als er den Mordanschlag auf Anna Gavaldo untersuchte. Mathilda hatte Anna, die damals im Koma gelegen hatte, täglich besucht. Da er die Patientin nicht hatte befragen können, hatte er sich an Mathilda gewandt und sich Hals über Kopf in sie verliebt. Ein Jahr später waren sie verheiratet.
Benedikt streichelte sanft über ihr Haar.
„Alles okay? Wasserpfützen im Bad beseitigt?“, fragte sie.
Er nickte und küsste sie noch einmal.
„Was wollte denn Max um diese Zeit von dir, Benny?“
Er hob die Augenbrauen und schmunzelte. „Benny? So hast du mich schon eine Ewigkeit nicht mehr genannt. Max will mit mir über Anna sprechen.“
„Über Anna? Komisch.“
Er nickte. „Behalte es bitte für dich, Matti.“
„Keine Sorge. Manchmal hasse ich deinen Job, Benedikt van Cleef. Anna ist meine beste Freundin.“
„Ich weiß, aber irgendetwas geht da wieder vor sich.“
„Das Gefühl habe ich auch. Anna hat neulich die Benefizveranstaltung verlassen. Ohne sich von mir zu verabschieden. Einfach so.“
„Hm … Wir werden sehen.“ Er trank rasch zwei Tassen Kaffee. „Ich muss. Bis später. Wobei ich mich lieber einer Studie der sexuellen Anziehung zwischen zwei Menschen widmen würde.“
Mathildas bernsteinfarbenen Augen leuchteten, als sie ihn zärtlich umarmte. „Wer käme da als Studienobjekt infrage?“
„Rate mal. Ich liebe dich“, hauchte er ihr ins Ohr, küsste sie noch einmal und verließ das Haus.
Während der Fahrt durch den Berufsverkehr zum Polizeipräsidium dachte Benedikt van Cleef an Anna Gavaldo und daran, wie er sie in Jakobs Keller vorgefunden hatte. Er verstand nicht, warum Max nach 16 Jahren plötzlich mit ihm darüber sprechen wollte.
Das gefiel ihm alles überhaupt nicht.
Mit einem Seufzer kam Verdrängtes wieder hoch. Er dachte an die leeren Augenhöhlen der Opfer, an die abgetrennten Hände mit den blaulackierten Fingernägeln, die sie im Keller dieses Psychopathen gefunden hatten, und an Anna mittendrin, gefesselt auf einer Liege im Keller. Wie damals stieg Entsetzen in ihm auf.
Max’ Botschaft und seine Bitte waren deutlich gewesen. Vor dem Frühstück hatte er versucht, die offensichtliche Wahrheit zu verdrängen, doch er wusste, dass er das nicht konnte. Alexandra Cordes, die Ehefrau eines befreundeten Kollegen und Gutachterin für Täterprofile, hatte ihm einmal erklärt, dass Opfer wie Anna Gavaldo häufig glaubten, dass sich Täter ein Leben lang an ihren davongekommenen Opfer rächen wollten und immer Mittel und Wege finden würden, mit den Opfern zu kommunizieren. Die Rache – auch nur in Gedanken – stellte für einen Psychopathen eine Attraktion dar. Die Rache war ein Ort, in den ein psychopathischer Mörder immer wieder abtauchte, um sich selbst wiederfinden und seine Tat immer wieder neu definieren zu können. So ein Ort war die Gedankenwelt von Anna Gavaldo.
Kapitel 12
München, Dezember 2016
Am Nachmittag betrat Max Gavaldo van Cleefs Büro. Mit ihm kam ein Hauch von Winter über die Schwelle. Sie begrüßten einander und verzichteten auf andere Höflichkeitsfloskeln.
Benedikt zog einen Sessel dichter an seinen Schreibtisch und bat Max, der völlig aufgebracht wirkte, mit einer Geste, Platz zu nehmen. Ihm war nicht wohl bei der Sache. Er selbst setzte sich in seinen Schreibtischsessel.
„Du hast dich am Telefon beunruhigt angehört, Max“, begann van Cleef. „Worüber wolltest du mit mir reden?“
„Über die Wahrheit.“
Ihre Blicke trafen sich, und Max hielt van Cleefs stand.
„Die Wahrheit worüber?“
Max schnaubte. „Über meine Frau.“
„Sag mir, was du meinst, und beruhige dich bitte.“
„Ich habe Annas Aufzeichnungen gelesen …“ Max stockte.
„Warum hast du dir das nach all den Jahren angetan, Max?“
„Anna ist schwanger, Benedikt. Und sie verhält sich wieder so seltsam“, begann Max. „Hast du mir etwas verschwiegen, Benedikt? Gibt es etwas, was ich wissen müsste?“
Benedikt wandte den Blick ab und zeigte auf die Kaffeemaschine. „Möchtest du einen Kaffee?“
„Ich will keinen Kaffee“, fuhr Max fort. „Es geht darum, dass du mir viele Details vorenthalten hast. Ich möchte die ganze Wahrheit, Benedikt. Ich möchte nicht, dass Anna unser Baby in der Psychiatrie zur Welt bringt.“
Benedikt schwieg noch immer.
„Durch das Tagebuch weiß ich, warum du diesen Jakob getötet hast. Man kann es dir nicht übelnehmen.“
„Mir nicht übelnehmen?“, wiederholte Benedikt zögernd. „Ich habe deiner Frau das Leben gerettet und nebenbei mein eigenes. Und womöglich das von vielen anderen Frauen …“ Er atmete tief ein. „Also komme mir nicht mit Man kann es dir nicht übelnehmen.“
„Entschuldige. So habe ich das nicht gemeint.“
„Verdammt, Max. Das ist alles fast siebzehn Jahre her. Was ist vorgefallen?“
Max hob hilflos eine Hand. „Weißt du, vor der Dunkelheit, vor dem Missbrauch, war Anna so fröhlich und stark und dann …“
„Und dann?“
„Ich habe mich damals so gefühlt, als wäre eine schwere Grippe im Anmarsch. Aber ich bekam keine Grippe. Ich war wütend und traurig zugleich, sobald ich an meine Frau und diesen Psychopathen denken musste – wie jetzt auch. Ich habe die Geschehnisse immer sorgsam ausgeblendet.“
Benedikt verstand. Max hatte es so lange geschafft, immer ruhig zu bleiben und jeden Gedanken an das, was Jakob mit seiner Frau angestellt hatte, zu unterdrücken. Aber jetzt war alles wieder da, ausgelöst durch … Ja, wodurch denn nur? So lange es auch her war – die Wunde hatte sich nicht geschlossen.
Das wusste Benedikt. Und Max wohl auch.
Die Zeit war immer ein wahrhaftiger Quacksalber.
„Ich kann anderen Menschen nicht gut mein Herz ausschütten“, fuhr Max fort. „Vielleicht habe ich es auch deswegen nie wirklich verwunden. Weißt du, meine Art Dinge zu verarbeiten, funktioniert anders. Ich weiß, dass ich etwas unternehmen sollte, bevor es zu spät ist. Bevor Anna wieder vollends in den Mahlstrom der Depression gerät, der sie hinabzieht in die Schwärze. Nein, nicht Anna allein, sondern uns alle, mich, Katharina und sogar dich und Mathilda. Ich habe ihre Tagebücher gelesen, weil Anna schwanger ist. Und bis vorgestern war ich der Meinung, dass sie dringend mit einem Arzt sprechen sollte. Anna kann sich aber nicht dazu aufraffen. Was ich wiederum verstehe. Die mentale Kraftanstrengung ist für sie irrsinnig groß.“
Benedikt hörte zu. Max Gavaldos Worte berührten ihn und tief in seinem Inneren beschlich ihn ein ungutes Gefühl.
„Du sagtest vorhin, dass du bis gestern der Meinung warst, dass Anna einen Arzt aufsuchen sollte. Warum hast du deine Meinung geändert?“, fragte Benedikt.
„Ich war in der vergangenen Nacht spazieren und hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass mich jemand verfolgt. Es klingt bescheuert, ich weiß. Aber da war jemand.“
Stille.
„Ich habe mir alles so viel einfacher vorgestellt, Benedikt. Aber so einfach ist es nicht, das Leben. Es ist vieles, aber sicher nicht einfach. Irgendetwas geht in unserem Haus vor. Das ist auch ein Grund, warum ich hier bin. Jemand ist in unser Haus eingedrungen, als niemand da war – trotz unserer Überwachungsanlage. Könntest du mal bei uns vorbeischauen? Ein Polizist sieht bekanntlich mehr.“
Er holte tief Luft. „Anna würde sagen: Der Tag geht, die Nacht nimmt seinen Platz ein und mit ihr kommen die Hirngespinste“, fuhr Max fort und lächelte gequält. „Anna hat Angst und ist angeschlagen, weil sie von jemandem auf der Benefizveranstaltung bedroht wurde. Weil sie davon überzeugt ist, dass irgendjemand ihren, meinen und Katharinas Tod plant.“
Stille.
Max’ Blick sagte ihm alles. Er schrie innerlich, weil er große Angst hatte um seine Familie. Er litt Höllenqualen.
Die Kaffeemaschine unterbrach gurgelnd die Stille.
Van Cleef räusperte sich. „Das hört sich nicht gut an, Max“, sagte er.
„Dann sag mir eins: Was hat meine Frau gesagt, als du sie damals im Keller vorgefunden hast?“ Max sah ihn durchdringend an.
Van Cleef schluckte. „Das möchtest du nicht wissen, Max.“
Max schlug mit der Faust auf die Stuhllehne. „Doch! Wie soll ich es sonst wissen?“
„Was wissen?“, fragte Benedikt
Max sprang auf. „Ob ich Anna glauben kann! Ob ich ihr vertrauen kann!“
Van Cleef blickte entsetzt auf.
„Ob sie in all den Jahren nachts neben mir nur an diesen Mann gedacht hat!“, rief er mit Tränen in den Augen.
Van Cleef dachte einen Moment nach, schluckte trocken und zählte langsam im Geist bis zehn. Er wollte die Bilder der Vergangenheit nicht wieder vor seinem inneren Auge haben, aber Max hatte ein Recht auf die Wahrheit. Er wählte seine Worte sorgfältig aus. „Anna war damals mehr tot als lebendig und vollgepumpt mit Drogen“, begann er. „Er hat sie seelisch und körperlich auf bestialische Weise geschändet. Wir haben grauenvolle Vorrichtungen im Keller und im Dachgeschoss seines Hauses gefunden.“
Max starrte van Cleef an. „Dann konnte sie ihm zu keiner Zeit entkommen?“
„Nein! Er hatte sie an Ketten gefesselt, betäubt und willenlos gemacht. Anna war niemals selbstbestimmt.“
„Dieser Mann hatte sexuellen Gefallen an ihr gefunden, anders kann ich es mir nicht erklären“, sagte Max leise. „Hätte er sie sonst nicht sofort getötet?“
Es klang weniger wie eine Frage, als wie eine Bitte um eine Sag-mir,-dass-das-alles-nicht-stimmt-Bestätigung.
„In erster Linie wollte er sie töten. Das ging eindeutig aus dem Schreiben hervor, das wir damals in ihrer Wohnung gefunden haben. Jakob hat in Anna seine Mutter gesehen. Aber dann änderte er sein Spiel.“
Er verschwieg Max, dass Jakob Anna an eine Milchpumpe angeschlossen hatte. Dass er wollte, dass Milch aus ihrer Brust floss, damit er sich wieder als Kind fühlen und sie gleichzeitig als Mann schänden konnte, wann immer er wollte und sie mit seiner perversen Zuneigung überschütten. Anna hatte sich unbewusst selbst hintangestellt und ihn in ihrem Drogenrausch vergöttert. Er holte tief Luft.
„Beziehungen entstehen aus vielerlei Gründen. Manipulation ist eine davon. Was sicher auch ein Grund dafür sein mag, warum Annas Verstand versagt hat.“
Max nickte. „Anna hat viele Jahre gebraucht, um sich davon zu erholen. Aber wie kann sie das? Jeden Morgen sieht sie im Badezimmer in den Spiegel, sieht die Bisswunden dieses perversen Schweines. Ich verstehe ihre Absencen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie von diesem Mann träumt, aber dass es keine Alpträume sind. Offensichtlich hat Jakob für meine Frau eine Romanze inszeniert und seine Erfahrungen als reifer Mann ins Spiel gebracht. Als junge, unerfahrene Frau unter Drogeneinfluss konnte sie sich dagegen kaum wehren.“
„Romanze?“, rief van Cleef entsetzt. „Er hat sie gequält, er hat ihr einen skalpierten Schädel vorgesetzt und einen Spiegel angerußt, um sie mit dem Spiegelbild des Todes zu konfrontieren, während er eine Milchpumpe auf Hochtouren laufen ließ und sie dabei missbrauchte.“ Du verdammter Idiot!
„Das wusste ich nicht“, stammelte Max. „O mein Gott. Warum habe ich nicht viel früher mit dir gesprochen? Vielleicht hat sie heimlich verhütet, weil sie nicht schwanger werden wollte. Weil eine Brust, in die die Milch schießt und an der ein Baby nuckelt, sie an Jakob erinnern würde. Weil …“
Benedikt räusperte sich und fragte sich, warum das nach all den Jahren für Max auf einmal eine Rolle spielte. Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Sich Gedanken zu machen, war die natürlichste Sache der Welt. Aber Gedanken wie diese waren unkontrollierte und schwer zu lenkende Impulse, die die Synapsen überfluteten. Sie konnten sich zu einem Problem entwickeln.
„Ich konnte Annas Reaktionen noch nie ganz nachvollziehen, Benedikt.“
Van Cleef nickte kurz, als Zeichen, dass er Verständnis hatte für Max’ innere Qual. Trotzdem war ihm unwohl bei dem Gedanken, seinem Freund solche Details preisgegeben zu haben. Verdammt!
„In den Augen dieses Monsters war Anna jemand“, sagte er schließlich. „Sie gab ihm eine neue Art von Energie, Energie, die er allein oder mit den anderen Frauen nie hatte, auch nicht mit Annas Schwester Katharina.“ Van Cleef schwieg einen Moment. „Energie, die seine kriminelle und kranke Kreativität in ungeahnte Höhen katapultieren konnte.“
„Auf Kosten einer Achtzehnjährigen“, antwortete Max grimmig und seine Stimme schien zu flattern. „Wahrscheinlich wollte sie ihm zeigen, wie viel er ihr bedeutete.“
Benedikt holte tief Luft. „Nein, Herrgott nochmal, Max. Das sind krause Gedanken. Jakob hat ihr Vertrauen bestialisch zerstört, als er ihr die Tsantsa gezeigt hatte. Von diesem Moment an wusste Anna, was er vorhatte. Dass er auch sie töten wollte.“
Max hob die Augenbrauen. „Vertrauen? Sie hat ihm vertraut?“
Van Cleef vermied es, seinem Freund direkt in die Augen zu schauen, aber dieser hatte ein Recht auf die ganze Wahrheit. „Sie hat mich damals in dem Keller angefleht, Jakob nicht zu töten, weil sie glaubte, ihn zu lieben.“
Max wurde blass. „Sie … sie … hat dich angefleht, ihn nicht zu töten?“
„Ja“, antwortete van Cleef leise. „Weil sie unter dem Einfluss von Rompun und Ketamin stand, zwei Substanzen, die einen Menschen willenlos und gefügig machen.“
„Dieser Psychopath kannte sich aus mit manipulativen Techniken. Es war nicht zu Ende. Nicht für Anna, nicht für Jakob. Die Tage, die sie in seiner Gewalt verbringen musste, all der Schmerz, den er ihr zugefügt hatte, das alles schien nicht mehr zu zählen. Sie wollte ebenso wenig ohne Jakob leben, wie er ohne sie leben wollte.“
Van Cleef erhob sich und ging wie ein Raubtier um Max’ Sessel, dabei ließ er ihn keinen Augenblick aus den Augen. „Begreifst du, dass er nicht anderes im Sinn hatte, als einen jungen Menschen körperlich und seelisch zu vernichten? Das verschaffte ihm Befriedigung. Die totale Vernichtung! Und wenn du zweifelst, dann sprich mit Alexandra Cordes. Ich verstehe nicht, warum du das nicht längst getan hast, wenn diese Gedanken dich so sehr quälen. Aber ich möchte jetzt nur eines von dir wissen.“ Er setzte sich wieder in den Sessel und betrachtete seelenruhig seine Fingernägel, bevor er Max scheinbar wie nebenher fragte: „Warum wolltest du das alles wirklich von mir wissen, Max?“
„Weil jemand in unserem Haus war! Weil … Er stockte, ließ den Satz auströpfeln. Der Kopfschmerz regte sich hinter seiner Stirn. „Weil Katharina Jakobs Tochter ist. Ich habe die Tochter dieses Monsters groß gezogen!“
Kapitel 13
Selma
Selma Wagenknecht blickte von den Arbeiten auf, die sie korrigierte, und betrachtete die Klasse, die vor ihr saß. Es war still. Man hörte nur das Kratzen der Stifte auf dem Papier, während die Schüler mit den Matheaufgaben kämpften, die ihre Lehrerin ihnen gestellt hatte. Klemens Lürken starrte aus dem Fenster, draußen lieferte der Bäcker gerade die Brötchen für die nächste Pause an.
„Der Bäcker da draußen kennt die Antwort auch nicht, Klemens“, sagte Selma in scharfem Ton.
„Kann man nie wissen, Frau Wagenknecht“, erwiderte Klemens. Einige Schüler kicherten.
„Aha. Konzentrier dich auf deine Arbeit!“
Selma korrigierte weiter. Die Schüler hatten Interpretationen zu Büchners „Leonce und Lena“ geschrieben. Sie war jetzt mit Chris Bohlen fertig, der geschildert hatte, wie er gerne den Frühling an anderer Stelle spürte als auf den Wangen. Selma schmunzelte. So ein Frechdachs. Als Nächstes kam Ellen Langers Geschichte: Für das Mädchen war Leonce ein Popstar, der das Knie vor ihr beugte – keine geringe Leistung, wenn man bedachte, dass er in ihrer Arbeit auf einer Harley Davidson saß – und ihr einen Heiratsantrag machte, bevor er sie zur Hochzeit mit Starbesetzung nach Hollywood entführte.
Selma verdrehte die Augen und stellte mit Erstaunen fest, wie wenig sich die pubertierenden Mädchen von heute verändert hatten, seit sie selbst eins gewesen war.
Sie hörte Getuschel.
Katharina Gavaldo flüsterte Ellen etwas zu.
„Du arbeitest allein, Ellen“, mahnte sie nachdrücklich.
Ellen nickte, aber Katharina flüsterte weiter.
„Und wenn du weiter versuchst, deiner Freundin zu helfen, Katharina, dann stehst du gleich draußen auf dem Flur.“
„Schon gut, Frau Wagenknecht“, erwiderte Katharina mit hochgezogenen Brauen und konzentrierte sich wieder auf ihre eigene Arbeit.
Selma fing mit Katharina Gavaldos Arbeit an. Ein dreiseitiger Bericht über eine Reise durch den menschlichen Körper. Kein Wunder, dachte sie. Schließlich war Katharinas Vater Pharmaunternehmer. Katharina verglich Büchners Lena mit dem Hypothalamus, der wichtigsten Hirnregion für die Aufrechterhaltung des inneren Milieus und seiner Anpassung bei Belastungen des Organismus. Büchners Leonce hingegen bezeichnete Katharina als Störenfried, dem im Großhirn ein wesentliches Stück der rechten Hälfte fehlte und dem deswegen die Fähigkeit zum Denken nicht angeboren war.
Weibliche Wesen passen auf, mit wem sie sich einlassen, männliche neigen zur Promiskuität. Erst mit dem Anerkennen dieser Realität als Maßstab der Wahrheit und dem Ablegen jeglichen Wunschdenkens in Bezug auf Sexualität, hat das Denken eine Chance.
Eine hervorragende Arbeit, dachte Selma. Eine Arbeit, die ein reales Gefühl davon vermittelte, wie klug das Mädchen für sein Alter war. Dennoch gab sie Katharina eine Drei. In der Arbeit steckte auch eine beachtliche Portion Arroganz und ein Mangel an Respekt.
Selma blickte hinüber zu dem Tisch im hinteren Teil des Raums, wo Katharina saß. Sie hatte den Kopf tief über ihr Heft gebeugt. Die einzige Blondine in einem Meer von schwarzen und braunen Köpfen.
Einer der Gründe, weshalb sie Katharina nicht besonders mochte, war der, dass sie ständig versuchte, sich aufzuspielen oder von den anderen abzuheben. Sie verschwand nicht in der Masse wie ihre Freundin Ellen. Katharina sprach auch, wenn sie nicht gefragt wurde, und dann so laut, dass Selma sich oft die Ohren zuhalten wollte. Katharina war ein Teenager, dessen Körpersprache den Wunsch signalisierte, besonders wahrgenommen zu werden.
Normalerweise ignorierte sie das Mädchen, aber nicht deswegen, weil zu viele andere Schüler ihre Aufmerksamkeit gefordert hätten.
Kein gutes Lehrerverhalten, dachte Selma. Aber da Katharina gute Leistungen brachte, kam es wahrscheinlich auch nicht so sehr darauf an.
Nein, Selma Wagenknecht, dein Verhalten ist absolut unfair, meldete sich ihre innere Stimme.
Aber sie konnte nicht anders. Sie hasste dieses engelhafte Mädchen mit den kalten Augen. Von ihm ging eine Gefahr aus. Da war sich Selma sicher.
Sie streckte sich auf ihrem Stuhl und spürte ein leises Ziehen im Rücken. Jetzt, da sie regelmäßig schwimmen ging, machten sich bisher unentdeckte Muskeln bemerkbar. Sie wollte ihrem Freund einen straffen Körper bieten. Beim letzten Mal hatte der Schwimmlehrer ihr die Butterflytechnik gezeigt. Es war genauso schwer, wie es aussah. Aber sie würde es lernen. Ganz gleich, wie lange es dauerte.
Noch einmal blickte sie in Katharinas Richtung, die Eyeliner trug und schwarzen Lidschatten. Sie kaute an ihrem Stift und spielte mit einer Locke hinter dem Ohr. Selma wusste, dass Katharina Geschichten über sie erfand. Böse Geschichten. Die meisten Schüler taten es hinter ihrem Rücken. Aber sie taten es und Selma wusste darüber Bescheid. Im Netz kursierten Momentaufnahmen von ihr, die nicht gerade vorteilhaft waren. Es war ihr egal. Bei den Bildunterschriften musste sie oft schmunzeln wie bei der über einem Foto, auf dem sie Schokolade naschte: Die Wagenknecht befindet sich auf dem geistigen Niveau eines Überraschungseies.
Katharinas Bildunterschriften waren jedoch völlig daneben: Wenn die Wagenknecht sich weiter so zurückentwickelt, sollten wir sie abtreiben oder Wenn der IQ der Wagenknecht so flach ist wie Ihre Brüste, sollte sie zuhause bleiben.
Natürlich hatte es keinen öffentlichen Vergeltungsversuch auf dem Schulhof gegeben. „Was meinst du als Unbeteiligte zum Thema Intelligenz, Katharina?“, hätte sie sagen sollen und noch mehr. Aber sie hatte es nur in Gedanken ausgesprochen. Und darauf kam es an. Vielleicht.
Katharina hob den Kopf und sah sie mit einem inzwischen vertrauten Blick an, aus dem Zorn und Verachtung sprachen. Sie starrte zurück, dabei tastete sie nach dem Bleistift und drückte ihn sanft, als wollte sie den schlafenden Drachen in sich kitzeln.
Katharina schaute als Erste weg.
Selma legte ihren Aufsatz zur Seite und nahm sich den nächsten vor.
Kapitel 14
Katharina
Katharina schrieb die Antwort auf die vorletzte Frage hin und blickte auf. Selma Wagenknecht korrigierte die Aufsätze, die sie am Tag zuvor geschrieben hatten. Mit ihrem Aufsatz hatte sie die Zicke provozieren wollen, aber die Wagenknecht war zu dämlich, das zu begreifen. Das hätte sie gern geschrieben, aber so etwas konnte man im Aufsatz nicht schreiben. Nicht mehr. Die Wagenknecht würde sofort ihren Vater anrufen. Nach der Sache mit den Gläsern ihrer Mutter konnte sie sich eine ähnliche Respektlosigkeit nicht mehr leisten. Ihr Vater würde ausrasten.
Katharina fragte sich, ob es keine andere Möglichkeit gab, der Wagenknecht eins auszuwischen. Sie war in ihren Augen alt, fast vierzig oder älter. Jedenfalls war sie eine hagere, unfreundlich aussehende Frau, der nichts entging. Die es nicht gut mit ihr meinte. Sie bekam in regelmäßigen Abständen unverhältnismäßig schlechte Noten. Seit sie sich ein wenig zurückgenommen hatte, war es zwar nicht mehr so schlimm wie früher, aber es kam immer noch vor. Ich wünschte, ich könnte dieser Schnepfe eins auswischen. Ich wünschte, ich könnte dafür sorgen, dass sie Angst vor mir hat.
Ich wünschte … ich wünschte … ich wünschte …
Neben ihrem Heft lag ein Satz Buntstifte. Ein Geschenk von ihrer Mutter, die von ihrer Zeichenkunst begeistert war. Nicht so Selma Wagenknecht. Und dafür hasste sie diese Frau.
Für deine Fünf in Kunst werde ich mich rächen.
Dann, wenn du es nicht bemerkst!
Wenn du nicht damit rechnest.
Ich werde dich daran erinnern, dass du für mich ohne Bedeutung bist.
Ich werde dir zeigen, was Angst bedeutet.
Du wirst dir vor Angst in die Hose pinkeln.
Du wirst mich dafür hassen.
Genau wie ich dich hasse.
Ihr Bleistift glitt über das Papier und malte Kreise an den Rand. Plötzlich war der Hass wie ein Feuer, das ihr Herz verbrannte. Die Kreise wurden immer größer, und das Gefühl wurde so inbrünstig, dass sie am liebsten geschrien hätte.
Der Bleistift brach ab. Sie spitzte ihn wieder an und schrieb ihren Test zu Ende.
Dann hob sie den Kopf. Ihre Blicke trafen sich …
Später trank Katharina zuhause ein Glas Wasser.
Hunger verspürte sie nicht.
Sie aß trotzdem.
Sie fühlte sich stark.
Sie könnte durch die Stadt radeln oder zur Friedhofskapelle gehen. Vielleicht würde sie ihn dort wieder sehen. Sobald sie an ihn dachte, kam sie sich sehr erwachsen vor.
Sie betrat die Küche. Ihre Mutter bereitete das Abendessen vor.
„Mom, ich fahre mit dem Rad in die Stadt.“
„Sei um sechs Uhr spätestens zurück, Katharina!“, sagte Anna, drehte sich um und musterte sie. „Hm …Ein bisschen viel Make-up für eine Fahrradtour, Katharina.“
„Warum nicht? Das tun viele Mädchen in meiner Klasse. Außerdem sieht es gut aus.“
Ihre Mutter schüttelte ihren Kopf. „Wie der Grufti-Szene entsprungen. Jesus, wer hat denn gesagt, dass das gut aussieht?“
„Irgendein Junge, mit dem ich geschlafen hab. Weiß nicht mehr, wie er hieß.“
Der Unterkiefer ihrer Mutter klappte herunter.
„Beruhige dich, Mom. Das war nur ein Scherz.“
„Das ist nicht komisch, Katharina.“
„Spitze Bemerkungen und beißender Spott über mein Aussehen auch nicht, aber hey, niemand ist vollkommen.“
Ihre Mutter runzelte empört die Stirn. „Was ist in dich gefahren?“
„Gar nichts. Triffst du dich heute Abend mit Mathilda?“
„Warum fragst du?“
„Ich frag nur“, antwortete Katharina. „Also?“
„Ja. Max muss länger arbeiten.“
„Musste er letzten Donnerstag auch länger arbeiten?“
„Ja. Warum fragst du?“
Katharina antwortete nicht.
„Ich hab dich was gefragt.“
„Er ist ein Idiot, Mom. Du könntest was viel Besseres haben.“
Plötzlich war das Lächeln auf dem Gesicht ihrer Mutter erloschen und Wut gewichen, fast im Einklang mit der flachen Hand, die sie ihrer Tochter mit Wucht ins Gesicht schlug. „Wage es nicht nochmal, so über deinen Vater zu sprechen.“
Katharina spürte, wie der Zorn in ihr hochkroch. Sie holte tief Luft und schluckte ihn hinunter. „Sorry. Ich wollte nur …“
„Nein! Jetzt geh, und wisch dieses Make-up aus deinem Gesicht! Du siehst aus wie ein Flittchen!“
Katharina wandte sich ab. In der Tür blieb sie stehen. „Mom?“
„Was?“
„Schlag mich nie wieder.“
Sie verließ das Haus, ohne sich abzuschminken, und schnappte ihr Fahrrad.
Fahrradfahren beruhigte sie. Es machte den Kopf frei. Sie fuhr nicht allzu schnell, hielt überall nach ihm Ausschau. Nichts. Dann radelte sie am Seeufer entlang und bog in die schmale Landstraße ein, auf der kaum Autos fuhren. Zwischen Wiesen und Feldern und ohne Anfang und Ende. Ein weißes, staubiges Band zwischen den flachen, mit Schnee bedeckten Feldern, die bis zum Horizont reichten.
Da! Ein Ruck durchfuhr sie. Komm in die Stadt. Ein Flüstern.
Katharina trat in die Pedale, machte sich ganz flach. Sie lag fast auf der Lenkstange. Der Fahrtwind griff ihr in die Haare. Sie hätte schreien mögen, so glücklich war sie.
Sie sah sich um. Weit und breit sonst niemand. Nur sie. Und die Endlosigkeit dieser Straße.
Sie hatte keine Ahnung, dass sie längst nicht mehr allein war. Dass ihr nur noch eine halbe Stunde blieb, bis das Böse in ihr Leben trat.
Sie hatte keine Ahnung, dass das Leben, wie sie es kannte, bald vorbei sein würde.
Kapitel 15
Selma
Selma Wagenknecht machte einen Schaufensterbummel in der Seestraße, um sich nach einem Kleid umzusehen und um sich die Zeit totzuschlagen, bis es endlich Abend sein würde. Dann würde der neue Mann in ihrem Leben sie endlich wieder in seine Arme nehmen, sie mit Leidenschaft lieben.
Sie kam an einer Boutique vorbei. Die Puppe im Fenster trug ein grünes, weit ausgestelltes Cocktailkleid mit einem Bustier, das eine große Amazonaslilie zierte. An der Puppe sah es gut aus, aber an ihr würde es noch besser aussehen.
Kaufs dir. Du solltest dich ein bisschen aufbrezeln, wenn du dich mit ihm triffst. Er sieht so verdammt gut aus!
Ob es ihm gefallen würde? Sie war vor einem Jahr aus einer Beziehung mit einem Alkoholiker entkommen und umgab sich seitdem mit schönen Dingen. Sich jetzt kopfüber in die nächste Beziehung zu stürzen, war alles, was sie brauchte, samt ungehemmtem Sex und Kuscheleinheiten, um die alkoholumnebelten Nächte der Vergangenheit vergessen zu können. Wo er wohl gerade war? Ob er sich auch auf den Abend mit ihr freute?
Selma betrat die Boutique, probierte das Lilienkleid und fand sich darin atemberaubend schön und sexy. Der Preis versetzte ihr allerdings einen Dämpfer, aber er hielt sie nicht davon ab, das Kleid mit ihrer Kreditkarte zu bezahlen.
Selma kam am Café School friend vorbei. Eine kleine Gruppe Schüler diskutierte dort heftig miteinander. Unter ihnen war auch Katharina Gavaldo. Selma blieb einen Moment stehen und beobachtete die Clique durch die Fensterscheibe. Beim Anblick der Schüler fräste sich ein Bild ihrer eigenen Schulzeit in Selmas Kopf. Sie schmunzelte und wollte gerade weitergehen, als Katharina unverhofft aufblickte. Ihre Blicke trafen sich durch das Glas.
Selmas Herz hämmerte. Worte wie eisig und ungezogen kamen ihr in den Sinn. Für einen Moment starrte sie in diese Winteraugen. Sie drückten unbeschreibliche Kälte und Leere, eine Trostlosigkeit jenseits der Verzweiflung aus. Als hätte jemand einen Vorhang weggerissen, sah Selma tief in einen Abgrund des Bösen.
Niemand, dachte Selma, darf einen solchen Ausdruck in den Augen haben, schon gar nicht eine Sechzehnjährige.
Ihr wurde mit einmal bewusst, dass Katharina in ihrem Hass auf die Welt eine Gefangene war. Aber das ging Selma nichts an. So wie das Verhältnis des Mädchens zu seinen Eltern sie nichts anging.
Selma ging weiter, ließ sich vom nächsten Schaufenster ablenken und dachte an den bevorstehenden Abend.
Eine Beziehung mit einem netten Mann ist alles, was ich mir wünsche. Vielleicht würde sie danach auch gnädiger mit ihren Schülern sein. Liebe soll ja Wunder bewirken.
Am späten Nachmittag hörte sie von ihm.
Es war kurz vor fünf, als eine SMS kam. Sie erkannte seine Nummer und war erleichtert. In einem kleinen Winkel ihres Hinterkopfs hatte sie sich schon gefragt, ob sie je wieder von ihm hören würde.
Lächelnd ließ sie sich die SMS anzeigen. Schaff’s heute Abend nicht. Ist was dazwischengekommen. Melde mich.
Die Worte wirkten wie eine Ohrfeige. Einen Augenblick lang war sie bestürzt. Dann wütend. Was war das für ein Spielchen? In letzter Minute abzusagen. Ihr auf der Nase herumzutanzen. Was dazwischengekommen – na bravo. Verbrachte er den Abend mit einer anderen? Vermutlich hatte er eine Jüngere abgeschleppt. Dann war es also nur eine Bettgeschichte gewesen?
Trotzdem, er hatte sie doch gemocht. Sie für etwas Besonderes gehalten. Das hatte sie instinktiv gespürt, und im Hinblick auf Männer irrte sich ihr Instinkt nie.
Oder doch?
Oh, Selma, komm zu dir! Hör auf zu plärren wie ein Kleinkind! Wenn er dich verletzt hat, dann sorge dafür, dass es ihm leidtut.
Aber er hatte sie nicht verletzt. Höchstens ihren Stolz, aber nicht ihre Gefühle.
Sie schüttelte sich wie der sprichwörtliche nasse Hund und setzte sich an den Schreibtisch.
Diese Schlampe!
Manchmal träume ich mehrere Nächte hintereinander von dir. In meinen Träumen habe dich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen – das ist eine lange Zeit. Wenn du jemanden über einen so langen Zeitraum nicht gesehen hast, verblassen selbst die persönlichsten Erinnerungen. Du weißt am Ende nicht mehr genau, was für eine Stimme oder welchen Augenausdruck der betreffende Mensch hatte. Aber du bist kein Traum, sondern mir immer vollständig gegenwärtig.
In meinen Träumen trägst du mein grünes Cocktailkleid mit der wunderschönen Blüte. Das Kleid ist viel zu fröhlich, viel zu weltlich, viel zu provokant, sagst du. Und dass ich das Kleid in den Sack für die Armen geben soll. Vielleicht hättest du es aber auch am liebsten gesehen, wenn ich es gleich ganz zerschnitten hätte, weil er seine Verabredung mit mir nicht eingehalten hat. Mein schönes Kleid ist dir ein Dorn im Auge, aber der Kampf um dieses Kleidungsstück ist einer, den du nicht gewinnen wirst. Du begehrst ganz offen gegen meine Ansichten auf und forderst mich mit fragwürdiger Absicht heraus. Das passiert so oft, und es sitzt auch. Um das grüne Bustierkleid dreht sich einer der Konflikte, die du mit dir austrägst und bei denen du mir die ganze Abscheulichkeit deines Wesens offenbarst. Dein einziges Zugeständnis in diesem Streit ist, dass du alles zerstören möchtest, was mir etwas bedeutet. All das wirst du mir eines Tages gestehen. Und mehr. Da bin ich mir sicher.
Was mir gefällt, verabscheust du. Und wenn er mir ein Kompliment macht, dann passt er auf, dass du dich nicht in der Nähe aufhältst und seine Worte nicht hören kannst. Du bist außer dir vor Wut, wenn ich mit diesem Mann allein sein möchte.
Du fragst dich, wer ich bin und warum ich dir das alles schreibe? Du wirst es niemals erfahren, denn du bekommst keine Gelegenheit, zu nah an mich heranzukommen.
Ich hasse dich, denn du wurdest in der Hölle gezeugt. Das Hemd des Teufels ein winziges Stück hoch, die Hose ein ebenso winziges Stück runter. Und selbstverständlich im Dunkeln und verborgen unter Decken von Hitze, Schmutz und Fäulnis und mit dem Speer der Verdammnis.
Wenn ich von dir träume, fehlen mir die Worte des Hasses. Mir fehlt jegliches Gefühl für dich. Ich bin, was dich betrifft, erkaltet. Ich sehe dich vor mir, wenn du aus purer Lust an der Provokation mit der Bürste deine langen Haare glattstreichst. Ich habe kurzes Haar. Frauen mit kurzgeschnittenem Haar sind peinlich, hast du mal gesagt, und sähen aus wie Männer. Und kurze Röcke dürfen nur junge Mädchen tragen. Frauen, die kurze Röcke tragen, sähen aus wie Huren. Du Schlampe lässt mich jeden Tag aufs Neue spüren, dass ich eine sündige, alte Schachtel bin. Dass die Welt durchweg aus Versuchungen bestünde, aber Menschen wie ich hätten den Lebensauftrag, dem zu widerstehen.
Weißt du, Schätzchen, ich benehme mich gern sündig. Ob es dir nun passt oder nicht. Ich küsse in der Öffentlichkeit, mein Freund wiegt mich im Park in den Armen, hört mir immer zu, wenn ich von der Schlampe in der Schule erzähle. Ich bin glücklich. Meine Augen strahlen, ich lache und werde geliebt. Ich trage kurze Röcke, weil ich ansehnliche Beine habe. Zuhause zeige ich ihm, wie man Apfelkuchen und gefüllten Spekulatius backt. Mein Freund bringt mir Geschenke, flüstert mir zärtliche Worte ins Ohr.
In einem anderen Traum behält er dabei die Wohnzimmertür im Auge, weil du hereinkommen könntest. In diesem Traum lehne ich mich auf. An dieser Stelle zerspringe ich fast vor Wut. Wir müssen leise sein, sagt mein Freund dann. Du seist unberechenbar.
Wie bitte? Ich soll dich nicht wütend machen, mich zurückhalten? Und warum? Was kann mir so eine widerwärtige Schlampe schon anhaben, die eine neunschwänzige Katze braucht, um ihren Willen durchzusetzen? Woher ich das weiß? Ich weiß es eben! Warum sollte ich Angst vor einer dummen Zicke haben, einer pubertierenden Sprücheklopferin ohne Moral? Ohne jede Achtung vor Menschen? Wer weiß, vielleicht warst du in einem früheren Leben eine Art Medusa. Gut möglich. Deine große Mundpartie mit zahlreichen, oft spitzen Zähnen und der heraushängenden Zunge kennzeichnet zu oft das wutverzerrte Gesicht einer Medusa.
Du bist eine Psychopathin, die ganze Scharen von Mitmenschen verbal abschlachtet. Ich hasse dich, halte mir in Gedanken die Ohren zu, wenn ich deine Stimme höre, oder kotze innerlich vor Entsetzen, wenn du mich bedrohst. Aber einfach weghören ist nicht möglich oder an gut schmeckende Sachen denken, wie heiße Schokolade mit Schlagsahne. Ich versuche krampfhaft, den Rat meiner inneren Stimme zu befolgen, doch oft genug zerschlägt deine donnernde Stimme dieses kleine gedankliche Ablenkungsmanöver.
Wieso dich, du Schlampe, also nicht zur Weißglut bringen? Ich hätte dir viel häufiger widersprechen sollen. Ich hätte dich eher offen auslachen sollen. Hätte deine dämlichen Sprüche durch den Kakao ziehen sollen. Dich anzweifeln sollen. Mich öffentlich von dir abwenden sollen. Ich hätte dir unmissverständlich zeigen sollen, dass du mir nichts vormachen kannst, du Missgeburt der Hölle.
Asche zu Asche, sagt der Pfarrer oft auf einer Beerdigung. Werden wir zu Asche, wenn wir tot sind oder ist es eben diese Asche, die verstreut wird, woraus sich ein Geist bildet, der sich in einen anderen Körper nistet wie eine Eizelle in die Gebärmutter? So wird es wohl sein, denn sonst wärst du nicht auf dieser Welt und das alles wäre nicht geschehen. Die Eizelle wuchs zu einem Embryo heran, dann zum Fötus. Du bist die Wiedergeburt des Teufels, sonst kann ich es mir nicht erklären. Du bist entstanden aus dem Bösen. Wie lange, denkst du, kann ich es noch aushalten, dich anzusehen? Dich zu hören? Dich zu riechen? Dich zu ertragen?
Wie lange noch? Nimm dich bloß in Acht!
Zwei Stunden später. Selma lungerte in einer Bar herum. Männer und Frauen ihres Alters standen gruppenweise herum. Im Hintergrund lief Popmusik der 80er Jahre. Sie nippte an ihrem Weinglas, wiegte sich im Takt der Musik und spürte die Männerblicke, die ihren Körper taxierten. Es war ein gutes Gefühl. Hinter ihr sah sie eine Frau, die sie neidisch musterte. Dieses Gefühl war noch besser.
Ein Mann spendierte ihr einen Drink. Cooler Typ. Das gleiche arrogante, gute Aussehen, das gleiche selbstzufriedene Gebaren wie der Mann, der sie versetzt hatte. Aber er war da, und sie brauchte nur „ja“ zu signalisieren. Wie bei jedem Mann, der auf einen One-Night-Stand aus war.
Ja, schrie ihr Körper.
Eher würde die Hölle zufrieren.
Sie sprach mit dem Mann, in flirtendem Tonfall und wiegte sich dabei im Takt der Musik.
Kapitel 16
Katharina
Katharina ging durch das Zentrum von Starnberg zur Buchhandlung in der Passage. Sie hatte einen Büchergutschein in der Tasche, ein Geschenk ihrer Mutter, mit dem sie eine Biographie über Fouché, den Polizeipräfekten von Paris, kaufen wollte. Im Geschichtsunterricht behandelten sie gerade die Französische Revolution – das Leben dieses abgrundtief bösen Intriganten fesselte sie. Vor der Passage stand eine junge Straßenmusikantin und sang mit kräftiger, klarer Stimme ein Volkslied. Ein paar Leute waren stehen geblieben, um zuzuhören. Sie tat es auch. In dem Moment ging die Tür des benachbarten Zeitungsladens auf und ein Mann trat heraus.
Die Welt hörte auf sich zu drehen.
Der Mann vom Friedhof.
Er blieb vor dem Laden stehen, öffnete eine Packung Zigaretten und zündete sich eine an. Dann wandte er sich ab und ging davon. Sie wollte ihm nachlaufen, stand aber wie angewurzelt da und öffnete den Mund. Wollte ihn rufen, aber sie kannte seinen Namen nicht. Sie konnte nur dastehen und ihm nachschauen, bewegungslos wie eine Statue, während sie innerlich nach einer Unterhaltung mit ihm schrie.
Als eine Frau sich an ihr vorbeidrängte, löste sich der Bann. „Hey! Du! Bleib stehen!“
Er hörte sie nicht, sondern ging einfach weiter. Sie rannte ihm nach, kämpfte sich durch die Menge und hätte beinahe jemanden umgerannt, ohne es zu merken. Sie sah niemanden, nur ihn. Wenn sie ihn jetzt nicht einholte, würde er sich im Nebel auflösen wie an jenem Abend.
„Warte auf mich! Bitte!“
Er hörte sie immer noch nicht. Sie streckte die Hand aus und packte seine Jacke. Als er sich umdrehte, lächelte er.
„Ich wusste, dass ich dich eines Tages wiedersehen würde“, sagte sie. „Ich wusste, dass es dich gibt.“
Wieder nur ein geheimnisvolles Lächeln. „Ich habe mein ganzes Leben von dir geträumt. Wir kennen uns seit Ewigkeiten. Ich dich und du mich. In unseren Visionen sind wir uns immer wieder begegnet.“
Katharina reichte ihm die Hand. Sie war fassungslos vor Glück. „Bist du es, der mir sagen wird, dass wir zusammengehören?“
„Hast du das auch gesehen?“, fragte er.
Sie nickte. „Ja.“
„Ich bin Baan. Wie ist dein Name?“ Seine Stimme hatte nicht die leiseste Spur eines bayrischen Akzents.
Sie hielt seine Hände umklammert. „Ich bin Katharina.“
In seinem Gesichtsausdruck lag eine Mischung aus Freude und Neugierde. „Wollen wir ins Café gehen und uns kennenlernen? Ich habe dir viel zu erzählen.“
Sie konnte nur nicken. „Ich dir auch“, flüsterte sie.
„Komm, dann lass uns gehen!“ Die Worte klangen zärtlich, aber bestimmend, als würden sie den Rest ihrer beider Leben miteinander verbringen.
Sie schloss einen Moment die Augen und öffnete sie wieder. Niemand war zu sehen. Kein Baan, der mit ihr einen Kaffee trinken wollte, nur einige Passanten, die ihr Selbstgespräch mitbekommen hatten. Sie wurde ausgelacht. Alle lachten. Alle hatten ihren Spaß.
Wo bist du, Baan?
Sie war vollkommen verwirrt. Eine Frau sah sie besorgt an. „Du weinst ja. Es ist überhaupt nicht in Ordnung.“
Freundliche Worte, dachte Katharina. Aber sie trösteten sie nicht. Vielleicht war es ein Trick, um sie dazu zu bringen, noch mehr zur allgemeinen Belustigung beizutragen.
„Mir fehlt nichts“, flüsterte sie. „Es ist gar nichts.“
Und dann war sie es, die sich einfach umdrehte und wegging.
Zehn Minuten später saß sie auf einer Bank in einem kleinen Park und starrte vor sich auf den Boden. Der Park war leer. An manchen Nachmittagen tummelten sich hier Scharen von Teenagern, aber jetzt wurde es dunkel und niemand war da. Sie weinte, konnte einfach nicht aufhören. Die Sehnsucht nach dem jungen Mann hatte ihr eine weitere Vision beschert und dieses Mal in der Öffentlichkeit. Das war noch nie geschehen. Bislang war alles ein beherrschbarer Wunsch gewesen, aber jetzt brannte die Sehnsucht wie eine offene Wunde und sie glaubte, ihr Herz müsse zerreißen. Sie wünschte, sie wäre nach der Schule gleich nach Hause gegangen. Sie wünschte, sie hätte nicht solches Aufsehen erregt. Sie wünschte …
Wünsche. Lauter Wünsche. Ihr ganzes Leben war eine einzige Vision voller Wünsche. Aber Wünsche brauchten einen Zauber, und es gab keinen Zauber, der stark genug war, um auch nur den kleinsten Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen.
Ein Geräusch drang in ihre Gedanken. Das Surren von Schritten auf Asphalt. Wieder spürte sie, dass er da war. Seine Präsenz hatte von ihr Besitz ergriffen wie ein tiefer Ton, den man mehr mit dem Kopf wahrnahm. Alle Körperhärchen stellten sich auf.
Sie lehnte sich zurück, machte kurz die Augen zu, versuchte nachzudenken, sich alles ins Gedächtnis zu rufen, was sie heute glaubte erlebt zu haben. Sie öffnete die Augen. Ein Jogger kam auf sie zu. Als sie aufblickte, sah sie, dass er es war.
Seine Stimme durchbrach die Stille. „Hey.“
Sie erhob sich von der Bank und nun standen sie sich gegenüber. Zwei junge Menschen, die sich zum zweiten Mal begegneten und keine Rituale vollzogen, die ein solcher Anlass erforderte: kein Händeschütteln, kein Austausch von Namen, kein Überspielen aller negativen Gefühle, die ihre Begegnung unter Umständen hervorrief.
Nur ein einfaches „Hey“.
Kapitel 17
Baan
Baan sah das Mädchen an, das fast genauso groß war wie er und noch schöner als in seiner Erinnerung. Schön genug, um arrogant zu sein. Seiner Erfahrung nach waren alle hübschen Mädchen arrogant, weil sie sich einbildeten, jeden Jungen, der ihnen gefiel, mit einem Lächeln gewinnen zu können. Aber nicht ihn. Er würde niemals ein Mädchen begehren können, in dessen Gesicht ihn nichts an seinen Vater erinnerte.
Ihre Augen hatten manchmal die Farbe von violettfarbenen Veilchen, obwohl die blau waren, sie wirkten unergründlich und gefährlich. Ein Mann, der nicht aufpasste, lief Gefahr sich in solchen Augen für immer zu verlieren. Aber nicht er. Gelassen erwiderte er ihren Blick, weil er sicher war, immun zu sein gegen ihre Macht.
Und plötzlich wusste er es.
Es war wie ein elektrischer Schlag in seinem Gehirn. Die absolute Gewissheit, die ihn von einer Sekunde auf die andere überkam, hatte nichts mit Logik oder Vernunft zu tun. Es handelte sich dabei um etwas weitaus Primitiveres – um einen rein animalischen Instinkt.
Du bist wie ich.
„Warum weinst du, Katharina?“
„Ich weine nicht.“
„Doch, du weinst. Du hast doch auf mich gewartet.“
Sie blinzelte und wischte sich über die Augen. „Verschwinde! Du bist eine Vision. Keine Realität!“
„Ich bin real. Wir haben uns am Friedhof getroffen, erinnerst du dich?“
„Lass mich in Ruhe.“
„Soll ich dich kneifen, Katharina?“
Sie blickte sich um. Verdammt, er war real. „Du kennst meinen Namen? Wer bist du?“
„Baan.“ Er versetzte ihr einen kleinen Schubs, dann lächelte er. „Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen.“
Und plötzlich geschah es. Die Sehnsucht, die sich im Laufe der Jahre in ihr aufgestaut hatte, brach sich Bahn wie flüssige Lava und nahm sie vollständig in Besitz. Mit einem Schrei klopfte sie ihm mit der Faust auf die Brust.
„Wo warst du all die Jahre?“, fragte sie und schloss die Augen. Gleich ist er wieder fort, dachte sie.
„Augen auf!“
Seine Stimme … Sie gehorchte.
Baan grinste. „Ich wollte absolut sicher sein, dass du tatsächlich das Mädchen in meinen Visionen bist.“
Katharina war erleichtert und es war ein verdammt gutes Gefühl. Unglaublich gut.
„Bist du dir jetzt sicher, Baan?“
Baan schaute zur Seite. „Wusstest du, Katharina, dass wir zusammengehören?“
„Ich weiß es, aber ich kenne den Grund nicht. Darauf geben Visionen keine Antwort. Ich sehe etwas, spüre etwas, aber warum es so ist, weiß ich nicht.“
„Ich erkläre es dir, wenn du es möchtest.“
Die Zeit verging. Sie blieben auf der Bank sitzen. Baan erzählte ihr seine Geschichte, bis die Nacht den letzten Schimmer des Lichts verschluckte. Er erzählte ihr von seinen Träumen, von dem Haus seines Vaters in Starnberg, das eine Firma in seinem Auftrag renoviert hatte, von den Gegenständen, die er vor einigen Tagen in den Keller geschleppt hatte: terrakottabraune Farbe, schwarze Kohlestifte und Einweckgläser in verschiedenen Größen, einen runden Tisch, zwei Eimer, große Kerzen, Plastiksäcke und Einwegschürzen. Im Stahlschrank bewahrte er einen Kanister Formaldehyd auf, ein Jagd- und Ausbeinmesser, eine Präzisionssäge, und verschiedene brasilianische Kräuter und Peyote-Pilze. Er erzählte Katharina, dass er fror, nicht nur im Keller. Dass die Wärme Brasiliens ihm noch in den Knochen steckte. Dass er ihr unbedingt das Arkanum zeigen wollte. Er verschwieg, dass das Haus seines Vaters etwas in ihm ausgelöst hatte, das er nicht kontrollieren konnte: Wut, Hass, Verzweiflung. Stattdessen sprach er von seiner Sehnsucht nach dem Mädchen in seinen Visionen, von Liebe.
Danach gingen sie Hand in Hand in ein Café. Katharina hielt den Kopf hoch und ihre Schultern gerade, nicht wie vor der Begegnung. Sie war groß, aber einen Kopf kleiner als er, ihre Figur versprach so gut wie die ihrer Mutter zu werden. Ihr Gang, früher hastig und nervös, war jetzt langsamer und sicherer. Sie hatte sogar einen leichten Hüftschwung. Sie hat in den vergangenen Wochen gelernt, ihren Körper zu beherrschen, dachte er, und sich zu bewegen wie eine Göttin. Und war sich dessen bewusst. Sie ging neben ihm her, bewegte sich wie ein Mädchen, das nach einem Schlummer plötzlich zum Leben erwacht war. Beim Abschied lud er sie in sein Haus ein.
Kapitel 18
Katharina
Die Schüler saßen im überfüllten Kunsterziehungsraum um einen Tisch herum, auf dem Bücher, Früchte und eine Glaskugel kunstvoll arrangiert waren. Bleistifte kratzten übers Papier, während der ortsansässige Maler die Techniken des Stilllebens erklärte, und Selma Wagenknecht die Klasse immer wieder daran erinnerte, wie glücklich sie sich schätzen konnte, einen so berühmten Gast in ihrer Mitte zu haben.
Katharina saß ziemlich weit hinten und starrte gedankenverloren ins Leere. Vor ihrem geistigen Auge lief der Film ab, in dem die Wagenknecht Nacht für Nacht wach lag und mit ängstlich klopfendem Herzen und trockener Kehle auf Schritte wartete und die Schatten vor dem Fenster.
Selma Wagenknecht soll Angst und Verzweiflung spüren, dachte Katharina.
Verzweiflung, weil sie ihren Willen nicht bekam, und Wut auf die Wagenknecht, die ihr schlechte Noten gab, waren Emotionen, die Katharina so gut zu verstehen gelernt hatte, dass sie ihr willkommen waren. Seit ihrer Begegnung mit Baan spürte Katharina aber nur noch eine seltsame Ruhe, die fast zu einer anderen Person zu gehören schien – einer Person, die keine Zeit für Zweifel hatte. Sie war bis über beide Ohren in Baan verliebt. Alles lag so klar auf der Hand wie in ihren Visionen. Was die Wagenknecht betraf, so hatte sie einen Plan und wusste, was zu tun war.
Die Zeit verging. Sie starrte weiter auf die Leinwand in ihrem Inneren, ohne zu merken, dass ihre Hand den Bleistift übers Papier bewegte, als wäre sie ein Medium.
Nachdem ihre Lehrerin sie aufgefordert hatte, zu einem Ende zu kommen, ging der Maler von Tisch zu Tisch und gab zu jeder Zeichnung einen Kommentar ab. Als er ihren Versuch sah, runzelte er die Stirn. „Was soll denn das sein?“
„Ich weiß es nicht“, antwortete Katharina.
„Es sieht aus wie ein Kreuz“, erwiderte der Künstler.
„Dann wird es wohl eines sein.“ Ihre Stimme klang ausdruckslos und abwesend.
„Warum hast du dich denn nicht an das gestellte Thema gehalten?“
„Ich habe keinen Sinn darin gesehen.“
„Warum nicht?“
„Weil ich nach meinem Schulabschluss als Prostituierte arbeiten werde und sich in dieser Branche niemand dafür interessiert, ob man eine anständige Obstschale zeichnen kann oder nicht.“
Alle im Raum holten tief Luft, dann folgte lautes Gelächter.
„Zum Rektor mit dir, aber auf der Stelle!“, rief Selma Wagenknecht.
Zwanzig Minuten später trat Katharina in den Nachmittag hinaus. Die Klasse stand in Grüppchen auf der Eingangstreppe. Bei ihrem Anblick verstummten alle Gespräche. Ellen kam auf sie zu. „Was haben sie mit dir gemacht?“
„Ich bin für eine Woche vom Unterricht ausgeschlossen. Aber ich habe dem Rektor von den schlechten Noten erzählt und er hat mir versprochen, sich die Arbeiten anzusehen. Er sagte auch, dass er im Gegenzug von mir erwartet, dass ich mich nicht mehr daneben benehmen und mich normal verhalten soll.“ Sie seufzte. „Normal. Was ist schon normal?“
Während die anderen sie anstarrten und flüsternd Kommentare darüber abgaben, begann sie zu lachen. Es war ihr so egal, wie sonst was.
„Das ist nicht lustig, Katharina!“
„Nein?“
„Warum benimmst du dich so?“
„Vielleicht bin ich besessen.“
„Wovon redest du?“
„Ich hasse diese Missgeburt von Wagenknecht. Sie ist unfair!“
Ellen wirkte ziemlich irritiert. „Was werden deine Eltern zu dem Verweis sagen?“
„Meine Mutter wird das sagen, was mein Vater ihr einredet. Aber wahrscheinlich interessiert sie das Ganze gar nicht. Sie haben zur Zeit anderes im Kopf.“
„Was denn …?“
„Meine Mutter bekommt ein Baby.“
„Hey, das ist doch cool.“
Katharina sah Ellen erstaunt an. „Das findest du cool? Babys schreien den ganzen Tag, scheißen die Windeln voll und das ganze Haus stinkt nach ihrer Bäuerchenkotze. Und nach Babypuder. Das ist nicht cool!“
Ellen schaute sie entsetzt an. „Beruhige dich!“
„Ich muss los. Hab eine Verabredung“, sagte sie hastig und ließ Ellen einfach stehen.
Baan wartete an der Friedhofskapelle. Sie reichte ihm ihre Zeichnung. „Das ist für dich.“
Er lachte laut auf. „Warum hast du mich gezeichnet?“
„Weil ich dich interessant finde.“
„Ich bin also ein schwarzes Kreuz für dich?“
„Manchmal, in meinen Visionen.“
Baan überlegte kurz. „Ich glaube, ich verstehe deine Zeichnung. Du arbeitest in einem Beerdigungsinstitut neben einem Friedhof. Das würde das Kreuz erklären. Die Schwärze darin symbolisiert meine Augenfarbe. Ist doch perfekt!“
Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn auf den Mund. „Holst du mich später ab? Wir haben eine neue Leiche und ich habe Lukas Käfer versprochen, sie aufzuhübschen.“
„Wenn du das möchtest, hole ich dich ab.“
„Ich muss dir einiges erzählen, Baan, und ich brauche deine Hilfe.“ Sie nahm ihre Zeichnung, riss sie entzwei und ließ die beiden Teile auf den Boden segeln. „Die Wagenknecht hat mich gestern wieder grundlos angegriffen. Es war richtig beängstigend“, log sie.
„Das glaube ich.“ Er machte einen betroffenen Eindruck. „Erzähl mir, wie es dazu gekommen ist…“
„Später.“
Baan lächelte und spielte kurz mit ihrem Haar.
Ein letzter Kuss. Ein Lächeln. Dann steuerte er auf das Friedhofstor zu.
Ein ganz wundervolles Lächeln, dachte sie und empfand wieder diese seltsame Ruhe und ein Flattern in der Magengegend.
Kapitel 19
Katharina
Ihre Mutter war mal wieder ausgeflogen. Aber das machte nichts. Sie wollte ihr gewiss nicht von Baan erzählen. Noch nicht. Sie wollte keine Unterstützung von ihr. Sie wollte ihr überhaupt nichts mehr erzählen oder ihrem Vater. Ihre Eltern waren ein Überbleibsel eines Lebens, das jemand anderes geführt hatte – wenn es die Bezeichnung Leben überhaupt verdiente.
Sie zog die obere Schublade auf und nahm ihr Tagebuch heraus. Das Tagebuch dieser großartigen Person, deren Eintragungen niemals aus Winseln um Liebe, aber aus Träumen von einem Mann bestanden hatte. Sie war kein schwächliches Geschöpf, sondern hatte begriffen, dass der Zauber von innen kam. Dass er aus Wut bestand – auf ihre Eltern, auf ihre Lehrerin und aus der Kraft, die sie daraus schöpfte, nie wieder jemanden zu brauchen. Sie hasste schwache Menschen. Und sie hasste die Wagenknecht mehr als irgendjemanden sonst auf der Welt.
Die Zeiten änderten sich. Die Epoche der Zurückhaltung ging zu Ende. Sie würde der Wagenknecht einen Denkzettel verpassen. Die Königin ist tot, lang lebe die Königin.
Sie nahm den Stift und begann zu schreiben.
Die Wagenknecht macht mich mürbe. Sie redet ständig auf mich ein. Sie lässt einfach nicht locker. Folgt mir auf Schritt und Tritt, zerrt an meinen Nerven. Es ist zu viel. Ich weiß nicht, warum sie so behämmert ist. Meine Kopfschmerzen sind mittlerweile so intensiv, dass ich immer wieder kleine Lichtblitze durch mein Gesichtsfeld flackern sehe. Meine Nerven liegen blank. Aber ich fühle, dass sich Risse im Kopf der Wagenknecht bilden.
Ich weiß, dass es mich nicht freuen sollte. Ich bin nicht in der Schule, um boshaft zu sein. Ich bin hier, um zu tun, was zu tun ist. Ich stehe auf der richtigen Seite. Das weiß ich. Aber etwas rührt sich in mir, etwas tief drinnen. Lange wusste ich nicht, was es ist. Doch langsam wird es mir klar. Es macht mir Spaß. Es macht mir Spaß, die Wagenknecht verzweifelt zu sehen. Ja, sie verdient es, denke ich. Ja, es gefällt mir, ihre Verzweiflung zu sehen. Aber ich darf mich nicht von meinen Gefühlen leiten lassen. Ich habe Baan von ihr erzählt, weil ich keine Lust habe, mich länger zu gedulden. Ich möchte diese Sache mit ihr zu Ende bringen.
Mit aller Kraft versuche ich mich zu beruhigen. Ich fürchte mich vor meiner inneren Wut. Fürchte mich vor mir selbst. Wenn ich das nächste Mal die Kontrolle verliere, wird mehr zu Bruch gehen als nur die Kristallgläser meiner Mutter.
Eines Tages werde ich jemand sein. Eines Tages werde ich Macht haben und berühmt sein, und jeder wird meinen Namen kennen. Die Zeitungen werden über mich schreiben und jedem, der mich verletzt oder verachtet, werde ich Angst einflößen. Mein Vater wird mich dann wieder auf Händen tragen und stolz auf mich sein. Er wird angekrochen kommen und mich anflehen, ihm zu verzeihen, dass er mich Lilith genannt hat. Und Mom? Sie ist ein armes Huhn, bereit für den Suppentopf.
Baan liebt mich schon jetzt, sagt er. Baan wird mich niemals verlassen. Er wird alles tun, was ich von ihm verlange, behauptet er. Selbst töten, wenn es sein muss, nur damit er in meinem Leben bleiben darf. Was immer dazu nötig ist.
Wir werden uns wegen der Wagenknecht etwas einfallen lassen.
Kapitel 20
Selma
Ihr Körper glitt langsam nach unten, während jedes Bild in ihrem Kopf verwässerte. Feuchter Sand rieb an ihrer Wange. Ein nasses Blatt blieb an ihrem Mund kleben. Sie würgte und spuckte und versuchte sich aufzurichten. Ihre Beine waren noch zu schwer und kaum in der Lage, ihr Gewicht zu tragen. Selma schlug um sich, gegen alles, was sie neben sich spürte. Hart und völlig unkontrolliert. Alles schmerzte, aber sie konnte nicht aufhören. Der innere Schmerz war zu groß.
Mit Schlägen wollte sie einen Körper zerstören. Er war schlecht, so durch und durch schlecht. Das Schlimmste aber war, dass sie Katharina Gavaldo nie durchschaut hatte. Zerstören wollte sie dieses Monster. Sie brechen. Für immer. Tot sollte sie sein, wie die Natur im Winter. Nur noch ein einziges Aufbäumen, mit letzter Kraft. Dann lag Katharina vor ihr auf dem Boden und das nasse Grau färbte sich rot. Was würde es schon ausmachen, wenn es das Mädchen nicht mehr gäbe? Nichts wäre damit verloren. Sein Tod würde ihr den ersehnten Seelenfrieden bringen.
„Niemals! Nein, niemals wirst du mich brechen können. Eher bringe ich dich um! Hörst du mich? Du bist nicht mehr sicher!“, hatte sie geschrien.
Sie wiederholte krächzend die Worte, erkannte ihre eigene Stimme kaum wieder. Der Alkohol hatte ihr Hirn umnebelt. Hatte sie das wirklich gesagt? Sie war verwirrt, hatte Schwierigkeiten, die Wirklichkeit wahrzunehmen. Nein! Niemals. Das würde sie nie tun. Doch! Sie hatte es zu Katharina gesagt. In dieser Bar! So musste es gewesen sein! Oh mein Gott. Vermutlich hatten sie alle ihre Handys gezückt und sie im Vollrausch fotografiert.
Ein Geräusch. Wurde da irgendwo eine Tür geöffnet? Selma versuchte ihren Kopf zu heben, aber ihr Gehirn ließ die Welt um sie herum seltsam kreisen. Der Alkohol übernahm wieder die Kontrolle.
Katharina. Nur wegen der kleinen Schlampe war sie in diesem Zustand. Die Gavaldo wollte sie auf grausame Weise vernichten. Ihre Albträume mit ihr beherrschten Selmas Nächte, kamen, gingen, kamen wieder. In ihnen starb Katharina und stand wieder auf. Sie konnte die Gedanken an sie nicht ausblenden, besonders nicht in der Nacht. Bestimmt war Katharina es gewesen, die in ihrem Haus eine Botschaft für sie hinterlassen hatte: Ich werde dich töten!
Katharina hatte Hass und Wut genährt und suchte ein Ventil. Sie wollte es zu Ende bringen und sie töten, sie wollte die totale Vernichtung. Selma konnte es fühlen.
Aber was machte sie dann hier? Wie war sie hierhergekommen?
Selma tastete um sich und spürte, dass sich etwas Scharfkantiges in ihre Handinnenfläche bohrte. Der Schmerz ließ sie aufschreien. Sie zog einen rostigen Nagel aus ihrer Hand.
Es war eine Offenbarung, dass sie den körperlichen Schmerz so leicht ertrug. Er war in keiner Weise vergleichbar mit der Qual, die ihr leeres Herz sprengte. Einst war da Gefühl gewesen, lautes pochendes Verlangen und Sehnsüchte. Vor Katharina, als sie so unbeschwert gewesen war. Jetzt war da nichts mehr.
Den Nagel noch immer fest in der unverletzten Hand, schlug Selma erneut um sich und verfing sich in dem Efeu, der an der feuchten Mauer entlang des Ufers emporkletterte. Die dicken Verzweigungen beeinträchtigen sie und schränkten ihre Bewegungen ein.
Selma versuchte sich zu erinnern. Sie war zum dritten Mal in dieser Bar gewesen, hatte getrunken, getanzt, mit einem Mann gesprochen. Er hatte dunkle Augen gehabt. Plötzlich war Katharina aufgetaucht. Oder hatte der Wein ihr eine Halluzination beschert? Und danach … Was war danach?
„Lass mich los“, flüsterte sie, während sie sich immer machtloser fühlte gegen alles, was mit dem Mädchen zu tun hatte. Ihre Muskeln gehorchten ihr immer noch nicht richtig. Sie bewegte sich entlang der Mauer weiter und behielt dabei ängstlich den Abgrund im Auge.
Da unten war es kalt, schmutzig und vor allem dunkel. Der aufsteigende Geruch von Moos und faulendem Laub war alles andere als eine barmherzige Begrüßung. Sobald Selma ihre Augen schloss, drehte sich alles um sie herum. Dunkle Schleier waberten leise und still und verhüllten gewohnte Umrisse. Da war dieses rohe Gefühl in ihr, verbunden mit dem Gesicht dieses Mädchens. Ertönte gerade Katharinas schrille Stimme aus der vergangenen Nacht? Schauten diese dunklen Augen sie wieder an?
„Katharina …?“ Ein Flüstern. Sie wollte nicht hinsehen, wollte den Blick abwenden. Ich möchte sterben, aufwachen und wieder sterben.
Da! Ein Rascheln, leise und kaum hörbar.
„Geh weg! Verschwinde von hier!“
Ein Wimmern aus der Tiefe des Starnberger Sees.
„Hau ab! Du bist tot!“
Weggehen? Nie. Ihre Augen versuchten erneut die Bilder der Vergangenheit zu erfassen. Diese Furie warf ihr gewiss einen verächtlichen Blick zu. Sie kannte diesen Blick. Immer dann, wenn sie in ihren Träumen seelisch brutal vergewaltigt auf dem Boden lag, stand Katharina da und sah auf ihre geschändete Seele herab.
O Selma … Wieso erträgst du das nur? Du hast dich zu oft in Tränen ertränkt. Und nun wieder in Alkohol.
Der klammernde Griff ihrer Hand gab den des Efeus frei. In plötzlich aufwallender Wut stach sie mit dem Nagel um sich, hinein in die Dunkelheit, die sie umgab. Etwas Weiches fing ihn auf. Noch einmal. Ein weiteres Mal. Immer wieder stach sie zu.
„Du hast es verdient.“ Das heisere Flüstern ihrer Stimme.
Dann verebbte ihr Zorn, bis sie sich nicht mehr vorstellen konnte, dass die zügellose Wut sie dermaßen überwältigt hatte. Der Wunsch, weiter auf Katharina einzustechen, war schlagartig vorüber. Ihr wurde wieder bewusst, dass sie allein war.
Selma kletterte aus den Trümmern ihrer vagen Erinnerungen hervor, setzte sich Stück für Stück wieder zusammen und legte ihre Hände auf ihr Gesicht, als versuchte sie, sich vor Katharinas Blicken zu schützen. Auch sollte niemand sie weinen sehen.
Wie kam sie jetzt nach Hause? Wie war sie hierhergekommen?
Seltsam. Es war plötzlich so still. Niemand war in ihrer Nähe, nur diese verwirrenden Nebelschleier. Wieder fragte sie sich, ob der Mann in der Bar vielleicht auch nur eine weitere Wahnvorstellung gewesen war, in der Katharina die Hauptrolle spielte. Sie war es leid, gegen ihre Amnesie anzukämpfen, gegen all das, was ihr angetan worden war. Was irgendjemand ihr antun wollte. Aber niemand würde ihr zuhören, ihr glauben, wie bösartig Schüler sein konnten. Niemand half ihr. Als hätte die ganze Welt sich gegen sie verschworen, mit Katharina als ihrer Anführerin.
Die Schlacht war geschlagen.
Sie war ein Niemand. Ein Freak. Eine Trinkerin. Irgendjemand hatte ihr etwas in ihr Getränk getan. Ganz sicher. Es war die einzige Erklärung für ihren Zustand.
Sie war so müde.
Nur vage spürte sie, dass sich Hände unter ihre Arme schoben, dass jemand sie hochzog und über den Boden schleifte. Keine Reaktion auf ihr „Lass mich los!“ Nur Gekicher. Ihre Füße fanden keinen Halt mehr. Immer nur der harte Boden, über den Selma geschleift wurde.
Schließlich durfte sie sich wieder hinlegen.
Wo bin ich?
Es machte ihr genau genommen nichts aus. Sie wollte nur schlafen. In Ruhe gelassen werden. Sie war zu müde. Doch da waren diese Hände, die an ihrer Kleidung zerrten.
„Lass mich. Was willst du? Du bist tot“, lallte Selma.
Die Antwort waren besitzergreifende Finger an Stellen, die nur ihr allein gehörten. Sie waren wie die lästigen Insekten in einem flimmernden Sommer. Vertreiben half nicht, sie kamen immer wieder.
Selma schloss ihre Augen und verschwand, tauchte ab in ihr inneres Meer. Die gleiche Stille, die sie in den vergangenen Jahren so verflucht hatte, fing sie wieder auf.
Kapitel 21
Selma
Ihre Augen verweigerten den Dienst. Das Einzige, was Selma spürte war eine feuchte Kälte, die sich in ihren Knochen festgesetzt hatte. Ihre kaltgefrorenen Finger ertasteten ihre unmittelbare Umgebung.
Meine Bettdecke fehlt.
Sie lag nicht in ihrem Bett. Als sie ihren Kopf hochheben wollte, wurde er von Tausenden Nägeln auf den Boden getackert, in einem Stakkato-Rhythmus, der Selma an jene Rave-Partys erinnerte, die sie früher besucht hatte. So kam es ihr vor. Ihr war aber nicht nach Party zumute.
Endlich gelang es Selma, ein Auge zu öffnen, die Wimpern ihres anderen Auges waren hartnäckiger. Vielleicht verklebt? Was war geschehen? Das frühe Morgenlicht war schrill, trotz der dichten Wolkendecke, die über ihr hing. Wolken? Wo bin ich?
Ein erster Blick auf ihre Umgebung brachte sie in die harte Realität zurück. Sie befand sich in einer Art Park, den sie nicht sofort erkannte. Das Gras um sie herum war mit Regentropfen übersäht, in denen das Licht sanft schimmerte. Ein Strauch nahm ihr die weitere Sicht, sodass sie sich aufrichten musste. Der Schmerz wachte mit ihr gemeinsam auf. Ihr Körper schrie. An ihren Beinen waren rohe Abschürfungen. Wunden voller Dreck. Zwischen ihren Beinen spürte sie einen stechenden Schmerz. Mit ihrer trockenen Zunge schmeckte sie etwas, was sie in den letzten Monaten zu oft gekostet hatte: Alkohol.
Sie krümmte sich, um der Kälte und dem Schmerz weniger Raum zu geben und zog die Reste ihrer Kleidung über ihren Körper. Durch die Zweige sah sie den Starnberger See, der genauso schmutzig braun war, wie Selma sich fühlte. Dann kam die Erinnerung mit voller Wucht auf sie zu.
Mein Name ist Selma Wagenknecht. Ich bin vierzig Jahre alt. Ich wurde vergangene Nacht vergewaltigt.
Das müsste sie auf einer Polizeidienststelle zu Protokoll geben, sollte sie sich dazu entschließen, Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. Unbekannt? Sie wusste doch, wer sie vergewaltigt hatte.
Nein! Sie wollte nicht über die Dinge nachdenken, die geschehen waren, obwohl die Erinnerungen daran unwiderruflich zurückkehrten. Seine Hände. Die Kraft, gegen die sie nicht ankam. Ihr Unvermögen, ihn aufzuhalten. Die Stille, die ihr half. Jetzt schrie alles in ihr. Schmerz, Schmutz und Erinnerungen, die sie nicht zulassen wollte. Männer waren Tiere.
Selma sah auf ihre Hände. Sie waren mit braunen Krusten übersäht. War das Blut? Die Ärmel ihrer Bluse waren ebenso voll großer, roter Flecken. Sie sah eine Wunde in ihrer Handinnenfläche, die zu bluten begann, jetzt, da sie sie wieder bewegen konnte. Hatte sie so viel Blut verloren?
Behutsam, um die messerstichartigen Schmerzen in ihrem Körper zu minimieren, versuchte Selma aufzustehen. Sie bemerkte erst jetzt, dass sie nur einen Schuh anhatte. In dem Strauch, der ihr in den letzten Stunden Gesellschaft geleistet hatte, hing ein feuchter Lappen. Ihr Mantel.
„Geh langsam“, flüsterte sie.
Ihr Körper protestierte mit Schmerzattacken. Sie zog sich ihren Mantel über und richtete sich auf. Für einen Moment kam die Welt zum Stillstand, als sie sich an dem Stamm eines Baumes festhielt. Wo war der andere Schuh? Ihr Blick schweifte über die Büsche. Nichts. Ein einzelner roter Schuh stieß wohl kaum auf Interesse.
Ein Schuh weniger in meinem Leben.
Sie hatte schon so viel verloren.
Sie musste nach Hause.
Duschen.
Weinen.
Wird mir Letzteres gelingen?
Aufrecht, mit dem „Wer-tut-mir-was-Blick“ auf ihr Gesicht getackert, ging Selma den Weg durch den Park. Ihr war dabei so kalt, dass sie kaum das Bibbern ihres Körpers unterdrücken konnte.
Auf dem Weg zu ihrer Wohnung begegnete sie nur wenigen Menschen. Auf ihre missbilligenden Blicke antwortete Selma mit einem stolzen Nicken.
Steckt eure Nasen doch in eure Scheiße, dachte sie und versuchte, den ungleichen Schritt ihres nackten und ihres beschuhten Fußes zu verbergen. Endlich erreichte sie den Eingang zu ihrer Wohnung.
Drinnen würde sie die Tür hinter sich schließen und alles ausblenden können, was ihr wehtat, was so fürchterlich schmerzte. Selbst den Geruch im Aufzug, der sie sonst so störte, würde sie mit einer immensen Erleichterung begrüßen.
Warum sah niemand das Unrecht, das ihr angetan wurde?
Ich werde von einer Schülerin gequält.
Man hat mich in einer Bar willenlos gemacht.
Ich wurde heute Nacht vergewaltigt.
Selma warf einen Blick zur Treppe und stellte erleichtert fest, dass der Pförtner nicht an seinem Platz war. Während sie auf den Aufzug wartete, ließ sie ihre Schultern nach vorne fallen, kroch dazwischen, und ließ das Elend zu. Die Überheblichkeit war nicht mehr notwendig. Sie war fast da. Fröstelnd hüpfte sie von einem Fuß auf den anderen. Die Kälte, die ihren nackten Fuß fast gefühllos hatte werden lassen, war auch im Inneren des Hauses noch zu spüren.
Wo bleibt der verdammte Aufzug? Welcher Idiot besetzt zu dieser frühen Stunde den Aufzug?
Plötzlich sah sie durch den Spalt der Tür Licht im Aufzug schimmern. Sie machte einen Schritt nach vorn. Fast zu Hause. Als die Aufzugtüren sich ruckartig öffneten, trat jemand heraus. Reflexartig trat Selma zurück. Zu spät. Die schwarzen Augen nahmen sie im Detail auf und glitten von ihrem Gesicht ihren Körper hinunter. Sie scannten jeden Zentimeter ihres schmutzigen, geschändeten Körpers.
Sie erstarrte. Ihre Augen flohen zum Boden.
„Hallo, Selma.“
Dann ging der Mann an ihr vorbei, mit beneidenswert forschen Schritten, in seine eigene Wohnung neben der Treppe.
Selma eilte in den Aufzug, wartete, zitterte. Sie konnte kaum atmen.
Die Türen glitten zu.
Sie fühlte sich schwach, durchlässig und schloss ihre Augen.
Schlafen. Ausruhen.
Da! Eine Erinnerung. Sie sah Katharina Gavaldo vor sich. Ihre kalten Augen.
Glaubte ihr Lachen zu hören.
Ein Schlag in den Magen.
So kündigte sich Unheil und Grauen an.
Kapitel 22
Selma
Das Wasser rieselte auf ihren Kopf. Mit geschlossenen Augen spürte Selma, wie ihr unterkühlter Körper seine Wärme aufsaugte und sich der Schmutz der vergangenen Nacht löste. In ihrer Brust lag jedoch ein Felsbrocken von Traurigkeit, der der Lunge kaum Raum zum Atmen ließ.
Wie bin ich an den See gelangt?
Was war mit der Zeit geschehen, die irgendwo in einem schwarzen Loch in ihrem Gedächtnis hauste? Sie erinnerte sich nur vage, dass sie unendlich wütend gewesen war. Dass sie um sich geschlagen hatte. So hart sie nur konnte. Den Mann, der danach kam, wollte sie nur vergessen.
Sie nahm ein wenig Duschgel und seifte sich ein. Erst sanft, um die Wunden zu schonen, aber der Schmutz auf ihrem Körper war hartnäckig, sodass sie begann mit einem Schwamm jede noch so kleine Fläche ihrer Haut zu schrubben.
Von dem Körper mit den sanften Rundungen, die Männer einst so an ihr geliebt hatten, war nichts mehr übrig. Er war vollkommen ausgezehrt, wie die ausgehöhlte Seele darin.
Das Stöhnen kam irgendwo aus ihrem Körper. Sie fühlte den brennenden Schmerz in ihren Augen, wusste aber nicht, ob die Seife oder das Salz ihrer Tränen ihn hervorrief. Sie hämmerte heftig auf ihren Bauch und ihre Brüste, aber ihre Verzweiflung fand kein Ventil. Erst als sie die Innenseite ihrer Oberschenkel berührte, drosselte sie ihr Schlagen. Mit ihren Fingern taste sie ihren Intimbereich ab. Der brennende Schmerz sagte ihr, dass jemand nicht sehr zimperlich mit ihr umgegangen war. Keiner der Männer, denen sie in den vergangenen Jahren erlaubt hatte, die Leere in ihr durch intime Berührungen zu füllen, hatte sie missbraucht.
Benutzt, das schon. Aber hatte sie nicht darum gebeten? Sie war froh über ihre Anwesenheit gewesen, weil die marternde Stille oft noch quälender gewesen war. Es blieb immer ihre Wahl, auch wenn sie manchmal zu weit gegangen waren, weiter als sie wollte. Aber es gab da auch mal einen Mann, Theo, der sie immer beschützt hatte. Auf ihn hatte sie sich verlassen können. Aber Theo trank und irgendwann musste sie sich von ihm trennen. Er war heute noch ein in Alkohol getränkter Schwächling.
In der vergangenen Nacht war es aber nicht ihre Wahl gewesen. Wer war es? Was hatte er mit ihr gemacht, bevor er sie wie Dreck zurückgelassen hatte? Die Frage, ob sie das wirklich wissen wollte, verweilte im Chaos ihrer Gedankenwelt.
Selma sah sich ihre Hände genauer an, sah aber nur eine einzige Wunde. Ein winzig kleines Loch. Sie konnte sich nicht einmal daran erinnern, wie sie sich verletzt hatte.
Wieso waren sowohl ihre beiden Hände als auch ihre Bluse so voller Blut? Schmutzig, klebrig. Jede Menge davon. Sie zermarterte sich das Hirn. Die Lücke blieb.
Nach einer Stunde verließ Selma schließlich die Dusche. Sie wählte ein raues Handtuch, um das Leben in ihrem Körper zu spüren. Erst jetzt ließ sie einen Gedanken zu: Sie erkannte mehr und mehr, dass sie Glück gehabt hatte.
„Glück gehabt“, sagte Selma leise.
Ein höhnisches Lächeln umspielte ihre aufgesprungenen Lippen, während sie dem Gefühl mehr Gewicht gab. Ihre Haut glühte und sie begann Selbstgespräche zu führen. Das machte sie seit Monaten. Sonst flüsterte sie ihrem Spiegelbild zu, jetzt aber sprach sie laut und deutlich. Als ob sie mit Wucht zu sich selbst durchdringen wollte.
„Du musst etwas unternehmen, Selma, dich ändern! Wenn du so weitermachst, wirst du den Kampf verlieren!“
Die Worte hallten als Echo in der kahlen Dusche nach. Sich zu ändern schien einfach zu sein in diesem Moment.
„Es muss aus dir selbst kommen. Liebe dich selbst.“
Schwachsinn! Das sagte ihr Therapeut immer, aber sie verspottete die gesprochenen Worte.
„Geh dagegen an!“, forderte sie sich selbst heraus. „Du musst die Veränderung nur wollen. Tief in deinem Inneren weißt du doch, wer dir das angetan hat, Selma Wagenknecht.“
Sie war zu müde, um zu kämpfen. Aber vor allem wollte sie nicht mehr die Anforderungen von den sogenannten Profis, vom Psychotherapeuten, erfüllen. Das Geld konnte sie besser verwenden, für einen Fitnesstrainer, um ihren Körper wieder in Form zu bringen. Um danach den Kampf aufzunehmen. Um ihnen Schaden zuzufügen. Um sie alle zu vernichten! Die Impulsiven, die Verspielten und die Gavaldo. Niemand hatte das Recht ihr so etwas anzutun.
Sie wollte kein Risiko mehr eingehen. Nicht nach diesem Vorfall. Ihr Geist schwebte wie ein furchterregendes Gespenst durch die Räume des Schulgebäudes. Sie war zum Symbol einer gescheiterten Lehrerin geworden. Davon war Katharina Gavaldo jedenfalls überzeugt.
Sie musste mit einem Fitnesstraining beginnen. Zur Rache entschlossen, wollte sie sich so gut wie möglich vorbereiten. Ein durchtrainierter Körper verkraftete Stress und Anspannung besser und konnte sich gegen einen Angreifer wehren.
Denn im Moment erinnerte ihr Körper sie nur daran, dass sie Opfer einer Vergewaltigung geworden war und wie sich die Schmerzen danach anfühlten.
Ihr Puls beschleunigte sich, sie schnappte nach Luft, sobald sie an die vergangene Nacht dachte. An den schrecklichen Alptraum, aus dem Selma sich nur mit Mühe befreien konnte. Und schon war alles wieder so wie zuvor. Nein, anders. In Gedanken lag jetzt Katharina in einem nassen Keller auf dem Boden. Nackt.
„Ich hauche dich an und du wirst den Atem des Wahnsinns zwischen deinen Beinen spüren, du Schlampe“, flüsterte sie. „Dort, wo du am empfindlichsten bist. Ich werde dich quälen, bis du um Gnade und Vergebung winselst. Oder dich töten. Mal sehen.“
Nachdem Selma jede Stelle ihres Körpers sorgfältig abgetrocknet hatte, ging sie ins Schlafzimmer. Ihr Blick schwankte, ihr Gang war zittrig, ihr Kopf kämpfte gegen diesen dunklen Nebel in ihr. Doch die Angst, wieder darin abzutauchen, wurde etwas gedämpft, sobald sie ihr Bett sah. In ihrem Bett war sie sicher. Dort konnte sie ihrem geschändeten Körper die Ruhe geben, nach der er verlangte. Die weiche Bettdecke war so wohltuend, dass sie emotional abglitt. Tränen schossen hinter ihre geschlossenen Augenlider, als sie sich hinlegte und ihre Muskeln sich entspannten.
Ihre Wohnung kam ihr jetzt wie eine uneinnehmbare Festung vor. Sie nahm ein Kissen und presste es an ihre Brust. Ihr Herzschlag wurde regelmäßiger, langsamer.
Kapitel 23
Katharina
Katharina hielt sich nach der Schule gern im Bürgerpark Schiffwiesen auf, weil sie dort einen atemberaubenden Blick auf die Alpen hatte. Im Winter traf man hier oft Schüler, die den See entlangradelten, aber an diesem Tag war es ruhiger.
„Hey.“ Baan küsste sie auf den Mund und ließ sich neben ihr auf der Bank nieder. „Hat es dir gefallen?“
Katharina tupfte ihm ein wenig Schnee auf die Nase. „Hm …“
„Du warst dabei. Und dann warst du plötzlich wieder fort. Warum?“
Sie zuckte mit den Schultern. „Meine Mutter tobt, wenn ich zu spät nach Hause komme. Hast du sie schwer verletzt?“
„Nein, ich habe ihr nur ein paar Tritte verpasst.“
Sie schnaubte verächtlich. „Aber du solltest sie doch vergewaltigen!“
„Das haben drei andere Männer für mich erledigt.“
„Oh …Warum?“
„Ich bin mit dir zusammen. Da schlafe ich nicht mit einem anderen Mädchen. Die Wagenknecht hat es verdient!“
„Jepp! Weil sie so gemein zu dir war.“
Er grinste und ließ sie nicht aus den Augen.
Gegen ihren Willen musste sie lachen und betrachtete ihn nun ebenfalls. Sein dunkles Haar umrahmte sein schönes Gesicht mit den klugen Augen. Sie kannten sich nur wenige Tage und doch kam es Katharina vor, als wäre es ein ganzes Leben. Sie waren sich so nah.
„Ahnt jemand, dass du hinter alldem steckst?“, fragte sie leise.
„Nein! Niemand hat etwas gesehen.“
„Du hast es für mich getan. Nur für mich.“
Seine Hand nahm die ihre. „Ich werde dir jeden Gefallen tun, Katharina. Wir gehören zusammen.“
„Jeden?“
„Ja, jeden“, antwortete er in ruhigem Tonfall.
„Okay. Es gibt eine weitere Art, mich zu beeindrucken. Hör mir zu …“
Als sie fertig war, beugte er sich zu ihr. „Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du bist dir absolut sicher? Warum?“
„Warum spielt keine Rolle. Einfach so. Es geht um Aufregung und wir werden einen Mordsspaß haben. Ich möchte dir aber dabei helfen. Wir packen das gemeinsam an!“
Sie versuchte, sich auf ihre Wut zu konzentrieren, stellte aber zu ihrer eigenen Überraschung fest, dass ein anderes Gefühl stärker war. Eines, mit dem sie nicht gerechnet hatte. Scham.
Baan zog sie an sich, strich ihr vorsichtig übers Haar. „Alles was wir tun, tun wir, weil es uns zusteht. Wir haben ein Recht auf Vergeltung, Katharina.“
Sie schluckte ihre aufsteigende Rührung hinunter und bemühte sich dann um einen lockeren Gesprächston. Einen Moment lang saßen sie schweigend nebeneinander in der Wintersonne. Einige Spaziergänger gingen an ihnen vorbei und warfen dem Mädchen mit dem Engelsgesicht und dem braungebrannten jungen Mann neben ihm neugierige Blicke zu.
Katharina blieb reglos sitzen. „Wann?“, fragte sie. In ihrem Kopf rumpelte die Wut noch immer, aber schwächer.
Er gab ihr keine Antwort. Sie kniff ihn in die Rippen. Keine Reaktion. Wieder stupste sie ihn.
Jetzt lachte er, herzlich und offen. „Wenn du magst, erfülle ich dir deine Bitte. Aber ich brauche zwei bis drei Tage zur Vorbereitung.“ Baan steckte das Kinn so tief wie möglich in den großen Wollschal, den er fest um den Hals gewickelt hatte. Seine Augen glühten. „Ich glaube, dass ich dich heiraten werde“, murmelte er plötzlich. „Wir gehen gemeinsam zurück nach Brasilien und werden dort ein wunderbares Leben haben.“
„Du möchtest mein edler Amazonasritter sein?“ Sie schüttelte ihr langes Haar, strahlte ihn an. „Ich brauche dich, weil du mich verstehst. Du bist es.“
„Ich bin es“, entgegnete er ruhig.
„Bin ich in deinen Augen kompliziert?“
„Vielleicht.“ Wieder sein anziehendes Lächeln.
Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu. „Ach ja, eins noch…“
„Was?“
„Eines Tages werde ich Ja sagen.“ Mit diesen Worten drehte sie sich um und ging.
Polizeipräsidium München, Verhörraum 21
28. Dezember 2016
Es war kurz vor Mitternacht. Auf dem Polizeirevier war man dabei, die Vorgänge des Abends zu bearbeiten. Das übliche Programm von alkoholbedingten Straftaten: Ein Mann hatte eine Prostituierte zusammengeschlagen, ein anderer jemanden bei einem Raubüberfall niedergestochen. Dazu kam, dass die Telefone seit einiger Zeit nicht mehr still standen. Ständig riefen Journalisten der unterschiedlichsten Presseorgane an, um sich nach dem Fall zu erkundigen, von dem das ganze Land redete.
Benedikt van Cleef stand im Korridor mit Alexandra Cordes zusammen, der Psychiaterin, die sein Gespräch mit der Beschuldigten soeben beendet hatte.
„Und – was hältst du davon, Alexandra?“