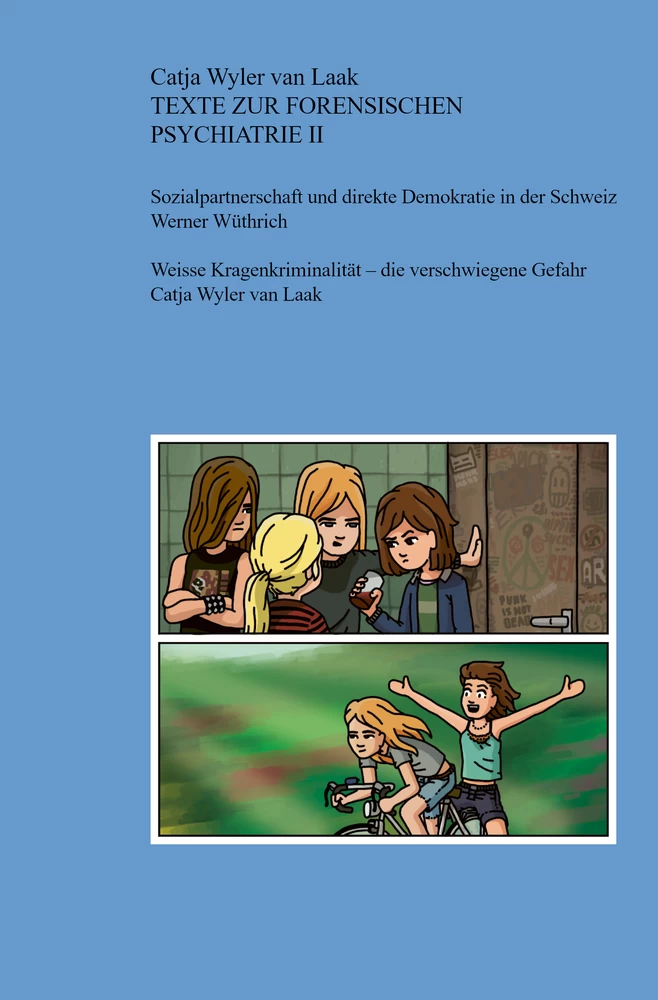Texte zur forensischen Psychiatrie II
Weisse Kragenkriminalität und die soziale Frage in der Schweiz
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Texte zur forensischen Psychiatrie II
Weisse Kragenkriminalität und die soziale Frage in der Schweiz
Präambel:
Endlich nun ist es soweit. Der zweite Band „Texte zur forensischen Psychiatrie“ ist erstellt. Das Thema ist diesmal „Weisse Kragenkriminalität und die soziale Frage in der Schweiz.“ Wie bereits Band I besteht auch der vorliegende Band aus zwei Beiträgen. Im ersten Beitrag mit dem Titel „Sozialpartnerschaft und direkte Demokratie in der Schweiz“ wird Werner Wüthrich die einzigartigen Besonderheiten der Sozialpartnerschaft im Kontext der direkten Demokratie in der Schweiz vorstellen. Besonderheiten der Sozialpartnerschaft und der direkten Demokratie werden in vielen aktuellen Diskussionen innerhalb der Schweiz, ganz zu schweigen von ausserhalb der Schweiz, zu wenig berücksichtigt und sind zum Teil auch erschreckend wenig bekannt. Ein grundlegend verankertes Wissen um diese Besonderheiten und ihrer Hintergründe erscheint jedoch nach Auffassung der Autorin unabdingbar, wenn die Schweiz und ihre Besonderheiten angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen Bestand haben sollen. Die Kenntnis dieser ganz wesentlichen Grundlagen des Schweizerischen Zusammenlebens ist Voraussetzung um die grossen Schäden, die die weisse Kragenkriminalität auch in unserem Land anrichten kann, auch nur annähernd ermessen zu können. Aus diesem Grunde wird der Beitrag „Sozialpartnerschaft und direkte Demokratie in der Schweiz“ dem Beitrag über weisse Kragenkriminalität vorangestellt werden.
Im zweiten Beitrag „Weisse Kragenkriminalität – die verschwiegene Gefahr“ wird Catja Wyler van Laak relevante Aspekte zur weissen Kragenkriminalität unter spezifischer Berücksichtigung der Schweiz darstellen. Wesentliche Inhalte der beiden vorliegenden Beiträge sind entnommen aus einem Praxiskolloquium, welches Catja Wyler van Laak gemeinsam mit Werner Wüthrich im Mai dieses Jahres unter dem Titel „White Collar Kriminelle: zur Prävalenz-Persönlichkeit und Deliktkarrieren und warum sich die forensische Psychiatrie dafür interessieren muss“ veranstaltet hat. Die jährlich gemeinsam mit jeweils einem Referenten veranstalteten forensisch, psychiatrischen Praxiskolloquien sind inzwischen zu einer festen Institution geworden. Erstaunlich jedoch ist, dass obwohl die wissenschaftliche Bedeutung der Praxiskolloquien jeweils durchaus gewürdigt wird und die Kolloquien auch deshalb von der Fachgesellschaft Psychiatrie und Psychotherapie bzw. der Schweizerischen Gesellschaft für forensische Psychiatrie und Psychotherapie mit 3 Credits für 3 Stunden anerkannt sind, insbesondere dieses Jahr die Teilnehmerzahl überraschend gering war. Mit 4 Teilnehmern bei zahlreichen Anmeldungen stellt sich eine Teilnehmerbilanz dar, die gerade unter Berücksichtigung des vorliegenden Themas nachdenklich stimmt. Angesichts dessen, dass die Veranstaltung im Internet ausgeschrieben ist, in relevanten Fachmedien veröffentlicht wird, dass die Teilnahme umsonst ist, d.h. weder aus der eigenen Tasche noch zulasten des Kantons bezahlt werden muss, die wissenschaftliche Qualität unbestritten ist und es nach der Veranstaltung noch Gelegenheit gibt zum Austausch bei einem Apéro, der ebenfalls von der Referentin offeriert wird, gibt es für diese geringe Teilnehmerzahl keine Erklärung, bis auf eine, die ein Teilnehmer in den Raum stellte; es könnte sich um gerade die Problematik handeln, die im vorliegenden Text beschrieben wird: Mangel an Unabhängigkeit und politische Korruption.
Das im Mai 2016 veranstaltete Kolloquium befasste sich über die in diesen Beiträgen dargestellten Themen hinaus mit „White Collar Criminality“ im Kontext von unnötigen medizinischen Behandlungen, Medikamenten, verschwiegenen Medikamentennebenwirkungen sowie Wissenschaftsbetrug. Die im Kolloquium vorgestellten Informationen und Zahlen im Kontext von unnötigen Operationen und Korruption (z.Bsp. in der Endoprothetik), unterschlagenen Nebenwirkungen von Medikamenten (nicht zuletzt auch Psychopharmaka, die auch in der Schweiz gebräuchlich sind) und bewusst gefälschten oder im Sinne der Erwünschbarkeit veränderten „wissenschaftlichen Erkenntnissen“ finden in der vorliegenden Publikation noch keinen Eingang, da das Material in ganz überwiegender Weise aus den USA stammt und in Bezug auf die hiesigen Verhältnisse abgeglichen werden müsste, bevor eine Veröffentlichung im breiten Rahmen verantwortbar erscheint. Vergleichbares gilt für die im Kolloquium vorgestellten Daten zur Prävalenz und Persönlichkeit von White Collar Kriminellen. Die von Weisburd und Waring1 im Jahre 2001 in den USA publizierte Studie weist darauf hin, dass sich situative, konstellative und persönliche Faktoren von White Collar Kriminellen kaum von denen anderer Straftäter unterscheiden: Aber auch hier fehlen vergleichende Informationen aus anderen Ländern, sodass eine schriftliche Veröffentlichung in dieser Publikation noch nicht verantwortbar erscheint. Dies bedeutet aber nicht, dass die Themen nicht auch in der Schweiz kritisch beleuchtet und untersucht werden sollten sondern im Gegenteil auch hierzulande erscheint es dringend notwendig die Untersuchungen aus den USA auf ihre Relevanz für unser Land hin zu überprüfen.
Die Leser sind herzlich eingeladen für die nächste Publikation „Texte zur forensischen Psychiatrie III“ in die Diskussion einzusteigen und eigene Beiträge beizusteuern.
Catja Wyler van Laak, im August 2016
Sozialpartnerschaft und direkte Demokratie in der Schweiz
von Dr. rer. publ. W. Wüthrich
Das Friedensabkommen vom 19. Juli 1937 in der Maschinen- und Metallindustrie
Die industrielle Revolution hat in der Schweiz – wie in vielen andern Ländern auch – die soziale Ordnung geschwächt oder gar aufgelöst, so dass es zum Teil zu unhaltbaren Zuständen kam wie Kinderarbeit, überlangen Arbeitszeiten, sehr tiefen Löhnen oder schlechten Wohnverhältnissen. Es gab verschiedene Ansätze, die soziale Frage anzugehen und die unbefriedigende Situation zu verbessern. Für Karl Marx waren diese Missstände Beweis, dass der Kapitalismus nicht funktioniert. Er warb für den Klassenkampf, der dazu führen sollte, dass das Proletariat die Macht übernimmt, zumindest vorübergehend eine Diktatur errichtet, die Produktionsmittel und den Boden verstaatlicht und die Wirtschaft staatlich und von oben lenkt und plant, was nach der russischen Revolution im Jahr 1917 in einem grossen Teil der Welt auch geschehen ist – mit bekannten Folgen. Liberale und auch eher liberale Sozialisten beschritten den Weg der Reform – ohne die Grundlagen der Marktwirtschaft wie Privateigentum, Handels- und Gewerbefreiheit, Vertragsfreiheit und Wettbewerb grundsätzlich in Frage zu stellen. Dazu gehörten Zusammenschlüsse zu „Associationen“, d.h. Gründung einer Vielfalt von Genossenschaften und Vereinen mit praktischer Selbsthilfe, Gründung von Arbeitervereinen und später Gewerkschaften (die die Interessen der Arbeiterschaft nachhaltig vertreten), Gründung von politischen Parteien, deren Vertreter sich in die Parlamente wählen liessen und Gesetze in Richtung einer sozialen Marktwirtschaft beschlossen.
Fabrikgesetze
1862 sagte das Volk an der Landsgemeinde in Glarus unter freien Himmel ja zu einem Fabrikgesetz, das für ganz Europa wegweisend war mit einem Verbot von Kinderarbeit, kürzeren Arbeitszeiten, Unfallschutz und manchem mehr. Um das Gesetz wirklich auch durchzusetzen, wurde ein Fabrikinspektor gewählt. 1876 folgten die eidgenössischen Räte und beschlossen ein eidgenössisches Fabrikgesetz, das ähnlich war. Das Schweizer Volk stimmte zu. Der Glarner Arzt und Fabrikinspektor Fridolin Tschudi wurde zum eidgenössischen Fabrikinspektor ernannt und kontrollierte auch hier die Einhaltung des Gesetzes. Es gab vorbildliche „Patrons“, die sich kümmerten und für ihre Arbeiter sorgten, indem sie zum Beispiel Wohnungen errichteten, Einrichtungen für die Kinderbetreuung schufen, die Altersversorgung regelten und manches mehr.
Generalstreik 1918
In den politischen Auseinandersetzungen vermischten sich klassenkämpferisch-revolutionäre und reformorientierte Dankansätze oft, so dass sie nicht immer klar getrennt werden konnten – so auch in der Schweiz. Zu einem markanten Ereignis kam es hier 1918 mit dem Generalstreik. Der landesweite Streik hatte einen sozialen und einen politischen Hintergrund. Die Wirtschaftslage und die sozialen Zustände waren am Ende des 1. Weltkrieges prekär – aber immer noch besser als in Kriegsländern. Die Versorgung der Bevölkerung war schlecht organisiert, weil die Behörden nicht mit einem langen Krieg gerechnet hatten. Die Landwirtschaft war gänzlich unvorbereitet und es mangelte an vielem, so dass die Teuerung massiv anstieg. Es wurde immer schwieriger, Nahrungsmittel zu importieren, weil diese überall in Europa knapp und der Transport aus Amerika schwierig war. Das ist ein Warnzeichen für diejenigen, die behaupten, wir könnten heute in jeder Situation von den Nachbarländern importieren. Die Mangelernährung und gar Hunger wurden zum sozialen Sprengstoff. Erst 1917 führten die Behörden die Rationierung ein. Ein Erwerbsausgleich für die Soldaten, die Monate und Jahre an der Grenze ausharrten, fehlte. Kein Wunder kam es zu einer Politisierung und Radikalisierung von Teilen der Linken. Lenin, Trotzki und andere russische Revolutionäre befanden sich damals als Asylanten für zweieinhalb Jahre in der Schweiz und waren politisch aktiv, bevor sie im Einverständnis mit der deutschen Regierung mit einem Sonderzug quer durch Deutschland transportiert wurden, um in Petersburg Revolution zu machen, so dass das zaristische Russland als Kriegsgegner ausgeschaltet werden konnte. Vor allem Lenin war in der Schweiz politisch aktiv und pflegte Kontakte zur Arbeiterbewegung. Als die sozialdemokratische Partei der Schweiz im Oktober 1918 – ein Jahr nach der russischen Revolution – überall im Lande Gedenkveranstaltungen durchführen wollte, reagierten der Bundesrat und General Ulrich Wille. Sie boten 95000 Mann auf, ungefähr ein Viertel der Armee, um Parlamente und die Sitze der kantonalen Regierungen, die Bahnhöfe, die Telefonzentralen, die Banken und weitere Einrichtungen zu bewachen, die in einem Umsturz jeweils besetzt werden. Ereignisse wie in St. Petersburg wollten sie verhindern. Die Zürcher Regierung zum Beispiel verlegte ihren Sitz in die Kaserne und vor dem Hauptbahnhof war ein Maschinengewehr postiert. Die Gewerkschaften reagierten mit Empörung und weiteten einen Streik in Zürich zu einem landesweiten Generalstreik aus. Die Soldaten standen an 117 Orten etwa 250000 Arbeitern gegenüber, die kurz zuvor noch die gleiche Uniform getragen hatten – und auf dem Fraumünsterplatz in Zürich wurde geschossen. Nun geschah in dieser gefährlichen Situation etwas, was fast an ein Wunder grenzt. Beide Seiten verhielten sich diszipliniert und die Soldaten schossen in die Luft – so dass es in Zürich nur einen einzigen Toten gab – einen Soldaten. Der Bundesrat stellte den Gewerkschaften ein Ultimatum, und der Generalstreik wurde nach drei Tagen abgebrochen. Dies war wohl der Tiefpunkt in der Geschichte des Bundesstaates. Die gerichtlichen Abklärungen danach ergaben, dass es keine Vorbereitungen gegeben hat für einen Umsturz. Anders als anderswo wurden die Streikführer nur symbolisch verurteilt und nicht aus dem politischen Leben ausgeschlossen. Ernst Nobs zum Beispiel wurde 1942 als erster Sozialdemokrat in die Landesregierung gewählt. – Ungefähr zur gleichen Zeit hatte es jedoch in München, Berlin, Wien, in Budapest und an andern Orten Europas ähnliche Vorkommnisse gegeben, die wirklich revolutionär waren und zu schweren Ausschreitungen mit vielen Toten führten.
Folgen des Generalstreiks nach Schweizer Art
Nach dem Streik passierte Erstaunliches, was man sich nur in der Schweiz vorstellen kann. Das Streikkomitee war mit einem umfangreichen Forderungskatalog aufgetreten. Bundesrat und Parlament gingen nach dem „Sieg“ über die Gewerkschaften nicht einfach zur Tagesordnung über, sondern nahm die Anliegen ernst, und es wurde in den folgenden Jahren abgestimmt – fast über jeden Punkt im langen Forderungskatalog der Gewerkschaften, die nun erlebten, wie die Stimmbürger fast immer Ja stimmten. Es gab also andere Wege, um soziale Anliegen durchzusetzen.
- Ja zur Proporzwahl des Parlamentes und ja zur sofortigen Neuwahl des Nationalrates nach dem neuen Prinzip (1918)
- zwei Mal Ja zur 48-Stundenwoche in öffentlichen und privaten Betrieben (1920 und 1924)
- vier Volksabstimmungen, die zu einer besseren Planung und Vorsorge im Lebensmittelbereich führten (1923, 1926, 1929)
- Ja zur Verfassungsgrundlage für die eidgenössische Altersvorsorge (1925)
- aber: Nein zur einmaligen Vermögensabgabe für Reiche (um die Schulden aus dem Krieg zurückzubezahlen) (1921)
Über das Frauenstimmrecht (das die Gewerkschaften 1918 ebenfalls forderten) sollte erst sehr viel später abgestimmt werden.
Die Arbeiter sollten in den Monaten und Jahren nach dem Generalstreik also immer wieder erleben, dass ihre Anliegen von der Gesamtbevölkerung ernst genommen wurden und in den Abstimmungen unterstützt wurden. Die 48-Stunden-Woche und die Einführung des Proporzsystems (mit dem die Sozialdemokraten ihre Sitze im Nationalrat verdoppeln konnten) sind Beispiele dafür. Die Zahl der Streiks nahm ab und die Anliegen der Arbeiter wurden zunehmend auf friedliche Art in Gesamtarbeitsverträgen geregelt. Der Streik blieb aber bis weit in die Wirtschaftskrise der Dreissiger Jahre die Hauptwaffe der Gewerkschaften.
Wirtschaftskrise der Dreissiger Jahre
Sogar in der Krise kam es zu zahlreichen Volksabstimmungen, in denen die Arbeiter erlebten, dass ihre Anliegen in der Gesamtbevölkerung ernst genommen wurden. Dazu zwei eindrückliche Beispiele: Der Bundesrat verfolgte damals die Politik des «guten Hausvaters», das heisst, er bemühte sich, seine Ausgaben auf die Einnahmen auszurichten, ohne Schulden zu machen. Weil die Steuern in der Krise eingebrochen waren, wollte er seine Ausgaben reduzieren und die Löhne beim Bundespersonal herabsetzen, was ein Signal gewesen wäre für Lohnsenkungen in der Wirtschaft. Tiefere Löhne würden ganz allgemein die Kosten senken und die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Produkte im Ausland stärken, waren seine Argumente. Zudem seien die Preise in der Krise eher gesunken, so dass man mit dem Lohn mehr kaufen könne, also – so seine Logik – könne man die Löhne senken. Die Gewerkschaften waren begreiflicherweise damit nicht einverstanden, ergriffen das Referendum und sammelten fast 300000 Unterschriften (zehnmal mehr als verlangt). 80 Prozent der Stimmberechtigten gingen am 28.5.1933 an die Urne, und stimmten grossmehrheitlich gegen die Pläne des Bundesrates.
Man beachte: Selbst gegen die Lohnpolitik der Regierung konnte in der Schweiz damals das Referendum ergriffen werden. Ein weiterer Erfolg kam hinzu. 1934 lancierten die Gewerkschaften und die Sozialdemokraten eine Volksinitiative, die sogenannte Kriseninitiative. Sie sammelten innert sechs (statt achtzehn Monaten) achtmal so viele Unterschriften wie verlangt und erlebten, dass gar 85 Prozent der Stimmberechtigten an die Urne gingen. Ihre Volksinitiative wurde zwar abgelehnt, erreichte aber eine hohe Zustimmung und hatte eine Wirkung auf die späteren wirtschaftlichen Reformen. Die Arbeiter erlebten auch in diesen Jahren immer wieder, dass sie dazugehörten, so dass Klassenkampf und Klassendenken in der direkt-demokratischen Schweiz allmählich schwächer wurden und verschwand.
Friedensabkommen von 1937
In diesen Monaten ging Konrad Ilg, Präsident des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterverbandes SMUV, auf Ernst Dübi zu, den Präsidenten des Arbeitgeberverbandes Schweizerische Maschinen- und Metallindustrieller ASM. Er schlug vor, die Beziehung zwischen den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden auf einen neuen Boden zu stellen. Konrad Ilg war aufgewachsen im thurgauischen Salenstein. Er war ein Schlosser, der sich leidenschaftlich für die Interessen der Arbeiter einsetzte. Schon als junger Arbeiter organisierte er einen Streik für die Bauarbeiter und gründete in Lausanne die Gewerkschaft der Metallarbeiter. Er studierte mit Vorliebe die Schriften von Pierre Proudhon und des französischen Sozialisten Jaurès, dessen tiefe Menschlichkeit ihn beeindruckte. 1909 wurde er als 32Jähriger Sekretär des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterverbandes SMUV, 1917 – 8 Jahre später – dessen Präsident. 1918–1919 und 1922–1947 war er für die Sozialdemokraten im Nationalrat.
1918 war Konrad Ilg Vizepräsident im Oltener Aktionskomitee, das den Generalstreik organisierte. Seine späteren Stellungnahmen und Vorträge lassen darauf schliessen, dass er hier mässigend auf allzu revolutionär gesinnte Kollegen eingewirkt hat. Vor allem widersprach er marxistisch orientierten Stimmen, die die Auffassung vertraten, zwischen Arbeit und Kapital bestehe ein unüberbrückbarer Gegensatz. Das Gegenteil sei wahr. Zwischen beiden Gruppen bestehe eine wechselseitige Interessengemeinschaft. In jedem Betrieb flössen die Mittel, die die Arbeiterschaft zum Leben brauche, und die Mittel, die der Betrieb für seine Existenz und für seinen Aufbau benötige, aus der gleichen Quelle – nämlich dem Verkauf der gemeinsam im Werk erzeugten Produkte. Beide Seiten seien gleichermassen an einem erfolgreichen Verkauf interessiert. Diese Interessensgemeinschaft sei umso wichtiger, weil die Schweiz die Rohstoffe für ihre Industrieprodukte zur Gänze im Ausland kaufen müsse und diesen Nachteil einzig mit einer höheren Qualität kompensieren könne. Alle – Unternehmer, Arbeiter, Kader – müssten deshalb zusammen die Leistungsfähigkeit des Betriebes sichern und ausbauen.
Mit dieser Einstellung ging Konrad Ilg in die Vertragsverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband. Sein Gegenüber war Ernst Dübi, Direktor von Von Roll in Gerlafingen – in der Armee Oberst und Chef der Artillerie im 4. Armeekorps. Ernst Dübi seinerseits versuchte auf der Arbeitgeberseite zu bewirken, dass diese vom «Herr im Haus»-Standpunkt abrückt. Die Arbeitgeber sollten die typischen «Arbeitersorgen» wie Lohn, Arbeitszeit, Ferien, Versicherungen und anderes nicht mehr defensiv als überspannte Ansprüche einer Gegenpartei betrachten, sondern in ihnen wichtige Faktoren erkennen, die die Qualität der Produkte verbessern und die Existenz des Unternehmens sichern.
In diesem Sinn soll das Prinzip von Treu und Glauben in den Verhandlungen wegleitend sein, d.h. die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände vertrauen sich gegenseitig und gehen davon aus, dass die Gegenseite gute Absichten habe und die gemeinsamen Interessen im Vordergrund stehen.
Konkret beinhaltete das Friedensabkommen folgendes: Lohnabschlüsse sollten nicht mehr unterschiedslos für eine ganze Branche, sondern individuell für den einzelnen Betrieb verhandelt werden. Streik und Aussperrung sollten als Druckmittel wegfallen, der Klassenkampf sollte beendet werden und den Weg bereiten für den Arbeitsfrieden.
Beide – Konrad Ilg und Ernst Dübi – bewirkten einen Kulturwandel in der Beziehung zwischen Arbeitgebern und –nehmern. Diese sollten sich nicht mehr als Über- und Untergeordnete in einer sozialen und beruflichen Hierarchie gegenübertreten, sondern sich menschlich als Gleichberechtigte begegnen. Damit begann eine Entwicklung, die bis heute anhält. Heute spricht niemand mehr von Arbeitern oder Angestellten – sondern von Mitarbeitern. Das Friedensabkommen von 1937 war ein erster und grosser Schritt in diese Richtung. Es ermöglichte und erleichterte das Zusammenrücken in einer bedrohlichen Zeit. 1942 erhielten Konrad Ilg und Ernst Dübi gemeinsam die Ehrendoktorwürde der Universität Bern.
Das Friedenabkommen wurde in der Bevölkerung mit Erleichterung begrüsst. Die vielen Streiks hatten das soziale Klima vergiftet. Nur die Kommunisten hielten an ihrer Meinung fest, dass der Gegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital unüberbrückbar und eine Versöhnung unmöglich sei. Das Abkommen wurde zum Modell für zahlreiche Gesamtarbeitsverträge bis heute. In den folgenden zwanzig Jahren wurden in allen Industriezweigen des Landes nicht weniger als 1500 Gesamtarbeitsverträge abgeschlossen, die alle die Verbesserung der Lebensverhältnisse zum Inhalt hatten. Während in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg noch ungefähr 90000 Arbeitstage pro Jahr wegen Streiks verloren gingen, sank diese Zahl in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gegen null, obwohl es in der Hochkonjunktur (in der die Auftragsbücher voll sind) eigentlich leichter wäre, mit einem Streik Druck auf die Arbeitgeber auszuüben.
Der Arbeitsfriede verändert die Politik
Das Friedensabkommen hatte Folgen für die Politik. Die Sozialpartner begannen zunehmend, Fragen und Streitpunkte des Arbeitsverhältnisses vermehrt in Gesamtarbeitsverträgen zu regeln – und die staatlichen Gesetze, die bisher die 48-Stundenwoche, die zulässigen Ueberstunden oder die Ferien zwingend vorschrieben, verloren etwas an Bedeutung. Gesamtarbeitsverträge waren flexibler als das Fabrikgesetz, man konnte dezentral vorgehen und auch betriebliche und regionale Unterschiede berücksichtigen – ganz nach dem Subsidiaritätsprinzip: Ins Gesetz gehören nur Fragen, die die Sozialpartner nicht selber lösen können.
Diese neue Vertrags- und Gesprächskultur sollte nach dem Zweiten Weltkrieg getestet werden und zu Widerstand in den Reihen der Gewerkschaften führen. Ausgelöst wurde diese ausgerechnet durch eine Volksinitiative. Die damalige Partei des Landesrings der Unabhängigen lancierte 1954 eine Initiative zur Einführung der 44-Stunden-Woche. Sie sollte den Einstieg in die 5‑Tage-Woche ermöglichen. Die reguläre Arbeitszeit in der Industrie betrug damals 48 Stunden an 6 Tagen. Gottlieb Duttweiler, Gründer und Patron der Genossenschaft Migros, galt als Vater dieser Initiative, so dass diese in den kommenden Auseinandersetzungen als «Duttweiler-Initiative» bezeichnet wurde. Ungewöhnlich und erstaunlich war, dass dieser Vorstoss zur Arbeitszeitverkürzung – ganz anders wie sonst – von Arbeitgeberseite kam. Die Migros ist heute der grösste Arbeitgeber in der Schweiz.
Gottlieb Duttweiler wollte die Bundesverfassung mit folgendem Satz ergänzen: «Die ordentliche Arbeitszeit in den Fabriken darf 44 Stunden nicht überschreiten. […] Die Vorschrift hat ein Jahr nach der Annahme durch die Volksabstimmung in Kraft zu treten.» Das hätte bedeutet, dass das Fabrikgesetz entsprechend hätte geändert werden müssen. Duttweiler wollte hier als Arbeitgeber an eine lange Tradition der Arbeiterbewegung anknüpfen, die so oft am 1. Mai für den 8‑Stunden-Tag demonstriert hatte. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte das Volk zweimal über die 48-Stunden-Woche im Fabrikgesetz abgestimmt und beide Male mit Ja. Die Duttweiler-Initiative fügte sich scheinbar nahtlos in diese Tradition ein. Sie stiess jedoch beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund SGB auf keine Gegenliebe, weil sie nicht zur neuen Vertragskultur passte. Walter Steiner, SGB-Präsident, wies die Einladung Duttweilers zurück, sich an der Unterschriftensammlung zu beteiligen. Die Zeiten hätten sich seit Abschluss des Friedensabkommens geändert. Das sei kein Nein zur 44-Stunden-Woche, sondern ein Nein zu einer zentralistischen, einheitlichen Lösung. Die 44-Stunden-Woche werde nicht mehr wie die 48-Stundenwoche von oben mit staatlichem Zwang über eine Gesetzesänderung erkämpft werden. Die Gewerkschaften würden in der Tradition des Friedensabkommens Verhandlungen führen und dieses Ziel erreichen – auch wenn dies mehr Zeit beanspruche als eine Volksabstimmung und ein neues Gesetz. Dieser Weg sei viel flexibler und würde die unterschiedlichen Verhältnisse in den verschiedenen Branchen und Betrieben berücksichtigen. Diesen Weg hätten die Gewerkschaften 1937 gemeinsam mit den Arbeitgebern beschlossen, und sie würden daran festhalten. Zudem wäre der Lohnausgleich so garantiert. – Walter Steiner war ein enger Mitarbeiter von Konrad Ilg und hatte mit ihm 1937 die Verhandlungen über das Friedensabkommen geführt.
Wegweisende Volksabstimmung vom 26.10.1958
Die Frage war nun: Würden die Stimmbürger, also auch die Gewerkschafter, in der Volksabstimmung dem Weg über die Gesamtarbeitsverträge zustimmen und die Verfassungs- und Gesetzesänderung ablehnen, die wahrscheinlich schneller zum „freien Samstag“ führen würde? Dazu kam, dass die Arbeitgeber damals es vorzogen, über Lohnerhöhungen zu verhandeln. Die Verkürzung der Arbeitszeit war wenig beliebt, weil die Auftragsbücher in der Hochkonjunktur übervoll waren und die Zahl der zulässigen Überstunden ausgereizt war. Es war für viele ein verlockendes Ziel, sich den „freie Samstag“ mit einem Ja an der Urne zu sichern.
Politisch würde der Ausgang dieser Abstimmung Weichen stellen. Ein Ja hätte sofort neue Volksinitiativen zur Folge gehabt, die auf diesem Weg die Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmer hätten verbessern wollen – zum Beispiel mehr Ferien. Ein Nein würde dagegen die neue Vertrags- und Gesprächskultur und das Friedensabkommen stärken.
SGB-Präsident Walter Steiner musste intern gegen massive Widerstände von Kollegen in den eigenen Reihen ankämpfen, die wie bisher auf politischem Weg die 44-Stundenwoche einführen wollten und deshalb mit Gottlieb Duttweiler sympathisierten. Aber es gelang Steiner, die Mehrheit in der Delegiertenversammlung des Gewerkschaftsbundes zu überzeugen, so dass diese die Nein-Parole für die Abstimmung beschloss. – Die Spannung in der Bevölkerung vor der Abstimmung war gross. Das Volk folgte Steiner – und lehnte am 26.10.1958 die Duttweiler-Initiative mit 65 % Nein-Stimmen klar ab.
In diesem Ergebnis kam zum Ausdruck, dass die grosse Mehrheit der Bevölkerung sich bewusst war, was das Friedensabkommen für die Schweiz bedeutet. Die Arbeitszeit wurde trotz des Volks-Neins in den Jahren nach 1958 in unterschiedlichem Tempo weiter verkürzt und die 5‑Tage-Woche überall eingeführt – aber eben freiwillig und flexibel im Rahmen der Gesamtarbeitsverträge und nicht von oben mit staatlichem Zwang.
Weichenstellung für die Zukunft
Die Abstimmung vom 26.10.1958 hat die Tradition des Friedensabkommens von 1937 gefestigt. Es kam und kommt zwar immer wieder vereinzelt zu Streiks und auch zu Volksinitiativen von verschiedenen Organisationen, die ähnlich wie die Duttweiler-Initiative kürzere Arbeitszeiten, längere Ferien und auch andere gewerkschaftliche Forderungen wie Mitbestimmung oder Mindestlohn auf gesetzlichem Wege durchsetzen wollten und wollen. Das Volk stimmte wie 1958 und stimmt auch heute immer wieder Nein:
- 1976 lehnte es die 40-Stunden-Woche mit 78 % Nein ab. Im gleichen Jahr fanden zwei Abstimmungen statt, die dem Bund die Kompetenz gegeben hätten, Vorschriften über die «Mitbestimmung der Arbeitnehmer und ihrer Organisationen in Betrieb, Unternehmung und Verwaltung» zu erlassen. Das Volk sagte Nein zur Volksinitiative und auch Nein zum Gegenvorschlag des Parlaments.
- 1985 sagte es mit 65 % Nein zur Verlängerung der Ferien auf vier Wochen für jüngere und auf fünf für ältere Arbeitnehmer.
- 1988 sagte das Volk mit 64 % erneut Nein zur 40-Stunden-Woche.
- 2002 stimmte das Volk mit 75 % nein zu einer flexiblen Reduktion der Arbeitszeit auf 1872 Stunden im Jahr – was im Durchschnitt einer 36-Stunden-Woche entsprochen hätte.
- 2012 sagten 67 % der Stimmenden Nein zur Initiative «6 Wochen Ferien für alle», und
- 2014 sagte das Volk wiederum Nein zu einem gesetzlich festgelegten Mindestlohn.
Die Abstimmungsergebnisse über die Arbeitszeit und die Ferien werden im Ausland häufig so interpretiert, dass die Schweizerinnen und Schweizer eben fleissig seien und lieber Arbeit und mehr Verdienst als mehr Freizeit oder Ferien hätten. – Das stimmt so nicht ganz. Das Nein war immer auch ein Ja zur Tradition des Friedensabkommens von 1937. Jede dieser zahlreichen Abstimmungen hat diese Tradition bestätigt und verfestigt – so dass sie heute zu einer festgefügten, im Volk verankerten Institution geworden ist. Eine Rückkehr zur Kultur vor 1937 – mit Streiks und einheitlichen, starren gesetzlichen Regelungen – erscheint heute fast unmöglich (obwohl die Reden der heutigen Gewerkschaftsführer manchmal anders klingen). Dabei ist es nicht so, dass die Arbeitszeit und die Ferien gesetzlich gar nicht erfasst werden. Sie sind seit einigen Jahrzehnten im Arbeitsgesetz und im OR geregelt – aber nur als Minimalstandard, der Raum lässt für weitergehende Lösungen in den Gesamtarbeitsverträgen. Und dies ist auch geschehen auf vielfältige Art und Weise.
Die Tradition des Friedensabkommens entspricht dem Schweizer Modell: Die Bevölkerung bevorzugt dezentrale und freiheitliche Lösungen, die die vielfältigen regionalen und kulturellen Unterschiede berücksichtigen. Auch werden die Bürgerinnen und Bürger selber aktiv und suchen Lösungen und Wege, so dass eine gesetzliche Regelung gar nicht nötig ist.
Heute
Die Unternehmenswelt und –kultur hat sich verändert. Viele Unternehmen sind stärker mit dem Ausland vernetzt – und haben manchmal eine ausländische Führung oder sind gar in ausländischer Hand. In Grossbetrieben ist mancherorts Englisch Standardsprache – zumindest in der Führungsetage. Der Druck der internationalen Finanzwelt auf die Geschäftsleitungen hat zugenommen. Sie sollen mehr Gewinn und mehr Rendite erzielen, um vor den kritischen Blicken von Analysten und Finanzmedien bestehen zu können. Dieser Druck wird auch auf die Mitarbeiter übertragen. Zudem passen extrem hohe Löhne und Boni für die Kader schlecht zur Kultur des Friedensabkommens. Sie werden von der Bevölkerung nicht verstanden und vergiften die Stimmung. Deshalb hat die Bevölkerung im Jahr 2012 die sog. „Abzocker-Initiative“ angenommen, die die exzessiven Löhne und die Boni in den Führungsetagen der Grosskonzerne begrenzen will. In den Klein- und Mittelbetrieben werden die traditionellen Werte noch am ehesten gepflegt. Auch die Welt der Gewerkschaften hat sich verändert. Die meisten der Gewerkschaften, die 1937 das Friedensabkommen abgeschlossen oder später unterstützt haben, gibt es als selbständige Organisationen nicht mehr, und die Nachfolger treten anders auf. Das Friedensabkommen von 1937 als nationaler Pakt hat Risse bekommen. Trotzdem – seine segensreiche Ausstrahlung auf die Arbeitswelt, die Bevölkerung und die Politik ist heute nach wie vor vorhanden.
Quellen:
Werner Wüthrich, Ökonomische, rechtliche und verbandspolitische Fragen der Arbeitszeitverkürzung in der Hochkonjunktur (1946 – 1975) in der Schweiz und in Österreich, Diss. 1987
David Lasserre. Schicksalsstunden des Föderalismus, 1963
Wolf Linder, Christian Bolliger, Yvan Rielle. Handbuch der eidgenössischen Volksabstimmungen 1848 – 2007, 2010
100 Jahre Sozialdemokratische Partei, 1988
Willi Gautschi, Dokumente zum Landestreik 1918, 1971
Hans Rudolf Kurz. Dokumente der Grenzbesetzung 1914 – 1918.1970
Patrick Halbeisen, Margrit Mülle, Béatrice Veyrassa, Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert. 2012
Historischer Verein des Kantons Glarus. Das Glarner Fabrikgesetz und der Arbeiterschutz im 19. Jahrhundert. 2015
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752140804
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (April)
- Schlagworte
- Schweiz Menschenrechte Cyberkriminalität Weisse Kragenkriminalität Korruption direkte Demokratie Lüge Schweizer Sonderweg Sozialpartnerschaft Vertrauen Geschichte Archäologie Ägyptologie Recht Jura