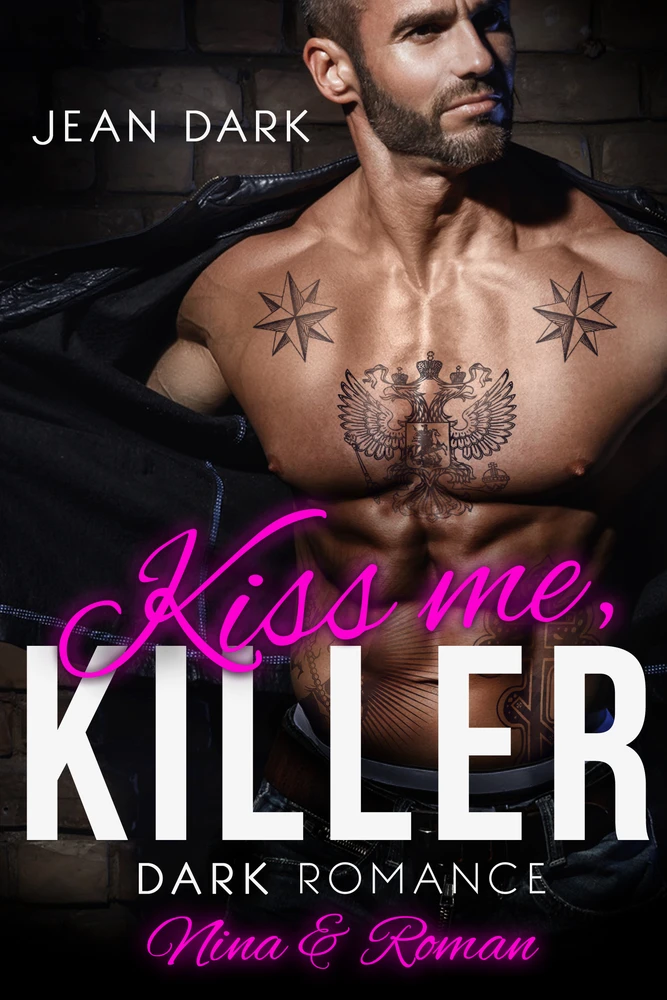Natürlich erwartet der Kerl keine Antwort auf diese Frage, denn immerhin presst er mir weiterhin seinen Handschuh auf Mund und Nase, und zwar mit einer Kraft, die es mir unmöglich macht, auch nur zu nicken oder den Kopf zu schütteln.
Das wird ihm offenbar ebenfalls klar, denn jetzt verschwindet die Spitze des Messers, die er gerade noch gegen meinen Hals gedrückt hat (zumindest glaube ich, dass es sich um die Spitze eines Messers handelt), und stattdessen packt mich jetzt eine zweite behandschuhte Pranke an der Kehle. Nicht mal unsanft, aber doch mit ausreichendem Druck, dass ich einen kleinen Schritt nach hinten stolpere. Mein Fall wird von einer Wand gestoppt, doch dann begreife ich, dass es keine Wand ist, sondern sein Körper. Muskeln hart wie Beton, Sehnen, die in Wahrheit Stahlseile sind. Na ja, zumindest fühlt es sich so an.
Dann lockert sich der Schraubstock um meinen Kiefer um ein paar Umdrehungen, und die Stimme raunt wieder etwas in mein Ohr.
»Wirst du schreien, wenn ich die Hand wegnehme?«
Ich schüttele den Kopf, das heißt, ich drehe ihn in seinem Lederhandschuh ein paar Millimeter hin und her, aber offenbar kommt die Antwort an.
»Gut«, sagt er und nimmt die Hand weg.
Ich bleibe erst mal stehen, auch wenn ich sehr gern wissen möchte, wer der Kerl ist, der da hinter mir steht.
Aber möchte ich das wirklich?
Davon abgesehen trägt der Fremde sehr wahrscheinlich sowieso eine Maske, also …
»Dreh dich um!«, befiehlt er.
Irgendwie hat dieses raue Flüstern, das aus seinem Mund kommt, auf mich eine nahezu hypnotische Anziehungskraft, und sie kommt mir fern bekannt vor. Prima, denke ich, genau die richtige Situation, um die Stimme des Kerls sexy zu finden, der dir gerade noch ein Messer an die Kehle gedrückt hat und der dich vermutlich nur losgelassen hat, um dich noch einmal gut ansehen zu können, bevor dich in die ewigen Jagdgründe schickt.
Es ist im Grunde eine einfache Rechnung: Da die Polizei das Haus längst verlassen hat, kann er keiner von denen sein – und soweit ich weiß, operieren die hiesigen Ordnungshüter auch nicht in völliger Dunkelheit mit Lederhandschuhen und Messern, die sie einem an den Hals setzen. Somit bleibt nur eine Art von Mensch übrig, der sich jetzt in diesem Gebäude aufhält: jemand, der eigentlich nicht hier sein dürfte und es um jeden Preis vermeiden muss, von der Polizei gesehen zu werden. Was in gewisser Weise auch auf mich zutrifft, und, davon abgesehen nur noch auf …
Genau.
Täter kehren immer an den Ort ihrer Untaten zurück, das weiß jeder Hobbydetektiv.
Vielleicht hat er ja auch irgendeinen wichtigen Hinweis am Tatort liegen lassen und nun stattdessen mich gefunden. Und somit einen Zeugen. Was hatte Barney noch gesagt, was ein Profi mit Zeugen macht? Ach ja, genau. Er lässt keinen einzigen am Leben.
Shit.
»Miss Hartley?«, brummt der Typ in mein Ohr.
Der muss Augen haben wie ein Luchs, denke ich noch, bevor mir auffällt … hey, woher kennt der meinen Namen?
Mal davon abgesehen, dass mich niemand – absolut niemand auf diesem Planeten – Miss Hartley nennt. Ich bin schließlich nicht meine Mutter. Und dann begreife ich, woher mir die Stimme bekannt vorkommt.
Der Kerl.
Mister Wahnsinnsaugen.
Mister Hast-du-nicht-Lust-auf-eine-Party-mit-mir-und-meinen-beiden-willigen-Gespielinnen? Das muss ein Scherz sein, und ich bin offenbar die Pointe. Gleich werden die Lichter aufflammen und Barney und Charly und vermutlich auch Big Jim hinter der Couch hervorspringen und »Gotcha!« rufen.
»Mister Baronov?«, flüstere ich.
»Was machen Sie denn hier?«, platzen wir gleichzeitig heraus.
Pause.
Da er keine Anstalten macht, meine Frage zu beantworten, beantworte ich eben seine.
»Ich bin Journalistin«, sage ich, als ob das alles erklärt. Inklusive des Einbruchs und des unbefugten Betretens eines Tatorts, Behinderung polizeilicher Ermittlungen und welche gesetzlichen Bestimmungen ich sonst noch übertreten haben mag.
Scheinbar genügt ihm das tatsächlich als Erklärung, er nickt bloß.
»Ist kein guter Ort«, sagt er.
Na sag bloß!
»Sie sollten hier nicht herumschleichen«, setzt er die Belehrung leise fort. »Das ist gefährlich.«
»Das einzuschätzen, überlassen Sie doch bitte mir, ja?«, raune ich zurück. »Darf ich vielleicht erfahren, warum Sie hier sind?«
»Geschäftlich«, sagt er.
Im Dunkeln kann ich es natürlich nicht sehen, aber ich glaube, er grinst dabei. Findet sich vermutlich ausgesprochen witzig.
»Videokameras«, sagt er dann. Was zunächst wenig Sinn ergibt.
»Manchmal sind an Orten wie diesen welche versteckt.«
Aha. Orte wie diese. Wie viele davon kennen Sie denn noch so, Mister Baronov?
»Meinen Sie nicht, dass diese sich jetzt in Gewahrsam der Polizei befinden?«
»Vielleicht«, sagt er vielsagend.
Oder vielmehr nichtssagend. Erst dann scheint ihm aufzufallen, dass er mich immer noch an der Kehle gepackt hält wie ein Katzenjunges. Mir auch. Vielleicht, weil das ein überraschend angenehmes Gefühl war. Seine Handschuhe sind aus wirklich erstklassigem Leder, sehr weich.
Er lässt meinen Hals los und ich bin frei. Oder wäre es, aber ich mache keine Anstalten, von ihm wegzutreten. Sein Duft ist der Wahnsinn, jetzt erinnere ich mich, dass der auch schon gestern in der Bar seine Wirkung auf mich nicht verfehlt hat. Wie kann ein Mann nur derart geil riechen? Das ist doch vollkommen unfair!
Ihn scheint meine Erscheinung dagegen weit weniger zu beeindrucken, denn er schiebt mich einfach mit einer beiläufigen Bewegung beiseite und flüstert mir dann zu, dass er jetzt nach den Kameras suchen werde.
»Dann gehe ich mal besser«, schlage ich vor, weil mir das das Vernünftigste erscheint.
»Nein«, flüstert er. »Wenn Sie im Dunklen irgendwo ein Geräusch machen, kann ich hier einpacken. Sie bleiben da stehen!«
Zu Befehl, Arschloch, denke ich. Sexy Arschloch.
»Zu Befehl!«, zische ich in seine Richtung, und ich glaube, den Anflug eines Kicherns zu hören. »Was bringt Sie eigentlich auf die Idee, dass Sie sich hier bewegen können, ohne ein Geräusch zu verursachen?«
Immerhin ist der Kerl gute zwei Köpfe größer als ich und etwa doppelt so breit, vermutlich bewegt er sich so geschmeidig wie ein Stahlträger.
»Das hier«, sagt er und etwas macht leise Klick, worauf ein matter grüner Schimmer in seinem Gesicht aufleuchtet. Ein Nachtsichtgerät, natürlich. Sollte ich mir vielleicht auch mal zulegen.
Während ich mir vorkomme wie ein kleines Mädchen, das beim Detektivspielen auf dem Dachboden erwischt wurde, macht er sich auf die Suche. Sein gewaltiger Körper verschmilzt dabei mit den Schatten im Raum, ich kann ihm kaum folgen, während er hierhin und dorthin huscht. Ich lag wohl falsch mit meiner Vermutung seinen gewaltigen Körper betreffend, er bewegt sich mit geschmeidiger Anmut durch das halbdunkle Zimmer. Vermutlich hat er einen exzellenten Yogatrainer. Gott, wie er sich wohl im Bett bewegt?
»Ah!«, macht er, nachdem er vorsichtig auf einen Stuhl gestiegen ist und sich eine Weile mit der Deckenlampe beschäftigt hat, so eine billige Imitation eines Kristalllüsters. Er schafft es, etwas zwischen den Glaskristallen hervorzuholen, das ein kleiner Würfel zu sein scheint, ohne dass er damit die ganze Lampe zum Klirren beginnt. Erstaunlich. Offenbar sind seine Hände nicht nur groß und kräftig, sondern auch ausgesprochen geschickt.
Gut zu wissen.
»Shit!«, flucht er leise und lässt sich sogar herab, mir zu erklären, wieso er sich zu diesem Kraftausdruck hat hinreißen lassen. »Die Kabel sind durchtrennt. Das war ein Profi.«
Seltsam, denke ich, genau das sind die Worte, die Barney auch verwendet hat. Und jetzt habe ich die Bestätigung dieser Vermutung von jemandem, der offenbar selbst einer ist. Na prima.
Er steckt die winzige Videokamera, denn um nichts anderes kann es sich bei dem kleinen Kasten handeln, in die Innentasche seines Jacketts und steigt dann wieder von dem Stuhl herunter.
»Verschwinden wir«, sagt er, und macht Anstalten, diesen Plan in die Tat umzusetzen, ohne sich groß darum zu kümmern, ob ich ihm folge oder nicht.
»Warten Sie«, zische ich, als er an mir vorbei in den Gang tritt. Er bleibt stehen, dreht sich um, schaut mich an aus grün leuchtenden Teleskopaugen.
»Sie hätten mich auf die Party begleiten sollen, Miss Hartley.«
»Woher kennen Sie meinen Namen?«, zische ich. Als ob es im Moment keine drängenderen Fragen gäbe.
»Ihre Karte. Sie haben Sie bei Jim hinterlassen, mit der Bitte, dass er sie an mich weiterreicht. Was er getan hat.«
»Ich habe was?«
»Wie mir Big Jim versichert hat, haben Sie von meinem Angebot reichlich Gebrauch gemacht«, sagt er.
Im Gang ist es stockfinster, aber jetzt bin ich absolut sicher, dass er mich hämisch angrinst. Und vermutlich kann er mit seiner dämlichen Nachtsichtbrille auch sehen, wie ich erröte. Selber schuld, denke ich. Aber daran, Big Jim meine Visitenkarte in die Hand gedrückt zu haben, erinnere ich mich beim besten Willen nicht.
»Hören Sie, ich glaube, wir sollten …«, sage ich, als ein Geräusch an der Vordertür ertönt. Das Geräusch eines sich im Schloss drehenden Schlüssels.
»Shit!«, zischt er, packt mich an der Hand und zieht mich mit sich in den Gang. Wie durch ein Wunder schaffen wir es, dabei keinen Lärm zu verursachen. Als im Flur eilige Schritte ertönen, schiebt er mich in den nächsten Raum, der wohl mal das Bad war.
Er drückt mich hinter der Türöffnung an die Wand, dann schlüpft er selbst hindurch und presst seinen Körper an mich. Das muss er, weil man ihn sonst vom Gang aus sehen kann, wo jetzt das Licht aufflammt.
»Johnson hat gemeint, er hätte gesehen, dass sich was bewegt hat«, sagt eine Stimme, unverkennbar die eines Cops.
»Kann nichts erkennen. Mann, das Einzige, das sich hier bewegt, sind die Scheißratten. Also, die die der Irre übrig gelassen hat.«
Sie lachen beide ein bisschen. Diese Spaßvögel.
Währenddessen drängt sich der steinharte Körper von Mister Baronov an meinen, als hätte er vor, mich einfach durch die Wand zu drücken. Vermutlich würde er das sogar schaffen, ohne dass es ihm allzu große Anstrengungen bereitet.
Und …
Oh Gott, da ist noch etwas, das gerade steinhart zu werden beginnt, und jetzt kräftig gegen meinen Oberschenkel drückt. Seine Taschenlampe, vermutlich, aber … aber wozu sollte ein Kerl mit einer Nachtsichtbrille eine verdammte Taschenlampe brauchen?
Das kann nicht sein Ernst sein!
Ich schaue nach oben, wo sich auf seinen durch das Flurlicht beleuchteten Zügen ein entschuldigendes Lächeln breitmacht. Das Nachtsichtgerät muss er irgendwann abgenommen haben, denn ich begegne wieder diesen eisblauen Augen über diesem Lächeln.
Ich würde ihn jetzt ungemein gern fragen, ob ihm das jedes Mal passiert, wenn er sich gemeinsam mit einer Frau vor der Polizei versteckt oder ob ich einen Sonderfall darstelle. Und wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich jetzt vielleicht gern noch ganz andere Sachen mit meinem Mund machen, anstatt ihm blödsinnige Fragen wie diese zu stellen. Oder mit meinen Händen. Oder mit meiner …
Halt!, rufe ich mir selber zu. Du darfst jetzt nicht durchdrehen. Du wirst einfach hier stehen und warten, bis die beiden Polizisten verschwunden sind. Dann wird er sich artig bei dir entschuldigen und seiner Wege gehen. Du hast dir nichts zuschulden kommen lassen, immerhin bist es nicht du, die versucht, ihn mit einem fleischgewordenen Wurfspieß zu durchbohren.
Dabei fällt mir auf, wo mich die Spitze seiner Nicht-Taschenlampe berührt. Mister Wahnsinn ist offenbar ausgesprochen gut bestückt.
Sein Körper, und jetzt meine ich ausnahmsweise einmal seinen gesamten Körper, versteift sich, als er hört, was die Cops besprechen, die inzwischen das Zimmer erreicht haben, in dem ungefähr gestern um diese Zeit ein Irrer ein Massaker angerichtet hat.
»Sieht genau aus wie vorhin«, sagt der eine.
Der andere antwortet mit einem kindischen: »Bäh!«, was die Situation jedoch ziemlich gut beschreibt.
»Also raus hier«, sagt der Bäh!-Macher.
»Warte«, sagt der andere Cop. »Lass uns zuvor noch kurz in die anderen Räume schauen.«
Der Blick des Kerls, der meinen Körper gerade an der Wand zerquetscht, zuckt nach links, zum Badfenster hin. Dann wieder zu mir, und jetzt lächelt er nicht mehr.
Er nickt mir zu, ich nicke zurück, denn uns ist beiden klar, dass das die einzige Chance ist, die wir haben.
Hinter dem Fenster dürfte der verwilderte und jetzt stockdunkle Garten sein, und von dort aus müsste man es aus dem Grundstück hinaus und bis auf den Innenhof schaffen. Falls uns die Cops nicht jeweils eine Kugel in den Rücken jagen.
Er nickt mir noch mal zu, löst sich dann von mir (wobei mein Körper leise »Schade …« ächzt, trotz der Gefahr, in der wir uns befinden)und tut einen Schritt in die Mitte des Zimmers, wo ein mittelgroßer Badschrank steht.
Er greift ihn sich, als wäre es eine leere Apfelkiste, hebt ihn über den Kopf und lässt ihn dann durch das Fenster fliegen, das mit ohrenbetäubendem Splittern zerspringt.
Na so was, denke ich, und ich Dummerchen hatte gedacht, er würde das Fenster leise aufschieben und dann unauffällig verschwinden wollen.
Doch eigentlich denke ich das erst später. Im Moment besteht mein gesamtes Bewusstsein eigentlich nur aus Panik, während es meinen Körper fröhlich mit Adrenalin flutet.
Er schnappt sich einen weiteren Schrank, diesmal einen Kleiderschrank, was auch immer der im Bad verloren hat. Mit einem Ächzen schiebt er das schwere Ding vor die Tür, dann ist er mit einem Satz beim Fenster beziehungsweise was davon noch übrig ist, und setzt hindurch. Wie in Trance taumele ich hinterher, während ich die hastigen Schritte der Polizisten auf dem Flur vernehme.
Einer stellt dem anderen die ausgesprochen intelligente Frage, ob er das gerade gehört habe? Kunststück, denke ich, vermutlich gibt es keinen in den angrenzenden Häusern, der das nicht gehört hat.
Unter dem Fenster steht er, die blauen Wahnsinnsaugen zu mir aufgerichtet wie ein Romeo unter dem Balkon seiner Julia und reckt mir seine Hand entgegen. Ich ergreife sie und klettere dann ebenfalls hindurch, wobei ich darauf achte, mich nicht an den im Rahmen verbliebenen Glasscherben zu schneiden.
Dann rennen wir.
Wir haben ungefähr die Mitte des verwilderten Gartens erreicht, als die beiden Cops aus dem Badfenster zu rufen beginnen, wir mögen doch bitte stehen bleiben und unsere Hände fein artig über den Kopf erheben. Natürlich tun wir nichts dergleichen. Wir nehmen stattdessen lieber unsere Beine in die Hand.
Ich setze über eine flache Hecke, als ich auch schon den niedrigen Gartenzaun vor mir sehe. Der kleine Garten auf der anderen Seite führt zu der Toreinfahrt, durch die ich hergekommen bin, erinnere ich mich. Wenn ich die erreicht habe, muss ich nur noch auf die Straße schlendern, als wäre es die normalste Sache der Welt und dann gemütlich das Weite suchen. Die Cops werden nämlich allesamt damit beschäftigt sein, in das Haus zu stürmen, um ihren Kollegen von dort aus in den Garten hinaus zu folgen.
Zumindest hoffe ich das.
Ich springe über den Zaun, bleibe dabei allerdings mit meinem Schuh hängen und plumpse auf der anderen Seite ziemlich unsanft auf die Erde. Die zum Glück weich ist, offenbar habe ich irgendjemandes Beet erwischt. Ich setze es auf die Liste meiner heutigen Karmaschulden, als ob die nicht auch so schon lang genug wäre.
Dann blicke ich auf.
Nichts.
Ich sehe mich um, spähe über die Hecke in Richtung Haus. Aber es bleibt dabei. Mister Fantastic ist spurlos verschwunden.
Ich bin allein. Offenbar ist irgendwann in der Zwischenzeit das Signal für »Jeder Mann für sich selbst!« ausgerufen worden. Fein, denke ich, dann eben auch jede Frau für sich.
Dann mache ich, dass ich von hier verschwinde.