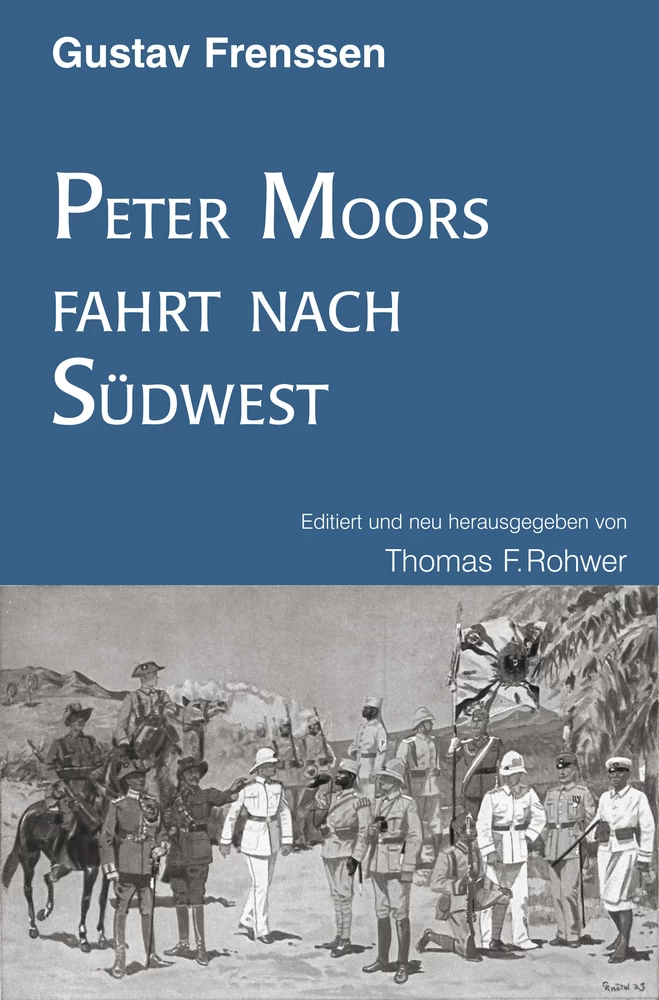Günter Frenssen - Peters Moors fahrt nach Südwest
Editierte vollständige Neuausgabe
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Aus heutiger Sicht betrachtet, zumal in Zeiten der “Cancel-Culture” und der Idee, historische Ereignisse wie auch historische Texte ausschließlich aus heutiger, aktueller Perspektive zu bewerten, mag die Idee ungewöhnlich erscheinen, einen Text wie Peter Moors Fahrt nach Südwest neu herauszugeben.
Das gilt umso mehr, als der Autor dieses fiktiven Tatsachenberichtes heute als Parteigänger der Nationalsozialisten einsortiert wird - und das zweifellos völlig zu recht.
Kann man also ein Werk, ein Buch von der Person seines Autors trennen? Selbstverständlich kann man das, denn der literarische oder sonstige Wert eines Buches ändert sich ja nicht dadurch, daß die Person des Autors nunmehr anders bewertet wird. Über den Autor Gustav Frenssen kann sich der Leser in der kurzen Biographie einen Eindruck verschaffen, die dieser Neuausgabe beigefügt ist. Frenssen kann spätestens seit 1932 oder 1933 als überzeugter Nazi eingestuft werden, vielleicht sogar schon seit den 1920er Jahren. 1906, als er Peter Moors Fahrt nach Südwest schrieb, war er es nicht. In jener Zeit war er ein typischer nationalistischer Untertan des Deutschen Kaiserreichs.
Das Buch selbst verblüfft den Leser. Wer um die genaueren Umstände seiner Entstehung nicht weiß, wird es unweigerlich für eine echte, authentische und persönliche Schilderung der Kriegserlebnisse eines einfachen Soldaten während des Herero-Krieges im “Schutzgebiet” Deutsch-Südwest-Afrika halten.
Es ist in der “Ich-Form” verfasst, es trifft die Sprache und die Denkweise, wie man sie sich für den Sohn eines Schmiedemeisters aus Itzehoe der Zeit der Jahrhundertwende um 1900 vorstellt. Die Kriegserlebnisse sind in keiner Weise geschönt, die Beschreibung ist realistisch bis zur Brutalität, auch findet sich keine Kriegsverherrlichung oder Romantisierung, wie es für viele Bücher dieser Art aus dieser Zeit so typisch ist.
Allein - “Peter Moor” hat es nie gegeben, und sein Erfinder Gustav Frenssen hat nicht am Herero-Krieg teilgenommen, er war nie in Afrika, er war auch überhaupt niemals Soldat, nicht einmal als Wehrpflichtiger im Kaiserreich. Das blieb ihm als studiertem Theologen und Pfarrer erspart. Als Frenssen den “Peter Moor” erfand, war er allerdings bereits so bekannt und angesehen als Schriftsteller, daß er lange Unterhaltungen mit einer Reihe von Teilnehmern des Krieges führen konnte, vom Generalarzt bis zum kleinen Unteroffizier. Und ganz offensichtlich war er in der Lage, die ihm geschilderten Kriegserlebnisse so aufzugreifen, daß er einen realistischer erscheinenden Kriegsbericht verfassen konnte als so manche Autoren, die diesen oder einen anderen Krieg tatsächlich mitgemacht hatten.
Peter Moors Fahrt nach Südwest kann insofern also auch heute noch als eine sehr eindrückliche Schilderung des grausamen Krieges in Südwest-Afrika gelesen werden. Liest man das Buch kritisch, kommt das kaiserlich-deutsche Militär dabei nicht allzu gut weg - die Idee, mit ein paar hundert Soldaten gegen eine feindliche Streitmacht mit fünfstelliger Zahl zu kämpfen, kann schon als etwas größenwahnsinnig bezeichnet werden, und hat dann ja auch entsprechende Verluste zur Folge gehabt.
Der Krieg der deutschen Kolonialmacht und ihrer einheimischen Verbündeten gegen das Volk der Hereros wird heute, völlig zu recht, als Völkermord angesehen, denn aus dem Versuch, einen Aufstand niederzuschlagen, wurde die Absicht, ein ganzes Volk samt Frauen und Kindern in die Wüste zu treiben und dort verhungern und verdursten zu lassen. Bemerkenswert ist, und auch das macht die Lektüre von Peter Moors Fahrt nach Südwest so interessant, dabei der Umstand, daß diese historische Schlussfolgerung und moralische Bewertung schon 1906 beim Erscheinen des Buches eigentlich zwingend war, denn Frenssen lässt seine Hauptfigur “Peter Moor” genau dies erleben und auch mitmachen: die Ermordung der einheimischen Bevölkerung in dieser deutschen Kolonie.
Ebenso bemerkenswert sind auch einige Dialoge zwischen den erfundenen Figuren mit ihren realen Vorbildern, die darum gehen, ob es mit der christlichen Überzeugung und dem christlichen Verständnis von Brüderlichkeit vereinbar sei, andere Menschen zu Sklaven zu machen. Frenssens Buch ist eine Abenteuergeschichte, keine politische oder gar moralisch-ethische Abhandlung, aber wer das Buch liest, wird mit all diesen Fragen direkt und unverblümt konfrontiert. Und das war 1906 beim Erscheinen des Buches schon genauso, wie es heute bei der Lektüre ist.
T.F.R.
Wie auch bei allen anderen in der Maritimen Bibliothek neu herausgegebenen Werken der historischen Marine-, Militär- und Expeditions-Literatur wurde die zugrunde liegende Originalausgabe sorgfältig editiert und von der ursprünglichen Ausgabe in Fraktur-Schrift in ein modernes, für den heutigen Leser besser und leichter lesbares Satzbild überführt.
Der Neuausgabe liegen in diesem Fall zwei verschiedene digitalisierte Originalausgaben aus der Zeit vom Beginn des 20.Jahrhunderts zugrunde. Dies wurde nötig, weil sich bei der Editierung herausstellte, daß eine der Ausgaben offenkundig erheblich gekürzt worden ist, teilweise ist dies vermerkt, teilweise auch nicht.
Zum einen handelt es sich um die 1914 bei Henry Holt and Company, New York, erschienene ins Englische übersetzte Ausgabe (Herman Bason M.A. Ph.D., Professor of German, Purdue University), aus dem Bestand der University of California.[1] Zum anderen liegt eine bereits von anderer Hand digitalisierte Ausgabe der deutschen Ausgabe von 1907 zugrunde, erschienen in der G.Grote’schen Verlagsbuchhandlung Berlin.
Aus diesen beiden Vorlagen wurde die Gesamtausgabe extrahiert, die nach Einschätzung des Herausgebers als vollständige Originalausgabe angesehen werden kann.
Wie üblich bei den Neuausgaben der Maritimen Bibliothek wurde die ursprüngliche Schreibweise unverändert übernommen. Nur offensichtliche Setz- bzw. Druckfehler wurden korrigiert.
Zum leichteren Verständnis für den Leser wurde einigen Kapiteln eine Reihe von erläuternden Fußnoten hinzugefügt. Das Original selbst hat keinerlei Fußnoten.
Abgesehen von zwei Illustrationen und einer Landkarte aus der Originalausgabe, die entsprechend vermerkt sind, handelt es sich bei den Abbildungen in dieser Neuausgabe um zeitgenössische Illustrationen sowie eine Karte der Kolonien und unabhängigen Staaten Afrikas um 1900 aus dem Archiv des Herausgebers.
[1] Es handelt sich dabei um eine zweisprachige Ausgabe, die eine ins englische übersetzte und die gekürzte deutsche Originalausgabe enthält.
Das “Schutzgebiet Deutsch-Südwestafrika” war von 1884 bis 1915 deutsche Kolonie auf dem Gebiet des heutigen Staates Namibia. Mit einer Fläche von 835.100 km² war es ungefähr anderthalbmal so groß wie das damalige Deutsche Kaiserreich. Deutsch-Südwestafrika war die einzige der deutschen Kolonien, in der sich eine nennenswerte Anzahl deutscher Siedler niederließ.
Die traditionelle Landwirtschaft zu Beginn der deutschen Kolonialzeit basierte auf dem Sammeln von Naras (einem Kürbisgewächs) und Gummi arabicum sowie den Anbau von Mais, Weizen, Tabak, Kürbisse und Melonen, vor allem durch das Volk der Ovambos. Handel wurde vor allem mit Guano, Fellen, Elfenbein und Hörnern betrieben. Die ersten Missionare bauten auch Gemüse, Obst und Weintrauben an. Die ersten deutschen Siedler beschäftigten sich hauptsächlich mit der Viehwirtschaft. Die Zahl der gehaltenen Rinder stieg von rund 121.000 im Jahre 1910 auf 205.000 drei Jahre später.
Im Süden entwickelte sich eine Wollschaf- und Ziegenzucht. Ziegen und Schafe waren im Lande seit jeher weit verbreitet und lieferten in erster Linie Fleisch. Europäische Züchter experimentierten mit Merino- und Karakulschafen, deren Zahl rasch anwuchs. Von den 135.500 km² landwirtschaftlicher Nutzfläche waren 1913 nur 56 km² bebaut – meist mit Mais, Kartoffeln oder Kürbissen. Der geplante Ausbau bewässerter Flächen fand kriegsbedingt (durch den Ersten Weltkrieg ) nicht mehr statt.
Bereits vor dem Fund von Diamanten wurden in Deutsch-Südwestafrika Bodenschätze nachgewiesen. Die früh gehegte Hoffnung auf abbauwürdige Goldvorkommen erfüllte sich jedoch nicht. Stattdessen stand der Abbau von Kupfererzen nach den Diamanten an zweiter Stelle. Kupfer wurde vor allem bei Tsumeb und Otavi sowie am Khan-Rivier gefördert. In der Umgebung von Karibib wurde ein Marmorwerk errichtet und Marmor zur Verschiffung nach Deutschland vorbereitet.
Laut Deutschem Kolonial-Handbuch gab es folgende Bevölkerungszahlen
zur Jahrhundertwende (1900):
Hottentotten ca. 1.800
Orlam ca. 2.000
Baster 1000–1200
Bergdama 35.000
Herero 65.000
Ovambo 60.000
Deutsche und andere Europäer 3338 (im Jahr 1900)
Auf den Farmen wurden eingeborene Arbeitskräfte angeworben, die meist aus dem Ovamboland stammten, wobei diejenigen Landwirte, die ihre einheimischen Arbeitskräfte schlecht behandelten, oft Schwierigkeiten bei der Rekrutierung hatten. Hereros und Buschmänner waren für Arbeit im Sinne der Kolonisten kaum einsetzbar. Die Maßregeln zur Kontrolle der Eingeborenen von 1907 (Gouvernementsverordnung Nr. 82 vom 18. Aug. 1907 gegen das “Vagabundieren”, das die nomadischen Völker natürlich stark betraf) brachten zahlreiche Eingeborene dazu, lohnabhängige Beschäftigungen anzunehmen.
Der Bau der ersten, in einer Spurweite von 600 Millimetern angelegten Bahnstrecke Swakopmund–Windhoek begann 1897. Die bislang ausschließlich verfügbaren Ochsenwagen waren schon länger als unzureichend kritisiert worden, der Ausbruch der Rinderpest brachte dann 1897 das Transportwesen zum Zusammenbruch. Die vollständige Strecke wurde am 19.Juli 1902 eröffnet. Ab 1903 baute die Otavi Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft (OMEG) mit der Otavibahn ebenfalls eine Strecke ab Swakopmund, die bis Kranzberg parallel zur staatlichen Strecke nach Windhuk verlief. In Otavi verzweigte sich die Strecke nach den Endpunkten Tsumeb und Grootfontein. Mit der Strecke erschloss die OMEG die ergiebigen Kupferlagerstätten rund um Otavi.
Das durchschnittliche Klima in “Deutsch-Südwest-Afrika” war heiß und trocken, das weitestgehend aride Klima ist subtropisch kontinental. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Landesteilen. Aufgrund der besonderen klimatischen Verhältnisse ist eine landwirtschaftliche Nutzung des Landes nur in beschränktem Maße möglich: im Hochland vor allem Viehzucht (im Norden eher Rinder, im Süden eher Schafe und Ziegen), im relativ regenreichen Norden auch Ackerbau.
In der Namib westlich der Abbruchstufe bleiben Niederschläge äußerst selten Selbst im Winter erreichen die Temperaturen oft 25°C und mehr. In den heißesten Sommermonaten Dezember und Januar liegen die Temperaturen meist deutlich über 30°C, während sie in den kältesten Monaten, Juli und August, nachts bis zum Gefrierpunkt sinken können, tagsüber dann aber wieder auf rund 25°C steigen. Morgens und abends ist besonders im Winter mit Temperatursprüngen von mehr als 20°C innerhalb weniger Stunden zu rechnen. Im Binnenhochland kann es wegen der großen Höhe nachts sogar Frost und in ganz seltenen Jahren auch Schneefälle geben. In der Kalahari verhält es sich ähnlich wie in der Namib. Die Niederschläge sind dort etwas häufiger, aber immer noch wüstentypisch selten.

Die Geschichte der sogenannten “Seebataillone” der Kaiserlichen Marine reicht bis ins 17.Jahrhundert zurück. Die kurbrandenburgische Marine verfügte seit 1684 über ein eigenes “Marinier-Corps”, also eine Marineinfanterie, die fast so alt ist wie die erstmals 1664 aufgestellten englischen “Royal Marines”. Das “Marinier-Corps” bestand noch noch über die Auflösung der brandenburgischen Marine hinaus bis 1721. Erst 1744 wurde es durch Umwandlung in das Garnisons-Bataillon Nummer 12 zu einer Heereseinheit.
Im Zuge des Wiederaufbaus der Preußischen Marine wurde im Januar 1850 in Stettin ein Königlich Preußisches Marinierkorps (auch Marinir-Korps) aufgestellt. Ein Zug dieses Bataillons nahm am Gefecht von Tres Forcas in Marokko am 7.August 1856 teil. Die Einheiten wurden an Land und an Bord eingesetzt.
Zusammen mit der Preußischen Marine wurde das Seebataillon 1867 zunächst Teil der Marine des Norddeutschen Bundes. 1870 hatte das Seebataillon eine Stärke von fünf Kompanien mit 22 Offizieren und 680 Unteroffizieren und Mannschaften, Standort des Bataillonsstabs war Kiel.
Nach Gründung der Kaiserliche Marine im Zuge der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 wurde das Seebataillon um eine sechste Kompanie verstärkt. Am 1.Oktober 1886 wurde das Seebataillon geteilt, Stab und I.Halbbataillon blieben in Kiel, während das II.Halbbataillon nach Wilhelmshaven verlegt wurde. Am 12.März 1889 wurden die beiden Halbbataillone dann in eigenständige Seebataillone zu vier Kompanien umgewandelt. Am 3.Dezember 1897 wurde ein drittes Seebataillon im Marinestützpunkt Cuxhaven aus der 1. und 2.Kompanie des I.Seebataillons und der 3. und 4. Kompanie des II.Seebataillons aufgestellt und zum Schutz des Deutschen Pachtgebiets Kiautschou nach Tsingtau verlegt.
Die Offiziere der Marineinfanterie ergänzten sich seit 1866 nur noch aus der Armee, wohin sie nach ihrer Dienstzeit (üblicherweise zwei Jahre) wieder zurückkehrten. Die Unteroffiziere kamen zum Teil aus Armee-, zum Teil aber auch aus verschiedenen Marinelaufbahnen.
Die Marineinfanterie der Kaiserlichen Marine diente hauptsächlich der Verteidigung der Reichskriegshäfen, wurde jedoch im 19.Jahrhundert aus Mangel an seemännischem Personal auch an Bord der Panzerschiffe eingesetzt. Die “Seesoldaten” wurden überwiegend zum Wachdienst und als Geschützbedienung herangezogen.
Seit 1895 wurden die Soldaten der Seebataillone nicht mehr an Bord von Kriegsschiffen eingesetzt, sondern als Interventionstruppe in den Kolonien. 1894 wurde eine Kompanie aufgrund des Dahomey-Aufstands nach Kamerun entsandt, 1904 ging während des Aufstands der Herero und Nama ein Verband in Bataillonsstärke zur Unterstützung der Schutztruppe nach Deutsch-Südwestafrika. 1905-1906 unterstützte ein Detachement der Marineinfanterie die kaiserliche Schutztruppe während des Maji-Maji-Aufstands in Deutsch-Ostafrika. Bei der Intervention während des “Boxer-Aufstandes” in China 1900-1901 wurden das I. und II.Seebataillon mit Verstärkung durch eine Pionierkompanie und eine Feldbatterie als Marine-Expeditionskorps nach Ostasien entsandt.
Im Ersten Weltkrieg wuchsen die Marine-Infanterie-Truppen schließlich bis zu einer Stärke von drei Divisionen an, die an der Flandern-Front an der belgischen Nordseeküste eingesetzt wurden.

In den Jahren nach 1830, also lange vor der Kolonialisierung Südwestafrikas, war die Volksgruppe der Nama von dem nach neuem Weideland suchenden, nomadisierenden Hirtenvolk der Herero immer stärker bedrängt worden. Mit Hilfe der neuzeitlich bewaffneten Orlam-Afrikaner unter deren Kaptein Jonker Afrikaner konnten die Nama ihre Stammesgebiete verteidigen und waren mit ihren Verbündeten nach Norden gezogen. Es begann nun zwischen den Nama und den Herero ein Jahrzehnte anhaltender Raub- und Verteidigungskrieg. Jonker und seine Orlam-Afrikaner stießen bis in das zentrale Stammesgebiet der Herero bei Okahandja vor und töteten dort eine große Zahl von Hereros.
Das Ende des Vormarsches der Orlam-Afrikaner und der Nama wurde in drei Schlachten 1863 und 1864 in Otjimbingwe besiegelt. Dort gelang es den Hereros mit Hilfe des schwedischen Abenteurers Karl Johan Andersson, der aus Herero-Kriegern eine Armee gebildet und sie mit modernen Feuerwaffen und zwei Feldgeschützen ausgerüstet hatte, ihre Feinde entscheidend zu schlagen.
Nach einer zehnjährigen Friedenspause begannen die landesweiten Angriffe und Plünderungen durch die Nama unter ihrem Kaptein (Häuptling) Hendrik Witbooi erneut. Auch der inzwischen stationierten, zahlenmäßig unterlegenen deutschen Schutztruppe gelang es nicht, die Hereros zu schützen und den Kampf der Nama zu beenden, weshalb die Hereros aus Protest für kurze Zeit ihre Schutzverträge mit den Deutschen wieder aufkündigten. Erst als die Schutztruppe mehrfach verstärkt worden war, gelang es dem kommandierenden Offizier, Major Theodor Leutwein, 1894 die Nama zu unterwerfen. Das führte zunächst zu einer Freundschaft zwischen dem deutschen Kommandeur Leutwein und Samuel Maharero, dem neuen Kaptein der Ovahereros.
Diese Freundschaft konnte allerdings nicht zu einem auf Dauer tragfähigen allgemeinen Bündnis zwischen den deutschen Kolonialherren und den Hereros ausgebaut werden. Zwei Hauptgründe führten schließlich zu einem allgemeinen Aufstand des Volkes der Hereros. Zum einen beanspruchten die deutschen Siedler immer größere Teile des Landes für sich, was vor allem auch daran lag, daß Klima und Bodenbeschaffenheit nur eine sehr extensive Landwirtschaft zuließen. Zum anderen machten sich zunehmend eine rassistische Einstellung der deutschen Siedler und der Kolonialverwaltung gegenüber den Hereros und Nama bemerkbar.
Wirtschaftliche Lebensgrundlage der Hereros war traditionell die Rinderzucht. Nachdem es 1897 zum Ausbruch einer Rinderpest kam, wurden die Herden der Hereros stark dezimiert. Gleichzeitig kam es zu einer immer stärker werdenden Aneignung des Landes, insbesondere wertvoller Weidegründe durch die deutschen Siedler, und zu Betrügereien, durch die die deutschen Siedler sich in den Besitz der Rinder bringen wollten. Beides machte den Hereros stark zu schaffen.
Durch die daraus folgende Verarmung waren viele Hereros gezwungen, Lohnarbeit auf deutschen Farmen anzunehmen. Hereros, die noch Vieh besaßen, gerieten immer öfter in Konflikte mit den Deutschen, wenn sie ihr Vieh auf nunmehr von Siedlern beanspruchtem Land weiden ließen. Dies erregte den Zorn der Siedler, die die Hirten oft gewaltsam vertreiben ließen.
Ab der Legislaturperiode 1893/1894 hatte sich der Reichstag mit der Grund- und Bodenfrage der Hereros und Nama im deutschen “Schutzgebiet” befasst. 1897 wurde unter Mitwirkung der Rheinischen Mission ein für die Nama zu reservierendes Territorium in einer Größe von 120.000 Hektar vertraglich geregelt.
Neben dem existenzbedrohenden Verlust immer größerer Weidegebiete war es die rassistische Diskriminierung der Hereros, die als Auslöser für den Aufstand wirkte. So förderte die bis zum Verbot 1902 lange Jahre geübte Kreditvergabepraxis der deutschen Kaufleute den Unmut der Hereros, nach der die Kapteins für die Schulden ihrer Stammesmitglieder aufkommen sollten.
Andere Konflikte kamen hinzu. Im Juli 1900 sprachen sich zum Beispiel 75 Bürger der südwestafrikanischen Stadt Windhuk in einer Eingabe an die Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes gegen die Abschaffung der Prügelstrafe mit den Worten aus: “Für Milde und Nachsicht hat der Eingeborene auf die Dauer kein Verständnis: er sieht nur Schwäche darin und wird infolgedessen anmaßend und frech gegen den Weißen, dem er doch nun einmal gehorchen lernen muss, denn er steht geistig und moralisch doch so tief unter ihm.” Die rassistische Gesinnung hinter solchen Forderungen ist offenkundig.
Diverse Fälle von Vergewaltigung und Mord von Siedlern gegenüber den Hereros, die nur milde oder überhaupt nicht geahndet wurden, verstärkten die Spannungen weiter.
Um ihre Herrschaft zu sichern, versuchten die deutschen Kolonialbehörden, die Zufuhr von Waffen ins Land zu unterbinden, um so die Kampfkraft der Einheimischen zu verringern. Das stieß allerdings auf entschiedenen Widerstand bei den Betroffenen, die sich generell nicht in das immer weiter ausgebaute deutsche Ordnungs- und Registrierungssystem einzwängen lassen wollten.
So entwickelte sich aus dem Zähl- und Registrierungsvorhaben der Kolonialverwaltung bei den Bondelswart-Nama in Warmbad im Oktober 1903 eine kaum geplante, aber dennoch heftige militärische Auseinandersetzung, die sich bis über das Jahresende hinzog und erst nach Einsatz von Verstärkungstruppen aus dem Norden des Landes am 27.Januar 1904 mit einem Sieg der Deutschen beendet werden konnte.
Dadurch aber war das Zentrum des Landes ohne ausreichende militärische Sicherung, was es der Verwaltung in Windhuk unmöglich machte, auf die Anfänge des von Okahandja im Landesinneren ausgehenden Herero-Aufstandes vom Januar 1904 mit ausreichender Stärke zu reagieren.
Unmittelbar vor dem Aufstand sammelten sich die Hereros in der Region Waterberg, offiziell wegen anhaltender Erbschaftsstreitigkeiten um den Tod des bedeutenden Waterberg-Hererokapteins Kaonjonia Kambazembi (1843–1903). Die Deutschen bemerkten bald, daß die Hereros in den letzten Wochen vor dem Aufstand verstärkt Vorräte und anderes aufkauften.
Am 11. oder um den 20.Januar 1904 verabschiedete Samuel Maharero in Osona den Befehl zum Aufstand, mit folgender Resolution als Zusatz:
“An alle Großleute meines Landes. Ich bin Samuel Maharero, Oberhäuptling der Hereros. Ich habe einen Befehl an all meine Leute angefertigt, dass sie nicht weiter ihre Hände legen sollen an folgende: Engländer, Bastards, Bergdamara, Nama, Buren. Alle diese rühren wir nicht an. Tut dies nicht! Ich habe einen Eid geschworen, dass dieser Beschluss nicht bekannt werden darf, auch nicht den Missionaren.”
Häuptling Daniel Kariko sagte später aus, dass die Hererogroßleute auch vereinbarten, alle deutschen Frauen und Kinder sowie Missionare und ihre Familien zu verschonen.
Die Verschonungsbefehle Mahareros und der Großleute wurden bis auf wenige Ausnahmen beachtet und Frauen und Kinder, die aufgegriffen wurden, zu deutschen Siedlungen geleitet. Dort waren sie willkommene (weil einzig präzise) Informationsquellen für den deutschen Stab. Die deutschen Männer wurden allerdings unterschiedslos ermordet.
Militärisch war die Lage für die deutsche Kolonialverwaltung zunächst prekär. Rund 8000 Hereros standen zunächst einer nur etwa 2000 Mann starken Schutztruppe gegenüber. In ihren Planungen hatten die Aufständischen jedoch die Fähigkeit des Deutschen Reiches unterschätzt, größere Truppenkontingente in nur kurzer Zeit über See nach Afrika zu verlegen. Nachdem dies erkannt worden war, gab es für die Hereros militärisch nur noch die Möglichkeit, die Deutschen zu besiegen, bevor diese wesentliche Verstärkungen erhalten konnten.
Am 17.Januar erging der Befehl zur Mobilmachung eines “Marine-Expeditionskorps”. Auf diese Truppe bezieht sich auch Frenssens Roman Peter Moors Fahrt nach Südwest.
Das Expeditionskorps war zusammengesetzt aus einem Marineinfanterie-Bataillon (“Seebataillon”) mit vier Kompanien, einer Maschinenkanonenabteilung, einer Sanitätsabteilung und einem Proviant- und Materialdepot. Die Gesamtstärke betrug 30 Offiziere, 648 Unteroffiziere und Seesoldaten sowie 25 Pferde. Es ist leicht zu erkennen, daß auch diese Truppe an der deutlichen zahlenmäßigen Unterlegenheit der deutschen Kräfte gegenüber denen der Hereros nichts ändern konnte.
Als weitere Verstärkung wurde eine Einheit aus 22 Offizieren und 516 Soldaten aufgestellt, die sich aus tropentauglichen Offizieren und Soldaten aus allen deutschen Armeen (Preußen, Bayern usw.) zusammensetzte. Aus der Kolonie selbst wurden 1141 Reservisten, Landwehrangehörige und Freiwillige aufgebauten. Zusätzlich konnte noch die Unterstützung der einheimischen Baster, Witboois und Bethanien-Nama gewonnen worden.
Das nach Schätzung des Missionars Johann Jakob Irle kurz vor dem Krieg knapp 80.000 Menschen zählende Volk der Hereros konnte etwa 5000 bis 7000 Soldaten aufbieten. Die erfolgreiche Verteidigung aller größeren Stationen wie Okahandja und Omaruru und deren Entsetzung aus eigener Kraft war daher für die Deutschen von kriegsentscheidender Bedeutung.
Der deutsche Gouverneur Theodor Leutwein, der bis zu seiner Ablösung durch Generalleutnant von Trotha im Juli 1904 auch Kommandeur der Schutztruppe war, war sich der begrenzten eigenen Möglichkeiten und der Schwierigkeiten für die deutschen Truppen in dem nahezu unerschlossenen Land bewusst. Leutwein plante, möglichst zu einer politischen Lösung des Konflikts zu kommen.
Optimistische deutsche Meldungen sprachen anfangs von einer nur lokalen Erhebung der Hererobevölkerung. Doch dagegen sprach der oben aufgeführte Befehl von Samuel Maharero an alle Hereroführer. Bereits am 12.Januar 1904 umzingelten sie unter seinem Oberbefehl Okahandja, zerstörten die Eisenbahnbrücke bei Osona (Bahnstrecke Swakopmund–Windhoek) und kappten die wichtige Telegrafenverbindung in die Landeshauptstadt Windhuk.
Danach versuchte Samuel Maharero, die Baster unter Kaptein Hermanus van Wyk und die Nama unter Kaptein Witbooi in den Kampf einzubeziehen, was jedoch fehlschlug.
Es wurde von Seiten der Deutschen spekuliert, ob die ganz im Norden Südwestafrikas siedelnden Ovambo ebenfalls aufgerufen worden waren, in den Aufstand einzugreifen. Doch nur eine einzige Volksgruppe nördlich der Etoscha-Salzpfanne wagte mit rund 500 gut bewaffneten Kriegern am 28.Januar den Angriff auf das deutsche Fort Namutoni, das nur eine Notbesatzung von sieben Mann hatte, da die dort liegende Einheit bereits Richtung Süden zu den aufständischen Hereros abgezogen war. Nachdem sich die eingeschlossenen Deutschen ohne Verluste verteidigt hatten und rund 60 Angreifer tot waren, zogen sich die Ovambo zurück.
Erste Opfer des Krieges waren deutsche Siedler. Die Hereros brannten deren Höfe nieder und töteten meistens die Männer. Den Kriegern kam zugute, dass sich der Hauptteil der deutschen Schutztruppe und Gouverneur Leutwein im Süden befanden, um einen lokalen Aufstand der Bondelzwart niederzuschlagen. Dadurch befanden sich nur schwache deutsche Kräfte im Kampfgebiet.
Neben Angriffen auf Farmen wurden die ersten Schläge der Hereros gegen Depots, Eisenbahnlinien und Handelsstationen geführt. Dabei wurden rund 140 Deutsche getötet. An fast allen Orten wurde den deutschen Frauen und Kindern freies Geleit zur nächsten Schutzstation gewährt. Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit der Deutschen – im Aufstandsgebiet lagen nur zwei Ersatzkompanien – gelang es ihnen, die Städte und letztendlich auch die Telegraphenlinie zu halten.
Strategisch wichtig für die Deutschen in dieser ersten Kriegsphase war ein schon am 12.Januar aus Swakopmund abgefahrener improvisierter Panzerzug unter dem Befehl des Kommandanten der Swakopmunder Garnison, Leutnant Theodor Kurt Hartwig von Zülow, der die Trupps sichern konnte, die an mehreren Stellen die von den Hereros unterbrochene Schmalspurbahnstrecke nach Okahandja reparierten. Ziel war, den Belagerungsring um Okahandja zu durchbrechen. Erst dieser Panzerzug würde wieder eine rasche Truppenverschiebung gewährleisten. Am Abend des 13.Januar erreichte der Zug Waldau, hinter Wilhelmstal und 22 Kilometer vor Okahandja, wo es in der Nacht zu ersten Kampfhandlungen kam. In Waldau lagerten auch 500 Meter Schienenbaumaterial, das zu ersten Ausbesserungsarbeiten herangezogen wurde.
Das Kanonenboot SMS “Habicht” der Kaiserlichen Marine lag seit dem 10.Januar aufgrund der jährlichen Instandsetzungsarbeiten in Kapstadt vor Anker. Am 12.Januar 1904 erhielt die “Habicht” eine telegrafische Meldung. Am 14.Januar lief das Schiff nach Swakopmund aus.
Unmittelbar nach der Landung in Swakopmund am 18. Januar gab der amtierende Platzkommandant, Bezirksamtmann Viktor Fuchs, an Bord einen Bericht ab: Am 12.Januar hätten sich alle Hererostämme – mit Ausnahme der Otjimbinguer – erhoben, hätten Farmer getötet und sich deren Viehs bemächtigt. Windhuk, Okahandja, Omaruru hätten sie eingeschlossen, die Bahnlinie von Okahandja bedroht, Karibib und die Verbindung mit Swakopmund gestört. Hieraufhin sei Leutnant von Zülow mit sämtlichen dienstfähigen Mannschaften – Reserven und Landwehr, zusammen 60 Mann – von Swakopmund abgerückt, habe seine Truppe in Karibib durch Einziehen aller Wehrfähigen auf 110 Mann gebracht und diesen Ort, unter Mitnahme von Proviant für drei Tage, zum Entsatz Okahandjas verlassen. Leutnant von Zülows letzte Nachricht sei die Meldung von seinem Eintreffen in Okasise am 13.Januar. Zur Verstärkung Karibibs sei noch ein rund 20-köpfiger Trupp unter Baumeister Laubschat hinaufgesandt worden. Die Verbindung mit Karibib sei noch sichergestellt; die Lage dort werde aber mit jedem Tage bedrohlicher. Die Hereros hätten bereits mehrere Patrouillen abgeschossen, und die schwache Besatzung sei kaum imstande, den Ort für den Fall eines Angriffs zu halten. Auch aus dem Süden fehle jede Nachricht, es gebe nur Gerüchte, die 2.Feldkompanie unter Hauptmann Victor Franke sei auf dem Rückmarsch nach Windhuk. Auch mit dem Norden, wo Hauptmann Kliefoth (gefallen am 17.Dezember 1905) mit der 4.Kompanie in Outjo stationiert war, fehle jegliche Verbindung.
Den Oberbefehl über die Kolonie übernahm jetzt an Stelle des abwesenden Gouverneurs Korvettenkapitän Hans Gudewill, der Kommandant der SMS “Habicht”. Das Kanonenboot schiffe sofort ein Landungskorps aus zwei Offizieren, einem Arzt und 52 Matrosen aus. Der Führer, Kapitänleutnant Hans Gygas, 1.Offizier des Kanonenbootes, erhielt Befehl, nach Karibib zu marschieren und diesen Ort zu sichern, die Verbindung mit Swakopmund unter allen Umständen aufrechtzuerhalten, weitere Unternehmungen jedoch, wenn nicht dringend geboten, in Anbetracht der geringen Stärke des Landungskorps zu unterlassen. Der Befehlshaber der in Karibib stationierten Truppen, Oberleutnant Kuhn, hatte den Stadtplatz eilig verbarrikadieren lassen. Das Eintreffen des Marinekorps beruhigte die verängstigte weiße Bevölkerung.
Wie undurchsichtig und verwirrend die Lage aufgrund der damals schwierigen Kommunikation war, zeigt die Tatsache, dass der Platzkommandant in Swakopmund am 18. Januar immer noch nicht wusste, dass Hauptmann Helmuth Gustav Heinrich Kliefoth mit der 4.Kompanie nach einem heliographischen[1] Befehl aus Windhuk bereits am 9.Januar mit seinen 50 Mann und einem Geschütz aus Outjo abgerückt war und die zu Outjo gehörenden Lichtsignalstationen Etaneno und Okowakuatjivi befehlsgemäß bereits am selben Tag geräumt worden waren, da mit deren erfolgreicher Verteidigung nicht zu rechnen war. So konnte natürlich am 18.Januar keine heliographische Anfrage mehr aus Swakopmund nach Outjo gelangen, wobei am gleichen Tag ein genauer telegraphisch gesendeter Bericht von Hauptmann Kliefoths Marsch in Deutschland veröffentlicht wurde.
Am 14.Januar wurden die Postämter von Waldau und Waterberg von den Hereros zerstört. Gewalt brach auch in Omarasa, nördlich vom Waterberg, aus. Der Militärposten Waterberg wurde erobert. Auf den Panzerzug hatten diese Gefechte keinen Einfluss; er rollte weiter Richtung Okahandja. Dieser Vormarsch auf Schienen war ein erster Schritt zur Stabilisierung der deutschen Truppen, doch für entscheidende Vorstöße benötigten sie Nachschub. Dazu wurde der am weitesten nördlich bei Gibeon stehenden 2.Feldkompanie unter Hauptmann Franke Order erteilt, nach Norden abzurücken. Leutwein übergab Franke, da er selbst erst den Aufstand der Bondelzwaart niederschlagen musste, für die Zeit seiner Abwesenheit das Kommando. Die 380 Kilometer nach Windhuk, wo der nächste Schlag der Hereros erwartet wurde, konnte Franke in fünf Tagen zurücklegen.
Am 15.Januar wurde Hauptmann Kurt Streitwolf in ein Gefecht in Oparakane verwickelt und Leutnant von Zülow erreichte, nachdem das teilweise zerstörte Bahngleis zwischen Waldau und Okahandja notdürftig geflickt worden war, mit seinem Panzerzug Okahandja.
Am 16.Januar begann die Belagerung von Gobabis, und eine deutsche Kompanie aus Outjo geriet in Okanjande, nahe dem heutigen Otjiwarongo, in einen Hinterhalt.
Franke hatte sich nicht lange in Windhuk aufgehalten, sondern war nach Okahandja gezogen, wo er, gemeinsam mit dem Panzerzug, die Hereros aufhielt und sie in den Kaiser-Wilhelm-Bergen in einem Gefecht schlug. Damit war Okahandja am 27. Januar wieder in deutscher Hand. Weiter nach Norden marschierend, konnte Franke auch die Städte Karibib und das belagerte Omaruru am 4. Februar entsetzen. Fast alle Geländegewinne der Hereros waren somit zunichtegemacht, und die Bahnlinie war wieder offen.
Die Nachricht vom Aufstand war zwischenzeitlich in Deutschland eingetroffen. Die Reichsregierung befahl, Marineinfanterieeinheiten in Marsch zu setzen, die in einer Stärke von zwei Seebataillonen (500 Mann) am 21. Januar eingeschifft wurden. Zur selben Zeit wurde eine Freiwilligentruppe aus Angehörigen des Heeres aufgestellt. Die dafür benötigten Gelder wurden im Deutschen Reichstag nach eingehender und kontroverser Debatte, bei Stimmenthaltung der SPD, bewilligt.
Am 12 Februar traf Leutwein aus dem Süden kommend ein und übernahm das Oberkommando. Samuel Maharero hatte in der Zwischenzeit um Waffenhilfe beim Nama-Kapitän Hendrik Witbooi ersucht; diesen erreichten Mahareros Briefe jedoch nicht. Die Nama kämpften so noch bis zum September 1904 auf deutscher Seite. Außerdem hatte Maharero Schwierigkeiten, die eigenen Truppen, bei denen auch die Frauen und Kinder waren, zu verpflegen und zu führen. Die Verhandlungen, die Leutwein im Folgenden wie einst mit Witbooi nun auch mit Maharero führte, sah Berlin als Zeichen der Schwäche des Gouverneurs. Auch kamen sie zu keinem Ergebnis. Doch Leutwein wusste nun, wo sich der Hererohäuptling aufhielt.
Für das kommende Vorgehen wurden die Kampfverbände der Deutschen in drei Abteilungen gegliedert. Die rund 100 Mann starke Westabteilung marschierte von Omaruru aus Richtung Otjihanamaparero-Berg und erreichte ihn am 25 Februar. Dort hatten sich bereits rund 1.000 Hereros um ein Wasserloch verschanzt. Ihre Stellung war sehr gut gewählt und konnte von Deutschen nur sehr schlecht angegriffen werden. Da ein Frontalangriff für Major von Estorff ausschied, versuchte er die Flanken des Gegners “aufzurollen”. Dies gelang aber erst, nachdem Teile des rechten Flügels (2.Feldkompanie) dem linken (4.Feldkompanie) beistanden. Nach neun Stunden Kampf konnten die Deutschen das Wasserloch in Besitz nehmen, und der geschlagene Hereroverband zog sich in Richtung Waterberg zurück. Nach dem Kampf marschierte die Westabteilung nach Okahandja, um sich mit der Hauptabteilung zu vereinigen. Am 24.März erreichte sie die.
Die 412 Mann starke Ostabteilung, bestehend aus meist unerfahrenen Männern, hatte den Auftrag, ein Gebiet in der Größe Bayerns zu sichern. Am 14.Februar marschierten die Einheiten aus Windhuk in Richtung Kampfgebiet ab. Doch sie erreichten nur gerade verlassene Siedlungen. Die Hereros waren ihnen militärisch immer einen Schritt voraus. Schließlich entschloss sich von Glasenapp gegen den erhaltenen Befehl, den Spuren der Tetjo-Hereros Richtung Westen zu folgen und nicht die Ostgrenze abzusperren.
Da das Versorgungslager der Ostabteilung aber in Gobabis war, wurden die Nachschubwege immer länger. Bei einem Versuch, die Rinderherden der Tetjo-Hereros für sich in Besitz zu nehmen, geriet ein Kundschaftertrupp unter von Glasenapp in einen Hinterhalt. Dreizehn Mann wurden getötet. Leutwein befahl die Abteilung am 11.März nach Okahandja, damit sie die Hauptabteilung beim Kampf gegen Maharero unterstützen könne. Später wurde der Befehl geändert. Nun sollte die Ostabteilung Fühlung zu den Tetjos halten und dem ursprünglichen Befehl nachkommen, die Ostgrenze abzuriegeln.
Eine größere Schlacht fand dann am 9.April statt, als Oberst Leutwein die rund 3.000 Mann starke Hauptmacht der Hereros bei Onganjira angriff und ihre Stellungen nach achtstündigem Gefecht durchbrach. Zwei weitere Gefechte für die Deutschen günstigen fanden am 9.April bei Onganjira und am 12.April bei Oviumbo statt. Die Hereros zogen danach in Richtung Waterberg ab. Am 13.April bestand Leutweins Truppe bei Okatumba ein schweres zehnstündiges Gefecht. Ende April brachen bei der Kolonne Glasenapps Typhuserkrankungen aus, die eine hohe Zahl an Opfer forderten.
Am 3.Mai 1904 wurde nach der Abberufung Oberst Theodor Leutweins als Oberkommandierender und Beschränkung auf das Amt des Gouverneurs, gegen den Protest führender Schutztruppenoffiziere, Adrian Dietrich Lothar von Trotha zum Oberkommandierenden von Deutsch-Südwest-Afrika ernannt, mit dem Auftrag, den Aufstand der Hereros niederzuschlagen. 1896 war Trotha bereits verantwortlicher Kommandeur bei der blutigen Niederschlagung der Wahehe-Rebellion in Deutsch-Ostafrika gewesen. Major Ludwig von Estorff, der spätere Kommandeur der Schutztruppe schrieb, “Wissmann, der ihn von Ostafrika her kannte, hatte sich seiner Ernennung widersetzt, aber er ward nicht gehört. Wie soll das in großen Verhältnissen werden, wenn sich schon jetzt solcher Mangel an Menschenkenntnis daheim offenbart.”
Am 11. und 12.August 1904 versuchte Trotha in der entscheidenden Schlacht am Waterberg, mit seinen Truppen die versammelten Hereros einzukesseln und zu vernichten. Dies gelang jedoch nicht, und ein großer Teil der geschlagenen Hereros floh unter schweren Verlusten mit Angehörigen und Vieh nach Osten in die Omaheke-Wüste. Es kam nun zu einem Konflikt zwischen Gouverneur Leutwein und Trotha. Ersterer wollte die Hereros nun schonen und sie als Arbeitskräfte bei der weiteren Kolonialisierung des Landes einsetzen, Trotha hingegen wollte sie vernichten. Trotha setzte sich durch und riegelte die Omaheke ab, um eine Rückkehr der Hereros zu verhindern, “da ich mit den Leuten weder paktieren kann noch ohne ausdrückliche Weisung Seiner Majestät des Kaisers und Königs will”. Major von Estorff wurde angewiesen, mit seinen Truppen den Flüchtenden nachzusetzen und sie immer wieder von eventuell dort gefundenen Wasserstellen zu verjagen.
Die wasserlose Omaheke sollte vollenden, was die deutschen Truppen begonnen hatten: die Vernichtung des Volkes der Hereros.
Am 2. Oktober 1904 erließ General von Trotha eine Proklamation an das Volk der Hereros, die später als “Vernichtungsbefehl” bekannt wurde:
“Ich der große General der Deutschen Soldaten sende diesen Brief an das Volk der Herero. Die Hereros sind nicht mehr deutsche Untertanen. Sie haben gemordet und gestohlen, haben verwundeten Soldaten Ohren und Nasen und andere Körperteile abgeschnitten, und wollen jetzt aus Feigheit nicht mehr kämpfen. Ich sage dem Volk: Jeder der einen der Kapitäne an eine meiner Stationen als Gefangenen abliefert, erhält 1000 Mark, wer Samuel Maharero bringt, erhält 5000 Mark. Das Volk der Herero muss jedoch das Land verlassen. Wenn das Volk dies nicht tut, so werde ich es mit dem Groot Rohr[2] dazu zwingen. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen, ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück, oder lasse auf sie schießen. Das sind meine Worte an das Volk der Herero. Der große General des mächtigen Deutschen Kaisers.”
Ergänzt wurde die Proklamation durch den nur der eigenen Truppe zu verlesenden Zusatz:
“Dieser Erlass ist bei den Appells den Truppen mitzuteilen mit dem Hinzufügen, dass auch der Truppe, die einen der Kapitäne fängt, die entsprechende Belohnung zuteil wird und dass Schießen auf Weiber und Kinder so zu verstehen ist, dass über sie hinweggeschossen wird, um sie zum Laufen zu zwingen. Ich nehme mit Bestimmtheit an, dass dieser Erlass dazu führen wird keine männlichen Gefangenen zu machen, aber nicht zu Grausamkeit gegen Weiber und Kinder ausartet. Diese werden schon fortlaufen, wenn zweimal über sie hinweggeschossen wird. Die Truppe wird sich des guten Rufes des Deutschen Soldaten bewusst bleiben.”
Während der ersten Verfolgungsaktion längs der Grenze der Omaheke, die Trotha am 13.August 1904 befohlen hatte, wurden alle aufgegriffenen Männer sofort erschossen, und auch zahlreiche Erschießungen von Frauen und Kindern sind dokumentiert. Die Hereros kannten zwar die Wege durch die Omaheke entlang der Wasserstellen. Um die vielen Menschen und Tiere auf der überstürzten Flucht zu versorgen, reichte deren Kapazität jedoch nicht aus. Die Deutschen orientierten sich ebenfalls am Verlauf der Trockenflüsse und den Wasserstellen und verwickelten die Fliehenden in Gefechte. Zwar konnten ihre Kontingente bei den geographischen und klimatischen Bedingungen keine wirksame Verfolgung leisten. Aber nach der Historikerin Gesine Krüger hatte Trotha bald erkannt, dass es ausreichen würde, den Gegner in das Sandfeld zu treiben, um ihn durch Durst und Entbehrungen zu ”vernichten”. Ende August gingen die Deutschen erneut gegen die Herero vor, um sie von den Wasserstellen am Rand des Sandfeldes zu vertreiben. Verhandlungsangebote von Herero-Führern schlug Trotha aus. Eine Gruppe von 11 Großleuten der Hereros wurde am 2.November 1904 in Ombakala bei Verhandlungen von Angehörigen der deutschen Schutztruppe erschossen. Wilhelm Maharero nannte später diesen Vorfall als Grund dafür, nicht mit den Deutschen zu verhandeln und stattdessen lieber auf britisches Gebiet zu flüchten. Nach Gesine Krügers Arbeit, versuchte Trotha seine Politik, das Sandfeld durch Patrouillen so weit wie möglich gegen Rückkehrer abzuschließen, bis zu seiner Abberufung im November 1905 durchzusetzen.
Am 8.Dezember 1904 erging der Gegenbefehl Kaiser Wilhelms II., dass Hereros, die sich nicht an Krieg und Tötungen beteiligt hätten, Gnade zu erweisen sei. Einen Tag bevor Trotha am 12.Dezember 1904 seinen “Vernichtungsbefehl” zurücknahm, hatte er telegraphisch am von Reichskanzler von Bülow die ausdrückliche Unterstützung dafür erhalten, die Hereros zur Zwangsarbeit einzusetzen und hierfür geeignete Sammellager zu errichten. Der Plan wurde daraufhin umgesetzt, während der Krieg im Osten laut oben beschriebenem Geheimbefehl fortgesetzt wurde.
[1] Der Heliograph (auch Spiegeltelegraf) nutzt einen Spiegel zur Reflexion von Sonnenlicht zu einem entfernten Beobachter. Bei einer Bewegung des mSpiegels sieht der entfernte Beobachter Lichtblitze, die dazu genutzt werden können, Informationen durch eine vordefinierte Signalkodierung zu übertragen.
Dieses Verfahren wurde u.a. von den deutschen Kolonialtruppen in Afrika zur Nachrichtenübermittlung angewandt.
[2] “Groot Rohr” - das “große Rohr”, eine gegenüber den Einheimischen verwendete Bezeichnung für die Kanonen der deutschen Artillerie.




Wie viele zeitgenössische Schriftsteller und wie viele seiner Zeitgenossen überhaupt, machte Gustav Frenssen im Laufe seines Lebens eine Wandlung von einem nationalkonservativen Weltbild, einem Weltbild des “völkischen Nationalismus”, hin zu einem überzeugten Nationalsozialisten durch.
Wie viel von der Wandlung auf eine echte, tiefere Überzeugung zurückzuführen ist, und wieviel eher Folge eines beschämenden Opportunismus, soll an dieser Stelle dahingestellt bleiben. Dem Herausgeber dieser Neuausgabe geht es ausschließlich um die halb fiktive, halb autobiographische Darstellung des Einsatzes eines einfachen Soldaten des 1.Seebataillons in Kiel während des sogenannten “Herero-Krieges” in der damaligen kaiserlich Kolonie “Deutsch-Südwest-Afrika”.
Gustav Frenssen hatte zehn Jahre zuvor angefangen, Bücher zu schreiben. 1863 in Barlt (einen kleinen Dorf zwischen Marne und Meldorf in Dithmarschen) als Sohn eines Tischlermeisters geboren, besuchte Frenssen nach der Volksschule zunächst das Gymnasium in Meldorf, später dann das in Husum. Nach dem Abitur 1886 studierte er Theologie an den Universitäten in Tübingen, Berlin und Kiel. 1890 wurde er “Zweiter Pastor” in Hennstedt, einem etwas größeren Dorf nördlich von Heide, und heiratete die Tochter eines Dorfschullehrers. Zwei Jahre später, 1892, wurde er Pastor im nahegelegenen Hemme.
1896 veröffentlichte er sein erstes größeres literarische Werk, Die Sandgräfin, und 1901 den Entwicklungsroman Jörn Uhl, der beim Publikum wie bei der Literaturkritik beachtlichen Erfolg hatte. Hermann Löns wie Rainer Maria Rilke sollen das Buch gelobt haben. Der schriftstellerische Erfolg machte es Frenssen jedenfalls möglich, 1902 seine Pfarrersstelle (damals im Gegensatz zu den heutigen Verhältnissen äußerst schlecht bezahlt) aufzugeben und von der Tätigkeit als Schriftsteller zu leben. 1903 bekam er für seine Dorfpredigten von der Universität Heidelberg den Ehrendoktortitel für Theologie verliehen.
1905 veröffentlichte Frenssen den Roman Hilligenlei, benannt nach einer Dithmarscher Warft[1], der eine Auflage von 120.000 Exemplaren erreichte. 1906 erschien das hier neu aufgelegte und editierte Buch Peter Moors Fahrt nach Südwest, das die Geschichte eines jungen Mannes beschreibt, der als einfacher Soldat in das 1.Seebataillon in Kiel eintritt, eine der drei damals aufgestellten Einheiten der kaiserlich-deutschen Marineinfanterie. Schnell wird die Einheit nach Südwestafrika eingeschifft, wo in der damaligen deutschen Kolonie “Deutsch-Südwest-Afrika” ein blutiger Krieg zur Niederwerfung eines Aufstandes der einheimischen Bevölkerung tobt.
“Peter Moor” ist eine fiktive Figur, auch wenn Frenssen nicht zuletzt durch die Form der “Ich-Erzählung” sehr gut den Eindruck beim Leser erweckt, er lese den urpersönlichen Bericht eines Soldaten über seinen Einsatz in diesem Krieg.
Tatsächlich hatte Gustav Frenssen seine Popularität als Schriftstellers geholfen, mehrere Kriegsteilnehmer des “Herero-Krieges” dafür zu gewinnen, ihre Kriegserlebnisse mit ihm zu teilen. Dazu gehörten vor allem Generaloberst Dr. Schian, der als reale Person unter seinem eigenen Namen im Roman auftritt, Leutnant Klinger, ein “weltreisender Vagabund”, der während des Krieges auf Seiten der Deutschen kämpft, und ein Student Namens Michaelsen, der als “Einjähriger”[2] Heinrich Gehlsen im Buch auftritt. Hinzu kamen Informationen von zwei oder drei Unteroffizieren, die persönlich am “Herero-Krieg” teilgenommen hatten. Auch “Peter Moor” erreichte eine Auflage von über 100.000 Exemplaren.
Trotz dieses Erfolges beschäftigte sich Frenssen danach literarisch nicht mehr mit dem Thema Kolonien oder Kolonialkriege. In den 1920er wurde Frenssen, dessen Werke in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden und besonders auch in Skandinavien beliebt waren, sogar für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen. Laut Arno Schmitt[3] war Frenssen so von sich eingenommen, daß er den Umstand, nicht für den Preis ausgewählt worden zu sein, nicht auf eine möglichweise dann doch nicht ausreichende Qualität beziehungsweise Bedeutung als Schriftsteller zurückführte, sondern auf die “Kabalen einer Judenclique”. Insgesamt erreichten die Bücher von Frenssen eine Auflage von etwa drei Millionen.
Politisch begann Gustav Frenssen als “Nationalkonservativer” und trat 1896 in Friedrich Naumanns “Nationalsozialen Verein” ein und blieb bis zu dessen Auflösung 1903 Mitglied. Wie auch Naumann war Frenssen Fürsprecher für ein deutsches Kolonialreich, und schon 1898 prägte er in seinem Roman Die drei Getreuen die Parole vom “Volk ohne Raum” und beschäftigte sich mit zeitgenössischen rassebiologischen Schriften.
Gustav Frenssen lebte von 1902 bis 1906 in Meldorf und danach in Blankenese. 1919 zog er zurück an seinen Geburtsort Barlt. Wie viele Dithmarscher seiner Zeit war er zwar nationalliberal und antidemokratisch gesinnt, begrüßte jedoch die Oktoberrevolution und lehnte die Weimarer Republik zunächst nicht ab. Walther Rathenau bezeichnete er als “vornehmsten Kopf in Deutschland”.[4]
Letztlich vertrat Frenssen die Idee von einem “starken Deutschland” mit deutlich autoritären Zügen und wurde schließlich zum Feind der Weimarer Republik.[5] Ab 1923 sind in seinen Werken Anzeichen für einen verstärkten Antisemitismus zu erkennen.[6] Bei der Reichspräsidentenwahl 1932 wählte er Adolf Hitler und unterstützte nach 1933 offen die NSDAP. 1933 unterschrieb er das “Gelöbnis treuester Gefolgschaft” für Hitler und unterstützte die Ausgrenzung der Juden und trat für die Euthanasie ein.[7]
Im Oktober 1933 ließ sich Frenssen in die gleichgeschaltete Preußische Akademie der Künste, Sektion Dichtung, aufnehmen, die sich ab 1939 Deutsche Akademie der Dichtung nannte, und wurde Ehrensenator des Reichsverbands Deutscher Schriftsteller, einer Unterabteilung der Reichsschrifttumskammer. 1933 erhielt er den Raabepreis. 1938 verlieh ihm Adolf Hitler die Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft.
Er war Vorstandsmitglied des 1936 gegründeten Eutiner Dichterkreises, einer der bedeutendsten Autorengruppen in Nazi-Deutschland.[8] 1936 erschien sein Buch Der Glaube der Nordmark, mit dem er sich endgültig von der christlichen Religion abwandte und eine Art nordisches Neuheidentum vertrat. Bürgerlich-konservative Sexualmoral lehnte er nun ab. 1937 erschien Vorland. Grübeleien, seine Notizen aus den Jahren 1920 bis 1935. In dem darin enthaltenen fiktiven Tagebuch der Amtmannschaft Wittschild, eines Deutschlands im Jahre 2023, sprach er sich für radikale Maßnahmen der Eugenik und Euthanasie aus.[9] 1938 veröffentlichte er Der Weg unseres Volkes.
1940 erschienen seine Autobiographie Lebensbericht, die von Großstadtfeindlichkeit, Antiintellektualismus und Antisemitismus geprägt ist, sowie Recht oder Unrecht – mein Land!, in dem er die Verfolgung der Juden und das Weltmachtstreben der Nationalsozialisten rechtfertigte. Sein vorletztes Buch Lebenskunde erschien 1942. Es beschäftigt sich u. a. mit dem Thema “Menschenzucht”. Sein letztes Buch, die Erzählung Der Landvogt von Sylt (1943), handelt eigentlich von zwei Inhabern dieses Amtes: von Uwe Jens Lornsen und seinem Nachfolger Hans Nicolai Frenssen (1798–1833), einem entfernten Verwandten des Autors. In den letzten Kriegsjahren arbeitete Frenssen vorwiegend für den Rundfunk und die Reichspressestelle der NSDAP.
Nach seinem Tod 1945 geriet Frenssen weitgehend in Vergessenheit. In der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR wurden viele seiner Werke auf die Liste der “auszusondernden Literatur” gesetzt.
Im Westen bezeichnete Arno Schmidt Frenssen als einen “Vertreter exemplarischer literarischer und gesellschaftlicher Anti-Moderne” und einen “chauvinistischen Scharfmacher”.[10] Frenssen habe durch seine öffentliche Parteinahme gegen “Juden und jüdische Künstler” vor und während der NS-Zeit eine große Mitschuld an den Verbrechen an den Juden während des Nationalsozialismus. Literarisch fällt Arno Schmidts Urteil gespalten aus. Einerseits könne man “90% seiner Produktion schlicht als Edelkitsch” bezeichnen; andererseits lobte er Frenssens 1300 Seiten langen Roman Otto Babendiek ausdrücklich und schreibt: “Ich bin weder verrückt, noch ein Winkelried der Objektivität, und setze mich also nicht für eine Frenssen-Renaissance ein; aber der Otto Babendiek wäre, ungekürzt & ungehudelt, in Großauflage sofort wieder auf den Markt zu bringen: dieses Buch darf unserer Literatur nicht länger fehlen ...”[11] Frenssen starb kurz vor Kriegsende, am 11.April 1945, an seinem Geburtsort Barlt.
In der Bundesrepublik wurde nach 1945 Frenssens publizistische Unterstützung des NS-Regimes lange Zeit überwiegend verdrängt und der Autor vielfach geehrt. Insbesondere in Schleswig-Holstein wurden z.B. Straßen nach ihm benannt. Erst ab 1983 wurden solche Straßen in Heide, Hamburg-Blankenese, Brunsbüttel, Meldorf, Marne und Hannover mit Verweis auf Frenssens Verstrickungen in den Nationalsozialismus umbenannt.
[1] Warft - ein aus Erde aufgeschütteter Siedlungshügel, der dem Schutz von Menschen und Tieren bei Sturmfluten dient, und vor allem auf den Halligen vor der schleswig-holsteinischen Nordseeküste anzufinden ist. Auf einer Warft können sich je nach Ausmaß Einzelgehöfte oder auch Dorfsiedlungen (Warfen- oder Wurtendörfer) befinden. Bei Sturmflut ziehen sich die Halligbewohner auf die erhöhte Warft zurück, in der Hoffnung, daß der höchste Wasserstand die Gebäude auf der Warft nicht erreicht. Die bereits seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. entstandenen Hügel waren lange vor dem Deichbau der einzig wirksame Hochwasserschutz.
[2] “Einjähriger” - die sogenannten “Einjährigen” waren zunächst im Königreich Preußen und dann im Deutschen Kaiserreich Wehrpflichtige mit höherem Schulabschluss (Obersekundareife), die nach freiwilliger Meldung einen Wehrdienst in einem Truppenteil ihrer Wahl als Präsenzdienst ableisteten. Nach Abschluss der Grundausbildung stand ihnen die Möglichkeit offen, Offizier der Reserve zu werden.
[3] Arno Schmidt: Ein unerledigter Fall – zum 100. Geburtstag von Gustav Frenssen. In Die Ritter Vom Geist – Von vergessenen Kollegen, Karlsruhe 1965, S. 137f.
[4] Es ist ein Jammer! Dieser vornehmste Kopf in Deutschland – man sah es äußerlich ganz deutlich; es gab keine drei solche Schädel in Europa –, von den engsten und versteinertsten Gehirnen im Land zerschmettert.”, Gustav Frenssen: Briefe aus Amerika. Berlin 1923, S. 81; zitiert nach: Andreas Crystall: Gustav Frenssen. Sein Weg vom Kulturprotestantismus zum Nationalsozialismus. Gütersloh 2002, S. 337.
[5] Hans Sarkowicz, Alf Mentzer: Literatur in Nazi-Deutschland. Ein biographisches Lexikon. Hamburg 2002, S. 171
[6] Ulrich Pfeil: Vom Kaiserreich ins ”Dritte Reich”: Heide 1890–1933. Selbstverlag Heide 1997. Zugleich Hamburger Universitätsdissertation 1995/96.
[7] Ulrich Pfeil, ebd.
[8] Uwe Danker, Astrid Schwabe: Schleswig-Holstein und der Nationalsozialismus, Neumünster 2005, Seite 88.
[9] Florian Dunklau: ”Wenn er stürbe, wäre ein Wertloser weniger.” – Frenssens ”Tagebuch der Amtmannschaft Wittschild” (1923), Heide 2014.
[10] Arno Schmidt: Ein unerledigter Fall – Zum Hundertjährigen Geburtstag von Gustav Frenssen. In: Die Ritter Vom Geist – Von vergessenen Kollegen. Karlsruhe 1965, S. 90 bis S. 166.
[11] Arno Schmidt: Ein unerledigerter Fall, in (ders.): Essays und Aufsätze 2, Bargfelder Ausgabe Bd. 4, S. 286 u. S. 289, Haffmans Verlag, Zürich, 1995
Kapitel I
Als ich ein kleiner Junge war, wollte ich Kutscher oder Briefträger werden; das gefiel meiner Mutter sehr. Als ich ein großer Junge war, wollte ich nach Amerika; da schalt sie mich. So um die Zeit, als die Schuljahre zu Ende gingen, sagte ich eines Tages, ich möchte am liebsten Seemann werden; da fing sie an zu weinen. Meine drei kleinen Schwestern weinten auch.
Aber am Tage nach meiner Schulentlassung stand ich, ehe ich recht bedachte, was mit mir geschah, in meines Vaters Werkstatt am Amboß, und unser Geselle, der aus Sachsen zugewandert war und schon lange Zeit bei Vater arbeitete, sagte: “Siehst Du – da stehst Du! Und da bleibst Du stehn, bis Du grau wirst,” und lachte. Da wir gerade eine gute Arbeit hatten, nämlich vor einem schönen Neubau an der Breiten Straße Tor und Gitter machten, gab ich mich zufrieden und blieb also die drei Jahre in der Werkstatt meines Vaters und arbeitete mit ihm und dem Gesellen und ging abends in die Gewerbeschule. Ich bekam zweimal einen ersten Preis.
Im zweiten Jahr meiner Lehrzeit, in meinem siebzehnten Lebensjahr, traf ich auf der Straße Heinrich Gehlsen, den Sohn vom Lehrer Gehlsen, der früher bei uns angestellt war und jetzt Hauptlehrer in Hamburg ist, mit dem ich als Junge zuweilen gespielt hatte. Er war einige Jahre älter als ich und war nun Student in Kiel. Während wir zusammen die Breitenburger Straße hinunter gingen, erzählte er mir, daß er im Herbst 1903 als Einjähriger beim Seebataillon eintreten wolle.
Ich fragte: “Warum willst Du gerade da eintreten?”
Er sagte: “Es ist eine feine Truppe. Und dann ist es möglich, daß man einmal auf Reichskosten übersee kommt. Denn wenn in irgendeiner unserer Kolonien ein Aufstand ausbricht, oder sonst in der weiten Welt was los ist, kommt zu allererst das Seebataillon unterwegs.”
Ich sagte nichts weiter dazu; aber ich dachte in meinem Sinn, daß ich später auch zum Seebataillon gehen könnte. Ich war schon einige Male in Kiel gewesen; und ich mochte auch die Uniform wohl leiden. Auch gefiel mir, was er von Übersee gesagt hatte. Ich wußte aber damals noch nicht, wie ich das Ding anfassen sollte.
Aber im nächsten Jahr erfuhr ich eines Tages von einem älteren Schulkameraden, der in Kiel bei den Fünfundachtzigern[1] diente, daß das Seebataillon[2] Dreijährig-Freiwillige annähme. Da fragte ich am selben Abend meinen Vater, als ich beim Aufräumen war und er mit seiner halblangen Pfeife durch die Werkstatt ging, um ein wenig die Straße entlang zu sehen, wie er abends zu tun pflegte: ob ich mich melden solle. Ihm gefiel das wohl; denn er hatte es bei den Einunddreißigern[3] in Altona bis zum Unteroffizier gebracht.
Er sagte also nichts weiter als: “Deine Mutter wird vor dem Wort ,See‘ bange werden.”
“Ja,” sagte ich, “aber sie hat doch die drei Mädchen.”
“Geh hin,” sagte er, “und stelle es ihr vor; sie ist in der Küche.”
Indem kam sie schon aus der Küche in die Werkstatt und sagte mißtrauisch: “Was steckt ihr noch die Köpfe zusammen?”
Sie meinte: weil es schon Feierabend war und die Arbeit getan.
Mein Vater sagte: “Der Junge will sich freiwillig beim Seebataillon in Kiel melden; Du mußt nicht bange werden: das Bataillon heißt nur darum so, weil es die Seefestung verteidigen muß. Und außerdem: wenn er sich nicht freiwillig meldet, kommt er vielleicht an die russische Grenze; und das ist weit weg.”
Da ging sie still in die Küche und sagte nichts weiter dazu, und gab mir im Herbst die Wäsche mit, alles heil und rein, wie es sich gehört; das meiste war neu. Und sie war ganz zufrieden, weil Kiel so nah‘ bei Itzehoe liegt. Auch hatte ihr unser Kaufmann, der in Kiel Verwandte hat, erzählt, daß viele gute Handwerkersöhne im Seebataillon dienen.
[1] (Holsteinisches) Infanterie-Regiment Nr. 85 “Herzog von Holstein”, ein Verband des Preußischen Heeres, aufgestellt 1866, aufgelöst 1919, mit Garnisonen in Rendsburg, Eckernförde, Neumünster und Kiel.
[2] siehe Kapitel “Seebataillon”
[3] (1.Thüringisches) Infanterie-Regiment Nr. 31 “Graf Bose”, ein Verband des Preußischen Heeres, aufgestellt ursprünglich 1812 in Thüringen, seit 1871 im damals schleswig-holsteinischen Altona (heute Hamburg) stationiert.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752141962
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (April)
- Schlagworte
- Kolonialismus Kolonialkrieg Kaiserliche Marine Deutsch-Südwest-Afrika Herero-Krieg Marinebataillon Roman Abenteuer