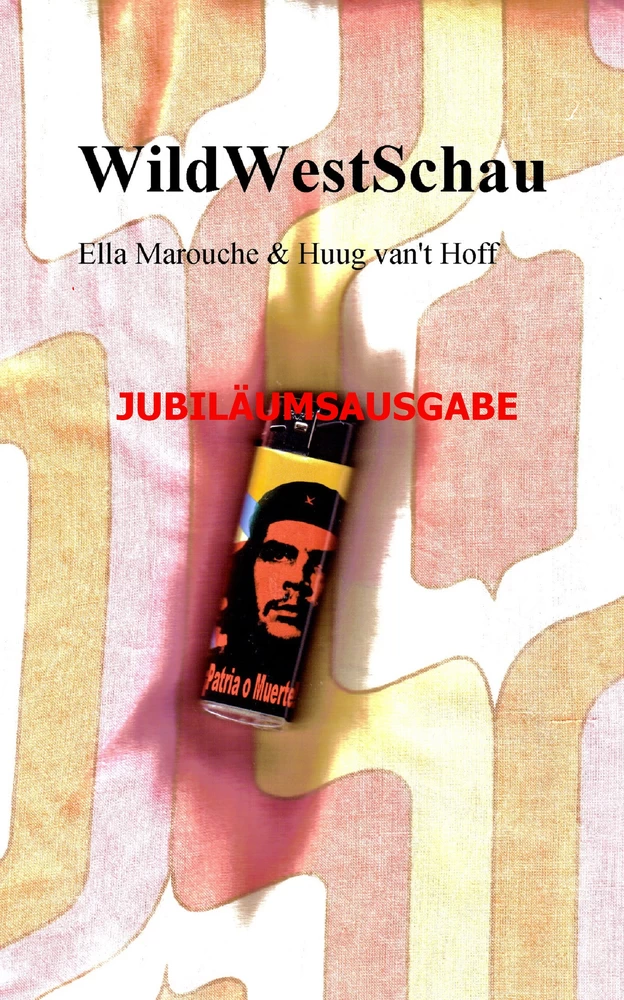Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Theater im Park, Beeschau
Hier möchte ich nicht einmal tot überm Zaun hängen, dachte Sebastian und zog die Vorhänge zu. Er hatte Kopfschmerzen. Schlimmer als die anderen Gastspielorte war dieser im Grunde auch nicht, allerdings bot das Beeschauer ›Theater im Park‹ neben der gewohnten Tristesse ländlicher Oberzentren ein weiteres perverses Vergnügen: den Blick auf die wartende Menge. In die wartende Menge, um genau zu sein, denn seine Garderobe, die nichts anderes war als das Büro des Kulturvereins, befand sich auf der Vorderseite des Gebäudes, direkt neben dem Haupteingang, und so staute sich die gesamte Kleinstadt aufgerüscht und erwartungsfroh vor seinem Fenster. Schlecht war ihm auch.
Ursprünglich war der stillgelegte Bahnhof dem Kulturverein nur ›übergangsweise‹ von der Stadt zur Verfügung gestellt worden, und weder der Kultur noch dem kleinen Backsteingebäude hatte man angesichts des derzeitigen konservativen Bürgermeisters eine lange Lebensdauer attestiert. Doch Totgesagte leben bekanntlich länger, und schnell war der hübsche Bau mit den überwucherten Geleisen den Beeschauern ans Herz gewachsen. Spender und Gönner ermöglichten Umbauten, Einbauten, Anbauten, und als das ›Theater im Park‹ schließlich offiziell und feierlich eröffnet wurde, pries die Witwe des Bürgermeisters seine Liebe zur Kultur.
Oh ja, die Bürger Beeschaus waren stolz auf ihr Theater. Was hatte es nicht schon für Gastspiele gegeben! Steppende Iren hatten die Statik auf die Probe gestellt, wehmütige Russen die Weisen ihres Landes gesungen, wobei allerdings nicht einmal die ortsansässigen, ehemals natürlich vertriebenen, Wolgadeutschen sie verstanden hatten, und auch abgehalfterte Musical-Sängerinnen waren schon beim Absingen ihrer Erinnerungen belauscht worden. Gruppen der benachbarten Kreise traten ebenfalls hier auf, denn eigentlich durfte jeder das Haus buchen, wenn er nur freundlich anfragte. Der Bibelkreis etwa, der jeden Dienstag mit seinen drei Mitgliedern auf größeren Zulauf harrte, oder die Theater AG des Gymnasiums. Mit dem Eifer der Jugend und dem sicheren Wissen, danach die Stadt zu verlassen, prügelte sich der jeweilige Abijahrgang durch ›Romeo und Julia‹, eine Tradition, deren Faszination vermutlich in ihrem Schrecken bestand. Natürlich hatten auch einige, vornehmlich mit Freizeit gesegnete Beeschauer Hausfrauen und Rentner ihre Liebe zu den Brettern entdeckt. So war das ›Ensemble Eva‹ entstanden, benannt nach seiner Gründerin Eva Nackenschneider, und die ›Combo Comedia‹ war die ganze Freude von Horst Zimmer, dem Geschichtslehrer.
Highlights blieben jedoch die Gastspiele, sie brachten die große Welt in den kleinen Ort. Recht selten. In der Zwischenzeit gab es andere Zerstreuungen. Frühjahrsmarkt, Herbstmarkt, Erdbeerfest, Schützenfest.
»Ich bin schon so gespannt«, sagte Susanne Bodenhaupt, die erste in der Warteschlange, zu ihrer Schwester Elisabeth, die, wie stets, einen Schritt hinter ihr stand.
Ihr kotzt mich ja so an, dachte Sebastian und bereute, dass er doch noch einen winzigen neugierigen Blick auf die Wartenden geworfen hatte. Wenn er Frauen wie die Bodenhaupt-Schwestern sah, vielleicht Mitte fünfzig, aber ganz bestimmt Kern des Bibelkreises, mit ihren ständig zu kurz gekommenen Körpern und den platt gekämmten mittellangen mittelblonden Haaren, fragte er sich stets aufs Neue, warum so wenig Leute soffen. Na, er tat es wenigstens. Immerhin musste er nicht mehr persönlich mit diesen Frauen reden. Die Verkaufspräsentationen selbst, das reine Anpreisen der vollkommen überteuerten Heizdecken und Steppbetten und Fußwärmer und was nicht noch, hatten ihm bei seinem alten Job nie Probleme bereitet. »Sehen Sie her, schlagen Sie zu, scheißteuer, aber billig verarscht«, das war ihm leicht von den Lippen gegangen, das hatte ihm an guten Tagen sogar Spaß gemacht. Zermürbend hingegen waren die Busfahrten gewesen. Denn zunächst einmal musste man den vergnügungssüchtigen Rentnern die Möglichkeit nehmen, vor dem angepriesenen Nepp davonzulaufen. Man karrte sie also irgendwo in die Pampa und versperrte ihnen den Fluchtweg. Während der Hinfahrt wollten die netten Damen noch unbedingt mit dem netten Herrn reden, weil sie sich so auf die nette Veranstaltung freuten, wo es doch sicher auch nett Mittagessen gab. Auf der Rückfahrt schwärmten sie dann gemeinschaftlich von ihren unglaublichen Schnäppchen.
Auch nicht angenehm. Zum Glück lag das hinter ihm.
Fahrig tastete Sebastian seine Jackettaschen nach Magentabletten ab, fand aber nur eine leere Schachtel, die er wütend neben den Papierkorb schleuderte. Dann eben nicht. Trotzig nahm er einen weiteren Schluck Asbach und zündete sich eine Zigarette an. »Dass Sie mir da aber nicht rauchen!«, hatte ihm eine wirklich hübsche, grässlich arrogante Göre beim Zuweisen der Garderobe zugeraunt, und wen interessierte das? Vielleicht wäre er dieser Göre gegenüber freundlicher gestimmt gewesen, wenn ihm jemand verraten hätte, dass es sich um die amtierende Beeschauer Erdbeerkönigin handelte. Garantiert hätte er höhere Stücke von ihr gehalten, wenn ihm klar gewesen wäre, dass sie die Gästebegrüßung nur übernommen hatte, um danach für den Rest des Abends sturmfreie Bude zu haben und just, während Sebastian sein verkorkstes Leben bedauerte, im elterlichen Ehebett endlich ihre Unschuld verlor.
»Sogar der Hammermörder Hamann?« Ungläubig schüttelte Elisabeth Bodenhaupt den Kopf.
»Ach…«, schnaubte ihre Schwester gereizt, um nicht zugeben zu müssen, dass sie selbst keine Ahnung hatte. Schließlich wollten sie sich heute Abend ein Stück ansehen, das bereits in über zwanzig deutschen Städten gelaufen war. In kleinen Städten, zugegeben, aber erfolgreich. Sehr erfolgreich. Ausverkaufte Häuser. Natürlich wusste sie, worum es ging! ›Die Gerechten‹ hieß die Truppe, und ihre Show nannte sich ›Deutsches Justiztheater‹. Eine ›RealityJustizsatire‹, hieß es in der Vorankündigung, die ›wahre Verhandlungen zeigen wird, die bereits in ihrer Skurrilität zum Brüllen komisch sind und einen Bühnenabend voller Spaß und Unterhaltung garantieren‹.
Na bitte, stand alles da, was musste ihre Schwester plötzlich so blöde fragen? Aber um eine Antwort kam sie wohl nicht herum.
»Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was am Hammermörder nun so komisch sein soll. Außerdem hat meine Freundin aus Hannover …«, und diese Freundin aus Hannover, die nicht nur keinen Namen hatte, sondern vermutlich nicht einmal eine Existenz, kam grundsätzlich dann ins Spiel, wenn es um Kultur ging, sie war gewissermaßen Susanne Bodenhaupts Kulturdiplom, »… das Stück schon in Berlin gesehen. Sie sagt, es gehe eher um die ulkigen Bonmots der Rechtsgeschichte.« Damit war die bewährte Hannoveranerin genau genommen schon disqualifiziert, denn in Berlin war das Stück nie gezeigt worden, aber das wusste niemand in der Warteschlange. Nicht einmal der Rentner Willy Großspur, obwohl Berlin sein Fachgebiet war. Sozusagen.
»In Berlin? In meiner alten Heimat? Ach, ick jloob et ja wohl nich.« Jede angemessene Distanz mühsam vermeidend schob er sich an die Schwestern heran. »Und wissense wat? In Berlin ha ick mal jelebt, und dit war juut. Wenn dit hier aus Berlin kommt, dann is dit och juut. Is ja logisch, wa?«
Susanne Bodenhaupt honorierte den Einwurf des pensionierten Kunstfreundes angesichts seiner weltmännischen Herkunft mit einem anerkennenden Nicken. Elisabeth hielt den Mund. Na also.
»In Berlin wurde das Stück sehr gut besprochen«, warf Susanne Bodenhaupt noch einmal unüberhörbar in die Menge der Wartenden und ruhte dann zufrieden in ihrer Überlegenheit. Auf Höhe ihrer immerhin vorhandenen Oberweite ruhte der Blick von Willibald Großspur, und so warteten alle etwas gelassener auf die Öffnung des Theaters und den Beginn der Vorstellung.
»Meine Damen und Herren, meine Ärsche und Sterze, meine … bäähh!« Vielleicht hätte ich vor der Vorstellung noch duschen sollen, dachte Sebastian Hemd und zog die Nase schnell wieder aus seiner Achselhöhle. Aber war das nicht scheißegal? War das nicht der eine Luxus, den man sich gönnen durfte, weil man es zu, nun ja, etwas gebracht hatte. Zweihundert Leute saßen da draußen. Bummelig. Und wie viel hatte jeder einzelne davon bezahlt? Na? So fünfzehn Euro vielleicht. Bitte schön! Nur, um ihn zu sehen. Also, seine Show. Sein Theater, seine Idee, seine Vision. Da durfte er ja wohl einen ganz leichten Achselgeruch haben. Künstlerschweiß. L’ eau de Genie! »Yes!« Noch einmal gönnte er sich einen großen Schluck aus der Flasche. Jawohl, fünfzehn Euro! Mehr war es denen nicht wert. Und dann musste er sich auch noch von Dorfklitsche zu Dorfklitsche hangeln, wo er die ›besseren‹ Büros als Einzelgarderoben bekam, und seine Truppe sich auf Sporthallenbänken für Zweitklässler die Wartezeit vertreiben musste. Mausgraue Zukunftsaussichten.
Gut sieht das aus, dachte Anna Haberland, die vom seitlichen Bühnenaufgang aus beobachtete, wie sich der Saal füllte. Platzreservierungen wurden von den Besuchern verglichen, einige standen wieder auf, setzten sich woanders hin, andere besetzten Plätze, um wenig später mal mehr, mal weniger freundlich, eines Besseren belehrt zu werden, kurzum: man benahm sich wie in einem richtigen, großen Theater und spielte die obligatorische Reise nach Jerusalem, die vor allem in den vorderen Reihen für entzückten Unmut sorgte, bot doch das Verwechseln der Plätze die schönste Möglichkeit, Rang-, Hack-, Platz- oder was für eine Ordnung auch immer frisch ins Gedächtnis zu rufen. Natürlich ging es nicht nur darum, Reviere zu markieren. Ein älterer Herr etwa fühlte sich schlicht zu weit von der Bühne platziert und fürchtete nun, kein Wort verstehen zu können, ein Pärchen wollte einfach nebeneinander sitzen und, was im Interesse aller lag, durfte es dann auch. Schließlich gab es noch eine junge Frau, die fünf Plätze gebucht hatte, weil ihr ihre Klaustrophobie gar keine andere Wahl ließ, und die nun mit Willibald Großspur einen Gegner vor sich hatte, der sie wahrlich zum Heulen brachte. Alles prima, dachte Anna und ging aufs Klo. Schon wieder. Die Leiterin des Beeschauer Kulturvereins hatte sich nämlich eine böse Blasenentzündung zugezogen, das passierte ihr häufiger, und irgendwie passte dieses latente Angeschlagensein auch zu ihrem Typ. Eine auffällige Schönheit war sie nicht, doch man könnte durchaus sagen, klassisch: mittelgroß, schlank und mit blondem Haar, das ihr schlicht gescheitelt auf die Schultern hing. Die wachen Augen zeugten von Intelligenz und ihr Lächeln, von dem vermutlich nicht einmal sie selbst wusste, ob es absichtlich oder zufällig auf ihrem Gesicht lag, verlieh ihr genau die richtige Portion friedlicher Melancholie. Die Rose unter den Mauerblümchen. Als Leiterin des Kulturvereins oblag Anna Haberland die Leitung des Theaters, dazu die Organisation sämtlicher Ereignisse, die sich irgendwie unter den Begriff Kultur drängen ließen. Waren alle anderen froh, einen Haufen Arbeit abgeschoben zu haben, so freute sich Anna ganz besonders, diese Tätigkeiten übernehmen zu dürfen. Als ehemalige ABM-Kraft der mickrigen Stadtteilbibliothek hätte sie sich keine steilere Karriere wünschen können.
»Nabend, schön, Sie zu sehen. Tschuldigung.« Zügig umschiffte sie die letzten Besucher, die noch im Foyer herumlungerten, und schob sich eilig in die Damentoilette, dankbar, es rechtzeitig geschafft zu haben.
»Scheiße, verdammte, das war knapp. Leck mich am Arsch, bin ich genervt von diesem Mist.« Laut aussprechen würde sie so etwas natürlich nicht, aber als stummen Stoßseufzer fand sie die Worte in so einer Situation ziemlich angemessen. Auf diese Aufführung hatte sie sich wirklich gefreut, und nun würde sie den Abend vor dem Theater verbringen müssen, weil sie schließlich nicht ständig Türen klappernd aus dem Saal rennen konnte. Der anstehenden Vorstellung stand sie zwar durchaus skeptisch gegenüber, aber ihre Neugier war groß. Schließlich hatte sie das ›Justiztheater‹ nach Beeschau geholt.
Ihre Skepsis hatte auch persönliche Gründe. Bevor sie an die Garderobe von Sebastian Hemd klopfte, atmete sie tief und genervt durch. Es fiel ihr schwer, zu so einem Schnösel freundlich zu sein. Bereits am Telefon, schon beim ersten Gespräch und auch bei der Buchung, hatte sie vermutet, dass er nicht ganz nüchtern gewesen war. Als sie ihm gegenüberstand, wusste sie, dass er schon lange nicht mehr ganz nüchtern gewesen war. Intendant, Chefdramaturg, Autor, Hauptdarsteller, da konnte er sich sonst was auf seine beißende Fahne schreiben, für sie war dieser Mann nichts anderes als ein mieser kleiner Heizdeckenverkäufer. Eine besondere Stärke von Anna war, sehr schnell sehr genau zu wissen, wen sie vor sich hatte.
»Herein!«
»Herr Hemd …«, säuselte sie professionell beim Öffnen der Tür und wusste im gleichen Moment, dass es ein Fehler war.
»Warum denn so förmlich? Wir sind doch Kollegen. Sebastian …« Schief grinsend hielt er ihr seine fischige Hand hin, besann sich, seiner Ansicht nach, noch einer eleganteren Lösung und bot ihr eine schlecht rasierte grünstichige Wange an. Anna schüttelte sich. Den Talar hatte er bereits übergestreift, doch hatte sich das sperrige Kleidungsstück seitlich an seinem Hosenbund verfangen und umrahmte somit feierlich den geöffneten Hosenschlitz, aus dem ein Hemdzipfel hervorlugte. Bislang hatte sie geglaubt, solche Figuren würde es nur auf schlechten Karikaturen geben.
»Herr Hemd«, wiederholte sie, diesmal keineswegs säuselig. Das da würde sie bestimmt nicht duzen. Lieber wäre sie mit den Bodenhaupts verwandt. Na gut, ganz entfernt verwandt. Dennoch war es kein schöner Anblick. Ein Häufchen Elend, das gerade fast über ihrem eigenen Schreibtisch zusammenbrach.
»Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie behilflich sein?«, fragte sie spitz. Meine Güte, hätte er sich nicht wenigstens die Mühe machen können, die Schnapsflasche vor ihr zu verstecken? Wie dem auch sei, beruhigte sie sich, mindestens zwanzig Auftritte hatte die Truppe schon hinter sich gebracht, vermutlich jedes mal mit diesem volltrunkenen Kipplaster, da würde es heute auch gut gehen.
Behilflich sein könntest du mir bestimmt, dachte Hemd, hatte sich aber tatsächlich noch so weit im Griff, dass er diese peinlichste aller Repliken für sich behielt. Irgendwie kam ihm die Frau bekannt vor. Das sagte er natürlich auch nicht. Schwerfällig stand er auf, fummelte mit fahrigen Bewegungen den Talar aus dem Hosenbund und hielt nach seiner Perücke Ausschau.
»Suchen Sie die?« Angewidert fischte Anna eine Art ehemaligen Wischmob aus ihrer Postablage.
»Ganz bestimmt.« Mit einer, wie er glaubte, schmissigen Bewegung nahm er ihr die Perücke aus der Hand und setzte sie sich auf die dünnen Haare. Ist ja ein ganz aufgewecktes Ding, diese Frau Kulturdingsda, hat alles im Blick. Alles im Griff, was? Die wär genau das Richtige für eine ganz persönliche After-Show-Party. Die hat was … Galantes, das war es. Er konnte sich wirklich nicht erklären, warum er das dringende Bedürfnis verspürte, ihr die Hand zu küssen. Wahrscheinlich sollte er auf Wodka umsteigen.
»Schön zu sehen, dass Sie ja dann so weit sind, Herr Hemd. Die Vorstellung beginnt in fünf Minuten.«
»Sie haben nicht zufällig ne Magentablette dabei?«
»Bitte?« Anna wippte inzwischen schon wieder sachte von einem Bein aufs andere, dabei wollte sie eigentlich vor Vorstellungsbeginn auch noch schnell beim Rest der Truppe in der Hauptgarderobe vorbeischauen.
»Na, einen Säureblocker. Ne Tablette. Oder meinetwegen auch so ein kleines Beutelchen mit Schleimzeug.«
»Bedaure. Dass gerade ihnen ein Schleimbeutel abgeht, überrascht mich allerdings.«
Absatzkehre, Tür zuschmeißen. Hemd lachte.
Keine halbe Stunde später hatte das Publikum bereits mehr als einmal herzhaft gelacht. Griffige Zoten, billige Kalauer, knapp zwanzig Jahre Kaffeefahrt und Aktionsfläche waren eine exzellente Schule gewesen. Hemd wusste, wo die sicheren Gags zu finden waren. Ich weiß, was ihr wollt, sagte er sich zum wiederholten Mal, während er auf der mit mickrigen Requisiten zum Gerichtssaal umgebauten Bühne saß, auf seinem Richterstuhl kippelte und sich durch den ersten Akt hetzte. Das Verfahren um den allseits bekannten ›Hauptmann von Köpenick‹ war von ihm um ein paar verbriefte Äußerungen gekürzt, dafür um ein paar Pointen erweitert worden, und wurde nun von seiner miesen Truppe zu Tode geleiert. Er brauchte etwas zu trinken.
»Der Hauptmann haben Befehl erteilt, und ich habe Befehl ausgeführt«, gab Bernd, armselig als Wachsoldat verkleidet, mit der Leidenschaft einer Frühkartoffel zu Protokoll, woraufhin Fred Vogel, der seine Aussage schon mühsam hinter sich gebracht hatte, demonstrativ auf der Zeugenbank zur Seite kippte, laut zu schnarchen begann und schließlich polternd auf den Boden krachte. Welch Überraschung. Slapstick geht immer. Das Publikum freute sich.
»Und dazu hatte er einen Befehl bekommen?«, fuhr der Richter den gefallenen Soldaten an, der sich langsam und ungelenk wieder aufrappelte. Ein blöder Kalauer, der Sebastian selbst nicht sonderlich gefiel, aber immer funktionierte. Und um etwas anderes ging es ja auch nicht.
»Hatte er …?«, stammelte Fred debil, denn noch war der Witz nicht tot. Mit überzogen Gesten und fragenden Blicken, die er zwischen Bank, Hinterteil und Richtertisch hin und her warf, konnte Fred die Lacher soweit anheizen, dass ein ernstes »Ich bitte um Ruhe im Gerichtssaal!« nötig wurde, unterstützt von den donnernden Schlägen eines übergroßen Holzhammers. Zunächst nahm das Gelächter dank dieser allzu erwarteten Pose noch einmal zu, wurde von Hammerschlag zu Hammerschlag leiser, bis nur noch vereinzelt Gekicher zu hören war, und auch das verstummte.
»Danke!« Das Publikum blieb ruhig. »Grenadier, sag Er, ist Ihm denn an dem falschen Hauptmann nichts aufgefallen?«
»Doch«, gab Bernd reumütig zu verstehen. »Er war so anständig. Nicht ein einziges Mal hat er mit uns geschimpft.«
»Das ist wirklich blöd«, stimmte Ingo zu, nachdem Anna über ihre Blasenentzündung und die damit verdorbene Abendplanung geschimpft hatte. Zur restlichen Theatertruppe war sie bis Vorstellungsbeginn auch nicht mehr gekommen, und nun stand sie gemeinsam mit dem Mann von der Abendkasse vor dem Theater auf der Straße und rauchte. Ingo war buchstäblich der Mann von der Abendkasse, nämlich von Gertrud, die am Nachmittag plötzlich krank geworden war. Ingo war ein netter Kerl. Etwas geknickt sah Anna auf ihre Armbanduhr, vermutlich gab es drinnen jetzt den zweiten Akt. Natürlich hatte sie das Stück nicht nach Beeschau geholt, ohne sich vorher bei Freunden und Bekannten, deren kulturellen Urteilen sie vertraute, darüber zu informieren. Ein Exfreund von ihr, der in einem kleinen Theater in Umsch beschäftigt war, hielt es für das ›mieseste Machwerk seit Erfindung der Doku-Soaps‹, was Anna als Garantie für einen Publikumserfolg wertete, und eine liebe Freundin, die mit dem Theaterbetrieb nichts zu tun hatte, war zwar nicht hellauf begeistert gewesen, sah im zweiten Akt aber ›durchaus ein gewisses Potential‹. Ein gewisses Potential konnte man in allem entdecken, dachte Anna, und wenn man weiß, dass es sich im zweiten Akt versteckt, steht man hinterher nicht ganz unbeholfen da. Sie warf ihre Zigarette in den sandgefüllten Blumenkübel und genoss für eine paar Minuten den schönen Sommerabend. Rasch wurde diese Freude jedoch getrübt, diesmal allerdings nicht durch stechenden Harndrang, sondern durch eine ziemlich attraktive Frau. Schwungvoll und ungelenk, diese motorische Kombination gelang nur Else Immerda. So parkte sie ihren Wagen auf dem Bordstein, und so stelzte sie auf Anna zu.
»Meine liebe Anna«, flötete sie, hauchte Wangenküsschen in die Luft und war schon vorbeigerauscht, hinein ins Foyer, jeden Protest bereits im Gedanken erstickend. Ernsthaft protestiert hätte sowieso niemand, denn Else Immerda war Journalistin beim Beeschauer Kurier, zuständig für den Bereich ›Feuilleton und Kultur‹, um genau zu sein, war sie der gesamte Bereich ›Feuilleton und Kultur‹. Die Presse, was für Einwände hätte man da wohl anbringen sollen. Gut, sie sah sich niemals ein Stück zu Ende an, häufig nicht einmal das Öffnen des Vorhangs, eigentlich lief sie grundsätzlich erst dann in den Zuschauerraum, wenn sich die Darsteller verbeugten. Dann fotografierte sie eifrig, und am nächsten Morgen zerriss sie das Stück. Oder lobte es in den Himmel, je nach Mondstand, Laune oder Hormonpegel. Aber all diese Dinge und die dadurch hervorgerufene abgrundtiefe Abneigung, die sie empfand, waren, so wusste Anna, ausschließlich privater Natur und mussten professionell ignoriert werden. Als Leiterin des Kulturvereins hatte sie gefälligst erfreut darüber zu sein, dass die Presse kam und schrieb. Und heute Abend, gestand sich Anna beschämt ein, hatte sie die Vorstellung ja selbst nicht gesehen. Himmel, konnte sie diese Zeitungselse nicht leiden.
»Danke, dass Sie heute einspringen konnten«, wandte sie sich an Ingo.
»Dafür nicht«, winkte er ab und drehte sich noch eine Zigarette. »Mach ich doch gern, wissen Sie ja. Komm ich mal raus. Seh ein paar Leute und so. Nicht wahr, was für die Birne, Kultur und so, nicht wahr. Theater ist schon spannend, find ich, nicht wahr?«
»Warum sehen Sie sich das Stück dann nicht an?«, hakte Anna nach.
»Ich hab schon mal eins gesehen. Und Gertrud meinte, die Stücke sind immer ähnlich. Beziehungskisten und so, nicht wahr?«
»Oft«, bestätigte sie, obwohl es nicht ganz die Antwort war, mit der sie gerechnet hatte.
»Sehen Sie, Frau Haberland. Und damals, ich meine, als ich da mal im Theater war, das hat mir nicht so gut gefallen, nicht wahr. Weil, also, nach ner halben Stunde tat mir der Hintern weh. Tschuldigung, mein Gesäß, nicht wahr. Und einfach so aufstehen kann man ja auch nicht. Stimmt’s oder hab ich recht?«
»Jaja.«
»Sag ich doch. Na, und wenn die alle ähnlich sind, mit den komplizierten Beziehungssachen und sowas, dann würd mir ja immer gleich …« Er beendete seinen Satz mit einem verkniffenen Gesichtsausdruck und rieb sich, um seiner Aussage Ausdruck zu verleihen, andächtig das Hinterteil. Wie gesagt, Ingo war ein netter Kerl, und Anna freute sich ernsthaft und ausgiebig über seine bestechende Logik. Schön, wenn jemand nicht versuchte, sie mit Weltwissen, unnützer Bildung oder gar Eloquenz zu beeindrucken. Ganz aus ihrer Haut konnte sie dennoch nicht. Irgendwie fühlte sie sich bemüßigt, den sitzschwachen Mann auf den Theatergeschmack zu bringen. War ja auch Ehrensache.
»Aber dieses Stück ist keine Beziehungskiste.«
»Aha…«
»Es ist wirklich etwas anderes. Nachgestellte Gerichtsverhandlungen. Und die im zweiten Akt sind besonders lustig.« Das hielt sie für das verführerischste Argument, wenn es auch gewissermaßen improvisiert war.
»So«, entgegnete Ingo, ganz leicht interessiert. »Worum geht das denn da?«
»Na, zum Beispiel …« Um einen Moment überlegen zu können, ließ sich Anna von Ingo noch einmal das Tabakpäckchen reichen. »Vor etlichen Jahren gab es doch die Verfahren um die Brandstifter, die später Terroristen wurden und sich ›rfa‹ nannten«, entschied sie sich schließlich für diesen Programmpunkt zur Beschreibung des Stückes. Daran konnte sich wohl jeder noch gut erinnern. Beinahe ein Jahrzehnt waren die Typen ja fast durch alle Zeitungen gegeistert, nahezu wöchentlich hatten neue Schreckensmeldungen für Aufregung und Panik in der entsetzten Republik gesorgt. Wer zu jung war, um sich selbst zu erinnern, hatte es dennoch oft genug zu hören bekommen.
»Wieso ›rfa‹?«, nahm Ingo ihr umgehend den Wind aus den Segeln.
»Na, die Terrorgruppe ›rot für alle‹«, erklärte Anna verwirrt. »Sie lesen sicher eine Tageszeitung, oder? Vielleicht nicht jeden Tag, aber manchmal …? Da kam man um die ganze Geschichte doch gar nicht herum. Die Anschläge von Andreas A., Gudrun D., der ganze …«
»Ach, wissen Sie, das Zeitunglesen überlass ich meiner Frau. Steht doch bloß nur was über Krieg, Hunger und Tod drin, nicht wahr? Warum sollte ich mich damit belasten.«
»Stimmt’s oder hab ich recht?«, ergänzte Anna stumm für sich und war entzückt. Jemand, der so bereitwillig seine Unkenntnis preisgab und obendrein eine einleuchtende Erklärung dafür anbieten konnte, war Gold wert.
»Manchmal lese ich diese kleinen Comics mit dem Tiger und den beiden Meerschweinchen. So oft aber auch nicht.«
»Das ist ja …« Ausgiebig pulte sie sich einen Tabakkrümel von den Lippen. Sollte sie ihm jetzt etwas erklären oder nicht? Ach, natürlich sollte sie, niemand kann aus seiner Haut. »Na, das war irgendwann Ende der sechziger Jahre, und, zugegeben, es hatte wirklich etwas mit Krieg zu tun.«
Ingo nickte.
»Die drei, um die es in der Verhandlung geht, haben zwei Kaufhäuser angezündet. Symbolisch, also aus Protest … Ich meine, die hatten da ihren ganz eigenen theoretischen Überbau.«
»Also brannten die Kaufhäuser nur theoretisch?«
»Nein, ich meine als Symbol gegen den Krieg. Die brannten auch praktisch. Die Brandstifter kamen vor Gericht, und da kam es dann zu durchaus komischen und absurden Wortwechseln. Bis hin zum Urteil.«
»Komisch? Sie meinen Klamauk und so?« Wenn er sich auch nicht vorstellen konnte, was an einer Gerichtsverhandlung komisch sein sollte, so machte ihn die Aussicht auf einen lustigen Abend langsam neugierig. Zudem gab sich Frau Haberland so viel Mühe. Sollte er nicht wenigstens mal reinschauen?
»Ob man jetzt direkt Klamauk …« Anna beendete den Satz nicht. Offenbar hatten ihre Überredungskünste gefruchtet, Ingo wollte ins Theater, und ob es da auf der Bühne nicht tatsächlich Klamauk gab, wusste sie ja selbst nicht. Wo sie schon wieder hinmusste, wusste sie allerdings ganz genau.
»Sie trippeln ja schon wieder. Dann lassen Sie uns mal reingehen, oder nicht?« Galant bot er ihr seinen Arm an.
»Warum haben die noch mal die Kaufhäuser angezündet?«
»Wegen des Krieges. Als Symbol gegen den imperialistischen Vernichtungsfeldzug der USA in Südostasien«, zitierte Anna automatisch die Phrasen vergangener Zeiten und Kämpfe.
»Die haben gegen den Krieg der Amerikaner in Deutschland Kaufhäuser angezündet? Das versteh ich nicht. Klingt ja langsam doch wie ne komplizierte Beziehungskiste.«
»Genau!«, lachte Anna und löste sich aus der Umarmung, inzwischen standen sie vor der Damentoilette. »Aber …«
»Schon gut. Schnell rein mit Ihnen.«
Langsam und so leise wie möglich schlich Ingo in den Saal und blieb direkt an der Tür stehen. Er kam gerade rechtzeitig zur Urteilsverkündung.
»Für jeden der drei Angeklagten ergeht folgendes Urteil: Drei Jahre Haft … « Sebastian machte eine Pause, um dem Publikum etwas Zeit zu geben, und wie erwartet stöhnte es bestürzt auf, und dann noch einmal, entsetzt über die eigene Reaktion. Unversehens waren die Zuschauer in der letzten halben Stunde zu Sympathisanten geworden, hatten die jungen Leute auf der Anklagebank in ihr Herz geschlossen. Gut, die hatten etwas Schlimmes getan, manchmal redeten sie auch gar zu unverständlich daher, aber charmant waren sie schon, aufgeweckt. Wie sie dem Richter widersprachen, witzig und pointiert, so würde jeder selbst gern einmal der satten Obrigkeit den Spiegel vors Gesicht halten. Drei Jahre! Da wurde eindeutig mit viel zu großen Kanonen auf diese kleinen Spatzen gefeuert.
»Drei Jahre Haft wegen schwerer Brandstiftung und versuchter Körperverletzung.«
Stille. Einige Zuschauer fragten sich, ob sie irgendetwas verpasst hatten. Brandstiftung leuchtete ihnen ja ein.
»Versuchte Körperverletzung?«, stellte dann Fred Vogel auch die Frage, die allen durch den Kopf ging. »An wem denn, um Mitternacht in einem Kaufhaus?«
»Guter Einwand«, rief jemand aus dem Publikum.
»Wie jeder weiß«, sprach der Richter weiter, »hätte die gesamte Stadt niederbrennen können.«
»Die Kaufhäuser standen durch Straßen von allen anderen Geschäften separiert. Und die nächsten Wohnhäuser liegen fünfhundert Meter entfernt«, beschwerte sich Bernd. Die ersten Zuschauer kicherten zaghaft.
»Außerdem ist ja wohl bekannt, dass gerade zu dieser Zeit eine besonders hohe Frequenz an Menschen an solchen Orten herrscht, also durchaus von einem stark bevölkerten Zustand des Kaufhauses ausgegangen werden muss!« Mit einem lauten Hammerschlag unterstrich Sebastian seine Worte. »Damit ist die Verhandlung beendet. Der Nächste bitte!«
Die Ruhe im Saal währte nicht lang. »Menschen im Kaufhaus? Um Mitternacht?«, kam es höhnisch aus einer der Mittelreihen. »Nee, is klar!«, brummte jemand von ganz vorn, und Katja Siebel, die gerade dreizehn und gegen alles war, pöbelte am Lautesten. »Das soll komisch sein? Das is ja sowas von voll zu weit hergeholt, null authentisch, typisch Scheiß-Provinz-Verarsche!«, und zog eine Flunsch. Ihre Mutter sagte nichts, immerhin saß das Kind im Theater. Die meisten lachten dann doch. Ingo nicht, er schüttelte verständnislos den Kopf. Bei einem Feuer wurden Menschen gefährdet, für ihn stand das völlig außer Frage. Wo war denn nun der Witz? Vermutlich fehlte ihm einfach der Zusammenhang, tröstete er sich, Humor hatte er nämlich eine ganze Menge. Zu weiteren Gedanken über sein Humorverständnis kam er nicht, da die Technik auf Flutlicht umschaltete und somit unmissverständlich zur Pause rief. Eilig verließ er den Saal, um den kleinen Verkaufstresen der Garderobe zu erreichen und die Theaterbesucher mit Getränken und winzigen Häppchen zu versorgen.
Die Häppchen waren für Sebastian weniger von Interesse, seine Pausenverköstigung war flüssiger Form.
»Prost, mein Knabe«, gratulierte er sich. »Läuft ja alles wie geschmiert.« Überraschungen hatte es keine gegeben, das Publikum war so dankbar wie erwartet. Das war ehrlich schön an diesen winzigen Bühnen, dachte er, so ausgehungerte Zuschauer gab es nur in Orten ohne Unterhaltungsangebot. Wenn die mal etwas vorgesetzt bekamen, wo ›Kultur‹ draufstand, waren sie schon begeistert, und wenn dann auch noch Lachen offiziell erlaubt war, gingen die ab wie Schmidts Katze. Solch naive Freude am Sein brauchten sie auch, wenn sie dem Akt nach der Pause mehr als ein paar höfliche Lacher abgewinnen wollten. Und sie würden, wusste Hemd. Denn trotz der abfallenden Qualität des Stücks nahm die Stimmung der Zuschauer bis zum Ende stets zu, ein Umstand, der in schlichtestem Zusammenhang mit dem Pausencatering stand. Ihm ging es ja nicht anders. »One for the road«, und hinaus ging es in den dürftigen dritten Akt. Ziemlich karnevalistisch mutete der Fall an, den Sebastian dafür ausgegraben hatte, und obwohl man es auf den ersten Blick nicht vermutete, Auslöser der Streitigkeiten war nämlich ein Pferd, handelte es sich um ein juristisches Problem der neueren Zeit. Dieses Pferd, braves Mitglied eines Brauerei-Gespanns, hatte gegen ein Auto getreten und es dabei, wenig überraschend, prompt beschädigt. Zumindest nach Ansicht des Klägers. Der Beklagte bestritt, zur fraglichen Zeit am Tatort gewesen zu sein. Die Kutsche schon, aber er selbst war viel zu besoffen gewesen, um als ›anwesend‹ bezeichnet werden zu können. Die Wortwechsel zwischen den beiden waren ganz amüsant, die Stimmung im ›Theater im Park‹ war bestens.
Ingo verspürte nach der Pause keine Lust mehr auf die Vorstellung, die kurze Auffrischung seiner Vorurteile hatte ihm genügt. Theater war seine Sache nicht.
»So schlimm?«, fragte Anna mitfühlend und half ihm bei den Vorbereitungen für das kleine Schnittchengeplänkel nach der Aufführung.
»Nee, Frau Haberland, für unsereins ist das wohl nichts, nicht wahr.« Kopfschüttelnd schob er ein paar Gläser hin und her. »Ne Beziehungskiste war das nun wirklich nicht, nicht wahr, da haben Sie wohl Recht. Aber das waren trotzdem so Sachen …«
Die Sache mit dem Pferd entwickelte sich auf der Bühne derweil weiter. Das Vieh hatte nun einmal gegen das Auto getreten, und auch wenn der Kutscher weiterhin beteuerte, nicht dabei gewesen zu sein, musste er für den Schaden aufkommen. Langsam begriff der gute Mann, dass er so nicht weiter kam, deshalb änderte er seine Strategie.
»Psychologie«, rief er, also Fred. »Die Psychologie ist Schuld.«
Zur Freude des Publikums führte er eine psychische Aversion des Huftieres gegen Blech an, womit der Schaden folglich krankheitsbedingt entstanden wäre. Um auf Nummer Sicher zu gehen, wies er außerdem auf die »unbestreitbare Tatsache« hin, dass es sich bei einem Pferdefuhrwerk ja auch um ein Fahrzeug handelte.
»Das Fahrzeug hat völlig eigenständig gehandelt«, provozierte er den nächsten sicheren Lacher und landete wieder bei seiner Anfangsthese. Er war bei der ganzen Sache nicht dabei gewesen und hatte nichts damit zu tun. Sebastian lachte nicht, er blieb bei seinem richterlichen Urteil.
»Der Beklagte haftet als Halter des Pferdefuhrwerkes insgesamt, weil dieses das Auto des Klägers beschädigt hat. Ein Pferd ist, auch wenn es durch PS angetrieben wird, kein Fahrzeug nach StVO, sondern nach §833 BGB ein Haustier, das mit dem beschädigenden Huftritt gegen das Auto des Klägers im Rahmen der typischen Tiergefahr im Sinne §833 BGB gehandelt hat.«
Verständnisvolles Nicken wippte durch das Publikum, alle hielten dies für einen gelungenen Abschluss der Geschichte und waren bereit für den nächsten Fall. Doch Sebastian Hemd wäre nicht der König des Zusatzverkaufes, wenn er an dieser Stelle die Klappe gehalten hätte.
»Die Fahrerlaubnis kann ihm jedoch nicht entzogen werden, da er zur Tatzeit nicht anwesend war.« Man stellte sich also auf eine weitere Wendung ein.
»Aber wie soll ich ein Pferd mit einer psychisch bedingten Aversion gegen Blech davon abhalten, Autos zu treten, wenn ich nicht anwesend bin?« Dezentes Brummen hing zwischen den Stühlen, das hatte man ja schon mal gehört. »Außerdem bin ich mir sicher, dass Julie, mein Pferd, nur mit dem Huf blinken wollte und nicht schlagen.«
»Es ist mir völlig egal, ob das Pferd gegen das Auto getreten hat, weil es kein Blech mag oder weil es sein Herz in seiner Einsamkeit mit schönem Klang erfreuen wollte. Und wenn es seinen Huf als Warnblinker genutzt hat, damit das liegen gebliebene Fahrzeug rechtzeitig als Hindernis erkannt wird, ist mir das auch schnurz.«
Besänftig mit dieser platten Pointe entließ Sebastian sein durchaus vergnügtes Publikum in den Rest des Abends.
»Das könnte ich schon noch ne ganze Weile machen.« Applausberauscht und asbachvergnügt stand Sebastian zur letzten Verbeugung auf der Bühne. »Und das auch!«, freute er sich, als Anna ihm einen Blumenstrauß überreichte. Dass sie eilig einen Schritt zurücktrat, als er ihr einen Kuss auf die Wange drücken wollte, ignorierte er großmütig. Eine Sekunde zuvor hatte Else Immerda auf den Auslöser gedrückt, und auf ihrem Foto lächelten sich die beiden noch über Rosen und Schleierkraut hinweg strahlend an. Das Licht ging an, ›Die Gerechten‹ gingen von der Bühne, und die Journalistin rannte mit gut gefülltem Wonderbra und ausgestreckter Hand direkt auf Sebastian zu.
»Holaha«, entfuhr es ihm, und Anna entschuldigte sich kurz, obwohl sie gerade jetzt eigentlich nicht musste.
»Herr …«
»Hemd. Aber sagen Sie doch Sebastian.«
»Sagen Sie doch Else. Else Immerda vom ›Beeschauer Kurier‹, hallo!«
»Hallo Else«, näselte er.
»Hihihi«, kicherte sie. Und dann verschwanden die beiden für eine ganze Weile in der Garderobe, um die Blumen ins Wasser zu stellen, die Schminke vom Gesicht zu kratzen, über das Stück zu plaudern und zu tun was sonst noch nötig war, um das symbiotische Verhältnis zwischen Künstler und Kunstkritik im Gleichgewicht zu halten.
»Ich hab das doch alles wirklich nicht nötig«, maulte Anna, ein Tablett mit leeren Gläsern auf den kleinen Tresen donnernd.
»Aber es macht Ihnen doch immer ne Menge Spaß, nicht wahr«, widersprach Ingo zaghaft und brachte schnell ein paar Flaschen in Sicherheit. So kannte er Frau Haberland noch gar nicht.
»Ach…« Sie verschränkte die Arme vor der Brust und sah sich schmollend um. Das Foyer war sehr klein, die Garderobe wurde nach der Vorstellung zur Bartheke umfunktioniert und die Saaltüren blieben einfach geöffnet, damit die Bestuhlung dort genutzt werden konnte. Es war ja ganz schön, wenn die Zuschauer nicht nach Hause gehen wollten, wenn sie lieber hier im Theater blieben, miteinander quatschten, noch einen tranken. Sie fühlten sich wohl, waren zufrieden gewesen mit dem Unterhaltungsprogramm. Aber wo blieb, zum Henker noch mal, der Star des Abends?
»Star, dass ich nicht lache.«
»Bitte?«
»Ach, nix.« Die Künstler, zumindest wenn es sich um eine wenig bekannte Truppe wie diese hier handelte, sollten sich nach der Vorstellung noch unter die Gäste mischen. So war es abgemacht. Zumindest sollten sie kurz auf der kleinen Nachfeier auftauchen, das gab den Gästen ein Gefühl von … Was auch immer, sie mochten das einfach.
»Sind doch alle da.« Mit einem Nicken wies Ingo zur Bühne, dort saßen die Darsteller auf dem Rand wie Hühner auf der Stange.
»Ja, alle da«, bestätigte sie knapp und wappnete sich mit einem klirrend süßen Lächeln gegen die beiden Bodenhaupts, die zur Verabschiedung auf sie zustürzten.
Sein Kopf fühlte sich an, als wäre er aus einem Hochhaus gestürzt. Und dann von einem Zug überrollt worden. Durch einen Häcksler gejagt, von einem Coyoten verschleppt, und dann … Stöhnend hielt Sebastian eine Hand vor die Augen und schnupperte an seinem Kaffee. Warum hatten die in diesem mickrigen Hotel kein Aspirin? Die Gäste hier fragten doch bestimmt ständig nach Schmerzmitteln, bei der Einrichtung taten einem sogar die Haare in der Nase weh. Er trank einen Schluck. Okay, der Kaffee war ganz gut. Aber diese Tapete, der Teppichboden, die Stühle, die Bedienung, diese Ansammlung von Staub und Muff und Kleinstadtfrust. Schlecht war ihm auch schon wieder. War es nicht genau das, was er loswerden wollte? Diese kleinbürgerliche kleingeistige Kleinkrämerei? Konnte er ja gleich wieder Gemüsehobel verhökern.
»Krieg ich noch mal n Kaffee, oder was?«
Der gemütliche Mann hinter dem Tresen überhörte einfach den zickigen Tonfall, Hemd war schließlich nicht der erste Morgenmuffel, den er bedienen musste.
»Soll ich Ihnen vielleicht ein paar Spiegeleier dazu machen?«, bot er freundlich an.
»Soll ich Ihnen vielleicht auf die Auslegeware kotzen?«, lehnte Sebastian dankend ab und zündete sich eine Zigarette an. Er hatte einfach keine Lust mehr. Auf solche Hotels, solche Morgen, solche Kopfschmerzen und schon gar nicht auf solche Theater. Dieser armselige Mist konnte ihm gestohlen bleiben, jawohl, das Thema war durch, der Zug war abgefahren. Sobald seine miese Combo hier aufschlug, würde er sie mit Arsch und Tritt in die Wüste schicken. Ganz genau, sein Entschluss stand fest, und nichts und niemand würde ihn davon abhalten können.
»Guten Morgen, Herr Hemd, haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich einen Moment zu Ihnen setze?«
»Sie säuseln ja schon wieder«, flötete er seiner Halluzination entgegen.
»Blöde Angewohnheit«, seufzte diese und ließ sich auf einen Stuhl fallen. »Hier, schon gelesen?« Anna warf den ›Beeschauer Kurier‹ auf den Tisch und wies mit dem Zeigefinger auf einen Artikel. Der Kaffee wurde an den Tisch gebracht, Anna bestellte sich auch einen, doch Sebastian las nicht einmal die Überschrift, so fasziniert war er von dem Foto. Else Immerda hatte ein Händchen für Schnappschüsse, das musste man ihr lassen, eine Fähigkeit, die sie durch ihr permanentes Last-Minute-Erscheinen perfektioniert hatte, und der Moment, den sie eingefangen hatte, das Lächeln über den Rosenstrauß hinweg, hatte etwas … Magisches. Für Sebastian Hemd. Anna Haberland hatte auf dem Foto nur gesehen, dass sie dringend mal wieder zum Friseur musste, ihre Freude hatte dem Artikel gegolten. »Perlen in Beeschau!«, protzte die Überschrift, und die gesamte Kritik lobte und hudelte. Zudem war ihre eigene Funktion wunderbar gepriesen worden, was sie zwar ein wenig überraschte, aber um so mehr erfreute. Ihre gute Laune wurde vom Verschwinden ihrer Blasenentzündung noch verstärkt, und dieser heiteren Stimmung hatte es Sebastian zu verdanken, dass sie überhaupt hier war. Normalerweise besuchte sie die Künstler am nächsten Morgen nämlich nicht beim Frühstück. Solche langweiligen Loser wie Sebastian schon gar nicht.
»Herr Hemd …?«
»Bitte?« Langsam löste er seinen Blick von der Zeitung und sah Anna in die Augen.
»Fehlt Ihnen etwas?« Dabei wusste sie genau, was ihm fehlte, aber sie wollte einfach ihre gute Laune genießen, mit dem ›Künstler‹ frühstücken und ein wenig Small Talk machen.
»Nein, vielen Dank, ist alles in Ordnung. Oder vielleicht doch, Sie haben nicht zufällig eine Kopfschmerztablette dabei? Nein, vergessen Sie’s, alles bestens.« Oh Gott, er führte sich ja auf wie ein pubertierender Idiot. Was sollte sie denn von ihm denken? Gestern war es eine Magentablette, heute eine Kopfschmerztablette, sie würde ihn noch für tablettensüchtig halten.
»Einen wunderschönen guten Morgen«, polterte es hinter Sebastian. »Da hast du ja im Separee ordentlich Eindruck gemacht, was?« Erst als Fred Vogel die Zeitung auf den Tisch warf, bemerkte er, dass Anna ebenfalls dort saß.
»Guten Morgen«, erwiderte sie spitz und hielt sich an ihrer Kaffeetasse fest.
»Sehr witzig«, bemühte sich Sebastian um Rettung der Situation. »Mit deinem Humor hätten wir es wohl nicht einmal bis in den Kleinanzeigenteil geschafft.«
»Aber ist doch ne super Kritik.«
Konnte man wirklich nicht anders nennen. Fred setzte sich auf den freien Stuhl zwischen Anna und Sebastian, und alle drei starrten eine Weile auf den Zeitungsartikel.
»Besonders im zweiten Akt steckt ein gewisses Potential«, brach Anna schließlich das nervige Schweigen mit belangloser Höflichkeit.
»Ja, nicht wahr?«, freute sich Sebastian.
»Ich hab’s immer gesagt«, ging auch Fred darauf ein, »die rfa-Verhandlungen sind die besten.«
»Steht auch hier!« Mit dem Zeigefinger tippte Sebastian energisch auf den Artikel.
»Unbedingt«, nickte Anna. Die Zeitungs-Else hat auch nur euer Programmheftchen gelesen, dachte sie.
»Vielleicht sollten wir den anderen Kram ganz rausschmeißen.«
»Genau, das Gesamtkonzept überdenken.«
»Straffen!«
»Soll’s sonst noch was sein?«
»Bitte? Nein, vielen Dank.«
»Für mich auch nicht.«
»Ich hätte gern einen Kamillentee, danke.«
»Das muss man einfach genießen!« Und noch einmal hob Sebastian die Zeitung ein kleines Stück an, räusperte sich und trug seine Lieblingsstelle vor: »Sebastian Hemd hat diesen Abend zu einem Event werden lassen, den keiner der Zuschauer so schnell vergessen wird. Gerade die historisch äußerst brisanten revolutionären Verfahren werden durch ihre leichte Wiedergabe entdämonisiert und kurzweilig, aber pointiert aufgearbeitet. Ein Muss für jeden Geschichtslehrer.«
»Ganz toll«, sagte Anna und überlegte, wie sie sich verabschieden könnte, ohne ihn in seiner Euphorie zu bremsen. War ja prima, dass er sich so freute, Erfolgserlebnisse waren bei ihm bestimmt nicht an der Tagesordnung, aber wenn sie nur ein weiteres Mal die Lobhudelei von der blöden Immerda vorgebetet bekam, müsste sie spucken. »Ja, wie gesagt, ich denke auch, dass ein großes Potential im zweiten Akt steckt …«, bereitete sie ihren Aufbruch langsam vor, hatte allerdings gegen Sebastians kindliche Begeisterung keine Chance.
»Frau Haberland, ich freu mich so!« Er strahlte sie an. Er hatte gar keinen Durst. Anna war toll, das Stück war toll, alles war toll. Er würde weitermachen, jawohl, mit einem neuen Konzept, mit neuer Energie. Da saß eine wundervolle Frau, die an ihn glaubte, die sein Potential erkannt hatte, die ihn dazu ermunterte, sein Talent zu nutzen. So konnte man das jedenfalls verstehen. Die revolutionären Verfahren, darauf hätte er auch längst schon selbst kommen können.
»revolutionär verfahren.«
»Jaja«, brummelte Fred in seinen fünften Kamillentee. Etwas schien Sebastian vergessen zu haben.
»Kommt schon, kommt schon, ich nenne euch gerade den neuen genialen Titel unserer neuen genialen Show, und dafür bekomme ich nur ein läppisches Jaja?«
»Sebastian …«
»Nix da, wir nennen den Krempel nicht mehr ›Deutsches Justiztheater‹, das klingt doch auch viel zu lahm, die neue Show heißt ›revolutionär verfahren‹, beides klein geschrieben, wie findet ihr das?«
»Herr Hemd …«
»Klein geschrieben, na, klingelt’s? Wie in den Bekennerschreiben oder so. Wir behalten unser altes Muster irgendwie bei, aber es wird ein ganz neues Stück. Nur den rfa-Kram, den ganzen Schmus, der sich damals vor Gericht zugetragen hat, reduziert auf die Pointen, zack und zack!«
»Wird vielleicht ein bisschen schwierig für zwei Leute«, bemerkte Fred.
»Klar, zwei wären zu wenig. Wie kommst du darauf?«
»Scheiße!« Er wusste also wirklich nichts mehr. »Sebastian, kannst du dich noch irgendwie an den gestrigen Abend erinnern? Ich meine an den Teil, nachdem du der Presse gegeben hattest, was die Presse wollte?«
»Klar, total. Also, fast alles. Ich meine, ein bisschen weiß ich schon noch, will sagen, eigentlich hab ich nicht den leisesten Schimmer.«
»Das hab ich befürchtet«, stöhnte Fred. Jetzt kam der anstrengende Teil.
Vielleicht bleib ich doch noch einen Moment, dachte Anna, jetzt kam wohl der interessante Teil. Sie naschte nicht, sie trank nicht, aber sie hegte eine ausgeprägte Leidenschaft für Klatsch und Tratsch. Was sie sich großmütig verzieh.
Was am Abend geschehen war, hatten ›Die Gerechten‹ ihrem Regisseur und Brötchengeber keineswegs verziehen. Nachdem er Else verabschiedet hatte, war Hemd nämlich doch auf der kleinen After-Show-Party aufgetaucht und hatte seine Truppe überredet, mit ihm in ein Taxi zu steigen und in die nächste Diskothek zu fahren. ›Domino‹ hieß das dörfliche Tanzlokal und befand sich mitten in der Pampa, etwa zwanzig Kilometer von Beeschau entfernt. Unabhängig von irgendwelchen Zeiten, Moden oder Erscheinungen amüsierte sich hier, wie stets, ein Publikum, das sich niemals treffender als unter dem Begriff ›Dorfdizze‹ zusammenfassen ließ. Dennoch hatte es einen betrunkenen, arroganten Sebastian Hemd einfach nicht verdient. Als er dem Moderator der gerade stattfindenden Miss-Wet-T-Shirt-Wahl das Mikro aus der Hand riss, beschwerte sich, abgesehen vom Moderator natürlich, noch niemand über ihn, da seine Sprüche tatsächlich unterhaltsamer waren. Gegenüber den zur Wahl stehenden Mädchen benahm er sich nicht mehr ganz angemessen, doch auch das lösten diese noch selbst und äußerst schlagfertig. Als er danach jedoch Diana und Steffi, die zwei Frauen seiner Bühnentruppe, mit Wasser übergoss, abfällig über ihre Brüste sprach, anschließend die Chuzpe besaß, Werbung für das ›Deutsche Justiztheater‹ zu machen, die er erst in einen weinerlichen und am Ende in einen brutalen Verriss verwandelte, war es den Schauspielern zuviel geworden. Mit seinen Stimmungsschwankungen hatten sie sich abgefunden, ihre Mittelmäßigkeit war ihnen durchaus bewusst, aber immerhin hatten sie die ganze Show bislang als eine Chance angesehen, irgendwann vielleicht doch noch mal eine echte Rolle an einem echten Theater ergattern zu können. Immer wieder hatte er sie zusammengeschissen, an ihnen rumgenölt, sie ausgezählt, lächerlich gemacht. Sogar rausgeschmissen hatte er sie mehrmals und war am nächsten Tag jedes Mal wieder zu Kreuze gekrochen. Ersteres war nach der Domino-Aktion nicht mehr nötig, und letzteres brachte auch nichts mehr. Beim besten Willen nicht, ›Die Gerechten‹ waren auf und davon.
»Und warum bist du noch da? Was versprichst du dir davon?« Bevor Fred antworten konnte, winkte Sebastian den Wirt heran und bestellte einen dreifachen Asbach.
»Weil, also, naja, da war …«
»Ach, leck mich doch am Arsch! Blasen wir den ganzen Scheiß eben ab, war sowieso ne saublöde Idee, verkauf ich eben wieder irgendein Zeugs. Salzkristalllampen? Wie wär’s?« Der Schnaps kam, und er kippte ihn in einem Schluck runter. »Noch einen!«
Doch Anna sah den Wirt an und schüttelte beinahe unmerklich den Kopf. Meine Güte, sie hätte wirklich längst gehen sollen, solche Situationen überforderten sie.
»Herr Hemd, das wird schon alles wieder.« Na prima, ein ganz origineller Allgemeinplatz. »Ihre neue Idee klang doch sehr vielversprechend. Können Sie nicht eine neue Truppe zusammenstellen?«
»Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Ich habe nämlich gestern Abend …« Fred wurde ignoriert.
»Sie glauben an mich?« Gerührt ergriff Sebastian Annas Hände.
»Nun … Ich …« Es war zum verrückt werden, musste er denn immer alles auf sich beziehen? Sie wollte doch nur nett sein.
»Ja, die gute Dame glaubt an dich.« Langsam verlor Fred die Geduld. »Würdest du mir jetzt endlich mal zuhören?«
»Is ja gut …«
»Wie gesagt, gestern Abend habe ich jemanden kennen gelernt. Hier. Seine Karte.«
»Und was hat dein neuer Stecher mit uns zu tun?« Verständnislos nahm Sebastian das billige Automatenkärtchen entgegen. »Hans Baarkozy – Event-Marketing-Management«, las er abfällig vor. »Das ist doch wieder so ein aufgeblasener Himbeertoni, hab ich Recht?« Mittlerweile kannte er Freds Vorliebe für gut gekleidete Windeier.
»Er sah schon sehr schick aus, falls du das damit meinst«, gab sich Fred entrüstet. »Nach Geld und Geschmack! Anzug, Seidenhemd, die Liga. Und er ist nicht mein neuer …«
»Bitte«, mischte Anna sich ein, langsam wurde es ihr zu privat.
»Entschuldigung. Also, was ich sagen wollte: Hans hat die Show gesehen, und er war ganz begeistert …«
»Von dir.«
»Herr Hemd …!«
»Von der Show! Sie ist nur viel zu bescheiden, viel zu klein angelegt. Da steckt unglaublich viel Potential drin, hat er gesagt, wir sollen das nur alles mal viel größer denken.«
»Ach ja?« Beiläufig steckte Sebastian die Visitenkarte in die Jackentasche.
»Na sehen Sie, alles geht weiter.« Anna erhob sich, dies schien ihr ein geeigneter Zeitpunkt zum Aufbruch zu sein.
»Wir sollen das also machen, sagen Sie?«
Ging das schon wieder los?
»Ja, machen Sie das. Machen Sie diese, wie haben Sie das vorhin genannt? revolutionär verfahren? Machen Sie das, das klingt sehr gut. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und einen schönen Tag. Also, Herr Vogel, für Sie auch alles Gute!« Energisch trat sie einen Schritt vom Tisch zur Seite. Daraufhin stand Fred ebenfalls auf, schüttelte ihr ausdauernd die Hand und bedankte sich überschwänglich für den schönen Abend und die gute Betreuung. Langsam kam auch Sebastian auf die Füße, aber nur, um Anna die Hände auf die Schultern zu legen und sie zurück auf ihren Stuhl zu drücken.
»Was wird das denn jetzt?«, fragte sie gereizt. Angrapscher konnte sie partout nicht ausstehen.
»Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.«
»Ach nee?«
»Frau Haberland, seien Sie nicht böse mit mir, bitte. Aber Sie können doch jetzt nicht gehen.«
»Ich muss, Herr Hemd, ich muss. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, wissen Sie, ich habe auch noch etwas anderes vor.« Das durfte doch nicht wahr sein. Inzwischen hatte sich auch Fred wieder auf seinen Stuhl fallen lassen.
»Sie haben schon so viel für unser Theater getan …«
»Gern geschehen. Dürfte ich jetzt bitte …«
»Nur eine Sekunde. Sie haben schon so viel für unser Theater getan, und nun haben Sie ihm auch die entscheidende Wendung gegeben. Dank Ihnen habe ich den Mut, weiterzumachen, Sie haben …«
»Stopp!« Es wurde ihr langsam zu viel. »Würden Sie mal das Pathos ausschalten und mir einfach sagen, was Sie von mir wollen?«
»Sie hat Recht, Sebastian. Was wird das hier?«
»Also schön, wenn ihr es schlichter wollt.« Wie ein bockiges Kind verschränkte er die Arme vor der Brust. »Ich stelle eine neue Truppe zusammen, eine bessere, versteht sich. Dann machen wir das neue Stück, ›revolutionär verfahren‹. Deinen komischen Baarkozy guck ich mir mal an, der könnte vielleicht wirklich das Marketing machen. Und Sie, Anna Haberland, sind mit dabei.« Sein selbstgefälliges Grinsen reichte von einem Ohr zum anderen. »Na?«
Fred freute sich, allerdings verhalten, Sebastians Visionen hatten bekanntlich häufig eine erbärmliche Halbwertszeit. Anna schüttelte den Kopf.
»Wozu brauchen Sie mich noch, wenn Sie schon diesen Sarkozy …«
»Baarkozy.«
»Wenn Sie schon jemanden fürs Drumherum haben.«
»Ich will Sie nicht drum, ich will Sie drin.«
»Was?«
»Oder drauf.«
»Jetzt reicht es tatsächlich!«
»Was hab ich denn gesagt? Ich will Sie in der Show oder auf der Bühne, liebe Anna.«
Das brachte sie völlig durcheinander. Auf einer Bühne hatte sie doch nichts verloren, dazu war sie doch zu unscheinbar, zu …, na, sie hatte doch gar kein Talent. Wie kam er bloß auf so einen Unsinn?
»Als ich Sie zum ersten Mal sah, haben Sie mich an jemanden erinnert, ich wusste nur nicht, an wen. Aber als es mir endlich einfiel, war mir sofort ganz klar, da gab es für mich keine Frage, da …«
»Komm auf’n Punkt, Sebastian. Also, an wen erinnert sie dich?«
»Mensch Fred, guck sie dir doch mal ganz genau an. Na? Andere Haare, halblang und dunkel, langweiligere Klamotten, und?«
»Das gibt’s doch nicht.«
Diese eingehende Musterung war Anna ziemlich unangenehm. Trotzdem wollte sie es nun auch endlich wissen.
»Sagt schon!«
»Ganz klar, die perfekte Ulrike L.«
»Keine Frage.«
»Ihr brennt doch!« Wutschnaubend sprang sie vom Stuhl auf. Herzlichen Dank für die Blumen! Was maßte sich dieser abgerissene Klinkenputzer eigentlich an? Das hatte ihr noch niemand gesagt, dass sie aussah wie eine Terroristin. Sie war stinksauer. Und sie fühlte sich ein winziges bisschen geschmeichelt.
Stadttheater Friedensheim
»Die Sitzung ist eröffnet.« Gemächlich ließ der Richter seinen Blick über die Anwesenden streifen, schnippte einen imaginären Fussel von seiner frisch gereinigten Robe und räusperte sich. »Gut. Dann rufe ich hiermit die Strafsache gegen Andreas A., Ulrike L., Gudrun D. und Jan-Carl Q. auf. Wie den Angeklagten bereits vor Beginn der Sitzung mitgeteilt wurde, sind ihre Wahlverteidiger aus den Ihnen bekannten Gründen vom Verfahren ausgeschlossen. Aus Fürsorgepflicht und zur Sicherung des Verfahrens werden Ihnen die vom Gericht bestellten Pflichtverteidiger Hinz und Dr. Kunz zugewiesen. Die Verhandlung kann …«
»Keiner von denen hat das geringste Recht …«, fiel Ulrike L. dem Richter lautstark ins Wort, doch welches Recht sie ihnen absprechen wollte, bekam er nicht mit, da ihm ein Beisitzer genau in dem Moment etwas ins Ohr flüsterte.
»Halt! Ruhe! Sie dürfen gleich reden. Das Band läuft nicht«, erklärte der Richter gereizt. »Es muss ja fürs Protokoll aufgenommen werden. Es ist ja nicht meine Schuld.«
»Verdammte Scheiße«, maulte Ulrike, die inzwischen aufgestanden war. »So lassen Sie mich doch ausreden!«
»Kacke ja, was sollen diese Mätzchen hier«, empörte sich auch der Angeklagte Andreas A.
»Bitte, Herr A.«, versuchte der Richter, noch freundlich, die Situation zu entschärfen. »Ich denke, Frau L. ist Manns genug, ihre Erklärung selbst abzugeben.«
Und ob sie das war!
»Ruhe, verdammt!«, schrie sie. »Lass uns reden.«
»Genau«, kam es nun auch noch von Gudrun D. »Das ist doch nicht Ihr Problem.«
War es selbstverständlich sehr wohl, er hatte sowieso keine Lust auf diesen Zirkus. »Verstehen die Angeklagten etwa unter Kollektivverteidigung, dass man kollektiv durcheinander redet?«
»Aber nun hören Sie doch mit Ihren blöden Witze auf«, regte sich Andreas A. auf. Der Richter massierte sich die Schläfen und schwieg.
Trotzdem forderte Ulrike kreischend: »Schnauze! Schluss mit Gequatsche, jetzt rede ich!«
»Aber wirklich«, wurde sie von Andreas unterbrochen. »Entweder Sie unterbrechen uns, oder Sie manipulieren uns mit Ihrer Abhöranlage.«
»Ach?« Nun mischte sich der Oberstaatsanwalt mit unüberhörbarem Zynismus ein. »Die Technik macht’s also unmöglich, dass Sie eine Erklärung abgeben können, wie?«
»Sie halten sich da raus, Nazischwein.« Das kam, ganz klar, wieder von Ulrike.
Hatte das Publikum im Friedensheimer Stadttheater gerade Gefallen an diesem Gezanke und Gezeter gefunden hatte, versteckte es doch schnell den letzten Lacher hinter Räuspern und Hüsteln. Schnauze, Scheiße, Kacke war zwar alles nicht die feine Art, aber wenn es der Kunst diente … Nazischwein hingegen war ein ganz anderes Kaliber. Das hörte man ja nicht so oft.
»Ach, halt die Fresse, Faschistenschwein«, setzte Andreas A. munter nach, womit die Theatergäste immer noch nicht wussten, ob sie lachen durften. Zum Glück lieferte ihnen Ulrike L. eine unverfänglichere Gelegenheit.
»Außerdem lässt die Manipulation der Mikrophone darauf schließen, dass dies dem einzigen Zweck dient, uns abzuhören.«
»Dies ist eine öffentliche Verhandlung«, warf der Richter verstört ein. »Welches Interesse sollte bestehen, etwas abzuhören, das sowieso alle hören können?«
Und die Öffentlichkeit hörte. Sie amüsierte sich über die Beschwerde von Andreas A., jemand habe neben seinen Mikrophonknopf ›Kopf ab‹ geschrieben, und genoss das Gerangel um abgelehnte, zugewiesene oder sonstwie gestörte Verteidiger. Sie lachte, als der Richter einwarf, alles geschehe nur aus Sicherheitsgründen, was Ulrike L. den Satz entlockte »Ich fühle mich da aber nicht sicher«, und sie lachte endlich auch bei den ›bösen Wörtern‹. »Faschistenschwanz«, »Nazityrann«, »Imperialistische Gesellschaftshure«, donnerte es von der Bühne, und die Zuschauer schlugen sich auf die Schenkel. Kurzum, ›revolutionär verfahren‹ lief großartig.
Sogar Sebastian hatte Spaß, er saß auch an diesem Abend gern auf seinem Richterstuhl, und dabei war Friedensheim bereits die achte Station ihrer Tournee. Zugegeben, die Truppe war noch nicht perfekt, obwohl Fred Vogel sich deutlich gesteigert hatte und mittlerweile einen ganz passablen Jan-Carl Q. abgab. Ja, gut, Gernot Möller hatte als Andreas A. seine Schwächen und Rita, die Darstellerin der Gudrun D., war möglicherweise nicht der absolute Glücksgriff gewesen, aber dann war da ja noch Anna. Er hatte es tatsächlich geschafft, sie zum Mitmachen zu bewegen. Wie ihm das gelungen war, wusste er selbst nicht so genau, aber wen interessierte das schon? Sie war da, sie war die Ulrike L., und sie war wirklich gut. Ihre Schimpftiraden machten ihn ganz schön an, er musste höllisch aufpassen, danach nicht seinen Einsatz zu verpassen.
»Im Rahmen der Sicherheitsvorkehrungen ist Sitzen geboten«, mahnte er, gerade noch rechtzeitig. »Also: setzen!«
»Verstehe ich das richtig«, begann Anna ihren Einwand, auf den Sebastian sich besonders freute, da sie ihn so wunderbar blasiert vorbrachte. »Stehen ist ein Sicherheitsrisiko? Also ich fordere: entweder wir stehen, oder wir werden dafür sorgen, dass wir gehen dürfen!«
»Ja«, rief Jan-Carl Q. »Wenn es Ihnen lieber ist, dass wir Sie beschimpfen und hier randalieren.«
»Wir wollen ohnehin nicht hier sein«, bekräftigte Gudrun D. seine Aussage.
»Dann stehen Sie eben«, gab Sebastian schließlich klein bei. »Wenn wir damit endlich anfangen können.« Und weil sich das Publikum stets so darüber freute, wackelte er noch ein bisschen mit seiner albernen weißen Lockenpracht. Allzu viele dieser blöden Gags hatte er allerdings gar nicht in das Stück einbauen müssen, das Ausgangsmaterial sprach meist für sich selbst. Mit wachsendem Elan hatte Sebastian die Protokolle gelesen und Texte gefunden, auf die er liebend gern selbst gekommen wäre.
»Ob ein Mandant mich Arschloch, Lappen oder dergleichen nennt, oder ich einen Mandanten mit ähnlichen Ausdrücken belege, sei es innerhalb oder außerhalb der Verhandlung, das geht nur mich oder meinen Mandanten etwas an«, konnte er etwa den Pflichtverteidiger Hinz sagen lassen, ohne sich weit vom Original zu entfernen. »Von wem ich mich beschimpfen lasse und von wem nicht, ist meine ganz eigene private Entscheidung, um das hier erst mal klipp und klar festzustellen«, wem wäre das nicht gern im passenden Moment über die Lippen gekommen? Das ganze Geschehen war wie fürs Theater gemacht, die Angeklagten pöbelten in diesem Prozess, dass es eine wahre Freude war, und die Vorsitzenden steigerten sich in ihrer Überheblichkeit unweigerlich ins Tölpelhafte, da konnte gar nichts mehr schief gehen. Sebastian sehnte sich nach einem großen Schluck. Vor lauter Begeisterung. Doch erst musste er noch ein wenig seines Amtes walten.
»Frau L. und Herr A.«, ermahnte er die schimpfenden Angeklagten. »Hören Sie auf, das Gericht, die Staatsanwälte und ihre Anwälte zu verunglimpfen, sonst muss ich Sie des Saales verweisen lassen. Das ist mein Gerichtssaal, hier entscheide ich.«
Andreas A. stänkerte erwartungsgemäß zurück. »Du Nazischerge, schmeiß uns doch raus«, fiel ihm diesmal dazu ein, womit er allen Zuschauern ein angemessen empörtes »Hö-hö-hö!« entlockte. Nur ein Theaterbesucher amüsierte sich offenbar nicht ganz so gut.
»Ach nee, wie böse!«
Alle drehten ihre Köpfe. Verständnislos, aber empört.
»Na, ist doch wahr, das nimmt man ihm doch nicht ab.« Jetzt hatten sie ihn entdeckt, hinten in der letzten Reihe. »Dieses Muttersöhnchen da würde doch nicht mal heimlich Blödmann sagen.«
Nach einer kurzen verwirrten Pause sagte das Muttersöhnchen erstmal weiter seinen Text auf: »Wir sind ohnehin als Gefangene des Systems hier und wollen lieber woanders sein.«
»Würd’ mich auch freuen«, unterstützte der frustrierte Theaterkenner diesen Wunsch und erhob sich von seinem Platz. »Na, dann muss ich eben …«, entschied er und verließ den Saal. Sebastian gab dem Publikum Zeit, über die unvorhergesehene Störung zu tuscheln und hätte selbst gerne gewusst, wer seinen Darsteller gerade so treffend kritisiert hatte.
»Können wir jetzt mit der Verhandlung fortfahren?«, kehrte er schließlich zum Stück zurück.
Alle nickten brav. Ulrike L. meldete sich wie ein Schulmädchen zu Wort.
»Ja?«
»Ich beantrage abermals die Enthebung unserer Zwangsverteidiger.«
»Und warum diesmal? Wir hatten festgestellt, dass sie für das Verfahren durchaus qualifiziert sind und sich bereit erklärt haben, Sie trotz aller Ärgernisse zu verteidigen. Was sollte also gegen diese Herren sprechen?«
»Ich muss bemerken, dass mein ach so qualifizierter Verteidiger gerade, wie schon häufiger im Verfahren, eingeschlafen ist.« Grinsend legte Anna den Kopf schief, knickte leicht in der Taille ein und zeigte mit dem Finger auf Dr. Kunz. »Da sitzt er und pennt.«
»Entzückend!«, freute sich Sebastian hinter der Bühne und zog die alberne Perücke vom Kopf. Ihm war heiß. Die Stimmung des Publikums, und damit seine eigene, hatte sich kontinuierlich gesteigert, und als Gudrun D. mit den unschlagbaren Worten »Wurde aber auch Zeit. Ich habe Hunger« die Pause eingeläutet hatte, brach ein Applaus los, der wirklich beeindruckend war.
»Na los, ihr kommt mit zu mir«, bat Hemd und schob Fred und Anna zu seiner Garderobe. Einer richtigen Garderobe, wohlgemerkt. Die beiden ließen sich nicht lange bitten, ihnen steckte die Freude über den gelungenen ersten Teil ebenso wohlig wärmend in den Knochen.
»Immer herein in …«, begann Sebastian und hielt die Tür auf, doch noch bevor er ›gute Stube‹ sagen konnte, blieb ihm vor Schreck der Mund offen stehen. »Wer …? Was machen Sie denn hier?«
»Herr Hemd?«
»Und?«
»Ich dachte …«
»Hans?«
»Hallo Fred, geht’s Dir gut?«
»Alles klar.« Sebastian grinste, schob sich an dem Eindringling vorbei, setzte sich auf die Fensterbank und musterte ihn von oben bis unten. Die königsblaue Samthose war eine Spur zu eng, das auberginefarbene Seidenhemd war ein bisschen zu rüschig, die spitzen Schuhe waren etwas zu grün, alles in allem: dieser Typ war um einiges zu schmierig. »Das ist dein Stecher aus Beeschau, hab ich Recht, Fred?«
Hatte er, und Fred fand das gar nicht komisch.
»Kann schon sein«, brummelte er und sah dem Wasserkocher äußerst interessiert beim Wasserkochen zu.
»Waren Sie nicht n Werbefuzzi oder sowas?«, fragte Sebastian, während er sich eine Zigarette ansteckte. »Und jetzt tingeln Sie rum und beschimpfen Schauspieler?“
»Sie haben mich erkannt, wie schön.« Mit einer angedeuteten Verbeugung ging Hans einfach über den beleidigenden Ton hinweg.
»Was ist das denn für einer?«, erkundigte sich Anna mit hochgezogenen Augenbrauen und warf Teebeutel in drei Bechertassen.
»Hans Baarkozy mein Name«, verkündete er mit Bänkelsängertimbre.
»Der Pöbler«, erklärte Sebastian trocken.
»Ach, bitte.« Ungefragt schnappte sich Hans einen Tee, zog den größten Stuhl der Garderobe beinahe in die Mitte des Raumes und machte es sich breitbeinig darauf bequem. Hätte seine Hose es erlaubt, wäre er vermutlich noch ganz neckisch in den Schneidersitz gehüpft. »Der Andreas-Darsteller ist absolut unglaubwürdig, eine armselige Karikatur ist der, so sieht’s doch aus. Wenn die bürgerlichen Kulturbanausen das nicht erkennen, muss eben einer von der Basis das Maul aufmachen.«
Verschone mich, dachte Anna und nahm noch eine Tasse aus dem Schrank. »Und mit dem hast du…?«, fragte sie Fred.
»Ich war betrunken«, entschuldigte der sich und spielte mit dem Zuckerstreuer.
»Schön.« Ewig wollte Sebastian nicht auf sein Pausenschlückchen warten, aber einen Fremden wollte er nicht gern dabei haben. »Sie haben Ihre Meinung kundgetan, ein Heißgetränk abgestaubt, dann ist ja alles prima. Ich wünsch Ihnen noch einen schönen Abend.« Demonstrativ postierte er sich neben der Tür und legte eine Hand auf die Klinke.
»Sie haben nicht angerufen«, sagte der Rüschenclown.
»Kann es sein, dass Sie mich verwechseln? Fred war derjenige …«
»Darum geht es hier nicht.«
Das hatte Fred auch schon bemerkt, und ihm war absolut nicht klar, ob er sich darüber freuen oder beklagen sollte.
»Also gut, Herr Baaderozzi …«
»Baarkozy!«
»Meinetwegen.« Man sollte sich von niemandem sein Pausenglück vermiesen lassen. Sebastian ging zu seiner Tasche, zog die Asbach Flasche hervor und goss einen großen Schluck in seine Tasse. Endlich. »Dann erzählen Sie uns doch fix, worum es hier geht, wir haben ja auch nicht den ganzen Abend Zeit.«
»Ganz genau«, stimmte Anna zu. Je schneller sich dieser aufgeblasene Gockel davonmachte, desto besser.
»Ich will ja erzählen, Sebastian, ich will ja.« Er zog eine Schachtel Zigaretten aus der Hosentasche, und für einen Augenblick waren alle von dem Gedanken abgelenkt, wie er sie dort jemals hineinbekommen hatte. »Ich mache Sie ganz groß.«
»Ich bin nicht so wie Fred.«
»Mit der Show, mein lieber Sebastian, mit der Show. Deshalb hatte ich Ihnen ja meine Karte gegeben. Damit wir ins Geschäft kommen. Ich hab Ihr Potential schon bei dem Justiztheater-Mist erkannt, da war mir schon klar, dass Sie was draus machen müssen.«
»Das haben wir ja auch.« Irritiert schüttelte Sebastian den Kopf. »Sie haben doch eben selbst in der Vorstellung gesessen, Sie haben doch gesehen, was wir aus der Sache gemacht haben.«
»Ja, ganz toll, super, prima.« Ironisch lächelnd erhob sich Hans von seinem Platz. »Und das reicht Ihnen so?« Mit ausgestreckten Armen drehte er sich theatralisch um die eigene Achse, wobei er jedem Anwesenden einmal kurz und intensiv in die Augen sah. »Ihnen allen?«
»Sind Sie taub? Haben Sie die Begeisterung, den Applaus da draußen nicht gehört?« Was glaubte dieser Kerl eigentlich? Langsam war Anna richtig geladen. »Oh, ich vergaß, der Herr Supertoll war sich ja zu fein für die ganze Vorstellung.«
»Presse war auch gut«, brummte Fred.
»Gut?« Mit erhobenem Zeigefinger ging Sebastian einen Schritt auf Hans zu. »Haben Sie, ganz zufällig, die eine oder andere Kritik über uns gelesen? Ach, ganz bestimmt haben Sie das, Sie sind ja so unglaublich gut informiert.«
»Und?«
»Das ging richtig nach vorne los. Von: ›Innovative Glanzleistung‹ bis ›Skandalöse Geschichtsfledderei‹ war alles vertreten, nach jeder Aufführung haben wir mehr Zeilen bekommen. Tolle Presse, jubelndes Publikum, was wollen Sie mir eigentlich anbieten?«
»Mehr Action. Dann kriegen wir auch mehr Headlines mit ›skandalös‹ drin.«
»Schwachsinn.« Nervös sah Fred auf die Uhr, war die scheiß Pause nicht irgendwann zu Ende?
»Das klingt …« ›Toll‹ wollte Sebastian sagen, ›skandalös‹ brachte immer Zuschauer, schließlich begafften alle gerne den Unfall, den sie nicht hatten.
»… völlig absurd«, beendete Anna den Satz. Dieser Kerl war ein Blender, sah Sebastian das denn nicht? Der würde ihnen nichts als einen Haufen Ärger einbringen.
Konnte man über die Skandalträchtigkeit des Stückes auf der Bühne noch streiten, so gab es für das, was sich derweil vor dem Theater abspielte, wohl nur einen treffenden Ausdruck: Ärger. Von dem keiner der Zuschauer etwas mitbekam. Nicht einmal während der Pause. In erster Linie war das wohl schlicht den üblichen Pausenaktivitäten zu verdanken. Frauen gingen aufs Klo, während sie ihre Männer zum Getränkeholen schickten. Beides war mit erheblichen Wartezeiten verbunden, und als dann alles erledigt war, rief auch schon der Gong zum zweiten Teil der Vorstellung. Hätte sich jemand vor die Tür gewagt, wäre dem Geschehen draußen eventuell mehr Aufmerksamkeit zuteil geworden, obwohl man kein Geld dafür bezahlt hatte.
Dass sie in den Genuss einer Gratisvorstellung kamen, konnte die Laune einer Gruppe älterer Damen und Herren allerdings auch nicht mehr besänftigen. Zunächst bemerkten sie es nicht einmal. Sie wären durchaus bereit gewesen, Eintrittsgeld zu zahlen, wenn sie denn Karten bekommen hätten. Lang hatten sie hin und her überlegt, ob sie sich ›revolutionär verfahren‹ tatsächlich ansehen sollten, wo sie doch sonst mit ihrem Kränzchen eher so … reizende Sachen sahen. Andererseits ging es hier um Geschichte, oder, aus ihrer Sicht, um modernes Zeitgeschehen, und am Ende hatte, wie immer, Hiltrud von Hohenstein für alle entschieden, und zwar morgens um zehn Uhr am Tag der Vorstellung. Da waren natürlich keine Karten mehr zu bekommen gewesen, aber sie könnte es ja ganz eventuell an der Abendkasse versuchen, hatte ihr die Studentin vom Kartenvorverkauf gesagt, da gäbe es manchmal noch was. Gab es auch, nämlich den Hinweis, dass außer Reservierungen nichts mehr da wäre, wenn sie allerdings bereit wären zu warten, könnte man ja sehen, ob vielleicht was liegen bliebe. Also blieben sie stehen, wenn auch die Hoffnung auf sieben zusammenhängende Karten etwas naiv anmuten mochte. Und natürlich nicht erfüllt wurde. Als die Klappe der Abendkasse zugeschoben wurde, waren Hiltrud und ihre Freunde bereits nicht mehr besonders gut auf das Stück zu sprechen.
»Es ist doch wohl eine Unverschämtheit, dass man so wenig Karten druckt, die wissen doch, dass viele Menschen dieses Stück sehen wollen.«
»Allerdings!«
»Und dann bringen sie ihr Personal dazu, die Leute trotzdem hierher zu schicken. Obwohl die ganz genau wissen, dass es gar keine Karten mehr gibt.«
»Jawohl!«
»Und dann werden wir auch noch dazu gezwungen, hier draußen zu warten, obwohl überhaupt keine Aussicht darauf besteht, noch hereinzukommen. Das ist ein Skandal.«
Über den Skandal waren sie sich einig, nicht ganz eins waren sie allerdings bezüglich der weiteren Abendgestaltung.
Während sie nun ihre Unentschlossenheit, aufgrund einiger Gehördefizite recht lautstark, auslebten, fanden sich am Fuß der ausladenden Freitreppe, die zur Theatertür führte, vier bullige junge Männer mit kahl geschorenen Köpfen ein, die im Grunde ein ganz ähnliches Problem hatten.
»Und nu? Wollen wir nich zu Ricardo gehen, Mann, bei dem seiner Party gibt’s bestimmt Ärger.«
»Is doch Kinderkram, lass mal lieber vorm ›Indi‹ warten, soll heut n Geburtstag von irgend so ner Zecke sein.«
»Also …«, begann Frau von Hohenstein und warf einen verstohlenen Blick auf die unentschlossenen Glatzen. »Dann wollen wir doch noch einmal in aller Ruhe überlegen, was wir jetzt Schönes machen könnten. Gibt es nicht vielleicht die Möglichkeit, hier im Foyer noch eine Kleinigkeit zu trinken?«
Eifrig nickend stimmten alle diesem Vorschlag zu, war doch der Weg ins Theater der einzige, der sie nicht an den abenteuerdurstigen jungen Leuten vorbeiführte. Deren Freizeitbeschäftigung übrigens gerade wie auf Stichwort auf sie zukam.
»Und wenn wir einfach zu … Hey, warte mal, was’ das denn?«
Schon fragten sich auch unsere älteren Mitbürger, was es mit der kleinen verwaschen bunten Menschenmenge auf sich haben mochte, die eilig auf das Stadttheater zulief, allerdings kurz vor den Stufen abdrehte, ohne die Treppe und alles, was sich darauf befand, auch nur eines Blickes zu würdigen und schließlich an einer Ecke des Baus zur Ruhe kam. Dort trat ein Kern von acht Männern und vier Frauen, alle waren etwa Mitte dreißig, aus der nicht wesentlich größeren Gruppe heraus. Sie hielten ihre linken Arme in die Höhe.
»Was haben die da für seltsame Bänder an den Armen?« Hiltrud von Hohenstein konnte auf die Entfernung nicht mehr besonders gut sehen.
»Das is ja geil«, freute sich der Alphaskin, als von einem der mutmaßlichen Linken eine stabile Eisenkette zunächst hinter das Fallrohr der Regenrinne gefummelt wurde, was die Standortwahl erklärte, und danach durch die metallenen Armschellen der uniformierten Nonkonformisten geführt wurde, die sich damit bereitwillig an besagtes Rohr anschließen ließen. Natürlich hatten sie sich damit nicht einfach an irgendein blödes Fallrohr gekettet, sondern an ein ›Bollwerk des reaktionären Unterhaltungstheaters‹. Was wie blinder Aktionismus anmutete, war das Ergebnis einer, nun, einer Art Planung. Deshalb sollte der Schlüssel auch verschluckt werden, wozu es allerdings nicht mehr kam, da er in den Gully fiel. So war der erste Teil der Aktion, wenn auch mit einiger Verspätung, vollbracht. Teil zwei gestaltete sich bereits eine winzige Spur schwieriger. Das Ganze sollte ein Sit-In als Protest gegen das Theaterstück werden, doch zum Sitzen war für zwölf Menschen an diesem Rohr einfach nicht genügend Platz. Bereits stehend konnten sich alle nur im Halbkreis um die Ecke gruppieren, und als sie langsam nach unten rutschen wollten, blieben sie in der klassischen Gymnastikhaltung stecken: die Knie leicht gebeugt. Mehr war nicht drin, tiefer kamen sie nicht.
»Verdammte Scheiße, der verkackte kapitalistische Protzbau ist einfach zu klein«, stellte eine blonde attraktive Frau im selbst gestrickten engen Kleid genervt fest.
»Aus Sit-In wird nix«, erkannte auch der große Kerl persischer Herkunft neben ihr. »Was machen wir nun, Uschi?«
»Was wohl? Wie immer, Benno«, entschied Uschi energisch, sie würde sich den Spaß doch nicht durch ein kleines Hindernis verderben lassen. In die freie Hand drückte sie Benno eine Plastiktüte, holte eine Farbspraydose daraus hervor und schüttelte sie ausgiebig, wobei sie ihn angriffslustig anlächelte. Uschi ließ sich nie den Spaß verderben, auch nicht von ihrem ›richtigen‹ Namen, Ursula de Üntrecht, den sie ihrer Oma zu verdanken hatte, einer resoluten alten Dame, die sich damit rühmte, im Widerstand in Brüssel gewesen zu sein. Im arischen Widerstand gegen den Widerstand gegen die Erlöser aus dem Deutschen Reich, denen sie mit ihrem Mann heim gefolgt war. Uschi war da natürlich längst noch nicht weit genug von Ursula entfernt, weshalb bereits in früher Pubertät ausgeflippte Klamotten und später SDS und Benno zu Hilfe genommen wurden. Der hatte seinen Namen im Grunde nur abgeändert, um es allen etwas leichter zu machen. Eigentlich hieß er Mahmut Ali ben Omar und war in Berlin geboren. Die meisten hielten ihn für einen Türken, obwohl seine Eltern aus Isfahan stammten. Geflohen vorm Schah und nicht zurückgekehrt zu den Mullahs predigten sie ihrem Sohn Shariatreue, die er nie hielt. Seit Jahren lebte er mit Uschi in wilder Ehe und studierte Islamwissenschaften, verbrachte also seine Zeit mit allem, was er nicht so ganz verstand. Was jetzt von ihm erwartet wurde, wusste er allerdings, so etwas machten sie wirklich nicht zum ersten Mal. Er stopfte die nun leere Plastiktüte in seine Jackentasche und griff mit der rechten Hand nach einem Zipfel des Protestplakates, welches er die ganze Zeit etwas ungelenk mit der angeketteten linken Hand festgehalten hatte. Sein Rohrnachbar Friedrich Engel, der einen kindlichen Stolz für seinen Namen empfand, wollte Benno beim Entrollen des Transparentes behilflich sein, doch es gelang ihm nicht. Stattdessen bekam er den Stock des Plakats so ungeschickt zu fassen, dass Benno mit dem oberen Teil versehentlich Uschi die Farbdose aus der Hand schlug. Entschuldigend sah er seine Freundin an, die hatte dafür jedoch überhaupt kein Verständnis. Keifend und zeternd schlug sie um sich, so gut es eben ging, wobei auch noch das Plakat zu Boden fiel und etwa einen Meter von ihnen wegrollte.
»Du Idiot!«
Erwartungsgemäß war Benno ganz allein Schuld an dieser Misere.
»Also los, versucht die Sachen wieder herzuholen!«
Umständlich streckte Benno erst ein Bein nach vorne, dann das andere, erreichte damit allerdings weder das Plakat noch die Spraydose sondern nur, dass seine Genossen kräftig ans Rohr gepresst wurden und schlechter atmen konnten.
Daher rührte Uschis Stöhnen jedoch nicht allein. In erster Linie drückte es ihren Unmut darüber aus, mal wieder alles selbst in die Hand nehmen zu müssen. Oder, diesmal, in die Füße. Doch obwohl sie fraglos sonst alles immer viel besser konnte, blieben ihre Beine einfach kürzer als die ihres Freundes, der sich dafür einen ordentlichen Anschiss einfing.
»Hat keinen Zweck«, murmelte Friedrich, der sein Glück gar nicht erst zu versuchen brauchte, da er mindestens zwei Köpfe kleiner war als Benno, wenn auch genauso behaart.
»Na, und nun?« Das war keine Frage, das war Grete, die mit bürgerlichem Namen Margret Fischer hieß und zu ihrem großen Unmut Pastorentochter war. Sie gehörte so selbstverständlich zur WG von Uschi, Benno und Friedrich wie der ›Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber‹ am Kühlschrank. Tägliche Reibereien hatten das Zusammenleben anfänglich arg strapaziert, bis die regelmäßigen Marihuana-Sit-Ins zur Festigung der Gemeinschaft eingeführt wurden. Der folgende entspannte Gleichmut der Bewohner hatte viele Leute angelockt und selten vertrieben, wodurch die WG irgendwann zu einer Schaltzentrale des linken Widerstandes geworden war. Die einzige, die nie von der Polizei durchsucht worden war.
»Das war alles wieder so scheiße typisch!« Außer Grete wagte es sonst niemand, an Uschi und Benno, also an Uschi, Kritik zu üben. Insgeheim hielten die anderen Grete für den intellektuellen Kopf der Truppe, der zu häufig für einen undurchdachten vorschnellen Aktionismus geopfert wurde. »Ja wirklich, ganz tolles Ding. Wozu einen Plan machen, wenn man auch völlig bekifft losrennen kann!« Wutschnaubend zupfte sie ihr Batikkleid wieder so zurecht, dass kein weiblicher Reiz versehentlich hervortrat. »Rumhängen, immer nur rumhängen.«
»Grete, wann verstehst du das endlich: Pläne sind was für Spießer. Null authentisch! Sowas nimmt der Aktion voll die Dynamik, du musst es einfach leben.« Mit einem reichhaltigen Phrasenschatz konnte Uschi ihren geringen Verstand immerhin hübsch ausstaffieren.
»Genau«, pflichtete Benno ihr erwartungsgemäß bei. »Pläne können ausgeplaudert werden, sind ergo konterrevolutionär.«
Der Rest der Angeketteten hielt sich raus, und die wenigen frei herumstehenden Demonstranten taten, was nur sie tun konnten. Sie gingen. Neu war das sowieso alles nicht. Wie hier alle so offen miteinander kommunizierten, beteiligt waren an einer kommunikativen Einheitsfindung, über alles diskutierten. Bis dann alle diese hübschen kleinen Euphemismen zum gleichen Ergebnis führten wie jeder gewöhnliche Streit: Meinungsdespotie und beleidigtes Murren.
»Und jetzt wieder wie immer?«, hakte Grete zynisch nach. »Auf die Bullen warten, loseisen lassen und für zwei Nächte im staatlichen Hotel übernachten, oder was?«
»Sicher nicht«, entgegnete Uschi beleidigt. »Macht kaputt, was euch kaputt macht!«
»Hä?« Unverständnis machte sich im Kollektiv breit.
»Die Dachrinne«, verstand Benno freudestrahlend. »Reißen wir das Scheißding aus der Wand!«
»Das könnte ja heute wirklich noch gewaltig scheppern«, freute sich Else Immerda und scheuchte ihren Kameramann zur Dachrinne. Dank ihrer ausgeprägten Kontaktfreude war sie von der Zeitung zum Fernsehen aufgestiegen, vom Ressort ›Feuilleton und Kultur‹ hoch hinauf zum Boulevard, und eben diese Freundlichkeit hatte auch einen Taxifahrer dazu gebracht, ihr sofort Bescheid zu geben, als er das ›Stand-In‹ am Theater entdeckt hatte.
»Vielleicht wartet ihr doch noch mal einen Moment«, pfiff Else plötzlich ihre Jungs zurück. Ihr Gespür für das richtige Timing war schließlich auch nicht zu verachten. »Unsere kurz geschorenen Freunde da drüben reiben sich ja gerade erst die Hände, das braucht noch ne Weile, bis wir die richtig guten Bilder kriegen.«
Indes konnten die Glatzen ihr Glück schon jetzt kaum fassen, mit dem Losrennen und Zuschlagen hatten sie bislang nur gezögert, weil sie sich bei der versteckten Kamera wähnten.
»Ach, und wenn schon«, gab schließlich einer von ihnen den Startschuss. »Was man hat, das hat man. Los jetzt!«
Als endlich die ersten Fäuste auf die wehrlosen Demonstranten krachten, ging Else Immerda auf die Rentnergruppe zu, die noch immer vor der Theatertür stand und dem Geschehen vollkommen fassungslos und absolut begeistert zusah.
»Guten Abend«, begrüßte sie einen der Herren, der sich sichtlich freute, von so einer hübschen Frau angesprochen zu werden, wenn er auch kein Wort verstand.
»Hier ist Else Immerda, Ihre flinke Zunge von Kanal XXL, und ich stehe gerade vor dem Friedensheimer Stadttheater, in dem heute Abend ein Stück gezeigt wird, mit dem nicht alle einverstanden sind. … Sie haben sich heute Abend hier eingefunden, um zu demonstrieren? Warum? Die Show ist doch sehr beliebt. Worum geht es Ihnen denn genau?«
»Was?« Horst, der halbtaube Rentner, zuckte erschrocken vor dem Mikrofon zurück.
»Sie müssen schon lauter sprechen, junge Frau«, erklärte sein Freund Heinz, woraufhin ihm das Mikro beinahe sein Gebiss heraus hebelte.
»Vielleicht können Sie uns die Frage beantworten? Die Zuschauer wollen Ihre Meinung hören, das kommt noch in die Spätnachrichten.«
»Wie bitte?«
»Die haben uns gar nicht erst reingelassen«, mischte sich jetzt eine der Damen ein. »Von Anfang an wollten sie das verhindern.«
»Ach…«
»So ist es.« Wenn das schon ins Fernsehen kam, wollte jeder aus der Gruppe etwas dazu sagen. »Ganz miese Methoden haben die drauf gehabt.« Dem Vorwurf folgte ein vages Rudern mit den Armen, welches unter anderem in Richtung der Angeketteten wies.
»Sie wollen also damit sagen, dass man Sie mit Gewalt davon abgehalten hat, Ihre Meinung zu äußern?«
»Was?«
Ganz genau hatte die Frage diesmal niemand verstanden. Waren die Schläge der Skins noch relativ leicht zu übertönen gewesen, so schwoll doch das Jammern der Opfer langsam zu einer äußerst unangenehmen Geräuschkulisse an.
»In der Tat!« Hiltrud von Hohenstein hatte zwar auch kein Wort verstanden, aber war das wirklich so wichtig? Ihre Freunde würden sie im Fernsehen sehen!
»Dann erzählen Sie doch mal!« Sofort hatte Else erkannt, wen sie da vor sich hatte: eine Rampensau par excellence, der Bericht war gerettet.
»Wir finden das alles nicht sehr erfreulich.«
»Das Theaterstück?«
»Auch die ganzen Begleitumstände.«
»Sie meinen die Opfer?«
»Für die Opfer ist das ja alles immer ganz schlecht.«
»Und was halten Sie davon, dass man sich mal auf diese Art und Weise mit der Zeit auseinandersetzt?«
»Wir wussten ja nun überhaupt nicht, was wir mit der ganzen Zeit anfangen sollten.«
»Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, dieser Theaterabend bietet Stoff für Kontroversen.«
»Ein Skandal!«
»Was?«
Die Schlägerei am Fallrohr schien ihren Höhepunkt erreicht zu haben, weshalb Else Immerda von den Rentnern weg und zu den etwas agileren Bildern überging. Unfair war das schon, was sich dort an der Hausecke abspielte, immerhin waren es vier Skins, die mit zwölf Linksuniformierten fertig werden mussten. Wenn man die Herumstehenden nicht mitzählte.
»Ist ›revolutionär verfahren‹ Verharmlosung von Geschichte?«, sprach Else ihren Text über die wundervollen Detailaufnahmen des pittoresken Gemetzels. »Ist es ein Affront gegenüber den Opfern? Oder ist es notwendig? Notwendige Aufklärungsarbeit, endlich einmal auf eine Art und Weise präsentiert, die auch der einfache Mann versteht?«
»Was?«
»Eine Menge Fragen, die geklärt werden müssen. Liebe Zuschauer, ich bleibe für Sie dran. Das verspricht Ihnen Ihre Else Immerda von Kanal XXL.«
Dranbleiben war augenscheinlich auch das Lebensmotto von Hans Baarkozy, von selbst machte er zumindest keinerlei Anstalten, die Garderobe zu verlassen, doch da Sebastian seine Hartnäckigkeit bereits einige Jahre länger trainiert hatte, bekam er ihn schließlich irgendwie hinaus. Bis sie wieder zurück auf die Bühne mussten, sagte keiner der drei mehr einen Ton. Sebastian trank, Anna nahm sich vor, nach der Vorstellung mehr als ein ernstes Wort mit ihm zu reden, und Fred schwankte zwischen Scham und Begehren. Scharf fand er diesen Baarkozy ja immer noch.
Etwa zeitgleich mit dem Beginn der zweiten Programmhälfte klingelte, nicht weit vom Stadttheater entfernt, das Telefon und weckte ein Begehren, das nie ganz eingeschlafen war.
»Das ist furchtbar nett, dass Sie da gleich an mich gedacht haben. Aber nehme ich Ihnen nicht den ganzen Spaß weg?«
Freundlichkeit war sonst gar nicht seine Art, doch auf diesen Anruf hatte Herold Storm einfach zu lange gewartet, als dass er seine Freude verbergen konnte. Selten klingelte das Telefon in der Abteilung ›Sondereinsätze politischer Konflikt‹, kurz: SpoK, da kaum jemand etwas von dieser Abteilung wusste. Außer natürlich Herold Storm, der sie leitete, und seine Männer. Ein kleiner Haufen williger Untergebener, denen die Bundeswehr zu lasch gewesen war und die Fremdenlegion zu weit von Mutti entfernt. Vor etlichen Jahren hatte man Storm gefeiert und seine Arbeit gelobt, sein harsches Vorgehen, seine durchschlagenden Methoden mit ebensolchen Erfolgen, doch die Zeiten waren vorbei. Was machte man aber mit einem Mann, der von seiner harten Linie, die ihm so viel Ansehen verschafft hatte, einfach nicht lassen wollte, für den der Feind stets auf der gleichen Seite stand, und den es noch immer ohne Diskussion und mit aller Stärke auszumerzen galt? Ein Mann, der noch nicht alt genug für eine Frühpensionierung war, der jede Strafversetzung als Belohnung angesehen hätte, der sich also mit üblichen Mitteln nicht stilllegen ließ? Man gab ihm eine Aufgabe, bei der er keinen Schaden mehr anrichten konnte, eine Abteilung, die zu nichts nütze war, und stellte ein Telefon in sein Wohnzimmer, welches dadurch zur ›Zentrale‹ wurde.
Seiner Frau war das übrigens völlig egal, wie ihr sonst im Leben auch alles andere völlig egal war, allein diesem Umstand hatte Storm vermutlich seine Ehe zu verdanken. Hannelore hatte einfach nicht nein gesagt. Ein Charakterzug, den sie ihrer Tochter vererbt hatte, nur dass diese fürs Ja-Sagen inzwischen Geld bekam. Herold Storm sagte an diesem Abend auch ja, und zwar mit einer Begeisterung, die seine Familie nie verstehen würde.
»Unangemeldete Demo? Chaoten und Naziaufmarsch? Eskalierende Gewalt? Prima! Selbstverständlich kann es sofort losgehen.«
Vorsichtshalber fragte Storm nicht nach, warum SpoK tatsächlich einmal angefordert wurde. Tatsächlich war die Polizeisituation in Friedensheim an diesem Abend einfach so katastrophal, dass Herold trotz seiner Fähigkeiten reaktiviert werden musste. Alles, was die städtische und umliegende Polizei an Personal aufzubieten hatte, war nämlich von der Kreisstadt Overnheim angefordert worden, die dank eines Planungsfehlers von drei Demonstrationen gleichzeitig heimgesucht wurde. Die ›Willigen Weiber‹, eine Vereinigung schlichter Frauen, welche eine Rückkehr zu den drei Ks für einen angemessenen Ausweg aus ihrer persönlichen Bildungsmisere hielten und auch für nichts Originelleres auf die Straße gingen, trafen auf die ›Mündigen Männermurkserinnen‹, eine kampfsportgestählte Lesbenvereinigung, deren Demonstrationsziel die Erhöhung der Frauenquote auf etwa hundert Prozent war, und gekreuzt wurden die beiden Demonstrationszüge von den ›Krämpfen‹, den ›Krippenkämpfern und -kämpferinnen‹, einem Sammelsurium von Erziehern und Innen, die das Mindestalter für Waffenbesitz auf viereinhalb senken wollten. Niemand hatte vorausgeahnt, dass an diesem Tag in Friedensheim mehr Polizeipräsenz benötigt wurde, als eine einzelne Knöllchenschreiberin namens Ingrid zu bieten hatte.
»Ach, wir sollen nur …?« Etwas enttäuscht war Storm dann doch, als er erfuhr, was bei diesem Einsatz erwartet wurde, prompt gewann er seinen normalen rüden Tonfall zurück. »Der ganze Scheiß ist schon vorbei, und wir sollen da nur die Trümmer von der Wand reißen? Weil diese dämlichen Chaoten, Scheiße noch eins, zu blöd sind, um ihre Kackaktion zu planen, soll ich da jetzt dreckige Händchen halten?« Den Linken helfen, soweit kam das noch. »Warum lasst ihr die nicht hängen und wartet auf Regen, hä? … Na, losrosten, was kann ich sonst damit gemeint haben? Ja, is ja gut, Befehl ist Befehl.«
Ganz konnte er die freudige Erregung in seiner Stimme nicht verbergen, und als er an die Aufregung seiner Jungs dachte, die ebenso gierig wir er auf eine Aufgabe lauerten, wandte sich sein optimistischer Geist auch schnell wieder den guten Seiten zu: Sicher gab es ein paar Verhaftungen und irgendein Presseheini bekam bestimmt was aufs Maul. Schließlich stand Herold Storm auf, rückte sich mit einem lauten Knacken den Hals zurecht, zog sein Hemd über den Bauch, um es in die Hose zu stopfen, nahm seine Jacke von der Garderobe und verließ die Wohnung. Beinahe. An der Tür machte er noch einmal kehrt, ging ins Schlafzimmer und holte seine liebevoll gepflegte alte Dienstwaffe aus dem Nachttisch. Man weiß ja nie, dachte er hoffnungsvoll und verließ das Haus.
Diesmal hatte die Aufführung wirklich alle Hoffnungen übertroffen. Das Publikum jauchzte, es jubelte, es applaudierte stehend. Alle Darsteller waren in, persönlicher, Bestform gewesen, doch damit allein ließ sich der Erfolg sicher nicht begründen. Die Berichterstattung, die Besprechungen hatten die Zuschauer mit großen Erwartungen in die Vorstellung gelockt, und die sahen dort genau das, was sie wollten. Wem eine positive Kritik zu Ohren gekommen war, der freute sich und lachte, bis ihm die Luft wegblieb, und wer wegen der Vorwürfe ›Skandal‹, ›empörend‹ oder ›würdelos‹ den Weg ins Theater gefunden hatte, kam ebenfalls auf seine Kosten.
»Eins … noch einer … und noch einer …« Voller Euphorie zählten die Schauspieler gemeinsam die Vorhänge und kamen, zu ihrem eigenen Erstaunen, auf sechs.
»Absolut unglaublich«, freute sich Rita, und alle stimmten ihr begeistert zu. Doch den größten Kick holte sich Sebastian, der ganz alleine noch ein siebtes Mal zum Verbeugen auf die Bühne trat, und ein achtes Mal, da saß allerdings nur noch ein Pärchen im Saal, welches sich schon während der gesamten Vorstellung gestritten hatte und sowieso nichts mitbekam. Die anderen Theaterbesucher drängelten sich längst in der Jackenschlange oder versuchten herauszufinden, wie ihnen das Stück gefallen hatte, indem sie sich unauffällig umhörten, wie denn den anderen das Stück gefallen hatte. Auf die eigene Meinung ist ja kein Verlass. Auch Fred, Gernot und Rita hatten sich inzwischen in die Garderoben zurückgezogen. Nur Anna stand noch hinter der Bühne und sah Sebastian in seinem Freudentaumel zu. Alles auf den Alkohol zu schieben, wäre viel zu einfach gewesen. Wenn er auch nicht nüchtern war, so gehörte doch das Torkeln und Trudeln in erster Linie zu dem strahlenden, glückseligen Lächeln auf seinem Gesicht.
Bravo, Sebastian!, dachte Anna und schluckte ihren Neid hinunter. Rampenrausch, anders konnte man es wohl nicht nennen. Während ihrer fast zehnjährigen Theaterarbeit hatte sie so etwas Ähnliches natürlich schon häufiger erlebt, aber eben noch nie ganz genau so etwas, noch nie jemanden, der in seiner ekstatischen Erschöpfung gleichzeitig so glücklich, weltfern und friedlich wirkte. Das wollte sie auch, das war es, weshalb sie sich von Sebastian hatte überreden lassen, bei der Show mit dabei zu sein. Na gut, und weil ihre Mutter ihr gesagt hatte, dass sie damit ihre wundervolle sichere Existenz mit Rentenanspruch aufs Spiel setzten würde. »Theaterspielen ist ja ganz schön, Kind, wenn man denn das Talent dazu hat.«
Langsam ging Anna, die wohl einzig ihre Mutter nie von ihrem Talent überzeugen würde, in ihre Garderobe und zog sich um.
Lange dauerte es nicht, bis sich alle Schauspieler abgeschminkt und die Kostüme gegen ihre Alltagskleidung getauscht hatten. Beinahe zeitgleich trudelten sie in dem kleinen Flur ein, der zwischen Foyer und Garderobenbereich lag und in erster Linie als Raucherecke genutzt wurde.
»Das Beste habt ihr verpasst!«
Wie ein Springteufel hüpfte Hans Baarkozy vom Fensterbrett herunter und baute sich grinsend vor ihnen auf. Fiese falsche Selbstsicherheit quoll ihm aus jeder Pore, wie Anna angewidert registrierte, doch sagen konnte sie ihm das nicht. Er ließ sie gar nicht erst zu Wort kommen.
»Habt ihr mitgekriegt, was draußen los war? Ha, natürlich nicht, wie solltet ihr auch, habt ja auf der Bühne geschuftet, der eine besser, der andere schlechter. Kommt schon, guckt nich so, war nur ein Scherz. Oder vielleicht auch nicht? Ich war jedenfalls vor der Tür und hab mir das Spektakel angesehen, super Promo, kann ich da nur sagen, ganz großes Ding, aber da muss man natürlich was draus machen, muss man mit arbeiten, mit spielen …«
»Würden Sie uns mal, bitte …«, versuchte Sebastian betont förmlich diesen atemlosen Redefluss zu stoppen, doch so leicht war das nicht.
»Lasst mich doch mal ausreden«, beschwerte sich Baarkozy umgehend. »Lasst mich doch wenigstens ein einziges Mal ausreden. Okay? Ist das okay für euch?«
Zumindest war es ihnen scheißegal. Also durfte er, in Höchstgeschwindigkeit, erzählen, was er gesehen hatte: die Linken am Fallrohr, die Skins beim Fäusteschwingen und die Rentner, die schief in die Fernsehkamera lächelten. Die Truppe hörte ihm entgeistert zu.
»Fernsehen, versteht ihr? Ganz großes Ding! Was wir brauchen, ist einfach mehr Action, Knalleffekte, und wenn ich euch …«
»So, jetzt mal Fresse halten«, polterte Sebastian dazwischen. »Ich hab keine Lust den Rest des Abends wie ein Neuntklässler in der Raucherecke zu stehen. Wir gehen jetzt in unser Hotel und setzen uns da an die Bar.«
»Genau! Wir gehen jetzt«, wiederholte Anna und drehte Hans demonstrativ den Rücken zu. Sie hatte Sebastians indirekte Einladung durchaus verstanden und war damit überhaupt nicht einverstanden. Idiot.
»Was für beschissene Idioten«, freute sich Herold Storm, und es war nicht ganz eindeutig, ob er damit Uschi, Benno, Grete und die anderen Mitglieder des Fallrohrkollektivs meinte oder die Sanitäter und die unifrischen Notärzte, die sie umständlich verarzteten. Die ärztliche Versorgung gestaltete sich nämlich durch einen winzigen Umstand recht schwierig: alle Opfer hingen noch immer gemeinschaftlich an diesem blöden Rohr. Während Wunden getupft, Blutungen gestillt und Pflaster geklebt wurden, verließen die ersten Zuschauer das Theater und stießen auf eine Realität, die ihre Fantasie überforderte. Gucken musste man trotzdem.
»Ach ja, das gefällt mir«, schoss Storm sich langsam ein. »Früher mussten wir immer stundenlang hinter euch herrennen. Dann mussten wir eure Angriffe abwehren. Und dann erst durften wir euch niederknüppeln. Scheiße, war das lästig. Und anstrengend. Heute sorgt ihr für euch selbst, Mensch, das find ich gut! Das nennt man wohl, passt auf, das nennt man wahrhaftig autonom!« Mit einem lauten »Ha!« kommentierte Storm seinen eigenen Scherz. So genau wusste niemand, ob das ein Lachen sein sollte, Humor war bei ihm bislang noch nicht festgestellt worden. Dabei hatte er ihn, er hob ihn sich nur gut auf. Wann lohnte sich das denn schon? Bei so einem Anblick ganz sicher. Warum lachten seine Leute dann nicht? Na, da würde er wohl noch was zu sagen, aber nicht heute Abend, das konnte warten.
»Sie sind also hier zuständig?« Mit einem bös genervten Funkeln in den Augen schritt einer der beiden Notärzte geradewegs auf Storm zu. »Statt große Reden zu schwingen, sollten Sie lieber dafür sorgen, dass die Verletzten endlich befreit werden und die Gaffer hier verschwinden. Das würde die Versorgung sehr viel einfacher gestalten.«
»Die Kollegen holen gerade einen Bolzenschneider«, entgegnete Storm hämisch grinsend. Nicht einmal ein Notarzt konnte ihm heute den Tag versauen. Jung fühlte er sich, lebendig, die Feinde aus früheren Zeiten hatten sich selbst verarscht. »Solange die notwendigen Gerätschaften nicht da sind, können wir rein gar nichts tun, das müssen Sie doch einsehen. Herr Doktor. Sind Sie überhaupt ein Doktor? Oder sind Sie nur Arzt?« Schon wieder lachte Storm über seinen eigenen blöden Spruch, und diesmal fielen seine Untergebenen dienstbeflissen mit ein. Geht doch, dachte Storm, können wir uns die Standpauke später ja vielleicht sparen.
»Ach, fick dich«, hätten Benno, Uschi und Grete vermutlich unisono dazu gesagt, wenn sie nicht viel zu sehr mit gegenseitigen Schuldzuweisungen beschäftigt gewesen wären. Und mit dem gern zitierten Wundenlecken, das in diesem Fall wörtlich zu nehmen war, da allen dreien das Blut über die Lippen rann, wenn es auch aus unterschiedlichen Quellen floss.
»Schön, gut, dann sind Sie Ihr Sprüchlein jetzt auch losgeworden«, konterte der Notarzt in einem Tonfall, den er sonst bei drogensüchtigen Randalierern anwandte. »Und was ist mit den Leuten, die hier im Weg stehen? Ist es nicht Ihr Job …«
»Erzählen Sie mir, verdammt noch eins, nicht, was mein Job ist, sondern machen Sie gefälligst erstmal Ihren! Sehen Sie zu, dass wir dieses Gesindel auf die Wache schaffen können«, fuhr Storm ihn zornig an. Allmählich verdarb ihm der Klugscheißer doch die Laune. Weil der Klugscheißer Recht hatte. Die Menge der Schaulustigen wuchs stetig, wodurch seine Arbeit auch nicht einfacher wurde. »Ihr habt alle euer Theater gehabt«, herrschte er die herumstehenden Glotzer an. »Geht nach Hause, macht ne Buddel Wein auf und kippt sie euch in eure hohlen Schädel. Na los, los! Gebt meinetwegen bei euren Nachbarn damit an, was ihr hier Wildes erlebt hat, is mir scheißegal, Hauptsache ihr verpi…!«
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783739401157
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2017 (November)
- Schlagworte
- männergeschenk humor komödie fakenews theater wildwestschau satire Satire Parodie Humor