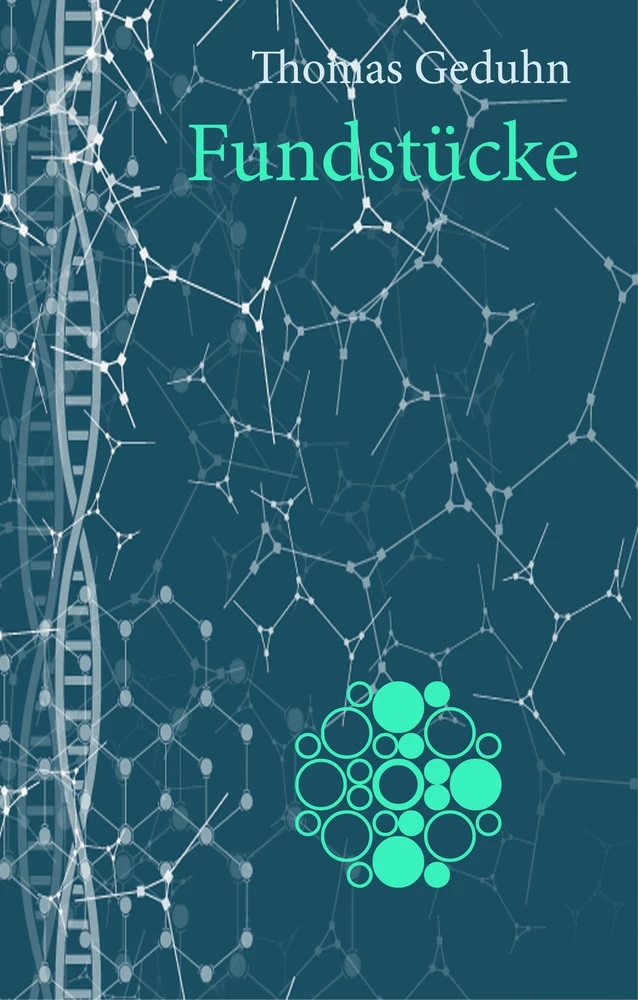Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Nicht, um zu töten ...
In Kopenhagen kamen Unternehmer, Politiker und Wissenschaftler am Rande einer internationalen Tagung zusammen. Sie nannten es einen Informationsaustausch, bei dem es um neue Verfahren der Stammzellgewinnung und Konservierungsverfahren ging.
Dabei trafen sich Dr. Max Brendel mit einem parlamentarischen Staatssekretär des deutschen Gesundheitsministeriums und zwei Abteilungsleitern aus dem Wirtschaftsministerium zu einem vertraulichen Gespräch. Abschließend fasste Dr. Brendel zusammen:
»Wir reprogrammieren sehr erfolgreich! Aus iPS-Zellen werden wir in den kommenden Monaten Vorläuferzellen des Gehirns herstellen und in virtuelle Nervensysteme transplantieren. Einige unserer führenden Mitarbeiter drängen bereits jetzt auf weitere Schritte. Und ich füge hinzu, sie tun dies energisch. Die Branchenkollegen aus der Pharmazie wühlen bereits seit längerem in den Zukunftsoptionen.
Wir alle haben Alzheimer, Parkinson oder Multiple Sklerose ... Krebs natürlich auch, im Auge. Das ist unser gesundheitspolitischer Beitrag für Deutschland und die Menschheit! Sie kennen die Fallzahlen und sie kennen die Wachstumsprognosen. Für den gesetzlichen Rahmen sind sie zuständig! Machen wir uns also an die Arbeit. Gemeinsam!«
*
All diese Lügen!
Bei einem Abendessen hatten sich Brendel und sein Vorstandskollege Bader ihren Ideen hingegeben.
»Hör mir jetzt mal zu!«, hatte Max Brendel mit nicht mehr ganz sicherer Stimme von Bader gefordert. Sie waren beim Whisky angekommen. «Cheers!« Dr. Bader grinste.
»Wir entwerfen Konstruktionen jenseits vereinbarter Grenzen die wir, grob gesprochen, mit Ethik umreißen. Wir loten diese Grenzen aus, interpretieren sie frei und immer wieder neu.«, gab sich Brendel Mühe»Mensch, Max. Maximal laaangweilig!«, gähnte Bader.
Er stand auf, ging zu der Musikanlage und kurz darauf tönte ein Stück von Jeff Buckley durch den großen Raum.
»Und deshalb, mein Lieber, braucht es Lügen!«, beharrte Brendel schmallippig. Dass das Ideal der Mündigkeit der Bürger überdehnt würde, war fester Bestandteil seines Meinungsrepertoires. »Du Moralinchen..., nüchtern gefällst du mir besser! «, unkte Bader.
»Geht es um die Vorbereitung von Zumutungen gegen die eigene Bevölkerung, muss der Staat lügen. Der einzelne Mensch muss lügen, weil er sonst ein Problem mit seiner eingeschränkten Komplexitätsverarbeitung bekommt. Da heißt es dann: Welt und der Sinn des Lebens ..., jede Veränderung wird nach innen verwurstet. Das ist der Schlusspunkt gegen die Komplexität! Jetzt hör mir doch mal zu, Matthias.«
Ungerührt schwang Bader sein Bleiglas von links nach rechts, nahm einen Schluck und drehte sich dabei langsam um die eigene Achse. Mit einem weichen Hüftknick sagte er: »Ok, ok: Ich lüge, du lügst, er-sie-es lügt ... alle lügen«, ging es weiter.
Brendel stand auf, starrte durch die großen Fenster und kniff die Augen zusammen. »Wir machen hier Schluss, aber erst muss ich noch einen Fingerhut voll haben und abtanzen.«
Dr. Bader sagte undeutlich so etwas wie ´endlich und wäre jetzt auch mal gut`. Dann versuchte er sich zu dem Song ´Forget Her` an einem Ausdruckstanz, während Brendel zur geöffneten Terrassentür ging und draußen raumgreifend zu tanzen begann. An der Stelle ‚She was heartache from the moment that you met her’ warf er die Arme in den einsetzenden Regen nach oben.
*
»Für unser Marketing ist die Erkenntnis leider ein Muster ohne Wert. Damit können wir nicht arbeiten«, sagte Dr. Bader am nächsten Tag zu Brendel auf dem Weg in die Kantine.
»Es muss Menschen geben«, sagte er jetzt leiser, «die, wie hast du gestern gesagt, nicht in diesem hypnagogen Zustand sind.
Eins-Null-Eins-Null-Eins-Null ... eingeschränkte Dialektik ... ohne jede Farbsättigung.
Die Gesellschaft soll doch von uns aus weiter von der Illusion der Freiheit und ihrer Mitbestimmung der Zukunft träumen. Sollen sie ihre Gedanken und Gefühle mit in den Schlag nehmen und dort ihre Träume gestalten. Zwischen ihren Wachträumen und ihrem Arbeitsalltag steht der Wunschtraum nach Durchlässigkeit in einer Gesellschaft. Diese Pampe, Max, hält sie auf Trab! Und in diese Schnittstelle müssen wir gehen! Es dauert nicht mehr lange, bis sich unser Markt durchsetzt und die natürliche Nachfrage größer wird. Dann müssen sie uns sehen. Alle!«
Dr. Brendel sagte, er würde nicht glauben, dass es sich bei den meisten Menschen um Dummköpfe oder Opportunisten handelt. Nein, man müsste sie vertraut machen mit dem Neuen. Und das ... würde das eigentliche Problem sein. »Aber,« fügte er hinzu,»ein Fremder ist schließlich auch nur ein Freund, den man noch nicht kennen gelernt hat.«
«Was haben wir denn da?« Brendel inspizierte seinen Teller. «Ich hatte schon die Befürchtung, dass sich so ein dünnes, schwarzes Wurmwesen auf meinem Teller heimisch fühlt.«
«Eine Trüffelzeste!« Bader sah Brendel vorwurfsvoll an:
«Wir wissen, dass diese Dynamik von immer mehr Politikern erkannt wird. Es sind mittlerweile erhebliche Mittel, die aus dem Finanzhaushalt für das Mannsfelderinstitut und andere Bundesforschungseinrichtungen für Langzeitprojekte bestimmt waren, über Spin-Offs an ”Vitacell“ weitergeleitet werden. Jetzt habe ich Hunger. Mahlzeit!«
Britta Zielke saß einige Tische hinter ihnen und unterhielt sich mit dem Leiter der Abteilung Tissue Engineering. Irgendwie schien sie Brendel und Bader zuzuhören, aber sie hatte schnell begriffen, dass sie an dem Tisch der beiden Vorstandskollegen nicht willkommen war.
*
Hamburg, die Alster, meine Frau, Nora, unser Haus namenlos, ich, B r e n d e l, Max. Es brennt, es brennt, und niemand kommt der rennt, der löscht. Ah, was wissen wir schon vom Löschen! Wer löscht, der kneift! Nora ist keine, die kneift, die löscht nicht! Ich auch nicht. Wozu löschen? Wir sind keine Beauftragten von irgendjemandem. Wir sind uns selber überlassen. Wir müssen selber entscheiden. Also entscheide ich selbst. Wer sonst? Alles sonst ist kommissarisches Geschwätz.
Nein, es soll künftig nicht mehr wie bei Brahms in dem alten Kinderlied heißen: ´Morgen früh, wenn Gott will ...`. Vielmehr wird es so sein, dass wir an seine Stelle treten ... wir Gott ersetzen werden. Das ist keine Suada! Es ist exakt so gemeint!
Laut tönen die Gedanken in Max Brendel nach.
*
Rüttelt man an den Grundfesten ihrer Überzeugungen, kontern viele Menschen mit Moral und Ethik. Dabei wissen die meisten noch nicht einmal, für welche Prinzipien sie stehen. So ähnlich hatte Nora Brendel sich gestern geäußert.
»Aber Wirtschaft ohne Moral schadet allen und gefährdet den Zusammenhalt der Gesellschaft! Diese Mahner vor der Habgier sehen sich immer Seite an Seite mit dem alten Thomas Jefferson, wie er dasitzt und liest, dass die menschliche Natur in keiner Weise geeignet sei, Wohlstand zu ertragen«, hatte seine Frau gesagt. »Ein Totschlagargument, weiter nichts!«. Max war bei ihr.
Sie überquerten die Elbchaussee und waren jetzt im Jenischpark. Nora hatte sich bei ihrem Mann untergehakt. Max sagte: »Die Aufrechterhaltung von Zeitgeist bedingten Tabus und die Errichtung von Schweigekartellen sind lediglich Wegkreuze, die in ein Apartheidsystem führen. Das weiß jeder!«
»Genau aus diesem Grund bist du nicht derjenige, der das letzte Band zerreißt und die Gesellschaft gleich mit. Oder?« Nora strich über Max Kopf. Sie schlenderten weiter.
Max Brendel schauderte, wenn er an die Menschen dachte, die ihr Weiterleben einem Organ von Hingerichteten verdankten. Staatlich legitimiert und somit legal. Pekings Gesundheitsministerium hatte das offiziell eingestanden. Die Hilfesuchenden hängen von nichts anderem ab, als von der Anzahl der Hinrichtungen.
Das Blut, die Zelle, die Heilung, das Geschäft, der Name, die Macht. Dr. Brendel lag nichts an einer bloßen Utopie.
Sie steuerten die Bank unter der mächtigen Ulme an. Mit angezogenen Beinen machte es sich Max auf der Bank bequem, während Nora sich an das freie Ende setzte und seinen Kopf liebevoll auf ihren Schoß legte.
Er meinte: »Trotz der verbalen und vordergründigen Aufgeschlossenheit vieler Menschen ist homo sapiens so unverändert verhaltensstarr.« »Tja, anders als am liebsten angenehm übersichtlich, mögen die Menschen sich die Welt doch gar nicht erklären.«, erwiderte sie und lachte.
Überrascht sieht Dr. Brendel seine Frau an, als sie sagte:
»Man kann nur gegen den Wind aufsteigen. Sonst treibt er einen vor sich her.«
Erster Fund
06.06., Samstag, 10:30 Uhr, Alt-Bessin, Hiddensee
Zwei Tage hatte es wie aus Kübeln geschüttet. Alles Wasser dieser Welt schien sich an diesem einen Ort versammelt zu haben. Jetzt blinkt die Luft in der Sonne und
die Sandbänke schlieren im saphirfarbenen Wasser. In dieser Farbe wirkt das Nass schwer und dickflüssig.
Eine kleine Bucht am nordöstlichen Ende von Hiddensee. Nur von der Seeseite kann man die weißen Kreideklippen sehen. Das Flachwasser drängt durch den dichten Schilfgürtel, der vom Festland weg eine grüne Wand bildet. Das Wasser erzeugt ein flappendes Geräusch und leckt den kleinen Strand hinauf. Auf der Suche nach Essbarem sprinten eifersüchtige Vertreter aus der großen Familie der Regenpfeifer über den Meeressaum; in der Luft – Austernfischer. Ihre durchdringenden Rufe passen nicht in die sich abzeichnende Trägheit des Tages hinein. Auf dem Wasser dösen zahlreiche Wildschwäne und Mantelmöwen, und die Kormorane verschwimmen als dunkle Punkte im Dunst des noch frühen Tages. Behäbige Wärme und Zeitlosigkeit machen sich breit. Inselsommerwetter!
Und irgendwann folgt wieder diese Stimmung, wie aus dem Endstadium der Sehnsuchtsprojektionen eines von den Zwängen der Grundversorgung befreitem Leben.
*
Gesine und Jakob sind Pensionsgäste auf der autofreien Insel. Das Paar ist Mitte zwanzig. Es ist jetzt Vormittag. Mit Fahrrädern machen sich die beiden auf den Weg zu den Kreideklippen. Der Abstieg zu den kleinen Sandstränden ist steil und gefährlich.
Sie haben den kleinen Ort Grieben im Osten passiert und radeln am Schilfgürtel vorbei. »Ein tolles Versteck!», sagt Gesine. »Kommt drauf an für was. Wenn du dir wie ein hungriger Reiher nasse Füße holen willst ...», erwidert Jakob. Er grinst und fragt sich, wie tief hier das Wasser sein mag. Das Paar verlangsamt das Tempo, hält an, dann steigen sie von ihren Rädern und legen sie auf die sandige Grasfläche.
Rasch steht die Entscheidung. Sich foppend und feixend ziehen sich Gesine und Jakob aus, dann gehen sie ins zunächst knietiefe Wasser. Nachdem sie übermütig die ersten Meter im Schilf hinter sich gebracht haben, gehen sie weiter, bis das erstaunlich warme Wasser ihnen über den Bauchnabel schwappt. Doch schon nach wenigen Metern steht das Schilf hinter ihnen wie unberührt. Gesine sieht angestrengt zu Jakob rüber. In ihrem Blick liegen Fragen:
Aus welcher Richtung sind wir gekommen, und wie weit sind wir vom Ufer entfernt, vor allem aber: Finden wir wieder raus?
Jakob scheint die Situation zu genießen. «Wir bewegen uns im Kreis, unser innerer Widerstand erlahmt, und du verfällst zuerst in Panik. Niemand wird auf die Idee kommen, hier zwei Menschen zu vermuten.« Gesine ballt die Faust und schlägt ihm leicht gegen die Brust. Dann küsst sie ihn kurz auf den Mund.
Im klaren Wasser blitzen Bewegungen auf. Fische, Amphibien, Vögel und ... Die zwei gehen vorsichtig voran. Dort, wo der Meeresboden schlickig ist, steigt hellbrauner Schlamm in zarten Schlieren unter ihren Füßen auf. Kleine Styroporbrocken treiben verstreut auf der Wasseroberfläche. Das Gebiet liegt in der Kernzone des Nationalparks. Selbst kleinste Abfallmengen sind hier ein klarer Gesetzesverstoß.
Noch etwas treibt teils auf, teils unter Wasser, etwas Helles, Rechteckiges. Vielleicht ist es ein Block aus diesem weißen Dämmmittel.
Das Paar bleibt stehen, sieht sich erstaunt an. »Kein Ufer ... kein Rest der Welt. Nichts! Nur diese grüne Wogen.», raunt Jakob geheimnisvoll und blickt Gesine herausfordernd an. »Hmm, der reinste Kindertraum!», antwortet Gesine mit leiser Gebetsstimme. »Gesine, wie fändest du ... wenn wir ... hier im Schilf.» Die junge Frau blickt ihren Freund an. »Gesine!», forciert Jakob gedehnt. Die Tonhöhe steigt mit den beiden letzten Silben dramatisch an. Jakob sucht Gesines Blick. »Pass du nur auf, dass sich kein Hecht an deinem kleinen Freund vergreift. Den brauche ich noch für später.»
Sie macht eine horizontale Schnittbewegung mit ihrer linken Hand. Die hüpft auf der Stelle, grinst und schüttelt ihre Brüste.
»Lass uns eine Schilfhütte bauen und Kinder großziehen.», sagt Jakob. Gesine zieht die Augenbrauen in die Höhe. Sie teilt entschlossen das Schilf und macht einen energischen Schritt nach vorne. »Auch eine Antwort, meine Liebe!», sagt Jakob und lächelt.
Sie sehen die Bewegung gleichzeitig. An einer Stelle ist das Wasser plötzlich unruhig.
Hechte, die sonst strikte Einzelgänger sind, stehen nahe beisammen. Das lange, entenschnabelförmige Maul strotzt nur so vor äußerst spitzen und nach hinten gebogenen Zähnen. Jakob und Gesine wundern sich, dass die sonst scheuen Räuber nicht sofort flüchten. Der Grund wird ihnen abrupt klar. Weißlich fahle Fleischfetzchen treiben umher und bilden einen kleinen löchrigen Teppich an der Oberfläche des Wassers.
Vor ihnen liegt ein Mensch im Wasser. Die beiden sehen sich bestürzt an.
Was Gesine und Jakob weit mehr entsetzt, ist die Tatsache, dass diesem Menschen Arme und Beine fehlen. Und als wäre das nicht bestürzend genug: Der Leiche fehlt der Kopf! Es ist der Torso einer Frau.
Max Brendel und ”Vitacell“
03.06., Mittwoch, 16:00 Uhr, ”Vitacell“, Hamburg-Eppendorf
Nach der letzten Besprechung an diesem arbeitsreichen Mittwoch packte Max Brendel in seinem Büro das auf dem Schreibtisch liegende Wochendossier, sein Laptop und diverse Schlüssel zusammen.
Er verschloss die Schreibtischschubladen, nahm seinen Pilotentrolley und verstaute alle Sachen in dem schwarzen Ungetüm. Sein Mobiltelefon steckte er in die Innentasche seines Jacketts.
Britta Zielke hatte sich bereits am frühen Nachmittag für den Donnerstag und Freitag entschuldigt, private Gründe, ein langes Wochenende, hatte sie kurz und bündig gesagt. »Britta, ich weiß es zu schätzen, dass sie mich ins Vertrauen ziehen. Bis Montag!», hatte Brendel lakonisch erwidert. Zielke und Brendel in einer Sitzung bedeutete häufig Kampf um das Setzen von Begriffen und um das letzte Wort.
Dr. Brendel war erleichtert, dass Hagen Florin gerade in Togo war. Der Einkaufsleiter ging Brendel auf die Nerven, weil er nie auf den Punkt kam, wenn es um Afrika ging. Levent Gül, der Finanzchef des Unternehmens, hielt sich eher am Rand der Vorstandsriege auf, wenn Brendel und Zielke in Fahrt kamen.
Dr. Matthias Bader war die vitacellsche Koryphäe für Produktentwicklung. Mit ihm konnte sich Brendel austauschen. Bader hatte keine Scheu, Zäune einzureißen. Es wäre der Kündigungsgrund schlechthin, es nicht zu tun, hatte Bader gesagt.
*
Brendel machte früher Schluss, um sich Zuhause in Ruhe auf seinen morgigen Vortrag vorzubereiten. Eine neue Lesart von ”Vitacell“ stünde ab jetzt auf dem Plan. Fünfzehn Pressevertreter, die meisten aus dem Printbereich, hatten ihr Kommen angekündigt. Neben dem Vorstand würden außerdem leitende Mitarbeiter anwesend sein.
Und am Freitag würde er mit seiner Frau an die kanadische Westküste fliegen.
Am folgenden Dienstag hatte Max bei “Gerontic Corporation“ in Baltimore Besprechungen, nur wenige Stunden, die er persönlich im Mutterkonzern von „Vitacell“ führen müssten. Er hatte Nora gefragt, ob sie mit ihm kommen würde.
»Kommt niemand sonst mit, Laura vielleicht?», wollte sie wissen. »Du bist eifersüchtig auf die talentierte Assistentin meiner Lieblingsgegnerin!«, neckte er Nora. Sie lachten leise. Also gut, dann Vancouver.
Außerdem wollten sie wieder ein gemeinsames Wochenende in ihrem Hiddensee-Haus verbringen. Eingebettet zwischen Dünenausläufern lag das Haus unterhalb der Streusiedlung Neuendorf. Nora nutzte es regelmäßig, während Max dazu kaum Zeit fand.
Brendel nahm seine Krawatte ab und steckte sie in den Rollkoffer. Er verriegelte die Fenster seines Arbeitszimmers, legte sich das Jackett salopp um die Schultern, nahm die Tasche und warf an der Türe stehend noch einen Blick auf seinen Schreibtisch.
Nachdem er sein Arbeitszimmer abgeschlossen hatte, sagte er seiner Assistentin, dass er wegen der Presseveranstaltung morgen früher käme und bat sie, wegen der letzten Vorbereitungen zeitig im Unternehmen zu sein. »Morgen müssen wir in Hochform sein.« Monika Strittmatter strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn und sagte, dass sie um 07:00 Uhr hier sein würde und dass er sich absolut auf sie verlassen könnte. Sie wünschte ihrem Chef einen schönen Abend.
Er ging über den Flur zum Aufzug. Nach wenigen Schritten stoppte er, ging zurück und fragte Strittmatter, ob sie wüsste, was mit Laura Domin los wäre. Sie verneinte. Strittmatter wusste nur, dass Domin bereits nach der Mittagspause gefahren wäre. »Sie hat ja jetzt das neue schöne Auto«, konnte sie sich nicht verkneifen, schaute ihren Chef vielsagend an und sagte:
»Vielleicht hat Frau Zielke ihr frei gegeben. Sie wollte ein längeres Wochenende einlegen.« »Das weiß ich. Sie hat es mir gesagt. Ich habe Frau Domin gemeint.
Na ja: Urlaubswahn!«, sagte er gedehnt. »Die Beiden sind aber auch total überarbeitet.«
Er zog die Augenbrauen in die Höhe. Brendel ging zu Strittmatter, tätschelte unbeholfen deren linke Schulter und grinste. Strittmatter fühlte sich geschmeichelt und lachte devot.
Brendel ging erneut zum Aufzug, steckte den Sicherheitsschlüssel in ein spezielles Schloss, drückte auf dem Tableau auf U1 und fuhr von der dritten und obersten Etage des kubischen Gebäudes nach unten in die Tiefgarage.
Der zusätzliche Sicherheitsmechanismus sollte es Einbrechern unmöglich machen, ins Hauptgebäude einzudringen, auch dann, wenn sie sich den Zugang durch die ohnehin gut gesicherte Zufahrt zur Tiefgarage bereits verschafft hätten. Aus dem Aufzug schritt er zu den fünf Stellplätzen, die dem Vorstand von ”Vitacell“ vorbehalten waren.
Das in der Biotechnologiebranche erfolgreiche Unternehmen lag am Haynspark mit direktem Blick auf den Alsterlauf, unweit vom Universitätsklinikum Eppendorf.
Das weiß gestrichene Gebäude wollte keiner Vorzeigearchitektur huldigen. Ein Mezzanin über dem dreigeschossigen Gebäude lockerte die nüchterne Machart zwar auf, ansonsten war der Bau eher konventionell errichtet worden.
Kein Kombizonenkonzept, keine Kommunikationsbrücken und auch kein sichtbarer Anspruch an eine besondere bauliche Weite, die nach Ansicht der Baupsychologie die innere Größe des individuellen Mitarbeiters zum Vorschein bringen sollte.
Auffällig waren allerdings die großzügigen Fensterfronten und der in die Fläche gehende Grundriss.
Trotz der eher niedrigen Höhe besaß das Unternehmensgebäude genügend Platz, um Verwaltung, Vorstand, die wissenschaftliche Abteilung samt der Labore sowie das Archiv unter zu bringen. Die einhundertdreißig Mitarbeiter hatten keinen Grund sich zu beschweren, jedenfalls nicht in dieser Hinsicht. Eine Tiefgarage komplettierte die Vertikale.
*
Seit knapp sechs Jahren war Brendel Vorstandsmitglied von ”Vitacell“. Er leitete die Abteilung Vertrieb und Marketing.
Er war ´angekommen`, wenn man die Prinzipien einer forcierten Leistungsgesellschaft zugrunde legt. Status, Geld, Ansehen: alles stimmte. Max Brendel war achtunddreißig, knapp einsneunzig groß, schmales, markant geschnittenes Gesicht, die Haare teerfarben, und trotz der sorgfältigen Rasur hatte er einen dunklen Bartschatten.
Er wirkte asketisch, jedoch mit einem Schuss Hedonismus, den Menschen benötigen, um nicht gänzlich linear zu leben.
Neben Betriebswirtschaft hatte er noch International Corporate Management an der angesehenen Universität in St. Gallen studiert. Bei einem überdurchschnittlichen Abschluss war diese Adresse eine wahrlich gute Voraussetzung, sich erfolgreich auf offene Leitungsstellen zu bewerben.
Der codierte Schlüssel öffnete den Porsche. Brendel hatte kurz überlegt, ob er nicht über Nacht nach Hiddensee fahren sollte. Drei Fahrstunden mit geöffnetem Verdeck würden vor ihm liegen. Raus aus der Innenstadt, über die Peripherie. Ab da ging es passabel vorwärts. Doch Max wollte erst nach Hause. Er nahm sich vor, seine Frau auf der Fahrt nach Hause anzurufen.
Im Vorstand standen zwei gegensätzliche Zukunftskonzepte zur Diskussion. Brendel hatte den Eindruck, dass die Vorstandsvorsitzende Britta Zielke mehr Rückenwind erhielt, seit Laura Domin für sie arbeitete. Dabei hätte er die Neue gerne für sich selber gehabt.
Brendel entschied gerne zügig und nahm klare Positionen ein. Diskurskultur wäre etwas für arbeitslose Akademiker, die versuchten, sich sozial am Leben zu erhalten, hatte er Zielke in einer Auseinandersetzung an den Kopf geworfen.
Ginge es nach ihm, würde „Vitacell“ Bioingenieure und Mediziner einstellen, die über umfassende Erfahrungen in der Stammzellforschung verfügten und Kenntnisse in der kommerziellen Verwertung von Biophysik, Biotechnologie mitbrachten. Keine Zuträger. Nein, souveräne Menschen, die anwendbares Wissen besaßen und mit einer Vorstellungskraft ausgestattet waren, mit der sie gesellschaftliche Visionen in Einfluss und Rendite verwandeln konnten.
Die verstanden, dass die ungleiche Verteilung von Geld der Vektor zur ungleichen Verteilung von Wahrheit war und deshalb keinem moralischen Rechtfertigungszwang unterlagen oder ethische Befangenheit vor sich her wälzten. Darin war er sich mit Dr. Bader einig. Doch die Vorstandsmehrheit lavierte. Dabei waren schon jetzt einzelne Politiker, Vertreter von diversen Syndikaten und meinungsführenden Medien mit im Boot.
´Unsere Zukunft ist die Zukunft der Biotechnologiebranche`, hatte ein parlamentarischer Staatssekretär kürzlich Brendel auf einem Empfang in Berlin gesagt.
Brendels Ehrgeiz hatte kein Problem damit, sich von nicht wettbewerbsfähigen Unternehmensbereichen wie dem Prüflabor ”Belbor“ in Leuven zu trennen. Die Rohware kam überwiegend aus Togo und Nigeria, und das belgische Unternehmen war zuständig für die zweistufigen Gütetests dieser Ware, bevor sie weiter nach Hamburg geschickt wurde. Doch der afrikanische Markt glich einer Hydra.
Das belgische Gesetz hatte großzügige Voraussetzungen für diese sensible Branche geschaffen. Noch vor fünf Jahren war ”Belbor“ ein ehrgeiziges Unternehmen, das internationale Investoren anzog.
Sehr bald war ”Vitacell“ mit rund fünfundfünfzig Prozent der größte Anteilseigner. An dem Geschäft war nicht zuletzt Dr. Hesse von ”Belbor“ beteiligt. Ein fähiger Syndikus, fand Brendel.
Jetzt könnte der Verkauf von ”Belbor“ ein starker Anfang und ein Zeichen für den Aufbruch von ”Vitacell“ sein. Zielke hielt sich bedeckt und Bader fand, dass Brendel den Zustand von ”Belbor“ dramatisierte. »Mein lieber Max, unser Belgiengeschäft mag nicht, noch nicht, optimal sein. Aber ”Belbor“ ist kein Dschungelcamp, es ist ein angesehenes Prüflabor und arbeitet günstiger als die deutsche Konkurrenz, vergiss das nicht. Und die arbeitet trotz höherer Preise keineswegs besser. Sprich mit Wouters.«
Mit Wouters sprechen? Der Professor war im gleichen Alter wie Brendel; ein Fleisch gewordener Hochbegabter und ohne Frage der begabteste Wissenschaftler im Unternehmen. Doch dieser Kerl mit dem bartlosen Gesicht unter der absurd hohen Stirn hatte den Laden in Leuven nicht im Griff. Außerdem hatte der Belgier so ein seltsames Flirren in seiner Persönlichkeit. Aber Bader hatte recht – natürlich war ”Belbor“ kein Dschungelcamp.
Levent Gül und Hagen Florin waren zwar keine Mitläufer. Sie neigten aber dazu, sich zügig auf die Mehrheitsseite zu stellen. Opportunisten, sagte sich Brendel, dessen Weitsichtigkeit im Vorstand trotz vieler Gegensätze anerkannt wurde.
*
Wie in allen Wirtschaftsunternehmen ging es auch bei „Vitacell“ um das ‚Kleine Einmaleins’ der Wirtschaft, die Rendite. Brendel ging es vor allem um den Innovationstakt. Wie eine Sinuskurve sollte dieser Takt durch „Vitacell“ pulsen. Die Fähigkeit, kontinuierlich exzellente Ergebnisse hervorbringen zu können, sollte die Konkurrenz in schweres Fahrwasser bringen und der Politik zeigen, wer das Alphatier dieser Zukunftsbranche ist. Nur mit den besten Köpfen und unter hohem Arbeitsdruck konnte ”Vitacell“ sich eine international unangefochtene Spitzenposition erobern und sichern. Dazu benötigten sie Wagniskapital, aber die Investoren verhielten sich wie Borderliner.
Die Konkurrenz wuchs schneller als die gesamte Branche. Von seinen Vorstandsmitgliedern verlangte Brendel deshalb mehr Freiheiten.
Und die Zielgruppe der Scharnierpersonen in Westafrika war empfindsam. Sie waren die eigentlichen Entscheidungsträger. Auch Hagen Florin wusste das. Er war der Kontaktmann zu ihrem Geschäftsführer in Lomé. Es war Britta Zielke, die ihn eingestellt und ihm alle Vollmachten verliehen hatte. Zielke hatte wirklich keine Ahnung...
Wie hieß der Leiter des operativen Afrikageschäftes in Lomé noch gleich? Irgendwas Schottisches oder Irisches ... McLellan, genau.
Brendel hatte vor einem Monat ein ehrgeiziges Positionspapier auf eigene Faust erarbeitet. Die anderen vier Vorstandsmitglieder zeigten sich von seiner Diagnose beeindruckt. Brendel war über die Resonanz eher erstaunt als erfreut.
*
”Vitacell“ war ein rechtlich eigenständiges Tochterunternehmen des an der Wallstreet Börse notierten Branchenführers ”Gerontic Corporation“ in Baltimore und spezialisiert auf die Gewinnung embryonaler Stammzellen aus Nabelschnurblut.
In Europa gab es keinerlei Harmonisierung. Das machte das Geschäft politisch und gesetzlich kompliziert. Aus diesem Grund hatten sie mit der Produktion von iPS-Zellen begonnen. Als erster und einziger kommerzieller Anbieter hatte ”Vitacell“ eine Zulassung des Paul-Ehrlich-Instituts erhalten.
Das Unternehmen machte nach außen stets deutlich, dass durch die Forschungsarbeit unheilbare Krankheiten später besiegt werden könnten. Kritiker hielten ihnen vor, darauf aus zu sein, aus Zellkulturen komplette Organe, Körpergewebe zu züchten und das Klonen von Menschen voranzutreiben.
Sogar Britta Zielke fand das komisch. Wissenschaftler konnten im Erbgut schon länger Genmutationen so gut lesen wie man ein anspruchsvolles Buch liest. Das erzeugt einen Selektionsdruck auf das ungeborene Leben. Ganz sicher! Die meisten Menschen wissen das nur noch nicht.
Die Konsequenzen? Sie werden die Menschheit verändern. Revolutionär.
Weit mehr als je zuvor hing die Zukunft von Entscheidungen ab, die im Grunde bereits getroffen worden sind und nicht mehr revidiert werden können.
Dr. Brendel war unzufrieden mit der Wahrnehmung des Unternehmens in der Öffentlichkeit. Ein Freund der Brendels war Gerichtsmediziner. Bei einem Abendessen hatte er gesagt, dass es in Deutschland keine Obduktionspflicht gebe. Ebenso wenig wäre ”Vitacell“ verpflichtet, sich mitzuteilen, worauf Brendel erwiderte: »Wir sind keine Leiche ... obwohl manch einer Zombies vor Augen hat, wenn er an ”Vitacell“ denkt.« Hierüber lachten Nora und Max Brendel mit ihren Gästen.
Die Menschen achten darauf, dass ihnen keine Schlachttiere in ihrer Ethik herumlaufen. Ein erstaunlicher Blinder Fleck. Und eugenisches Handeln findet schon seit Jahren statt.
Wer sind die Täter? Keineswegs der Staat oder böse Wirtschaftsunternehmen, nein, Selektion findet durch Eltern statt. Eine Frage der semantischen Hygiene!
Der böse Ausdruck, der sich in Brendels Gesicht eingenistet hatte, verschwand. Der Vorstand und die Mitarbeiter waren keine Berufsverbrecher. Ihre Unternehmenspolitik bräuchte also nicht rechtfertigt werden.
Diejenigen, die es sich leisten konnten waren wild auf eine Verjüngung mittels eigener Stammzellen. Die gesamte hoch gerüstete Kosmetikindustrie stand bei Fuß. Hatten die Leute kein Recht am eigenen Körper?
Libertäres suum cuique! Der Markt – nicht die Moral!
*
”Vitacell“ hatte Verträge mit zahlreichen medizinischen Einrichtungen abgeschlossen und das Vorzugsrecht erworben, als erste das Nabelschnurblut zu kaufen. Das Unternehmen zahlte lukrative Provisionen an die Einrichtungen, sofern es diesen gelang, die jungen Eltern zur Überlassung dieses Rohstoffes zu bewegen.
In Blockseminaren verinnerlichte das zuständige Personal, entsprechende Hinweise an die Eltern weiterzugeben. Die dem Nabelschnurblut entnommenen Stammzellen wären ein wahrer Segen. Bei dem Kind könnten im Verlauf seines Lebens schließlich schwere Erkrankungen auftreten.
Zweitausendfünfhundert Euro kosteten die Entnahme, Extraktion, Separation, Konservierung und das Einfrieren auf konstant -196° in flüssigem Stickstoff. Das waren Nebeneinnahmen, fanden Matthias Bader und Levent Gül, ein Schritt durch die Alltagstür der Biotechnologie.
Der Gesamtbevölkerung auf lange Sicht helfen. Warum nicht. Seine Frau war sehr dafür. Höhere Weihen? Die Zielke wollte immer nur Unternehmerin sein. Du dumme Kuh! Dabei wusste sie, dass heute in den westlichen Industrienationen mehr als neunzig Prozent aller Schwangerschaften abgebrochen werden, weil Trisomie 21 nachgewiesen wurde.
Und wer nimmt die Diagnose in Anspruch? Die Eltern! Sie waren die eigentlichen Betreiber dieses Geschäfts.
Brendel begriff sich als Komponist von Leben, dessen Werk andere auf die Bühne bringen durften. Komponist von Leben: Das war ein noch weit lukrativerer Zukunftsmarkt, sagte er sich.
Max Brendel ruft vergeblich an
03.06., Mittwoch, 16:40 Uhr, Hamburg-Klein Flottbeck, Privathaus der Brendels
Das Haus der Brendels steht in Klein Flottbeck an der Elbchaussee. Hamburger Toplage. Nach Süden hinaus fällt der Blick auf die unten vorbei fließende Elbe. Gegenüber ist der Jenischpark mit seinem Naturschutzgebiet Flottbecktal und dessen alten Baumbestand. Die Haushälterin hat das Haus wie gewöhnlich am Vormittag versorgt.
Max Brendel hat sich einen starken Kaffee gemacht. Er nimmt die Tasse, geht mit ihr quer durch den großzügigen Raum bis zu der Stelle, wo der helle Bambusboden in lichtgrünes Sicherheitsglas übergeht. Dieses Bodenglas ist die konsequente Fortsetzung der großzügigen Panoramafenster, die das ganze kubische Gebäude auszeichnen.
Eingerahmt in die strenge äußere Form des Hauses und dieses Fensters hätte Brendel, aus der Distanz betrachtet, wie eines jener menschenähnlichen Figürchen ausgesehen, die ein Modellbauer für sein fertiges Werk nutzt, um dem Architekten einen lebensnahen Eindruck seines Projektes zu vermitteln.
Er nippt an der heißen Tasse und blickt auf das leicht abfallende Grundstück. Das Grün des weitläufigen Rasens läuft scheinbar dynamisch auf die Elbe zu. Eine mächtiger Strom, diese blau-graue Wasserader.
Brendel nimmt einen vorsichtigen Schluck aus der Tasse.
Er steht da und verliert auf eine für ihn angenehme Weise seine gewohnte Sachlichkeit, sein daran geknüpftes Selbstgefühl. Anders als sonst denkt er an nichts Konkretes, nicht an das fertige Bild im Kopf, wenn er etwas in der ´Pipeline` hat.
Mit Blick auf den großen Fluss verspürt er auf einmal etwas Vages, das sich wie ein Verlangen nach einer alten Erinnerung anfühlt. Er trinkt den restlichen Kaffee und fühlt eine plötzliche Leichtigkeit, die ihn glücklich macht. Max Brendel blickt in die Tasse, geradeso, als wäre dort verborgen, was er soeben empfunden hat.
*
Ein Bild drängt sich ihm auf; es ist eine ganze Spur zu kraftvoll, beinahe unangenehm. Brendel spürt nicht mehr den gläsernen Boden unter sich. Seine Hand, welche die Tasse hält, wird leicht und das Gewicht der Porzellantasse sphärisch. Sein Blick über die Elbe weicht einem Blick nach innen. Brendel steht straff, wie angewurzelt und dennoch wachsen ihm Flügel.
Ein Boot trägt ihn über die Elbe in die Nordsee und von da in den Atlantik. Dort will er die blaueste Stelle dieses Ozeans suchen und finden. Als Junge hatte er sich das gewünscht, wenn er in seinem Bett liegend durch das Dunkel des Zimmers auf den erleuchteten Globus sah. Jeden Abend verkörperte der für ihn die sprichwörtliche Welt. Er hatte sich vorgestellt, dass sich das Wasser an manchen Stellen des Globus so stark verdichten müsste, dass es zu eben diesem besonderen Dunkelblau wird. Später wurde ihm klar, dass der Hersteller dieser Globusse nur unterschiedliche Blautöne nutzte, um verschiedene Gegebenheiten auf der Erdoberfläche hervorzuheben. Das Blau, welches über den ozeanischen Gebirgsketten lag, war deshalb dunkler, weil es auf den Spitzen der untermeerischen Gebirge lag. Und die hatten einen schwarzen Ton. So einfach war das!
Der junge Brendel hatte dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen gegeben und dem Bekannten die Würde des Unbekannten, sowie dem Verstehbaren die Aura des niemals Ergründbaren verliehen.
Als er das erkannte, hatte er sich vor sich selbst geschämt.
*
Max Brendel erschrickt kurz und muss lächeln. Sein Körper löst sich aus der leichten Starre. Noch vor wenigen Jahren wären ihm solche Erinnerungen peinlich gewesen. Jetzt nicht. Er bewegt sich mit verspielten Kippbewegungen in der Hüfte Fuß um Fuß zurück zu der offenen Küche, wo er die Tasse auf der Anrichte abstellt.
Dann geht er, über drei Stufen hinab, hinüber zu dem begehbaren Kleiderschrank. Während er sich bequemere Kleidung heraus nimmt, wählt er die Nummer seiner Frau.
Er hatte vergessen, sie aus dem Auto anzurufen und überlegt, ihr von dem Tagtraum zu erzählen. Er ist sich sicher, dass er es tun wird. Brendel lässt es lange läuten. Nora wollte doch an ihrem Bild weiterarbeiten, erinnert er sich.
Wahrscheinlich hatte sie ihre Malutensilien auf den Fahrradanhänger geladen und war zu dieser großen Sandmulde mit den Föhren -oder waren es Seekiefern?- gefahren. »Das klare Licht, die Kontraste der Farben ... das inspiriert mich.«, hatte Nora ihm wie ein ernsthafter Backfisch gesagt.
Sie ist robust-sanft und sehr eigenwillig, dachte er. Eine Mischung, die er an ihr schätzt. Es gefällt ihm, dass seine Frau betont eigenständig ist. Nora mag seine Zielstrebigkeit und die Art, die Dinge weiter zu fassen. Das weiß er. Und er weiß, dass sie ihm nicht schmeichelt. Einmal hatte sie ihm gesagt, dass er seine Ziele bei ”Vitacell“ auf jeden Fall erreichen würde und die Hilfe würde vor ihm sitzen. Dabei hatte sie ihn seltsam angesehen.
Sie leben zwei Leben, er in Hamburg, sie überwiegend auf Hiddensee. Genauso wollten sie es. Es war keines jener kleineren Übel, das einem Mangel an Alternativen geschuldet war.
Noch einmal lässt er es lange läuten, doch ihr Handy bleibt stumm. Es kommt häufig vor, dass es auf der Insel eine nur sehr schwache Funkverbindung gibt. Auch im Hiddenseehaus hebt niemand ab.
Es ist 17:00 Uhr, höchste Zeit, wenn er noch fahren wollte. Gegen 19:00 Uhr wäre er in Schaprode und würde mit dem Wassertaxi über den Bodden nach Neuendorf übersetzen, um noch das Tageslicht, die Wärme und den Sonnenuntergang des Frühsommers genießen zu können. Und Nora!
Mit diesen Gedanken nimmt er seine Arbeitstasche und geht beschwingt in sein Arbeitszimmer, das in der oberen Etage liegt. Er öffnet ein zur Elbe weisendes Fenster und genießt die milde Luft. Nach einem längeren Blick auf die Landschaft setzt er sich an seinen Schreibtisch.
Er genießt die Vorfreude auf die anstehende Arbeit für den morgigen Tag. Morgen würde er grundsätzlich werden.
Ich bin ein glücklicher Mann, denkt Max Brendel!
Spaziergänger
Harvestehude zeichnet sich durch vier Merkmale aus:
Der Stadtteil ist selbst für Hamburger Verhältnisse dicht besiedelt; der Mangel an Kindern greifbar; die Lage an der Außenalster ausgesprochen attraktiv und ebenso teuer. Pöseldorf war ein vormals eigener Stadtteil, besser gesagt ein Geviert, dessen Bewohner mit einer mitleidlosen Exklusivität auf den Rest der Stadt blicken. Stellen sie sich die Nachfahren der „Mayflower“ in Boston vor. So ähnlich wird dieses Kleinod in der Stadt und von den Medien wahrgenommen.
Das Profil passt positiv zu Britta Zielke. Am Pöseldorfer Weg bewohnt sie, keine hundert Meter entfernt von der Außenalster, ein Stadthaus, dessen Garten zum Harvestehuder Weg liegt. Es ist ein geweißtes, neoklassizistisches Haus, das zur Straße hin einen ausladenden, halbkreisförmigen Erker hat, dessen großzügiger Eintritt von Säulen eingerahmt ist. Gehässige sprechen von einer ´Vom-Winde-verweht-Architektur` für Bürgerliche.
Ein für diese Wohngegend typischer Baustil. Die Straße ist trotz ihrer zentralen Lage in der Großstadt außerordentlich ruhig. Alter Baumbestand säumt die breiten Bürgersteige und taucht Teile der Straße und der Gehwege selbst an heißen Tagen in einen angenehmen Schatten.
Kein Mensch ist zu sehen. An der angenehmen Witterung kann es nicht liegen. Die Straße wirkt, wie das ganze Viertel, ausgestorben.
Sollte jemand bei passendem Wetter seinen parkähnlichen Garten benutzen, geschieht das so diskret, dass nur sie selbst davon mitbekommen. Sie gehen auch nicht in der eigenen Straße spazieren, sie queren sie höchstens zum Wasser. Man fährt mit dem Auto, hier. Auch kurze Wege. So ist das.
Von der benachbarten Milchstraße kommend sind an diesem warmen Frühabend noch zwei Spaziergänger unterwegs. Eine Frau und ein Mann. Ein kleiner Hund, eines dieser schwarz-weißen Energiebündel mit Drahthaar, die heutzutage offenbar alle besitzen müssen, leistet ihnen Gesellschaft.
In der Milchstraße stehen Häuser, die fast noch eindrucksvoller als die am Pöseldorfer Weg sind. Es könnten Touristen sein, die gelegentlich hierher kommen, um ein wenig die ´Schöner-Wohnen-Schau` zu betreiben. Neureiche Chinesen vielleicht oder nostalgietrunkene Japaner. Auch Gäste der nahe gelegenen Hochschule für Musik und Theater vertreten sich hier ab und zu die Beine.
Ohnehin kann man sich hier gefahrlos bewegen. Das Viertel ist, trotz seines Reichtums, sicher. Gelegentlich passieren Streifenpolizisten auf ihren Fahrrädern die Gegend. Ansonsten herrscht hier Friedhofsruhe.
Die Spaziergänger könnten, betrachtet man ihre Kleidung, auch Anwohner sein, die von einem Spaziergang an der Außenalster zurückkehren.
Sie ist etwa fünfzig Jahre alt, er Ende dreißig bis Mitte vierzig. Sie schlendern und unterhalten sich angeregt. Dann ein gelöstes Lachen.
Beide bleiben stehen. Der Hund, gleichermaßen irritiert wie erwartungsvoll, setzt sich, ohne jeden Befehl, neben sie.
Der hoch gewachsene Mann holt eine kleine Digitalkamera aus der Tasche seiner Clubjacke hervor. Kokettierend dreht er sich mal in diese, mal in jene Richtung und lichtet die Umgebung ab. Dann nimmt sie die Kamera und sieht durch den Sucher. Sie fotografiert zielstrebig: die alleenartige Straße, die Häuser in einem perspektivischen Anschnitt, den Hund und ihren Begleiter. Erneut lachen die beiden.
Der Mann stellt sich vor eines der Häuser auf den Bürgersteig, während die Frau ihn fotografiert. Charmant schwenkt er die Arme und stellt sich frontal vor den Zugang des Hauses.
Verrückter Kerl, denkt sie. Er sollte es nicht übertreiben. Wer sich hier so gebärt, dem droht ein Besuch von der Polizei. Der Hund läuft derweil die Straße entlang, schnüffelnd und suchend. Die Marotten seiner Besitzer müssen ihn nicht kümmern. Ein leiser Pfiff ist zu hören. Rasch kehrt der Hund zu der Frau zurück.
Während sie sich mit dem Hund beschäftigt, sieht sich der Mann die Einzelheiten des Gebäudes an. Vom Gehweg ruft die Frau etwas und setzt sich in Bewegung, während der Mann dem Haus langsam den Rücken zudreht, die schmale Straße diagonal quert und zu der Frau zurück geht.
Nicht ohne zum wiederholten Male zu lachen, schlendert das Paar nun weiter. Das Lachen der Frau klingt hoch und exaltiert, es erinnert an eine bekannte Fernsehwerbesendung aus den siebziger Jahren. Der Hund läuft voraus. Vom ersten Foto bis zum knapp gehaltenen und von einem erneuten Lachen untermalten Abschied sind gerade drei Minuten vergangen.
Dort, wo der Pöseldorferweg auf die Alsterchaussee stößt, geht die Frau mit ihrem Hund jetzt geradeaus. Dagegen wendet sich der Mann nach links und geht die Alsterchaussee in Richtung Rothenbaumchaussee.
Er hat ein Rendezvous in einem Hotel, ganz in der Nähe. Und er hat noch eine besondere Aufgabe vor sich.
Britta Zielke und ”Vitacell“
Sie hatte sich durchgesetzt, trotzdem versteht Britta Zielke die Welt nicht mehr. Stattdessen wieder heftige Auseinandersetzungen mit Brendel. Levent Gül und der Kollege Florin, beide keine dieser adrenalingesteuerten Männer, sind von Brendels Art angetan. Sie sind im selben Alter wie Brendel, der Führung beansprucht, leiten will. Zielke kann verstehen, dass es da Affinitäten gibt. Aber ”Vitacell“ ist kein Wildrevier für Rang und Ränke von Alphatieren und Omegas. Sie war es leid, die drei nachdrücklich daran zu erinnern, wer im Unternehmen primus inter pares ist.
Geblieben sind nach diesem Freitag inhaltliche Leere und ein sozialer Scherbenhaufen. Wer würde diesmal kehren?
*
»Wenn wir den Körper von ”Vitacell“ schützen wollen, werte Kollegen, müssen wir die faulen Teile rasch amputieren. Sonst riskieren wir einen Wundbrand!« Zum wiederholten Male ritt er auf seiner Körpermetapher. Rhetorische Sprengkörper, die bei den Omegas ankommen. Dieser Brendel sollte auf seinem Inselhaus bleiben, angeln, ein Buch schreiben oder malen, wie seine Frau, dachte sie.
Einzig Bader war gut, ließ sich aber nicht einfangen. Der Elsässer besaß Bodenständigkeit und Vernunft. Andererseits spitzte er seine Ideen glegentlich zu. Er nimmt lange Witterung auf, bevor er etwas unternimmt. Wie ich, dachte Zielke.
”Belbor“ würde noch nicht verkauft. Doch sie würde den richtigen Zeitpunkt bestimmen.
Über den Kopf von Professor Wouters hatte Zielke zwei Biologen austauschen lassen. Brendel konnte das nicht imponieren. ‚Wundbrand’. Für den notwendigen Schritt war eine harte Hand gegen den Widerstand des belgischen Tochterunternehmens nötig. Wouters hatte geschäumt. Er war der Kopf von „Belbor“.
Die Stimmung färbte sich rasch nationalistisch ... die Deutschen. Es gab Widerstände und Drohungen wurden ausgesprochen.
Wouters hatte ihr mitgeteilt, dass hohe Geldforderungen, die Rede war von zwei Millionen Euro, gestellt wurden und Zielke ein anonymisiertes Schreiben gezeigt, aus dem hervorging, dass ein Finanzrichter sich, zusammen mit einem der Staatsanwälte aus Leuven, keinen Scherz erlauben würde, wie es hieß. Es gäbe ein fertiges Urteil gegen den ´Drecksstall` ”Belbor“.
´Keinen Scherz erlauben würde`? Das klang dilettantisch. Doch was sollte das bedeuten? Versuchte Wouters etwa zu retten, was noch zu retten war, und er selbst hatte dieses Schreiben angefertigt, um das Geld vor dem Kollaps von ”Belbor“ noch schnell auf Seite zu schaffen? In jedem Fall war es ein Desaster für ”Vitacell“. Erpressung. Große Öffentlichkeit, Strafen gar. Gesetzliche Auflagen und Verbote!
Es war eine Frage der Zeit, wann die Brüsseler Generalstaatsanwaltschaft einen Hinweis erhalten und ihrerseits mit den Untersuchungen beginnen würde. Würden sie ”Belbor“ zum jetzigen Zeitpunkt abstoßen, käme es zwangsläufig zu einem Rechtshilfeersuchen der belgischen Justiz bei den deutschen Behörden.
Möglich auch, dass Brendel hinter den Querelen steckte. Sie verfluchte ihre mangelhafte Menschenkenntnis. Hatte er Kontakte zu den Rechtsinstanzen in Leuven und die Drohungen gestreut?
Erst die Karre im Sand festfahren ...
Britta Zielke war verunsichert! Erst vorgestern hatte er sie in Hamburg noch um ein persönliches Gespräch gebeten. Gegen zehn Uhr war er in ihr Büro gekommen. Anfänglich sah alles nach einem guten Gespräch aus. Sie machte sich sogar Hoffnung, dass Brendel einlenken würde.
Die Unterredung eskalierte. Er hielt ihr Entscheidungsschwäche und taktische Fehler vor, und er hatte ihr gesagt, dass es für sie keine Mehrheit im Vorstand gäbe. Gül und Florin teilten bereits Brendels Meinung, sagten es aber nicht. Jetzt hieß es Dr. Bader und sie selbst gegen diese drei.
*
Sie musste etwas unternehmen, konnte aber nicht ständig mit der Keule arbeiten, dass sie die Vorsitzende im Vorstand war. Brendel akzeptierte sie nicht. Sie sollte ihr Verhalten ändern und eine neue Strategie wählen. Von Brendel durfte sie das nicht erwarten. Sie brauchte dringend Verbündete. Aber wen und wie anfangen? Vielleicht ein Gespräch von Frau zu Frau, Max Brendels Frau. Nora Brendel war schon besonders, fand Zielke. Unkonventionell. Britta Zielke machte sich mehr aus Frauen als aus Männern.
Ohne besonderen Anlass organisierte der Vorstand Feste für die Mitarbeiter. Wer verheiratet oder anderweitig liiert war, konnte seinen Liebsten oder seine Liebste mitbringen.
Auch Brendels Frau kam stets gerne zu den bisweilen holprigen, aber gerade deshalb kurzweiligen Feiern, deren Gestaltung Zielke persönlich in die Hand nahm. Dabei hatte sie die Frau ihres ärgsten Widersachers nicht nur schätzen gelernt.
Sie hatte sich angeregt mit einem Mitarbeiter unterhalten und ließ sich an der verwaisten Cateringtheke ein Glas Sekt geben. Genießerisch nahm sie einen großen Schluck und ließ sich sofort nachschenken. Nora Brendel kam direkt auf sie zu, bestellte einen Weißwein und sagte: »Es ist wie immer sterbenslangweilig, liebste Britta.« Zielke war erstaunt und wusste nicht, wie sie diesen Satz einschätzen sollte.
War es Sarkasmus, unverschämte Offenheit oder nur plumpe Provokation, eine Stichelei, hinter der ihr Mann stand? Außerdem hatte Nora Brendel sie noch nie nur bei ihrem Vornamen genannt. Nora Brendel beobachtete Zielkes offensichtliche Irritation und schob nach: »Das war nur Spaß. Wirklich! Es ist nett hier. Alles ist wunderbar arrangiert, und es trägt ganz eindeutig ihre Handschrift.« Nora Brendel strahlte Britta Zielke an. «Sie haben das wieder wunderbar hinbekommen. Ich fühle mich wohl, und Britta, wissen sie was, das liegt auch an ihnen.«
Brendel sah Zielke fest an und umarmte sie. Dabei drückte sie ihren Körper fest an den von Zielke. Es dauerte kaum zwei Sekunden, doch Britta Zielke kam es vor, als wären sie endlos aneinandergeschmiegt. Nora drückte der verdatterten Zielke noch einen Kuss auf die Wange, nahm ihr Weinglas und verschwand so zielstrebig, wie sie gekommen war. Für einen Moment stand Zielke wie versteinert da.
Auch wenn Homosexualität heutzutage nichts mehr war, was die Menschheit verschrecken konnte - eine gewisse Camouflage war unumgänglich, sagte sich Zielke.
Als ihr dieser Gedanke durch den Kopf ging, fühlte sie sich mit einem mal alt; älter noch als fünfundfünfzig Jahre.
Nicht, das ihr die Arbeit keinen Spaß machte, im Gegenteil. Aber der Rest! Welcher Rest? Da war nichts!
In dem Erzählband eines deutschsprachigen Schriftstellers hatte sie eine Textstelle gefunden und markiert:
»... Das sind die Felsen in der Schlucht des Wasserfalls, die stehen geblieben sind; der ganze Rest ist unsagbare Strömung ...«
Das gefiel ihr, es schmerzte sie aber gleichzeitig! Sie lebte ein felsenloses Leben. Kein Ort, nirgends! Britta Zielke war diejenige, die in dieser Strömung trieb.
Zur Planung der Feste gehörten Spiele und tanzbare Livemusik. Die Veranstaltungen fanden immer in der Unternehmenskantine statt, deren Design und Ausstattung jedoch eher einem gehobenen Restaurant als einer säuerlich riechenden und trist gestalteten Essenabfertigungseinrichtung entsprachen.
Laura Domin, Zielkes neue Assistentin, hatte Psychologie studiert. Sie wusste, dass ihrer Chefin viel an einem guten Unternehmensklima lag und hatte den Vorschlag gemacht, hierarchiefreie Kommunikationsbrücken, wie sie es nannte, in die Feiern einzubauen.
Wie überall bei solchen Anlässen wurde zunächst gegessen und getrunken. Nach der sich anschließenden kleinen Rede, die abwechselnd jemand aus dem Vorstand hielt, sollte die Tabuzone zwischen den mit weißen Hussen geschmückten Tischen und der Bühne aufgelöst werden.
Domins Idee bestand darin, dass sich die Vorständler in diese Tabuzone stellen und sich von ihren Mitarbeitern betrachten lassen sollten. Kommentarlos!
»Wir können nicht nicht-kommunizieren«, hatte Domin gesagt, deren Studienschwerpunkt ´Selbstregulation und die Nutzung non-verbaler Kommunikation zur Leistungsoptimierung in Wirtschaftsunternehmen` war. ´Kann der Blick nicht überzeugen, überredet die Lippe nicht.`
Sie kannte die Wirkungen der Augensprache ... all die liebevollen, neidischen, vorwurfsvollen oder treuen, kritischen und gehässigen Blicke.
Die Schweigesituation dauerte nie lange. Das erste Lächeln steckte an und ging in einem allgemeinen Lachen auf. Es gab lockeren Gesprächsstoff zwischen den Vorstand und den Mitarbeitern, und die Musiker spielten ein vorher abgesprochenes Stück. Man konnte das Manipulation nennen. Doch zuverlässig begannen die meisten Anwesenden zu tanzen. »Wenn es hilft, haben wir alles richtig gemacht«, sagte Britta Zielke zu ihrer Assistentin.
Einmal hatte Monika Strittmatter, die persönliche Mitarbeiterin von Dr. Brendel, in die Leersekunde, die zwischen den letzten Blicken und dem ersten Lachen entstand, hinein gesagt: «Wenn Blicke töten könnten!« «Dann kommt wie immer der Leichenwagen, und wir haben einen Mörder«, hatte jemand belustigt geantwortet.
Für einen Moment, der sich für viele deutlich länger anfühlte, war es so still, dass es beinahe schmerzte. Die Gesichter der Anwesenden drückten mulmiges Schweigen aus. Die Münder zuckten und die übrigen fleischigen Gesichtspartien wirkten in einem wörtlichen Sinne wie betreten. Es war Nora Brendel, die als erste lachte und diejenige, die als erste tanzte. Wenn Blicke töten könnten!
Nora und Laura trafen sich am Ende der Veranstaltung auf ein Glas Wein. Sie waren alleine in dem Saal und betrachteten sich mit schelmischen Blicken.
»Die Strittmatter!« Nora Brendel lachte und Laura Domin lachte spontan mit ihr. »Ich habe übrigens auch Psychologie studiert«, sagte Brendel und wie ein Kind hielt sich eine Hand vor den Mund.
»Dann sind wir beide eine Macht«, erwiderte Domin vergnügt und stieß erneut mit Brendel an.
Britta Zielke findet nicht nach Hause
Britta Zielke fährt durch Hamburg. Sie will noch nicht nach Hause. Zuhause ist sie alleine; zuletzt allein, egal wie faszinierend ihr Haus ist.
Während ihr sanft und stetig der Schweiß aus den Poren dringt, würde sie ihren hämmernden Herzschlag hören; hören, wie er sich an den mit Bildern und Gobelins geschmückten Wänden bricht und zu ihr zurückkehrt. Wie er ihr unbarmherzig sagt, dass sie leidet und kein zweites Leben hat.
Sie steht im dichten Abendverkehr und denkt: Nora ist wundervoll. Eine Autolänge anrollen, das zarte Grollen der zwölf Zylinder, erneut abbremsen. Sie drückt auf einen Knopf in der Mitte der mit weichem Leder ausgeschlagenen Konsole und das Autodach öffnet sich rasch. Der britische Wagen war teuer, ist sehr luxuriös und äußerst dynamisch. Sie wollte den Vanquish haben. Must have hatte sie dem Verkäufer lächelnd gesagt, als sie den Vertrag unterschrieb.
Kurz blickt sie in den nachmittäglichen Himmel, der sich in einem leuchtenden Blau zeigt. Ein Gefühl überkommt sie mit Macht. Wie gerne würde sie jetzt ausbrechen und das Gaspedal bis auf den Boden durchtreten. Zielke erschrickt über diese Vorstellung, atmet tief durch und blickt besorgt auf ihr rechtes Bein.
Du musst ruhig sein, sagt sie sich, hörst du. Du musst ruhig sein, unbedingt. Die Autoschlange bewegt sich weiter. Die Frau mit. Erneut halten die Fahrzeuge. Stillstand.
Ob ich jemanden anrufen soll, fragt sie sich. Niemand fällt ihr ein. N i e m a n d. Zielke spürt, wie sich ihre Lider von alleine senken. Ihre Mundwinkel ziehen nach unten. Es passiert einfach. Sie hebt die Hände, presst sie fest ins Gesicht, so, dass ihre Fingerkuppen hart an ihren Nasenöffnungen liegen. Langsames Anfahren. Ein leiser Fluch. Jemand drängt sich unverschämt vor sie. Sie hupt. Alles steht!
Zielke klappt die Sonnenblende herunter und blickt in den Kosmetikspiegel. Mit fahrigen Bewegungen richtet sie das Haar an der linken Stirnseite, wo ein starker Wirbel ihren Versuchen, die neue Frisur herzurichten, widerborstig widersteht und die Haare nach rechts dreht. Vielleicht hilft eine Operation, denkt sie und klappt die Blende nach oben.
Was machst Du mit dem Rest Deines Lebens? Die Frage schießt ihr durch den Kopf. Bist immer im Werden und fast nie im Sein. Es trifft, nüchtern betrachtet, auf sie zu. Anderseits sind ihr die von Seele besoffenen Gesichter widerlich. Dieses sozial aufgeschäumte Menschsein. Kein Abschaum, aber eben Schaum. Die falsche Temperatur hier, ein kleiner Luftzug da, und schon fällt das menschelnde Momentum in sich zusammen. Dann laufen sie davon in ihre kleinen Höhlen.
Sie hält es lieber mit der Parole: Betrachte die Dinge nüchtern, lass Dich nicht einschüchtern, niemals.
Britta Zielke, geboren 1954 in einem kleinen Kaff namens Quitzow bei Perleberg. Ihr Vater war evangelischer Theologe, die Mutter unterrichtete Fremdsprachen an der Regelschule. Ihre Erziehung war streng und körperlos. Als sie drei Jahre alt war, wurde eine Pfarrstelle in Prenzlau frei. Zielke, die als kleinste ihrer Klasse, die die Schnellste der ganzen Unterstufe war.
Sie war zehn, als die aus Hanau stammenden Eltern, die wegen des Pfarrermangels in die nach dem Krieg noch offene DDR gezogen waren, mit ihr geflohen sind. Nach Singen am Hohentwiel. Britta Zielke. Die später am Heilig-Geist-Gymnasium das beste Abitur seit Bestehen der Schule gemacht hatte und die nie wirklich einen Freund oder eine Freundin hatte.
Nur ein einziges Mal in ihrem Leben hatte sie sich mit einem Mann eingelassen. Universität in Köln, Volkswirtschaftslehre und Soziologie.
Erstes Semester. Eine Studentenfeier. Wie hieß er noch gleich? Leid. Nein, sie wollte sich nicht erinnern. Kein Mensch hat keinen Freund. Britta Zielke ist ein Mensch.
Ins Gelingen verliebt sein, darum muss es doch gehen, hatte sie auf einer Unternehmensfeier gesagt. Wenigstens etwas, in das sie vernarrt ist, haben sich damals viele gedacht. Ein harmloser Satz, wer wollte ihn nicht unterstreichen! Aber aus ihrem Mund hörte er sich an wie: ‚Ich vertraue dem Glück nicht, weil sein Preis zu hoch ist!’ Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man es miteinander teilt. Und wird das Ich nicht erst durch das Du zum Ich. DU!?
Schon mitten im Leben sind manche vom Tod umfangen. Sind das Gedanken, die einem nur kommen, wenn man in einem zweihundertzwanzigzigtausend Euro teuren Auto sitzt? Für einen winzigen Moment muss Britta Zielke lächeln.
Das Leben ist eine Tragödie für die, die fühlen und eine Komödie für die, die denken.
Wohin gehörst du: Britta Zielke?
Es scheint, als würden alle Ampeln auf Rot stehen. Die Zeit ist wie ein besonderer Teig. Sie fließt langsamer, wird träge, sie verdichtet sich, stoppt und bildet einen weichen Kern aus.
Mit dem Bewegungsverhalten eines Chamäleons klappt die Mittfünfzigerin die Sonnenblende erneut herab und blickt wieder in den Kosmetikspiegel. Sie sieht in ein weiches Frauengesicht, das sich in den Falten sichtbar geworden grämt, dabei gleichzeitig Spuren von unterdrückter Wut in den wachen Augen zeigt. Die etwas weit auseinander liegenden Augen scheinen durch den Spiegel hindurch zu sehen. Zielke streicht sich durch das noch dunkelbraune Haar, schiebt die Lippen nach innen und fängt an zu grimassieren. Sie denkt, mein Gesicht ist aus Stein.
Oberhalb ihres Magens spürt sie eine seltsam reibende Empfindung. Ihr Sonnengeflecht regt sich. Wie früher, als sie von ihren Eltern gemaßregelt wurde.
Schnell klappt sie die Blende wieder nach oben.
Der Verkehr rollt an. Endlich beschleunigen. Sie fährt über die Sechslingspforte am St. Georg-Krankenhaus vorbei. Kurz darauf biegt sie links in die Uferstraße ‚An der Alster’ ein, um im weiteren Verlauf die Kennedybrücke zu überqueren. Die breite Außenalster liegt rechts von ihr. Verschiedene Boote fahren unter der Brücke hindurch, Segelboote zumeist, mit ihren weißen Spitzen vor taubenblauem Wasser. Die Fahrt über die Brücke empfindet sie wie eine extreme Zeitlupenaufnahme.
Ihr Körperäußeres ist eine Hülle, dehnbares Plasma, das, bernsteingold, wie in der Reklame für Motorenöl, Zähigkeit beweist. Sie spürt den Schwindel, ihr Blut fühlt sich an wie ein überhitztes Gel, durchstreift den Körper und setzt sich maskenartig in ihrem Gesicht fest. Auf der gesamten Haut macht sich ein unangenehm feucht-warmer Film bemerkbar, wie ein eigenständiges Lebewesen. An einer Ausbuchtung der Straße lenkt sie den Aston Martin rechts ran und bleibt dort stehen. Sie muss, weil sie in diesem Zustand nicht fahren kann.
Später wird sie die Rothenbaumchaussee nehmen und vor dem Völkerkundemuseum, wie stets, rechts abbiegen, um zu ihrem Haus zu gelangen. Sie ist jetzt entschlossen, etwas zu ändern.
Nora Brendel und das andere Gesicht
02.06., Dienstag, Hiddensee
Bereits am frühen Dienstagmorgen war Nora Brendel nach Hiddensee gefahren. Es machte ihr Freude, den Garten mit verschiedenen Stauden und Rankenpflanzen zu schmücken. In Hamburg hatte sie mit dem Van Einkäufe gemacht, da manche Dinge auf der Insel nicht erhältlich waren.
Meistens fuhr sie mit ihrem Mann nicht nach Hamburg zurück, sondern blieb auf der kleinen Insel, um an ihren Bildern zu arbeiten. Ihr aktuelles Bild war unfertig und zeigte den Ausschnitt einer Landzunge, die wie ein Sandhaken ins Meer überging. Neben Menschen am Strand waren zwei Segelboote zu sehen, die vor dem Strand dümpelten.
Vor drei Jahren hatte sie die Malerei für sich entdeckt. Die Naturmalerei hatte es ihr besonders angetan, wie die Künstler, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Künstlerkolonie auf Hiddensee gebildet hatten.
Nora Brendel kannte die Schaffensplätze jener Künstler, die durch ihr hiesiges Wirken berühmt wurden und suchte diese Plätze auf. «Malen ist kein Problem; das Problem ist: was tun, wenn man nicht malt!«
Ihr Mann hatte nie einen Einwand erhoben. Im Gegenteil. Er fand es gut, dass seine Frau ihrer inneren Stimme folgte, mochte diese Stimme auch noch so skurril erscheinen und bisweilen vergangene Geister wichtiger nehmen als ihre gemeinsame Gegenwart.
Nora hatte oft böse Träume. Max war beunruhigt, wenn er von ihren Lauten wach wurde. In diesen Träumen mussten wohl dämonische Wesen vorkommen, die sich seiner Frau in solchen Nächten bemächtigten. Dann weckte er sie vorsichtig, um sie zu beruhigen, nahm sie in den Arm und sprach leise mit ihr.
In diesen Momenten hatte sie einen Blick, den er sonst nicht von ihr kannte.
Wahrscheinlich war alles harmlos: Nora war eine Malerin, die wie alle Künstler ein starkes, inneres Spannungsfeld hatten.
Daran wollte er glauben. Doch diese Erkenntnis verdeckte einen blinden Fleck und war nichts wert. Denn seine Intuition sagte ihm etwas anderes.
Haeckermanns Frauen 1)
05.06., Freitag, Hiddensee
Die ganze Insel ist Teil eines Nationalparks. Der äußerste Süden und die seltsam, wie Rüssel geformten Gebiete im Norden sind besonders streng geschützt.
Der Küstenabschnitt im Süden gehört zu den schönsten an der Ostsee. Lang und rund gezogen, bis die Kräfte der Natur befanden, dass das Modellieren jetzt ein Ende haben müsste.
Ansonsten ist Hiddensee ein wahrer Ausbund an Friedfertigkeit. Bis auf gelegentliche Reibereien zwischen Nachbarn, Pensionswirten oder sich ereifernden Touristen gibt es keine Vorfälle. Kein Autoverkehr, nur Pferdekutschen, Fußgänger, Fahrräder. Saumseligkeit. Das einzig Kriminelle findet im Inselkino statt. Wöchentlich abwechselnd werden in einem großen Zelt Thriller und Krimis gespielt.
Gerhard Haeckermann geht mit seinem Hund vom Norderende aus am Strand spazieren. Er nimmt seine Dienstmütze ab und fährt mit einer Hand durch das füllige braune Haar. Seine schmale, kurze Nase und der Strichmund bilden einen Kontrast zu seinem gut sichtbaren Doppelkinn und den munter wirkenden blauen Augen. Liebevoll blickt er auf seinen Hund.
Leo rennt gerne geworfenem Holz hinterher. Der gutmütige und leicht füllige Haeckermann weiß, was seinem gestromten Mischlingsrüden Spaß bereitet.
Treibholz als Wurfmaterial gibt es in Hülle und Fülle. Er wirft das Holz ins Wasser, auf die Kuppe der sanft ansteigenden Dünen oder in Gehrichtung: der Hund bringt alles zurück. Das Holz fest im Maul, schüttelt er sich, wenn er aus dem Wasser kommt. Eine belustigende Situation, in der, könnte man sagen, der Hund viel Würde versprüht.
Das unbeschwerte Spiel mit dem Hund, die Farbkontraste, das Wasser, die mehrdimensionale Weite zwischen seinen Füßen und dem Himmel: Alles wie geschaffen für Maler, selbstvergessene Poeten und andere kreative Geister.
Vieles auf der Insel ist dem Mitfünfziger vertraut. Trotzdem gibt es immer wieder etwas, wo er denkt: So habe ich das noch nicht gesehen!
Jetzt seufzt der Chef der Hiddenseer Polizeistation. Er könnte ein Heureka gut gebrauchen, denn ihm schwirren an diesem schönen Frühabend unschöne Gedanken wie Ringgeister durch den Kopf. Und das war noch nie wirklich gut, wie der Polizeihauptmeister und Chef der Inselpolizei sich selbstkritisch eingesteht. Vertraute Dinge waren ihm eindeutig lieber.
*
Manchmal fragt Haeckermann sich, warum sich bestimmte Menschen anderen Leuten überlegen fühlen. Das, meint er, wäre dumm und diskriminierend. Denn erst die Ungleichheit würde sie doch einander ebenbürtig machen, weil jeder in seinem Leben Chancen hat, genau das zu versuchen: ebenbürtig zu sein, hatte er er Jörg Niebel, seinem Kollegen erläutert. Der junge Polizeimeister hatte ihn staunend angesehen.
Für Haeckermann ist jedenfalls klar, dass hierin der Schlüssel zur Dynamik menschlicher Existenz liegen muss.
Aber muss man auch, um die Unterschiede zu betonen, gleich jemanden ermorden?
Den rechtschaffenen Haeckermann verwirrt dieser Gedanke. Der Polizist weiß, dass das Leben keine Sonntagskirche ist. Zudem fehlt ihm fehlt die Autonomie des Finsteren in seinem Erfahrungsrepertoire, welches manche Menschen wie eine Naturbegabung besitzen. Und aus genau diesem Grund, hatte er Niebel gesagt, würde ihn die gehobene Polizeilaufbahn nicht interessieren, denn da käme er weitaus häufiger mit solchen Begabungen in Berührung.
Der leichte, noch warme Wind flaut ab, und die Oberfläche der Ostsee ist beinahe glatt. Im Westen steht die Sonne immer noch hoch genug, um ihre wärmenden Sonnenstrahlen auf das Eiland zu schicken.
Leo streift derweil ungestüm um die Beine seines Herrchens herum und fordert den nächsten Wurf. Noch während der Hund dem Holz nachjagt, dreht Haeckermann um und beschließt, zur Polizeistation zurückzugehen und nach dem Kollegen Niebel zu sehen. Bei dem Gedanken, dass Niebel durch die Tagesereignisse mitgenommen sein könnte, fühlt er sich merkwürdig gestärkt. Niebel wäre jemand, dem er helfen könnte. Leo würde er mit auf die Wache nehmen.
*
Am späten Vormittag hatten Haeckermann, Niebel und Dr. Bergans die kleine Straße auf der Boddenseite nach Kloster genommen. Ingo Bergans, der von Hugenotten abstammte, war der einzige Notfallmediziner auf der Insel. Das Einsatzfahrzeug des Arztes hatten sie am Hafen abgestellt, um anschließend mit einem russischen Allradfahrzeug über das Hochland zu fahren.
Um 10:50 Uhr war in der Polizeistation ein Anruf eingegangen. Der männliche Anrufer behauptete, er hätte eine Frauenleiche unterhalb vom Klausner gefunden, etwa hundert Meter Richtung Enddorn, vom Treppenabgang aus.
Dr. Bergans trug seinen Notfallrucksack, Niebel und Haeckermann trugen jeweils einen Spurensicherungskoffer.
Die drei Männer waren bis zur Waldschänke ”Zum Klausner“ gefahren, dann vorbei an der Wetterstation eines bekannten TV-Metereologen. Dort parkten sie das Fahrzeug. Dann der Abstieg am Kliff, über mehrere hundert Stufen, zum Strand. Nur Bergans schwitzte nicht, als sie um 11:35 Uhr den Strand erreichten.
Nach Norden zu sahen sie mehrere Menschen. Jemand winkte ihnen. Die drei beschleunigten ihre Schritte und erreichten bald die kleine Gruppe. Ein etwa sechzigjähriger Mann gab an, dass er angerufen hätte. Mit einigen Freunden wollte er um den Enddorn auf die andere Seite zum Altbessin wandern. Er lamentierte wie ein ertapptes Kind, weil der Fußweg an der Steilküste wegen akuter Abbruchgefahr gesperrt war. Die Belege lagen dafür überall auf dem Strand.
Abgestürzte Sträucher und andere Pflanzenteile lagen zwischen Findlingen auf Sandhügeln und nachgestürztem Erdreich herum. Diese zum Teil noch wochenlang lebensfähigen Pflanzen gaben der Szenerie ein bizarres Gepräge.
Dr. Bergans stellte offiziell den Tod fest. Um am Fundort keine Spuren zu beseitigen, bewegte er sich filigran und steckte seine wenigen Bewegungslinien ab, damit die Spezialisten problemlos arbeiten könnten.
Die Wirbelsäule der auf einem Findling liegenden Leiche sah aus wie ein überdimensioniertes Baguette, das man vor dem Zerlegen in ein dünnes Tuch gehüllt hat, um beim Schneiden das Auseinanderfallen zu vermeiden.
Haeckermann verscheuchte die Leute vom Fundort und führte ein Erstgespräch mit dem Anrufer. Von den anderen Leuten wollte er anschließend wissen, ob sie sich der Leiche genähert hätten. Alle verneinten und schüttelten niedergeschlagen die Köpfe. Sie stützten sich und schluchzten leise in die Körper derer, die sie gerade in den Armen hielten.
Der Anrufer erwähnte, dass ihnen ein Mann von Norden entgegen gekommen wäre, kurz bevor sie den Fundort erreichten. Haeckermann verlangte eine Beschreibung. Wortkarg und präzise schilderte der Zeuge den Mann. Falten zeigten sich auf Haeckermanns Stirn.
Für einen Strandspaziergang teuer gekleidet, sehr gepflegt, hoch gewachsen mit auffälligem Haarschnitt und ebensolchen Augenbrauen. Eine ungewöhnliche Erscheinung mit Wiedererkennungswert. Der Polizeihauptmeister notierte die Angaben. Als Niebel die persönlichen Daten der Wanderer aufgenommen hatte, sagte er ihnen, sie sollten zurück nach Kloster oder Vitte gehen.
Die Polizisten und der Mediziner sicherten den Fundort mit einem Absperrband, machten Fotos, Notizen und Zeichnungen, nahmen eine einfache Skalierung vor, der Arzt führte eine Augenscheinuntersuchung der Leiche durch.
Haeckermanns Handy klingelte, es war die Leitwache in Stralsund. Die Kollegen König und Bergkamp kämen gegen 13:15 Uhr im Hafen von Kloster an, er sollte sie abholen. Bergans und Niebel wollten den Fundort gegen Beweismittelvernichtung durch Schaulustige solange schützen.
*
Haeckermann marschierte sofort los, stapfte den Treppenaufgang hoch. Oben kam er mit schweren Schweißperlen am Fahrzeug an. In dieser Schutzhülle aus Blech fühlte er sich erleichtert. Er war erschöpft und froh, alleine zu sein.
Das am Strand reichte ihm bis zu seiner Pensionierung, und für heute hatte er sowieso die Nase gestrichen voll.
An diesem Morgen hatte er neue Untersuchungsergebnisse bekommen.
Die Zahl seiner Leukozyten war erneut dramatisch gestiegen. Innerhalb eines Monats waren sie von 58000 auf 107000 gestiegen, Tendenz stetig steigend.
Viel ist viel Mist, dachte er. Haeckermann litt unter chronisch myeloischer Leukämie, eine genetisch bedingte, weltweit seltene Variante des Blutkrebs. Nur sein Arzt und das Labor wussten davon.
Nilotinib war ein sehr teures Medikament, die Kosten wurden ihm nur zu zwanzig Prozent von der Krankenkasse erstattet. Als unverheirateter Polizeihauptmeister verdiente Haeckermann 3.050,- Euro netto, plus Amtszulage, seine Dienstjahre einrechnet.
Eine Stammzelltherapie könnte aussichtsreich sein, hatte sein Arzt gesagt, wäre aber weit kostspieliger als das jetzige Medikament. Er bräuchte deutlich mehr Geld! Mit seiner Krankheit könnte er in fünf Jahren abschlagsfrei in Pension gehen. Dieser Zeitraum kam ihm kosmisch lang vor.
Fünf Jahre! Würde er noch so lange leben? Er hatte keine Ahnung, wie er seinen Eigenanteil an der jetzigen Therapie zahlen sollte. Wäre da nicht das kleine Erbe, wäre er womöglich schon jetzt tot. Und dass ihm ausgerechnet heute noch sein erster Mord durch’s fragile Leben lief, war eindeutig zuviel!
»Ach was, der Chef muss raus! Und Leo auch«, hatte er Niebel mehr zugeschrien als gesagt.
Niebel hatte seinem Chef noch ein Zungenschnalzen mit auf den Weg gegeben, als wäre dieser ein Pferd, das man mit solchen Schnalztönen locken könnte. Polizeimeister Niebel wirkte gefestigter als sein Chef. Sein einziges Problem war:
Wer würde jetzt den Schreibkram zu dem Mordfall erledigen?
Dabei hatte ihn Haeckermann am Abend zum Telefondienst verdonnert. »Lass gut sein Jörg. Nix mit Papier. Nur warten, ob das Telefon oder das Fax klingelt. Und vergiss bloß nicht die Mails zu checken! Könnte sich noch jemand aus Stralsund melden. Ist jetzt«, er sah auf die Uhr, »18:10 Uhr. Die Herrschaften haben andere Arbeitszeiten als wir. Und wenn die auch nur das Band hören würden ... Nee, wat mut, dat mut.«
Der Papierkram würde sich für die beiden in überschaubaren Grenzen halten. Die Schriftstellerei müssten die Stralsunder übernehmen. Polizeimeister Niebel nahm die beiden letzten Sätze erfreut zur Kenntnis und sagte mit loyaler Ernsthaftigkeit, dass er die Stellung schon halten würde.
Dann war Haeckermann weg, zusammen mit Leo, durchatmen.
*
Unter der Kinnlade und auf Höhe des Atlas und Axis hatte die Frau eindeutige Druckstellen. «Fingerabdrücke!« sagte Dr. Bergans. Die Hämatome wären das Resultat eines gewaltsamen Vorgehens, hatte er nach der vorläufigen Untersuchung geäußert. In Stralsund würde ein Forensiker ohnehin eine gründliche Untersuchung durchführen.
«Das hier ist eindeutig Mord.« legte sich Bergans fest.
Haeckermann nuschelte was von Schweinerei und der erste Mord, seit er vor dreißig Jahren nach Hiddensee kam. Er musste die Kollegen aus Stralsund anfordern.
*
Als die Fähre bei sonnigem Wetter nach Mittag ihre Landeklappe öffnete, verließen nur wenige Touristen das Schiff, um Kloster zu erkunden.
Unmittelbar hinter der Fähre machte die ”Ummanz“, das Schnellboot der Stralsunder Polizei, fest. Haeckermann hatte zwischenzeitlich das Polizeiauto am Hafen von Kloster abgestellt und sich gerade beim Inselhafenmeister Fred Niebel auf einen Kaffee eingeladen, als die Kollegen an der winzigen Hafenmeisterei vorbei gingen.
Haeckermann kannte die beiden und stöhnte leise: Uwe Bergkamp und Torsten König. Aber da war noch ein dritter Kollege, mit straffen, schwarzen Haaren und hoher Stirn, sportlich, unter dreißig, Mittelmeertyp.
Er stellte sich mit »Hallo. Malte. Spurensicherung.« vor. Knappe Ansage, dachte der Chef der Inselpolizei. Ob seine Informationspolitik am Fundort genauso kurz ausfiele? Haeckermann verzichtete auf eine weitere Sozialabfrage, trank seinen Kaffee und verabschiedete sich von Niebel.
Herrjeh, der große Bergkamp und der kleine König. Beide PHK waren Mitte Vierzig und keineswegs Leuchten ihres Berufsstandes, wie Haeckermann fand, aber irgendwie clever, besser gesagt raffiniert genug, das Bild großer Ermittler abzugeben.
Alles eine Sache des Auftretens, sagte sich Haeckermann. Körperlich machten der kleine, rundliche König und der groß gewachsene, füllige Bergkamp nicht viel her. Für PHK waren sie nicht sonderlich fit. «So wie ich«, sagte sich Haeckermann schmunzelnd.
Aber auf Hiddensee war soziale Kompetenz gefragt, tröstete er sich.
Bergkamp und König begannen sofort mit ihren Sticheleien und sprachen vom ´schwer kriminellen Tatort Hiddensee`. Der Unterton ließ das Festländische raushängen, als ob er, Haeckermann, der Erfinder der Begriffsstutzigkeit wäre, während die PHK alle Weltläufigkeit dieses Planeten verkörperten.
Andererseits waren die PHK ganz in Ordnung. Sie duzten sich sogar, und dass über vier Besoldungsstufen hinweg. Haeckermann dachte, dass da wohl Respekt oder Sympathie im Spiel sein mussten.
Die Kommissare stellten ihren jungen Kollegen als Oberkommissar Malte Mutlu von der Spurensicherung vor.
Mutlu wäre türkisch und bedeutete ´glücklich` gluckste Bergkamp sichtlich zufrieden über sein Wissen. Malte zeigte ein gequältes Grinsen. Nach einem kurzen Geplänkel berichtete Haeckermann, was er bisher herausgefunden hatte. »Viel ist das nicht«, meinte Bergkamp anschließend gedehnt, was eher an dem steilen Anstieg als an seinen analytischen Fähigkeiten lag.
»Kann ich bestätigen«, sagte sein Kollege König nach Luft schnappend. Mutlu sagte nichts. Scheinbar hatte er beschlossen, an nichts Anstoß zu nehmen, oder es interessierte ihn nicht, dass sich gestandene Polizeikollegen wie Backfische verhielten.
Schien ein kluger Kopf zu sein, dachte Haeckermann und erwiderte: »Wie sollte es auch anders sein«, nicht ohne verärgert heftig mit den Augen zu zwinkern. »Die glauben wohl, ich hätte den Fall schon gelöst«, grummelte er in sich hinein.
Im Ortskern angekommen ließen sich die PHK in das Allradfahrzeug fallen, und die kleine Truppe fuhr los. Als sie am Treppenabgang ankamen, sahen Bergkamp und König besorgt auf ihre Schuhe. König meinte lakonisch: Ganz schön viel Natur hier.«
Vor allen Dingen Dr. Bergans wäre wegen seines vorbildlichen Vorgehens zu loben, sagte König blasiert. Der so Gelobte sagte, dass der Todeszeitpunkt etwa zwischen drei bis fünf Stunden zurück liegen müsste. Niebel und Haeckermann gefiel, dass man ihren Notfallmediziner lobte, nicht aber, dass sie damit unausgesprochen wohl keine gute Arbeit geleistet hätten.
Der unverändert sprachlose Spurenexperte konstatierte nach Abschluss seiner Ermittlungen in Zweiwortkombinationen, dass die Situation geringkomplex und damit einfach wäre. Zusammen mit König und Bergkamp war er sich einig, dass die Frau aufgrund der Spuren am Hals von oben gestoßen worden sein musste. Die offenen Frakturen an der Wirbelsäule hätte sie sich durch den Aufprall zugezogen.
Dr. Bergans nickte zu den Ausführungen. Allerdings müssten Obduktion und KTU zu den Spuren im Kopfbereich mehr sagen.
Wegen der schwierigen Bedingungen vor Ort müsste er die Möglichkeit biometrischer Nachweise jedoch ausschließen, weil sie nach seinen bisherigen Untersuchungen nicht feststellbar wären.
Kurzum, die Ergebnisse waren im wörtlichen Sinn naturgegeben äußerst mager.
König kontaktierte den Bootsführer der ”Ummanz“ und teilte ihm die Koordinaten des Fundorts mit. Jemand würde nachher nasse Füße kriegen, aber sie würden die Leiche direkt vom Fundort an Bord bringen.
»Eins steht fest: es war Mord«, sagte König. Bergkamp gab eine Reihe von Wörtern von sich, die ganz ohne Vokale auskamen, aber irgendwie zustimmend wirkten. Dr. Bergans teilte den Stralsunder Ermittlern mit, dass er heute Abend seinen Bericht per Email an sie schicken würde. Malte Mutlu winkte schweigend, als er mit König und Bergkamp an Bord der „Ummanz“ verschwand.
Ich hätte uns malen sollen
03.06., Mittwoch, etwa 15:00 Uhr, Hiddensee
Vitte liegt auf halber Strecke zwischen der Nord- und der Südspitze der Insel. Es ist so etwas wie der Hauptort, inoffiziell versteht sich. Dort sind das Rathaus, die Verwaltung, das Tourismusbüro und die Polizei untergebracht. Der Hafen dort ist der größte auf der Insel.
Direkt am Vittener Hafen liegt die Hotelpension ”Lachmöwe“. Die Pensionsgäste können ihr Frühstück auch auf dem Außengrundstück einnehmen. Von dort aus haben sie das Geschehen am Hafen und zwei Fahrradkreuzungen im Blick.
Es ist das verkehrstechnische Zentrum der Insel, und dort spielt sich, rein mengenmäßig betrachtet, das soziale Hauptgeschehen ab.
Ein Mann ist gerade von einer Fahrradtour zum Süderleuchtturm zurückkehrt. Seit einigen Tagen wohnt er in der ”Lachmöwe“. Seiner, in der Küche beschäftigten, Pensionswirtin erzählt er durch die zur Küche offen stehenden Tür, dass er in der Nähe des kleinen Leuchtturms eine Malerin getroffen habe. Und dass es dort unten ganz anders wäre als im Norden. »Das ist der große Süden dieser kleinen Insel. Verwunschen, sinnlich, sandig.«
Die Pensionswirtin lachte kurz und sagte nur:«So so ...«.
Der Mann geht aus dem lindgrün gestrichenen Flur des Pensionsgebäudes hinaus. Er nimmt in dem weiß gekalkten und von üppigen Blütenpflanzen bestandenem Innenhof an einem kleinen Tisch Platz und streckt mit einem behaglichen Seufzer die langen Beine von sich. Als sich die junge Bedienhilfe nach seinen Wünschen erkundigt, bestellt er ein Kännchen Darjeeling und den Tageskuchen. Der Mann setzt die Sonnenbrille ab, schließt die Augen und wendet sein Gesicht der Sonne zu.
»Also wirklich, ich hab’ keine Ahnung. Hier malen so viele Leute«, antwortet die geschäftige Pensionschefin mit beträchtlicher Verzögerung durch das zum Innenhof geöffnete Küchenfenster und weist die Bedienhilfe mit eindeutigem Unterton an, das schmutzige Geschirr auf den frei gewordenen Tischen schneller abzuräumen. Die junge Frau erschrickt kurz und beschleunigt ihren Schritt.
»Hab’ nur kurz gesehen, wie unser Polizeiauto nach Norden gefahren ist«, schiebt die Gastronomin noch hinterher. Und damit ist das Gespräch für sie beendet. Nachfragen sind ganz offensichtlich nicht mehr möglich.
Auch eine Art des Umgangs, denkt sich der Gast. Die Serviererin kommt mit einem Tablett, stellt Kuchen und Tee auf den Tisch des Mannes. Sie lächelt ihn an, dann verschwindet sie wieder in Richtung Küche.
Der Gast macht einen selbstzufriedenen Eindruck und schiebt sich ein großes Stück Kuchen in den Mund.
Was passiert ist, ist passiert! Während er langsam und genussvoll kaut, denkt er an seine Begegnung.
Mit einer Hand streicht er das volle Haar aus der Stirn zur Seite und zupft seine auffälligen Augenbrauen nach oben. Eigentlich schade, sagt er sich, unter anderen Umständen hätte ich jetzt ganz romantisch behaupten können, dass ich noch nicht einmal ihren Namen weiß.
04.06., Donnerstag, 17:10 Uhr, Plogshagen, Hiddensee
´Nichts würde mehr sein wie es voher war.` Furchtbar, dachte sie. Furchtbar und kitschig. Fürchterlicher Kitsch. ´Nichts würde mehr sein, wie es voher war.` Ein banaler Satz, der mit Deutungen übersättigt war. Die Moralkeule, die dem Satz sein Gerüst gab, zeigte aber auch bei ihr Wirkung. Sie versuchte erst gar nicht, diese Wirkung zu ignorieren. Trotzdem musste sie zugeben, war etwas in ihr aufgebrochen. Was sie getan hatte, erschloss sich ihr erst nach und nach, dafür aber mit atemberaubender Klarheit. Wie ein Katarakt, der Wassermassen auf Wassermassen aus großer Fallhöhe abwirft und weiter unten wieder anhäuft. Wassermassen, in denen du unweigerlich ertrinken musst. Fallhöhe.
Sie dachte an Laura Domin und dass sie erneut nach Vitte müsste. Die Fähre würde pünktlich kommen.
Und tags zuvor, dieser Mann. Er fuhr, um die Mittagszeit langsam von Süden kommend, auf einem Fahrrad. In einem etwas altmodischen Deutsch rief er, noch mit einigem Abstand zu ihr und wie selbstverständlich, dass es auf der Insel schön sei und er in Vitte eine ausgezeichnete Unterkunft habe. Ohne abzusteigen hielt er an und teilte der ihm völlig fremden Frau mit, dass er dabei sei, die Insel zu erkunden.
Ach so, die Insel erkundigen, hatte sie uninteressiert erwidert. So ein Schnösel! Was sonst tun die Gäste auf Hiddensee? Sie erkunden die Insel. Je kürzer ihr Aufenthalt, desto mehr erkundigen sie. So ist das hier. Der Mann musste wohl an der Grenze des Schutzgebietes gewesen sein.
Vor allen Dingen aber missfiel ihr die Art, wie er ihr seine Absicht mitteilte. Viel zu selbstbewusst und dennoch verspielt. Im Grunde also nett, fand sie.
An diesem Morgen war sie wieder zu dem Flecken südlich von Plogshagen gefahren. Gestern hatte sie dort mit den Arbeiten an einem Bild begonnen.
Ihr Fahrrad samt Anhänger hatte sie hart an einen Busch gestellt und ihre Malutensilien rings um die Staffel auf eine wasserdichte Decke ausgebreitet.
Sie saß auf einem Drehhocker und blickte nach Westen, vorbei an dem kleinen Leuchtturm.
Irgendetwas war! Der Mann machte Anstalten, seine Fahrt fortzusetzen, als sie plötzlich von ihm wissen wollte, woher er käme.
Sie wunderte sich über ihre Frage. Aus Hamburg. Sie käme ebenfalls von dort, erwiderte die Frau ohne Umschweife. Wieder wunderte sie sich. »Kommen sie regelmäßig an diesen Ort?«, fragte der Mann. Sie bejahte, es wäre ein guter Ort mit inspirierender Ausstrahlung.
Es war ein hoch gewachsener Mann, schlank. Ende dreißig, vielleicht älter, schätzte sie. Er hatte ein schmal geschnittenes Gesicht mit auffallend sichelförmigen Augenbrauen und Augen in einem interessanten Blau, das violett gesprenkelt war. Sein dunkelbraunes Haar war voll, für ihren Geschmack lag es zu weich gescheitelt. Affektiert ...
Der Wind frischte auf und rauschte durch die Wipfel der Seekiefern. Er stieg ab, legte sein Fahrrad in den Sand, ging zu ihr hin und setzte sich ungefragt neben sie auf den Sand. Zwei Handbreit lagen zwischen ihnen. Er betrachtete das Bild. »Sie malen gut, gute Technik, das Motiv ist interessant getroffen. Die Zuordnung und Gewichtung sind stimmig.», sagte er in einer Weise, wenn Experten über etwas dozieren.
»Ach, finden sie?«, fragte sie kühl zurück. »Unbedingt! Sehen sie, hier, das Segelschiff, die Details, fast fotografisch und dennoch hat es etwas Sphärisches, es lässt seinen zentralen Gegenstand los. Der Strand, der ins Wasser hinein läuft und dort das Meer, stark aufhellt. So erscheint ein Licht von unten. Und im Vordergrund die Kiefern auf der Düne. Das Bild erinnert mich an diese pastellfarbenen Designobjekte der fünfziger Jahre. Dezent, aber farbenfroh und leicht, vor allen Dingen leicht. Wissen sie, was ich meine?« Sie hatte stumm zugehört. Der kleine Glücksschauer, der ihren Körper durchlief, wurde größer.
Noch nie hatte sich jemand in dieser Weise mit ihren Gemälden beschäftigt.
Sie wollte noch wissen, ob er etwas von Malerei verstünde, gar selber malen würde. Aber sie fragte nicht.
Das Geräusch der Brandung überwand die Dünen mühelos und fiel in die tieferen Senken und breiten Mulden hinter diesen zeitlosen und sich ständig verändernden Wällen aus warmem Sand.
Der Mann hatte sich zwischenzeitlich ausgestreckt und gemurmelt, er sei schläfrig. »Es ist wirklich sehr schön hier!«, murmelte er noch, während er die Außenseite seines linken Unterarms wie zum Schutz auf die Stirn legte. Seine Hand hing dabei entspannt nach unten. Sie erhob sich von ihrem alten Drehhocker, setzte sich neben ihn und betrachtete sein Gesicht.
Später streifte der Wind über die Körper der Beiden.
Was für ein kitschiges Bild, denkt sie. «Ich bin sentimental, auf eine ungute Weise, wie die meisten Frauen«, ätzt sie in sich hinein. »Ich hätte uns malen sollen, großer Unbekannter«, murmelt sie belustigt. Doch sie stockt, denkt an Max. »Du Spannerin! Was machst du eigentlich, wenn ich nicht auf der Insel bin, meine Liebe?« Und er hätte kurz gelacht. Ganz bestimmt hätte Max gelacht. Die Situation war ihr durchgegangen. Punktum. Entstehen so nicht die besten Situationen, fragt sie sich. Sie würden sich ohnehin nie mehr wiedersehen. Ein Zufallsfund! Nora Brendel grient.
Als sie an den Fund denkt, den sie heute am frühen Morgen gemacht hat, wird sie augenblicklich ernst. Sie muss zur Polizei gehen, aber erst würde Laura kommen. Danach, denkt sie, danach gehe ich zur Polizei.
Tagebucheintrag: ”Blinder Fleck 1“
Jede Tat ist eine Insel in der Zeit, definiert durch vier Koordinaten. Drei durch den Ort, an dem sie stattfindet und eine durch den Zeitpunkt des Augenblicks. Jeder Moment, der einer Tat vorausgeht, führt zu Veränderungen ihrer Ursache. Und jede Sekunde, die danach verstreicht, wird ihre Wirksamkeit erneut beweisen. Letztlich ist jeder mit seiner Zeit allein. Auch dies ist Komplizenschaft!
Ein Mord ist eine Tat, die sich in ein schwarzes Loch verwandelt hat, welches immerzu nimmt und nichts mehr zurückgibt – einigen nicht einmal das sprichwörtliche Licht.
Wie kann ich es sagen? Ich bin nicht sicher! Erst waren da Hemmungen in mir. Ich musste sie überwinden. Ein Mord lässt sich, von Ausnahmen abgesehen, nur unter großen Bedenken in das alltägliche Verstehen und Empfinden integrieren. Verstehen Sie? Bedenken Sie bitte, dass es äußere Umstände gab, die ein solches Handeln notwendig machten. Das Handeln?
Erst kommt das Erstens, gefolgt von dem Zweitens, und schließlich bildet das Drittens und dessen weitere Nachfolger einen stimmigen Handlungsrahmen. Handeln tut gut. Es ist rein äußerlich. Du siehst das, was du tust und bist richtiggehend blind vor lauter Sehen ... irgendwann!
Wir alle kennen so etwas. Vielleicht nicht, indem man zwei Menschen tötet. Dennoch gibt es bei jedem von ihnen einen Blinden Fleck.
Es fühlte sich ... also er, der Blinde Fleck, fühlte sich so an, als würde ein Schüler in einem besonders unbeliebten, schwierigen Fach einer Prüfung unterzogen.
In dem aschfahlen Klassenzimmer hängen Reglosigkeit und Totenstille wie bleiche, unbewegliche Tücher über den Schülern.
Der Weg von deinem Pult zur Tafel führt dich durch den Hades. Kein Charon weit und breit, du scheinst nie und nirgendwo anzukommen. Die Tafel verlangt von dir Schriftzeichen oder Ziffern, die in der korrekten Abfolge geschrieben sein wollen. Sagen wir doch, was es ist: Du leistet Blutzoll!
Zwischen Trotz, Ärger, schwärender Wut und später quellendem und hilflosem Hass stehst du da, wie ein Spielball, der sich selber flach hält, damit er nicht völlig unspielbar wird. Es ist ein Vexierspiegel! Ich trage ihn ständig mit mir herum. Und ja: Er plagt mich!
Wissen Sie, bevor ich die große Idee der Gerechtigkeit verteidige, verteidige ich zunächst einmal mich selbst. Es öffnet sich ein Fenster in dir, unvermittelt wie es scheint, und du kannst antworten. Du spürst, dass die Situation leichter wird für dich, und siehst die erstaunten Augen aller in der Klasse. Je einfacher dir die Antworten ins Hirn hinein- und aus dem Mund wieder herausfallen, desto distanzierter bist du diesem kleinen Rest der Welt gegenüber, der sich in dem Gemäuer angesammelt hat. Alles erscheint stimmig. Niemandes Knecht und niemandes Herr.
Nun wissen Sie es! Außerdem sollten Sie wissen, dass Mehrdeutigkeit jeden Interpreten stets zwingt, sich selbst preiszugeben.
Die Wahrheit ist schließlich keine Tugend, sondern eine Leidenschaft. Deshalb ist sie niemals barmherzig. Verstehen Sie ... etwa nicht?
Ich bin nicht bei Jekyll’s & Hyde’s aufgewachsen und auch nicht in einer Familie aus altem, humanistisch fein gebildetem Bürgertum. Nein, so war es nicht! Ohne eigene Schuld ist es anders gekommen, vollständig: geboren, verschoben, verdrängt.
Sie fragen, ob eine humanistische Haltung grundsätzlich vor gar nichts schützt? Ich gebe zu, die Frage ist geeignet, einen in Verzweiflung zu stürzen.
Man sollte große Fragen vermeiden, wenn man bereits ahnt, dass man nur kleine Antworten erhält!
Jeder Mensch hat ein hundertfach aufgezeichnetes Bewegungsmuster. Und jeder neue Tag ist der Versuch einer Rekonstruktion des vorhergegangenen.
Man kann die Welt von einer Art innerem Hochsitz betrachten. Fürwahr. Irgendwann dann waren die beiden reine Beobachtungsobjekte, ohne jeden verbindenden Hintergrund. Es war so leicht.
Ungefähr so fühlte sich mein Blinder Fleck an!
Zweiter Fund
04.06., Donnerstag, 16:10 Uhr, Hiddensee, Polizeistation in Vitte
Nora Brendel steht am Tresen, der sich im Eingangsbereich der Wache befindet. Sie ist alleine. Auf der anderen Seite der Tresens, ungefähr in der Mitte des Raumes, sitzt Haeckermanns junger Kollege, Polizeimeister Jörg Niebel. Er ist der jüngere Bruder des Hafenmeisters, der nach seiner Ausbildung die ersten Dienstjahre auf Rügen verbracht hat. Außer einem Computer und einer Papierablage aus Kunststoff ohne Papierinhalt ist sein Schreibtisch leer. Wie es scheint, wurde auf dem Möbel noch nicht viel gearbeitet, denn es sieht neu aus. Hinter der Frau stehen zwei breite Holzstühle.
Niebel ist alleine auf der Wache. Jörg Niebel ist leicht füllig und untersetzt. Er steht halbherzig von einem verschlissenen Drehstuhl auf und ordnet sorgfältig seine Vokuhila-Frisur, die, was ihr hinteres Ende angeht, vermutlich nicht mit dem theoretisch gewünschten äußeren Erscheinungsbild eines Polizeibeamten in Einklang zu bringen ist. Irgendwie sieht Niebel sieht so aus, als habe er die Uniform nur deshalb angezogen, um endlich Polizist spielen zu können.
Die Frau, mittelgroß, Mitte dreißig, trägt eine sehr tief sitzende Jeans. Vermutlich beult der dunkelblaue Stoff deshalb unter dem kleinen Hintern herum. Oberhalb der Hose ist sie mit einem dünnen Hemd bekleidet, das ein farbenprächtiges Paisleymuster zeigt. Die schlanke Figur darunter kann man nicht nur erahnen. Ihr blondes Haar ist kurz geschnitten. An ihrem linken Haaransatz zeigt sich ein kräftiger, rechtsdrehender Wirbel.
Der junge Beamte geht linkisch zum Tresen und hört zu, was ihm Brendel am Tresen mit einer auffallend hellen und klaren Stimme sagt. Sie spricht akzentuiert, fast so, als würde sie bei Polizeimeister Niebel vorsprechen wollen.
Er unterbricht sie ungelenk, weil er noch nicht ihre Personalien aufgenommen hat.
Als Niebel ihre Daten aufnimmt, stutzt er für einen Augenblick. »Ach, Brendel, aus Hamburg, wie?« Er schreibt und murmelt leise »Nora Brendel.« Sie nickt. Niebel bittet die Frau fortzufahren. So gut er kann, tippt Niebel mit und verschafft sich zusätzlich Luft und etwas Autorität, indem er sagt: »Nu mal nich’ so zügig, bitte. Das will ja alles ordentlich dokumentiert sein.« In den jetzt großzügigeren Pausen protokolliert Niebel das Gehörte in den Computer. Brendel hält kurz inne. »Südwestlich vom ´Schwarzen Peter` gibt es das Waldstück, wo dieses hohe Gras zwischen den Seekiefern wächst.« »Kenn’ ich. Vorm Leuchtfeuer Gellen. Passt irgendwie nicht auf die Insel«, unterbricht Niebel sie mit zuletzt erhobener Stimme.
Sie blickt ihn missbilligend an und fährt fort: »Ich gehe da manchmal entlang, wenn ich von unserem Haus zum Strand will. Nur so. Wir haben ein Haus in Plogshagen.« »Weiß ich doch«, unterbricht sie Niebel erneut, ohne die Brendel anzusehen.
»Ein schöner Kontrast, das Grün, zum hellen Farbton des Sandes und dem Borkenbraun der Seekiefer.«
«Ja, ist gut. Was haben sie an dem Tag dort gemacht?«, will Niebel mürrisch wissen.
»Naja, das Licht war wieder einmal fantastisch. Ich wollte malen und habe meine Sachen zusammen gepackt, um ...«
Der Polizeimeister verdreht die Augen und wiederholt tonlos, so als hätte er den Satz schon hundertmal gesagt: »Das Licht war wieder einmal fantastisch ... und Frau Brendel wollte malen.«
Die Frau berichtet knapp, wie sie beim Verankern der Staffelei diese erst kaum sichtbaren, weißlich hellen Gegenstände liegen sah. »Wie groß war die Fläche, die davon bedeckt war?« »Nicht groß, etwa so groß wie dieser Vorraum hier. Es war nicht viel. Eigentlich leicht zu übersehen. Die Fleischstückchen waren verstreut. Kann sein, dass noch einige unter dem Sand liegen. Es hätte ja sonst was sein können. Wenn da nicht bei einigen ganz deutlich die zahlreichen Fingerringe zu sehen gewesen wären!« Niebel nickt zustimmend. »Und die einzelnen Stücke, wie groß waren die?« »Alle Stücke hatten eine fast gleiche Länge. Warten Sie!«
Sie kramt in ihrer Umhängetasche und befördert ein kleines, weißes Papierpäckchen heraus. Das Päckchen ist sorgfältig verpackt und die zu langen Enden liegen gleichmäßig an. Vorsichtig öffnet Brendel das gefaltete Papier und holt ein fahlfarbenes Segment eines menschlichen Fingers hervor.
»Sehen Sie, als ob man jemand einen Finger in acht bis zehn kleine Stücke geschnitten hätte.«
Der Polizist sieht sie misstrauisch an. »Sie glauben mir nicht? Haben Sie gedacht, ich bringe ihnen keine Proben als Beweismittel mit?« »Nö, so war das nicht gemeint. Aber sie müssen zugeben, dass das schon ein bisschen seltsam klingt. Finger in Ringstückchen geschnitten, bei uns, auf Hiddensee!« »Hier, der Fingernagel ist noch dran, also ist das ein Teil eines Fingers. Und davon liegen an der Stelle viele herum, noch«, sagt Brendel.
Erst jetzt steht Niebel auf, kommt langsam an den Tresen und sieht sich das Fingerstück genauer an. »Oh, Mann! Was ist das denn?« Er wendet sich kurz ab und holt hinter seinem Rücken tief Luft. »Ich habe zunächst nicht genau darauf geachtet, sondern war nur froh, dass ich so ein Ding mit Hilfe zweier Ästchen auf ein Blatt gelegt bekommen habe.« Plötzlich wirft der Polizist Nora Brendel einen grimmigen Blick zu.
»Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie unbefugt die Befundlage an einem Tatort verändert haben?« Er stutzt. »Ach, ist erstmal egal.« Dann setzt er sich wieder an den Schreibtisch.
Niebel schreibt und schreibt. Wenn er innehält, geht sein Blick nach links außen, so als suchte er dort den Punkt seiner Kreativität. Zwischen Sätzen wie: »Habe ich sie da richtig verstanden?» kommen lautmalerisch ein staunendes »Ahaa« ebenso wie ein lakonisches »Jepp, verstehe« vor, bis er fast schon drohend fragt: »Und warum kommen sie erst jetzt damit zur Polizei?«
»Entschuldigung, ich habe sie nicht sofort untersucht. Ebenso gut hätte es gleichmäßig grobe Stücke von irgendeinem Kunststoff sein können. So genau sieht man das erst mal nicht auf dem hellen Sand.«
Sie sagt das beinahe gnädig. »Aber diese Form ist schon eindeutig, auch wegen der Nägel. Ich bin dann gestern noch mal hin gefahren. Ist das nicht gruselig?« Sie zögert kurz und sagt noch: »Herr Polizeimeister Niebel ...«. Sie sieht auf das Namensschild, dass die Uniform des Polizisten auf dessen rechter Brustseite schmückt und spricht die Anrede mit wohlwollendem Unterton aus. »Ja, ja, ist schon gut ...«, murmelte Niebel.
Er legt ihr das fertige Protokoll vor. »Bitte lesen und unterschreiben sie ihre Aussage. Halten sie sich bitte zu unserer Verfügung.« »Das wird nicht möglich sein, ich verreise mit meinem Mann bis Dienstag kommender Woche. Dann können sie wieder ganz über mich verfügen. Ich lebe hier sowieso die meiste Zeit des Jahres. Aber das wissen sie doch längst!«
Sie lacht und streckt ihren rechten Arm zur Verabschiedung über den Tresen. Niebel sieht den Arm, versucht aus der sitzenden Position die Hand zu erreichen, merkt aber schnell, dass das nicht geht.
Der junge Polizist steht auf und bewegt sich leicht hüftsteif auf den Tresen zu, ergreift die ihm angebotene gepflegte weibliche Hand, lässt seine eigene Hand wieder rasch sinken, geradeso als hätte er etwas Unanständiges getan.
Nora Brendel lacht erneut und wünscht Polizeimeister Jörg Niebel einen schönen Tag.
Laura Domin 1)
Ohne Details zu nennen: Einige haben es nicht geschafft. Diese spröden Naturgesetze ...
Das Ganze ist dennoch gut ausgegangen, jedenfalls was mich angeht.
Alles hat eine Ursache? Eine Äußerung zum Vergessen!
Eine verhängnisvoll vage Macht erzeugt ein ungutes Gefühl. Und schwer zu fassende Wahrheiten tanzen um einen herum, um irgendwann blanke Gewissheit zu werden. So ist es eben. Selbst die größten Rationalisten werden gelegentlich von einem Sinnrauschen erfasst. Oder ist es eher sinnlose Mystik? Interessant; für Psychologen; also interessant für mich.
Alles hat eine Ursache! Wer wollte widersprechen?
Da ist ein vielschichtiges physikalisches Raunen und ein zehrender philosophischer Grundton. Und dieses durch nichts zu erhellende Denkmodell, dessen Widerhall zur mentalen und kühlen Anstrengung gemahnt. Achtung: Rotkäppchen geht durch den Wald!
Was bedeutet ´Alles`? Wann ist oder hat etwas eine ´Ur/Sache`? Und schon bewegen wir uns auf den Gipfeln existenzieller Verdunklung und blicken ins Bodenlose!
Ich sollte Nora Brendel fragen. Sie kennt sich damit, ganz praktisch betrachtet, besser aus.
Alles, was ist, entspringt einer Vorgängersituation. Es ist das unmissverständliche Ineinandergreifen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu jenem Zeitpunkt, in dem das Aufeinandertreffen und der Abschied gleich und gleichzeitig sind. Noch so ein Naturgesetz. Andere würden es Zufall nennen.
Der Vorstand von „Vitacell“ hat sich mir wie eine Asymptote für den weiteren Verlauf angeboten.
*
Aber ich will den Bogen nicht überspannen, sondern nur sagen, dass ich mich mit meinen grauen Augen in jedem Spiegel gut ansehen kann. Mein kurzer Garçonschnitt zeigt zwischen den sonst dunklen bereits einige silberne Haare, dick wie dünner Draht. Zusammen mit meinem Jungenmädchengesicht und einer zierlichen Figur ergibt das eine Mischung, die alberne Besitzerinstinkte bei Männern weckt und mich Frauen gegenüber sympathisch macht. So ist es.
Manche reagieren irritiert. Weil meine äußere Erscheinung nicht zu meinem Verhalten passt?
Sicher ist: Das ist mein innerer Hochsitz und das ist mein Vergnügen!
*
Kleine Schritte, von Aggressivität genährte Geduld und kurzfristig erreichbare Ziele. Konsequent und kühl den Blick auf das nächste Etappenziel gerichtet.
Domin sah das Große und das Ganze, die Systeme, in denen sie selbst vorkam. Kein Blitzschach. Weibliches Denken und Handeln? Sie legte keinen Wert auf solche Kategorien. Die Dinge ergaben sich oft von ganz alleine.
Kurz nachdem sie ihr von der Universität Konstanz verliehenes Diplom in der Hand hielt, hatte sie sich bei „Vitacell“ beworben. Das Unternehmen suchte eine Assistentin für die Geschäftsführung. Sie hatte recherchiert: ”Vitacell“ besaß in der internationalen Forschung einen guten Ruf, war relevant für die Biotechnologie und genau deshalb einflussreich. Eine attraktive Mischung.
An ihrem Vorstellungsgespräch nahmen drei Mitglieder des Vorstands teil:
Britta Zielke, Dr. Matthias Bader und Dr. Max Brendel.
Die drei hatten sich nur mit ihren Namen vorgestellt. Von Dr. Bader erhielt sie die Information, dass sie dem Vorstand angehörten. Keinen Hinweis auf Aufgabenschwerpunkte oder Hierarchie. Laura Domin grinste in sich hinein. Nicht, dass sie diese Situation auf die leichte Schulter nehmen wollte. Aber so ein Hauch von Assessment hätte was gehabt. Bei dem Gehalt den inneren Schweinehund überwinden. Wie ein leichtes Prickeln vor heraufziehender Gefahr, ohne echte Angst. Das hier würde berechenbar sein. Gefahrlos.
*
Schnell verstand Domin, dass Zielke die Vorsitzende des Vorstandes war und eine persönliche Assistentin suchte. Bader und Brendel waren eine Art männlicher Letztkontrolle.
Domin sah intuitiv, dass es in diesem Vorstand sandig knirschte. Flugsand wäre kalkulierbar, Treibsand dagegen nicht. Ob Geröll im Spiel war, konnte sie noch nicht beurteilen.
Sie beschloss kühl, dass es ihr relativ egal sein konnte, was mit den dreien war. Der Entschluss fühlte sich an wie ein Reißverschluss; ziep und zu. Sie bekam den Job. Das gefiel Laura Domin. Bader gefiel ihre Weiblichkeit und Verbindlichkeit, Brendel ihr klares Selbstkonzept und ihre Zielstrebigkeit.
Zielke war von so ziemlich allem angetan, was diese junge Frau anging. Auch das gefiel Domin.
*
Nach einer kurzen Einarbeitungszeit stellte Domin fest, dass Zielke sie für anspruchsvollere Aufgaben vorbereiten wollte. Sie ließ sich bereitwillig dafür gewinnen und entwickelte sich im Gegenzug rasch zu einer Vertrauten Zielkes. Den anderen Vorstandsmitgliedern gegenüber verhielt sie sich neutral und loyal. Weniger bedeutsame und kleinteilige Arbeiten delegierte sie ab einem frühen Zeitpunkt selber. Es gab Sachbearbeiter, die sich an wiederkehrenden Aufgaben abarbeiten konnten.
Dagegen wusste Monika Strittmatter nicht, was sie von Domin und der neuen Situation halten sollte. Freiheiten dieser Art und soviel Aufmerksamkeit waren ihr, seit sie vor drei Jahren für ”Vitacell“ zu arbeiten begonnen hatte, noch nicht entgegengebracht worden. Als persönliche Referentin von Dr. Brendel stand sie Domin doch in nichts nach.
Die Domin hatte was, das musste sie zugeben. Im Grunde hätte sie besser zu Max Brendel gepasst. Der war auch so eine kühle Intelligenzbestie. Aber Dr. Brendel war in Ordnung. Die Zielke hatte dagegen etwas Unberechenbares; auf Dauer unangenehm. Latente Zicke.
Ihr Chef und Zielke lieferten sich gelegentlich kleine Scharmützel. Dann lästerte Brendel in ihrer Gegenwart über Zielke. Für Strittmatter war das ein Zeichen von Vertrauen und schuf Nähe. Über Domin sagte er nie etwas.
*
Domin bereitete Geschäftssitzungen, wissenschaftliche Tagungen und Veranstaltungen mit einem politischen Hintergrund vor.
In der Politik lägen die Schnittstellen, welche die gesellschaftliche Tragweite und unternehmerische Philosophie von ”Vitacell“ auf Kurs halten sollten, hatte Max Brendel gesagt.
Sie hatten es häufig mit Politikern zu tun. Deren Hintergründe und Interessen jenseits dessen ausloten, was medial und für die Öffentlichkeit sichtbar war, das Persönliche, auch das musste sein.
In einer Mittagspause saß sie zusammen mit Zielke, Bader, Brendel und Strittmatter in der Kantine des Unternehmens. »Wirf einen Stein ins Wasser,« sagte Bader, »und du wirst sehen, dass sich die Menschen nur mit den Wellen beschäftigen, die der Stein an der Oberfläche erzeugt. Wer den Stein geworfen hat, interessiert nur wenige, nach dem Warum fragt kaum jemand. Woher der Stein stammt, interessiert dann schon keinen mehr.
Menschen und Reduktionismus sind zwei Variable der selben Gleichung.«
»Absolut, lieber Matthias.«, erwiderte Dr. Brendel. Sein Ton hatte etwas süffisantes. »Wenn man das weiß, und wenn man sich diesem Wissen entsprechend verhält, mögen einen die Menschen sogar, denn du bist nicht mehr gezwungen, wie alle anderen den Motiven deiner Mitmenschen hinterher zu jagen, um einen kleinen Vorteil für dich zu erhaschen. Du lässt anderen Menschen den Vortritt, wenn auch nur scheinbar. Du wirkst entspannter, und das spüren die Menschen. Seht, sagen sie, da ist jemand, der einem nichts Böses will. Der ist vielleicht nur etwas ehrgeiziger als der Durchschnitt oder er hat es einfach drauf.«
»Wenn sie erst spüren, dass man ihnen etwas Böses will, haben alle verloren«, sagte Zielke.
Domin hatte den Eindruck, als würde sich ihre Vorgesetzte mit diesem Satz beeilt haben.
Aufmunternd sah sie jeden einzeln an: »Aber wer bei „Vitacell“ will schon etwas Böses?“
Zielke sah sie erstaunt an. Strittmatter sagte besorgt: »Wir sind doch die Guten ...«
Die Balance unmerklich zu eigenen Gunsten verschieben, dachte sich Domin und lächelte in die Runde. Darum ging es. Und es machte verdammt viel Spaß!
*
Domin organisierte Gespräche mit ”Belbor“ dem belgischen Prüflabor in Leuven. Ging es um Investoren, internationale Rechte oder Patente, flog sie nach Baltimore, dem Sitz von ”Gerontic Corporation“.
Meistens flog sie mit Dr. Bader, ein in Baltimore gern gesehener Gast, denn der Wirtschaftsingenieur warf einen technischen Blick auf das Geschehen.
Für ”Gerontic“ war der Elsässer schlicht der ´Deutsche`. Dr. Bader war der Mann, der die Produkte und deren Entwicklung besser als alle anderen bei ”Vitacell“ kannte. Er konnte ´angedachte` Produkte mit einem schlüssigen Konzept umreißen und kurzfristig auf den Tisch legen. Deshalb war er für die Produktentwicklung zuständig.
Bader und Domin ergänzten sich gut. Beide pflegten das Motto: sich einsetzen, umsetzen, durchsetzen. Keine Verluste!
Zielke beschloss, sie nach einigen Monaten ins kalte Wasser zu werfen. Domin sollte den Leiter des Afrikageschäftes treffen. Nicht nur Zielke, sondern der gesamte Vorstand kritisierte die Vorgänge in Togo.
Lieferungen nach Leuven oder Abmachungen mit lokalen Vertretern wurden willkürlich gehandhabt. Dokumentationen waren lückenhaft oder kamen gar nicht erst vor. Das führte zu erheblichen Auseinandersetzungen mit dem belgischen Zoll. Wie der togolesische Zoll reagierte, blieb undurchsichtig. Als sei dies nicht genug wurden statt des Blutes mitunter ganze Nabelschnüre geschickt.
Weshalb eigentlich hatte ”Vitacell“ dort unten ein gutes Labor eingerichtet? Diese Wahnsinnigen. Zielke war wütend!
Das Fehlverhalten der Geschäftsführung in Lomé rechtfertigte die aufwändige Beschaffung von Nabelschnurblut in keiner Weise.
Sarkastische Belustigung lösten in Hamburg die beinahe wie absichtlich schlampig gemachten Tabellen aus, die Professor Wouters aus Leuven weiterleitete. Neben einem Begleitschreiben, das offenbar zwischen der sprichwörtlichen Tür und Angel geschrieben sein musste, waren die Tabellen nichts anderes als eine mehrseitige Liste, auf denen die Spender mit Namen, Wohnort und dem Datum der Spende verzeichnet waren.
Die Unterschrift irgendeines Menschen in Togo stand stempellos am Ende der Tabelle. Wer hatte unterschrieben und gab es Mittelsmänner, die an diesem Geschäft mitverdienten?
Und kein Wort darüber, wie man an die Spenden gekommen war, ob und wie viel Geld den Spendern übergeben wurde. Nach welchen Gesichtspunkten wurden die Spender ausgesucht? Gab es Beschwerden oder Probleme seitens der Spender? Wurden offizielle togolesische Stellen aufmerksam und verfolgten das ´koloniale Geschäft`?
*
Zielke besprach sich mit Laura Domin vor jeder Reise.
Für ihre Aufgaben erhielt Domin genug Spielraum, um in den Verhandlungen und den Kontrolluntersuchungen bestehen zu können.
Es galt das Wichtige vom Unwichtigen, die Finte vom Realgeschehen unterscheiden zu können. Nur dieses Können sorgte für den entscheidenden Unterschied und sicherte Einfluss.
Doch Domin hatte eigene Vorstellungen. Wenn sie auf ihrem inneren Hochsitz saß, konnte sie abwarten, wie sich die Dinge entwickelten. Ja, tatsächlich: Die Dinge ergaben sich von alleine!
Dr. Bader denkt, ...
Einmal im Monat konnte jedes Vorstandsmitglied jeweils eine Stunde Ideen und fertige Konzepte vortragen. Spaßeshalber wurde diese Stunde ´Lauschangriff` genannt.
Bei einem dieser ´Lauschangriffe` berichtete Bader über eine neue Generation von Bioreaktoren und den erstmalig eingesetzten Gewebedruckern.
Mit Hilfe dieser Technik könnten sich hocheffizient embryonale Stammzellen auf eigens dafür konstruierten menschlichen Prothesen ansiedeln und vermehren, um später zu einem leistungsfähigen Teil des menschlichen Körpers werden. Die regenerativen Fähigkeiten solcher Zellen würden für die Züchtung genutzt, was man als eine Art Starthilfe verstehen könnte, sagte Bader und wirkte zuversichtlich. Allerdings hätten diese Prothesen noch die Eigenschaft, sehr sensibel zu reagieren.
Das langfristige Ziel dieser Forschung wäre es jedenfalls nicht, komplette Organe zu züchten und zu transplantieren, sondern diese Organe mit einem Trägersystem in den Körper zu bringen, wo sich das Material des Trägersystems nach und nach auflöst und das Organ, wie eine Pflanze, auf zellulärer Ebene Wurzeln schlagen würde.
Dazu müsste sich das künstliche Gewebe im Körper wie körpereigenes Gewebe verhalten. Matthias Bader wirkte wie ein Trainer vor dem Endspiel.
Max Brendel nahm die Informationen dankbar an. »Wir steuern die Vermehrung der Stammzellen nicht nur progressiv, sondern stoppen sie gezielt ab. Therapeutisches Klonen treiben wir voran. Wir müssen uns deswegen zusammensetzen, Matthias.«
»Achtung, meine Herren, wir müssen sehen« schob Zielke behutsam nach, »dass wir nicht in das Fegefeuer der Falschinformation geraten. Therapeutisches Klonen als neues Geschäftsfeld in Angriff nehmen ist gut und schön. Wir müssen allerdings aufpassen, dass wir in der Öffentlichkeit nicht das Bild eines Unterrnehmens abliefern, das klammheimlich die Grenze zum reproduktives Klonen gerissen hat. Dr. Bader, sind sie da nicht ein bisschen zu schnell?«
Bader konterte trocken, er sei eher zu langsam, »weil sich über einen Umprogrammierungsschritt eines bestimmten Proteins in Hautzellen schon jetzt saubere Blutzellen herstellen lassen. Beispielsweise für Menschen mit Leukämie eine Art Wunderheilung, die aber schon wissenschaftliche Praxis ist. ”Vitacell“ muss seine Vorreiterrolle behalten. Wir müssen! Ich sage das ausdrücklich. Der gesamte Markt erlebt derzeit eine ungeheure Dynamik und werthaltige Kreativität.«
An Brendel gewandt meinte er, dass eine Wahlfreiheit der ´Verbraucher` spätestens nach der gesellschaftlichen und politischen Akzeptanz zum Erliegen käme. Denkbar wäre eine umlagefinanzierte Monopolisierung. Man könnte dann für alle Bürger die jeweiligen Leistungen erbringen, abgestuft natürlich.
*
Außer Zielke und Brendel waren jetzt nur noch Strittmatter und Domin im Sitzungsraum. Gül, Florin und Bader waren als erste durch die Türe.
Plötzlich tauchte Matthias Bader auf. Erst erschien nur sein Kopf im Türrahmen, wie verlegen in den Raum hineinblickend, dann der ganze Mensch. »Hallo, ich war nur kurz auf der Toilette«, sagte er neutral in die Runde.
Das stimmte nicht ganz, denn er war schon eher von seinem Gang zur Toilette zurückgekehrt und hatte einige Sekunden in direkter Nähe der Tür auf dem Flur gestanden. Dabei hatte er gehört, was Zielke zu Brendel über ihn gesprochen hatte. Bader konnte es nicht verstehen, aber beide hatten darüber gelacht. Er wusste nicht, ob er sich darüber ärgern sollte.
Ihn irritierte, dass es eine der raren Situationen war, in denen Zielke und Brendel miteinander vertraulich und entspannt umgingen. »Bis morgen«, sagte Bader mit gehobener Stimme. Die anderen schauten ihn an, nickten erst schweigend und antworteten dann versetzt: »Bis morgen.«
*
Bader verließ das Gebäude über den Haupteingang und ging über das Außengelände in die Tiefgarage.
»Gerade die Beiden!« Ob sie jetzt auf Bündnispartner machten? Bader rang sich ein schiefes Lächeln ab. Ohne den Motor zu starten, schob er den dicken Schlüssel in den Schacht und wartete. Er saß einfach nur in der Hülle seines italienischen GT. Nach fünf Minuten ging die Garagenbeleuchtung aus.
Die plötzliche Dunkelheit schockierte ihn im ersten Moment. Ein stimmloser Laut war seine einzige Reaktion. Er hatte einfach nicht daran gedacht, dass das Licht ausgehen würde. Hinzu kam die Stille. Mit seinem Sportwagen bildete Bader jetzt eine Einheit, die von dem kontemplativen Schwarz verschluckt wurde.
Sollen sie doch, sagte er sich. Der Gedanke löste seine innere Starre.
»Ich entwerfe die wichtigen Linien, ich bin derjenige, der die politische Entwicklung und die Zukunft sieht. Max ... wir könnten vieles schaffen. Aber manchmal lavierst auch du.«
Für einen Moment herrschte grimmige Ruhe in seinem Kopf. Er dachte nach.
Ließen sich pluripotente Zellen klonen und würden sie sich wie embryonale Stammzellen verhalten? Ließen sich die Zelllinien organismisch zu einem in sich geordnet und gegenseitig beeinflussenden und dabei auch noch selbst regulierenden Cluster anlegen, so, dass daraus neue Lebewesen entstehen konnten?
Er fingerte in der Mittelkonsole und schob sich ein Ingwerbonbon in den Mund. Das Innenlicht hatte er nicht eingeschaltet. Bader winkelte die Beine an. Seine Finger lagen auf dem unteren Rand des Lenkrads. Angestrengt blickte er in das Dunkel hinein. Die Konturen der Pfeiler konnte er nicht ausmachen. Es gab keinerlei Lichtreflexe. Es gelang ihm noch nicht einmal, die lange Motorhaube seines Fahrzeugs zu sehen.
Zellkerntransfer, biochemische Behandlung des Kerns, genetische Manipulation von Blastozysten. Das ganze Programm bis hin zu Bioreaktoren, die eine ausgezeichnete Kontrolle der Stellvertreter ermöglichten.
Zwar vertrat Bader die Meinung, dass allen Formen menschlichen Lebens eine qualitativ andere Achtung zuerkannt werden sollte als sonstigen Entitäten, die sonst auch für schützenswert gehalten wurden.
Trotzdem war diese Gattungssolidarität in seinen Augen ein Anachronismus. Vor allen Dingen missbilligte er die für ihn traurige Unterscheidung zwischen menschlichem Wesen und menschlichem Leben. Stattdessen fand Bader zunehmend Gefallen an den Ideen des Transhumanismus.
Warum sollte es keine geklonten Menschen geben, wenn die Technik schon jetzt zur Verfügung stand und beherrschbar wäre. Was den Menschenklonen jedoch fehlte, war der Schleier des ´Nichtwissens`. Sie könnten so gut wie alles über sich in Erfahrung bringen und wüssten etwa, dass drei nahe Blutsverwandte um die Vierzig herum an Leukämie gestorben wären, während alle anderen hochbetagt starben. Wie also sollte ein Menschenklon angesichts dieses Wissens sein Leben ausrichten? Ein erheblicher Mangel an Freiheit wäre das.
Was für ein Vorwurf! Wir alle haben Prädispositionen, nur kennen wir sie nicht. Ein Vorteil für die Klone, dachte Bader.
Bader erschrak. Sein Smartphone summte. Er sah auf den Bordmonitor und überlegte kurz. Dann drückte er den Anrufer weg. Es war Zielke. Bader schüttelte sich leicht, streckte die Beine aus und legte die rechte Hand lässig auf den Beifahrersitz.
Eingriffe in die Evolution wären keineswegs mehr bloße Utopie. Leben 3.0: Angesiedelt zwischen einem animalisierten Hominiden und humanen Primaten.
Er überlegte, ob er Brendel mit zu den ´Denkwerkstätten` mitnehmen sollte. Trotz allem kam der ihm offener vor als die anderen. Und Brendel hörte ihm gerne bei seinen Ausführungen zu. Bei ihm hatte Bader das Gefühl, auch persönlich anzukommen.
Gül hielt er für ungeeignet. Er war ein Kaufmann. Sesselpupser, nett, kompetent, aber ein Sesselpupser. Und Florin? Was war das für einer? Florin wirkte unbestimmt, wie bei dem Thema heute kurz vor der Pause. Es ging um das Afrikageschäft. War Florin für oder gegen die Schließung in Togo?
Sollte die Domin doch Nachforschungen anstellen und diesem McLellan die Fingerkuppen quetschen. Sie war energisch und würde schon Informationen einholen. Dieses Afrikageschäft stieß ihn ebenso ab wie der Kontinent samt seiner Menschen. Er wäre eben ein bisschen rassistisch, hatte er im Vorstand geäußert.
»Es ist die Art von Rassismus, die in Schulbüchern vorkommt. Subtil, nur selten offen und mit wenig sympathischen, Exotik verbreitenden Fotos aufgebrezelt«, hatte er Brendel und Zielke gegenüber offen eingeräumt.
Florin muss in irgendetwas verstrickt sein, das spürte Dr. Bader. Und Hagen Florin kümmerte sich um den Einkauf. Der behauptete, er könnte sich auf die Vorgänge in Lomé keinen Reim machen. Wie konnte das sein? Jemand musste die Geschäftsstelle in Lomé von Hamburg aus eingerichtet haben!
Domin musste nach Lomé fliegen. Florin und Domin. Sie sollten dem Leiter auf die Fingernägel schauen und diese notfalls schmerzhaft ziehen.
Lomé war für „Vitacell“ der Sammelplatz für Nabelschnurblut, das in den Krankenhäusern westafrikanischer Staaten gewonnen wurden.
»Wir düngen und ernten!«, lautete die Devise des Leiters in Lomé. Aussagen dieser Art empfand Zielke nicht nur als stillos, in ihrer unverhohlenen Arroganz fügten sie ”Vitacell“ auch Schaden zu.
Was, wenn irgendein Pressevertreter dieses Motto in Lomé aufschnappen würde? Die Verbindung zu ”Vitacell“ konnte jeder Journalist herstellen. So legte man eine Spur aus.
Bald würde das ein Ende haben. Beinahe angewidert stellte sich Bader Nabelschnüre vor, wie ihnen das Blut entnommen wurde und ... »Was für eine Sauerei!«, sagte er leise. Die iPS-Zellen würden alles revolutionieren. Unaufhaltsam!
Dann drückte er den Startknopf, der Achtzylinder erwachte zum Leben. Die Bewegungsmelder registrierten die Bewegung des Autos und das Licht ging an.
McLellan 1
Liam McLellan war Mediziner, den es von seinem äußerst angenehmen Arbeitsplatz in einem Krankenhaus in der kanadischen Provinz Saskatchewan nach Westafrika verschlagen hatte. Dort tingelte er eine Weile herum, verdingte sich als Arzt in verschiedenen Pflegestationen auf dem Land oder Krankenhäusern in Provinzhauptstädten. In Lomé erhielt er schließlich eine Festanstellung in der International Clinic Saint Joseph. Die Klinik lag direkt am Flughafen der togolesischen Hauptstadt.
Die Arbeit war in Ordnung. Es gab einige Deutsche beim medizinischen Fachpersonal, sodass er neben Französisch noch Deutsch lernte. Dass er es nicht lange aushielt, lag vor allen Dingen an der Bezahlung, die ihm, nach seinen Maßstäben, kaum für seinen Lebensunterhalt ausreichte.
Er kündigte quasi über Nacht und zog von Lomé aus nach Lagos. Die chaotische Riesenstadt gefiel ihm. Hier konnte er vielfältige Kontakte herstellen und unauffällige Geschäfte machen. Er besorgte sich abgelaufene Medikamente, etikettierte sie um und verkaufte sie an Apotheken, Zwischenhändler oder direkt auf der Straße, wenn sich ihm eine rasche Gelegenheit bot. Die Käufer glaubten ihm , weil er mit einer Art Expertise diese Medikamente verkaufte. Schließlich war er Arzt!
*
McLellan hatte Kanada verlassen, um einem Gerichtsverfahren zu entgehen. Der Zweiundvierzigjährige war als Oberarzt am Krebszentrum des Royal University Hospital in der Provinzhauptstadt Saskatoon tätig. Nach einigen Jahren bekam der bis dahin mustergültige Mediziner Probleme mit dem Alkohol. Warum, das wusste niemand in den internen Anhörungen und später vor Gericht zu sagen. Irgendetwas musste seine Lebensachse verschoben haben.
Er war Anästhesist. Beim ersten Mal konnte die Patientin, ein dreizehnjähriges Mädchen, noch gerettet werden. McLellan hatte wohl die Narkosezutaten mit den Cocktailmischungen vom gestrigen langen Abend verwechselt.
McLellan fiel auf, weil er verhaltensauffällig wurde. Als Mediziner und allgemein als Mensch, er wurde fahrig, engstirnig, bis an die Schmerzgrenze präzise und mitunter ausfallend. Innerhalb eines halben Jahres versagte er bei gleich vier Eingriffen. Zwei davon mit Todesfolge. Ein Rapport fand statt. Noch bevor er seine Entlassungspapiere erhielt, erstattete die Klinikleitung Strafanzeige gegen McLellan. Das Verfahren gegen ihn wurde zügig eröffnet.
Der Sachverhalt in den fraglichen Fällen war komplex und nicht immer klar nachvollziehbar. Nach seiner Anhörung blieben Zweifel, und die Gutachter kamen zu verschiedenen Schlussfolgerungen. Aufgrund der Beweissituation sprach ihn das Gericht nach fünf Verhandlungstagen schuldig. McLellan erhielt eine fünfjährige Freiheitsstrafe auf Bewährung, und ihm wurde seine ärztliche Approbation aberkannt. Zusätzlich erlegte das Gericht ihm auf, dass er das Royal University Hospital zeitlebens nicht mehr betreten durfte.
Liam McLellan blieb arbeitslos, mischte sich billige Cocktails und verkam allmählich. Hatte er in seiner Zeit als Oberarzt noch in ´The Willows` gelebt, einer geschlossenen Sicherheitswohnanlage für Wohlhabende, musste er sich jetzt mit einem möblierten Zimmer in der Nähe des Bahnhofs begnügen, dessen Wände ebenso dünnhäutig war wie er.
Eines Morgens wurde er wach und fühlte, dass sich sein Leben ab heute ändern würde.
Er rasierte sich, duschte ausgiebig. Nachdem er sich gründlich abgetrocknet hatte, fuhr er mit gespreizten Fingern durch das noch feuchte, dunkelbraune Haar. Die Nervenenden an seinen Fingerkuppen bemerkten das lichter gewordene Haar am Hinterkopf. Er betrachtete seinen hoch gewachsenen und eher schmalen als schlanken Körper und sah in sein ebenfalls schmales Gesicht, das für einen Angelsachsen einen eher dunklen Teint hatte. Ob seine Vorfahren Cree gewesen wären, hatten ihn die Kollegen gefragt.
McLellan aß einen Apfel, trank einen guten halben Liter Wasser, aß methodisch einen weiteren Apfel und putzte sich anschließend die Zähne.
Während er sich anzog, setzte sich ein zufriedenes Lächeln um die argillitgrauen Augen fest. Er wohnte ebenerdig. McLellan stand am Fenster und beobachtete den dichten Autoverkehr. Dichtgedrängt gingen Menschen direkt an seinem Fenster vorbei.
McLellan öffnete seine Wohnungstüre und blickte hinaus auf den Flur, geradeso, als wollte er sich vergewissern, dass niemand sonst sich dort aufhält.
Auf der Türschwelle drehte er sich um exakt einhundertachtzig Grad, machte eine fußlange Bewegung nach hinten und stand jetzt mit dem Rücken zum Flur.
Abrupt wandte er sich der Haustüre zu und ging mit einem weichen Taumel durch den Hausflur, während sich hinter ihm die Wohnungstüre der Hausverwalterin öffnete.
McLellan drehte sich um seine Körperachse, lehnte sich, als glaubte er umzufallen, mit der linken Schulter spitz gegen die Wand und wünschte der Hausverwalterin einen schönen Tag.
Er hob die Mundwinkel an und musste beinahe über sich selbst lachen, weil ihm seine Stimme vorkam, als wäre sie in einem Tonstudio bearbeitet worden - gedehnt und mit einer unnatürlichen Tiefe ausgestattet. Zudem verspürte er eine unbekannte Innerlichkeit seiner Bewegungen, die er wie stark verlangsamt empfand.
McLellan drehte sich erneut in Richtung Haustüre und ging mit kleinen Schritten voran, während er hörte, wie sich hinter ihm die Türe wieder schloss. Er machte zwei weitere kleine Schritte, wartete einen Augenblick, machte kehrt und ging dann zur Tür der Hausverwalterin.
Er klopfte höflich, genau dreimal. Die Sekunden verstrichen. Fast wäre er gegangen, nach draußen, um sich wie sonst treiben zu lassen. Jetzt wurde die Türe geöffnet.
Die Frau war Ende Dreißig. Sie hatte dieses Indianerwettergesicht, mit dem sie den Mann erst missbilligend und dann erstaunt ansah. Es war still im Haus.
Ohne einen Ton von sich zu geben schlug Liam McLellan zu. Immer wieder, nur mit seinen Fäusten. Nach wenigen Minuten schob er die tote Hausverwalterin in ihre Wohnung und machte von außen die Tür zu.
*
Als Liam McLellan von Lomé nach Lagos zog, machte er vielfältige Bekanntschaften, die ihm jedoch allesamt nicht zusagten. Weder machte er genügend Geld, noch konnte er Zutrauen zu irgendjemandem fassen. Auch in Lagos trieb er sich herum, besser gesagt, er wurde getrieben. Er verließ die Stadt und durchstreifte das Land. In Kano, einer Großstadt im Norden Nigerias, traf er Allen Baxter-Jones.
Es war der 10. Juni 1996. In einer Sportbar wurde überraschender Weise das vierte und vermutlich letzte Play-off-Spiel um den Stanley-Cup übertragen.
Baxter-Jones saß am Tresen und schaute sich das Spiel an. McLellan, der sich nach einem Bier verzehrte, steuerte zielstrebig auf den Tresen zu, bestellte ein großes Bier und hörte, gerade als er das Glas ansetzen wollte, wie Baxter-Jones wild aufjaulte. McLellan drehte sich jählings herum. Mit dem Ellbogen stieß er heftig an Baxter-Jones Bierglas, das mit einem hellen Klirren auf dem Steinboden zersprang. Baxter-Jones guckte McLellan entgeistert an. Beinahe hätte er wieder aufgejault. Doch mit einer Kopfbewegung zum Wirt hin hatte McLellan bereits ein neues Bier bestellt. »Wer spielt?«, wollte McLellan wissen. »Colorado Avalanches gegen Florida Panthers«, knurrte Baxter-Jones, ohne McLellan anzusehen. Der Wirt kam mit einer Art Besen und kehrte die Glasreste und das verschüttete Bier unter einen der Tische. Dabei sah er gelegentlich nach draußen auf die Straße, wo sich ein Stau gebildet hatte und die Autofahrer wütend hupten, weil ein Lieferwagen die rechte Fahrspur komplett versperrte.
Dann ging er hinter den Tresen zurück und kramte eine alte Zeitung hervor. Mit dem Besen und der Zeitung bewaffnet ging er zu dem Scherbenhäufchen zurück, legte die Zeitung auf den Boden, straffte mit der einen Hand ein Zeitungsende und kehrte mit der anderen die mit Bierresten vermischten Glasscherben andächtig auf das Zeitungspapier.
»Und, zu wem halten sie«, fragte McLellan, während er ein zweites Bier für sich bestellte. »Panthers! Wen denn sonst«, knurrte Baxter-Jones vorwurfsvoll. »Danke für das Bier.« Er nahm einen großen Schluck. »Nichts mit Eishockey am Hut?« »Könnte man sagen, obwohl ich Kanadier bin.« »Das glaube ich einfach nicht. Sie sind Kanadier und haben nichts für Eishockey übrig. Mann, hier geht’s um den Stanley-Cup!
Sie sind vielleicht ein Vogel Entschuldigung, wenn ich das so frei sage. Noch ein Bier?«, fragte Baxter-Jones mit einem Lächeln und riss die Augen clownesk auf. McLellan nickte lächelnd. Sein Glas war fast schon wieder leer.
Die Männer stellten sich einander vor. »Sachen gibt’s!«, unkte Baxter-Jones. »Was hat sie denn in den Norden Nigerias verschlagen, wenn ich fragen darf? Vielleicht Entwicklungshelfer oder Langzeitweltreisender? Hier laufen viele Weiße rum, die vor irgendwas weglaufen oder sich einen Heiligenschein aufgesetzt haben. Nicht gerade in Kano, aber in Nigeria insgesamt. Kano ist noch sehr nigerianisch.«
McLellan stutzte. Er hatte hier kaum Weiße gesehen. »Na ja, Urlaub mache ich hier nicht gerade. Ich bin also.« Er stellte einen Fuß auf den Boden und sah Baxter-Jones mit sachlichem Blick an. »Die Arbeit in einem Krankenhaus oder einer medizinischen Forschungseinrichtung in der so genannten entwickelten Welt ist was feines und vor allen Dingen sicheres. Aber es wird irgendwann auch Routine und langweilig. »Baxter-Jones sah McLellan erstaunt an. »Sicher, ein Luxusproblem. Dennoch wollte und musste etwas anderes machen. Statt in den Westen Afrikas hätte ich genauso gut nach Südamerika gehen können. Eigentlich wollte ich runter nach Chile.«
Er nahm sein Bierglas und trank den Rest. Baxter-Jones machte mit den Fingern ein Victoryzeichen. Kurz darauf hatten die Männer ein frisches Bier vor sich stehen.
McLellan erzählte dieses und jenes. Baxter-Jones feixte, denn er schaute sich weiterhin das Spiel an.
Einmal heulte er wie ein Laienschauspieler in der Rolle eines Wolfes auf. Der Wirt lachte. Die Tampas hatten den Puck ins Tor des Gegners gestochert, doch der Treffer wurde nicht gegeben, weil das Tor sich aus seiner Verankerung im Eis gelöst hatte.
Unterdessen beobachtete McLellan, wie Baxter-Jones ihn trotz des Spiels regelrecht fixierte, geradeso, als könne er die Pointe nicht abwarten. McLellan’s Selbstdarstellung endete schließlich in dem langen Satz: » Keine Frage, Vancouver ist eine der schönsten Städte. Die Arbeit bei ”Primalcord Cryo“ war sehr interessant und wurde gut bezahlt. Schade eigentlich. Aber das Unternehmen bekam zunehmend Probleme mit religiösen Gruppierungen. Die ständigen Demonstrationen vor dem Gebäude brachten erst die Polizei und anschließend Untersuchungen auf den Plan. Gesundheitsbehörde, Staatsanwaltschaft, das volle Programm.
Von massivem Betrug die Rede, ”Primalcord Cryo“ hätte den werdenden Eltern vertraglich zugesichert, weiter alle originären Rechte behalten zu können, wenn sie ihr Nabelschnurblut zur Verfügung stellen würden.
”Primalcord Cryo“ hatte, natürlich nicht offiziell, stabile Kontakte zu einigen Krankenhäusern im Großraum Vancouver. Wenn man so will, also an der gesamten Westküste Kanadas. Die werdenden Eltern wurden über die Chancen der Heilungsmethoden informiert. Im Grunde wurde nichts anderes als ein Klima des schlechten Gewissens erzeugt. In dieser Atmosphäre wurde ihnen eingeredet, dass ihre Nachkommen es doch wohl verdient hätten, von den Segnungen der modernen Medizin zu profitieren.
Nur wenige konnten sich dem Gewissensballast entziehen. Wer will es ihnen verdenken. Ich frage sie: Will nicht jeder das Beste für seine Kinder?« »Na klar ...«, knurrte Baxter-Jones, während er mit seinen Augen das Spiel verschlang.
»Ich weiß nicht«, fuhr McLellan fort, »diese Religiösen, dass waren richtige Fanatiker. Die dachten, dass sie sich dem Teufel gegenüber sähen. Teufel in Menschengestalt.« McLellan lachte hart auf. Baxter-Jones zog die Stirn in Falten und fragte lakonisch: »Und, hat es nach Schwefel gerochen?«
»Wie man’s nimmt. Das Geschäftsmodell sah vor, dass die Eltern eine Einmalzahlung von dreitausendeinhundert Dollar für die allgemeine Einlagerung und eine jährliche Lagerungsgebühr von einhundertfünfzig Dollar zahlten. Nicht schlecht bei über zweitausendfünfhundert Kunden. Tendenz steigend!«
Baxter-Jones nickte anerkennend.
»Im Grunde sollten Eltern froh sein, wenn sie auf das Nabelschnurblutpräparat zurückgreifen können. Es gibt Eltern, die sich als Vorreiter verstehen. Für sie ist die Medizin nichts weiter als ein Mittel zur Befriedigung ihrer Wunschvorstellungen. Nicht nur heilen und Leben retten, sondern auch Nachwuchs bekommen, wie aus dem Katalog. Wie sehen sie das? Es wird ein riesiger Markt, ein Milliardengeschäft, davon bin ich überzeugt!«
Baxter-Jones pflichtete ihm schweigend bei, bestellte Bier und sagte, auch er wäre überzeugt davon, dass Stammzellen irgendwann das bisherige Geld als Währung zukünftig ersetzen würden.
Die Männer tranken in großen Schlucken.», sagte McLellan. »Amerikaner? Sie sehen nicht so aus, als würden sie hier Entwicklungshilfe betreiben.»
Vielleicht war das die Pointe, auf die Baxter-Jones die ganze Zeit gewartet hatte.
Baxter-Jones lachte und blickte fordernd in den ansonsten leeren Barraum. »Ich bringe den Nigerianern bei, wie man Stanley-Cup-Experte wird.» Der Mann hinter dem Tresen blickte auf. »Nein, im Ernst, ich stamme aus New York und arbeite als Unternehmensvertreter. Wir haben hier seit einigen Jahren eine kleine Niederlassung, die ich leite. Ist nicht immer ganz einfach, aber es wird allmählich besser. Sie werden lachen, unser Geschäft ist gar nicht mal so weit von dem entfernt, was sie zuletzt gemacht haben.« »Sie sind Mediziner?«
»Nein, ich bin kein Mediziner«, sagte Baxter-Jones. »Aber ich bin jemand, der guckt, dass die Dinge in einem bestimmten medizinischen Bereich richtig laufen. Wir haben Produkte, die wir erst testen, bevor wir sie auf den Markt bringen. Ich sage ihnen, McLellan, da steckt richtig viel Geld drin. Ist immer ein bisschen schwierig bei uns Zuhause. Unser jetziger Wirkstoff wurde zwar im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens in den USA bereits zugelassen, hat aber noch längst nicht alle Testreihen durchlaufen.« Er nahm einen großen Schluck.
»Die Zulassungsbehörde FDA hatte keine Einwände. Die Leute hier, na ja, es gibt Behörden und Behörden. Manche Mitarbeiter sehen uns auf die Finger, und manche gucken auf das, was zwischen den Fingern ist. Wir tun ein gutes Werk. Kostenlos. Das sollte man auch sehen. Indien ist ebenfalls ein riesiger großer Markt für uns. Die Versuche sind alle sehr kostengünstig.
Einige der Leute hier verstehen das auch. Aber es gibt in diesem Land auch andere, schwierige Fälle. McLellan, ich sag’ ihnen mal was. Da, wo wir momentan arbeiten, herrscht die Scharia. Schon mal gehört davon? Ich sage ihnen, dagegen sind ihre christlichen Strenggläubigen in Kanada die reinsten Manatis.«
Er gluckste, trank einen Schluck, wischte sich genüsslich den Bierschaum von den Lippen, rülpste und fuhr fort. »Bei Verstößen gegen den Koran wird hier in manchen Gegenden schon mal die eine Hand oder ein Fuß angetrennt. Sind sie schon mal -und dass als Erwachsener- ausgepeitscht worden, so in aller Öffentlichkeit? Und wenn sie mal auf eine Dame ihres Herzens treffen, sie wissen schon, dann sollten sie in jedem Fall der Schnellere sein. Hier liegen nämlich jede Menge Steine rum.«
Ohne eine Antwort abzuwarten setzte Baxter-Jones nach. »Ich habe keine Ahnung, wie die danach weiterleben. Ganz ehrlich. Aber eigentlich sollte es uns schnuppe sein, was die Eingeborenen hier so treiben, oder! Man muss etwas organisieren, verstehen sie? Und das machen wir. So oder so. Auf ihr Wohl!« Jetzt lachte Baxter-Jones auf, nicht hart wie zuvor McLellan, sondern so, als hätte er gerade einen Schülerwitz erzählt.
McLellan kniff die Augen leicht zusammen. Beide waren mittlerweile angetrunken. »Medikamente?«, sagte er langsam. »Ich verstehe. Sie vertreten ”Pharmex“«, sagte McLellan gedehnt. »Ich habe in der Hauptstadt von „Pharmex“ gehört und bin deswegen nach Kano gekommen. Lagos war für mich kein gutes Pflaster. Ich dachte mir, dass sie hier oben Verwendung für einen qualifizierten Mediziner haben. Oder täusche ich mich?« McLellan beäugte Baxter-Jones, der sein Gegenüber lange ansah.
»Wir haben bereits einen Prüfarzt von der hiesigen Regierung aufs Auge gedrückt bekommen. Aber«, er schien nachzudenken, »ich kann mir vorstellen, dass wir noch einen guten Mediziner gebrauchen können.« Baxter-Jones sah McLellan mit einem verhangenen Blick an. »Fachrichtung?« »Anästhesie! Drei Jahre leitender Oberarzt. ”Primalcord Cryo“ habe ich ja schon erwähnt.« Baxter-Jones hörte aufmerksam zu. »Welche Aufgabe hatten sie bei ”Primalcord Cryo“?« »Im Wesentlichen die Materialkontrolle. Das ging durch die Aufarbeitung des Rohstoffs über Volumenreduktion und Trennung der Blutbestandteile durch Sedimentation. Vorher setzt man dem Blut noch einen Gerinnungshemmer zu.«
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752143133
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (April)
- Schlagworte
- Wissenschaftsthriller Politische Macht Stammzellforschung Bio-Technologien Krimi Ermittler