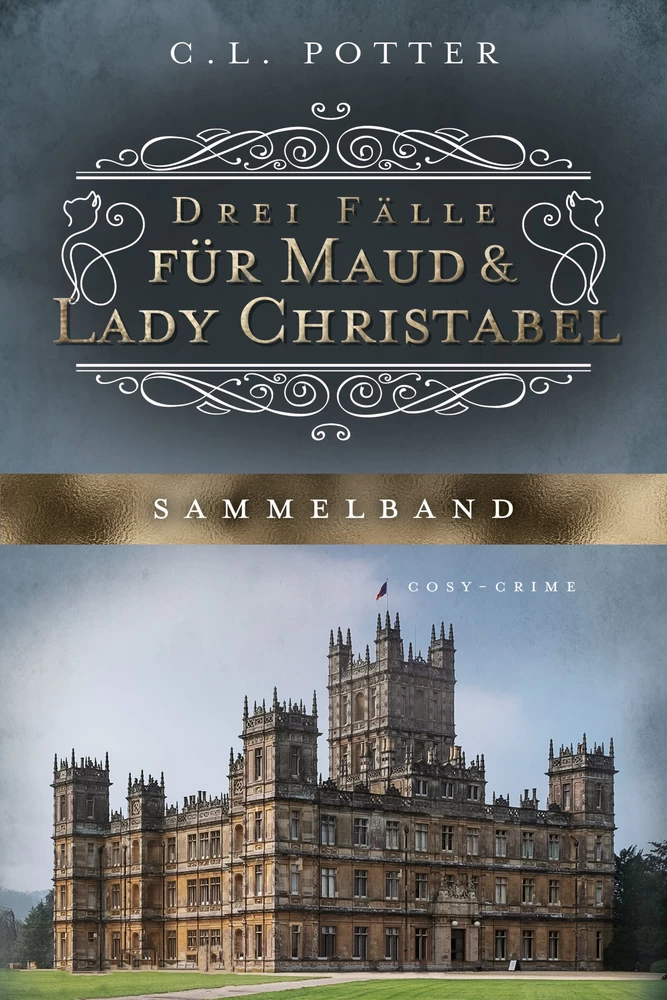Während ihre Ladyschaft sich nur Gedanken darüber machen musste, was sie auf Ashburn Abbey tragen wollte, oblag es Maud, sich um die Garderobe zu kümmern und die Reise zu planen. Sie würden den Zug nehmen, weil Lord Mowgray das Automobil benötigte. Maud war das nur recht, denn ihr behagte die Vorstellung, Stunden in dem engen Gefährt zu sitzen, beileibe nicht.
Nun blieb ihr nur noch, sich von ihren Freundinnen zu verabschieden, bevor sie sich mit einer überraschend gut gelaunten Lady Christabel auf die Reise begeben würde.
»Mach Lentune Hall keine Schande, Maud.« Jessamine Eggerton, die Hausdame, beugte sich vor, um Maud ins Ohr zu flüstern. »Selbst wenn der Butler dort unseren Mr Rowe in den Schatten stellt, bemühe dich, höflich zu bleiben.«
»Es wird mir schwerfallen.« Maud stieß einen Seufzer aus. »Ich verstehe nicht, wie Sie mit ihm zurechtkommen.«
»Harold hat seine guten Seiten.« Mrs Eggerton lächelte, was ihr kantiges Gesicht weicher werden ließ. Die Hausdame von Lentune Hall war keine klassische Schönheit. Ihr Gesicht war zu kantig, die Nase zu groß, der Mund zu schmallippig und die Augen von einem langweiligen Braun. Ihr eher biederes Äußeres machte sie durch viel Energie und eine überraschend tiefe Stimme wett.
»Maud, lass unsere Lady nicht warten«, mischte sich die Köchin ein. »Sonst überlegt sie es sich noch anders.«
Selbstverständlich hatten die Dienstboten mitbekommen, wie sehr Christabel Mowgray in den vergangenen Wochen gelitten hatte. Maud war sicher, dass sie alle sich ihre Gedanken darüber gemacht hatten, aber sie ihr gegenüber nicht äußerten.
Als Zofe war sie weder Fisch noch Fleisch. Für die Hausmädchen galt sie als obere Dienstbotin und wurde daher nicht in deren Klatsch und Tratsch eingebunden. Für die oberen Dienstboten war sie immer noch ein Hausmädchen, das den Aufstieg geschafft hatte, aber nicht wirklich zu ihnen gehörte. Manchmal fühlte sie sich einsam, obwohl Mrs Eggerton und Mrs Cramton wirklich freundlich zu ihr waren.
»Wenn dir ein neues Gericht unterkommt, vergiss nicht, dir das Rezept geben zu lassen.« Die Köchin drohte Maud spielerisch mit dem Finger. »Ich werde Lady Christabel ebenfalls danach fragen. Also vergiss es bloß nicht.«
Die runde Frau mit den ergrauten Haaren zog Maud in eine Umarmung. Maud konnte den Geruch erschnuppern, der die Köchin stets begleitete: Bratfett, frisch gebackenes Brot und karamellisierter Zucker. Sofort fing ihr Magen an zu knurren, obwohl sie gerade erst gegessen hatte.
»Wehe, dir schmeckt dort etwas besser als hier.« Nellie Cramton verengte die ohnehin kleinen grünen Augen. Tiefe Tränensäcke zeugten von einem Leben voll harter Arbeit. »Das betrachte ich als Verrat.«
»Niemand kann sich mit Ihren Leckereien messen«, antwortete Maud im Brustton der Überzeugung. Als Kind hatte sie Hunger gekannt und wusste daher die regelmäßigen Mahlzeiten zu schätzen. Inzwischen hatte sie auch gelernt, die Kochkunst von Nellie Cramton zu würdigen. »Ich muss los.«
Als sie durch die große Halle eilte, schlug die Standuhr elfmal. Obwohl es den Dienstboten untersagt war, im Haus zu rennen, schürzte Maud ihre Röcke und sprang die breite Treppe hoch. Sie klopfte einmal, bevor sie die Tür zu Lady Christabels Zimmer aufriss.
»Kommen Sie, Mylady.« An ihrem Tonfall merkte man, dass Maud langsam die Geduld verlor. »Wenn wir uns nicht beeilen, verpassen wir den Zug.«
»Meinst du nicht, ich sollte das zitronengelbe Kleid mitnehmen? Es schmeichelt meinem Teint.«
»Aber es lässt Ihre Haare stumpf aussehen«, würgte Maud jegliche weitere Diskussion ab. »Der Chauffeur wartet.«
Endlich schloss ihre Ladyschaft die Schranktür und folgte ihr die Treppe hinab, durch die große Eingangshalle bis zur Tür.
Dort wartete Rowe, der es sich nicht nehmen ließ, sich von Lady Christabel zu verabschieden und Maud mit einem Blick zu bedenken, in den er seine ganze Abneigung legte.
»Ich wünsche Ihnen eine gute Reise.« Egal, wie sehr er sich um eine saubere Aussprache bemühte, seinen Akzent aus Nordengland konnte Maud erkennen.
»Danke, Rowe. Bitte grüßen Sie meine Eltern.«
Lady und Lord Mowgray hatten gesellschaftliche Verpflichtungen, sodass sie sich bereits gestern von ihrer ältesten Tochter verabschiedet hatten.
»Gewiss.« Rowe verbeugte sich dermaßen steif, dass Maud ihn am liebten geschubst hätte. Der Butler öffnete die Tür. Auf dem breiten Kiesweg wartete bereits der schwarze Wagen.
»Lady Christabel. Maud.« Rupert Kendall, der junge Chauffeur, lächelte sie schüchtern an. »Ausnehmend schönes Wetter heute.«
Maud verkniff sich ein Lächeln. Es war nur allzu deutlich, dass der schlaksige Junge in Lady Christabel verschossen war. Jedes Mal, wenn er das Wort an sie richtete, liefen seine leicht abstehenden Ohren rot an. Da seine Haare einen Rotstich hatten, fiel dies umso mehr auf.
Maud mochte den Jungen, der besser mit Automobilen als mit Menschen zurechtkam. Sie hoffte, dass sich eines der Hausmädchen die Mühe machte, den wunderbaren Mann hinter dem ungelenken Äußeren und den zögerlichen Gesten zu entdecken. Mehrfach hatte Maud schon die Hausmädchen Gladys und Enid auf Ruperts ungewöhnlich schöne grüne Augen aufmerksam gemacht, bisher jedoch ohne den gewünschten Erfolg.
Und Lucy-Anne, die Küchenhilfe, war noch schüchterner und ungelenker als Rupert. Bei ihr brauchte Maud es gar nicht erst zu versuchen.
»Ich … ich wünsche Ihnen eine wunderbare Reise.« Rupert hatte es sich nicht nehmen lassen, ihnen die Koffer bis ins Abteil zu tragen, obwohl Lady Christabel einen Gepäckträger heranwinken wollte.
»Beeil dich, der Zug fährt gleich los,« musste Maud sagen, obwohl er ihr leidtat, wie er Lady Christabel aus hundetreuen Augen anschmachtete.
Auf den bequemen Sitzen der ersten Klasse ließ es sich wunderbar reisen. Maud holte ihr Buch aus der Tasche und lehnte sich zurück, als der Zug ruckelnd anfuhr. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie er den Bahnhof verließ. Da stand sie auf und stellte sich ans Fenster, um London langsam an sich vorbeiziehen zu sehen.
»Weck mich, wenn wir angekommen sind.« Lady Christabel schloss die Augen. Auch wenn Maud nicht glaubte, dass sie schlief, genoss sie es, in Ruhe aus dem Fenster zu schauen und die sanften grünen Hügel zu betrachten. Sicher, die Landschaft war hübsch, aber Maud fühlte sich in der Stadt einfach wohler.
Nach einer langen, ereignislosen Fahrt erreichten sie endlich den Bahnhof von Chippenham. Nachdem Maud Lady Christabel geweckt hatte, suchte sie einen Gepäckträger, der ihre Koffer sicher aus dem Abteil bugsierte. Nur wenige Menschen waren mit ihnen ausgestiegen. Maud hielt Ausschau nach einer Kutsche oder einem Automobil, das sie abholen sollte. Zielsicher kam ein Mann, dessen dunkle Uniform und Mütze ihn als Chauffeur auswiesen, auf sie beide zu.
»Myladys.« Er tippte sich an die Mütze und griff nach ihren Koffern. Schwungvoll, als wögen diese gar nichts, pfefferte er sie auf den Wagen. »Leonard Arnold. Ich bin der Chauffeur von Ashburn Abbey.«
Obwohl sein Tonfall beflissen und höflich war, spielte ein freches Grinsen um seinen Mund. Seine dunklen Augen musterten Maud von oben bis unten und das Grinsen vertiefte sich. Was für ein unverschämter Kerl!, dachte sie, fühlte sich allerdings ein wenig geschmeichelt von seiner Aufmerksamkeit.
»Bitte sehr.« Leonard Arnold öffnete die Tür des Wagens. »Stoßen Sie sich nicht den Kopf.«
Lady Christabel kletterte elegant ins Innere und wehrte die Bemühungen des Chauffeurs ab, ihr behilflich zu sein. Maud hingegen nahm die ihr angebotene Hand, die er ein wenig zu lange hielt. Gute Chauffeure gab es wenige, sodass diese Kerle sich gern ein paar Frechheiten erlaubten, bis auf Rupert natürlich. Obwohl sie eigentlich nur bessere Kutscher waren.
Den Willmingtons muss es gut gehen, wenn sie sich ein Automobil leisten können, überlegte Maud. Da Lady Christabel weiterhin schwieg, blieb ihr nichts anderes übrig, als erneut aus dem Fenster zu schauen. Die Felder und Weiden, auf denen schwarzbunte Kühe standen, zogen an ihnen vorüber. Auch wenn Leonard Arnold ein frecher Kerl war, musste Maud ihm zugestehen, dass er das Ungetüm sicher fuhr.
»Wir sind bald da«, unterbrach er das Schweigen. »Ist ein Prachtbau.«
Weder Maud noch ihre Ladyschaft würdigten ihn einer Antwort. Die Auffahrt zum Herrenhaus zog sich endlos lang hin. Ein Sandweg führte leicht bergab, umrahmt von einem schmalen Stück Rasen, das von einer dunkelgrünen Eibenhecke begrenzt wurde. Hinter den sorgsam gestutzten Pflanzen erstreckte sich ein Mischwald aus Laub- und Nadelbäumen.
Endlich kam das Haus in Sicht, ein gewaltiger Klotz aus hellem Sandstein mit Vorsprüngen und Erkern, in dem selbst Lentune Hall zweimal Platz gefunden hätte.
Was wohl Lady Christabel durch den Kopf ging, fragte sich Maud, während sie selbst überlegte, was sie auf Ashburn Abbey erwartete.
Höchstwahrscheinlich bekäme sie es mit einem mürrischen Butler zu tun, der sich für den Stellvertreter des Lords hielt. Wenn sie großes Pech hätte, gäbe es eine ungnädige Hausdame, deren Blick nichts entging. Außerdem rechnete sie mit einer arroganten Zofe, einer übel gelaunten Köchin und natürlich dem wichtigtuerischen Leibdiener des Hausherrn. Dazu würde sich ein Sammelsurium der niederen Dienstboten gesellen: Hausmädchen, Lakaien, Küchenhilfen.
Woher sie das wusste? Weil es in jedem Haus, das Lady Christabel besucht hatte, bisher so gewesen war. Dank ihrer Reisen hatte Maud die Freundlichkeit der Hausdame und der Köchin von Lentune Hall schätzen gelernt. Bisher jedoch hatte sie keinen Butler getroffen, der es mit Rowe aufnehmen konnte.
Als der Chauffeur bremste, konzentrierte Maud ihre Aufmerksamkeit auf das Haus. Eine gewaltige Eichentür, über der das Familienwappen hing, war verschlossen und öffnete sich, nachdem der Chauffeur die Klingel betätigt hatte. Die Tür ging so schnell auf, als hätte der Butler bereits auf ihre Ankunft gewartet. Er sah ihnen gelassen entgegen, während sie aus dem Wagen stiegen.
»Willkommen auf Ashburn Abbey. Mein Name ist Marmaduke Trowbridge.« Er neigte den Kopf. »Falls Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.«
Während er Lady Christabel gegenüber äußerst servil schien, musterte er Maud kritisch.
Der Blick genügte Maud, um zu ahnen, dass Trowbridge, der Butler von Ashburn Abbey, und sie wohl keine Freunde werden würden. Er betrachtete sie, als wüsste er von Mauds Vergangenheit, die niemals vermuten ließ, dass sie einmal die Zofe einer Lady einer der ältesten und geachtetsten Familien Englands sein würde.
Butler schauen immer so von oben herab. Ich muss aufhören, mir einzureden, jemand wüsste von Patrick und mir. Maud straffte die Schultern und erwiderte den prüfenden Blick des Butlers, was diesen nur noch kritischer dreinblicken ließ.
Was für ein wichtigtuerisches Wiesel! Bisher war Maud davon ausgegangen, dass es keinen schlimmeren Butler als Howard Rowe geben konnte, nun schien sie eines Besseren belehrt zu werden. Was konnte man schon erwarten von einem Mann, den die Eltern mit dem furchtbaren Namen Marmaduke geschlagen hatten? Wahrscheinlich war er das Gespött seiner Dorfschule gewesen. Bestimmt hatten die anderen Kinder ihn Marmelade oder Ähnliches genannt. Das allerdings gab ihm nicht das Recht, sie dermaßen von oben herab zu behandeln.
»Mylady möchte sich gern frisch machen. Es war eine anstrengende Fahrt hierher.«
Trowbridge zuckte zusammen, als hätte Maud ihm eine Ohrfeige verpasst. Ihre Worte warfen ihm verklausuliert vor, er käme seinen Aufgaben nicht nach und würde das Wohl der Gäste vernachlässigen.
»Selbstverständlich.« Der Butler verbeugte sich steif. Mit einem Fingerzeig winkte er einen Lakaien heran, der Lady Christabels Koffer ergriff. »Simon wird Sie auf Ihr Zimmer bringen.«
Dann wandte er sich Maud zu. »Wenn Sie mir folgen würden. Ich stelle Ihnen die anderen Dienstboten vor.«
Maud sandte einen hilfesuchenden Blick zu ihrer Lady, den diese jedoch nicht bemerkte. Daher konnte Maud nur zusehen, wie Lady Christabel dem jungen Mann die große Treppe hinauffolgte. Mit einem künstlichen Lächeln wandte Maud sich an den Butler. »Ich freue mich, dass Sie mir die Räume Downstairs und meine Kammer zeigen.«
»Ich weiß nicht, wie Sie es auf Lentune Hall halten, aber auf Ashburn Abbey gehört es nicht zu den Aufgaben eines Butlers, einer Zofe ihr Zimmer zu präsentieren.«
Erstick an deinem Pomp, dachte Maud, die Trowbridge aufmerksam beobachtete. Ihrer Erfahrung nach ließen sich bei jedem Menschen Schwächen entdecken. Man musste nur wissen, wann und wie man zu suchen hatte. Bei Männern wie dem Butler ging es meist darum, die Kontrolle zu behalten und jedem in ihrer Umgebung ihren Willen aufzuzwingen. Menschen wie Trowbridge hassten nichts so sehr wie eine Störung ihrer Regeln und Abläufe. Nun, damit würde Maud gewiss arbeiten können.
»Ich stelle Sie der Hausdame vor, die sie in unsere Abläufe einweihen wird. Hier auf Ashburn Abbey haben wir klare Hausregeln.«
»Aha.«
»Es ist Ihnen hoffentlich bewusst, was für eine Ehre es ist, auf Ashburn Abbey zu weilen. Die Willmingtons sind eine der ältesten Familien des Landes.«
In dem Stil redete er den ganzen Weg zum Dienstbotentrakt auf Maud ein, die ab und zu zustimmend brummte. Trowbridges kurze Nase zuckte jedes Mal, wenn er die Worte »Ashburn Abbey« aussprach, was Maud an den Märzhasen aus »Alice im Wunderland« erinnerte.
Wenn man ihm zuhörte, konnte man meinen, man wäre im Paradies angekommen. Allerdings hatte Maud in ihrem Leben eines gewiss gelernt: Je mehr Menschen von etwas schwärmten, desto weniger stimmte es.
Ob der angespannte Mund Marmaduke Trowbridges wohl lächeln könnte?, fragte sie sich, während sie seinem Sermon lauschte. Als spürte der Butler, dass Mauds Gedanken abschweiften, fixierte er sie mit einem strengen Blick aus verengten graublauen Augen. Sie wich ihm aus und starrte auf die Falten an seiner Nasenwurzel.
Endlich hatten sie die Küche erreicht. Wie sie es erwartet hatte, war auch auf Ashburn Abbey hier das Herzstück Downstairs. Erstaunlich, wie sehr sich die Küchen der Herrenhäuser ähnelten. Auch hier gab es hohe, dunkle Decken, die sich über einem gewaltigen Arbeitstisch aus dunklem Holz spannten. Ein enormer Herd, auf dem ein Topf stand, nahm die eine Wand ein, an der anderen befand sich der Spülstein, wo ein mageres Mädchen eine dreckige Pfanne schrubbte. Große gusseiserne Pfannen und Töpfe stapelten sich in einem Holzregal an der dritten Wand. Die Hitze des Herdes schlug Maud entgegen, nachdem sie die Tür zur Küche geöffnet hatte.
»Tür zu«, erklang ein Flüstern. »Sonst fällt mir der Hefeteig zusammen.«
Nie und nimmer ist das eine Köchin, dachte Maud, als Trowbridge ihr Harriet Pratt vorstellte. Die hochgewachsene, schlanke blonde Frau wirkte wie eine Hausdame, die alles überwachte und dafür sorgte, dass der Haushalt reibungslos funktionierte. Köchinnen hatten, jedenfalls nach Mauds Erfahrung und Meinung, rundliche Frauen zu sein, die gern einmal die Stimme erhoben, wenn es nicht nach ihren Wünschen lief.
Harriet Pratts Stimme hingegen war so leise, dass Maud sich anstrengen musste, um zu verstehen, was die Köchin ihr sagte.
»Ihnen wird es hier gefallen«, sagte Mrs Pratt. »Auf jeden Fall müssen Sie sich die Gärten anschauen. Wir haben seltene Pflanzen aus der ganzen Welt hier.«
Ihr Tonfall war so stolz, als hätte sie Büsche und Bäume höchstpersönlich nach Ashburn Abbey geholt.
»Gewiss«, antwortete Maud, deren Begeisterung für Gärten und Pflanzen sich in Grenzen hielt.
»Sie sollten sich auf jeden Fall den violetten Ginster und unseren Rhododendron ansehen.«
»Sie kennen sich aber gut aus.« Maud konnte keinen einzigen Baum mit Namen nennen.
»Mein Ehemann, Gott habe ihn selig, war Gärtner.« Resolut wandte die Köchin sich ab. »Ich muss mich ums Abendessen kümmern. Flossie zeigt Ihnen Ihr Zimmer.«