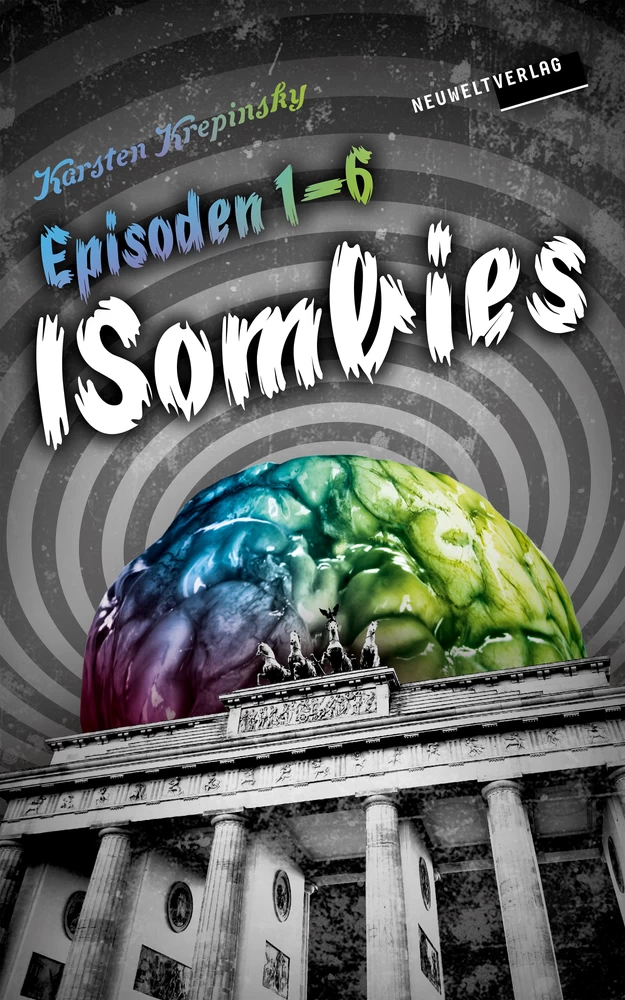Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
KARSTEN KREPINSKY
Angriff der ISombies
Episode 1: Sie sind gekommen, um dich zu konvertieren
KARSTEN KREPINSKY
Angriff der ISombies
(c) 2015 Karsten Krepinsky
Originalausgabe, Dezember 2015
Alle Rechte vorbehalten
Nachdruck und Vervielfältigung aller Art (auch in Auszügen) nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors
Umschlaggestaltung: Ingo Krepinsky
Für alle Querdenker
An ihren Taten sollt ihr sie messen, nicht an ihren Worten.
Neues Testament, 1. Joh. 2, 1-6
1.
Jetzt, wo mich dieser unbändige Hass vollkommen übermannt hat, schreite ich auf dieses mächtige Gebäude aus Stein zu. Zentrum eines Staates, der einmal mein Land war. Der Instinkt, mich in einen Menschen zu verbeißen, treibt meinen zuckenden Körper voran. Die Landesflagge weht im Wind, Sonnenstrahlen spiegeln sich in der Glaskuppel, Rauchfahnen steigen in den Himmel. Längst hat mein Verstand die Kontrolle über den Körper hergegeben. Es war ein zähes Ringen, doch am Ende war der fremde Wille stärker gewesen. Ich weiß nun, dass ich sie alle umwandeln werde. Ich bin nicht mehr als ein Gefäß, bestimmt dazu, den Samen, den ich in mir trage, weiterzugeben. Auf dass eine neue Gesellschaft entstehe. »Dem Deutschen Volke« lese ich über dem Eingangsportal, bevor mein Verstand vollends entweicht und der Parasit die Kontrolle übernimmt.
2.
Am Tag zuvor.
Berlin, 24. September 2018.
Schloss Bellevue, Büro des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland.
Bundespräsident Hauch saß hinter seinem Schreibtisch und strich mit einem goldenen Füllfederhalter den Satz durch, den er soeben geschrieben hatte.
Die Globalisierung ist Chance, sie birgt aber auch Risiken.
Irgendwie war dies kein würdiger Eröffnungssatz für seine anstehende epochale Rede, die ihm einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern sollte. Zweifelsohne wusste er, was in dieser so schicksalsträchtigen Zeit seines Landes auf dem Spiel stand. Nicht weniger als sein Vermächtnis sollte diese Ansprache an die Bevölkerung werden. Wie es seinem eher unglücklichen Vorgänger mit einem einzigen, beiläufig geäußerten Satz zu einer durch die Immigration nach Deutschland heimisch gewordenen Religion gelungen war, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Es würde keine einfache Angelegenheit werden, dachte der Präsident, denn der Bundeskanzler hatte mit der nicht zu setzenden Obergrenze von Schutzsuchenden noch einen oben drauf gesetzt. Was konnte Hauch jetzt noch sagen, das ihm die Bewunderung des Feuilletons einbrachte und ihn als den Intellektuellen und Menschenfreund dastehen ließ, für den er sich hielt? Er stand auf, stützte sich in staatsmännischer Manier von der Tischplatte ab und zeigte dem goldumrandeten Spiegel an der Wand sein Halbprofil, als der Summer erklang und die Sekretärin fragte, ob Staatssekretär Roland Padolla hereintreten dürfe. Warum nicht?, dachte der Präsident mit einem selbstzufriedenen Lächeln. »Nur herein mit ihm«, sagte er beim Betätigen der Sprechanlage. Vielleicht hatte dieser Lakai eine zündende Idee für seine Rede.
Padolla verneigte sich noch im Türrahmen stehend und trat in für ihn ungestüm schneller Weise an den Schreibtisch heran. »Wir müssen Bellevue sofort evakuieren«, sagte Padolla mit hoher, fast hysterischer Stimme, während er sich des korrekten Sitzes seines Seitenscheitels versicherte.
»Was müssen wir?«, fragte der Präsident nicht überrascht, sondern eher ungehalten über den fordernden Tonfall des Bediensteten nach.
»Es gibt Kämpfe in Kreuzberg und in Wedding.«
»Kämpfe? Was sagen Sie da? Etwa der Russe oder was?«
»Der Hubschrauber wird in zehn Minuten auf dem Hof landen«, ignorierte Padolla die Frage seines Dienstherren.
»Aber ich ... jetzt ist nicht ... und der Bundespresseball? Wie stellen Sie sich das überhaupt vor?«
»Der Ball muss ... er kann nicht ... ich ... ich sehe da keine Möglichkeit.«
Der Präsident fasste sich mit dem Zeigefinger an die Lippe. »Vielleicht könnten wir den Ball nach Bonn verlegen?«, fragte er, mit einem breiten Lächeln und einer gerunzelten Stirn, als forderte er Bewunderung für seine rasche Entschlusskraft ein.
»Der Hubschrauber – verstehen Sie nicht?«, fragte Padolla.
Der Präsident winkte ab. »Sie wissen doch, dass man auch in schwierigen Zeiten seinen Aufgaben nachkommen muss. Sie kennen die Pflichten des Bundespräsidenten. Er muss das Land repräsentieren. Und deshalb wird es am allerwichtigsten sein, dass Werner diesmal wieder kommt«, wies Hauch Padolla zurecht. »Was für ein toller Fotograf«, ergänzte der Präsident. »So gut hat er mich beim letzten Ball zur Geltung gebracht. Frontale, schräg von unten.« Der Bundespräsident bewunderte verzückt sein Lächeln im Spiegel. »Ich habe extra Tanzunterricht genommen. Dieses Mal soll mir keiner die Show stehlen. Ach, wissen Sie, eine halbe Stunde hat sich der amerikanische Präsident Zeit für mich genommen. Ich habe die Protokolle prüfen lassen: So lange war noch keine Nummer 1 Amerikas bei seinem deutschen Amtskollegen.«
»Aber der Hubschrauber ...« Fast entglitt Padolla in diesem Augenblick die Gesichtsmimik, wenn, ja wenn in seinem Repertoire mehr als zwei Mimiken vorhanden gewesen wären. Doch dem war nicht so. Die Dutzenden von Muskeln, die das Gesicht der meisten Menschen in die unterschiedlichsten Gemütszustände zu modellieren vermochten, schienen bei Padolla nur zwei Ausdrücke zuzulassen: einem für Außenstehende eher dümmlich-spöttischen Grinsen, das er auflegte, wenn er aufgeregt war, angegriffen wurde, sich tatsächlich freute oder auch wenn er seiner Frau sagte, dass er sie liebe – was zweifelsohne das letzte Mal vor gut zwei Jahrzehnten der Fall war – und die überraschte Mimik eines Pennälers, den der Lehrer beim Spicken erwischt hatte – die er der Welt das letzte Mal vor vier Jahren zeigte, als seine Partei ihn mit dem Posten des Staatssekretärs beglückte.
»Keine Eile, mein Guter.« Der Präsident lachte hüstelnd. »Ohne mich wird die Maschine schon nicht abheben.« Er ging um den Schreibtisch herum und legte eine Hand auf die Schulter des Staatssekretärs. »Packen Sie doch schon mal meine persönlichen Sachen ein«, sagte er.
»Sehr wohl.« Padolla verneigte sich unterwürfig.
»Ich gehe dann mal schon zum Hubschrauber vor«, sagte Hauch mit gespitztem Mund und ging zunächst langsam, und als er glaubte, dass Padolla nicht mehr hinsah, recht schnellen Schrittes aus dem Büro. Padolla nahm den Aktenkoffer, der unter der Stehlampe stand, ging zum Schreibtisch und räumte gewissenhaft die beiden oberen Schubladen aus. Zuletzt packte er auch das Haargel und die beiden Kämme ein. Als er das Büro verließ, war die Sekretärin schon gegangen. Er schritt durch die leeren Flure von Schloss Bellevue und konnte in der Stille seine Schritte vernehmen, die auf dem Boden nachhallten. Er war verwundert, dass niemand auf ihn gewartet hatte. Als er die zweiflüglige Vordertür aufstieß, stand der Hubschrauber bereits mit kreisenden Rotorblättern in einem Blumenbeet des Vorgartens.
»Ihre Sachen!«, rief Padolla, den Koffer präsentierend. Doch ungeachtet seines Winkens fuhr der Pilot den Motor hoch, und der Hubschrauber hob vom Boden ab. Während Padolla langsam die Stufen des Eingangsportals hinunterging, gewann die Maschine rasch an Höhe. Ein gepanzerter Dienstwagen schoss über den geschotterten Weg des Schlossparks, raste auf die Straße und fuhr mit quietschenden Reifen in den benachbarten Tiergarten. Wenigstens der Gärtner ließ ihm Aufmerksamkeit zuteilwerden und kam leicht wankend, die Hände um eine Harke geklammert, auf ihn zu. Padolla wunderte sich über die derangierte Erscheinung seines Gegenübers. Musste ein harter Arbeitstag für ihn gewesen sein, dachte er. Kreidebleich, der gute Mann, die Augen eingefallen. Padolla bemerkte nicht die klaffende Wunde am Hals des Gärtners. Auch nicht, wie dieser ihn mit beinahe wahnsinnigem Blick musterte, um ihn dann als Beute für geeignet zu befinden. Padolla lächelte nur und streckte geschmeichelt seine Hand zum Gruß aus. Der Gärtner ließ die Harke fallen und hob langsam seinen Hut an, als wollte er ihn grüßen. Eine eigenartig gewölbte Stirn kam nun zum Vorschein und ein sich windendes, dunkles Etwas hinter der nahezu durchsichtigen Haut. Pulsierend und fremd. Padolla ließ die Hand sinken, die Finger erschlafften, und der Aktenkoffer fiel in den Kies. Die Augen verdreht, umfasste der Gärtner Padollas Schultern und biss sich in dessen Hals fest. Ohne sich zu wehren, wie ein gefällter Baum, fiel Padolla im Klammergriff des Gärtners zu Boden.
3.
Zwei Stunden zuvor.
Kreuzberg, Hochbahn der U-Bahnlinie U1.
Seit zwei Semestern studierte Frank Biologie an der Freien Universität. Da er in Friedrichshain wohnte, führte ihn sein Weg mit der U1 von der Endhaltestelle Warschauer Straße über die Spree und dann quer durch Kreuzberg. Bis zum Gleisdreieck verlief die U1 auf Stahlpfeilern über der Straße entlang der Häuser, fast auf Höhe der zweiten Etage. Gründerzeitbauten, moderne Betonensemble und der ein oder andere Sakralbau wischten am Fenster vorbei, ohne bei Frank bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Mit halb geschlossenen Augen, die Müdigkeit der letzten Party noch in den Knochen, saß er auf einer Seitenbank des vorderen Wagens. In schwarz gekleidet, mit Kapuzenpullover und ausgetretenen Doc Martens gefiel er sich in der Rolle des Rebellen. Ein Außenseiter, der im Bus bevorzugt in der hinteren Reihe saß und distanziert seine Umgebung beobachtete, um von Zeit zu Zeit einen zynischen Kommentar abzusondern. Frank hatte keine Ahnung, was er mit seinem Leben anstellen sollte. Aus einem unerfindlichen Grund hatte er sich vor einem Jahr in Biologie immatrikuliert, auch wenn er dies jetzt für einen Fehler hielt. Ein Genie war er zu seinem Leidwesen nicht. Ihm war zwar ein IQ von 167 bescheinigt worden, doch es war ein Online-Test, selbst durchgeführt und erst im zweiten Durchgang erreicht. Zum Teufel, dachte er, nahm eine Schachtel Aspirin aus der Tasche, brach eine Tablette aus dem Blister, zerkaute die Pille und schluckte sie herunter. Anti-Thrombin-Mangel. Dickes Blut, wie man so sagte, das die unangenehme Tendenz hatte zu koagulieren. Ein genetischer Defekt, weswegen er sich drei Tabletten des Blutverdünners täglich einwerfen musste, um Thrombosen vorzubeugen.
Den bitteren Geschmack des Medikaments noch im Mund, sah sich Frank um. Zu dieser Zeit, kurz nach elf Uhr, herrschte in der U-Bahn nur wenig Betrieb, da die meisten Pendler schon längst an der Arbeit waren. Nur noch drei weitere Personen saßen mit ihm in dem alten Schmalspurwagen: ein grobschlächtiger Arbeiter im Blaumann, ein durchgestylter Türke und eine Studentin. Dass sie alle um die zwanzig waren, schien ihm die einzige Gemeinsamkeit zu sein, die sie hatten. Die Frau kannte er. Es war Sophia, eine Kommilitonin aus seinem Semester, engagiert im Studentenausschuss der Universität. Die blaue Tasche mit dem großen »Refugees Welcome«-Sticker, die sie noch im ersten Semester getragen hatte, war mittlerweile einer grün-weiß karierten Tasche mit ausgefransten Bommeln gewichen. »Kill capitalism, not animals. Go vegan!«, prangte darauf. Kein Semester ohne Motto, dachte Frank. Ein Che Guevara-Sticker, dazu ein St. Pauli-Aufnäher und fertig war das linke Abziehbild. Er hielt sie für ein Political-Correctness-Vakuum. PC bis zum Abwinken, ohne jemals eine eigene Meinung entwickeln zu können. Eine von denen, die behaupteten, Geschlecht und Ethnie spielten keine Rolle, aber fortwährend nach Quoten einteilten und bewerteten. Die der Gesellschaft die Fähigkeit des kritischen Diskurses genommen hatten, weil ihre Denkweise Tausende Tabus kannte, die unausgesprochen bleiben mussten. Selbstgerechte Dogmatiker und uniformierte Anarchisten, dachte er, die Sprache in Orwellscher Manier so reduzieren wollten, dass Diskriminierung nur noch gedacht, aber nicht mehr ausgesprochen werden konnte.
Frank blickte Sophia verächtlich an. Die Antipathie beruhte auf Gegenseitigkeit. Als Sophia am Schlesischen Tor eingestiegen war und ihn erkannte, hatte sie sich sofort abgewandt und war zum anderen Ende des Wagens geeilt. Wenn er ein Außenseiter war, dachte er, war sie zweifelsohne der Typus der Cheerleaderin, die blonde Freundin des Quarterbacks, wenn auch mit ihren Rastalocken und zerschlissenen Jeans die deutsche Öko-Edition davon.
Der bullige Arbeiter mit seinen kurzgeschorenen Haaren stöhnte auf. Eine portable Spielkonsole in den Händen, die er abwechselnd nach rechts und dann wieder nach links schwenkte, war er sicher mit seinem Rennwagen gegen irgendeinen Betonpfeiler gefahren, dachte Frank. Diese ein Meter neunzig große, hundertfünfzig Kilo schwere Manifestation der Ignoranz und Debilität. Endpunkt von Millionen Jahren Evolution. Darwin konnte einfach nicht recht haben, glaubte er. Von wegen Survival of the fittest und so. Der Fettsack verstand es bestimmt als seine Berufung, sich auf irgendeiner Baustelle den letzten Funken Verstand zu versaufen, wenn er sich nicht gerade auf dem Dixi-Klo einen runterholte. Die Welt ging eh zum Teufel, dessen war sich Frank sicher. Wer konnte sie retten? Etwa der Türke, der an der Tür stand und seine frisch manikürten Fingernägel bewunderte? Sicherlich arbeitete der als Friseur irgendwo im Prenzlauer Berg und warf seinen schwulen Freunden Luftküsse zu, während er laut kichernd irgendeine Tussi frisierte.
Schon mehr als fünf Minuten hielt der Zug an der Station Hallesches Tor. Nervös stand Sophia auf und ging zum vorderen Ausstieg. Sie drückte auf den Knopf, doch die Türen waren nicht mehr freigegeben.
»Weißt du, was los ist?«, fragte Sophia den Türken.
»Signalstörung oder so«, antwortete der gelangweilt. »Geht bestimmt gleich weiter.«
»Hast du ’n Netz?« Sie deutete auf ihr Handy.
Der Türke wischte sich die langen Haarsträhnen aus dem Gesicht und zog sein Smartphone aus der Tasche. »Nein«, sagte er, als er nochmals auf das Display sah, um sich zu vergewissern. »Kein Balken. Absolut nichts.«
»Merkwürdig. Ist mir hier noch nie passiert.«
»Kommt sicher gleich wieder«, beruhigte der Türke sie.
»Hallo?« Sophia wedelte mit der Hand vor dem Gesicht des Arbeiters herum, um dessen Aufmerksamkeit zu erlangen.
Der Mann zog die Ohrhörer ab. »Was?«, fragte er träge, und es klang in Franks Ohren, als wäre es eine Frage, die der Arbeiter allzu häufig stellen musste.
»Hast du ’n Netz?«, fragte Sophia ihn.
»Netz?«
»Empfang? Kannst du telefonieren?«
»Ist ’ne PSP.«
»Was?«
»Na, ’ne PSP. Damit kann man nicht telefonieren.« Er hob die portable Spielkonsole hoch.
»Du kannst nur damit zocken oder was?«
»Ja.«
»Geht bestimmt gleich weiter«, sagte der Türke.
»Äh«, mischte sich Frank ein. »Ich kann euren Optimismus nicht ganz teilen.«
Als die drei zu Frank hinübersahen, deutete der auf den Bahnsteig. Wie ferngesteuert stolperte der Zugführer an den Sitzbänken der Haltestelle vorbei, blieb stehen, sah wie von Sinnen zu ihnen hinüber, stürzte auf ihren Wagen zu und schlug mit voller Wucht gegen die Tür. Einen Schrei ausstoßend, sprang Sophia zurück. Der Zugführer hämmerte mit den Fäusten gegen die Scheibe, zog seine Mütze ab und rieb seine merkwürdig hervortretende, ausgebeulte Stirn an der Scheibe. Frank stand auf, stellte sich direkt ans Fenster und musterte den weggetreten wirkenden Zugführer aus nächster Nähe. Der Stirnknochen des Mannes schien aufgelöst zu sein; die Haut war transparent und dünn. Lymphsubstanz trat aus einer Öffnung über der Nase aus. Hinter der durchsichtigen Hautblase bewegte sich etwas, was zweifelsohne nicht dahin gehörte. Frank ging noch dichter an die Scheibe heran. Es schienen wurmartige Lebewesen zu sein, die sich in der löchrigen Hirnsubstanz wanden. Der Zugführer trommelte mit den Fäusten nun noch heftiger gegen die Tür. Jetzt wich auch Frank zurück.
»Oh Gott, oh Gott, der arme Mann«, flüsterte Sophia und biss sich auf die Unterlippe.
Die Augen verdreht, so dass nur noch das Weiße zu sehen war, wandte sich der Zugführer von ihnen ab und torkelte über den Bahnsteig, bis er aus dem Sichtfeld der vier verschwunden war.
Frank drehte sich zu den anderen um. »Was war ’n das für ’ne perverse Scheiße?«
»Polizei«, murmelte Sophia vor sich hin. »Wir müssen sofort die Polizei rufen ... und den Notarzt.«
»Ist wohl eher ’ne Sache für ’n Exorzisten«, wandte Frank ein.
»Kannst du nicht einmal dein blödes Maul halten.«
»Beruhigt euch doch«, redete der Türke beschwichtigend auf sie ein und sah auf sein Handy. »Es gibt immer noch kein’ Empfang.«
Der Arbeiter steckte seine Spielkonsole in die Seitentasche seines Blaumanns und blickte auf. »Ich bin Kai.«
»Na, schön für dich«, kommentierte Frank mit sarkastischem Unterton, während er sich mit den Fingern in kreisenden Bewegungen über die Schläfen rieb.
»Ich bin auf dem Weg zur Arbeit«, fuhr Kai unbeirrt fort.
»Daraus wird wohl nichts«, knurrte Frank. »Die Bierkästen stapeln müssen jetzt andere.«
»Was?«
»Ach, hör nicht auf ihn.« Sophia schüttelte den Kopf. »Das ist eben Frank, ein Trottel aus meinem Semester. Ich bin Sophia.«
»Hallo, Sophia.«
»Was machen wir jetzt, Kai?«
»Ich weiß nicht. Was war mit dem Mann los?«
»Was schon?«, sagte Frank. »Der hatte eben ’n zerfressenes Hirn. Gibt es Zehntausende davon in Berlin.«
»Ist der immer so?«, fragte der Türke.
»Ach, weißt du, Hunde, die bellen, beißen nicht«, antwortete Sophia.
»Ich bin Can.«
»Gibt’s hier ’nen Notfallknopf, Can?«
»An der Tür ist einer, aber da steht, dass man mit dem Fahrer verbunden wird.«
Frank lachte auf. »Wirklich? Gelobt sei das Sicherheitssystem. Da wurde wirklich an alles gedacht.«
»Wo ist der Fahrer wohl hin?«, fragte Sophia.
Can schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung.«
»Ich muss jetzt hier raus!«, sagte Frank bestimmt. Er öffnete eine Deckenluke über der Tür und zog am Nothahn für die Türentriegelung.
»Mach keinen Blödsinn«, schritt Sophia ein.
Frank aber hörte nicht auf sie. Mit einem Ruck schob er die Tür auf und lugte auf den Bahnsteig. Es war niemand zu sehen. Frank stieg aus, ging bis zum dritten Wagen der U-Bahn vor und sah durch eine offen stehende Tür. Der Zugführer hockte neben einer Frau, die mit einer blutenden Halswunde bewusstlos am Boden lag. Etwas war aus seiner Stirn herausgetreten. Schwarz und wurmartig wand es sich wieder zurück in die transparente Aussackung der Haut. Der Zugführer hob langsam seinen Kopf, sah Frank einen Augenblick mit leeren Augen an, sprang mit einer zuckenden Bewegung auf, stürzte sich auf Frank und riss ihn zu Boden. Frank versuchte mit aller Gewalt, ihn von sich wegzudrücken, doch wie ein bisswütiger Hund näherte sich der Zugführer mit aufgerissenem Mund und gefletschten Zähnen immer weiter seinem Hals. Die ausgebeulte Stirn pulsierte, als die Würmer wie in Ekstase in der aufgeweichten Hirnsubstanz zirkulierten. Frank schrie auf. Die Zähne des Mannes berührten seine Haut, als ihn jemand von hinten packte, hochhob und zwischen zwei Wagen ins Gleisbett schleuderte. Es war Kai, der Frank zu Hilfe geeilt war. »Lass uns abhauen«, sagte er merkwürdig unaufgeregt und griff sich an den Rücken, als hätte er Schmerzen.
»Die Treppe!«, schrie Sophia aus dem Hintergrund.
Sophia und Can voran, sprangen alle vier die Stufen nach unten, rannten zum Ausgang der Station und blieben an den Platanen stehen, die die Gitschiner Straße säumten. Ein Auto raste dicht an ihnen vorbei und erfasste ungebremst an der Ecke Mehringdamm einen Mann, der wie eine Puppe durch die Luft geschleudert wurde, um dann mit dem Kopf voran auf dem Asphalt aufzuschlagen. Der Fahrer fuhr weiter und ließ sein Opfer mit verdrehten Armen und Beinen auf dem blutigen Teerbelag zurück.
Brummende Laute drangen vom anderen Ende der Straße zu ihnen hinüber. Ein fremdes Grunzen und Stöhnen, wie aus Tausend Kehlen. Die vier drehten sich ruckartig um.
»Soll das ’n Witz sein?«, fragte Frank, als er sah, wer da auf sie zukam. Entlang der Straße und der Bürgersteige in einer Phalanx aufgereiht kamen schwarzhaarige Männer mit langen Bärten auf sie zu, Goldkettchen-behangen, um die Stirn ein grünes Tuch mit arabischen Schriftzeichen gebunden. Sahen aus wie eine Mischung aus Islamist und Zuhälter. Langsam, aber unaufhaltsam wie die zweite Welle eines Tsunamis schoben sie sich dichtgedrängt voran. Ein Armageddon zuckender Körper, eine Kakophonie grunzender Laute. Als wären die vier Zuschauer und nicht die Objekte der Sehnsüchte, die geliebte Beute einer entfesselten Horde, standen sie wie paralysiert da, unfähig, ihre Blicke von diesem Schauspiel abzuwenden.
»Verdammte Scheiße«, flüsterte Frank dann, als die Meute nur noch Hundert Meter entfernt war. Eine junge Frau, die selbstvergessen Selfies von sich und den Entfesselten schoss, wurde umringt, niedergerissen und verschwand in einem Wald von Stirntüchern und Bärten.
»Wir müssen ... hier ... weg! Kommt!«, stammelte Can, drehte sich um und lief los.
Sophia und Frank sahen sich noch einen Augenblick fassungslos an.
»Wir müssen Djang hinterher«, sagte Kai dann und rüttelte Frank an der Schulter. Zögernd und ungläubig nickte der ihm wortlos zu, stand aber noch einen Moment mit offenem Mund da, als konnte er sich noch nicht damit abfinden, dass sein Leben, wie er es bisher kannte, nicht mehr existierte.
4.
Bundeskanzleramt, Büro des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland.
Der Kanzler kraulte sich zufrieden sein brandneues Gemächt, wie es ihm der Arzt empfohlen hatte, um die Durchblutung zu fördern, als der Chef des Kanzleramts Neumeier hereinplatzte, ohne an die Tür zu klopfen. Ungehalten sah der Kanzler zu ihm auf und fragte sich, ob er derlei ungebührliches Verhalten ahnden sollte. Mitarbeiter waren zu Respekt angehalten, schließlich war er Kanzler der Bundesrepublik Deutschland in einer überaus erfolgreichen ersten Amtszeit, nicht mitgerechnet die drei Amtszeiten, die er vor der Geschlechtsumwandlung als Kanzlerin die Geschicke des Landes lenkte. Wandelbarkeit hatte er schon als Frau bewiesen. Sich anpassen zu können, war eine seiner herausragenden Fähigkeiten. Und nach zwölf Jahren wollte das Volk wieder einen Mann an der Spitze des Staates wissen. Jemanden, der etwas mehr Territorialverhalten zu zeigen in der Lage war, als ihm dies als Frau notwendig erschien. Der Kanzler blickte auf das Bild, das auf dem Schreibtisch vor ihm stand. Trotz aller Überredungsversuche hatte er seinen Ehemann nicht davon überzeugen können, den umgekehrten Weg der geschlechtlichen Transformation einzuschlagen, so dass sie nun in homosexueller Ehe zusammen lebten. Er nahm das Bild, zog die obere Schreibtischschublade heraus, legte es hinein und schloss die Schublade wieder. Immerhin, so dachte er sich, war er sich nun der Unterstützung der Schwulenverbände sicher.
»Frau, Herr ... äh ... BundeskanzleriX* (*seit Oktober 2017 geschlechtsneutrale Anrede des Bundeskanzlers)«, brachte Neumeier außer Atem hervor, das Gesicht kreidebleich, »es gibt beunruhigende Meldungen ... so viele ... viele ...«
»Reißen Sie sich zusammen, Neumeier. Hören Sie auf zu stammeln.«
»Ich ... ich ... wir sind hier nicht mehr sicher.«
»Was?«
»In Kreuzberg ...« Neumeier taumelte zum Schreibtisch und stützte sich an der Tischplatte ab, als wäre ihm schwindlig. »Die Menschen fallen übereinander her ... Ausschreitungen und Morde ... massenhaft. So etwas hat es noch nicht gegeben. Eine Polizeistation ist ... überrannt worden.«
»Was? Soziale Unruhen? Hier? In meinem Land?«
»In Kreuzberg.«
»Kreuzberg?«
»Beim Halleschen Tor, in der Nähe der Zentrale der Sozialdemokraten hat alles angefangen.«
»Bei den Sozis? Was haben die damit zu schaffen?«
»Ich glaube nicht, dass die Sozis was damit zu tun haben.«
»Die sollen sich nicht so aufregen. Ich brauchte halt einen neuen Koalitionspartner. Und da kamen mir diese schwanzlosen Ökos eben ganz recht.«
»Ich glaube nicht ... die Morde ... so was hat es noch nicht gegeben ... es ist .. es ist außer Kontrolle.«
»Was erzählen Sie da für einen Unsinn, Neumeier.« Der Kanzler stand auf und fasste sich in den Schritt. »Lassen Sie meine Limousine kommen. Ich werde zum Reichstag fahren. Los – beeilen Sie sich.«
»Aber ... die Sitzung ... sie kann nicht ... sie wird ausfallen müssen. Es ist nicht mehr sicher in Berlin.«
»Mein lieber Neumeier, da muss schon mehr kommen als ein paar wildgewordene Sozis, dass ich nicht vorm Parlament spreche.«
5.
Kreuzberg, Mehringplatz.
Wie eine Herde aufgeschreckter Rinder liefen die Menschen panisch mal in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Can, Sophia und Frank flüchteten in den Eingang der Wohnanlage, die den Mehringplatz kreisförmig umschloss. Frank hielt die Tür für Kai auf, der nicht mit ihnen hatte Schritt halten können. Die Hände um seinen Bauch gehalten, als wollte er ihn festhalten, sah er sich immer wieder nach den bärtigen Männern um, die sie unbarmherzig verfolgten.
»Mensch komm, oder willst du sterben?«, rief Frank ihm zu.
»Ich will nicht sterben«, sagte Kai, als wäre es nötig, Frank davon zu überzeugen.
»Dann beeil dich!«
Als Kai sich ins Treppenhaus gerettet hatte, schlug Frank die Tür hinter ihm zu und stemmte sich mit dem Körper dagegen. Die Verfolger prasselten gegen die Scheibe, Köpfe schlugen gegen das Glas. Bald schon zerplatzten die ersten Beulen und eine Masse aus Würmern, Hirn und Flüssigkeit floss die Scheiben herunter. Das Schloss sprang auf, und die Tür öffnete sich einen Spalt.
»Hilf mir, verdammt!«, schrie Frank.
Nun stemmte sich auch Kai mit seinem schweren Körper gegen die Tür. Und ebenso Sophia, die schon in die erste Etage hochgelaufen war, eilte herbei und drückte sich gegen den Türrahmen.
»Wo ist eigentlich dieser Türke?«, fragte Frank.
»Can klingelt überall«, presste Sophia stöhnend hervor. »Bisher hat aber niemand aufgemacht.«
»Guck schon nach, was der macht. Lange können wir die eh nicht mehr aufhalten«, forderte Frank.
Sophia nickte, ließ die Tür los und rannte die Treppe hoch.
»Nun lauf schon hinterher«, befahl Frank Kai.
Doch der schüttelte den Kopf. »Ich lass dich nicht alleine.«
»Ich bin schnell. Ich komme nach. Also, mach schon.«
»Tust du das?«, fragte Kai.
»Nun renn schon los, du fetter Trottel.«
Kai ließ die Tür los und schleppte sich schwer atmend, eine Hand am Geländer, die Stufen hoch.
Frank konnte nicht verhindern, dass die Tür noch weiter aufgedrückt wurde und sich der Kopf eines der Bärtigen durch den Türspalt presste.
»Wir sind ganz oben! In der dritten Etage!«, rief Sophia durch das Treppenhaus. »Komm hoch!«
Sofort ließ Frank die Tür los und rannte die Stufen hoch. Als der metallische Türrahmen gegen die Betonwand schlug, zersprang das Glas der Scheibe. Derartig viele Verwandelte drängten ins Treppenhaus, dass sie sich gegenseitig blockierten und im Türrahmen stecken blieben. Die nächste Welle der Angreifer trampelte die Eingequetschten nieder und ergoss sich ins Treppenhaus.
Frank blickte die Treppenflucht nach unten und sah, wie Welle um Welle an Bärtigen hereinstürmte und sich ungeordnet und wild, aber unwiderstehlich die Stufen nach oben schob.
Sophia erwartete ihn an der offenen Tür einer Wohnung im dritten Stockwerk.
»Verrammeln!«, schrie Frank, als er die Tür zuschlug und die Vorhängekette einhängte. »Irgendwas muss noch davor.«
»Das Schuhregal da«, schlug Sophia vor.
»Ja, zum Teufel, Beeilung!«
Zusammen mit Kai hoben sie das Regal an, trugen es bis zur Tür, setzten es ab und schoben es bis an die Schwelle heran.
Frank drehte sich um. »Wer wohnt hier eigentlich?«
»Keine Ahnung«, sagte Sophia. »Die Tür war offen. Niemand war da.«
»Können wir abschließen?«
Sophia schüttelte den Kopf.
»Vielleicht bringt der arme Kerl gerade den Müll runter«, vermutete Frank.
»Keine gute Zeit dazu«, erwiderte Kai.
Frank nickte. »Verdammt, das kann man wohl sagen«, gab er ihm recht, ging durch den Flur und erblickte Can, der auf der Loggia stand und gebückt hinter einer Zimmerlilie Deckung zu suchen schien. »Feiges Schwein!«, schrie Frank, ging auf den Balkon hinaus und rempelte Can von hinten an.
»Sei leise«, zischte Can, ohne sich umzudrehen.
»Was meinst du?«
»Na, guck dir das an.«
Frank sah zum Mehringplatz hinunter. Die Bärtigen fielen über die Menschen her, rissen sie nieder und bissen sich in ihren Hälsen fest. Rasend vor Zorn stürmten sie auf Greise zu, griffen Frauen an und verschonten selbst die Kinder nicht, grunzend, wie stumpfe Jäger, die nicht satt wurden. In enthemmter Raserei überrannte die Horde ihre Opfer, ungeachtet, ob diese wegliefen oder schicksalsergeben, nahezu apathisch, auf den Bänken sitzen blieben. Ein paar Verzweifelte, die versuchten, an der Säule inmitten des Brunnens im Zentrum hinaufzuklettern, wurden heruntergerissen und einer nach dem anderen niedergemacht. Die kreisförmig angelegte Wohnanlage umschloss vollständig den Platz, so dass sich Frank auf dem Balkon in der dritten Etage wie auf der Tribüne des Kolosseums fühlte. In seiner Loge verfolgte er den verzweifelten Abwehrkampf derjenigen, die am Boden lagen, traten, schlugen und schrien, um irgendwann, als ihre Kräfte nachließen, von den Bärtigen vereinnahmt zu werden. Als der letzte Schrei verstummt war, erfüllte ein Grunzen und Schmatzen den Platz.
»Sind das Vampire oder was?«, fragte Sophia als Erste, obwohl auch Frank und Kai Ähnliches dachten.
»Nein«, widersprach Can. »Keine Vampire. Seht nur da rüber.« Er zeigte auf eine Frau, die auf der Brüstung des Brunnens lag. Ein Bärtiger, der sie in den Hals gebissen hatte, beugte sich über sie, zog sein grünes Stirnband ab und rieb seine Stirn an ihrem Hals.
»Was macht der da nur?«, fragte Frank.
»Die wird ... so ... die wird befruchtet«, vermutete Kai und grinste unwillkürlich.
»Du bist echt widerlich«, wies Sophia ihn zurecht.
Frank runzelte die Stirn. »Vielleicht liegt er richtig. Sieht irgendwie wirklich so aus, als wollte der sie beimpfen.«
»Beimpfen?«
»Ich meine, irgendwas in die Wunde einbringen.«
Sophia hielt sich die Hand vor den Mund und stieß auf, als müsste sie sich übergeben. »Ihr beide seid echt widerlich.«
»Was heißt hier wir? Die machen das doch«, verteidigte sich Frank.
»Was sind das nur für Typen?«, fragte Can, immer noch gebannt auf die Angreifer blickend, die jetzt zu Hunderten ihre Stirnbänder gelüftet hatten und sich an den Hälsen ihrer paralysierten Opfer rieben. »Zombies?«
»Das sind keine Zombies«, widersprach Kai.
»Woher willst du das wissen?«, fragte Can.
»Ich spiele immer so Zombiesachen auf meiner PSP, wa? Die strecken die Arme nach vorne aus und machen immer uuhh und oohh, manchmal auch uuurg. Aber die hier sind irgendwie ... anders, wa? Das sind keine Zombies.«
»Ist doch vollkommen egal, wie die heißen«, mischte sich Sophia ein.
»Auch die Beule, die ist nicht typisch«, ergänzte Frank bedeutungsvoll, als handelte es sich um eine wissenschaftliche Diskussion.
»Nicht bleich, ganz braun sind die. Die sehen aus wie aus’m Solarium«, stellte Kai fest. »Sind die überhaupt untot?«
»Also ich geh jetzt nicht runter und fühl den Puls«, sagte Can.
»Wenn wir ’ne Wärmebildkamera hätten, könnten wir prüfen, ob die noch Körpertemperatur haben«, überlegte Frank.
»Ja, so ’ne Kamera wäre echt cool«, sagte Kai und grinste.
»Jungen und Technik«, lästerte Sophia.
»Zombies essen eigentlich Hirn, oder?«, fragte Can nach.
»Nicht immer«, sagte Kai. »Manchmal ziehen sie den Leuten auch die Schläuche raus.«
»Mmh, da haste auch wieder recht.«
»Vielleicht ist es was zwischen Zombie und Vampir?«, schlug Can vor.
Frank sah Can verächtlich an. »Und die Bärte und die grünen Stirnbänder mit arabischer Schrift?«
»Ja und?«
»Klingelt da nichts?«
»Was sollte da klingeln?«
»Das sind deine Glaubensbrüder, du Arsch. Deine salafistischen Freunde aus den interkulturellen Zentren hier«, sagte Frank mit sarkastischem Unterton.
»Du kannst mich mal«, wiegelte Can ab.
»Auf jeden Fall scheinen deine Freunde in religiösen Fragen eine relativ harte Auslegung des Glaubens zu praktizieren«, stellte Frank spöttisch fest. »Seht: Über die normalen Kopftücher sind sie auch hergefallen.«
»Auch die mit den Taucheranzügen haben sie geschnappt«, ergänzte Kai.
»Tschador nennt man das«, erklärte Can genervt.
»Auch die Schwarzen mit den Sehschlitzen mussten dran glauben«, fügte Frank hinzu.
»Die sehen so aus wie die Sturmtruppen auf der Eiswüste Hoth bei Star Wars. Nur in Schwarz, wa?«, sagte Kai und sah zu Frank hinüber. »Das sind Mombies«, glaubte er, ihr Namensproblem gelöst zu haben.
»Mombies?«, fragte Frank nach.
»Ja, Mombies. Halb Moslem, halb Zombie.«
Frank lächelte. »Du bist ja echt ’n Witzbold, was?«
»Sagt mein Papa auch immer«, bestätigte Kai.
Can schüttete den Kopf. »Ihr seid doch nicht mehr ganz dicht.«
Halb Mensch, halb Zombie«, warf Sophia ein, wobei sie die Betonung auf Mensch legte.
»Immer noch politisch korrekt, selbst in der Apokalypse«, bemerkte Frank kopfschüttelnd.
»Ja und? Was stört dich daran?«, fragte Sophia.
Frank sah nun irritiert zum Mehringplatz hinunter. »Die Frauen mit dem Ganzkörperkondom. Die mit der Burka, die werden gar nicht angegriffen«, stellte er verblüfft fest.
»Nein. Die stehen einfach da in der Ecke rum«, bemerkte nun auch Kai die Burkaträgerinnen in einem Durchgang der Wohnanlage.
»Das komplette Programm«, sagte Frank zu Can gewandt, »die Vollverschleierung scheint für deine Freunde also OK zu sein.«
»Meine Freunde?«
»Na, deine Glaubensbrüder.«
»Du kannst mich mal«, sagte Can verärgert und ging zurück ins Wohnzimmer.
Frank holte sein Smartphone aus der Jackentasche, schaltete es an und sah auf die Anzeige. »Hast du vielleicht Empfang?«, fragte er Sophia. Die schüttelte den Kopf.
»Kein Internet, kein Telefon. Jetzt kann ich nicht mal unter Hashtag Zombie-Apokalypse ein Bild posten. Wie viele Likes gehen mir da wohl flöten? Das ist das Ende«, sagte Frank und grinste.
»Du bist aber auch ’n Witzbold«, bemerkte Kai.
»Viel schlimmer als das.«
»Viel schlimmer?«
Frank klopfte Kai auf die Schulter. »Ach, nichts.« Die drei verließen den Balkon, und Frank schloss die Tür hinter sich.
»Wir brauchen ’ne Schrotflinte«, sagte Kai. »Damit kann man diesen Dingern den Kopf wegpusten.«
»Wäre nicht schlecht«, stimmte Frank zu. »Wir sind hier aber nicht in den Staaten, sondern in Good Old Germany. Und ’ne fucking Zombie-Apokalypse in Deutschland zu überstehen bei all unseren Waffengesetzen wird ‘ne verdammte Handarbeit.« Frank drehte sich zu Can um. »Wer wohnt hier eigentlich? Nicht zufällig ’n Moslem? Dann könnten wir ja versuchen, uns die Jungs mit ’nem Koran vom Leibe zu halten.« Frank hob die Hände, als hielte er ein Buch zur Verteidigung in die Höhe. »Wir sind doch Brüder, oh meine Mombies, Brüder im Geiste«, flehte er mit ironischem Unterton.
»Brüder ...«, äffte Kai nach und lachte.
Can schüttelte nur den Kopf, ohne zu antworten und verließ das Wohnzimmer.
»Nun lass ihn doch in Ruhe!«, forderte Sophia Frank auf.
»In Ruhe lassen? Wir haben diese Typen viel zu lange in Ruhe gelassen. Deshalb haben wir jetzt ja diesen Schlamassel.«
»Hör auf, ihn zu diskriminieren.«
»Diskriminiiieren«, stöhnte Frank. »Das Wort darf natürlich auch nicht fehlen. Was bin ich denn noch? Rassistisch? Sexistisch? Was? Guck doch nach draußen. Was sagt ihr immer? Wir haben die Nation überwunden? Na, da bin ich aber froh, dass wir jetzt alle wunderbare Europäer sind. Hey, Weltbürger, gleichgespült, mit etwas weicher Birne zwar, aber, man, was soll’s?« Frank riss die Arme hoch. »Gibt es wenigstens keine Unterschiede mehr. Ihr habt euer Ziel erreicht. Endlich sind wir alle wahrhaftig gleich: eine blökende Herde.«
Sophia setzte an, um Frank Paroli zu bieten, als plötzlich Can nach ihnen rief. Sie gingen ins Schlafzimmer, in dem Can vor der Wand stand und die Totenkopfmasken bewunderte, die dort hingen. Das Zimmer war komplett in Schwarz gestrichen, das Bett mit schwarzer Wäsche bezogen.
»Wo sind wir denn da reingekommen? Pulp Fiction oder was?«, fragte Frank.
»Das scheint ’n Grufti zu sein«, vermutete Sophia.
»Gruufti?«, wiederholte Kai fragend.
Sophia öffnete den Kleiderschrank. »Nee, kein Grufti«, sagte sie und deutete auf die Peitsche und die Handschellen, die dort an Haken hingen. »Irgendsoein SM-Typ.«
»SM-Typ?«, fragte Frank und blickte zu Can hinüber. »Muss wohl ’ne Herzensangelegenheit gewesen sein, als du die Wohnung ausgesucht hast.«
»Jetzt lass ihn doch endlich in Ruhe«, verteidigte Sophia Can. »Sag mir lieber, was wir jetzt machen.«
»Frag doch den Türken. Der ist doch der Experte.«
»Arschloch«, zischte Can.
Frank verließ das Schlafzimmer, ging durch den Flur zurück zur Wohnungstür, stützte sich auf der Kommode ab und sah durch den Spion. »Verdammt ... die sind immer noch da«, rief er und ging zurück ins Schlafzimmer. »Das habt ihr uns eingebrockt mit eurem scheiß Fanatismus«, giftete er zu Can gewandt.
»Nun lass gut sein«, redete Sophia beschwichtigend auf ihn ein.
»Was hast du denn? Sind doch nun mal seine Glaubensbrüder.«
»Es könnten ja auch Christen sein.«
»Sind es aber nun mal nicht.«
»Könnten aber.«
»Bringt uns das jetzt weiter?«
»Es sind Menschen.«
Frank verdrehte die Augen. »Vielleicht vor dem Wurm. Aber jetzt nicht mehr.« Er ging auf Can zu und schubste ihn aufs Bett. »Konntet nicht genug bekommen. Lebt hier in Freiheit bei uns und konntet das nicht ertragen. Zieht euren kleinen Töchtern Kopftücher über. Was glaubt ihr eigentlich, wo ihr seid?«
Von schmächtiger Statur, musste Can einen Kampf gegen den um einen Kopf größeren Frank vermeiden und sah auf den Boden.
Sophia schritt ein und stellte sich zwischen ihn und Can. »Du glaubst doch nicht wirklich, dass der Islam damit was zu tun hat?«
»Oh Gott, wie ich diesen Spruch liebe. Hat der Islam eigentlich mit irgendwas zu tun? Womit hat der Islam denn überhaupt was zu tun? Mit Religion jedenfalls nicht. Und Vernunft wohl am wenigsten.«
»Immer noch besser als eure scheiß Religion«, platzte es aus Can heraus.
»Wer glaubt’s denn? Jetzt wird der auch noch frech.«
»Ihr habt doch mit den Kreuzzügen angefangen. Ihr habt die Menschen in Jerusalem wie Vieh abgeschlachtet.«
Frank lachte auf. »Hast wohl vergessen, wie sich eure stumpfsinnige Sache ausgebreitet hat, was? Feuer und Schwert? Noch ein Begriff? Das war lange vor den Kreuzzügen, mein Lieber.«
»Wir haben euch Barbaren die Kultur gebracht.«
»Ihr habt Köpfe abgeschnitten. So wie ihr es heute macht. Eine Bande von Mördern, damals wie heute.«
»Ihr habt doch den IS stark gemacht«, verteidigte sich Can. »Ihr mit euren Kriegen in Afghanistan und Irak.«
»Wir? Du meinst wohl die Amis.«
»Das sind Christen wie ihr.«
Frank lächelte. »Du kannst mich eh nicht beleidigen. Ich bin zwar Christ, aber ich praktiziere nicht.«
»Das ist ja euer Problem. Ihr seid so reine Theoretiker, ihr Deutschen.«
»Was willst du denn, Türke.« Frank baute sich drohend vor Can auf.
Dann trat Kai zwischen die beiden. »Ihr solltet nicht streiten.«
Sophia nickte. »Schon vergessen? Da draußen?«
Frank blickte auf sein Handy. Immer noch gab es keinen Empfang.
Can stand auf, ging zum Kleiderschrank und zog ein schwarzes Laken heraus. Dann ging er in die Küche. Als er zurückkam, hatte er sich das Laken übergezogen. Zwei Sehschlitze waren auf Höhe der Augen in die Baumwolle hineingeschnitten.
»Soll das ’n Witz sein?« Frank schüttelte den Kopf.
Can hielt Sophia eine Schere hin. »Wir dürfen nicht auffallen. Bei den verschleierten Frauen hat es ja auch geklappt.«
»Meinst du, dass wir sie täuschen können?«, fragte Sophia, nahm die Schere in die Hand und zog ein Laken aus dem Kleiderschrank.
»Soll das ’ne Art Voodoo-Zauber werden oder was? Wir sind Naturwissenschaftler«, glaubte Frank Sophia ins Gedächtnis zurückrufen zu müssen.
»Das ist wie früher bei Halloween!«, stieß Kai begeistert aus, nahm das Laken mit den Aussparungen für die Augen, die Sophia für ihn hineingeschnitten hatte, und zog es sich über.
»Also ich werde hier nicht wie ’n Gespenst rumlaufen und auf die Gutmütigkeit von Islamisten hoffen. Ich werde mir Waffen besorgen.«
»War eh kein Laken mehr im Kleiderschrank«, sagte Can gleichgültig.
»Djang ist ’n Trickser«, sagte Kai.
»Was meinst du?«
»In Computerspielen muss jeder irgendwas sein. Und du bist ’n Trickser.«
Can lächelte. »Vielleicht hast du recht.«
Kai, Sophia und Can standen mit ihren schwarzen Überwürfen vor dem Bett, als Frank mit einem Wischmop in der Hand zurückkam. Mit Paketband hatte er am vorderen Ende notdürftig ein Küchenmesser befestigt. »Du meine Güte. Eine Bande von Irren«, kommentierte Frank die Erscheinung der drei. »Und das soll unsere bärtigen Freunde abschrecken?«
Sophia hielt ihm die Schere hin. »Du musst das bezogene Laken nehmen. Sonst ist keins mehr da.«
Frank nahm die Schere in die Hand und zeigte auf das Bett. »Du meinst das Laken mit den Flecken drauf?«
»Dir bleibt keine Wahl.«
Frank führte mit seinem improvisierten Speer Stoßbewegungen durch. »Das denke ich nicht. Ich werd’s denen schon zeigen.«
»Wo wollen wir hin?«, fragte Sophia.
»Hauptsache raus aus Kreuzberg«, schlug Frank vor.
Sophia nickte. »Die Friedrichstraße hoch. Bis zum Checkpoint Charlie müssten wir es schaffen.«
»Wir können die U-Bahn-Röhre langgehen«, sagte Can.
»Die U6?«, fragte Sophia.
Can nickte. »Ich denke nicht, dass die jetzt noch fährt. Und die Zombies sollten noch nicht da unten sein.«
»Lass uns die Lage checken«, schlug Sophia vor. Die vier gingen auf die Loggia und sahen auf den Platz hinunter.
»Das gibt’s doch nicht«, sagte Can. Gebannt starrten die vier auf die bärtigen Männer, die die von einer Engelsskulptur gekrönte Säule in der Mitte des Platzes umkreisten.
»Das ist ja noch besser, als ich geglaubt hab’«, stieß Frank aus. »Und was sagt ihr jetzt? Bleibt euch wohl die Spucke weg, was?«
»Es ... ich ... bin ...«, stammelte Can.
»Die haben wohl in den Pilgermodus geschaltet«, glaubte Frank zu wissen. »Denken, dass sie in Mekka sind.«
Sophia legte eine Hand auf Cans Schulter. »Lass gut sein. Ich weiß, dass es nichts mit deinem Glauben zu tun hat«, sagte sie dann aufmunternd.
»Wir sind nicht so«, sagte Can, den Blick auf die Meute gerichtet. »Wir sind barmherzig. So sind wir nicht...«
»Ihr seid wurmverseuchte Fanatiker. Das seid ihr und das ist eure Natur«, sagte Frank und zeigte auf die Zombies.
Aus dem Flur war ein klickendes Geräusch zu vernehmen, als steckte jemand den Schlüssel in den Zylinder der Wohnungstür.
»Was zum Teufel...? Was soll denn das?«, fragte Frank entgeistert. »Können die jetzt schon Türen öffnen oder was?« Er rannte zur Wohnungstür und hielt seinen Wischmop-Speer hoch. Die Tür öffnete sich einen Spalt, die Kommode wurde langsam nach hinten geschoben und die Türkette spannte sich. Ein Kopf erschien im Türspalt. »Was soll das?«, fragte ein glatzköpfiger Mann mittleren Alters. »Wer ist da in meiner Wohnung?« Plötzlich schrie er auf. »Um Himmels willen!« Eine Hand legte sich auf den Kopf des Mannes, und er wurde von der Tür weggerissen. Kai und Sophia stürmten herbei, hängten die Türkette aus und zogen die Kommode von der Tür weg. Frank öffnete die Tür, holte mit seinem Speer aus und schob ihn einem der Zombies, die sich auf den Mieter gestürzt hatten, in die Stirn. Das Messer blieb im Kopf stecken und riss vom Mob ab. Zwei weitere Zombies überwältigten den schreienden Mieter und rissen ihn zu Boden. Die anderen Zombies aber griffen Frank an, der in die Wohnung flüchtete. Er stemmte sich gegen die Tür, doch die Zombies waren stärker und drückten sie auf. Unwiderstehlich drängten sie in den Flur, ignorierten Kai, Sophia und Can in ihren Kostümen und torkelten auf Frank zu, der gerade noch rechtzeitig die Schlafzimmertür hinter sich zuschlug, bevor die Zombies ihn zu greifen bekamen.
Es hämmerte an die Tür. Zuerst war es eine Faust, dann zwei, dann drei. Die Tür vibrierte in den Angeln, das Holz knirschte. Frank sah sich verzweifelt im Zimmer um. Durch das schmale Fenster konnte er nicht fliehen. Er öffnete den Schrank, nahm eine Handschelle und steckte sie in die Jackentasche. Keine Waffe zu finden. Er sah zur Tür. Kein Schlüssel im Schloss. Er zog das befleckte Laken vom Bett ab, riss zwei Sehschlitze hinein und warf es sich über. Eine Weile stand er nur da und starrte auf die Klinke. »Verdammt nochmal«, murmelte er. Das Trommeln gegen die Tür wurde immer stärker, als die Klinke nach unten gedrückt wurde und zwei Zombies in den Raum torkelten. Die Körper fahrig, die Münder aufgerissen, die Stirnen gewölbt. Die hinter der transparenten Haut sich windenden Würmer verfärbten ihre Leiber mal ins Rote und mal ins Grüne. Die Augen der Zombies lagen in tiefen Augenhöhlen, als würde die schrumpfende Hirnmasse sie ins Innere zurückziehen. Ihr Blick leer, schienen sie Frank, der bewegungslos neben dem Bett stand, unter dem schwarzen Überwurf nicht zu erkennen. Frank ging langsam auf die Tür zu, wurde angerempelt, aber nicht angegriffen. Er schlich durch den Flur, wobei er sich dicht an der Wand hielt. Die Zombies zogen sich ihre Stirntücher über, um die Aussackung mitsamt den Würmern wieder in den Schädel zu drücken. Ohne Opfer in der Nähe zu wähnen, schienen sie in eine Art Starre zu verfallen. Frank erreichte das Treppenhaus und stieg die Stufen nach unten. Nur apathisch dastehende Zombies, aber keine Menschen mehr. Auch nicht Sophia, Kai oder Can. Der Eingang zum U-Bahnhof »Hallesches Tor« lag direkt vor der Wohnungstür. Vielleicht hatten sich die drei an ihren Plan gehalten und flüchteten über die Gleise nach Mitte. Auf der Treppe zur U-Bahn stand ein langhaariger blonder Mann. Helle Baumwollkleidung, Birkenstockschuhe. Typ alternder Achtundsechziger. Kreidebleich war er, die Augen eingefallen, die gewölbte Stirn unter einem Schweißband verborgen. Die eingerollte Weichschaummatte hatte er noch unter den Arm geklemmt. Yogaübungen würde er aber keine mehr machen, dachte Frank. Und dann wurde ihm bewusst, dass das wohl der erste, aber nicht der letzte Konvertit war, der ihm über den Weg laufen würde.
6.
Schloss Bellevue. Im Schlosspark.
Staatssekretär Padolla öffnete seine Augen und sah in den strahlend blauen Himmel. Mit einer Hand fuhr er sich durch das Haar und tastete den Sitz seiner Frisur ab. Der Seitenscheitel hatte durch den Sturz nicht gelitten. Er wischte sich mit der Hand über das Gesicht. Als er den Hals entlangfuhr, blieb er in etwas Fremdem stecken. Er zog daran, doch es ließ sich nicht so einfach entfernen. Er blickte an sich hinab und sah, dass es ein Hautfetzen war, den er in der Hand hielt. Die Haut schnappte zurück, als er sie losließ. Er tastete die tiefe Wunde am Hals ab und fuhr die freigelegten Adern entlang. Die Wunde blutete nicht, und er fühlte keinen Schmerz. Mit einem Ruck setzte er sich auf und sah sich um. Es war niemand mehr im Park, aber auf der Straße zog jetzt eine Parade entlang. Es mussten Tausende sein, die durch den Tiergarten in Richtung Reichstag drängten. Doch war es wirklich eine Parade? Welcher Tag war heute? Obwohl Padolla lange überlegte, fiel es ihm nicht ein. Aber er wusste noch, was heute Vormittag passiert war. Seine Frau hatte ihn verlassen und war mit den beiden Kindern zu ihren Eltern nach München gezogen. Einen Bettnässer und Schwächling hatte sie ihn genannt. Einen Menschen, der vor allen anderen kriecht. Seine Frau hatte ihn verlassen, obwohl doch sie es war, die ihn betrogen hatte. Er erinnerte sich, wie er mit seinem Aktenkoffer in der Hand minutenlang schweigend vor ihr stand, als sie ihm ihre Entscheidung verkündete, er sich dann umdrehte und ging. Immerhin musste er sich nicht um das Wohl seiner Kinder sorgen, schließlich standen seiner Frau laut Ehevertrag 80 % seines Gehalts zu. Eigentlich kein Grund, sich zu beschweren, dachte Padolla, denn die verbleibenden 20 %, die er als Staatssekretär erhielt, waren mehr als genug. Zum ersten Mal hatte er heute im Bundespräsidialamt im Mittelpunkt stehen sollen. Eine kleine Zeremonie und die Überreichung einer Urkunde für seine treuen Dienste sollte er erhalten. Doch es war nicht mehr dazu kommen. Seine Ehefrau blieb nicht die Einzige an diesem Tag, die ihn im Stich lassen sollte. Auch der Bundespräsident war mit dem Hubschrauber abgeflogen, ohne an ihn zu denken. Padolla stand auf und blickte zur Straße hinüber. Die Menschen zogen wie in Trance vorbei, die Bewegungen merkwürdig zuckend. Wie in einer Prozession, begleitet von einem monotonen Grunzen und Stöhnen. Padolla wunderte sich darüber, dass keine Musik gespielt wurde. Von der neumodischen Art, wie er sie damals vernommen hatte, als er als Teenager zum ersten und einzigen Mal in seinem Leben eine Diskothek besucht hatte. Manchmal wachte Padolla noch immer nachts auf, geplagt von Alpträumen über dieses traumatische Erlebnis. Das Hämmern der Bässe aus den Boxen, vor seinem geistigen Auge die zuckenden Körper auf der Tanzfläche, die enthemmten Klassenkameraden, die wild in der blitzenden Lichterkulisse herumknutschten. Unweigerlich schüttelte Padolla den Kopf, denn nichts fürchtete er mehr als solch einen Kontrollverlust, zog er es doch vor, wie ein Butler bereitzustehen, ohne selbst Ansprüche zu stellen. Ein stechender Schmerz durchfuhr ihn. Er rieb sich die Stirn und kniff die Augen zu.
Du miese, kleine Type, schien ihm jemand von hinten zuzuflüstern.
Padolla drehte sich um, doch es war niemand da.
Du bist immer nur eine Randfigur gewesen, verhallte ein Gedanke in seinem Kopf. Wieder dieser stechende Schmerz. Padolla rieb sich über die Stirn. Dann zog er seine Jacke aus und ließ sie fallen, öffnete die Krawatte und knöpfte sein Hemd auf.
Du bist nur Inventar von Bellevue. Man hat dich wie einen Stuhl zurückgelassen.
Wieder diese Stimme. Padolla drehte sich um die eigene Achse. Es gab niemanden in der Nähe. Wer sprach da zu ihm?
Der Präsident hat dich verraten. Er ist ohne dich abgeflogen.
Es gab bestimmt einen Grund dafür, wehrte sich Padolla in Gedanken.
Ja. Weil du ein Niemand bist.
Ein Niemand? Ich bin der wichtigste Staatssekretär des Bundespräsidenten.
Du bist nur ein erbärmlicher Opportunist.
Das bin ich nicht.
Guck nach vorne.
Padolla rieb sich über die Stirn und folgte der Anweisung.
Was siehst du?
Menschen, die über die Straße gehen.
Es sind keine Menschen mehr.
Sie sehen aber wie Menschen aus.
Das sind sie aber nicht. Sie sind gebissen worden.
Gebissen?
Weißt du, wo sie hinwollen?
Nein.
Sie wollen sich rächen.
Rächen?
Sie wollen zu denjenigen, die euch alle verraten haben. Die euch preisgegeben haben. Die nicht zuhören wollten und die Verfassung missbraucht haben.
Ich verstehe nicht ...
Sie können es aber nicht schaffen ohne dich.
Ohne mich?
Du sollst ihr Anführer sein.
Ihr Anführer?
Du wirst ihnen den Weg zeigen.
Ich kann es nicht. Ich bin zu schwach.
Du gehörst jetzt zu unserer Gemeinschaft. Wir werden dir Stärke verleihen und die Kraft, die du dir immer gewünscht hast. Wir werden dich retten.
Wer seid ihr?
Wir sind viele.
Was wollt ihr?
Wir wollen eine neue Gesellschaft errichten.
Erneut durchfuhr Padolla ein stechender Schmerz. Er rieb sich an der Stirn. Immer wieder, solange, bis seine Hand heiß wurde. Doch auch dann rieb er weiter. So, als wollte er den Schmerz wegscheuern.
7.
Auf den Gleisen der U-Bahnlinie U6.
Frank konnte durch die Sehschlitze des Bettlakens in der Dunkelheit kaum etwas erkennen. Er orientierte sich an den Bahnschwellen und ging die U-Bahnröhre entlang. Es waren mehrere Hundert Meter bis zur nächsten Haltestelle. Ab und zu blieb er stehen und horchte, ob ein Zug heranfuhr oder fremde Laute auf die Anwesenheit von Zombies hindeuteten. Aus der Ferne glaubte er zu hören, wie jemand in den Schotter trat, doch dann herrschte wieder Stille. Von Sophia, Can und Kai war nichts zu sehen, und er wusste nicht, ob sie überhaupt in die U-Bahn geflüchtet waren. Hinter der nächsten Biegung sah er die Helligkeit am anderen Ende der Röhre. Das musste die Station »Kochstraße« sein. Eine U-Bahn stand dort abfahrbereit. Frank verließ die Gleise und benutzte eine Treppe, die zu einer Wartungsplattform führte. Er kniete sich hin und lauschte. Es war nichts zu vernehmen. Er zog das Bettlaken vom Kopf, rollte es zusammen und legte es sich über die Schulter. Dann nahm er ein Eisenrohr vom Boden auf, ging auf die offene Tür eines Aufenthaltsraums der Gleisarbeiter zu und lugte hinein. Mehrere Männer mit reflektierenden Westen saßen um einen Tisch herum und tranken Bier. Vor ihnen auf dem Boden lagen vier Leichen in einer einzigen, großen Blutlache. Ihre Stirnplatten waren zerschmettert, Blut, Würmer und Hirnsubstanz hatten sich auf dem Betonboden vermischt. Frank schlich an der Tür vorbei, öffnete ein Gitter, das nicht abgeschlossen war, und erreichte den Bahnsteig der Station »Kochstraße«. Hinter dem Abfertigungshäuschen auf dem Bahnsteig, dessen Fenster mit Spiegelfolie beklebt waren, seitdem dort niemand mehr arbeitete, sah er drei Gestalten entlanghuschen. Wie Gespenster bei Halloween sahen sie mit ihren übergeworfenen Bettlaken aus. Kai, dem das Bettlaken nur bis zu den Knien reichte, bemerkte ihn zuerst.
»Frank!«, rief er ihm freudig erregt zu. Dann drehte er sich zu den anderen beiden um. »Ich hab’ euch doch gleich gesagt, dass er es schafft.«
Frank ignorierte Kai, lief auf Can zu und schubste ihn. »Weshalb die Bettlaken? Woher wusstest du das?«, stellte er ihn zur Rede.
Can wehrte ihn ab. »Hey, spinnst du?«
»Woher wusstest du, dass die Laken was bringen?« Frank hob die Eisenstange drohend in die Höhe.
Sophia stellte sich zwischen die beiden. »Sag mal, hast du sie nicht mehr alle?«
»Der weiß doch was, der Türke. Die stecken doch alle unter einer Decke, diese verdammten Muselmanen.«
»Was weißt du denn schon?«, verteidigte sich Can. »Islam bedeutet Frieden.«
»Frieden?« Frank lachte auf. »So? Also wenn Moslems von Frieden sprechen, muss ich immer an den Film Mars Attacks denken. ,Wir bringen euch Frieden‘«, ahmte er mit hoher Stimme die Marsianer nach, hob seine Hand, formte mit den Fingern die Umrisse einer Pistole und schoss damit auf die anderen. Dabei stieß er Laute aus, als handelte es sich um eine Laserwaffe.
»Es ist halt alles ’ne Sache der Auslegung«, versuchte Can immer noch seine Religion zu verteidigen.
Frank winkte ab. »Na klar. Alles kann unterschiedlich interpretiert werden«, sagte er mit sarkastischem Unterton. »Den Zombiestreifen Dawn of the dead sehen einige auch als Kritik an der Konsumgesellschaft, andere amüsieren sich einfach, weil da ’n paar Körper zerfetzt werden. Djihad? Heißt ja eigentlich auch große Anstrengung, ne? Tschuldigung, wenn da eben ’n paar Köpfe abgeschlagen werden. Ist ja körperlich auch nicht ganz ohne.«
»Ach, halt’s Maul, du Arschloch«, zischte Can. »Und außerdem: Ich bin kein Türke, sondern ’n Kurde.«
»Ja und?«
Can drehte sich weg und ging ein paar Schritte weiter über den Bahnsteig. »Ihr habt doch keine Ahnung, wie das läuft.«
»Wie was läuft? Dann weißt du, was hier vor sich geht?«, fragte Frank.
Can drehte sich um und zog sich das Bettlaken ab. »Gar nichts weiß ich. Nur, wie man überlebt. Indem man nicht auffällt. Und wenn diese IS-Pisser eben nur Frauen in Burka ertragen können, dann sollen sie eben auch nur das bekommen.«
»Was sagst du da?«
»Ich versteh’ genauso wenig wie du, was hier vor sich geht, aber ich weiß, dass man sich anpassen muss.«
»Du hast das Laken genommen, weil die Zombies ...«
»... die Mombies«, korrigierte Kai.
»... wie auch immer ...«, fuhr Frank fort. »... diese Typen die Burka-Trägerinnen verschont haben?«
»Ich beobachte die Dinge und passe mich halt an.«
»Was soll das heißen? Dass du so ’n Zelig-Typ bist oder was?«
»Was bin ich?«
»Na, so ’n Zelig-Typ. Woody Allen. Kennt man wohl nicht in Anatolien?«
»Ich kenn’ Zelig auch nicht«, mischte sich Sophia ein. »Jetzt sag schon, was du meinst. Mimikry oder was? Wie eine Heuschrecke als wandelndes Blatt?«
»Ja, so ähnlich. Zelig ist auch so ’n Unauffälliger«, erklärte Frank. »Verwandelt sich immer in die Person, wie es sein Umfeld erfordert. Will sich immer anpassen. Steht er mit Ärzten zusammen, spricht er Minuten später ein perfektes Mediziner-Latein – aber nicht nur das. Er hat auch physisch seine Gestalt verändert, trägt plötzlich ’nen weißen Kittel und so.«
»Wie das?«
»Was weiß ich? Es geht ja nicht darum, ob es realistisch ist. Steht er also mit Rabbis zusammen, hat er plötzlich ’nen langen Bart. Es ist eben jemand, der die Konformität so verinnerlicht hat, dass er seine Gestalt wandeln kann. Der konnte gar nicht mehr seine eigene Meinung vertreten und wurde von seiner Umgebung vollkommen absorbiert.«
»Dachte eher, du stehst auf Chuck Norris«, warf Sophia spöttisch ein.
»Was?«
»Na, Law and Order ist doch eher so dein Ding. Hätte nicht gedacht, dass du auf Woody Allen stehst.«
»Na, Chuck ist immer noch besser als dein Freund Che, dieser miese Mörder«, wandte Frank ein.
»Du hast ja keine Ahnung«, verteidigte sich Sophia.
»Natürlich bin ich nicht so informiert wie ihr auf euren blitzgescheiten Asta-Kaffeekränzchen.«
»Wenn dir die Argumente ausgehen, dann beleidigst du.«
»Argumente? Welche Argumente hast du denn vorgebracht?«
»Mein Papa ist immer zum Autorennen gegangen«, meldete sich Kai.
»Was?«
»Er hat immer Rennen angeguckt, wa? Wenn die Rennfahrer das Gas durchgedrückt haben, weißt du, bei angezogener Bremse, die Reifen drehen also durch, total der Krach. Dann hört man nichts mehr. Mein Papa hat also gesagt: ,Der Lärm übertönt all das Geschwätz.‘ Ja, das hat er immer gesagt.«
Frank nickte anerkennend. »Kluger Mann, dein Papa.« Er ging bis zum Ende des Bahnsteigs vor, blickte in die Dunkelheit des Schachtes, dann drehte er sich um und ging zu den dreien zurück. »Lasst uns weiter. Ich gehe vor. Kai, du bildest die Nachhut.«
»Nachhut? Cool, wie im Ego-Shooter«, sagte Kai aufgeregt.
»Warum willst du vorgehen?«, fragte Sophia.
»Warum? Hallo? Weil man sich formieren muss. Starke nach außen und Schwache in die Mitte. Du bist doch Biologin. Paviane formieren sich ja auch, wenn der Feind kommt.«
»Paviane? Aus welcher Höhle bist du denn gekrochen?«
»Entschuldige, Fräulein. Ich vergaß, dass wir in dieser fucking Gender-über-alles-Zeit leben. Dann muss ich jetzt meinen Überlebensinstinkt eben wieder ausschalten.« Frank hob die Arme. »Was soll’s. Glaub’ ja eh, dass Geschlechter nur eine Erfindung der kroatischen Wettmafia sind.«
Kai lachte auf. »Der Mafia?«
»Überlegt doch mal«, fuhr Frank mit einem verschmitzten Grinsen fort, »durch die künstliche Geschlechtertrennung, die, wie wir jetzt ja alle wissen, es gar nicht gibt, haben wir bei jeder Sportart zwei Wettkämpfe. Für Männer und für Frauen. Doppelte Wettkämpfe bedeuten doppelte Wetteinsätze. Bedeuten doppelte Gewinne.«
»Das ist das Dümmste, was ich je gehört hab’«, bemerkte Can und schüttelte den Kopf.
»Na ja, du warst wohl noch nie bei einer Diskussion im Studentenausschuss«, erwiderte Frank. »Sophia, dann sag uns doch, was zu tun ist. Jetzt musst du Farbe bekennen. Keine Diskussionen mehr. Jetzt ist Handeln angesagt. Kein Relativieren, kein Abwägen, jetzt müssen Taten folgen.«
»Gender-Wissenschaft ist eine seriöse Disziplin, du Arsch.«
»Natürlich. So wie unsere außer Kontrolle geratenen bärtigen Freunde da draußen wahrscheinlich eine Verschwörung der Amis sind, um den Islam in Misskredit zu bringen.«
»Die sehen aber nicht wie Amis aus«, stellte Kai nüchtern fest und deutete auf das andere Ende des Bahnsteigs. Drei Zombies waren auf sie aufmerksam geworden und kamen auf sie zu. Zuhältertypen mit Jogginghosen. Langsam und torkelnd näherten sie sich. Frank hob die Eisenstange an und ging auf sie zu. Als er nur noch einige Meter von ihnen entfernt war, legten die Zombies die Stirnbänder ab und präsentierten Frank die Stirnen.
»Na, wartet nur ab«, sagte der. »Ich werd’ euch jetzt zeigen, was es heißt, sich mit mir anzulegen. Ich werde euch jetzt eine Lektion erteilen.« Frank holte mit der Eisenstange aus und schlug sie dem ersten Zombie auf die Stirn. Die Haut platzte auf. Blut, Würmer und Hirnmasse ergossen sich auf die Fliesen des Bahnsteigs. Dem zweiten Zombie stieß er die Stange in die Stirn, dem dritten, der schon seine Arme um ihn gelegt hatte, würgte er und schlug ihm solange mit der Faust ins Gesicht, bis dieser zusammenbrach. Dann holte Frank mit der Stange aus und hieb auf den Zombie ein, bis dieser nicht mehr zuckte.
Kai, Can und Sophia standen schweigend im Hintergrund.
»Na, das war gar keine große Sache«, presste Frank außer Atem hervor. »Sind nicht die Hellsten, deine bärtigen Freunde, Can.«
»Na, phantastisch. Die Apokalypse hat nicht mal angefangen, und der ist schon jetzt vollkommen durchgedreht«, kommentierte Can.
»Du hast da was kleben«, sagte Kai zu Frank.
»Was?«
»An deiner Stirn.«
Frank fuhr sich über die Stirn, ertastete etwas Glitschiges, zog es ab und warf es auf den Boden.
Die vier versammelten sich um das klebrige Etwas, das sich auf den Fliesen wand.
»Ist das etwa in den Köpfen drin?«, fragte Can.
»Sieht so aus«, bestätigte Sophia.
»Das ist ja ’n Regenwurm«, glaubte Kai zu wissen. »Das sind ja gar keine Mombies«, fügte er dann enttäuscht hinzu.
Sophia zog das Bettlaken vom Kopf und bückte sich. »Das ist kein Regenwurm. Regenwürmer sind Gliedertiere. Die haben immer die gleichen Segmente. Der hier ist nur eine undefinierte Masse. Sieht eher wie ’n Egel aus.«
Frank nahm das untere Ende seines Bettlakens und reinigte damit sein Gesicht. »Scheiße – ob ich jetzt?«, fragte er mit Entsetzen in den Augen. »Werde ich jetzt auch einer von denen?«
»Glaub’ ich nicht«, verneinte Sophia. »Guck dir die hier an.« Sie deutete auf die toten Zombies. »Die haben Wunden am Hals. Das scheint dazuzugehören. Der Biss.«
»Glaubst du das wirklich?«, fragte Frank unsicher nach.
»Ich denke schon.«
Ein Windhauch streifte sie und das quietschende Geräusch eines einfahrenden Zuges erklang. Die vier drehten sich um.
»Weg, weg«, flüsterte Frank.
»Wohin?«, fragte Sophia.
»Wir müssen raus. Nach oben«, schlug Frank vor.
Die vier liefen in Richtung des Ausgangs, blieben aber stehen, als die U-Bahn einfuhr und so früh abbremste, dass nur die ersten beiden Wagens am Bahnsteig standen, die restlichen aber noch in der U-Bahn-Röhre steckten. Der Zugführer schien benommen hinter seinem Pult zu stehen. Der Kopf wackelte leicht und die Hände suchten nach dem richtigen Schalter auf dem Fahrerpult. Als er ihn gefunden hatte, öffneten sich die Türen. Augenblicklich sprangen Dutzende von Zombies heraus. Konvertiten der zweiten Generation, die Stirn verdeckt mit Baseballkappen, Bauhelmen, selbst T-Shirts, die ausgezogen wurden und als Kopftuch herhalten mussten. Zunächst orientierungslos, blickte ein Zombie eher zufällig in ihre Richtung. Ein Grunzen, und auch die anderen erkannten ihre Beute. Kai, Can, Sophia und Frank drehten sich um und rannten die Treppe der Station »Kochstraße« nach oben.
»Warum zieht ihr nicht wieder die Bettlaken über«, forderte Sophia Frank und Can vorwurfsvoll auf.
»Da drunter sieht man nichts!«, rief Frank. »Vielleicht wirkt es eh nicht mehr.«
»Checkpoint Charlie« lag direkt vor ihnen. Als wäre nichts passiert, ließen sich am ehemaligen Grenzübergang Touristen mit Statisten in amerikanischer Uniform fotografieren. Selbst als die grunzende Horde die Treppe der U-Bahn hochstürmte, brachte es die Touristen nicht davon ab, vor einem Wall mit Sandsäcken zu posieren.
»Da, der Laden!«, rief Sophia und deutete auf das 1-Euro-Geschäft auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Sie rannten hinein, schlossen die Glastüren und blockierten sie mit zwei schweren Warenkörben.
»Was soll’n das werden, wenn’s fertig ist?«, beschwerte sich die Verkäuferin.
»Wissen Sie überhaupt nicht, was los ist?«, rechtfertigte sich Sophia. »Zombies ... da draußen geht gerade die Welt unter.«
»Hallo? Apokalypse?«, schob Can nach.
»Ich kann euren Halloween-Käse jetzt nicht gebrauchen. Schiebt mal wieder die Körbe zurück, aber ganz schnell«, verlangte die Verkäuferin unwirsch.
Schreie von Touristen, die von den Zombies überwältigt wurden, drangen ins Geschäft vor.
»Na, überzeugt?«, fragte Frank und hob die Eisenstange.
»Dreht ihr hier ’n Film oder was?«, fragte die Verkäuferin, sich immer noch nicht darüber im Klaren, in welcher Lage sie sich befand.
Can schüttelte den Kopf. »Verstehen Sie doch – das da draußen ... das sind Zombies.«
»Jetzt reicht’s mir aber. Ihr mit euren blöden Zombies. Mein Sohn guckt sich die ganze Zeit auch diesen Schwachsinn an.«
Ein Konvertit sprang gegen die Schaufensterscheibe, hob seine Baseballkappe an und rieb seine Wulst am Fenster. Die Verkäuferin schrie auf. »Jesus, Maria und Josef. Was sind denn das für Kreaturen da draußen?«
»Verehrte Dame«, sagte Can feierlich, »ich darf Ihnen hiermit einen Untoten vorstellen.« Als wäre der Zombie mit Saugnäpfen an der Scheibe festgeklebt, verharrte er bewegungslos.
»Ach du heilige Scheiße«, fluchte die Verkäuferin. »Das Fenster ist heute erst geputzt worden.«
Frank ging zur Tür und hob seine Eisenstange an. Dann überlegte er kurz und wandte sich an die Verkäuferin. »Haben Sie vielleicht den Koran hier?«
»Ich ...«
»Die Bibel wäre auch nicht schlecht. Ich meine als Referenz sozusagen.«
»Was hast du vor?«, fragte Sophia.
»Ich will was ausprobieren an unserem anhänglichen Freund hier. Vielleicht klappt es.«
Die Verkäuferin reichte Frank einen Koran und eine Bibel, die sie unter dem Ladentisch lagerte.
»Sie sind wohl hier auf alles vorbereitet, was?«, fragte Frank.
»Für einen Euro kann man so einiges bekommen«, erklärte die Verkäuferin.
Frank hielt dem Zombie die Bibel direkt vor die eingefallenen Augen. Zitternd vor Erregung, den Blick weiter auf Frank gerichtet, schlug der Zombie noch heftiger gegen die Scheibe. »Na, das ist dann wohl die Negativ-Kontrolle«, sagte Frank, als er sich zu den anderen umdrehte. »Und jetzt mal sehen, wie er das hier annimmt.« Frank streckte ihm den Koran entgegen, doch die Augen des Zombies verharrten unbeirrt auf ihm. »Also der Koran scheint ihn jetzt auch nicht gerade milde zu stimmen.«
»Gib ihm doch ’nen Telefonbuch«, schlug Kai vor, »da kann sich dieser Trottel festbeißen.«
Frank lächelte. »Vielleicht hast du recht.«
»Ich hab’ne Idee, woran es liegen könnte«, sagte Sophia.
»Na, dann lass mal hören«, forderte Frank.
»Wenn ich mich nicht irre ...«, begann Sophia.
»Rita?«, unterbrach sie die Verkäuferin. »Was machst du denn hier? Du hast doch heute frei.«
Die Angesprochene kam mit zuckenden Bewegungen vom hinteren Ende des Ladens zu ihnen hinüber, wobei sie gegen mehrere Warenkörbe stieß. Eine Strumpfhose um die Stirn gewickelt, die Augen leer, schien sie ihren freien Tag nicht recht genießen zu können.
Frank ging mit erhobener Eisenstange auf sie zu, doch die Verkäuferin stellte sich ihm in den Weg. »Junge, wenn du ihr was tust, bekommst du es mit mir zu tun.«
»Hören Sie, Sie sehen doch, dass es Rita nicht gut geht.«
Die Zombie-Verkäuferin griff nach ihrer Kollegin und wollte sie in den Hals beißen.
»Rita? Was machst du ’n da?«, beschwerte sich die Verkäuferin. Kai sprang auf den Zombie zu und hielt ihn von hinten umklammert. Wie eine Schildkröte, die nach ihrer Beute schnappen wollte, versuchte der Zombie die Verkäuferin weiterhin zu beißen. Doch so sehr er sich auch wand, aus Kais Umklammerung konnte er sich nicht lösen.
Frank holte mit der Stange aus, doch die Verkäuferin hielt ihn am Arm fest.
»Bitte, bitte, nicht«, flehte sie.
»Was sollen wir denn tun?«, fragte Frank. »Ich muss Sie erlösen.«
»Nein!«
»Lasst mich mal ran«, mischte sich Can ein. Er nahm eine Rolle mit Müllsäcken, wickelte einen ab, entfaltete ihn, stülpte ihn dem Zombie über den Kopf und schnürte das Zugband zu. Das Grunzen des Zombies hörte augenblicklich auf. Er wurde still wie ein Papagei, dem man die Nachtdecke über den Käfig warf.
»Djang hat Rita eingetütet«, freute sich Kai.
»Und was jetzt?«, fragte Frank. »Kai kann sie ja nicht ewig festhalten.«
»Ich schaff’ das schon ’ne ganze Weile«, widersprach der. »Kann nur nicht mehr heben. Hat der Arzt verboten.«
»In die Mitarbeitertoilette. Bringt Rita nach hinten«, sagte die Verkäuferin. »Da kann sie sich erholen.«
»Erholen?«, fragte Frank entgeistert. »Das glauben Sie wirklich?«
»Nun bringt sie schon dahin«, forderte Sophia.
Kai zog den Zombie ohne große Mühe in den Personalbereich, trug ihn auf die Toilette und setzte ihn auf der Kloschüssel ab.
»Sie braucht noch ein Luftloch, sonst erstickt sie«, wies Sophia an.
»Also, du hast Nerven«, sagte Frank. »Die hat jetzt wirklich andere Probleme.«
Sophia beugte sich über den Zombie, der wie paralysiert auf der Kloschüssel saß, und riss die Tüte am unteren Ende ein.
»Kommt hierher!«, rief Can aufgeregt vom anderen Ende des Ladens. Frank schloss die Klotür hinter sich ab, und dann rannten sie in den Verkaufsbereich. Dutzende Zombies drückten ihre Gesichter gegen die Scheibe, blökten und grunzten dabei.
Frank schüttelte den Kopf. »Wie die Schmeißfliegen kleben die an der Scheibe. Da kommen wir nicht mehr raus.«
»Gibt’s ’nen Hinterausgang?«, fragte Can.
»Ja«, sagte die Verkäuferin.
»Ich erkunde den Weg hier raus«, verkündete Frank. »Ihr bleibt solange hier.« Er drehte sich zur Verkäuferin um. »Zeigen Sie mir, wie ich in den Innenhof komme.«
Die Verkäuferin nickte.
Can folgte den beiden durch das Geschäft, bis er zu einem Warenkorb kam, in dem sich Teppichmesser befanden. Er nahm eins, brach es aus der Verpackung und steckte es ein. »Ein Euro«, sagte er vor sich hin. »Da kann man keine Qualität erwarten.«
Sophia steckte die Packung mit Müllbeuteln ein, eine gekühlte Flasche Wasser und einen Schraubendreher. Sie ging zur Ladentheke und legte drei Euro neben die Registrierkasse.
Kai betrachtete derweil die Zombies, die sich gegen die Scheiben pressten. Dann blickte er über sie hinweg zum Checkpoint Charlie hinüber. Ein amerikanischer Zombie-Soldat mit Flagge in der Hand hatte sich in einen asiatischen Touristen verbissen. Im Café in der zweiten Etage gegenüber saßen immer noch Menschen, die in aller Ruhe ihren Kuchen aßen. Kai wunderte sich darüber und musste daran denken, was sein Vater ihm gesagt hatte. Dass er zwar nicht den schnellsten Prozessor hatte, die Taktrate veraltet war, aber dass man auch mit einem alten Computer ganz vernünftige Dinge anstellen konnte. Und als er die lächelnden Menschen im Café sah, die Einkaufstaschen unter die Tische gestellt, dachte er, dass sein Vater recht hatte.
»Was siehst du?«, fragte Sophia, als sie an ihn herantrat.
»Ich bin nicht der Dümmste hier«, sagte Kai.
»Wie kommst du dazu, so etwas zu sagen? Natürlich bist du das nicht.«
»Ja, aber jetzt weiß ich es.«
Can ging zur Kühltruhe, nahm sich eine Cola und trank gierig ein paar Züge. Mit den Lippen umschloss er dabei den Flaschenhals, so dass durch den Unterdruck immer wieder etwas Cola zurückgesaugt wurde.
»Das Bezahlen nicht vergessen, junger Mann«, sagte die Verkäuferin, als sie mit Frank zurückkam.
»Ist das ihr Ernst?«
»Mir schenkt auch keiner was«, bekräftigte die Verkäuferin.
»Ach, menno. Ich soll bei ’ner Zombie-Apokalypse echt zahlen? Das hab’ ich mir irgendwie cooler vorgestellt.«
»Du hast die Lady gehört. Einen Euro, nehme ich an«, sagte Frank zur Verkäuferin gewandt.
»So wie alles hier«, bestätigte sie.
Can kramte das Geld aus der Tasche und drückte es der Verkäuferin in die Hand.
»Ich hab’nen Weg nach draußen gefunden«, sagte Frank.
»Äh, an deiner Eisenstange klebt was ...«, wunderte sich Can.
Frank musterte die Haare, die in dem eintrockneten Blut an der Stange mit einem Fetzen Haut verklebt waren. »Hatte unerwünschten Besuch«, stellte er nüchtern fest. »Wir müssen in die erste Etage. Da ist eine Wohnung frei. Nach vorne raus, auf das Gerüst, dann die Kochstraße rein und die Wilhelmstraße lang. Vielleicht schaffen wir’s zum Reichstag.«
»Warum willst du dahin?«, fragte Can.
»Da wird es ja wohl Polizisten geben«, begründete Frank seine Entscheidung.
»Bereit«, sagte Kai und salutierte.
»Ich bin mir nicht sicher, ob wir da lang gehen sollten«, gab Sophia zu bedenken.
»Wir müssen das so machen, Sophia«, sagte Kai. »Frank ist unser Scout.«
»Unser Scout?«
»Er zeigt uns, wo’s langgeht.«
»Siehst du, meine Liebe, er ist auf meiner Seite.«
»Can, was meinst du?«, fragte Sophia, noch nicht überzeugt.
Can zog sich das Laken über. »Also hier können wir nicht bleiben.«
»Also gut«, stimmte Sophia zu. »Dann gehen wir.«
Die vier gingen den Weg entlang, den Frank ausgekundschaftet hatte. Niemand wollte sich ihnen anschließen, weder die Verkäuferin des 1-Euro-Ladens, noch die verängstigten Mieter der Wohnungen, die sie passierten, als sie auf dem Gerüst entlanggingen.
»Jetzt zieh dir wieder das Laken über«, forderte Sophia Frank auf, als sie an einer Leiter hinabstiegen.
»Ich verstecke mich nicht«, widersprach Frank.
»Du bringst uns alle in Gefahr.«
»Ich zieh mir dieses vollgewichste Laken nicht mehr über«, weigerte sich Frank beharrlich.
»Was?«
»Eure Laken sind neu, schon vergessen? Ich musste meins abziehen.«
Sophia berührte seine Schulter. »Es sind aber die Gesichter, die sie reizen. Deshalb haben sie die Burka-Trägerinnen verschont und deshalb haben sie uns am Mehringplatz passieren lassen.«
»Es sind verdammte Zombies. Zombies von der Islamschule, vielleicht.«
»Du bist Wissenschaftler, Frank«, redete sie auf ihn ein. »Du weißt, dass es nichts mit dem Islam zu tun hat.«
»Schwachsinn! Sie sind eins: der Wurm und der Islamist.« Frank ging zu einem gebissenen Souvenir-Verkäufer, der regungslos am Boden lag, und nahm ein Gasmasken-Imitat, das der Mann neben Fähnchen und Wollmützen der Roten Armee verkauft hatte. »Wenn du recht hast«, sagte Frank und zog sich die Gasmaske über. »Wenn du recht hast, dann müsste das hier ausreichen. Er lief bis zur Friedrichstraße zurück, breitete die Arme aus und stellte sich der Horde Zombies entgegen, die auf ihn zukam.
»Dieser Irre«, sprach Can fassungslos vor sich hin.
Frank wurde von der Horde umschlossen, doch als wäre er nur ein Hindernis auf ihrem Weg zur nächsten Beute, torkelten sie weiter und ließen ihn unbeschadet zurück. Frank hatte immer noch die Arme gehoben, als die Zombies längst weitergezogen waren. »Es hat wirklich funktioniert«, wunderte er sich, als er zu den dreien zurückkam.
Sophia nickte zufrieden. »Ich hab’s dir ja gleich gesagt. Die sind auf die Gesichter der Menschen aus. Das zieht sie an. Und so finden sie ihre Opfer.«
Das laute Wummern der Bässe, die helle Stimme einer arabisch singenden Frau. Ein BMW raste auf sie zu. Die Scheiben heruntergelassen, war am Steuer ein Araber mit Vokuhila-Frisur. Kai, Frank und Sophia schafften es noch rechtzeitig, von der Straße zu flüchten, doch Can blieb regungslos stehen. Vom Auto gestreift, wurde er nach hinten geschleudert und schlug auf dem Asphalt auf. Noch unter Schock, zog sich Can das Laken vom Körper und sprang hoch. Der Araber fuhr in die nächste Welle Zombies hinein, die durch die Friedrichstraße zogen. Körper wurden weggesprengt, wie Puppen nach oben geschleudert, von den Rädern zermalmt. Die Kontrolle über den Wagen verlierend, knallte der Fahrer gegen eine Straßenlaterne. Sofort torkelten mehr Zombies herbei und umschlossen den Wagen. Der Fahrer holte eine Pistole aus dem Handschuhfach, schoss und fällte noch drei Zombies, bevor ihm die Munition ausging. Der Araber rückte auf den Beifahrersitz hinüber und trat auf die Zombies ein, die durch das heruntergelassene Fenster drängten. Als ein Zombie Can erblickte, der nun ohne sein Bettlaken auf der Straße stand, wandte er sich vom Wagen des Arabers ab und torkelte erregt auf ihn zu. Immer noch unter Schock, fuhr sich Can mit der Hand über eine Platzwunde am Hinterkopf. Als er das Blut an seinen Fingern sah, wurde ihm schwindlig, und er brach zusammen. An beiden Armen zog Frank Can von der Straße auf den Bürgersteig, den Blick auf die Zombies gerichtet, die vom Wagen des Arabers abließen, als sie ihre Beute gemacht hatten, und sich nun ihnen zuwandten.
»Wir müssen Can tragen! Kommt!«, schrie Sophia.
»Tragen kann ich«, sagte Kai. »Nur nicht heben.«
»Du bist mit Abstand der Stärkste«, willigte Frank ein und hob Can auf Kais Schultern. »Lauft vor zum Mahnmal, ich komme nach«, sagte er dann.
»Wohin?«, fragte Sophia.
»Auf die Stelen vom Mahnmal!«, schrie Frank, drehte sich zu den Zombies um und hob seine Eisenstange. »Kommt nur her, ihr Bastarde, ich werd’s euch zeigen«, fluchte er.
Mit Can auf der Schulter rannte Kai zusammen mit Sophia zu den Stelen des Holocaust-Mahnmals hinüber, während Frank auf die Zombies einhieb. Mit aufgesetzter Gasmaske ignorierten sie ihn jedoch. »Verdammt«, flüsterte Frank und eilte den anderen hinterer.
Die Stelen des Mahnmals erhöhten sich zunehmend, je weiter man in das Innere des überdimensionalen Gräberfeldes vordrang. Frank sprang auf die erste Stele, die ihm nur bis zu den Knien reichte, dann auf die nächste, immer weiter. Wie eine Welle wurden die Zombies von den dicht an dicht aufgereihten Betonklötzen geteilt. Unfähig, sich von Stele zu Stele zu bewegen, blieben sie in den Schluchten zwischen den Monolithen gefangen. Kai und Sophia hatten in der Mitte des Mahnmals auf einer Stele Schutz gesucht, die mehr als vier Meter über den Boden ragte. Can lag schwer atmend auf der Seite und blickte auf die Angreifer hinab, die sich zu ihren Füßen versammelten, ihre Arme nach oben streckten, die Hälse reckten und ihre gewölbten Stirnen präsentierten.
8.
Reichstagsgebäude, Fraktionssaal der Union.
Um über die Lage beraten zu können, hatten sich der Kanzler und der Chef des Kanzleramts in den Fraktionssaal auf der oberen Ebene des Reichstags zurückgezogen. Die beiden Leibwächter des Kanzlers sicherten die Tür. Neumeier hatte seinen Laptop aufgeklappt und dem Kanzler mehrere Youtube-Videos von Berlinern vorgespielt, die die Verwandlung ihrer Stadt in ein Zombie-verseuchtes Armageddon dokumentiert hatten, noch bevor das Internet ausfiel. Aufmerksam hatte der Kanzler die verwackelten Videosequenzen in schlechter Qualität studiert.
»Was es heute alles für Möglichkeiten gibt, Neumeier. Donnerwetter. Internet. Das wird das Ding der Zukunft, sage ich Ihnen.«
»Da haben Sie sicher recht«, stimmte Neumeier zu, wobei er versuchte, seine Fassungslosigkeit hinter der Fassade des scheinbar immer gut gelaunten lukullischen Genießers zu verbergen. »Diese Bilder gibt es aus fast ganz Berlin«, erklärte Neumeier.
»Und der Rest der Republik?«
»Wir sind noch am Auswerten. Zurzeit haben wir noch keinen Überblick.«
»Und der Reichstag?«
»Die Bundespolizei hat alle Eingänge verschlossen. Es wurde angeordnet, dass mehrere Hundertschaften der Bereitschaftspolizei das Gebäude sichern, aber nur eine Handvoll Männer ist dem Befehl überhaupt gefolgt. Die Parlamentarier haben sich im Plenarsaal versammelt. Die Notstromaggregate funktionieren noch die nächsten 72 Stunden.«
»So schlimm?«
»Die Bundespolizisten sagen, es wäre eine Seuche. Bei den Leuten würden Würmer aus dem Kopf sprießen.«
»Das ist schon ärgerlich, was da draußen passiert. Sehe ich ja ein. Wie sieht es aber mit dem Parlament aus? Unsere Handlungsfähigkeit ist das oberste Ziel. Lassen Sie alle verfügbaren Kräfte hier zusammenziehen.«
»Welche Kräfte? Es gibt keine mehr. Die Bereitschaftspolizei hat sich aufgelöst.«
»Dann muss halt die Bundeswehr anrücken.«
»Die Bundeswehr ist an der Grenze in Bayern zusammen mit den meisten Bundespolizisten gebunden.«
»Sie sind alle an der Grenze?«
»Sie haben sie vor den letzten Wahlen dorthin kommandiert. Wissen Sie nicht mehr? Die Flüchtlingskrise?«
»Dass das jetzt wie ein Bumerang zurückkommt. Verdammt. Dann geben wir Berlin eben preis. Lassen Sie mich sofort ausfliegen, Neumeier.«
»Es gibt hier keine Hubschrauber mehr. Und der Kontakt zum Flughafen Tegel ist abgerissen.«
»Was? Keine Hubschrauber mehr?«
»Sie haben den Wehretat vor einem Jahr nochmals reduziert, damit der Grimmige die schwarze Null halten kann.«
»Erwähnen Sie nicht mehr diese Person, Neumeier. Verstanden?«
»Ja.«
»Dann sollen uns eben die Amerikaner raushauen.«
»Die Amerikaner?«
»Ja, unser großer Bruder.«
»Die werden keine Truppen nach Berlin verlegen, um die Russen nicht noch weiter zu provozieren.«
»Und die EU? Kann die EU vielleicht helfen?«
»In Anbetracht dieser äußerst kritischen Lage wurde entschieden, nächste Woche eine Sondersitzung einzuberufen.«
»Nächste Woche?«
»Der EU-Parlamentspräsident hat Ihnen aber in dieser schweren Krise seine vollkommene Solidarität ausgesprochen und auch der Kommissionspräsident zeigte sich ob der Opfer erschüttert.«
»Diese verdammte Scheißbande«, fluchte der Kanzler. »Gut. Dann ist es so. Dann muss der Notfallplan zur Evakuierung greifen.«
»Notfallplan?«
»Der Masterplan. Wie zu Zeiten des Kalten Krieges.«
»Den gab es in der DDR, die BRD hat niemals einen Plan besessen, da man mit der vollkommenen Zerstörung des Landes mit Atomraketen gerechnet hat. Daran hat sich auch nach der Wende nichts geändert.«
»Verdammt. Neumeier, ich hab’ es Ihnen immer gesagt: Wir hätten mehr von der DDR übernehmen müssen.«
»Wie Sie meinen, BundeskanzleriX.«
»Dann lassen Sie uns in den Bunker. Wir werden die Köpfe einziehen und dann wird schon irgendjemand kommen. Abwarten und Aussitzen lautet das Motto der Stunde.«
»Nun ja, ich muss ... ich ...«, stotterte Neumeier. »Leider ... wie soll ich es Ihnen sagen? Wissen Sie, der Flughafen BER ist nicht das einzige Projekt, das gescheitert ist.«
»Wie meinen Sie das?«
»In die Bunker-Baustelle ist vor drei Jahren Spreewasser eingedrungen. Ein schwerer Schaden. Man hat alles mit Sand aufgefüllt, damit die Fundamente des Reichstags nicht destabilisiert werden. Nun ja ... da unten gibt es keine Schutzräume. Da ist eigentlich gar nichts mehr. Nur noch Sand.«
»Es gibt keine Schutzräume?«
»Nein.«
Der Laptop von Neumeier meldete einen eingehenden Skype-Anruf.
»Was ist das?«, fragte der Kanzler.
Neumeier sah auf seinen Laptop. »Es ist der Bundespräsident.«
»Hauch?«, fragte der Kanzler. »Wo zum Teufel steckt der überhaupt?«
»Einen Moment ...« Neumeier nahm den Anruf an, und auf dem Bildschirm erschien Bundespräsident Hauch. Die Arme auf den Schreibtisch gelegt, standen hinter ihm mehrere Soldaten in Uniformen preußischer Offiziere.
»Hauch, wo zum Teufel stecken Sie?«, fragte der Kanzler.
»Ich bin in Weimar«, sagte dieser beinahe andächtig.
»Weimar?«
»Ja.«
»Wer ist das da bei Ihnen? Und was sollen diese dämlichen Uniformen?«
»Das, BundeskanzleriX, ist meine Leibgarde und ich bitte Sie in Anbetracht der außerordentlich schweren Lage, mir die Regierungsgeschäfte nach Weimar zu übertragen.«
»Was? Regierungsgeschäfte? Sind Sie ... haben Sie sie nicht mehr alle?«
»Ich hatte befürchtet, dass mein Anliegen bei Ihnen auf taube Ohren stößt. Sie lassen mir leider keine Wahl. Um das Land weiter handlungsfähig zu halten, bin ich gezwungen, weitere Schritte einzuleiten.«
»Haben Sie den Verstand verloren, Hauch?«
»Ich muss unser Gespräch hiermit beenden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen«, sagte Hauch und bekreuzigte sich.
»Ich bringe Sie ... Hauch!«, schrie der Kanzler, doch im selben Augenblick brach die Verbindung ab. »Neumeier, haben Sie das gehört?«, fragte der Kanzler außer sich vor Zorn.
»Ja, es ist mir nicht entgangen. Der Bundespräsident möchte dem Land nun in einer anderen Position dienen.«
»Das ... die Verfassung sieht das überhaupt nicht vor. Er muss nur repräsentieren, er ist nicht mein Stellvertreter.«
»Wie mir scheint, sieht Herr Hauch dies anders.«
»Diese Pappnase.«
»Der Bundespräsident will das Grundgesetz vermutlich ändern lassen. Mit der Kirche im Rücken.«
»Der Kirche?«
»Er hat gute Kontakte.«
Die Miene des Kanzlers verfinsterte sich. »Dieser miese, raffgierige ...« Dann lachte er auf. »IM Larve. Das war sein Deckname in der DDR. Da hat es dieser verfluchte Scheißer also geschafft.«
»Was?«, fragte Neumeier verblüfft.
»Hat Hauch etwa ...? Die Stasi? Hat er seine Kontakte genutzt?«
»IM Larve? Stasi?«
»Sie kommen aus dem Westen, Neumeier. Sie verstehen das nicht. Sie verstehen nicht, wie es damals war. Die Seilschaften, es gibt sie immer noch. Wir werden immer älter, aber viele sind noch da.«
»Ich verstehe nicht, wovon Sie sprechen.«
»Ob diese komischen Würmer da ein geheimes Waffenprojekt von damals sind?«
An die Tür des Fraktionssaals klopfte es. Der Kanzler nickte, und die Leibwächter ließen den Fraktionsvorsitzenden herein.
»Ich muss Ihnen etwas mitteilen«, sagte dieser.
»Ja?«
»Ihr Volk ist gekommen. Es versammelt sich auf dem Platz der Republik.«
»Mein Volk?« Der Kanzler lächelte. »Meine treuen Untertanen. Neumeier, sehen Sie? Ich hab’ es Ihnen gleich gesagt. Es ist noch nichts verloren. Mein Volk ist gekommen, um mich zu beschützen.« Der Kanzler stand auf und ging freudig auf den Fraktionsvorsitzenden zu.
»Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Begeisterung teilen kann«, sagte dieser. »Sie verhalten sich anders als sonst.«
»Was meinen Sie?«
»Ihr Volk – es hat sich in eine Horde von Wilden verwandelt.«
9.
Stelenfeld des Holocaust-Mahnmals.
»Die sind immer noch da«, sagte Frank, die Hände auf die Kante der Betonstele gestützt und in die engen Fluchten zwischen den grauen Monolithen blickend. Er sah zu Sophia hinüber, die neben ihm im Schneidersitz saß. Das Bettlaken hatte sie zerrissen, so dass es nur noch den Kopf bedeckte, und mit der Kordel ihrer Umhängetasche lose am Hals befestigt. Für Can, der auf der benachbarten Stele saß, hatte sie eine eben solche Kopfbedeckung improvisiert. Kai hatte sich eine der Mülltüten übergezogen, die sie aus dem 1-Euro-Laden mitgenommen hatten, und drei Löcher für Augen und Mund eingerissen. Die Blutung an Cans Hinterkopf konnte mit mehreren Taschentüchern gestoppt werden, doch die Kopfschmerzen, die er nun hatte, verbesserten sich auch nicht durch die Aspirin, die Frank ihm gab.
»Die zerstreuen sich nicht, auch wenn sie unsere Gesichter nicht mehr sehen«, sagte Frank, der noch immer die billige Gasmaske vom Souvenir-Stand übergezogen hatte. Er schwitzte erbärmlich darunter und kam sich, die grunzenden Zombies unter sich, inmitten des riesigen Gräberfeldes vor wie ein Statist in einem Sci-Fi-Film, der eine billige Latexmaske zu tragen hatte.
»Das werden auch immer mehr«, stellte Sophia entsetzt fest.
»Nun ja«, sagte Frank. »Islamisten und Konvertiten. Exponentielles Wachstum nennt man das wohl.«
»Die brauchen einen äußeren Reiz, jemanden, der sie weglockt. Hier gibt es ja nirgendwo mehr Menschen«, gab Sophia zu bedenken.
»Einen Lockdings?«, fragte Kai.
»Ja, einen Lockvogel«, bestätigte sie.
»Kann ich abgeben«, sagte Frank. »Ich bin diese scheiß Gasmaske eh leid.« Er hob seine Eisenstange und schwang sie durch die Luft. »Ein paar dieser Bastarde werde ich mitnehmen.«
»Nun beruhig dich mal. Wir brauchen einen Plan, sonst bringt uns die Ablenkung eh nichts«, schritt Sophia ein.
»Djang braucht ’nen Arzt«, sagte Kai.
»Ach, dem fehlt nichts«, wiegelte Frank ab. »Der war ja nur kurz weggetreten.«
»Mir ist aber so schlecht«, widersprach Can.
»Vielleicht ’ne Gehirnerschütterung«, vermutete Sophia.
»Hauptsache keine Amnesie«, sagte Frank. »Kannst du dich noch an alles erinnern? Deine Kollegen da unter uns? Was sie wollen und so? Klingelt da was?«
»Ich erinnere mich ... ich erinnere mich daran, dass du ’n Arsch bist.«
»Na, also«, sagte Frank scheinbar zufrieden. »Alles noch da.«
»Jetzt hört schon auf, euch zu streiten«, forderte Sophia. »Die Lage ist schon ernst genug. Was machen wir jetzt?«
»Na ja, vielleicht braucht Can ja wirklich ’nen Arzt«, gab Frank zu. »Die Charité? Die ist nicht weit weg.«
»Wie weit denn?«, fragte Can in leidendem Tonfall.
Frank zog sein Smartphone aus der Tasche und startete Google-Maps, doch noch immer hatte er keinen Empfang. »Knapp ’nen Kilometer, würd’ ich schätzen«, antwortete er dann.
»Das schafft der nicht in seinem Zustand«, wandte Sophia ein.
»Ich kann ihn schleppen«, stellte sich Kai zur Verfügung. »Kein Problem. Nur nicht heben. Das hat der Arzt verboten. Nur schleppen.«
»Dann auf zum Pariser Platz und weiter zur Charité«, sagte Frank, stand auf und zeigte mit der Eisenstange den Weg.
Frank und Sophia hoben Can auf Kais Rücken, so dass dieser ihn Huckepack tragen konnte.
»Ich locke unsere theistischen Hysteriker nach Süden und komme dann nach«, erklärte Frank seinen Plan.
Sophia nickte.
Frank zog sich die Gasmaske ab, sprang auf die nächste Stele und schlug dann mit der Eisenstange auf die Kante. »Kommt her!«, schrie er den Zombies zu, die unter ihm standen. »Kommt her, hier gibt es Futter. Einen weiteren Ungläubigen, den ihr bekehren könnt.« Er sprang von Stele zu Stele weiter, und die Zombies begannen, ihm zu folgen. »Kommt her!«, rief er wie befreit. Dann streckte er seine Arme aus. »Hier bin ich, der letzte Mann, den ihr in eure Gemeinschaft holen könnt. Ich warte auf die Erleuchtung, die euer Glaube mir geben wird.«
»Dem scheint das wirklich Spaß zu machen«, kommentierte Sophia das Geschehen.
»Das ist der Vorteil, wenn man eh nicht alle Tassen im Schrank hat«, brummte Can, nicht ohne Schmerzen in der Stimme. »Dann kann einem so ’ne Zombie-Apokalypse auch nichts mehr anhaben.«
»Das ist unser Scout«, widersprach Kai ehrfürchtig. »Er zeigt uns den Weg.«
Als die drei das nördliche Ende der Stelen erreicht hatten, drehten sie sich um. Frank sprang in fast hundert Metern Entfernung immer noch von Stele zu Stele, dabei hieb er immer wieder mit seiner Eisenstange auf die Zombies ein. Es schien ihm ein Vergnügen zu bereiten, die Zombies hinter sich herlaufen zu lassen. Sophia winkte ihm zu, doch Frank sah sie nicht. Bald schon lief er auf den niedrigeren Stelen des Denkmals entlang, ließ sich von den Zombies berühren wie ein Rockstar, der sich der entfesselten Fangemeinde näherte. Dann rannte er zu den höheren Stelen in der Mitte des Denkmals zurück, und als er eher zufällig in Sophias Richtung blickte, winkte sie ihm erneut zu, um ihm zu bedeuten, dass er jetzt nachkommen könne. Frank ließ die Eisenstange in der Luft kreisen. »Ich komme!«, schrie er.
Kai bog mit Can auf dem Rücken in die Wilhelmstraße ein. Der Abschnitt vor der britischen Botschaft war mit Pollern gesichert.
»Ihr da!«, erklang eine Stimme aus einem Lautsprecher. »Kommt her!«
»Wer ist das?«, fragte Sophia.
»Das kommt von da drüben«, erkannte Kai und deutete auf die Britische Botschaft.
»Von der Botschaft?«
»Geht durch die Tür, und ihr seid in Sicherheit«, meldete sich die Stimme aus dem Lautsprecher abermals.
»Da, die kleine Tür ist aufgesprungen«, sagte Sophia. »Merkwürdig. Scheint ’ne Art Diensteingang zu sein oder so was in der Art.«
Frank schloss zu ihnen auf. Er hatte sich die Gasmaske wieder übergezogen, und die Zombies waren ihm nicht gefolgt. »Los, weiter!«, rief er und zeigte in Richtung Charité.
»Vielleicht bekommen wir hier Hilfe«, hoffte Sophia und ging auf die offene Tür zu, die getarnt war mit den Lamellen einer Lüftungsanlage. Kai folgte mit Can, den er immer noch Huckepack trug. Frank sah sich hilflos um, dann ging auch er widerwillig durch die Tür, die sich sogleich hinter ihm schloss.
Die vier gingen durch einen schmalen Flur, der komplett mit Aluminiumfolie ausgekleidet war. Sie liefen auf einem Gitter entlang, unter dem sich ein System von Rohrleitungen und Schächten befand. Am Ende des Flurs war eine Wand. An der Decke hingen ein Neonleuchter, eine Kamera und ein Lautsprecher. Vor die Seitenwände waren mehrere Sitzbänke gestellt. Kai legte Can mit Sophias Hilfe vorsichtig auf einer der Bänke ab.
»Soll das hier der Besuchereingang sein oder was?«, fragte Frank ungläubig.
»Das hier ist doch niemals Botschaftsgelände«, sagte Sophia kopfschüttelnd.
»Na ja«, sagte Frank, »die Gastfreundschaft der Engländer ist ja nicht gerade weltberühmt.«
»Ich bin der Prepper«, erklang die Stimme aus dem Lautsprecher an der Decke.
»Hallo«, antwortete Kai und winkte in die Kamera. »Ich wollte dich schon immer mal kennenlernen.«
»Der Prepper?«, fragte Sophia.
Frank lächelte. »To be prepared. Das sind Leute, die sich vorbereitet haben auf die Apokalypse«, erklärte Frank.
»Wie? Vorbereitet?«
»Na, das ist so ’ne Art Internetkult. Man plant, welche Lebensmittel nötig sind und was man sich alles besorgt und welche Vorkehrungen man trifft, um zu überleben, wenn die Zivilisation zusammenbricht.«
»Was habt ihr mir anzubieten?«, fragte der Prepper.
»Anzubieten?«, wiederholte Sophia ungläubig und zog sich das Bettlaken vom Kopf.
»Ich spreche von Handel«, ergänzte der Prepper.
»Was soll das hier werden?«, fragte Frank genervt. »Zuviel Mad Max gesehen oder was?«
»Die Zeiten haben sich geändert.«
»Nach fünf Stunden Apokalypse? Spinnst du?«
»Ihr braucht einen Unterschlupf und etwas zu essen«, sagte der Prepper unbeeindruckt.
»Also, ich denke, wir brauchen nichts von dir«, widersprach Frank. »Es gibt da in der Friedrichstraße so einen kleinen 1-Euro-Laden mit einer äußerst resoluten Verkäuferin.«
Kai lachte. »Ja und auf’m Klo ist noch Rita.«
»Ich bin von Wahnsinnigen umgeben«, stöhnte Can, zog sich das Bettlaken vom Kopf und rieb sich die Schläfen. »Ich hätte mit meinen Brüdern gegen den IS kämpfen sollen. Das wäre besser gewesen als das hier.«
»Deine Brüder kämpfen gegen den IS?«, fragte Frank überrascht. »Respekt.«
»Ja, die sind im Irak. Die wollten mich aber nicht mitnehmen«, erklärte Can.
»Warum kämpfen die im Irak? Ihr seid doch Deutsche?«, wunderte sich Sophia.
Can sah zu ihnen auf. »Du bist wie ein Deutscher, das haben meine Brüder auch immer gesagt. Zu weich. Ein schwächlicher Feigling, für den sich meine Familie schämen muss.«
»Du bist kein Feigling«, widersprach Sophia.
»Vielleicht bist du nicht der Stärkste«, sprang Frank ihr bei, »aber durch deinen Burka-Trick sind wir überhaupt nur hier. Du bist eben kein Muskelprotz. Aber auch die List braucht man im Krieg. Muskeln und Hirn«, sagte Frank und tippte sich an die Stirn.
»Glaubt ihr das wirklich?«, fragte Can.
»Ja«, bestätigten Frank und Sophia gleichzeitig.
Kai setzte sich neben Can auf die Bank und legte einen Arm auf dessen Schulter. »Du bist doch unser Trickser«, sagte Kai.
Can lächelte. »Und du, mein Freund, du bist der Greifer.«
»Der Greifer?«, fragte Kai nach.
»Der, der ohne Furcht einen Zombie im Schwitzkasten halten kann.«
»Der Greifer?«, wiederholte Kai mit leuchtenden Augen und sah Frank an.
»Wenn Can es sagt«, bestätigte der.
»Wunderbar«, meldete sich der Prepper. »Menschen, die in einer Extremsituation zusammengeschweißt werden. Das muss ich mir gleich notieren.« Es knackte in der Leitung. Nach einem Augenblick fuhr der Prepper fort: »Ihr gebt euch also Kampfnamen? Das ist ja noch besser, als ich gedacht hab’.«
»Und was soll dein Name?«, fragte Frank. »Der Prepper? Zu oft ZombiU gespielt oder was?«
»ZombiU?«, fragte Sophia nach.
Kai lächelte Frank zu, als kannte er die Antwort bereits.
»Ein altes Konsolenspiel«, erklärte Frank. »Eine Zombie-Apokalypse in London. Da gab es auch so einen Prepper, der im Hintergrund agiert hat.«
»Was hat der gemacht?«, wollte Sophia wissen.
»Er hat andere zu seinen Zwecken missbraucht. Haben alle ins Gras beißen müssen«, sagte Frank mit einem Blick in die Kamera. »Man konnte ihm nicht trauen.«
»Er hat eine wichtige Aufgabe gehabt«, widersprach der Prepper.
»Dein Idol wollte sich selbst retten. Wie edel«, lästerte Frank. »Und so einer bist du also?«
»Ich habe ...«, begann der Prepper, »... ich habe euch nicht hierher geholt, um mit euch zu diskutieren.«
»Dann lass uns doch wieder raus«, forderte Frank und ging zur Tür. »Alles da draußen ist besser, als hier drinnen mit so einer Schlange zu reden.«
»Was willst du von uns?«, fragte Sophia.
»Was ich will? Informationen über die Dinge, die da draußen vor sich gehen.«
»Dann guck aus’m Fenster, dann weißt du’s«, sagte Frank.
»Was willst du wissen?«, fragte Sophia.
»Es gibt kein Internet mehr. Sind das wirklich die Schlächter vom IS, wie ich anfangs gelesen hab’?«
»Die Menschen wurden von einer Krankheit befallen. Es ist eine Art Parasit«, fügte Sophia an.
»Oh, bitte, das sind mutierte Islamisten, verdammt«, widersprach Frank energisch.
»Es sind auch Deutsche dabei. Es sind Menschen jeder Religion und jeder Hautfarbe«, bestritt Sophia.
»Nicht schon wieder dieses PC-Geschwätz. Die wurden zwangskonvertiert.«
»Sie sind konvertiert?«, fragte der Prepper nach.
»Ja, ein Biss und vorbei ist’s mit dem Verstand und der westlichen Selbstbestimmung«, bestätigte Frank.
»Was sagst du da?«, fragte der Prepper.
»Hören Sie nicht hin, Herr ... Prepper. Der Mann hier hat etwas seltsame Vorstellungen«, ordnete Sophia ein.
»Vorstellungen? Islamisten waren nun mal die Ersten, die betroffen waren. Das ist Fakt«, verteidigte Frank seine Position.
»Weil wir in Kreuzberg waren. In Marzahn hätten uns Nazis angefallen.«
»Weil in Marzahn nur Nazis wohnen? Wow, das ist mal eine ausgeglichene, vorurteilsfreie Meinung«, lästerte Frank mit sarkastischem Unterton.
»Es sind aber keine Islamisten«, wollte Sophia Franks Meinung nicht gelten lassen. »Es sind befallene Menschen.«
»Jetzt kommt wieder dieses Relativieren.«
»Ich relativiere nicht. Es könnten aber auch Deutsche angefangen haben.«
»Vielleicht ... ja vielleicht ist es so. Vielleicht ist der Islamist mit dem Wurm aber auch eine perfekte Symbiose eingegangen.«
»Der Wurm? Wovon zum Teufel sprecht ihr?«, unterbrach sie der Prepper.
»Es sieht so aus, dass sich eine Art Egel im Gehirn einnistet und dann das Verhalten von Menschen beeinflusst«, erläuterte Sophia.
»Es ist die Religion, die ihr Verhalten manipuliert«, widersprach Frank, aber nur noch halbherzig.
»Es ist ein Wurm, der die Leute durchdrehen lässt?«, wollte der Prepper wissen. »Wie ist das möglich?«
»Dicrocoelium dendriticum«, antwortete Sophia.
»Was?«
»Es gibt da ein Beispiel in der Natur«, fuhr Sophia fort. »Es gibt da den kleinen Leberegel, der sich am Spinalganglion einer Ameise festsetzt und dann das Verhalten der Ameise ändert. Sie beißt sich in einem Grashalm fest, um dann irgendwann vom Schaf mitsamt dem Gras gefressen zu werden. Das ist dann der nächste Zwischenwirt.«
»Dicro...?«
»Dicrocoelium dendriticum.«
»Leider kann ich nicht im Internet nachsehen«, bedauerte der Prepper, »aber ich kann mal nachfragen, ob sich da einer auskennt.«
»Haben Sie Handyempfang?«, fragte Frank.
»Nein, nur CB-Funk«, sagte der Prepper. »Wisst ihr, wie man den Wurm stoppen kann?«
»Eine draufhauen, dann platzt die Rübe auf und die Würmer spritzen raus«, glaubte Kai, die Antwort zu kennen.
»Oder man täuscht sie«, sagte Can, der sich aufgesetzt hatte. »Die Infizierten reagieren auf menschliche Gesichtszüge. Maskiert man sich, hat man einen gewissen Schutz.«
»Ihr seid wirklich gut, ihr vier«, urteilte der Prepper. »In einem funktionierenden Team vereinen sich immer unterschiedliche Fähigkeiten.«
»Dann gib die Infos weiter«, forderte Frank, »damit sich auch die Leute wehren können, die jetzt ihre Köpfe einziehen und sich in ihren Häusern verkrochen haben.«
»Das werde ich«, bestätigte der Prepper.
»Und vergiss nicht zu erwähnen, woher die Infos kommen.«
»Ich werde das Video ins Netz stellen. Ich meine, sobald wieder Internet da ist.«
Kai lächelte in die Kamera. »Cool«, freute er sich.
»Hast du Kontakt nach Kassel?«, fragte Frank.
»Kassel?«
»Meine Familie wohnt da.«
»Und Tübingen?«, schloss sich Sophia Franks Frage an.
»Nein«, sagte der Prepper, »sind nur Berliner dran.«
»Ob es da wohl auch so aussieht?«, fragte Sophia und blickte Frank beunruhigt an.
»Du hast gesagt, dass die Ameise nur der Zwischenwirt vom Leberegel ist«, warf der Prepper ein.
Sophia nickte. »Ja, das stimmt.«
»Wenn wir Menschen also nur der Zwischenwirt dieses Wurms da draußen sind, wer zum Teufel ist dann der Endwirt?«
»Das weiß ich nicht.« Sophia überlegte. »Vielleicht sind wir nur zufällig auf seine Speisekarte gerutscht, und der Wurm hat sonst andere Wirte.«
»Aber warum gerade jetzt? Warum nicht schon früher?«
»Es gibt auf der Erde tausende parasitäre Würmer. Vielleicht ist er schon lange da und nur noch nicht wissenschaftlich beschrieben worden.«
»Der Klimawandel? Kommt der Wurm vielleicht aus Afrika?«, bohrte der Prepper nach.
»Ehrlich, ich hab’ keine Ahnung«, gab Sophia zu.
»Na gut«, gab sich der Prepper zufrieden, »ihr habt euch eine Belohnung verdient.« In der Wand auf der Stirnseite des Flurs öffnete sich auf Brusthöhe eine Klappe. In einer Durchreiche lagen acht Müsli-Riegel, vier Colabüchsen, eine Leuchtfackel und eine Taschenlampe. Frank nahm zwei Colabüchsen und warf eine Kai und die andere Can hinüber. Dann bot er Sophia eine an, doch die lehnte ab. Frank öffnete die Dose und trank sie gierig aus.
»Hast du vielleicht ’ne Bionade?«, fragte Sophia in die Kamera.
»Bionade?«
»Vergiss es«, sagte Frank und verteilte die Müsliriegel unter ihnen. Dann deutete er auf die Leuchtfackel und die Taschenlampe, die noch in der Durchreiche lagen. »Wofür soll das gut sein?«
»Die braucht ihr«, erklärte der Prepper.
»Wofür?«
»Ihr müsst was für mich tun.«
»Moment mal. Wir haben dir Informationen gegeben. Wir sind quitt.«
»Ich hab’ euch immerhin Nahrung gegeben.«
»’Ne Cola und ’n paar Müsliriegel würd’ ich nicht als Nahrung bezeichnen. Die kann ich jetzt auch aus ’nem Automaten klauen.«
»Ihr müsst mir aber helfen.«
»Wir müssen gar nichts«, widersprach Frank.
»Wobei?«, schritt Sophia ein.
»Ich suche jemanden.«
»Willkommen im Club«, lästerte Frank.
»Meine kleine Schwester ist aber hier in Berlin und nicht irgendwo in Deutschland.«
»Deine kleine Schwester?«, fragte Sophia.
»Ich hab’ keinen Kontakt mehr zu ihr. Sie hat auch ein CB-Funkgerät, doch ich erreiche sie nicht.«
»Wo ist sie denn?«, wollte Sophia wissen.
Frank schüttelte den Kopf. »Du willst ihm doch nicht wirklich helfen oder was?«
»Im Move Inn Hotel am Alexanderplatz«, sagte der Prepper.
»Das ist wirklich nicht weit«, urteilte Sophia.
»Nicht in der Zombie-Apokalypse. Da zählt jeder Meter zehnfach. Außerdem haben wir jetzt Wichtigeres zu tun«, entschied Frank.
»Plündern?«, fragte Can mit ironischem Unterton.
»Das ist mal ’ne gute Idee«, ging Frank auf den Vorschlag vermeintlich ein.
»Wo ist deine kleine Schwester denn genau?«, fragte Sophia.
»Rebecca ist im Panoramarestaurant«, antwortete der Prepper.
»OK. Ich werde nach deiner kleinen Schwester suchen«, legte sich Sophia fest.
»Mach keinen Unsinn«, riet Frank Sophia. »Wir wollen doch eigentlich zur Charité.«
»Was kümmern uns seine Angelegenheiten?«, sprang Can ihm bei. »Wir wissen gar nicht, was dieser Typ für Absichten hat.«
»Ich werde jedenfalls gehen«, sagte Sophia entschlossen. »Notfalls alleine. Ich werde ein kleines Mädchen nicht seinem Schicksal überlassen.«
»Du bist so ein guter Mensch«, bedankte sich der Prepper bei ihr. »Ich weiß gar nicht, was ich machen würde, wenn Rebecca was zustößt. Sie ist doch alles, was ich habe.«
»Sag den Leuten, wie man sich schützen kann, dann helfen wir dir, deine kleine Schwester zu finden«, stimmte nun auch Frank widerwillig zu. »Und wenn du uns verarscht, werden wir dir ein paar dieser Zombies auf den Hals hetzen. Dann hilft dir auch diese bescheuerte Aluminiumverkleidung nichts mehr.«
»Ihr werdet es nicht bereuen. Das schwöre ich«, sagte der Prepper.
»Das hoffe ich«, erwiderte Frank argwöhnisch.
»Nehmt die Leuchtfackel und die Taschenlampe.«
»Die brauchen wir nicht. Es ist grad mal drei Uhr. Es ist noch lange hell.«
»Ja, aber ihr müsst nach unten.«
»Wie? Nach unten?«
»In den U-Bahnschacht hinunter. Entlang der neuen Strecke der U5.«
»Die ist doch noch gar nicht fertig.«
»Die Röhre aber schon. Ihr könnt vom Brandenburger Tor bis zum Alexanderplatz laufen. Es gibt keine Schienen und die Haltestellen sind im Rohbau, also sollte niemand da unten sein.«
»Bis auf die Arbeiter.«
»Ja, vielleicht die.«
»Aber besser als auf der Straße ist es allemal.«
»Das mag sein. Unter den Linden ist bestimmt voll mit unseren bärtigen Freunden«, vermutete Frank.
Das Neonlicht ging aus und schaltete sich nach einem Moment wieder an.
»Was war das?«, fragte Sophia.
»Ein Stromausfall. Die Notstromaggregate sind angesprungen«, erklärte der Prepper. »Ich werde euch jetzt zeigen, wo es langgeht.« Eins der Bodengitter hob sich automatisch und legte eine Treppe nach unten frei. »Es gibt einen Verbindungsgang von hier bis zum Tunnel.«
»Wo geht’s lang?«, fragte Frank.
»Es gibt nur diesen einen Korridor dahin. Ihr könnt euch nicht verlaufen.«
Sophia zögerte. »Nach unten? Meint ihr, das ist ’ne gute Idee?«
»Warum nicht?«, erwiderte Frank. Dann wandte er sich Can zu. »Du bleibst hier und ruhst dich ’n bisschen aus.«
»Ich werd’ auf keinen Fall bei diesem Verrückten bleiben«, widersprach Can. »Ich komme mit.«
»Du kannst ja kaum laufen.«
»Kai kann mich stützen«, schlug Can vor.
»OK«, sagte Kai.
»Na, dann los«, entschied Frank.
Die vier gingen die Stufen nach unten und folgten einem Korridor, in dem verschiedene Rohrleitungen verliefen, bis zu einer verschlossenen Metalltür. Der Schlüssel steckte im Schloss. Sie öffneten die Metalltür, schlossen sie hinter sich wieder ab, und Frank steckte den Schlüssel ein.
Sophia leuchtete mit der Taschenlampe in die Dunkelheit. Vor ihnen lag der Rohbau des U-Bahntunnels der Linie 5, die in einem Jahr von Hönow bis zum Hauptbahnhof führen sollte.
»Glaubst du, man kann dem Prepper trauen?«, fragte Sophia und leuchtete die Platten der Betonverschalung aus.
»Er scheint ein Feigling zu sein«, vermutete Frank.
»Die waren dann alle tot, wenn der Prepper mit ihnen gesprochen hat«, sagte Kai.
Frank drehte sich zu Kai um. »Du meinst bei ZombiU?«
»Es hat ihn nicht gejuckt.«
»Es war nur ein Spiel«, wandte Sophia ein. »Unser Prepper ist bestimmt anders.«
»Jemand, der im Hintergrund agiert, hat immer was zu verbergen«, sagte Frank.
»Hört ihr das?«, unterbrach Can ihn, ängstlich in die Dunkelheit blickend.
»Was denn?«, fragte Sophia.
»Dieses komische Geräusch da hinter uns.«
Die vier drehten sich um, und Sophia leuchtete in die Dunkelheit. Jetzt hörten sie alle diese merkwürdigen Laute, die im U-Bahn-Tunnel verhallten. Im Lichtkegel der Taschenlampe war aber nichts zu sehen.
»Was ist das nur?«, fragte Sophia und leuchtete Frank mit der Taschenlampe ins Gesicht.
»Ich weiß es nicht. Es hört sich gewaltig an. Wie ein Prusten oder Schnüffeln.«
»Schnüffeln?«
»Eigentlich .. nun ja ... wie Hunderte von Hunden, die Witterung aufnehmen wollen.« Frank nahm die Leuchtfackel, entzündete sie und warf sie so weit in den Tunnel, wie er konnte. Die Fackel schlug auf dem Boden auf und tauchte die Umgebung in ein rötliches Licht. Die vier versuchten zu erkennen, ob sich dort etwas bewegte, doch da war nichts. Nur dieses merkwürdige Geräusch schien immer näher zu kommen.
»Lass uns weg«, flüsterte Sophia, obwohl sie nichts erkennen konnte.
»Wir müssen sehen, wer uns folgt«, widersprach Can. Die unheimlichen Laute kamen nun immer näher. Wie gebannt sahen alle vier auf die Leuchtfackel, die immer heller zu werden schien, als ein Schatten auf die Decke der Betonröhre gezeichnet wurde. Dann ein zweiter und ein dritter.
»Oh, mein Gott«, flüsterte Sophia. Ein Horde Zombies kam direkt auf sie zu. Die ersten Zombies krochen auf allen vieren, die Nase an den Boden gedrückt, wie Spürhunde. Die Zombies dahinter gingen mehr oder weniger aufrecht, hielten den Kopf in den Nacken und atmeten von Zeit zu Zeit tief ein, als versuchten auch sie, Witterung aufzunehmen.
»Die können hier unten nichts sehen. Also schnüffeln sie«, schlussfolgerte Frank.
»Can zog sich das Bettlaken vom Kopf. »Dann bringt uns die Maske nichts mehr.«
Kai griff Can unter die Arme, und die vier flohen, so schnell sie konnten. Die Leuchtfackel erlosch. Nur noch dieses diffuse Geräusch in der Dunkelheit war hinter ihnen zu hören. Der Lichtkegel der Taschenlampe zuckte über die Betonwände, tastete irgendwann Gerüststangen ab, um dann eine hölzerne Treppe einzufangen, die aus dem Tunnel auf eine Ebene darüber führte. Es musste eine U-Bahn-Station sein, die sich noch im Rohbau befand. Kai ging mit Can vor, der Mühe hatte, die Stufen zu erklimmen. Sophia folgte den beiden und Frank bildete die Nachhut. Als sie die Zwischenetage erreicht hatten, sahen sie eine Betontreppe, die auf die Straßenebene führte. Durch einen Spalt drang Licht bis zu ihnen vor.
»Ich werde nicht weichen«, sagte Frank plötzlich.
»Was meinst du?«, fragte Sophia.
»Ich werde mich ihnen stellen. Ich werde mich nicht mehr verstecken. Man muss den Kampf gegen diese Zombie-Islamisten aufnehmen. Man darf nicht weichen.«
»Spinnst du? Komm mit, da oben ist der Ausgang!«, sagte Can. »Wir sind fast da.«
Kai ließ Can los und nickte. »Ich bleib’ auch hier.«
»Nein, mein Freund«, sagte Frank. »Du bleibst bei Sophia. Ihr müsst es bis ins Move Inn schaffen. Rebecca hat ein CB-Funkgerät. Damit holt ihr Hilfe.«
»Dann komm du auch mit. Wir brauchen dich«, bat Sophia.
»Für mich gibt es kein Zurück mehr. Die werden uns nicht in Ruhe lassen. Und ich werd’ mich nicht mehr verstecken.«
Die ersten Zombies hatten die Holztreppe erreicht und torkelten nach oben.
»Ich wünsche euch alles Gute«, verabschiedete sich Frank, hob seine Metallstange und ging die Stufen nach unten, direkt auf die Zombies zu. Das Licht, das von der Straße hereinfiel, erleuchtete die Mitte der Treppe. Dort blieb Frank stehen und wartete. »Kommt her, ihr Bastarde. Ich stehe noch hier!«, rief Frank den Zombies zu. Er hämmerte mit der Eisenstange auf das Geländer ein. Geblendet vom Lichtstrahl, blieb der erste Zombie stehen und schien ihn zu mustern. Frank hieb ihm mit der Stange auf die Stirn. Sofort fiel der Zombie nach hinten die Treppe hinunter. Auch den zweiten und dritten Zombie fällte Frank mit Schlägen auf den Kopf, den Körper und die Beine. »Ich werde euch zeigen, was es heißt, uns anzugreifen!«, schrie er und trat einem Zombie der zweiten Angriffswelle ins Gesicht. Er merkte die Flüssigkeit, die auf sein Gesicht spritzte, doch es kümmerte ihn nicht. Wie Leonidas bei den Thermopylen, schoss es Frank durch den Kopf. So würde er diesen Engpass verteidigen. Es gab kein Zurückweichen mehr. Diese Bastarde würden bezahlen. Hier und heute. Aber es waren nicht 300 Spartaner, die der Übermacht widerstanden. Hier stand nur ein Mann.
10.
Platz der Republik, vor dem Reichstagsgebäude.
Padollas angeschwollene Stirn brannte. Er rieb sich darüber, doch der Schmerz wollte nicht nachlassen. Er drückte mit den Fingern gegen die Stirn und konnte die Frontpartie eindrücken, doch wenn er die Hand wegnahm, sackte die Stirn wieder nach vorne aus. War da überhaupt noch ein Knochen? Er brauchte etwas zum Stabilisieren.
Du bist fast am Ziel, sprach diese fremde Stimme erneut zu ihm.
Was?, dachte Padolla.
Du hast es fast geschafft. Nun guck nach vorne.
Padolla blickte nach vorne.
Was siehst du?
Da ist ein Platz voller Menschen.
Du weißt, dass es keine Menschen mehr sind.
Sie sehen aber immer noch wie Menschen aus.
Sie gehören jetzt aber zu uns. Zu unserer Gemeinschaft.
Gemeinschaft?
Erinnerst du dich nicht an meine Worte?
Ich ... nein.
Du warst schwach, und sie haben dich zurückgelassen.
Sie?
Unsere Feinde.
Ich war schwach?
Du warst schwach, und wir haben dir Stärke verliehen. Du warst voller Zweifel, und wir haben dir den Weg gezeigt. Du warst einsam, und wir haben dich in unsere Gemeinschaft aufgenommen.
Ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die, die mich getäuscht haben und sich als meine Freunde ausgaben. Die mich zurückließen.
Es sind nicht deine Freunde.
Ich erinnere mich an sie.
Wir sind nicht so. Wir werden dich niemals zurücklassen.
Es tut aber so weh.
Du wirst schon bald keine Schmerzen mehr haben.
Meine Beine gehorchen mir nicht mehr.
Du wirst deine Beine kontrollieren können, solange es notwendig ist.
Aber diese Schmerzen ...
Siehst du den Sonnenschirm? Den, den man sich auf den Kopf setzt? Das wird deine Schmerzen lindern.
Padolla hob den Kopfsonnenschirm auf, den ein Tourist liegen gelassen hatte. Bespannt mit einem Tuch in den Farben der Republik, zog er sich den Plastikring über, spannte den Gurt um den Kopf und drückte die Aussackung somit zurück.
Blicke nun auf, ein Gedanke in seinem Kopf.
Padolla sah auf.
Was siehst du?
Den Reichstag.
Die Eingänge sind geschlossen. Du weißt aber, wie man dort hineingelangt.
Ja. Es gibt da einen Weg.
Zeige nun unseren Brüdern diesen Weg. Denn wir sind eins. Wir gehören alle zusammen.
11.
Rotes Rathaus, Baustelle der U-Bahnlinie 5.
Das rote Rathaus lag vor ihnen, und es regnete in Strömen. Die Laute erregter Zombies, die Beute gemacht hatten, im dunklen U-Bahn-Schacht unter ihnen, gingen Sophia, Kai und Can wie betäubt über die Baustelle. Kai drehte sich zu Sophia um, die Augen gerötet, Entsetzen im Gesicht. Er stützte Can, dessen Beine vor Erschöpfung immer wieder wegsackten.
»Weiter, immer weiter!«, rief Sophia den anderen zu und schob den Absperrzaun beiseite. Den Kopf zur Seite gerichtet, rempelte Kai sie von hinten an.
»Was ist?«, fragte Sophia, als sie das Entsetzten in seinen Augen sah. »Was hast du?« Dann drehte auch sie sich zur Seite. Vor der Baustelle lagen auf dem Boden hunderte, vielleicht auch tausende von Zombies mit aufgeplatzten Schädeln. Würmer, weißliche Larven und gelbliche Eier wurden zusammen mit den Resten von Hirnsubstanz vom Regen in die Ausgüsse gespült. Die Zombies füllten den Platz bis zum Fernsehturm, stapelten sich im Becken des Neptunbrunnens und lagen vor dem Roten Rathaus. Entwichen die Wut und der Hass, leblos und erbärmlich. Sophia klammerte sich an Kais freien Arm, als ein Grunzen aus dem U-Bahn-Schacht hinter ihnen drang. Dicht an dicht drängten die Zombies die Treppe der Baustelle hoch und torkelten auf sie zu, die pulsierenden Stirnblasen präsentierend. Unfähig zu fliehen, blieben die drei stehen. Plötzlich begannen die Zombies wie wild mit den Köpfen zu wackeln. Ein Zombie nach dem anderen stürzte vor ihnen auf den Boden und schüttelte sich noch einmal, bevor die Stirnblase aufplatzte.
Kai wischte sich über sein vom Regenwasser feuchtes Gesicht und lachte auf. »Das sind doch Regenwürmer«, sagte er. »Wenn es regnet, müssen die raus.«
»Ja«, stimmte Can zu. »Nichts weiter als blöde Regenwürmer.«
»Biologisch gesehen sind das keine ...«, widersprach Sophia, dann legte sie den Kopf in den Nacken, schloss die Augen und ließ den Regen auf ihr Gesicht fallen. »Aber sie verhalten sich wirklich ’n bisschen so.«
»Die kommen immer raus, wenn es regnet«, sagte Kai.
Vor dem Fernsehturm nutzte eine Gruppe Jugendlicher die Gelegenheit und plünderte die gefällten Zombies aus, nahm ihnen Portemonnaies, Handys und Geld ab. Nur diese Leichenfledderer, sonst war keiner auf den Straßen unterwegs. In den Hochhäusern, die den weitläufigen Platz säumten, standen hier und da auf den Balkonen Menschen und blickten herunter. Einige hatten Bierflaschen in der Hand, andere hielten ihre Smartphones in die Luft, als versuchten sie, den Empfang wiederherzustellen. Manche riefen, als sie sie sahen. Es waren keine Hilferufe. Was auch immer die Menschen von ihnen wollten, Can, Kai und Sophia verstanden es nicht. Bis hin zur Hochbahntrasse der S-Bahn lagen die Zombies mit aufgeplatzten Schädeln auf der Straße, wanden sich Würmer auf dem Pflaster, verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Wirt. Mit durchnässter Kleidung erreichten die drei das Foyer des Move Inn Hotels. An der Rezeption saß niemand mehr. Sie gingen zu den Aufzügen hinüber.
»Die haben immer noch Strom«, wunderte sich Can, als er die Fahrstuhltaste drückte und der Aufzug aus der 37. Etage nach unten fuhr.
»Vielleicht haben die ja auch ein Stromaggregat«, vermutete Sophia.
»Oder der Spuk ist vorbei?«, hoffte Can.
»Nein, es ist nicht vorbei«, sagte Kai und zeigte auf die fünf Zombies, die aus dem Hinterzimmer der Rezeption kamen. Nicht alle waren dem Regen ausgesetzt gewesen. Ein Klingeln signalisierte, dass der Fahrstuhl das Erdgeschoss erreicht hatte, und die Tür öffnete sich. Die Kabine war mit einer alten Frau besetzt, die im Rollstuhl saß.
»Was zum Teufel? Ist sie ein ..?«, fragte Can.
»Nee, die macht nur ’n Nickerchen«, erkannte Kai sofort. Er schob den Rollstuhl mit der alten Frau in die Kabinenecke, so dass sie genug Platz hatten, um einzusteigen. Sophia drückte sofort die Taste »37«, doch noch bevor sich die Tür schließen konnte, hatte der erste Zombie den Fahrstuhl erreicht. Kai blockierte mit seinem massigen Körper den Zutritt zur Kabine, doch solange der Zombie im Türraum stand, konnte sich die Tür nicht schließen. Der Zombie streckte seine Arme nach Kai aus und versuchte, ihn in den Hals zu beißen, doch da dieser mehr als einen Kopf größer war, gelang es ihm nicht. Mit einem kräftigen Stoß katapultierte Kai den Zombie nach draußen.
»Nach oben! Los!«, schrie Can. Sophia hämmerte auf die Taste »37« ein, als zwei weitere Zombies angriffen. »Nein, nein!«, schrie Sophia auf.
Plötzlich erschien Frank hinter den angreifenden Zombies, griff einen von hinten und bohrte ihm einen Spachtel in die Stirn.
»Scouuut!«, rief Kai. »Der Scout ist zurück!«
Frank griff sich den nächsten Zombie und stach auch diesem gezielt den Spachtel in den mit Würmern gefüllten Stirnbeutel. Trotzdem ignorierten die beiden anderen Zombies Frank und griffen weiterhin Kai an. Frank entleerte auch ihre wurmhaltigen Kopfzysten. Sophia stand mit offenem Mund da, in Cans Gesicht spiegelte sich Angst, nur Kai lächelte. »Der Scout ist wieder da!«, rief er erneut aus.
In Franks Gesicht ließ sich keinerlei Emotion ablesen. Er hatte sich eins der grünen Stirntücher um den Hals gebunden, die er einem der Zombie-Salafisten abgenommen hatte. Er zog die leblosen Körper der Zombies in aller Ruhe aus dem Türbereich und stieg in die Kabine ein.
»Frank?«, fragte Sophia ungläubig. »Wie hast du es ...? Wie konntest du ...?«
»Entkommen?« Frank sah auf den Boden. »Ich bin hier. Reicht das nicht?«
Kai klopfte Frank auf die Schulter. »Du hast es geschafft.«
»Da müssen schon mehr kommen als so ein paar Durchgeknallte.«
Can musterte Frank mit kritischem Blick. »Was ist mit deinem Hals passiert?«
»Nur ein Biss ...«
»Ein Biss?« Can wich zurück.
»Oder auch zwei«, berichtigte sich Frank. »Hab’ es mir noch nicht im Spiegel angesehen.«
Sophia wollte das Halstuch berühren, doch Frank wehrte sie ab. »Es ist nichts«, sagte er.
»Müssest du nicht?«, begann Sophia nachdenklich. »Müsstest du nicht ...«
»Müsste ich nicht was?«
»Dich nicht verwandelt haben?«
»Weißt du«, sagte Frank mit einem gequälten Lächeln, »ich denke, dass bei einem Agnostiker wie mir der Wurm wahrscheinlich an seine Grenzen gestoßen ist.«
»Was stinkt denn hier so?« Kai wedelte mit der Hand vor seiner Nase.
»Riecht hier wirklich ganz schön streng«, bestätigte Sophia.
»Was guckt ihr mich so an?«, verteidigte sich Frank. »Das kommt von eurer neuen Freundin hier.« Er deutete auf die alte Frau im Rollstuhl.
»Das gibt’s doch nicht.« Kai hielt sich die Nase zu.
»Hat die Alte etwa einen fahren lassen?« Can drehte sich angeekelt weg.
»Oh Mann«, sagte Kai. »Die Leisen stinken immer am schlimmsten.«
»Und dazu dann noch diese dämliche Fahrstuhlmusik«, beschwerte sich Frank. »Wer ist die Frau überhaupt?«
»Keine Ahnung. Die hat im Fahrstuhl gepennt«, sagte Kai.
Die Kabine hielt im 37. Stockwerk an, und Frank stieg als Erster aus. »Ihr bleibt hier, ich kundschafte«, sagte er und blockierte die Tür mit einem Stuhl. Mit gehobenem Spachtel durchsuchte er das Panoramakaffee nach Zombies. Als er sich sicher war, dass kein Wurmbesessener in der Nähe war, setzte er sich auf einen Barhocker, der am Tresen stand. »Die Luft ist rein. Ihr könnt kommen!«, rief er ihnen zu. Dann klopfte er auf die Tischplatte. »Und du brauchst dich auch nicht mehr zu verstecken.«
»Wen meinst du?« fragte Sophia, als sie neben Frank stand.
»Die junge Dame, die sich da unterm Tresen verkrochen hat, als wir gekommen sind.«
Ein Mädchen stand auf und zeigte Frank den Mittelfinger. Sie hatte ein weiß geschminktes Gesicht mit angedeuteten Spinnweben um die Augen, ausgewaschene Jeans und wiegte ein langes Skateboard in einer Hand, ein Longboard. Auf ihrem Kapuzenpullover war der Spruch I want to leave aufgedruckt, darüber abgebildet war die Silhouette eines Ufos. Der Wunsch, die Erde zu verlassen, schien die Abwandlung des allseits bekannten I-want-to-believe-Mottos der Alien-Jünger zu sein, reimte sich Frank zusammen. »Na toll. Eine vierzehnjährige Nihilistin«, sagte er mit breitem Grinsen. »Du bist dann wohl Rebecca, nehm’ ich an.«
Das Mädchen zog die Augenbrauen hoch. »Spinnst wohl oder was?«
»Na, du bist doch bestimmt die kleine Schwester vom Prepper.«
»Prepper? Welcher Prepper?«
»Ist das nicht dein Bruder?«
»Müsst’ ich wissen.«
»Wer bist du dann?«
»Geht dich nichts an.«
»Du kannst uns ruhig deinen Namen sagen«, mischte sich Sophia ein.
»Ja, wir wollen dir helfen«, fügte Can hinzu.
»Ich kann auf mich selbst aufpassen.«
»Auf dich selbst aufpassen? Wie wohl alle Teenager dieser Welt«, lästerte Frank.
»Du kannst mich mal.«
»Wie sollen wir dich denn nennen? Jackie Skater-Girl vielleicht?«, reizte Frank sie weiter.
Wieder zeigte das Mädchen ihm den Mittelfinger.
»Entschuldigung. Du bist wohl die dunkle Edition. Eher ein bad Skater-Girl.«
»Jetzt lass sie doch in Ruhe«, schritt Sophia ein.
»Was willst du denn?«, fragte Frank. »Es läuft doch prima zwischen uns. Wir freunden uns gerade an.«
»Wir haben einen wichtigen Auftrag vom Prepper«, erklärte Kai dem Mädchen derartig bedeutungsschwanger, als suchten sie nach dem heiligen Gral.
»Auftrag?«, fragte das Mädchen nach.
»Wir müssen Rebecca finden. Die kleine Schwester vom Prepper. Dann gibt er uns Essen und wir können funken, wa?«
»Nichts für ungut«, sagte das Mädchen, »aber ich denke, da hat euch jemand mächtig verarscht.«
»Was machen wir mit der Alten im Fahrstuhl?«, fragte Can.
»Die Frau hatte ich ganz vergessen«, gab Sophia zu.
»Na, immer rein in die gute Stube«, entschied Frank. »Machst du das, Kai?«
»Ich kann sie holen«, sagte Can.
»Geht’s dir denn wieder besser?«, erkundigte sich Frank.
»Noch ’n bisschen wacklig, aber ich will mich jetzt auch mal nützlich machen.« Can holte die alte Frau aus dem Fahrstuhl und fuhr den Rollstuhl an den Tresen heran.
Sophia musterte Franks Hals. »Warum hast du dir das Tuch umgewickelt? Was ist passiert? Und wie hast du überleben können?«
»Das würdest du wohl gerne wissen.«
»Wir haben ein Recht darauf, es zu erfahren.«
»Es hat sich eben ausgezahlt«, begann Frank, »dass ich fünfzigmal den Film Taxi Driver gesehen hab’. Eine perfekte Vorbereitung auf die Apokalypse kann ich euch sagen.«
»Du bist eigentlich ganz schön retro«, schlussfolgerte Can.
»Lass mich mal nachsehen«, sagte Sophia und griff nach dem Halstuch. Zuerst wehrte Frank sie ab, doch dann ließ er sie das Tuch abwickeln. Im Hals gab es mehrere tiefe Bisswunden, doch die Halsarterien waren unverletzt, stellte Sophia fest. »Kein Blut, obwohl du tiefe Bisse hast«, wunderte sie sich.
»Die sondern bestimmt irgendwas ab, die Würmer. Das stoppt die Blutung«, vermutete Frank. »Es tut auch gar nicht weh.«
»Was ist da unten im Tunnel mit dir passiert?«, fragte Can.
»Nun, ich hab’ viele Zombies umgebracht, äh getötet, also wie auch immer man das nennen mag«, sagte Frank ruhig. »Ich hab’ meinen ganzen Hass also rausgelassen. Ich hab’s ihnen gezeigt. Einen nach dem anderen. Ich bin über ihre Körper hinweg gestiegen, hab ihre Schädel mit der Stange gesprengt. Doch mein Hass hat nicht für alle ausgereicht. Irgendwann haben sie mich gekriegt. Dann muss ich ’ne ganze Zeit bewusstlos gewesen sein. Keine Ahnung, was da passiert ist. Als ich aufgestanden bin, standen die Zombies um mich herum. Sie haben mich aber nicht mehr angegriffen.«
»Du hast deinen Hass rausgelassen? Hast du denn kein Mitleid mit den Menschen?«, fragte Sophia.
»Es sind doch längst keine Menschen mehr. Es sind angreifende Dinger. Die oder wir. Es geht einzig und allein ums Überleben. Was sie einmal waren, ist bedeutungslos. Und ob ich Mitleid habe, was aus ihnen geworden ist«, erklärte Frank und sah Sophia an. »Wenn es dich beruhigt: Es hat mir keine Genugtuung verschafft, diese Bastarde zum Teufel zu jagen.«
Sophia drehte sich zu Kai um. »Such doch mal nach dem Verbandkasten in der Küche ... der muss da an der Wand hängen oder so.«
»Ist gut«, sagte Kai.
»Und du gib mir doch mal bitte den Whiskey«, bat Sophia das Mädchen. »Wie heißt du denn nun?«
»Claudia. Mein Name ist Claudia.« Sie reichte Sophia die Flasche.
»Ich muss die Wunde desinfizieren.«
»Desinfizieren? Also eins nach dem anderen«, widersprach Frank. »Zuerst muss ich mich innerlich mal reinigen.« Frank blickte auf die Bar. »Freie Auswahl, denk’ ich. Nur leider kein Barmann.«
»Ich mixe auf Parties immer Cocktails«, bot sich Can an.
»Du?«, fragte Frank verwundert. »Ich denke, ihr Moslems trinkt nichts.«
»Ich mische nur, trinken tun die anderen.«
»Auch ’ne Lösung. Na, hoffentlich sieht Allah nicht so genau hin.«
»Das lass mal meine Sorge sein.«
»OK. Machst du mir dann vielleicht ’nen Mojito?«
»Kein Problem.« Can ging hinter die Theke, stellte sich Rum und Limettensaft zurecht und holte aus dem Kühlschrank frische Minze. Derweil kam Kai aus der kleinen Küche mit einem Verbandkasten zurück. Sophia nahm eine Kompresse, tränkte sie mit Whiskey und wischte vorsichtig über die klaffende Wunde.
»Tut gar nicht weh«, zeigte sich Frank verwundert. »Kein bisschen.«
»Merkwürdig.« Sophia musterte die Wunde und rieb dann die Kompresse darüber. »Da steckt noch was drin.«
»Was? Was zum Teufel meinst du?«, fragte Frank aufgebracht.
»Ein Fremdkörper. Etwas Schwarzes«, sagte Sophia.
Frank trank den Mojito, den Can ihm hingestellt hatte, in einem Zug aus. »Verdammte Scheiße.«
»Ich misch dir noch einen, Bruder«, sagte Can.
Sophia überlegte. »Ich hab’ eine Idee. Ich hab’ da mal ’ne Doku gesehen vom Amazonas. Wie die da mit Parasiten umgehen. Wart’ mal.« Sie ging in die Küche und kam mit einer Flasche Öl zurück.
»Willst du mich jetzt braten oder was?«, fragte Frank. »Gibt es keine weniger radikale Lösung? Ich entschuldige mich auch für alle Beleidigungen.«
»Das kommt reichlich spät«, ging Sophia auf seine Anspielung ein.
»Also bitte: am ersten Tag der Zombie-Apokalypse zum Kannibalen werden? Ist das nicht etwas übertrieben? Wie war der Spruch? Go vegan. Das sollte doch auch Menschenfleisch einschließen.«
Sophia schüttelte den Kopf. »Du und deine Sprüche.«
»Die hast du doch bestimmt vermisst, oder?«
»Na, vielleicht ein wenig«, gab Sophia zu. Sie tränkte eine Kompresse mit dem Öl und tupfte die Wunde ab. Dann nahm sie die Flasche und ließ das Öl direkt über die Wunde laufen.
»Hey, das versifft meine Klamotten«, beschwerte sich Frank.
»Warte«, forderte Sophia. Sie inspizierte die Wunde und dann, auf einmal, kniff sie mit den Fingern zu.
»Spinnst du?«, fragte Frank, obwohl er keinen Schmerz spürte. Eigentlich spürte er gar nichts.
Sophia zog etwas Schwarzes heraus. Es entglitt ihren Fingern und sie musste nachfassen. Sie schleuderte den schwarzen Egel auf den Tresen, nahm die Whiskeyflasche und zerdrückte ihn.
»Igitt, ist das eklig«, wandte sich Claudia angewidert ab.
Frank betrachtete den zerquetschten Wurm. »Wie hast du ... woher wusstest du?«
»Wenn ein Wurm unter der Haut lebt, braucht er Luft. Er stülpt seine Atemöffnung also nach draußen, und die kann man mit Öl versiegeln. Um nicht zu ersticken, muss er dann nach oben kommen.«
»Meine Güte, du weißt wirklich ’ne ganze Menge«, sagte Frank nicht ohne Bewunderung.
»Wissen ist Macht«, bestätigte Sophia, wischte das überschüssige Öl mit der Kompresse ab und drückte dann eine saubere Kompresse auf die Wunde. »Halt mal«, sagte sie zu Frank. Der hielt die Kompresse fest, während Sophia Heftpflaster von der Spule abwickelte und die Kompresse mit zwei Streifen am Hals fixierte.
Kai sah Sophia bewundernd an. »Jetzt wissen wir auch, wie du heißt, wa?«, stellte er fest.
»Was meinst du?«, fragte Sophia.
»Du bist der Doc.«
»Was? Nein, ich hab doch nur ...«, wehrte sich Sophia gegen den Namen.
»Doch, du bist jetzt unser Doc.«
Frank nickte. »Also von mir bekommst du die Approbation.« Er sah Sophia an. Er war ihr dankbar, doch er sagte nichts. Dann zog er die Handschellen aus seiner Jackentasche, die er in der Wohnung am Mehringplatz mitgenommen hatte.
»Was soll das?«, fragte Sophia.
»Ich kann nicht bei euch bleiben«, erklärte Frank. »Ich bin eine Gefahr. Gott weiß, warum ich mich nicht schon verwandelt hab’.«
»Vielleicht hab’ ich ja den Wurm noch rechtzeitig entfernt?«
»Oder der hat schon Eier gelegt.«
»Eier«, wiederholte Can angewidert. »Also, ich brauch’ jetzt wohl auch einen«, sagte er, schenkte sich einen Whiskey ein und trank ihn in einem Zug aus.
»Na, Allah wird schon nichts dagegen haben«, bemerkte Frank und prostete ihm mit seinem zweiten Mojito zu. Dann trank er ihn aus. »Ich werd’ jetzt aufs Dach und mich dort festketten. Ihr verrammelt die Türen zum Treppenhaus und blockiert alle Fahrstühle.«
»Warum gibt es hier eigentlich überhaupt noch Strom? Der ist doch fast überall ausgefallen.«
»Das ist das Interhotel«, keifte plötzlich die Alte im Rollstuhl so laut, dass Sophia aufschrak. Die Frau öffnete die Augen und räusperte sich. »In der DDR«, fuhr sie fort, »da war das Interhotel mit allem Drum und Dran ausgestattet.«
»DDR? Ganz schön lange her, oder?«, fragte Frank.
»Reich mir doch auch mal ’n Schnäpschen rüber, mein Junge«, sagte die Alte zu Can.
Can bot ihr einen Pflaumenschnaps an, die Alte nickte und Can schenkte ihr ein Glas ein. »Kette dich doch hier unten an«, schlug er vor.
»Nein, besser nicht«, sagte Frank. »Ich muss jetzt alleine sein. Ich brauch ’n bisschen Zeit für mich. Wer weiß, wie lange ich noch bei Verstand bin.«
»Du musst nicht gehen«, sagte Sophia. »Du kannst bei uns bleiben.«
»Er ist der Scout«, sagte Kai. »Der geht mal hier hin, mal dahin.«
Frank nickte. »So ist es wohl.« Dann stand er auf, ging zum Treppenhaus, schritt die Stufen nach oben und öffnete die Tür zum Dach.
Die Sonne war bereits untergegangen, und Frank blickte über Berlin. Die Leuchtreklame des Move Inn Hotels funktionierte noch immer. Im Gegensatz dazu war in den meisten anderen Gebäuden der Strom ausgefallen. Hier und da ein Schrei, das Bellen eines Hundes, das Hupen eines Autos. In Kreuzberg brannte ein Wohnhaus. Sirenen von Einsatzfahrzeugen hörte er jedoch keine. Den Whiskey in der Hand, starrte Frank auf den Mond und überlegte, wie viel Zeit ihm noch blieb.
Die Tür zum Treppenhaus öffnete sich. Sophia kam mit mehreren Decken in der Hand heraus. »Ist ’n Vorteil, wenn man in einem Hotel unterkriecht«, sagte sie.
»Du musst vorsichtig sein, wenn du in die Zimmer gehst«, bemerkte Frank beinahe fürsorglich.
»Es sind keine Zombies da gewesen.«
»Na gut. Aber gib das nächste Mal Bescheid – dann gehe ich.«
»Hier hast du die Decken.«
»Danke, aber es ist nicht kalt.«
»Vielleicht jetzt noch nicht.« Sophia legte die Decken auf die Brüstung.
»Weiß gar nicht, ob die Zombies Kaltblüter oder Warmblüter sind«, sagte Frank.
»Was?«
»Ihre Haut ist eigentlich warm, aber irgendwie strahlen sie Kälte aus.«
»Du bist kein Zombie.«
»Noch nicht.« Frank blickte sie an und sah, wie sich der Mond in ihren Augen spiegelte.
Sophia wich seinem Blick aus. »Siehst du die Sterne?«, fragte sie ihn.
»Ja.«
»So gut hab’ ich sie noch nie hier gesehen.«
»Liegt daran, dass es ganz schön dunkel in der Stadt ist. Kein Störlicht dringt mehr ins Weltall.«
»Hast du schon einen Platz zum Schlafen gefunden? Ich meine, weißt du schon, wo du dich ...?«
»Ich mich festkette? Unter der Leuchtreklame«, antwortete Frank. »Da ist es trocken.«
»Frank?«
»Ja?«
»Was du vorhin gemacht hast ...«
»Was meinst du?«
»Dass du uns ... dass du dich ...«
»Dass ich Amok gelaufen bin?«
»Was du getan hast ... ich wollte mich ... mich nur bedanken. Ohne dich hätten sie uns alle gekriegt.«
»Ich hab getan, was getan werden musste.«
»Das war sehr mutig von dir.«
Frank lächelte. »Das hat mit Mut nichts zu tun. So sind Männer nun mal.«
»Bitte jetzt keine Macho-Allüren.«
Frank lächelte. »Kennst du die Geschichte der jungen Mammuts?«
»Was meinst du?«
»Die haben bei Ausgrabungen tausende von Mammutknochen in einer Grube gefunden. Alle in Schichten übereinander. Die müssen vor zehntausend Jahren und mehr in einen Sumpf geraten sein oder so was. Nicht alle auf einmal. Immer mal wieder ’n paar von ihnen. Von Generation zu Generation. Bis sich der Sumpf gefüllt hatte. Immer mal wieder waren welche unvorsichtig, wagemutig oder tolldreist. Wollten vielleicht angeben.«
»Worauf willst du hinaus?«
Frank blickte Sophia in die Augen. »Es waren alles junge Männchen, die dort gestorben sind.«
Sophia lächelte. »Was soll ich sagen?«
Frank wandte sich von Sophia ab, lehnte sich an die Brüstung und sah auf die Straße hinunter. »Wir müssen es so machen. Wir müssen die Gefahren suchen. Versuchen, unsere Grenzen zu überschreiten. Testosteron ist ein Killer. Manchmal stürzen wir Deppen eben in eine Grube und manchmal stürzten wir uns auf wurmverseuchte Zombies, um andere zu verteidigen. Ich bin ganz zufrieden, dass ich zur zweiten Gruppe gehöre.«
»Wir sind keine Mammuts, Frank. Wir sind anders.«
»Du weißt, dass das nicht stimmt. Wir sind immer noch die, die wir vor Jahrhunderttausenden waren. Ein bisschen Zivilisation vielleicht, ein größeres Gehirn, damit wir ein Smartphone bedienen können, mehr ist es nicht. Und sieh dich um. Wie viel wird davon jetzt übrig bleiben?«
Sophia sagte nichts.
»Warum bist aufs Dach gekommen?«, fragte Frank.
»Ich wollte nachsehen, dass du auch keine Dummheiten machst.«
»Und mehr ist es nicht?«
»Was soll denn mehr sein?«
»Stehst du auf mich?«, fragte Frank frei heraus.
Sophia lächelte. »Natürlich. Von Anfang an wollte ich dich.«
»So?«
»Deine Hülle sieht gut aus. Das Innere ist mir doch piepegal. Je verdorbener, desto besser.«
»Was?«, fragte Frank überrascht.
»Du weißt nicht so viel über uns Frauen. Wie wir uns anpassen können.«
»Du magst mich, weil du glaubst, dass ich verdorben bin?«
»Ich«, setzte Sophia zur Antwort an, doch als sie sah, wie begierig Frank auf ihre Erklärung wartete, atmete sie noch einmal tief durch, um ihn noch ein wenig zappeln zu lassen. »Ich verrate dir nun ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das unter Frauen von Generation zu Generation weitergegeben wird.«
»Weitergegeben? Du meinst so Geheimbund-mäßig?«
»Was dachtest du?«
»Ich hab’ befürchtet, dass ihr alle unter einer Decke steckt.«
»Ich steh’ auf dich, weil du die besten Gene mitbringst. Das wird unseren Kindern das Überleben sichern.«
»Kindern? So weit sind wir schon?«
»Eine Frau denkt eben vorausschauend.«
Frank runzelte die Stirn, sah sie zuerst nachdenklich an und dann lächelte er. »Weißt du, Sophia, ich hab’ dich vollkommen falsch eingeschätzt.«
»Ach ja?«
»Ich dachte, du wärst vollkommen Humor-befreit.«
»So?«
»Ich hab’ mich wohl geirrt.«
Kai öffnete die Tür zum Dach. Hinter ihm standen Can und Claudia. Sie hatten sich Decken unter die Arme geklemmt und kamen langsam zur Brüstung vor.
»Wo habt ihr denn die alte Frau gelassen?«, wollte Frank wissen.
»Die hat sich an der Bar festgetrunken«, gab Can Auskunft. »Ich hab’ ihr Schnaps hingestellt. Dann kann sie sich selbst bedienen.«
»Na, dann lasst uns mal das Nachtlager vorbereiten«, schlug Frank vor. »Hulk kettet sich jetzt fest, ihr könnt in gebührendem Abstand seine Verwandlung beobachten.«
12.
Am nächsten Morgen.
Reichstag, geheimer Nebeneingang an der Spree.
Ein Zombie mit einem Kopfsonnenschirm taumelte an den am Boden Liegenden vorbei und watete durch die mit Würmern zersetzte Hirnflüssigkeit, die sich auf dem Asphalt ergossen hatte. Hunderte von Brüdern, die der Regen gefällt hatte. Nur bei diesem einen Zombie war es anders. Sein Gesicht war durch die besondere Kopfbedeckung trocken geblieben, und die Würmer hatten nicht instinktiv den selbstmörderischen Weg ins Freie gewählt.
»Herr Staatssekretär! Herr Staatssekretär Padolla!«, rief einer der Wachleute, der die Geheimtür zum Reichstag geöffnet hatte und auf seinen Kollegen wartete, der an der Spree eine Zigarette rauchte. Entspannt schien der Wachmann zu sein, weil er wohl glaubte, die Apokalypse wäre nun vorüber. »Kommen Sie!«, rief der Wachmann ihm zu. Und der Zombie, der einmal Padolla hieß, folgte, wie er es schon als Mensch immer getan hatte. Erfüllungsgehilfe der Würmer und unfreiwillig dem Bundespräsidenten ein letztes Mal ein willfähriger Handlanger, indem er seine teuflische Saat in den Reichstag trug, biss er dem überraschten Mann in den Hals.
13.
Dach des Move Inn Hotels am Alexanderplatz.
»Bist du noch da?«, fragte eine Stimme.
»Ja«, antwortete Frank und öffnete die Augen. In Decken gehüllt, lag Sophia direkt neben ihm. Als er sah, wie erleichtert sie wirkte, dass er sich nicht verwandelt hatte, gab er ihr einen Kuss auf die Stirn.
Sie lächelte. »Und wie geht es dir?«, fragte sie.
»Ich hatte schlechte Träume«, sagte Frank.
»Das glaub’ ich dir.«
»Von Würmern und so. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich glaub’, ich hab mit ihrem König diskutiert.«
»Mit ihrem König?«
»Dem König der Würmer.«
Sophia gähnte. »Worüber habt ihr euch denn unterhalten?«
»Über Religion.«
»Ach ja?«
»Ich hab ihn davon überzeugt, dass sie im Unrecht sind und ihr Djihad niemals erfolgreich sein kann. Sie alle verlieren werden. Dann hat er seine Argumente vorgebracht. Paradies und so. Jungfrauen eben. Und dann ich meine. Wir haben das Pro und Contra aufgeschrieben und am Ende hatte ich ihn überzeugt. Und dann haben wir zusammen einen getrunken, und er ist mit seinem Gefolge abgezogen.«
»Und was hast du ihm genau gesagt?«
»Wenn ich das nur noch wüsste. Kann mich einfach nicht erinnern.«
»Das ist aber dumm. Deine Argumente würden wir wohl alle gerne kennen.«
Frank strich sich mit dem Zeigefinger über die Lippen. »Ich denke, es liegt an meinem Blut ...«, vermutete er.
»Was meinst du?«
»Dass ich mich nicht verwandelt hab’. Ich hab’ dickes Blut. Anti-Thrombin-Mangel. Vielleicht mögen das die Würmer nicht.«
»Du hast einen Gendefekt?«
»Ja.«
»Nun, es könnte schon sein, dass die Larven in deinem Blut nicht wandern können oder so ...«
Frank winkte ab. »Bitte, keine Details.«
»Ich hör’ ja schon auf.«
»Weißt du, was komisch ist?«, fragte er.
»Was?«
»Wie viel Angst ich hatte in meinen Träumen. Ich meine, nicht vor dem Tod. Vor dem Tod hatte ich keine Angst. Aber ich hatte Angst davor, kein Mensch mehr zu sein und trotzdem zu leben. Umherzuwandeln.«
»Das glaub’ ich dir.«
Frank sah nachdenklich auf den Boden. »Ich hab’ nie viel übrig gehabt für meine Spezies und trotzdem hab’ ich heute Nacht nichts mehr gefürchtet, als alles Menschliche in mir zu verlieren.«
Sophia streichelte ihm über die Wange. »Weißt du was? Unten wartet ein schönes Frühstück auf uns. Wir setzen uns ans Fenster und trinken gemütlich Kaffee.«
Frank lächelte. »Weißt du, wenn es euch Frauen nicht gäbe ...«
»Ja und?«
»Also, wenn es euch nicht gäbe, dann wären wir echt verloren.«
»Warum? Weil ihr keinen Kaffee machen könnt?«
»So ... aber so war das doch nicht gemeint.«
Dann lächelte Sophia verschmitzt.
Frank biss sich auf die Unterlippe. »Also, an die neue Sophia mit ihrem Humor muss ich mich echt noch gewöhnen.« Dann stand er auf und betrachtete verwundert sein Handgelenk. »Wo sind eigentlich die Handschellen hin?«
»Ich hab’ dich losgekettet. Die Handschelle hatte sich heute Nacht in deine Haut eingeschnürt.«
»Aber ich hätte mich verwandeln können?«
»Weißt du was? Auch wir Frauen gehen Risiken ein.«
»Dass du das für mich ...« Frank stockte und musste schlucken.
Sophia stand auf. »Can und Claudia sind schon unten. Lass uns auch runter.«
»Warte noch, ich muss noch jemanden holen«, sagte Frank und ging zu Kai hinüber, der im Schneidersitz auf der Brüstung saß und den Sonnenaufgang bewunderte.
»Die stört sich nicht daran«, sagte Kai, als er merkte, dass Frank an ihn herantrat.
»Was meinst du?«
»Der Sonne ist es egal. Sie geht auf. Für Menschen und für Zombies. Es juckt sie nicht ...«
»Kai?«
»Ja.«
»Warum warst du wirklich in der U-Bahn? Ich meine, es war schon elf Uhr. Da hättest du längst an der Arbeit sein müssen.«
»Meine Mama macht sich immer Sorgen.«
»Du wolltest gar nicht zur Arbeit, nicht wahr?«
»Mein Chef sagt, ich bin dumm wie Scheiße. Und wenn mein Rücken kaputt ist, dann bin ich absolut nutzlos für ihn.«
»Ich bin froh, dass dein Chef so ein Arschloch ist.«
»Du bist froh?«
»Sonst hättest du nicht in der U-Bahn gesessen, und niemand hätte mich vor dem Zombie gerettet.«
»Und wer hat dich gerettet?«
»Du hast mich natürlich gerettet. Du hast den Zugführer in die Gleise geschmissen. Aber nicht nur mich hast du gerettet: Du hast Can den ganzen Weg geschleppt.«
»Schleppen kann ich noch. Nur nicht mehr heben.«
»In dieser Welt, Kai, da ist der klug, der sich keine Würmer einfängt. Vielleicht wurdest du vorher nicht gebraucht. Aber wir brauchen dich jetzt. Ohne dich werden wir es nicht schaffen.«
»Wir müssen noch Mama und Papa retten, wa?«
»Das werden wir, Kai. Das werden wir. Wir werden diese gottverdammte Stadt von den Würmern reinigen. Wir werden nicht zurückweichen und uns verstecken. Wir werden uns vorbereiten und dann werden wir den Kampf aufnehmen.«
»Das hört sich gut an«, sagte Kai und sah zum Fernsehturm hinüber.
Aus der Entfernung waren die Rotorengeräusche von Hubschraubern zu vernehmen.
»Die haben keine Hoheitsabzeichen?«, sagte Frank, als er sie erblickte.
»Was?«
»Die sind nicht von der Bundeswehr.«
Drei Hubschrauber kreisten zweimal um den Fernsehturm und landeten dann in der Nähe des Neptunbrunnens. Mehrere Soldaten sprangen heraus und sicherten das Gelände. Als Zombies auf sie zustürmten, schossen sie aus automatischen Waffen. Die erste Welle wurde niedergestreckt, doch schon die zweite sprengte die Reihen der Soldaten. Die Überlebenden retteten sich in die Hubschrauber, doch nur zwei der drei Maschinen konnten abheben.
»Wird nicht so einfach werden«, stellte Frank nüchtern fest.
»Wir bräuchten mehr Regen.«
»Ja, das stimmt. Mehr Regen.« Frank klopfte Kai auf die Schulter. »Kommst du mit runter?«
»Gleich.«
»Gut, dann sehen wir uns.«
»Ja, wir sehen uns.«
Frank wandte sich von Kai ab und ging mit Sophia zur Dachtür. »Fuck OFF ISombies« hatte Claudia an einen Ventilationsschacht gesprüht. Das »I« war merkwürdig weit entfernt vom Rest des Wortes. »I Sombie«, sprach Frank nachdenklich das ,I‘ englisch aus. »Jetzt bin ich selbst einer von denen.«
Sophia berührte seine Schulter. »Du bist keiner von denen.«
»Aber im Inneren trage ich es mit mir herum.«
Als die beiden ins Panoramakaffee kamen, frühstückten Can, Claudia und die alte Frau gemeinsam an einem Tisch. Claudia versuchte, mit der Fernbedienung am Fernseher, der über der Theke hing, einen Sender einzustellen.
»Was machen wir jetzt?«, fragte Can.
»Mal sehen«, antwortete Frank. »Wir sind ja eigentlich immer noch auf einer Mission. Die müssen wir abschließen, damit der Prepper uns hilft.«
»Was wollt ihr denn vom Prepper?«, mischte sich die alte Frau ein.
»Wie? Sie kennen ihn?«, fragte Can.
»Natürlich, der Herbert ist mein Bruder«, sagte die alte Frau.
»Ihr Bruder?«, fragte Sophia. »Herbert?«, fragte Can gleichzeitig.
»Dann sind Sie Rebecca?«, fragte Frank. »Sie sind seine junge Schwester?«
»Die bin ich«, sagte Rebecca stolz.
»Mann, der Prepper muss hundert sein«, merkte Can an.
»Ich bin immer noch rüstig, du kleiner Scheißer«, erwiderte Rebecca, »und mein Bruder nimmt’s mit euch allen auf.«
Aus dem Fernseher waren plötzlich Stimmen zu hören. »Ich hab’nen Sender reingekriegt«, sagte Claudia.
»Was ist das?«, fragte Can.
»Scheint der Offene Kanal zu sein«, vermutete Sophia.
Eine improvisierte Diskussionsrunde wurde übertragen. Im Hintergrund hing die Regenbogenflagge. Anton Hofstreiter, seinen Pferdeschwanz hinter die Schulter werfend, plädierte dafür, dass Männer und Frauen fortan in der Öffentlichkeit Burkas tragen sollten, um die Zombies nicht zu reizen. Ebenso setzte er sich für eine weitgehende Überdachung der Gehsteige ein, damit es zu keinen Benachteiligungen der Zombie-Mitbürger käme. Auch sollte der Versuch unternommen werden, Zombies schnellstmöglich in die Arbeitswelt zu integrieren. Dann verlas er eine Liste mit diskriminierenden Wörtern, deren Gebrauch fortan verboten war: Wurmkopf, Matschbirne und ebenso Mombie gehörte dazu, wenn nicht unverzüglich der Nachsatz hinzugefügt wurde, dass es sich um eine Mischung aus Mensch und Zombie handele. Zum Schluss rief Gregor Dyssi die Ökologisch-sozialistische Quarantäne-Republik Berlin aus, mit mahnendem Blick von Anton Hofstreiter berichtigt auf Ökologisch-sozialistische Quarantäne-RepubliX Berlin. Sie wollten diese RepubliX ausdrücklich als Gegenpol zu der von Bundespräsident Hauch gegründeten Neoliberalen Weimarer Republik verstanden wissen. Dabei saßen die beiden derartig selbstzufrieden da, als glaubten sie, auch diese Krise gemeistert zu haben, noch dazu, ohne auf das genormte Vokabular verzichten zu müssen. Nur Jakob Ohrstein, der einer von fünf weiteren Rednern war, schien nicht zufrieden zu sein. Mit einem zerfledderten Manuskript in der Hand schmollte er im Hintergrund, offensichtlich unglücklich darüber, keine bessere Sendezeit erhalten zu haben. Als Hofstreiter und Dyssi das Podium verließen und ein Netzexperte mit rotem Irokesenschnitt sein neues Buch »Die Gefahren der digitalen Revolution: Wie ich rechtes Gedankengut im Netz erkenne« vorstellen wollte, schaltete Claudia den Fernseher aus.
»Wie können die jetzt noch so reden?«, fragte Sophia entgeistert.
»Die finden auch immer ’ne Fernsehkamera«, stellte Can nüchtern fest. »Selbst in der Apokalypse.«
»Dann ist es jetzt also offiziell«, sagte Frank. »Ich hab’nen Zombie-Hintergrund, aber keine Zombie-Erfahrung.«
Claudia lachte.
»Hat man denn vor denen niemals Ruhe?«, fügte Frank hinzu.
»Nö, das hört niemals auf«, sagte Can.
»Wisst ihr, was ich denke?«, fragte Frank in die Runde.
»Was?«, wollte Claudia wissen.
»Autorennen sind keine schlechte Idee.«
»Wie meinst du das?«
»Wie es der Vater von Kai macht. Geht einfach zum Rennen, wenn er genug hat. Das Quietschen der Reifen, das Dröhnen der Motoren. Übertönt das ganze Geschwätz.«
»Gibt’s hier in der Nähe denn ’ne Rennstrecke?«, fragte Sophia.
Can nickte. »Die Avus kann man jetzt bestimmt langbrettern, ohne dass es jemanden stört. Wir bräuchten nur ’n Auto.«
»Das dürfte kein Problem sein«, sagte Frank lächelnd. »Es ist Apokalypse-Zeit. Wir machen jetzt ’ne Spritztour und dann, ja dann treten wir den Zombie-Islamisten gehörig in den Arsch.«
******
KARSTEN KREPINSKY
Rückkehr der ISombies
Episode 2: Sie konvertieren wieder!
Zum Buch
Politisch. Unkorrekt. Die Fortsetzung der subversiven Zombie-Satire »Angriff der ISombies«.
Regisseur Uwe Moll nutzt die Gunst der Stunde, um die Apokalypse in Berlin auf Zelluloid zu bannen, während sich im Reichstag eine Bedrohung unbekannten Ausmaßes zusammenbraut …
Halt! Hier Grenze!
Sie verlassen die Political-Correctness-Zone!
Attention!
You are leaving the PC sector!
KARSTEN KREPINSKY
Rückkehr der ISombies
(c) 2016 Karsten Krepinsky
Originalausgabe, Februar 2016
Alle Rechte vorbehalten
Nachdruck und Vervielfältigung aller Art (auch in Auszügen) nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors
Umschlaggestaltung: Ingo Krepinsky
www.nichtdiewelt.de
Wenn du das liest, solltest du Charlie sein*
*… oder Blutdrucksenker zur Hand haben.
»Pressezensur heißt heute Pressekodex.«
Uwe Moll, Regisseur des Films »In der Hölle gibt’s keinen Stoff, Baby«
Was bisher geschah:
Meldung der Deutschen Presse-Agentur vom 24. September 2018 zu den Vorkommnissen in Berlin
Menschen, genannt Angreifer, haben in Teilen von Kreuzberg Anwohner attackiert. Es wird von Morden und Plünderungen berichtet, die sich auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet haben. Hunderttausende sind nach Brandenburg geflohen. Medienberichte, wonach es sich bei den Angreifern um »bärtige Männer« gehandelt haben soll, die über den Mehringdamm liefen und Aussagen zu Allah gemacht haben, bestätigten sich indes nicht. Über das Schicksal von BundeskanzleriX ist nichts bekannt. Es wird vermutet, dass X sich noch immer im Reichstagsgebäude aufhält. Bundespräsident Hauch hat derweil in Weimar die Neoliberale Republik proklamiert. Er betont, dass der Vorfall in Berlin nichts mit dem Islam zu tun habe und ermahnt alle Bürger zu äußerster Wachsamkeit. Die Bundeswehr hat damit begonnen, um Berlin herum Sperranlagen zu errichten. Hauch stellt jedoch klar, dass es sich dabei nicht um einen Zaun handele, da es keine Grenzen mehr gäbe.
1.
Inschallah. So Gott will, würde er diesen Bastard kriegen. Der Syrer küsste die Patrone und drückte sie in das Magazin seiner Dragunow. Dann lud er das Scharfschützengewehr durch, das er aus der Asservatenkammer des Landeskriminalamtes Berlin gestohlen hatte, und sah in das Okular. Von der bogenförmigen Dachkonstruktion des stillgelegten Flughafens Tempelhof aus hatte er eine ausgezeichnete Sicht auf die Containersiedlung. Wie auf dem Frachtterminal eines Überseehafens waren die Wellblecheinheiten zu Tausenden auf dem Tempelhofer Feld gestapelt. Die Massenunterkünfte für Flüchtlinge boten einen trostlosen, hoffnungslosen Anblick. Der Syrer schwenkte die Mündung des Gewehrs über die Reihen der kargen Wohnverliese, bis er die fünfundzwanzigste Reihe des arabischen Viertels erreicht hatte. Er zählte den zehnten Container in der fünften Etage ab, und als er das Fenster im Sucher des Gewehrs hatte, hielt er inne. Ein Mann stand hinter der Scheibe und starrte verängstigt nach draußen, jedoch sah er die Gefahr von woanders kommen. In aller Ruhe richtete der Syrer das Fadenkreuz auf die Stirn seines Opfers aus, legte seinen Zeigefinger auf den Abzug und atmete einmal tief durch. So Gott will, würde dieser Sohn einer Hündin heute sterben. Inschallah, sprach er vor sich hin und schoss.
2.
Tag 2 der Apokalypse.
Berlin, 25. September 2018.
Einwohner: weniger als 300.000 von vormals 3.700.000.
3,4 Millionen Menschen sind auf der Flucht, befallen oder tot.
Fernsehturm am Alexanderplatz, Restaurant auf der Besucherebene.
»Auf die Quarantäne-RepubliX«, sagte Gregor Dyssi und prostete mit dem Sektglas in der Hand Anton Hofstreiter zu, der neben ihm auf einem Barhocker saß.
»Wir gehen in die Geschichte ein, mein Lieber«, bemerkte Hofstreiter und trank den Sekt genüsslich in einem Zug aus. Dann stellte er das Glas auf der Theke ab und tätschelte beinahe zärtlich die Regenbogenflagge auf seinem Schoß, die ihnen bei der feierlichen Ausrufung der Ökologisch-sozialistischen Quarantäne-RepubliX Berlin vor einigen Minuten als würdiger Hintergrund gedient hatte.
»Dass mir die Flüchtlinge noch mal zu einem solchen Comeback verhelfen«, wunderte sich Dyssi kopfschüttelnd. »Eigentlich war ich ja längst Pensionär.«
»Umgezogene«, rief Hofstreiter Dyssi belehrend ins Gedächtnis zurück. »Vergessen Sie nicht: Der Terminus Flüchtlinge ist negativ behaftet und sollte nicht mehr verwendet werden.«
»Natürlich«, stimmte Dyssi milde zu und lächelte unweigerlich, als er daran dachte, welche Zufälle es im Leben gab. Gestern Nachmittag hatten sich Dyssi und Hofstreiter zusammen mit anderen abgehalfterten Politikern, aussortierten Größen der Talkshow-Industrie und Vorzeige-Radikalen zu einer Diskussionsrunde des Offenen Kanals Berlin im Drehrestaurant des Fernsehturms am Alexanderplatz eingefunden und waren in 207 Metern Höhe unfreiwillige Zeugen der Zombie-Apokalypse geworden.
Geistesgegenwärtig hatten sie reagiert und in luftiger Höhe ihre Version einer Republik ausgerufen, die sie zunächst bescheiden auf das Berliner Stadtgebiet begrenzt hielten. Sie waren nicht geflohen wie etwa der Barmann oder die Küchenhilfen. Oder die anderen Besucher des Restaurants, die alle versuchen wollten, sich aus der Stadt abzusetzen. Sie waren standhaft geblieben. Und würden es bleiben, solange es eine Kamera gab, die das übertrug, was sie der Welt mitzuteilen hatten. Eine RepubliX wollte schließlich organisiert sein und schon bald mussten sich die beiden in einer ersten, aufmunternden Ansprache an ihr stark dezimiertes und verängstigtes Volk wenden.
»Sie haben zehn Minuten überzogen«, unterbrach jemand die selige Zweisamkeit der beiden Männer. Es war Jakob Ohrstein, der zu ihnen an die Theke kam. »Jedem war nur eine Umrundung im Drehrestaurant zugesichert worden«, beschwerte er sich bei ihnen. »Start- und Endpunkt sollte die Bar sein. Und was machen sie beide? Sie haben ihre bizarre Republik erst auf Höhe der Toiletten ausgerufen.«
»Etwa neidisch?«, kanzelte Dyssi Ohrstein mit einem selbstzufriedenen Lächeln ab, während er vom Barhocker aufstand.
»Die Arbeit ist gemacht, Ohrstein«, pflichtete Hofstreiter Dyssi bei. »Wir haben nun einen neuen deutschen Staat.«
»Deutsch?« Ohrstein zog die Augenbrauen hoch. »Solch einen Staat kann es gar nicht geben. Ad eins. Es gibt gar keine deutsche Kultur. Dies ist eine Fiktion. Ad zwei. Wenn es eine deutsche Kultur gäbe, wäre sie per se verzichtbar.«
»Ohrstein, Ohrstein. Hören Sie sich mal zu. Sie sind mir vielleicht ein Nieselpriem«, wiegelte Dyssi ab.
»Alter, weißer Mann, deine Zeit ist abgelaufen«, ätzte Ohrstein.
Dyssi spitzte seinen Mund und nippte am Sekt. »Nun, nicht jeder von uns kann sich auf dem Vermögen der Eltern ausruhen. Manch einer muss auch arbeiten«, parierte er den verbalen Angriff und stellte sich auf die Zehenspitzen, wobei er dachte, dass Ohrstein im Fernsehen viel größer wirkte, als er es in Wirklichkeit war.
»Sie fliehen, ihre Bürger, aber dieses Mal brauchen Sie sich nicht mal selbst um einen anti-faschistischen Schutzwall zu kümmern.« Ohrstein verzog die Mundwinkel nach unten. »Die Mauer um Berlin errichten nun andere für Sie. Hauch mit seinen Neo-Kapitalisten.«
»Können Sie jetzt vielleicht aufhören, uns zu belästigen?« Dyssi winkte ab und lehnte sich zu Hofstreiter hinüber.
»Dann lasse ich Sie mal Ihre Wunden lecken«, verabschiedete sich Ohrstein. Mit einem überaus großen Selbstbewusstsein ausgestattet, glaubte er, den Schlagabtausch gewonnen zu haben. Im Gefühl des Sieges verließ er die Theke, setzte sich auf eine der Sitzgruppen des Restaurants, die auf einem drehbaren Podest montiert waren, und sah durch das schräge Fenster auf Berlin hinab. Hinter der Weltzeituhr lagen auf dem Alexanderplatz dichtgedrängt leblose menschliche Körper auf dem Boden, die Schädel aufgeplatzt, die Hirnflüssigkeit durch den letzten Regen in die Gullys gespült. Wenig Details waren aus der Höhe zu erkennen; das Grauen blieb abstrakt, fast wie bei einer Fernsehübertragung. Zudem plagten Ohrstein andere Sorgen. Er zog ein zerfleddertes Manuskript aus der Jackentasche und schüttelte nachdenklich den Kopf. Die traurige Realität hatte ihn eingeholt: Die Apokalypse hatte seine brillante Rede mit dem Titel »Wie Amerika die Welt unterwirft« hinfällig gemacht. Einige Passagen seines Redebeitrags hatte er bereits durchgestrichen, an anderen Stellen in flüchtiger Handschrift Ergänzungen eingefügt und nachgebessert. Doch es reichte bei weitem nicht. Ohrstein zog einen Kugelschreiber aus der Jackentasche, drückte die Mine heraus und strich die Überschrift mit Ausnahme des Wortes »Amerika« durch. »Aaa … merika«, murmelte er vor sich hin. »Amerika … Apo… Apokalypse … Ab… Zombie …« Dann, plötzlich, sah er auf, rief »Heureka!« aus, schnippte mit den Fingern und notierte als neue Überschrift: »Die Apokalypse ist eine einmalige Chance, die Abhängigkeit von Amerika zu überwinden.« Zufrieden lehnte er sich zurück. Der Anfang war gemacht. Nun würden die Worte fließen. Eine ganze Umrundung des Restaurants hatte er Zeit, in der Anne Wollte mit Pierre Mogel vor der Kamera diskutierte. Der Islamist und die ehemalige Talk-Queen, die sich zwei Tische weiter auf ihren Beitrag vorbereiteten, waren noch vor ihm an der Reihe. Dazu kamen noch die fünfzehn Minuten, in denen der Netzreporter mit dem roten Irokesenschnitt sein in Anbetracht der aktuellen Geschehnisse komplett deplatziertes Buch über Neonazi-Propaganda im Cyberspace vorstellte. Fünfundvierzig Minuten insgesamt. Dieser pseudo-politische Irokese, dachte Ohrstein lächelnd. Irokese. Da war sie wieder, die Verbindung zum imperialistischen Amerika.
3.
Auf dem Dach des Roten Rathauses.
Statisches Rauschen … dann ein Klicken …
»Hier spricht der Prepper, die Stimme aus dem Untergrund. Wie geht es euch da draußen, die im Vorhof der Hölle mit mir ausharren? An alle Partygänger, Hedonisten und Langschläfer, die noch nicht mitbekommen haben, was passiert ist: Die Apokalypse ist über uns hereingebrochen: Horden von Zombies haben Berlin überrannt. Ich hoffe inständig, dass ihr euch so auf diesen Tag vorbereitet habt, wie ich es getan habe. Und damit meine ich nicht nur Batterien zu kaufen und ein paar Lebensmittel. Eine richtige Vorbereitung auf das, was sich da draußen derzeit abspielt, bedarf Jahre der Planung. Diese Dinger, die da auf den Straßen rumlaufen, ich weiß noch nicht viel über sie. Es stecken Würmer dahinter, soviel ist sicher, die sich in den Köpfen der Menschen einnisten und sie dann irgendwie umprogrammieren. Sie Dinge tun lassen, die sie nicht wollen. Sie in Zombies verwandeln. Woher der Parasit kommt, das weiß ich nicht. Cui bono? Wem zum Vorteil? Vielleicht ist es eine Verschwörung? Aber welche fremde Macht mag dahinter stecken? Regen scheint den Dingern jedenfalls nicht zu gefallen. Zuckerschnecke44 aus Wedding berichtet, dass seit der letzten Schauer Hunderte von Zombies mit aufgeplatzten Schädeln in der Müllerstraße liegen – wie die Opfer bei einer Krötenwanderung. Offensichtlich suchen die Würmer bei Nässe den Weg nach draußen. Das wird ein Vorteil für uns sein. Und noch was: Die Fantastischen Vier haben mir gesagt, dass es gut ist, wenn man sein Gesicht bedeckt. Denn irgendwie reagiert der Wurm auf die Gesichter. Ein Biss, und es ist aus. Hütet euch vor denen, die Wunden am Hals tragen und noch leblos am Boden liegen. Bald schon werden sie sich aufrichten und nach euch trachten. Denn erbarmungslos ist unser Gegner. Hier noch eine Verkehrsinfo: Hartmut18 aus Potsdam sagt, dass die Bundeswehr alle Straßen aus Berlin heraus blockiert hat. Das heißt wohl, dass wir jetzt ganz auf uns alleine gestellt sind. Mein Rat an alle in Deutschland: meidet Berlin. Und mein Rat an die, die hier ausharren: Haltet die Köpfe unten und versucht zu überleben. Hier spricht der Prepper, die Stimme aus dem Untergrund.«
Ein Klicken … dann statisches Rauschen …
»Schon eine Nachricht vom anderen Hubschrauber?«, fragte Uwe Moll, als er die Tür zur Kanzel des Bell-Hubschraubers öffnete.
»Nein«, antwortete der Pilot und reduzierte die Lautstärke des Funkgeräts.
»Aber wer hat da eben gesprochen?«
»Ein Amateurfunker«, erklärte der Pilot. »Die spielen sich immer ’n bisschen auf.«
»Dann wechseln Sie doch die Frequenz. Wir müssen mitkriegen, wenn die anderen sich melden.«
»Entweder melden sie sich auf dieser Frequenz oder gar nicht.«
»Wo sie wohl hingeflogen sind?«
»Vielleicht wieder zurück nach Babelsberg.«
»Babelsberg? Meinen Sie? Ob da noch jemand ist?«
»Jedenfalls keiner, der auf meine Rufe antwortet.«
Moll nickte und schloss die Tür. Dann sah er den Piloten nachdenklich durch die Scheibe an und öffnete die Tür wieder. »Sie machen aber keinen Unsinn?«
»Unsinn? Was meinen Sie damit?«
»Sie würden nicht ohne uns abfliegen, oder?«
»Ich bin ein Profi. Und Sie haben mich für vier Tage engagiert.«
»Dann halten Sie ihre Verträge ein?«
Der Pilot sah Moll ernst an, antwortete ihm aber nicht.
»Schon gut, schon gut«, gab sich Moll zufrieden. »Es ist ja alles in Ordnung.« Der ergraute Mann mit den wachen Augen, unermüdlicher Regisseur von zweiundfünfzig B-Filmen, ein deutscher Ed Wood, der sein fehlendes Talent durch seine kindliche Begeisterungsfähigkeit kompensierte, schloss nachdenklich die Tür zur Kanzel. Eigentlich hatte sein dreiundfünfzigster Film »Nazi-Alarm auf Vilnius Prime« die Invasion eines diktatorisch regierten Planeten durch echsenhafte Aliens zum Thema haben sollen. Alles war dafür vorbereitet: Die Kulissen in Babelsberg waren während laufender Renovierungsarbeiten billig zu mieten gewesen und der Direktor des Technischen Museums München hatte Moll drei Hubschrauber zur Verfügung gestellt, nachdem dieser dessen Tochter in einem seiner letzten Streifen die Hauptrolle zugestanden hatte. Als Moll am Filmset in Babelsberg jedoch erfuhr, welche unerhörten Vorkommnisse in Berlin vor sich gingen, wollte er seinen Film um eine realistische Komponente erweitern und als Semi-Dokumentation weiterentwickeln. Seinen Darstellern hatte er nicht erzählt, was er vorhatte, um ihre ungefilterten Emotionen einfangen zu können, wenn Sie sich mit ihren Waffen gegen Zombies erwehrten. Doch etwas war schrecklich aus dem Ruder gelaufen. Dutzende Untote drängten augenblicklich zu den drei Hubschraubern, nachdem diese vor dem Roten Rathaus gelandet waren. Zu viele, als dass sie von den wenigen richtigen Kugeln in den Läufen der Gewehre aufgehalten werden konnten, mit denen der Requisiteur hastig die Magazine neben den üblichen Platzpatronen bestückt hatte. Die erste Welle der Angreifer war von den Schauspielern zurückgehalten worden – die Bilder, die der Kameramann schoss, mussten unglaublich realistisch sein. Dramatik pur. Doch dann überrannten die Zombies sie förmlich, überwältigten den Kameramann und den Aufnahmeassistenten und verbissen sich im Hauptdarsteller. Nur noch zwei der drei Maschinen hatten abheben können, und der andere Hubschrauber mit der weiblichen Hauptdarstellerin an Bord war nicht zum vereinbarten Sammelpunkt auf dem Dach des Roten Rathauses geflogen.
Leicht vornübergebeugt, die Arme im Rücken verschränkt, ging Moll zur Brüstung des Rathausdaches vor, an der Daniela Mäuseberger in der Uniform eines SS-Offiziers stand. Das Schiffchen mit dem Totenkopfemblem keck auf die hochtoupierten Haare gesetzt, blickte sie zum zurückgebliebenen Hubschrauber hinunter, der noch vor dem Neptunbrunnen stand. Ein Drittel der Filmcrew war Opfer der Zombie-Attacke geworden. Die meisten der Angreifer waren weitergezogen, nachdem sie Beute gemacht hatten. Nur hier und da standen noch einige Untote herum. Apathisch wirkend, als wüssten sie nichts mit sich anzufangen, schienen sie auf ihr nächstes Blutmahl zu warten.
Mäuseberger griff nach dem Arm des Regisseurs. »Du, ich glaub’, der Klaus, der hat sich eben bewegt.«
»Bewegt?«
»Ja, der hat gezuckt, denk’ ich. Sollen wir mal nachsehen?«
»Willst du etwa da runter?«, fragte Moll ungläubig nach.
»Vielleicht braucht der Klaus ’n Schlückchen Wasser.«
»Was? Die Zombies hatten sich in seinen Hals verbissen. Ist kein gutes Zeichen.«
»Meinst du?«
Moll schüttelte den Kopf. »Wo sind die anderen aus der Maschine?«, wollte er wissen.
»Den Walter hab ich da hinten gesehen. Am Brunnen. Der is’ so komisch gegangen. Als hätte er einen gesoffen, weißt du. Aber nich’ getorkelt jetzt. Irgendwie anders. Hat sich wie verrückt die Stirn gerieben.«
»Mhm. Der ist jetzt ’n Zombie, der Walter.«
»Zombie? Der Walter?« Mäuseberger kicherte. »Glaubst du?«
Moll nickte. »Sammy und Freddy sehe ich von hier aus. Die rühren sich nicht. Liegen einfach so da.«
»Aber der Klaus, der hat eben gezuckt.«
»Verdammt.«
Plötzlich hörten die beiden jemanden hinter sich. »Ausgerechnet jetzt bekomm’ ich die Scheißerei«, jammerte Lutz Weiterstadt, der Produzent des Films von RLT2. Zum vierten Mal innerhalb von kurzer Zeit hatte er hinter einem Ventilationsschacht austreten müssen. Der gepflegte Mann in den Vierzigern mit gegeltem langen Bart, Holzfällerhemd, ausgetretenen Chucks und Hornbrille war kreidebleich.
»Der Klaus hat sich eben bewegt«, teilte Mäuseberger nun auch dem Produzenten mit.
Weiterstedt ignorierte die Neuigkeit und sah auf sein Smartphone. »Habt ihr vielleicht Empfang?«
Moll schüttelte den Kopf. »Du weißt, dass ich kein Handy hab’.«
»Meins muss ich da unten verloren haben«, glaubte Mäuseberger sich zu erinnern und deutete auf den Hubschrauber.
»Zum Teufel«, beklagte sich Weiterstedt, »was die Drehverzögerung wieder kostet.«
»Oh ja«, stimmte Moll zu.
»Na, zumindest haben die Schauspieler ’ne Verzichtserklärung unterschrieben«, freute sich Weiterstedt.
»Da müssen wir noch mal drüber reden«, gab Mäuseberger zu bedenken. »Also, das war ja dann doch ’n bisserl mehr als ’n Dschungelcamp hier.«
Weiterstedt stöhnte und griff sich vor Schmerzen an den Bauch. »Lass uns später drüber reden.«
»Ich hätt’ das niemals machen sollen«, übte Moll Selbstkritik. »Wir hätten in Babelsberg bleiben müssen.«
Weiterstedt legte die Stirn in Falten. »Wenn wir nur an den Hubschrauber da unten könnten …«
»Ich bin schuld am Tod der Jungs …«
»Die Kamera muss noch da sein«, ließ sich Weiterstedt nicht beirren. »Der Sammy muss unglaublich gute Bilder im Kasten haben. Ich meine, der hat seinen eigenen Tod gefilmt. Wann bekommt man so was denn mal hin? Das wird der Knüller.«
»Hoffentlich hat der Sammy nicht so dicht rangezoomt«, überlegte Mäuseberger. »Mein Make-up ist ganz zerlaufen.«
»Was soll’s? Mehr Realismus eben. Die Leute wollen jetzt Pickel und Unreinheiten sehen. Das Leben, wie es ist.« Vor Aufregung musste Weiterstedt furzen und blickte plötzlich ganz verlegen, als wäre unbeabsichtigt etwas in die Hose gerutscht, was nicht dorthin gehörte.
Mäuseberger ignorierte Weiterstedts Fauxpas. »Aber Lutz, ich bin ’ne kesse SS-Biene. Da muss ich schon auf mein Äußeres achten.«
Weiterstedt drehte sich zu Moll um. »Was machen wir jetzt, Uwe? Wer soll der neue Hauptdarsteller werden?«
Moll rieb sich mit den Fingern nachdenklich über das Kinn. »Wir werden alles auf Daniela konzentrieren, denk’ ich. Die Aliens sind hinter ihr her und sie muss sich als starke Frau in einer feindlichen Umgebung behaupten. Wie in diesen Jugend-Dystopien.« Moll zeichnete einen Bogen über den Himmel. »Die SS-Dirne auf dem Planet der Zombies, ist der Titel«, verkündete er mit aufkommendem Optimismus.
»Daniela ist schon über dreißig. Und sie ist keine Hauptdarstellerin«, widersprach der Produzent.
»Hey, das ist aber nicht nett, Lutz«, mischte sich Mäuseberger ein.
Weiterstedt stöhnte. »Daniela, du siehst nicht so gut aus und du kannst nicht schauspielern. Die Leute gehen wegen Beata ins Kino. Wie sie sich in Klaus verliebt. Das wollen die Leute sehen. Eine Prinzessin, die ihren Prinzen kriegt. Beata ist die Hauptdarstellerin. Und die ist jetzt mit dem anderen Hubschrauber was weiß ich wohin geflogen.«
»Und ich? Was bin ich?«
»Du bist das Füllmaterial«, urteilte Weiterstedt unverblümt. »Eine der C- und D-Promis, die unbedingt ins Rampenlicht wollen. Die kein Talent …«
»Jetzt reicht’s aber, Lutz«, schritt Moll ein.
»Ich … ich«, schluchzte Mäuseberger mit Tränen in den Augen, »ich bin kein Viehzeug.«
»Doch, es ist wahr«, fuhr Weiterstedt ungerührt fort und zog missmutig seine Hose zurecht. »Du nervst die Leute. Die wollen sehen, wie du dich hier lächerlich machst. Wie du scheiterst. Die Frauen lieben dich, weil du so unzulänglich bist. Aber tröste dich: es gibt auch für eine Bauernfrau Abnehmer. Viele Männer lieben ja deine burschikose Art. Oder eben das, was du vorzuweisen hast … na ja …« Weiterstedt deutete auf ihre üppigen, Silikon-gestählten Brüste. »Du weißt ja selber, wie wir Männer ticken.«
»Ich hab’ doch studiert«, erklärte Mäuseberger mit verheulten Augen.
»Was heißt studiert? Du warst ein Jahr an der Berlin Business School for Gender Studies.«
»Ja und? Das zählt auch.« Mäuseberger zog ein Taschentuch aus ihrer Uniformtasche und schnäuzte sich.
»Wir wissen beide, dass man da nur Geld zahlen muss und dann den Abschluss bekommt«, ordnete Moll ihre Leistungen ein.
»Nein, es war hart. Acht Stunden am Tag.«
»Fingernägel lackieren und Make-up auflegen mitgezählt?«
»Ein perfekter Style ist nun mal der Schlüssel zum Erfolg, hat unser Dozent immer gesagt.«
»Da hat er auch recht. Du bist ja auch erfolgreich. Aber du bist nun mal keine Hauptdarstellerin. Du bist das Dummchen, das ab und zu im Bikini auftaucht und dann in der Mitte des Films gefressen wird oder was weiß ich wie umkommt.«
»Uwe?«, forderte Mäuseberger die Unterstützung des Regisseurs ein und zog sich den Schnodder durch die Nase hoch.
Moll aber antwortete ihr nicht. Abgelenkt starrte er auf ein Auto, das auf der Straße vor dem Roten Rathaus in Schlangenlinien versuchte, die auf dem Boden liegenden Untoten zu umfahren.
»Uwe?«, wiederholte Mäuseberger und drückte sich Halt suchend an die Schulter des Regisseurs.
»Ja?«, fragte dieser abwesend, den Blick gebannt auf den Geländewagen mit den getönten Scheiben gerichtet, der sich in den Zombies festfuhr.
»Also ich, ich hätt’ jetzt gern ’n Leberwurschtbrot«, wünschte sich Mäuseberger ihr Lieblingsessen herbei.
»Kriegst du…«, versprach Moll, während er auf den Geländewagen starrte, der mittlerweile stehengeblieben war. Ein Mann mit einer dunklen Jacke und einem grünen Halstuch öffnete die Fahrertür und stellte sich auf das Trittbrett. Angezogen von den Geräuschen des Motors, torkelten die verstreut auf dem Platz stehenden Zombies auf den Wagen zu, ohne den dunkelhäutigen Mann jedoch anzugreifen.
»Zum Teufel! Der Neger ist ja wie Luft für die«, kommentierte Weiterstedt verwundert.
»Vielleicht is’ der durch die dunkle Haut getarnt?«, vermutete Mäuseberger.
»Getarnt? So ein Unsinn«, widersprach Moll.
Jetzt öffnete sich auch die Beifahrertür des Geländewagens. Eine Frau stieg aus, die einen Motorradhelm mit gespiegeltem Schutzvisier trug. »Wir müssen hier raus!«, schrie sie.
Nun öffneten sich auch die beiden Hintertüren. Ein schmächtiger Mann mit Motorradhelm und ein hochgewachsener Mann im Blaumann, der sich eine Plastiktüte über den Kopf gezogen hatte, stiegen aus. Der stämmige Mann packte den Schwarzen von hinten an die Schulter. »Lass uns abhauen, Frank!*«, rief er.
*{Wenn Sie denken, dass Frank ein Weißer sein muss: Sein Aussehen wurde in der ersten Episode mit keiner Silbe beschrieben.}
4.
Stillgelegter Flughafen Tempelhof. Auf dem Dach der ehemaligen Abfertigungshalle.
Der Syrer nahm das Messer und ritzte eine Kerbe in den hölzernen Schaft seiner Dragunow. Die letzte Rechnung war beglichen. Vierunddreißig Kerben zierten das dunkle Holz. Eine Kerbe für jeden Toten. Neun Menschen hatte er innerhalb eines Tages mit dem erbeuteten Gewehr töten können, die anderen in den Monaten zuvor noch mühsam mit dem Messer meucheln müssen. Er strich mit dem Finger über die Narbe, die sich vom Kinn bis zu seinem Jochbein zog, und rückte die Augenklappe zurecht. Einer der Granatsplitter, die sein linkes Ohr, die Wange und die halbe Nase abgerissen hatte, steckte noch immer im rechten Auge. Sein Gesicht war dermaßen entstellt, dass sich die meisten Menschen abwandten, wenn sie ihm begegneten, und er Prostituierte aufsuchen musste, wenn er eine Frau spüren wollte. Nur die Kinder, die drehten sich nicht weg. Die betrachteten neugierig seine Male aus dem Bürgerkrieg. Dem Syrer war das alles gleichgültig, denn Schönheit war für ihn irrelevant geworden. Sohn einer sunnitischen Syrerin und eines schiitischen Iraners war er der Vollstrecker, der in Almania, dem Land der Ungläubigen, die Soldaten des Kalifen richtete, um seine Familie zu rächen.
Der Syrer stand auf, legte den Lauf des Gewehrs auf seine Schulter und blickte auf die weitläufige Containersiedlung, die sich von den überdachten alten Flugsteigen über das ehemalige Flugfeld erstreckte. Wie ausgestorben wirkte der zentrale Platz vor den Hangars, auf dem sich der Supermarkt und die Schule befanden. So leergefegt, wie er viele Dörfer aus dem Bürgerkrieg in Erinnerung hatte. Gestern Morgen noch war alles anders gewesen. Da tobten in diesem Moloch eines Lagers die üblichen, über Monate ritualisierten Kämpfe: Syrer gegen Afghanen, Iraner gegen Iraker und alle gegen die Somalier und Eritreer, die in der Hackordnung ganz unten standen. Der Syrer aber interessierte sich nur für die Soldaten des Kalifen. Viele von den Mördern des Islamischen Staates, der sich in den sunnitischen Gebieten des arabischen Raums wie ein Krake festgesaugt hatte, wollten sich hier im Ausland eine neue Existenz aufbauen, ihre Gräueltaten und die ihrer Brüder vergessen. Sie wollten ihr altes Leben mit dem Staub der Wüste hinter sich lassen. Doch sie alle hatten die Rechnung ohne ihn gemacht. Für den Syrer gab es kein Vergessen und kein Vergeben. Einen nach dem anderen hatte er umgebracht und verschwinden lassen. Die deutschen Wachleute des Flüchtlingslagers stellten keine Fragen. Es hieß, die Vermissten wären untergetaucht oder weitergezogen nach Schweden oder England. Die Menschen kamen und gingen. Und die Deutschen zogen es vor, dass sie gingen. Niemand stellte Fragen, wenn die Wiese im Süden am nächsten Morgen ein neuer Erdhügel zierte. Alte Rechnungen zu begleichen – darum ging es. Einmal hatte ihn eine Frau gesehen, als er zum Container eines ahnungslosen Opfers schlich. Sie hatte ihn aber nicht verraten, sei es aus Angst oder in stiller Übereinkunft, dass es nicht ein Mensch war, der des Nachts gekommen war, um zu morden, sondern ein Schatten der Gerechtigkeit die Islamisten richtete. Alle hielten still, auch wenn der eine oder andere ahnte, wer die Gruben des Nachts aushob. Ein Schweigen in der Hoffnung, dass mit den IS-Kämpfern auch der Bürgerkrieg endgültig in diesem kalten und dunklen Land begraben wurde.
Der Syrer ließ seine Blicke bis zur Moschee am Columbiadamm schweifen. Er verstand nicht, was gestern Morgen passiert war. Nur, dass es die Türken waren, die das Lager angegriffen hatten, wusste er mit Bestimmtheit. Enthemmt hatten sie die Zäune niedergerissen, die Gesichter hassverzerrt, die Stirnen mit grünen und schwarzen Bändern bedeckt. Sie hatten keinen Unterschied gemacht. Noch radikaler als alles, was er bisher gesehen hatte, griffen sie auch die IS-Kämpfer unter den Flüchtlingen an, die eilig ihre schwarzen Flaggen entrollten. Sie waren noch unerbittlicher als die Splittergruppen der Islamischen Befreiungsfront und die Anhänger des Wahren Islamischen Staates, die sich letzten Monat im Supermarkt gegründet hatten. Wie rasende Derwische waren die Angreifer über die Flüchtlinge hergefallen, verbissen sich wie Tiere in ihre Opfer. Die Horden hatten die Siedlung verwüstet und die, die ihnen in die Hände fielen, weil sie sich nicht rechtzeitig in ihren Containern verbarrikadieren konnten, liefen nach einiger Zeit der Starre genauso wutentbrannt umher wie sie. Innerhalb kürzester Zeit hatten die Türken es verstanden, ihre Opfer zu konvertieren, ohne mit ihnen reden zu müssen. Die Überzeugungskraft roher Gewalt, vermutete der Syrer. Eine alte Taktik des IS. Ihn selbst hatten sie ignoriert, als er vor der Teestube saß. An ihm waren die Angreifer vorbeigelaufen, als wäre er Luft für sie. Allah hatte alle bestraft und ihn übrig gelassen. Allah hatte ihn verschont, damit er seine Arbeit vollenden konnte: diejenigen Islamisten zu richten, die in die Container geflohen waren. So war der Syrer in das Landeskriminalamt gegangen und hatte sich, umringt von den Wütenden, ein Gewehr und Munition besorgt. Derweil flohen die deutschen Ungläubigen, gejagt von den entfesselten Horden, mit ihren Autos Richtung Süden.
Dank seines neuen Gewehrs war die Arbeit nun schneller vollbracht, als er es für möglich gehalten hatte. Der Syrer drehte sich um und betrachtete die Silhouette der Stadt. Das Lager hatte er in zwei Jahren nur einmal verlassen, um in der Moschee am Columbiadamm zu beten. Jetzt schien ihm die Zeit gekommen zu sein, Berlin näher kennenzulernen. Der schlanke Fernsehturm, der ihn an ein Minarett erinnerte, war sicherlich einen Besuch wert, glaubte er.
5.
Fernsehturm am Alexanderplatz, im Drehrestaurant.
»Salem aleikum. Inschallah. Aleikum essalem. Dann immer wieder Allahu akbar, damit die anderen einstimmen können. Mehr war es nicht«, gab Pierre Mogel Auskunft und lehnte sich zurück.
»Und so einfach haben Sie ihre islamistischen Anhänger gewonnen?«, hakte Anne Wollte mit gespieltem Interesse nach.
»Das schweißt zusammen«, fuhr Mogel fort. »Und das kann jeder. Dann braucht man noch ein paar psychologische Tricks, um die Kiddies anzusprechen. Und die hab’ ich mir aus dem Leitfaden zur ‚Ertüchtigung von Hitlerjungen‘ genommen, den mein Opa auf dem Dachboden gelagert hat.«
»Hitlerjungen?«, wiederholte Wollte plötzlich hellwach. »Sie meinen, es gibt da eine Verbindung zu den Nazis?«
Mogel lachte. »Na ja, nicht direkt. Vielleicht, wie man junge Menschen anspricht. Und dass der Führer den Islam wegen seiner Werte ganz gut fand. Gewalt und so. Aber nichts Zentrales jetzt …«
»Nein, nein«, widersprach Wollte. »Das ist etwas ganz Essentielles. Sie haben ja keine Ahnung, wie Talkshows funktionieren. Ich kann da nicht einfach rausgehen und in meiner Sendung behaupten, dass der Islam Schuld daran ist, dass Menschen gewalttätig werden. Man muss das schon relativieren. Und eine Verbindung zum Nationalsozialismus lässt die Dinge in einem ganz anderen Licht dastehen. Dann hätten die Deutschen nach dem Verursacherprinzip eigentlich wieder selbst Schuld. Wie sie es mögen.«
Mogel runzelte die Stirn. »Ich werde mich hier nicht insti…tutionieren lassen. Der Islam ist absolut. Er braucht keine Rechtfertigung und hat keine Vorbilder. Er ist unteilbar und absolut. Er war am Anfang hier und wird bis zum Ende der Welt die Wahrheit sein. Er wird niemals ein Teil Deutschlands sein. Deutschland wird ein Teil des Islams sein. Inschallah.«
»Nur ruhig Blut«, beschwichtigte Wollte. »Es ist ja alles in vollem Gange: der Tempel von Palmyra ist ja schon weg, bei den Buddhastatuen existieren nur noch die Zehen und Moscheen soll es ja schon bei der Entdeckung Amerikas gegeben haben«, fügte Wollte scharfzüngig hinzu.
»Was?«, fragte Mogel, der ihren Sarkasmus nicht deuten konnte, überrascht nach.
»Kleiner Scherz!« Wollte winkte ab und stieß stakkatohaft mehrere Lacher aus. »Der Islam ist wahrhaftig ein Geschenk – für das Entertainment. Damit kann ich 25% der Talkshows im nächsten Jahr füllen. Und jetzt die exklusive Übertragung aus dem Berliner Kriegsgebiet mit einem gefährlichen islamistischen Psycho… äh … einem berühmten Moslem. Vielleicht bekomme ich wieder die Primetime. Und in sechs Monaten dann wieder ‚Euro-Verfall‘, ‚Finanzkrise‘, ‚Rente‘ und ‚Sexismus‘. Da muss ich mich nicht mal einarbeiten.« Wollte lachte erneut, diesmal aber langanhaltend.
Mogel beobachtete die Journalistin argwöhnisch. »Sie können machen, was Sie wollen, aber ich will wieder zurück in die Öffentlichkeit«, sagte er, nahm eine Dose aus seiner Hosentasche, öffnete sie, schüttete kleine, runde Pillen auf seine Handfläche und warf sich diese in den Mund. »Schüßler-Salze«, erklärte Mogel nach dem Runterschlucken, als ihm der fragende Gesichtsausdruck von Wollte auffiel. »Homöopathie und Islam. Die einzigen beiden Dinge auf der Welt mit Substanz.«
Wollte zog die Augenbrauen hoch und nickte. Im Kampf gegen ein Auflachen presste sie die Lippen zusammen. »Wie sind Sie überhaupt in die Szene gekommen?«, versuchte sie sich selbst gedanklich von der Einfältigkeit der Argumente ihres Gegenübers abzulenken. »Ich meine, wie wird ein junger Mann überhaupt ein islamistischer Führer?«
»Wenn ich ehrlich bin, ging es zuerst um Mädchen.«
»Mädchen?«
»Ich bin auch nur ein Mann. Und ich bin ja nicht gerade ein Adonis. Das ist mir schon klar. Ich seh’ ja nun mal nicht aus wie George Clooney. Zum Guru hat es auch nicht gereicht.«
»Wegen dieses Sprachfehlers?«, warf Wollte ein.
»Ja … das Lispeln hat mir früher schon arg zugesetzt in der Schule. Da hatte ich noch kein Selbstvertrauen.«
»Was haben Sie eigentlich nach der Schule gemacht?«
»Ich war ein richtiger Tunichtgut. Hab’ einfach so in den Tag hineingelebt. Wissen Sie, dass ich jahrelang wie ein Barde Gedichte vorgetragen hab’? Doch die wollte niemand hören.«
»Gedichte? Das ist ja mal eine ganz andere Seite«, überlegte Wollte. »Ich weiß nur noch nicht, ob wir das in die Talkshow einarbeiten können. Passt irgendwie nicht.«
»Wollen Sie ein Gedicht hören aus meiner Zeit in Amsterdam? Als ich mich in den Coffee-Shops rumgetrieben hab’?«
»Wenn es nicht zu lange dauert …«
»Nein, nein, es geht ganz schnell.« Mogel räusperte sich. »Jetzt bin ich ja ’n bisschen aufgeregt«, gab er zu. »Hab’ ich schon lange nicht mehr gemacht.«
»Nur zu …«, forderte Wollte ihn auf.
Mogel faltete die Hände, legte sie auf den Tisch und sah beinahe schüchtern nach unten. »Überall, ohne Licht, aus allen Richtungen kommen sie«, fing er an, atmete einmal tief durch und fuhr fort:
»Geräuschlos aus der Dunkelheit, unheimlich stoßen sie aus den Seitengassen kreuz und quer.
Autos, durch Grachten an den Rand gedrängt, der Fußgänger, ey Mann, an die Wand gedrückt.
Meine Kinder, ich muss euch sagen: Das ist die Fahrraddiktatur.« Mogel blickte auf und sah Wollte auffordernd an. »Und? Wie finden Sie’s?«, fragte er unsicher.
»Nun ja … gar nicht schlecht.«
»Das hat aber niemand hören wollen. Selbst die Jungs aus dem Coffee-Shop nicht.«
»Vielleicht hätten Sie es rappen sollen?«, schlug Wollte vor.
»Rappen? Meinen Sie?«
»Rapper haben viele Groupies.«
»Ja, das stimmt«, sagte Mogel nachdenklich. »Aber so ein Rapper, der braucht Credibility. Der muss sich in den Straßen rumtreiben, Leute abziehen und andere umklatschen. Das ist nicht so mein Ding.«
»Aber ein Islamist muss Köpfe abschneiden.«
»Nein, nein, nicht unbedingt«, widersprach Mogel. »Die Fußsoldaten vielleicht, aber die spirituellen Führer nicht.«
Wollte seufzte. »Irgendwie ist diese ganze Sache noch nicht rund. Sie sagen also, Pierre, dass Sie wegen Mädchen zum Prediger wurden?«
»Ja, es ist verrückt, aber immer, wenn ich über den Islam geredet hab’, dann haben die Frauen geradezu an meinen Lippen geklebt. Einige zumindest. Aber 150% mehr als vorher.«
»Verschleierte Frauen …«, hakte Wollte nach.
»Ja, natürlich … man kann es sich nicht aussuchen, aber ein paar Hübsche waren bestimmt dabei … glaub’ ich.«
»Nein, nein, das passt nicht«, widersprach Wollte energisch. »Ein dichtender Möchtegern-Frauenheld. Das können wir so den Leuten nicht verkaufen. Da muss mehr Pep dahinter. Die Geschichte mit den Hitlerjungen war ja schon ganz gut. Dazu irgendeine Story von Ausgrenzung und Diskriminierung.«
»Die Araber haben mich nie ernst genommen, die Türken erst recht nicht. Da haben sich viele schlappgelacht, wenn ich über Allah geredet hab’.«
»Doch nicht so, mein Lieber. Die Deutschen diskriminieren. Wir müssen dem Zeitgeist entsprechen. Haben Sie vielleicht ausländische Wurzeln?«
»Nein …«
»Keine türkische Großmutter? Keine arabische Connection?«
»Ich hab mal ’nen belgischen Schäferhund gehabt. Den hab ich in Brüssel von ’nem Algerier gekauft.«
»Mhm, das reicht aber nicht. Pierre, da müssen wir noch mal ran, damit wir Sie medial besser an die Leute bringen können.«
»Ich verstehe das nicht. Die deutschen Medien haben mich früher doch geliebt, weil ich ein Konvertit bin. Da konnten sie zeigen, dass der Islamismus nichts mit Ausländern zu tun hat.«
»Aber Sie sind medial längst ausgeschlachtet. Da muss eine neue Facette her. Gut, dass wir das abstimmen können, aber dafür ist so ein Vorgespräch ja da.«
»Ich versteh’ nicht ganz, wie das laufen soll.«
»Sie sind der Bad Guy. Ein Stimmungsmacher mit zweifelhaftem Charakter und düsterer Vergangenheit. Da muss ich noch überlegen, was explizit angesprochen wird. Dann lade ich noch als Gegenpol Hering-Zweckhart ein. Die wird dann Sachen sagen wie: ‚Statt auf eine deutsche Leitkultur zu pochen, sollte lieber das Gemeinsame betont werden.‘ Und alle sind zufrieden. Der Stammtisch wird kochen und die PCler werden Zweckhart noch übertrumpfen wollen.«
»Was meinen Sie damit«, fragte Mogel nach. »Das Gemeinsame?«
»Wie?«
»Sie sagten, dass das Gemeinsame betont werden soll.«
»Das war ja nur ein Beispiel, was Zweckhart sagen könnte. Nur dass Sie darauf vorbereitet sind. Sie müssen nicht darauf eingehen, das tun die anderen auch nicht. Jeder spult nur sein Programm ab. Sie können ja davorschieben: ‚Aber Frau Zweckhart …‘. Dann sagen Sie das, was Sie vorbereitet haben.«
»Aber was ist das Gemeinsame von Islam und Deutschland?«, grübelte Mogel. »Der Hass auf Juden?«
Wollte hob den Zeigefinger. »Vorsicht, mein lieber Mogel, Vorsicht. Niemals, Pierre, niemals behaupten Sie wieder so etwas. Niemals erwähnen Sie ‚Juden‘. Da hört bei mir der Spaß echt auf. Mit Juden mache ich immer ’ne Sondersendung. Aber nur einmal im Jahr. Für den Toleranzpreis und die Reputation. Die Einschaltquoten sinken dann aber immer ins Bodenlose.«
Mogel kniff die Augenlider zusammen und rieb sich mit der Hand über das Gesicht. Er hörte Wollte angestrengt zu, doch er hatte Probleme, ihr nun gedanklich zu folgen. Seine Aufmerksamkeitsspanne, die nur einige Minuten lang war, schien sich erschöpft zu haben, und sein Verstand verlor die Orientierung. Bei seinen Predigten rief er in solchen Fällen immer ‚Allahu akbar‘, um sich sortieren zu können. Deshalb mochte er den Islam auch so: Die Dinge waren so einfach.
»Haben Sie verstanden?« Wollte beugte sich zu Mogel hinüber, der vor sich hinstarrte.
»Was?«
»Haben Sie verstanden, wie es läuft?«
Mogel sah Wollte zunächst fragend an. Dann verfinsterte sich seine Miene. »Der Islam ist immer radikal«, versuchte er seine fehlende Konzentration durch Phrasen zu verbergen. »Das ist seine Natur. Er ist unteilbar und absolut. Wir werden die Ungläubigen aus unseren Ländern vertreiben und auf ihren Leichen tanzen.«
»Klasse! Sie werden langsam warm«, freute sich Wollte. »Für den Offenen Kanal machen wir jetzt den Standard-Talk und für die Sendungen zur Prime Time überleg’ ich mir noch was.« Sie winkte den Aufnahmeleiter herbei. »Wie lange dauert’s noch?«, erkundigte sie sich bei ihm.
»Du bist gleich dran, Anne«, sagte der Aufnahmeleiter.
»Super, Benjamin.« Wollte tätschelte den Arm des jungen Mannes.
»Aber dann ist Schluss. Ich mach’ das nur dir zuliebe, weil ich so ein großer Fan bin.«
»Och, Benni, du bist so lieb.«
»Du kriegst dann noch ’nen Sonderpreis des Offenen Kanals für investigativen Journalismus. Danach brechen wir aber auf. Irgendwie müssen wir noch aus Berlin raus.«
»Na, hoffentlich ist der nicht zu schwer«, gab sich Wollte nachdenklich.
»Was meinst du?«, fragte der Aufnahmeleiter sie.
»Na, der Preis«, sagte Wollte mit einem spitzen Lächeln. Stakkatohaft stieß sie mehrere Lacher aus. »Schließlich muss ich mit dem dann durch halb Berlin fliehen«, erklärte sie verschmitzt.
6.
Auf dem Dach des Roten Rathauses.
Statisches Rauschen … dann ein Klicken …
Hier ist der Prepper, die Stimme aus dem Untergrund. Wie geht es euch da draußen im Vorhof der Hölle? Martin aus Kreuzberg behauptet, dass sie ganz gut zurechtkommen. Sie bleiben auf den Dächern, haben Solarenergie, pflegen ihre Gemüsegärten und machen Yoga gegen die Todesangst. Und wenn sie mal auf die Straße müssen, hat er sich und seine ganze Kommune mit Burkas eingedeckt. Ein Dank an den afghanischen Schneider von nebenan. Satter Geier 56 warnt davor, die Zombies mit Wasser zu bekämpfen. Das funktioniert nicht wie beim Regen. Wahrscheinlich gehört der tiefe Luftdruck dazu, dass die Würmer rauskommen. Ach ja … wollt ihr wissen, wie Killerbiene diese Dinge nennt? Wurmbies. Was meint ihr dazu? Theoderich aus Zehlendorf fragt, ob die Leinenpflicht für Hunde weiterhin bestehen würde. Vielleicht sollte er den Spaziergang auf die nächsten Tage verschieben. Bei sonnigem Wetter und angenehmen 24°C ist heute vermehrt mit Zombie-Aktivitäten zu rechnen. Zum Schluss noch ein lieber Gruß an meine kleine Schwester. Hier spricht der Prepper, die Stimme aus dem Untergrund. Zieht den Kopf ein und haltet die Ohren steif.
Ein Klicken … dann statisches Rauschen …
Nur einen Spalt weit öffnete Weiterstedt die Tür zum Dach, blockierte sie mit dem Fuß und lugte ins Treppenhaus. Als er sah, dass es ein Mensch und kein Zombie war, der die Treppe hochlief, trat er beiseite. »Ist euch jemand gefolgt?«, vergewisserte er sich.
»Nein, die sind nicht so schnell wie wir«, beruhigte ihn der Schwarze, der das Dach betrat. Dem athletischen Mann folgten eine Frau mit Rastalocken, ein schmächtiger Türke und ein massiger, hochgeschossener Mann mit einem einfältigen Gesichtsausdruck.
Weiterstedt schloss die Tür, blockierte sie mit mehreren Backsteinen und klemmte einen Stuhl unter die Klinke.
»Wer seid ihr?«, wollte Moll wissen.
»Kinder der Apokalypse«, gab die Frau lächelnd Auskunft.
»Ganz schön keck bist du.« Weiterstedt nickte anerkennend. »Das gefällt mir.«
»Ich bin Uwe«, sagte Moll, »das da ist mein Produzent Lutz und hier drüben, das ist Daniela.«
»Ich kenne dich«, sagte der grobschlächtige Mann zu Moll. »Du machst immer so Sachen mit Nazis. Ähm … Nazis aufm Teller, das war so ’n Film von dir.«
»Ich fühle mich geschmeichelt«, erwiderte Moll. »Der Film heißt aber: Nazis auf Tellar Prime.«
»Der Große hier ist Kai«, stellte der Schwarze seinen Freund vor, »ich bin Frank, die blonde Schönheit da ist Sophia und der Kleine ist Can.«
»Hallo, ich bin Kai.«
»Der haut immer so Sprüche raus«, erklärte Frank. »Daran müsst ihr euch gewöhnen.«
»Was macht ihr hier?«, fragte Sophia, die von Weiterstedt begafft wurde.
»Was schon«, nahm Frank die Antwort vorweg, »unser hochgeschätzter Filmemacher dreht bestimmt seinen neunundneunzigsten Film: Nazis auf Tellar Fourty.«
»Der dreiundfünfzigste Film ist es«, korrigierte Moll, ohne dass er beleidigt zu sein schien. »Und der wird alle anderen um Längen schlagen«, war er sich sicher.
»Na, die Typen da unten im Hubschrauber haben zumindest vollen Einsatz gezeigt«, lästerte Frank. »Da kann man sich als Regisseur ja nicht beklagen.«
»So ein Unglück«, jammerte Moll. »Und all das ist meine Schuld«, gab er zu.
Weiterstedt musterte Frank. »Warum haben die Zombies ihn nicht angegriffen? Liegt es daran, weil er ein … na ja ein …« Weiterstedt stockte.
»Weil er ’n süßer Schoko-Boy ist?«, fragte Mäuseberger frei heraus.
»Schoko-Boy?«, wunderte sich Frank.
»Na, wie sagt man da? So einer aus Afrika«, versuchte Mäuseberger eine Beschreibung zu finden. »Na, hilf mir doch mal, Uwe. ’N Afro-Amerikaner oder wie heißt das?«
»Ich bevorzuge den Begriff Mulatte«, berichtigte Frank sie trocken.
»Wir sind alle Deutsche«, mischte sich Sophia nun ein.
»Also ich bin ’n halber Franzose mit kanadischen Wurzeln«, stellte Weiterstedt klar.
»Okay, natürlich«, sagte Sophia, »aber ich meine eben, dass die Hautfarbe, die Religion oder die Herkunft keine Rolle spielen.«
»Schon klar«, stimmte Moll zu, »aber weshalb greifen die Dinger ihn nicht an?«
»Was heißt hier nicht angreifen? Eigentlich wurde ich das Opfer dieser Hysteriker«, stellte Frank klar. Er schob das Halstuch nach unten und deutete auf die Kompressen, die seine Wunde bedeckten. »Die haben bei mir das volle Programm durchgezogen. Die haben mich sogar gebissen.«
»Du bist gebissen worden?«, fragte Weiterstedt fassungslos nach. »Warum hast du dich nicht … nicht verwandelt?«
»Bist du immun oder so was?«, kam es Moll in den Sinn.
»Wir denken«, sagte Sophia, »dass es damit zusammenhängt, dass er ’nen Gendefekt hat. Er hat Anti-Thrombin-Mangel, also dickes Blut, und das mag der Parasit offenbar nicht. Die Larven können dann vermutlich nicht über die Blutbahn in den Kopf gelangen.«
»Dickes Blut«, wiederholte Moll nachdenklich.
»Wir wissen nicht genau, ob es daran liegt«, gab Frank zu bedenken. »Es könnte auch einen anderen Grund geben.«
»Und die Motorradhelme? Warum tragen die anderen die Helme?«, hakte Moll nach.
»Das ist leicht zu beantworten«, meldete sich nun Can. »Die Zombies sind auf die Gesichter fixiert. Die Gesichter ziehen sie an und machen sie verrückt. Die Augen reizen sie …«
»Aber wenn die Zombies nichts sehen«, wandte Kai ein, »wie da im Tunnel der U5, dann können die auch schnüffeln.« Er zog die Luft durch die Nase und ahmte die Geräusche der Zombie-Horde nach.
»Das stimmt auch wieder«, gab Can zu. »Eigentlich wissen wir nicht viel über sie.«
»Das ist aber schon ’ne ganze Menge«, sagte Moll anerkennend. »Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie wir uns schützen können.«
»Die Maschine da …« Frank deutete auf den Hubschrauber, der auf dem Dach des Seitenflügels stand. »Gehört die Ihnen?«
Moll nickte. »Ich habe sie für ein paar Tage gemietet.«
»Mit dem Wagen kommt man nicht voran«, überlegte Frank. »Zu viele tote … äh … ausgeschaltete Zombies. Aber mit dem Hubschrauber … da könnten wir leicht fliehen.«
»Nun mal eins nach dem anderen«, widersprach Moll. »Zuerst muss der Film im Kasten sein, dann können wir alle hier raus.«
Can hob die Augenbrauen. »Sie wollen jetzt echt hier ’nen Film drehen? Ich fass es nicht. Heißt das etwa, dass Sie freiwillig nach Berlin geflogen sind, obwohl Sie von der Apokalypse wussten?«
»Was heißt hier obwohl?«, wunderte sich Moll. »Das ist überhaupt der Grund gewesen, warum wir uns in Babelsberg aufgemacht haben. Das ist eine ganz neue Dimension des Filmens. Eine Stufe der Immersion, die man sonst nie erreichen kann.«
»Immersion?«, fragte Can nach.
»Das komplette Eintauchen des Zuschauers in den Film«, schwärmte Moll. »Wenn sich Realität und Fiktion miteinander vermischen.«
»Und nachdem uns die Hauptdarstellerin abhandengekommen ist«, urteilte Weiterstedt, »haben wir jetzt sogar ’ne neue Blondine.« Er griff nach Sophias Arm. Die wehrte ihn jedoch wütend ab. »Ich bin kein Stück Fleisch, wenn’s recht ist«, sagte sie verärgert.
»Sie kann für Beata einspringen«, ignorierte Weiterstedt Sophias Einwand. »Sie ist athletisch. Wie eine Amazone …«
»Amazone«, wiederholte Moll, plötzlich hellwach, mit aufgerissenen Augen.
»Das ist der Kick, den der Film gebraucht hat«, sagte Weiterstedt lächelnd und sah Moll auffordernd an. »Was meinst du?«
Moll nickte. »Ich sehe es schon vor meinem geistigen Auge.« Er malte einen Halbkreis in die Luft und verkündete dabei den Titel: »Amazonen versus Nazis auf Vilnius Prime. Der Kampf unerschrockener Kriegerinnen gegen skrupellose Nazi-Schergen.«
»Weiter … «, forderte Weiterstedt aufgeregt. »Lass deiner Fantasie nun freien Lauf.«
»Und mitten im Gemetzel … mitten in der erbarmungslosen Schlacht apokalyptischen Ausmaßes verliebt sich die Anführerin der Amazonen in die oberste Nazi-Braut.« Moll zeigte mit dem Finger auf Mäuseberger. »Deine Rolle, Daniela.«
»Eine lesbische Beziehung im Spannungsfeld interkultureller Konflikte«, überlegte Weiterstedt. »Das lässt sich immer gut verkaufen«, stimmte er dann zu.
»Zum Schluss, also als überraschende Wendung, wird die Nazi-Geliebte nach der Hochzeit dann von dem echsenhaften Alien gefressen …« Moll drehte sich zu Weiterstedt um. »Wo ist eigentlich der Stuntman? Wo ist der Dieter hin?«
»Keine Ahnung«, gab sich Weiterstedt ahnungslos.
»Der Dieter war bei mir mit im Hubschrauber«, wusste Mäuseberger zu berichten. »Der ist rausgefallen, als wir gelandet sind und dann davon gewatschelt.«
»Dann haben ihn die Zombies erwischt«, vermutete Moll.
»Nein, das glaub’ ich nicht.« Mäuseberger überlegte. »Die Zombies haben ihn gar nicht angegriffen. Der Dieter ist einfach so weiter zum Brunnen gedackelt.«
»Das Kostüm«, vermutete Frank. »Hat er das Echsenkostüm noch angehabt?
»Ja, muss er, denn da kommt er ohne Hilfe gar nicht raus«, sagte Moll.
»Bedeckt es den Kopf?«
»Natürlich.«
»Dann ist er geschützt. Die Zombies tun einem nichts, wenn man sein Gesicht nur irgendwie bedeckt hält.«
»Stimmt. Das habt ihr gesagt.«
»Also geht natürlich auch ’n Echsenkopf.«
»Das heißt, dass wir jetzt ’nen Typen in ’nem Echsenkostüm haben, der hier frei rumläuft?«, fragte Can erheitert.
»Weit kann er ja nicht gekommen sein«, mutmaßte Weiterstedt.
»Aber ihr Skript stimmt trotzdem nicht«, warf Frank ein.
»Was meinst du?«, wollte Moll wissen.
»Na, die Dinger da unten sind weder Nazis noch Echsen. Diese Zombies da unten, das sind Islamisten.«
»Islamisten?«, wunderte sich Moll.
»Diese Salafisten-Pisser haben uns am Mehringdamm angegriffen.«
»Salafisten? Wie kommst du darauf?« Moll musterte die Zombies, die am Neptunbrunnen standen. »Da haben einige Baseballkappen auf.«
»Das sind die Konvertiten, verdammt«, regte sich Frank auf. »Die wandeln eben alle um. Die, die uns gestern angegriffen haben, als alles losging, die hatten grüne Stirnbänder an und haben lange Islamistenbärte getragen.«
»Ihr habt mitbekommen, wie alles angefangen hat?«, wunderte sich Weiterstedt.
»Das stimmt«, sagte Can mit dem Stolz eines Kämpfers, der ein hartes Gefecht überlebt hatte.
»Und wir werden jetzt Zeugnis ablegen«, fügte Frank feierlich hinzu.
»Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?« Sophia griff nach Franks Arm, als sie verstand, was dieser nun sagen wollte.
Frank ignorierte sie und sah Moll durchdringend an. »Sie müssen den Film als ein Fanal gegen den Islam machen«, sagte er. »Sie müssen den Leuten zeigen, was der Islam für eine zerstörerische Kraft in sich trägt. Sonst werden diese Ärsche, diese Spinner mit dem Allahu-akbar-Tourette ganz Deutschland überrollen.«
Moll lächelte. »Fanal?«
»Ich habe gesehen, wozu diese Tiere in der Lage sind«, redete sich Frank in Rage.
»Es ist doch ein Parasit«, hakte Moll nach. »Ein Wurm, der sich im Kopf einnistet, habt ihr gesagt.«
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752105087
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (Juli)
- Schlagworte
- Zombie Zombies Zombieapokalypse Politsatire Satire Schwarzer Humor Parodie