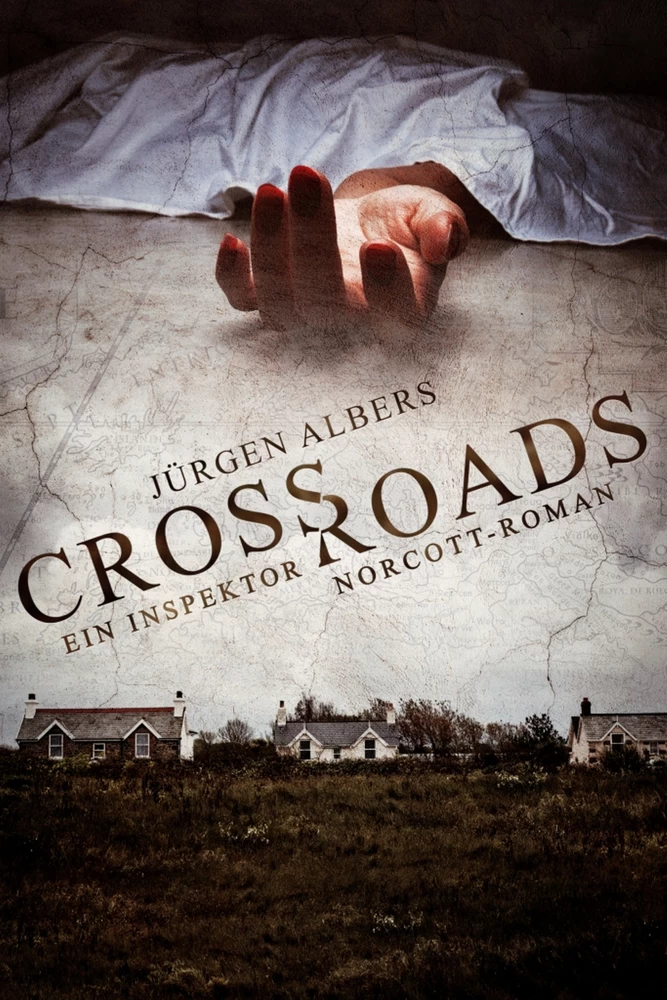Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Jersey, St. Helier, Amtssitz der Verwaltung am Royal Square
Donnerstag, 20. Juni 1940, früher Nachmittag
Er drehte langsam sein Handgelenk, bis er einen unauffälligen Blick auf das Ziffernblatt seiner Uhr werfen konnte. Exakt 14:41 Uhr. Über zwei Stunden saß er nun in der großen Besprechungsrunde beim Bailiff, dem Verwaltungschef der Insel Jersey, fest. Bei dem Gedanken daran, dass sie sich erst ungefähr in der Mitte der Tagesordnung befanden, entfuhr ihm ein leiser Seufzer. Er zog den Ärmel seines sandfarbenen Jacketts wieder zurecht und ließ seine Gedanken zu den Ereignissen der letzten Tage zurückschweifen.
Vor fünf Tagen, am Samstag, dem 15. Juni 1940 hatte das britische Kriegskabinett angesichts des deutschen Vormarsches in Frankreich beschlossen, die britischen Kanalinseln nicht zu verteidigen und alle Truppen schnellstmöglich abzuziehen. Vier Tage hatte man gebraucht, um alle britischen Soldaten nach England zu schaffen. Gestern, am 19. Juni, hatten die Vorbereitungen für die Evakuierung der Zivilbevölkerung begonnen und schon morgen sollte es losgehen.
Erneut musste Norcott seufzen, stritten sich doch zum wiederholten Male einige Anwesende lautstark über Details der Evakuierung. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, dachte er sarkastisch, ist die deutsche Wehrmacht hier, bevor wir überhaupt angefangen haben. Seine Ungeduld veranlasste ihn beinahe dazu, erneut auf die Uhr zu sehen, als die Tür zum Konferenzraum aufging und ein uniformierter Polizeisergeant eintrat.
»… kann ich absolut nicht nachvollziehen! Ich denke …«, der Bailiff brach ab. »Ja? Was können wir für Sie tun, Sergeant?«
Der Polizist salutierte. »Entschuldigen Sie, Sir. Ich muss den Chief Inspector in einer dringenden Angelegenheit sprechen.«
Detective Chief Inspector Charles Norcott, Chef der Kriminalpolizei, zugleich Leiter aller Polizeikräfte auf den Kanalinseln seiner britischen Majestät, gelang es mühelos, seine Erleichterung über die Unterbrechung zu verbergen. Mit angemessen entschuldigender Geste nickte er dem Bailiff zu, raffte Notizbuch und Papiere mit einer fließenden Bewegung zusammen und war mit wenigen langen Schritten aus dem Raum verschwunden.
»Entschuldigen Sie, Sir. Ich hätte nicht gestört, wenn …«, begann der Sergeant draußen.
Der Chief Inspector winkte ab. »Lassen Sie nur, Sergeant.« Er dehnte vorsichtig seinen Rücken. »Sie haben mir sozusagen das Leben gerettet.« Beide Männer mussten grinsen.
»Verstehe, Sir. Schwere Kämpfe an der Papierfront?«
Norcott zwinkerte dem Mann zu. »Schwere Kämpfe, Sergeant, äußerst schwere. Und? Was haben wir?«
Die Miene des Sergeants wurde augenblicklich ernst. Er räusperte sich. »Eine Tote auf Guernsey, Sir. Wie es aussieht, Mord.«
Charles Norcott atmete tief ein. Er kannte die Reaktion, die jetzt kam, genau. Adrenalin trieb Herzschlag und Blutdruck nach oben, alle Sinne schienen sich wie auf ein geheimes Kommando hin zu schärfen und zu fokussieren. Der Jagdhund in ihm erwachte mit einem Schlag zum Leben.
»Der Anruf kam vor einer Viertelstunde. Eine Frau ist tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Dem Anschein nach erwürgt oder erdrosselt.«
»Hinweise auf den Täter?«, fragte Norcott, während er bereits zum Ausgang des Gebäudes strebte.
»Nichts Augenfälliges, Sir. Das Motorboot der Lifeguard liegt bereit und Ihr Koffer ist schon im Wagen.« Der Sergeant lief voraus und hielt seinem Chef die Tür zum wartenden Streifenwagen auf. »Soll ich noch mal?« Er wies mit dem Daumen hinter sich auf das Gebäude der Zivilverwaltung.
»Bescheid geben, dass ich nicht in die Sitzung zurückkomme?« Der Chief Inspector schüttelte den Kopf. »Lieber die Papierschlacht nicht stören.« Grinsend schlug er die Tür zu.
Sein Fahrer gab Gas. Dank Blaulicht schafften sie den Weg durch den Mittagsverkehr in wenigen Minuten. Bis zur Station der Lifeguard am Rande des Hafens waren es nur knapp zwei Meilen.
Norcott hob einen kleinen Reisekoffer aus dem Streifenwagen und ging in Richtung Anleger. Es war nicht nachvollziehbar, wieso es kein eigenes Polizeiboot gab. Bisher hatte man sich der Boote der Coastguard bedient, die aber, wie die Armee, inklusive aller Fahrzeuge von den Kanalinseln abgezogen worden waren. An Fliegen war schon gar nicht zu denken. Die Royal Air Force war auf und davon und bis man einen der wenigen Freizeitpiloten aktiviert hatte, konnte man ebenso gut das Motorboot der Lifeguard benutzen. Das brauchte für die Strecke nach Guernsey immerhin nur zwei statt der vier Stunden, die es mit der regelmäßig verkehrenden Barkasse dauerte.
Norcott nickte der wartenden Besatzung des Motorbootes zu und setzte sich ins Heck. Wortlos schob der Bootsführer den Gashebel nach vorn und sofort hob der Schub der zwei Dieselmotoren die Nase des Bootes aus dem Wasser. Ab jetzt hatte der Polizeichef der britischen Kanalinseln zwei Stunden Zeit, über die bisher eigenartigste Station seiner Laufbahn als Kriminalbeamter nachzudenken.
Der Ärmelkanal lag mit einer trägen Ruhe in der Nachmittagssonne. Harmlos wirkende Schleierwolken zierten einen unschuldig blauen Himmel. Alles strahlte gemächliche Sommerferienstimmung aus. Und nie, dachte Norcott, war der Anschein von Frieden und Ruhe verlogener.
Die Fahrt und das Dröhnen der Motoren wurden schnell eintönig, nachdem das Boot den Hafen verlassen hatte, und ebenso rasch glitten Norcotts Gedanken fünfzehn Monate zurück, zum Anfang des Jahres 1939.
Heather Norcott war Lehrerin mit einer guten Stelle an einer soliden Public School gewesen. Ihre Aufgabe hatte sie erfüllt. Vielleicht wegen ihres Jobs, vielleicht weil ihr Mann wieder einmal bis zum Hals in einem Fall steckte, hatte sie wegen der Schmerzen nichts unternommen, die sich ganz langsam in ihr Leben geschlichen hatten. Nach sieben Tagen war Heather tot. Nach achtunddreißig Jahren Leben und einer Woche Schmerzen hatte sie ihn allein gelassen. Und noch immer, nach über einem Jahr, fühlte sich Charles Norcott wie taub, noch immer gab es Momente, in denen er glaubte, an seiner Wut und seiner Verzweiflung ersticken zu müssen.
Die Tage und Monate nach Heathers Tod waren vergangen und die Welt drehte sich unbarmherzig weiter. Der alte Lebensrhythmus schien wieder hergestellt. Aber Norcott wusste, dass es nicht so war. Etwas hatte sich in ihm verhärtet, das er im Zaum halten musste. Nur seine engsten Mitarbeiter bemerkten, wie der Chief Inspector immer früher kam und immer später ging. Manchmal verließ Norcott nur noch stundenweise sein Büro, um in seiner Apartmentwohnung zu duschen und sich umzuziehen. Ihr altes Haus hatte er verkauft. Er hatte es darin nicht mehr ausgehalten. Der neue Charles Norcott machte sich nicht nur Freunde. Nicht im Yard und nicht in Westminster. Er war nie besonders feinfühlig bei seinen Ermittlungen gewesen, aber irgendwann hatte sich die Geduld seiner Vorgesetzten offenbar erschöpft.
An einem trüben Montagmorgen im März hatte Norcott eine Vorladung zum Chef der Metropolitan Police, Sir Philip Game, erhalten. Der Commissioner of Police of the Metropolis war der leitende Polizeioffizier für das gesamte Königreich, auch wenn sich sein Titel auf die Polizei der Hauptstadt bezog. Charles Norcott wunderte sich nicht über die Vorladung, eher erstaunte ihn, dass es so lange gedauert hatte. Wenn man rücksichtslos durch London jagte, trat man zwangsläufig einigen Leuten auf die Füße. Und Norcott hatte in dieser Beziehung ganz neue Maßstäbe gesetzt. Jetzt, an Bord eines einsamen Motorbootes im Kanal, erinnerte er sich schmerzhaft an die Nervosität, mit der er vor Sir Philips Vorzimmertür gestanden hatte.
»Sie wollten mich sprechen, Sir?«
»Charles. Bitte kommen Sie.« Noch bevor Norcott den Stuhl vor dem weiträumigen Schreibtisch des Polizeichefs erreicht hatte, hob der die Hand und sah gleichzeitig auf seine Taschenuhr. »Wie ich sehe, ist es schon nach 15:00 Uhr. Durchaus eine angemessene Zeit, um etwas zu trinken.« Um seinen schmalen Mund mit den Bleistiftlippen spielte, kaum wahrnehmbar, für eine Sekunde ein Lächeln.
Norcott blieb stehen und deutete auf ein chinesisches Lacktischchen an der Wand, auf dem eine Reihe von Karaffen stand. »Darf ich?«
»Ich bitte darum. Und nicht diese unchristlichen Portionen, die sie im Army & Navy Club ausschenken.«
Norcott reichte dem Polizeichef ein großzügig gefülltes Kristallglas. Bei seinem eigenen Quantum war er vorsichtiger. Game nickte einladend und Norcott setzte sich auf einen der beiden Stühle, die vor dem Schreibtisch bereitstanden. Sir Philip trank einen Schluck und begann dann, das schwere Kristallglas in seiner Hand zu drehen. »Charles, ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden. Sie haben in den letzten Monaten versucht, die Kriminalität auf den britischen Inseln im Alleingang auszurotten. So jedenfalls schien es. Und wo gehobelt wird, fallen Späne, sagt man. Falls Sie sich gewundert haben, dass Sie nicht schon längst hier sitzen mussten: Sie haben das allein Ihren Ermittlungserfolgen zu verdanken!« Der hagere, fast zierlich wirkende Polizeichef betrachtete einen Moment seine schmalen Hände. Er holte sichtlich Atem. »Charles, bevor wir weiterreden, möchte ich, dass Sie etwas lesen.« Er nahm einen dünnen Aktendeckel und reichte ihn Norcott über den Schreibtisch. Der schlug den Deckel auf und begann zu lesen. Das erste Blatt Papier war eine Aktennotiz aus dem Büro des Premierministers, ungefähr einen Monat alt. Darin ließ Premierminister Neville Chamberlain seinen Polizeichef wissen, er sei während der wöchentlichen Besprechung von Seiner Majestät angesprochen worden. Georg der VI. habe sich freudig erstaunt über die Ermittlungserfolge eines gewissen DCI Norcott geäußert. Die Notiz endete in höflichen nichtssagenden Floskeln. Das zweite Schriftstück war eine dienstliche Beurteilung, wie sie vor Beförderungen verfasst wurde. Im letzten Teil hatte Sir Philip seine Beförderung zum Detective Superintendent mit Nachdruck befürwortet. Norcott ließ den Aktendeckel sinken und sah den Polizeichef an.
»Sie haben sicher bemerkt, dass Ihre Beurteilung noch nicht von mir unterschrieben wurde?«
Norcott nickte. Er hatte plötzlich einen sehr trockenen Hals.
»Sie sind mit Sicherheit einer der fähigsten Kriminalbeamten, die wir im Land haben. Und mit noch größerer Sicherheit sind Sie einer der Unvorsichtigsten, Charles! Sie sind seit dem Tod Ihrer Frau hohe Risiken eingegangen und haben sich eine Menge Feinde gemacht. Und damit meine ich nicht die Bosse aus der Unterwelt! Wenn ich Sie jetzt befördere, werden einige Herrschaften nicht ruhen, bis man Sie so oder so zur Strecke gebracht hat.«
Norcott machte Anstalten, etwas zu sagen, aber Game schüttelte den Kopf. »Nein, Charles, ich weiß, was Sie sagen wollen. Und Sie wissen, ich teile Ihre Meinung über solche Menschen. Leute, denen ein blindes Schicksal einen Sitz im Oberhaus beschert hat, aber nicht genug Verstand, damit sie mit ihren zugekoksten Köpfen auch den Eingang finden!« Er machte eine wegwerfende Geste. Seine buschigen Augenbrauen sträubten sich vor Erregung. »Es ist besser, ich ziehe Sie ein wenig aus der unmittelbaren Feuerlinie. Sie gehen als neuer Polizeichef auf die Kanalinseln. Kriminalistisch sicher keine Herausforderung für einen Mann Ihres Kalibers, aber vielleicht der geeignete Ort, um, um …« Game rang sichtlich nach Worten. »Herrgott Charles, um wieder zu sich zu kommen! So kann es doch nicht weitergehen! Ich verbiete Ihnen ausdrücklich, weiter so Schindluder mit sich zu treiben. Das sind Sie Heather schuldig!«
Es gab nicht einmal eine Handvoll Menschen, die sich in Norcotts Gegenwart auf seine tote Frau berufen durften, ohne einen Schlag auf die Nase zu riskieren. Der kleine, hagere Polizeichef gehörte dazu.
Norcott nickte stumm, aber Sir Philip ließ ihn nicht aus den Augen. Er insistierte: »Versprechen Sie mir, dass Sie Jersey für einen Neuanfang nutzen werden, Charles?«
»Ja, Sir«, war die einsilbige Antwort.
Sie hatten sich per Handschlag verabschiedet. Es war Montag, der 27. März 1939 gewesen. Vier Tage später, am 1. April, hatte Charles Norcott seinen neuen Posten auf den britischen Kanalinseln angetreten. Das alles war nun fünfzehn Monate her und über den scheinbar so ruhigen Inseln hatte sich ein Sturm zusammengebraut. Wie, um ihn aus seinen Gedanken zu wecken, schrammte der Bootsbug an die Kaimauer. Er war auf Guernsey angekommen.
Kapitel 2
Guernsey, St. Peter Port, Parnell Road 5
Donnerstag, 20. Juni 1940, später Nachmittag
Der Notruf ging um 14:17 Uhr bei uns ein, Sir,« sagte Sergeant Mulgrave. »Eine Frau meldete, sie habe ihre Arbeitgeberin tot in deren Wohnung aufgefunden. Sie sei ermordet worden. 14:28 Uhr war ich zusammen mit Constable Haydon vor Ort.« Mulgrave blätterte seinen Notizblock um und folgte Detective Chief Inspector Norcott aus dem Flur ins Schlafzimmer. Der Chief trug, wie immer, einen eleganten Anzug mit passender Krawatte. Sergeant Mulgrave machte ein verdrossenes Gesicht und es schien, als würde er sich über sich selbst ärgern. Er hatte, auch wie immer, heute Morgen irgendein Jackett gegriffen und schwitzte nun in dickem Harris-Tweed.
»Die Tote ist, nach derzeitigem Erkenntnisstand, Mrs. Nora Henley, 34 Jahre, Hausfrau, Ehefrau von William Henley. Er arbeitet in der Western Channel Bank in der North Esplanade.«
»Wer hat sie identifiziert?«, wollte Norcott wissen und beobachtete gleichzeitig den Gerichtsmediziner Dr. Hamilton bei der Untersuchung der Toten.
»Einmal die Zeugin, die uns angerufen hat: Libby O’Meare, sie putzt bei den Henleys seit zwei Jahren. Und die Nachbarin, die im Erdgeschoss wohnt, Mrs. Elanor Dobbs.«
»Was ist mit dem Ehemann?«
Mulgrave kratzte sich mit dem Bleistift am bulligen Nacken. »Da wir nicht wussten, wie schnell man Sie auf Jersey benachrichtigt und wie schnell Sie es schaffen würden, herüberzukommen, hielten John Pearson und ich es für das Beste, ihn gleich am Arbeitsplatz abzuholen. Sie hätten es ihm vielleicht lieber selbst gesagt, um die Reaktion zu beobachten. Ich hoffe, wir haben’s nicht verpatzt?« Er sah Chief Inspector Norcott an und kratzte sich weiter verlegen am Nacken.
Norcotts Ruf eines Perfektionisten war ihm vorausgeeilt, als er auf die Kanalinseln versetzt wurde. Da sich der Chief Inspector zumeist auf der größten Kanalinsel Jersey aufhielt und auch dort sein ständiges Büro unterhielt, hatten Clive Mulgrave und John Pearson, die beiden leitenden Sergeants der Polizeistation auf Guernsey noch keine Erfahrung mit seiner Arbeitsweise bei Kapitalverbrechen.
»Wer hat ihm die Nachricht überbracht?«, fragte Norcott, ohne eine weitere Reaktion zu zeigen.
»John Pearson und Detective Constable Lancer, Sir.«
»Dann wird das auch gut gelaufen sein, Clive.« Norcott drückte Mulgrave freundlich am Arm. »Das war schon gut so. Wir reden heute Abend in der Besprechung darüber. Wo ist Henley jetzt? Hat er seine Frau schon gesehen?«
»Er ist nebenan, Sir, im Wohnzimmer. Das Zimmer am Ende des Flurs.« Mulgrave deutete mit dem Bleistift aus der offenen Schlafzimmertür. »Lancer ist bei ihm. Und nein, er hat sie nicht gesehen. Der Doc war schon mit ihr beschäftigt, als John und Constable Lancer mit ihm eintrafen.«
»Gut. Ich werde kurz mit Dr. Hamilton sprechen und gehe dann rüber.«
Der Chief Inspector lehnte sich an den Türrahmen und beobachtete still Dr. Hamilton, der ruhig und systematisch arbeitete. Norcott hielt überhaupt nichts davon, die Gerichtsmediziner während der laufenden Untersuchung zu überfallen. Nach seiner Erfahrung purer Aktionismus, der nur dazu führte, dass dem Arzt womöglich ein Detail entging, weil er im falschen Moment abgelenkt worden war. Ein guter Gerichtsmediziner meldete sich schon, wenn er fertig war. Und ausnahmsweise, dachte Norcott bei sich, ausnahmsweise haben wir hier mal Glück. Von den zwei Ärzten auf Guernsey, die als Gerichtsmediziner zugelassen waren, hatte sich der jüngere und unerfahrenere evakuieren lassen. Ansonsten war der Polizei auf Guernsey – genau wie auf Jersey – ein beträchtlicher Aderlass nicht erspart geblieben. Kriminaltechniker, einfache Streifenbeamte, ein junger Inspector, Schreibkräfte, selbst Mechaniker hatten innerhalb von Stunden ihren Arbeitsplatz geräumt und entweder schon zusammen mit den Truppen die Insel Richtung England verlassen oder würden es heute oder morgen tun. Bald würde der Mangel die Herrschaft übernehmen.
Dr. Hamilton holte ihn aus seinen trüben Überlegungen. »Charles?«
»Hallo, Brian, entschuldige, ich war in Gedanken. Was kannst du mir sagen?«
»Noch nicht so furchtbar viel im Moment«, antwortete der Arzt und zog sich dabei seine Gummihandschuhe aus. »Die Frau ist ungefähr vier bis maximal sechs Stunden tot.«
Norcott sah auf die Uhr, es war mittlerweile fast halb sechs. Dann war die Frau noch nicht lange tot, als sie entdeckt wurde, dachte er bei sich und sagte: »Der Tod trat also zwischen 11:30 und 13:30 Uhr ein, richtig?«
»Ja, das ist richtig, wobei ich eher auf später tippen würde.«, erwiderte Dr. Hamilton. »Sie ist erdrosselt worden, mit einem etwa 1 bis 1,5 Inch breiten, härterem Gewebe. Ich tippe auf einen Ledergürtel, dazu würden auch die feinen Abriebfasern passen, die ich gefunden habe. Aber das ist alles erst einmal Augenschein, Genaueres nach der Laboruntersuchung. Sie hat sich gewehrt, aber sie hat wohl hauptsächlich versucht, den Gürtel oder was immer es war, loszubekommen und hat weniger ihren Angreifer attackiert. Jedenfalls konnte ich keine nennenswerten Gewebereste unter ihren Fingernägeln feststellen.«
»Ist sie vergewaltigt worden?«, fragte Norcott nach.
»Nein … das sieht nicht so aus.«
Norcott hatte das kurze, sekundenlange Zögern in der Antwort des Arztes bemerkt. »Aber? Du bist dir nicht sicher?«
Der Arzt zögerte noch einen Moment, sagte dann: »Charles, das ist noch alles wacklig, aber ich würde behaupten, sie war ›bereit‹, es ist aber nicht mehr zum Geschlechtsverkehr gekommen.«
Charles Norcott strich sich nachdenklich durch die graumelierten Haare. »Das wäre also ein Indiz dafür, dass sie ihren Mörder gekannt hat.« Er überlegte weiter. »Und ein Unfall?«
»Ah, du meinst, die Strangulation könnte einvernehmlich …?«, assistierte Hamilton. Er blies ein wenig die Wangen auf und dachte einen Moment nach. »Das will ich nicht hundertprozentig ausschließen, heutzutage probieren die Leute ja allerhand aus, aber das ist im Moment reine Spekulation.« Er nahm seine Tasche. »Ich kann dir nur sagen, dass sie erregt war, als sie starb, alles Weitere müssen wir sehen. Und ihr wollt ja auch noch etwas zu tun haben, nicht wahr?« Der Gerichtsmediziner lächelte Norcott aufmunternd zu und betrachtete ihn einen Moment. Das ohnehin schlanke, scharf geschnittene Gesicht mit der schmalen Nase wirkte grau und unnatürlich straff. Der Arzt trat mit seiner Tasche zur Tür und für einen Moment standen die beiden Männer dicht beieinander. »Sag mal, mein Freund, gönnst du dir auch genug Ruhe? Ich möchte bald mal wieder deine Blutwerte überprüfen.« Er tippte Norcott mit dem Zeigefinger auf die Brust und fügte leise hinzu: »Und deine Leberwerte auch!«
Jeder andere hätte sich damit bei Norcott eine patzige Replik eingefangen, aber Brian Hamilton war einer der wenigen Freunde, die er an sich heranließ. Er sah Brian einen Moment stumm an, nickte dann aber resigniert. Man gab sich die Hand und der Arzt verließ die Wohnung der Henleys. Unmittelbar danach kamen die Mitarbeiter der rechtsmedizinischen Abteilung des Métivier-Krankenhauses. Sie sahen Norcott fragend an und er nickte stumm. Dann transportierten sie Mrs. Henley ab.
Norcott sammelte sich kurz, dann durchquerte er den kurzen Flur und betrat das Wohnzimmer. Er nickte dem Ehemann nur knapp zu und wandte sich dann an Constable Lancer. »Kommen Sie kurz?«
»Hallo, Sir, schön Sie zu sehen«, freute sich Lancer, der erleichtert wirkte.
»Wie hat er sich verhalten, seit Sie mit ihm hier sitzen?«, wollte Norcott wissen.
»Erstaunlich gefasst, wenn Sie mich fragen, Sir. Kein Geheule oder großes Gejammer. Scheint eher herumzugrübeln. Knetet viel an seinen Händen herum, das werden Sie noch sehen. Wahrscheinlich noch im Schock. Dr. Hamilton hat ihn sich vorhin kurz angesehen, hat ihm aber nichts gegeben. Wir haben angeboten, ihm Tee zu kochen. Das hat er auch angenommen, dann seinen Tee aber nicht getrunken.«
Eine Tasse Tee könnte ich jetzt auch vertragen, dachte Norcott, der seit dem Morgen nichts mehr in den Magen bekommen hatte. »Meinen Sie, Sie könnten mir auch …?«
»Tee? Ja, klar, Sir. Kommt gleich.« Der Constable war sichtlich froh, von der Warterei mit dem Ehemann wegzukommen und verschwand in der Küche.
Charles Norcott betrat das Wohnzimmer. William Henley saß in einem von zwei zierlichen Clubsesseln, die neben einem massigen Sofa verloren wirkten. Verloren wirkte auch der Mann im Sessel, der jetzt mit leerem Blick den hochgewachsenen Polizisten ansah.
Norcott griff in seine Jackettasche und präsentierte seinen Dienstausweis. »Mr. Henley, ich bin Detective Chief Inspector Norcott. Lassen Sie mich mein Beileid aussprechen zum Tod Ihrer Frau.« Er machte eine kurze Pause und Henley nickte stumm. »Fühlen Sie sich soweit in Ordnung, dass wir erste Fragen klären können? Sie werden sicher verstehen, dass nach einer Gewalttat die Zeit eine große Rolle spielt.«
Wenn William Henley das Gesagte verstanden hatte, ließ sich dies an keiner Regung in seinem Gesicht ablesen.
»Mr. Henley?« Norcott machte einen kleinen Schritt auf den Ehemann zu. »Darf ich mich setzen?«
Henley schien zu erwachen, machte eine Geste zum leeren Sessel und räusperte sich. »Bitte entschuldigen Sie, Inspector. Ja, es geht mir gut. Bitte stellen Sie Ihre Fragen.«
Ganz der korrekte Bankangestellte, dachte Norcott, der sich vorsichtig in den Sessel setzte und die sofort einsetzende Entspannung in seinem Rücken genoss. Seit Monaten machte der ihm zu schaffen. Bei einer Körpergröße von fast sechseinhalb Fuß war mit Rückenproblemen früher oder später zu rechnen. Aber in diesem Moment verfluchte Norcott seinen Rücken und die damit verbundenen Einschränkungen und versuchte, sich wieder ganz auf William Henley zu konzentrieren. Er beschäftigte sich lang genug mit Gewaltverbrechen, um niemals dem ersten Anschein zu glauben. Selbst in Menschen, die im Angesicht eines Mordes scheinbar völlig stumpf und unbeteiligt schienen, konnte ein ordentlicher Kampf der Gefühle toben. Es war immer ein Fehler, in so einem Fall vorschnell zu urteilen.
»Mr. Henley, wir konnten bei der bisherigen Untersuchung Ihrer Wohnung keinerlei Einbruchsspuren oder sonstige Merkmale gewaltsamen Eindringens feststellen. Wir müssen also davon ausgehen, dass Ihre Frau dem Täter entweder selbst die Tür geöffnet hat oder er einen Schlüssel besaß. Beginnen wir bei diesem Punkt: Wer hat außer Ihnen und Ihrer Frau noch Schlüssel zu dieser Wohnung?«
»Mrs. O’Meare hat einen Schlüssel, aber das wissen Sie sicher schon und dann liegt ein Schlüssel für Notfälle bei meinen Eltern.«
»Mr. Henley, ich kann mir vorstellen, wie erschreckend diese Frage für Sie klingen muss, aber haben Sie einen Verdacht, wer Ihre Frau ermordet haben könnte?«
Henleys Augen flackerten nervös und er begann wieder, sich die Hände zu reiben, wie Lancer es schon beschrieben hatte.
»Hatte Ihre Frau Feinde?«
Der Kopf schnellte hoch und nun sah der Ehemann ehrlich überrascht aus. »Feinde? Meine Frau?«
Ruhig setzte Norcott hinzu: »Hat jemand Ihre Frau genug gehasst, um ihr den Tod zu wünschen?«
Henley schüttelte wortlos den Kopf, das Reiben der Hände wurde stärker.
Norcott stellte diesen Punkt gedanklich zurück und beschloss, ein weiteres heikles Thema anzugehen.
»Wie würden Sie Ihre Ehe beschreiben, Mr. Henley?«
Wieder schnellte der Kopf des Ehemanns hoch. Norcott hatte sich bei der Frage ganz auf die Reaktion konzentriert und versuchte, jeden noch so kleinen Teil in sich aufzunehmen.
»Ich habe«, Henley brach ab, räusperte sich und setzte lauter hinzu, »meine Frau geliebt!« Seine Hände verkrampften sich in seinen Hosenbeinen und er war sichtlich aufgewühlt, aber Norcott wusste, er musste noch weiterbohren.
»Und Ihre Frau«, Norcott baute eine kaum hörbare Pause ein, »hat Sie auch geliebt?«
»Glauben Sie etwa, ich habe sie umgebracht?« Es brach förmlich aus dem Ehemann heraus und er sprang auf.
Norcott zwang sich zu maximaler Ruhe. »Bitte, Mr. Henley. Niemand hat das unterstellt und ich habe das auch nicht gesagt. Aber Sie werden verstehen, dass ich alle Möglichkeiten überprüfen muss.«
Henley ging nun zwischen Sessel und Fenster hin und her und seine Hände rieben sich weiter ineinander. »Vielleicht wollen Sie gleich noch wissen, wo ich gewesen bin?«, setzte er aufgebracht hinzu.
Je nervöser Henley wurde, umso mehr zwang sich Charles Norcott zur Ruhe. »Ja, Mr. Henley, das muss ich tatsächlich fragen. Also bringen wir es hinter uns. Wo waren Sie zwischen 11:00 und 14:00 Uhr?«
»Ich war selbstverständlich in der Bank. Ich arbeite in der Western Channel Bank.«
»Sie waren die ganze Zeit über im Bankgebäude? Ich nehme an, das können Kollegen oder Ihr Vorgesetzter bezeugen?«
Henley, der weiter im Wohnzimmer umhergewandert war, blieb abrupt stehen. »Ich … Ich war in meiner Mittagspause an der Luft. Ich war im Cambridge Park.«
»Allein?«
»Ja, allein.«
»Haben Sie niemanden getroffen? Freunde, Kollegen? Irgendwen, der sich an Sie erinnern könnte?«
»Ich fürchte nein, Inspector. Und ich habe auch nicht darauf geachtet, wenn Sie es genau wissen wollen!« Henley drehte sich zum Fenster und nach einem Moment sagte er: »Ich war nervös. Jeder ist doch im Moment nervös. In der Bank ist die Hölle los. Alle wollen jetzt ihr Geld abheben, ihr Geld in Sicherheit bringen.«
Norcott beschloss, die Gelegenheit zum Themenwechsel zu nutzen. »Hatten Sie auch vor, sich evakuieren zu lassen?«
Der Ehemann starrte weiter aus dem Fenster.
»Mr. Henley? Würden Sie bitte meine Frage beantworten?«
»Ich hätte nie daran gedacht.« Die knappe Antwort kam gepresst.
Charles Norcott runzelte kurz die Stirn, hielt es aber für besser, in diesem Punkt nicht weiter nachzubohren.
»Vielen Dank, Mr. Henley. Dann möchte ich Sie jetzt auch nicht weiter behelligen. Ich kann Ihnen leider noch nicht sagen, ab wann wir das Schlafzimmer wieder freigeben können, unter Umständen müssen die Kollegen der Spurensicherung dort morgen noch weiterarbeiten.« Norcott stand auf und verabschiedete sich von William Henley.
Auf dem Flur wartete schon Constable Lancer auf ihn. »Ihr Tee, Sir. Ich dachte, es ist wohl besser, jetzt nicht hineinzuplatzen.« Er reichte Norcott einen etwas angeschlagenen Becher voller Tee, der offensichtlich reichlich Sahne enthielt, so wie ihn Norcott mochte.
»Danke, Constable.« Norcott nahm einen vorsichtigen Schluck und verbrühte sich doch fast die Lippen. »Lassen Sie sich von Henley die Adresse seiner Eltern geben, die haben einen Ersatzschlüssel für die Wohnung. Fahren Sie hin und überprüfen Sie, wo der Schlüssel aufbewahrt wird, ob er noch da ist und ob ihn jemand unbemerkt benutzen konnte.«
»Ja, Sir.«
»Wo ist Sergeant Mulgrave?«
Der Gesuchte steckte seinen Kopf aus einer Tür neben der Küche. »Ich bin hier, Sir. Das hier scheint so etwas wie ein Damenzimmer gewesen zu sein.« Er wies mit einer leicht hilflosen Geste in einen recht großzügigen Raum, der im Wesentlichen mit einem großen bequemen Sofa, einem Tisch mit Plattenspieler und Radio sowie einer auffallend großen Frisierkommode gefüllt war. Daneben fanden sich ein großer drehbarer Schneiderspiegel und eine Damenkleiderpuppe.
»Clive, haben Sie irgendwo Koffer entdeckt?«
Mulgrave stutze einen Augenblick. »Sie meinen, ob die beiden wegwollten? In einem der Schlafzimmerschränke – auch etwas übergroß, wenn Sie mich fragen – standen verschiedene Koffer, aber alle leer, soweit ich weiß. Ich werde das gleich überprüfen.«
Im selben Moment stand Sergeant Pearson in der offenen Tür. »Hallo, John«, sagte Norcott und sie gaben sich die Hand. »Wie geht es mit den Nachbarn voran?«
»Alles im Lauf, Sir. Ich habe zwei Männer darauf angesetzt und war bis eben selbst dabei. Die Spurensicherer kommen auch gut voran.«
»John, ich würde gern«, er sah auf seine Armbanduhr, »in einer Stunde eine Besprechung in der Hospital Lane haben. Kriegen wir das hin?«
»Das dürfte kein Problem sein, Sir«, antwortete Pearson zuversichtlich und betrachtete mit Interesse Norcotts Teebecher. Norcott fing den Blick auf und zeigte zur Küche. »Lancer.«
Kapitel 3
St. Peter Port, Polizeizentrale in der Hospital Lane
Donnerstag, 20. Juni 1940, nach sieben Uhr abends
Um neunzehn Uhr war die Befragung der Nachbarschaft erst einmal abgebrochen worden. Das Team der Spurensicherung hatte in der Wohnung der Henleys bereits früher seine Taschen gepackt. Nur das Schlafzimmer als engerer Tatort war versiegelt worden. Sollten aus den ersten Untersuchungen neue Verdachtsmomente entstehen, bestand keine Gefahr, dass Spuren vorschnell verwischt wurden.
In der Hospital Lane, wie die Polizeizentrale von Guernsey nach der kurzen Straße, in der sie lag, genannt wurde, hatte sich das kleine Ermittlungsteam in den Besprechungsraum zurückgezogen. Staubteilchen tanzten dort in den letzten Strahlen der Frühsommersonne. Sie tauchte den Raum in unschuldig warmes Orange, heuchelte Ruhe und Frieden. Am Rand des Raumes hatte man eine große Tafel platziert. Die Bilder an dieser Tafel sprachen eine andere Sprache, zeigten den Tod in Schwarz-Weiß. Zeigten den Tod, der kein warmes Hinübergleiten kannte. Nur Kälte und grausige Schwärze.
Charles Norcott hatte sich von den Bildern losgerissen und betrachtete verstohlen die vier Männer, die mit ihm an dem abgenutzten Tisch Platz genommen hatten. Der grauhaarige John Pearson, immer beherrscht; Clive Mulgrave, dessen bullige Gestalt scheinbar nicht zu seiner zerstreuten Art passen wollte. Nahe zur Tafel, der leitende Sergeant der Spurensicherung, Roderick Alleyn und schließlich Hubert Haydon, dienstältester Detective Constable, ein hagerer Mann mit militärisch wirkendem Bürstenhaarschnitt.
Nach dem langen Tag hatten sich alle mit Tee versorgt und hingen für einen Moment ihren eigenen stillen Gedanken nach. Trotzdem glaubte Norcott, das Jagdfieber der Männer fast körperlich spüren zu können. Jetzt galt es, die Untersuchung weiter systematisch und penibel aufzubauen. Er wusste, dass sein Team über kaum Erfahrung mit Gewaltverbrechen verfügte. Übermotivation war das größte Risiko.
Norcott löste sich von seinen heimlichen Sorgen und gab eine kurze Einleitung für alle. In den vielen Jahren der Erfahrung mit Ermittlungsteams hatte Charles Norcott eines ganz sicher gelernt: Von glücklichen Zufällen abgesehen, waren Erfolge immer das Ergebnis gewissenhafter, manchmal kleinlicher Teamarbeit. Ermittlungspannen konnten meistens auf mangelnde Kommunikation zurückgeführt werden. Norcott war fest entschlossen, diesen Fall mit maximaler Energie zu einer schnellen Aufklärung zu bringen. Die Kriegssituation hing als riesengroße, unberechenbare Drohung über allem. Niemand konnte erahnen, wie schnell und wie gründlich der Krieg ihr Leben auf den Kopf stellen würde.
»Was ist bei der Befragung der Nachbarn herausgekommen?«, wollte Norcott von Sergeant Pearson wissen.
»Zunächst wenig Detailliertes, was die Charakteristik der beiden Henleys angeht, Sir.« Pearson blätterte in seinem Notizbuch. »Ich beschränke mich auf das, was wir nicht schon ohnehin an biografischen Daten hatten. Er, William Henley, wird durchgängig von allen Nachbarn als stiller, zurückhaltender Mensch beschrieben. Ich mag solche Klischees nicht, aber er wird als klassischer Bankangestellter beschrieben – korrekt, ruhig, ein wenig langweilig. Das einzig Aufregende in seinem Leben scheint Sie, Nora, gewesen zu sein. Bei ihr laufen die Beschreibungen dann auch deutlich auseinander. Einige Nachbarn wollten sich zuerst gar nicht zu ihr äußern.«
»Sag nichts Schlechtes über Tote«, warf Sergeant Mulgrave ein.
»Ja, so ungefähr«, stimmte Pearson zu und nickte. »Wir haben allein …«, er zählte in seinen Notizen nach, »vier Nachbarn, die ihre Aussagen tatsächlich mit ›Man soll ja nichts Schlechtes über Tote sagen‹ anfingen! Ob so oder anders eingeleitet, letztlich kamen alle Befragten zum gleichen Urteil: Sie ist Arbeit, wo immer es möglich war, aus dem Weg gegangen, war mit dem Geld großzügig, solange es um ihre Wünsche ging und wurde knauserig, wenn es um ihn oder andere ging. Außerdem war sie Männerbegegnungen, um es einmal so zu nennen, nicht abgeneigt. Zwei Zeugen aus der Nachbarschaft haben sie am Haus oder in der Nähe ihres Hauses mit fremden Männern gesehen.«
»Wie glaubwürdig sind diese Zeugen?«, unterbrach Norcott. »Können wir das als Tratsch neidischer Nachbarn abtun oder steckt Substanz hinter den Aussagen?«
»Nein, Sir, ich denke, das können wir nicht abtun«, antwortete Pearson. »Clive, vielleicht gibst du mal dein Gespräch mit Mr. Woolton wieder«, wandte sich Pearson an Mulgrave.
»Roger Woolton, 43 Jahre, ist Büroleiter in einer der großen Gemüseplantagen. Wohnt Parnell Road 7, schräg gegenüber dem Haus der Henleys. Macht auf mich einen ausgesprochen scharfsinnigen Eindruck. Dem entgeht nichts so schnell, bewertet aber sehr zurückhaltend. Er konnte sich an insgesamt drei Begegnungen erinnern, in denen er die Henley mit ihm nicht bekannten Männern – also keinem Nachbarn oder Lieferanten oder ähnlichem – in nicht eindeutiger Situation gesehen hat. Einmal kam sie ihm auf der Maurepas Road aus Richtung der Henleyschen Wohnung entgegen und hatte sich bei einem Mann untergehakt. Sobald sie ihn sah, ließ sie den Mann los. Mit demselben Mann sah er sie im Hauseingang stehen, wobei sie den Mann wohl, wie Woolton sagte ›ziemlich eilig aus der Tür schob‹. Mrs. Henley hatte bei dieser Gelegenheit, es war seiner Erinnerung nach bereits nach dem Mittag, nur einen Morgenmantel an. Woolton war an diesem Tag nur zufällig zu Hause, weil er irgendwelche Unterlagen vergessen hatte. Er suchte sie gerade auf seinem Schreibtisch, als er die Szene durch das Fenster beobachtet hat. Ich habe es ausprobiert, Sir, man kann von seinem Schreibtisch aus die gegenüberliegende Haustür unmittelbar und gut einsehen und sicher auch Gesichter erkennen.«
»Kann Woolton eine Beschreibung des Mannes abgeben?«, hakte Norcott nach.
»Eine ziemlich gute sogar, Sir, nach meiner Einschätzung. Er würde ihn mit einiger Sicherheit wohl auch wiedererkennen. Möchten Sie …?« Er deutete auf seine Notizen.
»Details brauchen wir jetzt nicht. Wenn es jemand Bekanntes gewesen wäre, hätten Sie das wohl schon erwähnt. Was noch? Sie sprachen von drei Begegnungen?«
Mulgraves Augen leuchteten auf. »Ja, das ist sicher der interessanteste Teil der Aussage! Mr. Woolton hat Mrs. Henley drei Tage vor dem Mord, also am vergangenen Montag, dem 17., abends gegen 21:30 Uhr im Cambridge Park gesehen. Beziehungsweise um exakt zu sein, er sagt, er hat sie nicht gesehen, oder um noch präziser zu sein …«
»Clive, bitte«, stöhnte Norcott, »kommen Sie auf den Punkt.«
»Entschuldigung, Sir. Also, Woolton sagt, er sei durch den Cambridge Park gegangen, auf dem Weg nach Hause. Als er an einer Gruppe von großen Eichen am Westausgang vorbeiging, hätte er zwei Stimmen gehört, die leise, aber ziemlich heftig diskutierten. Weil ihm die eine, die weibliche Stimme bekannt vorgekommen sei, sei er einen Moment stehengeblieben. Er ist sich absolut sicher, dass es Mrs. Henleys Stimme gewesen ist. Und obwohl er die beiden Personen nicht gut erkennen konnte, ist er ebenfalls sicher, dass der Mann Uniform getragen hat!«
»Okay. Weitere Merkmale? Groß? Klein?«
»Nichts, was uns wirklich weiterhilft. Mittelgroß, etwa 8-10 Inch größer als Mrs. Henley, wobei Woolton – guter Beobachter – sagte, er hätte ihre Schuhe nicht sehen können. Ansonsten wollte er sich auf keine weiteren Merkmale festlegen, weder ein ungefähres Alter noch sonst irgendwas.«
»Besser, als wenn er etwas hinzuerfindet, was er glaubt, gesehen zu haben!«, warf Hubert Haydon ein und die anderen murmelten zustimmend.
Norcott hob kurz die Hand und das Gemurmel verstummte. »Weiß jemand, ob unser Zeichner noch hier ist oder auch die Insel verlassen hat?« Er blickte in die Runde, erntete aber nur Kopfschütteln und Schulterzucken. »Clive, bitte versuchen Sie den Zeichner, wie hieß der noch?«
»Franoux. Norman Franoux. Er ist Zeichenlehrer am Mädchen-College.«
»Ja der. Versuchen Sie ihn oder sonst jemanden aufzutreiben, der ein halbwegs brauchbares Phantombild anfertigen kann und bringen Sie ihn mit Mr. Woolton zusammen. Ich möchte ein Bild von diesem Mann, mit dem die Henley zweimal gesehen wurde.« Er wandte sich wieder Sergeant Pearson zu.
»Okay John, Sie sprachen von zwei Zeugen, die Nora Henley mit Männern gesehen haben? Wer ist der andere Zeuge?«
»Die andere Zeugin, Sir«, antwortete Pearson. »Mrs. Elanor Dobbs. Das ist die Nachbarin, die unter den Henleys im selben Haus wohnt. Sie ist gleichzeitig auch die Vermieterin. Und keine einfache Zeugin, wenn ich das sagen darf.« Er seufzte, für seine sonst eher nüchterne Art, tief.
»Moment John. Was dürfen wir uns denn unter ›nicht einfach‹ vorstellen?« Norcott wirkte ungeduldig und Pearson beeilte sich mit einer Erklärung.
»Mrs., richtigerweise ›Miss‹, Dobbs ist offenbar unverheiratet und interessiert sich auffallend für Männer, um es vorsichtig auszudrücken. Nach meinem Eindruck hat sie eine Vorliebe für Farben und Blumenmuster und genauso farbig und blumig sind ihre Antworten.«
Pearsons Erläuterung sorgte für ein allgemeines Schmunzeln. Es erstarb aber schnell unter dem genervten Blick des Sergeants.
»Es war wirklich mühsam, die Dame bei der Aussage immer wieder zum Kern zurückzubringen.« Er seufzte noch einmal. »Fakt ist, sie gibt an, einen Mann in Uniform gesehen zu haben, der aus dem Haus ging. Sie konnte sich nicht mehr an das genaue Datum erinnern, es war ungefähr Anfang dieses Monats. Sie hörte die Vordertür und hat aus der Küche durch die Tür des Wohnzimmers auf die Straße geschaut. Da ging der bewusste Mann am Fenster vorbei. Wobei wir, bei allem Enthusiasmus bezüglich des Uniformträgers, auch berücksichtigen müssen, dass theoretisch die Person, die aus der Vordertür das Haus verließ, auch nach links, Richtung Evans Lane gegangen sein könnte und der Mann in Uniform kam aus Richtung Evans Lane und passierte zufällig im passenden Moment das Fenster von Mrs. Dobbs.«
Norcott bohrte nach: »Hat sie den Uniformierten so gut erkennen können, dass sie Genaueres sagen konnte? Navy? Air Force? Dienstgrad? Irgendetwas Auffälliges an der Uniform? Und würde sich auch bei ihr ein Phantombild lohnen?«
»Die Teilstreitkraft können wir nicht bestimmen. Der Mann trug Khaki, keine Ausgehuniform. Also könnte es sich um jede der drei Teilstreitkräfte handeln, wobei sich Mrs. Dobbs ja nicht einmal sicher war, dass es sich um eine Militäruniform handelte, von Details wie Rangabzeichen oder Ähnlichem einmal ganz abgesehen.« Pearson stülpte kurz die Lippen nach innen, was immer ein untrügliches Zeichen für eine gesalzene Bemerkung war, die gleich kommen musste. Und sie kam auch.
»Mrs. Dobbs interessiert sich zwar ausgesprochen stark für jede Art von männlichen Wesen, aber leider fehlt ihr jeglicher Funken von Beobachtungsgabe. Dass sie sich ihres Mangels in keiner Weise bewusst ist, macht es nicht einfacher. Sie ist eine der schlechtesten Zeuginnen, die ich jemals befragen musste.« Pearson nahm einen großen Schluck Tee.
Norcott wechselte das Thema: »John, lassen Sie uns noch einmal über Ihr erstes Treffen mit dem Ehemann, William Henley, sprechen. Sie fanden sein Verhalten auffällig?«
Pearson nickte zustimmend. »Ich denke, wir kennen das alle. Wenn Polizei auftaucht, noch dazu am Arbeitsplatz, dann reagieren die Leute meistens erschrocken, manchmal abweisend oder sie sind nervös. Henley war ganz anders. Keine Frage im Stil von ›ist etwas mit meiner Frau? Ist meinen Eltern etwas zugestoßen?‹. Nichts. Ich glaube, er hat mein Erstaunen bemerkt und dann umgeschaltet und gefragt, ob zu Hause etwas passiert sei. Aber auch das klang für meine Begriffe nicht besorgt, sondern eher verärgert. Er hat versucht, es zu kaschieren, aber für mich schien es die ganze Zeit durch.« Pearson sprach nicht mehr, aber dachte sichtlich nach. Dann ergänzte er: »Als wenn von außen ein Schatten auf ein Fenster fällt. Ich hab es die ganze Zeit gespürt.«
Es herrschte einen Moment Stille in der Runde, bis Norcott das Schweigen brach. »Gut. Ich denke, wir sind uns einig: Das bringt ihn auf der Liste der Verdächtigen weiter nach oben. Aber ich will es genauer wissen. John, Ihr Job wird morgen sein, die bisherigen Erkenntnisse zu sortieren und fehlende Bestandteile aufzuarbeiten. Ergänzen Sie die Hintergrundinformationen zu den beiden Henleys, konzentrieren Sie sich ganz auf ihn. Ich will alles wissen, was es zu wissen gibt über diesen Mann.« Norcott blätterte noch einmal in seinen Unterlagen, bis er die richtige Notiz gefunden hatte. »Ja genau. Was uns schon in der Wohnung aufgefallen ist – dieses ständige Händekneten und Abwischen. Henley ist ständig mit seinen Händen beschäftigt. Ist Ihnen das auch in der Bank aufgefallen, John?«
Pearson überlegte einen Moment und antwortete dann zögernd: »Nein, kann ich nicht behaupten. Aber ehrlich gesagt, habe ich mehr auf sein Gesicht und den Tonfall geachtet. Vielleicht ist es ja auch nur ein Tick von ihm.«
Die andere mögliche Deutung, nämlich die, sich zwanghaft von etwas befreien zu wollen, was seine Hände befleckt hatte, sprach keiner aus. Sie alle wussten, worauf diese Deutung hingewiesen hätte.
Norcott nickte bedächtig. Er beugte sich vor. Leise sagte er: »Finden Sie’s raus. John. Finden Sie es heraus.« Nach einer Pause wandte sich Norcott an den Leitenden Kriminaltechniker: »Dann eine andere wichtige Sache. Roddy, konntet ihr Fingerabdrücke herausfiltern?«
Roderick Roddy Alleyn zog an seiner Calabash-Pfeife, schien aber mit dem Ergebnis unzufrieden. Er stocherte mit seinem Pfeifenbesteck im Kopf herum und jeder, einschließlich Norcott, wusste: Es war besser, jetzt Geduld zu haben. Roddy Alleyn wirkte für jeden Außenstehenden oft wie die Wurzel eines alten Olivenbaumes – verdreht und störrisch. Aber worauf es einem detailverliebten Perfektionisten wie Norcott ankam: Die Ergebnisse aus Alleyns Abteilung waren makellos. Ungenauigkeiten merzte er gnadenlos aus. Seine Techniker wussten ein Lied davon zu singen. Und in Probleme bohrte er sich mit derselben Beharrlichkeit wie eine Olivenwurzel in den kargen Sandboden Siziliens.
»Nachdem wir die Fingerabdrücke vom Ehepaar Henley, der Putzfrau und dieser Nachbarin, Mrs. Dobbs, ausgeschlossen hatten, blieben noch eine Menge brauchbarer übrig. Fast zu viel für meinen Geschmack.« Wieder ein tiefer Zug aus der Pfeife. »Es wäre gut, wenn wir noch die Abdrücke der Familie bekommen könnten oder wer sonst noch regelmäßig in der Wohnung verkehrte.« Der Satz war mit einem spürbaren Fragezeichen versehen.
Norcott nickte Haydon zu. »Kümmern Sie sich darum.« Der Constable macht sich eine entsprechende Notiz.
»Die Interessantesten«, ergänzte Alleyn, »besonders die Abdrücke, die wir ausschließlich an der Wohnungstür und im Schlafzimmer gefunden haben, können Sie gleich haben.«
Norcott wandte sich wieder Haydon zu. »Teilen Sie Constable Lancer für den Abgleich der Fingerabdrücke ein. Er soll mit den Tätern anfangen, die wegen Sittlichkeitsdelikten vorbestraft sind, dann die Gewalttäter, dann die Einbrecher. Außerdem möchte ich, dass die Gruppe notorischer Wiederholungstäter auch mit einbezogen wird, gleichgültig wofür sie vorbestraft sind.«
Haydon seufzte bei dieser Vorstellung. Der Vergleich von vielleicht zwei Dutzend Fingerabdrücken mit jeweils hunderten von Karteikarten war echte Sklavenarbeit, die überdies noch mit äußerster Genauigkeit durchgeführt werden musste. Er nickte wieder und machte auch hierzu eine Notiz.
Damit waren für den Moment alle Aufgaben verteilt und Norcott war schon aufgestanden, da sprach Mulgrave ihn noch einmal an.
»Was machen wir mit den Zeugen, die Mrs. Henley mit anderen Männern gesehen haben? Mr. Woolton und Mrs. Dobbs? Wir sollten die Fotos der einschlägig Vorbestraften mit ihnen durchgehen, finden Sie nicht, Sir?«
»Ja, natürlich, das sollten wir wohl. Wäre ein gottverfluchter Zufallstreffer, aber Sie haben recht, Clive. Nur keine Option offenlassen. Sorgen Sie dafür, dass das morgen im Laufe des Tages passiert? Danke.«
* * *
Der Chief Inspector hatte sich nach der Besprechung in sein Büro zurückgezogen. Er wollte noch einmal alle Fakten durchgehen, um keinen Aspekt zu übersehen, kein Detail unbeachtet zu lassen. Sie war sofort wieder da, die alte Sucht nach Perfektion, seine Besessenheit. Der Drang, sich in den Fall zu verbeißen, dem Täter gnadenlos näher zu rücken, den Zwang, den er nicht unterdrücken und nur mit äußerster Anstrengung kanalisieren konnte. Und Norcott kannte auch die Nebenwirkungen: Nervosität und Perfektionismus, eine Mischung, die Mitarbeiter zum Wahnsinn trieb.
Er strich sich, wie immer, wenn er nervös war, durch die Haare. Dabei sah er auf die Uhr und musste auf einmal lachen. Es war weit nach neun Uhr und ihm fiel gerade ein, dass er noch gar nicht wusste, wo er übernachten sollte.
Wie auf ein Stichwort klopfte es kurz und Sergeant Pearson schaute herein.
»Entschuldigung, Chief, die meisten haben für heute Feierabend gemacht und ich wollte fragen, ob Sie mich noch brauchen?«
Norcott winkte ihn herein. »Ganz kurz noch, John«, er grinste verlegen. Wieder das Streichen über sein Haar. »Ich habe gar nicht an ein Bett für heute Nacht gedacht.«
Aber ich, sagte das Lächeln, mit dem Pearson antwortete. »Ich habe mir die Freiheit genommen, ein bisschen vorzusorgen. Im Hotel ›Guillaume de Beauvoir‹ ist ein Zimmer reserviert.«
»Danke, John«, erwiderte Norcott erleichtert. »Ich hatte mich schon gefragt, ob überhaupt noch Hotels geöffnet sind. Urlauber gibt es wohl keine mehr auf der Insel?«
»Leider nein.« Pearson nickte. »Viele Hotels haben schon vor Wochen geschlossen. Einzelne, wie das Beauvoir, halten sich mit Flüchtlingen, vor allem aus Frankreich und Belgien, über Wasser. Aber wie das Ganze weitergehen soll …« Der Sergeant zuckte mit den Achseln und verstummte.
Was die kommende Finsternis für sie alle bereithielt, das wollte sich Norcott nicht vorstellen. Für heute Nacht freute er sich einfach nur noch auf ein bequemes Bett, etwas Warmes zu essen und vielleicht auch auf einen Whisky. Weitere Zukunftsgedanken würde er auf morgen verschieben. Er schlug mit Entschiedenheit die vor ihm liegende Akte zu. »Kommen Sie, John. Es ist fast zehn. Schluss für heute!«
Kapitel 4
St. Peter Port, Polizeizentrale
Freitag, 21. Juni 1940, morgens
Normaler Dienstbeginn in der Hospital Lane war um sieben Uhr. Gewöhnlich war das Arbeitstempo der Beamten, speziell morgens, eher gemächlich. Dies schien sich seit gestern komplett verändert zu haben. Bereits um zwanzig Minuten vor sieben trafen die ersten Constables ein und auch Sergeant Mulgrave war schon seit halb sieben im Büro. Der ältere Sergeant vom Dienst, der die Nacht über Bereitschaft gehabt hatte, beobachtete stirnrunzelnd das geschäftige Treiben um sich herum. Eine Aufregung, als wenn der König auf Besuch käme, dachte er bei sich. Als Constable Lancer dann noch mit einer Kanne duftenden Inhaltes vorbeistrebte, zog er endgültig die Augenbrauen in die Höhe.
»Lancer, was zur Hölle ist das?«
»Kaffee, Sergeant. Starker heißer Kaffee zum Wachwerden. Möchten Sie einen Becher?« Er strahlte und hob einladend die Kanne.
Der Sergeant hob zweifelnd die Augenbrauen. Er war sich sicher, dass bei dieser Truppe von neu entstandenen Frühaufstehern nichts so überflüssig war wie Kaffee zum Wachwerden, behielt diesen Gedanken aber für sich.
»Nein, schönen Dank, Lancer«, sagte er milder. »Ich hab gleich Schichtende und werde mich dann in mein Bett legen.«
Um zehn Minuten vor sieben betrat Charles Norcott das Gebäude. Seine latenten Rückenschmerzen hatten dank eines guten Hotelbettes nachgelassen. Auch zwei großzügige Portionen eines überirdisch guten schottischen Whiskeys hatten ihre Wirkung getan. Den Morgen begann Norcott optimistisch und voller Entschlossenheit. Auch wenn er gestern bereits das Jagdfieber der Männer gespürt hatte, war der Chief Inspector doch überrascht, auf dem Weg zu seinem Büro die Stimmung so überdeutlich spüren zu können.
Da und dort standen Männer zu zweit oder zu dritt zusammen und diskutieren ganz offensichtlich lebhaft den Fall. Eine leise innere Stimme warnte Norcott zwar weiter vor Übereifer, aber auch in ihm stieg das lange vermisste Jagdfieber auf. Er konnte nachfühlen, dass die meisten von ihnen nicht Polizist geworden waren, um bis ans Dienstende verirrten Urlaubern den Weg zu weisen oder auf der Promenade Taschendieben hinterherzujagen.
Leider nahm der täglich wachsende Papierkrieg keinerlei Rücksicht auf seinen neuen Fall und so wusste Norcott, er würde sich heute dem Berg Papier widmen müssen, der sich auf seinem Schreibtisch türmte. Vorher wollte er aber unbedingt, wenigstens kurz, mit den beiden Detective Sergeants sprechen. Der Mordfall Nora Henley war mittlerweile knapp achtzehn Stunden alt.
Er traf beide in ihrem gemeinsamen Büro an, das im selben Flur lag wie sein eigenes. Nach der knappen Begrüßung zog sich Norcott einen der betagten Besucherstühle heran. »Sie beide sehen nicht aus, als wäre heute Nacht etwas Bahnbrechendes vorgefallen.«
Auch wenn es eher eine Feststellung als eine Frage gewesen war, verneinten beide Männer.
Norcott lächelte. »Offen gesagt hatte ich auch wenig Hoffnung, dass der Täter die Güte haben würde, sich zu stellen. Also werden wir heute dort weiterarbeiten, wo wir gestern aufgehört haben.« Er seufzte.
»Ich beneide Sie nicht um das, was Sie in Ihrem Büro erwartet, Chief.« Mulgrave lächelte mitfühlend.
Norcott zuckte mit den Achseln. »Es hilft ja nichts, Clive. Die Evakuierungen werfen jeden Tag neue Fragen auf. Tausende jetzt unbewohnte Wohnungen und Häuser, allein gelassenes Vieh …« Er hob in einer hilflosen Geste die Hände. »Für das alles gibt es keine Planungen. Nicht einmal Ansätze zur Planung.«
»Bis hin zu der Frage«, ergänzte Pearson, »wie wir mit deutlich weniger Personal auskommen sollen.«
Die Polizei der Kanalinseln war auf die Bevölkerung von knapp 100.000 Menschen ausgerichtet. Die Kriminalität, die mit den zahlreichen Feriengästen auf die Insel kam, im Wesentlichen Taschendiebstahl und Ruhestörungen, wurde durch die fast vollständige Abwesenheit von Gewaltverbrechen aufgewogen. Bestimmte Delikte, etwa Autodiebstahl kam überhaupt nicht vor. Wohin sollte man mit einem gestohlenen Wagen auch fahren? Nun war zwar durch die Evakuierungen die Bevölkerung geschrumpft und der Fremdenverkehr zum Erliegen gekommen, aber ganz neue Probleme forderten Aufmerksamkeit. Flüchtlinge, vor allem aus Frankreich, die versuchten, Hitlers Armeen zu entkommen, trafen täglich mit kleinen und kleinsten Booten ein. Viele hatten kaum Nahrung bei sich, die Versuchung in leer stehende Häuser einzudringen, war groß.Der Chief Inspector erhob sich von seinem Stuhl. »Hat keinen Sinn, Trübsal zu blasen. Wir müssen es durchstehen.«
»Aye, Chief!« Beide Sergeants nickten, aber die Nachdenklichkeit blieb.
Zurück in seinem Büro widmete sich Norcott zunächst den Dienstplänen. Es würde eine Menge Erfindungsreichtum dazu gehören, mit weniger Kräften umfangreichere Aufgaben zu lösen. Das begann bei Norcotts eigenem Schreibtisch. Sein bisheriger Stellvertreter auf Guernsey, ein junger Detective Inspector, war Reserveoffizier der Royal Military Police und hatte schon am Mittwoch die Insel mit den Truppen verlassen. Seither hatte es keinen Polizeioffizier mehr auf Guernsey gegeben. Norcott setzte sich an seinen Schreibtisch und überflog die obersten Papiere. Dienstplanentwürfe der nächsten Wochen, alle Arten von Verwaltungspapieren, zu denen er als leitender Polizeibeamter Stellung nehmen sollte und, immer wieder, offene Fragen der Evakuierung.
* * *
Ein lautes Klopfen ließ Charles Norcott aus seinen Gedanken aufschrecken. Sergeant Pearson stand mit leicht schuldbewusstem Gesicht in der Tür. »Entschuldigung, Chief, ich hatte schon zweimal geklopft, aber Sie haben mich wohl nicht gehört.«
»Macht nichts, John, kommen Sie. Was kann ich tun?«
»Oh, die Zeichnerin ist gerade gekommen, Miss Rhys-Lynch. Clive Mulgrave hat sich vorhin noch darum gekümmert, bevor er in die Parnell Road gefahren ist. Mr. Franoux, unser alter Phantomzeichner hat sich evakuieren lassen und … ach, sie wird es Ihnen sowieso selbst erzählen. Ich wollte sie Ihnen kurz vorstellen?«
Norcott hätte auch darauf verzichten können, die Phantomzeichnerin persönlich kennenzulernen, aber ihm war jede Unterbrechung seines Papierkrieges willkommen. »Ja, John. Sicher.«
Pearson öffnete die Bürotür. »Miss Rhys-Lynch? Bitte entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten. Detective Chief Inspector Norcott würde Sie jetzt gern kennenlernen.«
Die junge Frau, die jetzt sein Büro betrat, war eine wirkliche Erscheinung. Sie war nur unwesentlich kleiner als Norcott selbst und überragte Sergeant Pearson um mindestens einen halben Kopf. Die kinnlangen, weißblonden Haare lagen in weichen Wellen um ein ebenmäßiges Gesicht, das von strahlenden, meerblauen Augen dominiert wurde. Sie hielt ihre schlanke Hand ausgestreckt und lächelte ihn gewinnend an.
»Chief Inspector, Vicky Rhys-Lynch – mit drei Ypsilon. Schön, Sie kennenzulernen, wenn auch vielleicht nicht …«
»Nicht unter diesen Umständen«, ergänzte Norcott leicht stockend, der immer noch ihre Hand festhielt. »Ja, Mrs. Rhys-Lynch, ich kann …«
»Miss, bitte.«
»Entschuldigung, Miss Rhys-Lynch …«
»Sagen Sie doch einfach Vicky, Chief Inspector. Das macht vieles einfacher.« Sie sprach mit einem kaum wahrnehmbaren walisischen Akzent. »Sie können mir übrigens jetzt meine Hand zurückgeben.«
Norcott musste lachen. »Bitte entschuldigen Sie, Miss …«
»Vicky.«
»Vicky ja. Bitte entschuldigen Sie nochmals, ich war gerade vertieft in diese Papiere.« Er machte eine Geste über die Papierberge. »Bitte setzen Sie sich doch einen Moment. Darf ich Ihnen einen Tee bringen lassen?«
»Offen gesagt, Chief Inspector, ein Kaffee wäre mir lieber. Ich konnte mit Tee noch nie etwas anfangen. Sehr unbritisch, in der Tat.«
Norcott sah zu Pearson, der nickte und dann das Büro verließ.
»Ihr Mr. Mulgrave rief heute Morgen in der Schule an und schien einigermaßen konsterniert, dass sich Mr. Franoux zum Festland aufgemacht hat. Nun, Sie haben ja wohl noch einen Mörder zu fangen, machen wir es also kurz. Ich bin ausgebildete Kunsterzieherin, zur Künstlerin hat es damals nicht gereicht. Ich habe versucht, mein Geld damit zu verdienen, kleinen Mädchen und Jungen so etwas wie Sinn für Stil und Kunst beizubringen, bis eine entfernte Tante sich entschloss zu sterben, rechtzeitig bevor ich im Schuldienst alt und grau werde. Sie hat mir ein Cottage hier vermacht und ein bisschen Geld und so habe ich dem Schuldienst adieu gesagt und widme mich wieder dem Malen.«
Ein Constable brachte den Kaffee und so hatte Miss Rhys-Lynch Zeit, Luft zu holen. Norcott, der immer noch damit beschäftigt war, ihre blauen Augen zu bewundern, wartete auf die Fortsetzung.
»Wo war ich? Ach ja. So hat es mich also von Aberystwyth hierher verschlagen. Nachdem sich viele Lehrkräfte haben evakuieren lassen, wir aber immer noch einen Haufen Kinder hier haben, hatte ich angeboten, wieder zu unterrichten. So bin ich quasi die Nachfolgerin oder der Ersatz für Mr. Franoux. Und wenn Sie wollen, versuche ich auch seine Aufgabe hier zu übernehmen.«
Charles Norcott musste sich eingestehen, dass er fasziniert war. Natürlich war sie eine wirklich attraktive Frau, aber es war vor allem die Energie, die sie versprühte. Er war bereits jetzt überzeugt, dass es nur wenige Herausforderungen gab, vor denen Vicky Rhys-Lynch kapitulieren würde.
Ms. Rhys-Lynch kniff ein wenig die Augen zusammen und beugte sich zu Norcott vor. »Chief Inspector, Sie haben da sicher mehr Erfahrung, aber sollten wir nicht vielleicht jetzt mit den Zeichnungen anfangen?« Ihr energiegeladenes Lächeln war so bezaubernd und völlig ohne Arg – Norcott streckte die Waffen.
Er holte Atem. »Bitte entschuldigen Sie, Vicky, ich halte Sie hier die ganze Zeit im Gespräch fest.« Norcott stand entschlossen auf. »Nein, bitte warten Sie doch einen Moment hier. Ich werde sehen, ob schon beide Zeugen bereitstehen. Es wäre mir wichtig, dass Sie mit den beiden Zeugen getrennt arbeiten.«
»Mmm, ich verstehe, Sie befürchten gegenseitige Beeinflussung.«
Norcott nickte und öffnete seine Bürotür. John Pearson, der im Büro schräg gegenüber saß, sprach dort mit einem stämmig gebauten Mann im Tweed-Anzug. Als er Norcott sah, nickte er ihm zu und entschuldigte sich bei dem Mann.
»Das ist Roger Woolton, Chief. Wir könnten mit ihm gleich anfangen, falls Miss Rhys-Lynch bereit ist?«
»Was ist mit Mrs. Dobbs?«, fragte Norcott zurück. »Haben wir sie erreicht oder ist sie schon hier?«
Sergeant Pearson räusperte sich bei der Erwähnung der Zeugin. »Ja, sie ist hier. Constable Lancer geht seit einer halben Stunde mit ihr unsere Fotoalben durch. Er gibt wirklich sein Bestes. Aber«, er hüstelte leise, »nun, sie ist wirklich anstrengend. Der Junge kann einem leidtun.«
Norcott nickte zur Bestätigung. »Wo sitzen die beiden?«
»Im Besprechungsraum 2. Soll ich mich dann mal um Mr. Woolton und Miss Rhys kümmern?«
»Ja bitte, John, übernehmen Sie das. Miss Rhys, ähm … Vicky muss auch noch ein bisschen eingewiesen werden.« Er drehte sich um. »Vicky. Kommen Sie? Wir würden gern mit Mr. Woolton hier anfangen.«
Norcott streckte sich und versuchte, den Rücken zu dehnen, während er der kleinen Gruppe hinterher sah, die in Pearsons Büro verschwand. Er sehnte sich plötzlich nach einem starken Kaffee. Etwas zu essen, wäre auch eine gute Idee, dachte er sarkastisch. Sein Frühstück hatte mal wieder nur aus einer schnellen Tasse Tee bestanden und er musste sich nicht erst Dr. Hamiltons Ermahnungen ins Gedächtnis rufen, um ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Er straffte sich. Jetzt wollte er sich erst einmal Mrs. Dobbs ansehen. Er ging den Flur entlang und öffnete die Tür zum Besprechungsraum. Lancer sah sofort hoch, als er die Tür hörte, während Mrs. Dobbs wie gebannt auf die Fotoalben starrte.
Norcott ging auf sie zu und streckte ihr mit einem freundlichen Lächeln die Hand entgegen. »Guten Tag, Mrs. Dobbs. Ich bin Chief Inspector Norcott. Ich leite die Ermittlungen im Fall Nora Henley.«
Im ersten Moment wirkte es so, als könne sich die Angesprochene nicht von den Bildern lösen, dann wandte sie sich aber doch Norcott zu. Wieselflink, bemerkte er, wanderten ihre Augen über sein Äußeres. Für einen kurzen Moment hatte der Chief Inspector das Gefühl, taxiert zu werden. In einer Art, in der man ein altes Pferd taxiert, um zu entscheiden, ob es sein Futter noch wert sei. Mrs. Dobbs trug ein Sommerkleid mit großen Blüten in Pastellfarben. Es wirkte betont jugendlich und war etwas zu knapp für die leicht füllige Zeugin. Sie gaben sich die Hand und Mrs. Dobbs schenkte dem Kriminalbeamten ein Lächeln. Ein Lächeln, das eine Spur zu freundlich war und doch kalt wirkte. Wieder glaubte Norcott, Berechnung spüren zu können.
»Mrs. Dobbs, zunächst vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir sind uns bewusst, was für ein Schock der Tod Ihrer Nachbarin für Sie sein muss.«
Ihre Miene veränderte sich pflichtschuldigst. Mechanisch bewegten sich die Mundwinkel nach unten, züchtig wurden die Augen niedergeschlagen. Mrs. Dobbs schaffte es, in den Sätzen, die folgten, alles einzuschließen: Ihre Bestürzung über den Tod ihrer ach so geschätzten Nachbarin, die Befürchtung, sicher das nächste Opfer des Killers zu werden und ihre Bereitschaft, der Polizei tapfer und selbstlos zu helfen.
Norcott hörte kaum auf den Inhalt ihres Geplappers. Er wusste instinktiv, dass nichts davon echt und ehrlich war. Es schoss ihm durch den Kopf, dass allein Mrs. Dobbs’ Stimme nicht so perfekt zu der Vorstellung passte, die hier gerade gegeben wurde. Sie war zu schrill. Auf eine irrationale, unlogische Art schien es Norcott, als ob diese Stimme das einzig ehrliche an dieser Frau war. Trotzdem mussten sie versuchen, alle eventuell vorhandenen Informationen aus ihr herauszubekommen.
»Mrs. Dobbs, wir sind Ihnen für Ihre Mithilfe wirklich dankbar. Es kann für uns eine wichtige Hilfe sein, falls Sie einen Verdächtigen wiedererkennen würden.« Norcott ließ seine Stimme leiser werden und gab ihr einen verschwörerischen Unterton. »Zeit, Mrs. Dobbs, ist für uns bei einem Kapitalverbrechen immer der wichtigste Faktor. Die ersten Stunden und Tage nach der Tat sind entscheidend. Es wäre uns daher höchst willkommen, wenn Sie sich – bei aller notwendigen Sorgfalt – die Bilder möglichst zügig ansehen könnten.«
Ohne ihr die Chance einer Antwort zu geben, sagte Norcott: »Constable, sobald Mrs. Dobbs mit den Fotoalben fertig ist, fragen Sie bitte Sergeant Pearson, ob die Zeichnerin für das Phantombild schon frei ist. Mrs. Dobbs«, er reichte ihr die Hand, »nochmals vielen Dank für Ihre Mithilfe.«
Norcott widerstand auf dem Weg zurück in sein Büro der Versuchung, in Pearsons Büro hineinzuschauen um der neuen Zeichnerin über die Schulter zu sehen. Zufrieden mit sich, gab er einer anderen Versuchung nach. Er bog in die Teeküche ab und nahm einen Becher Kaffee mit.
Kapitel 5
St. Peter Port, Polizeizentrale
Freitag, 21. Juni 1940, Mittag
Es war weit nach ein Uhr, bis Sergeant Pearson wieder an Norcotts Bürotür klopfte. Der Chief Inspector warf seinen Bleistift auf die Akten und winkte seinen Sergeant erleichtert herein. »Kommen Sie, John. Wie sieht’s aus?«
Pearson setzte sich auf einen der Besucherstühle und rieb sich über die Augen. »Wie Sie wohl schon erwartet hatten, ist bei der Zeichnung mit der Hilfe von Mrs. Dobbs nicht viel herausgekommen. Miss Rhys hat wirklich eine Engelsgeduld bewiesen, aber letztendlich, wir wussten ja, dass die Dobbs diesen Soldaten oder was immer er war, nur kurz und nur im Profil gesehen hat.« Pearson zuckte mit den Schultern.
Norcott nickte. »Was ist mit der anderen Zeichnung?«
Als Antwort entrollte Sergeant Pearson ein großes Zeichenblatt und Norcott pfiff leise durch die Zähne. »Alle Wetter, John. Das sieht ja fast wie ein Foto aus!« Er streckte die Hand aus, als wolle er das Bild berühren. »Wirklich gute Arbeit!« Er war ehrlich begeistert. Falls dieser Mann noch auf der Insel war, dann würden sie ihn mit diesem Bild auch finden.
Pearson lächelte zufrieden. »Mit dieser Qualität können eine Menge der hauptberuflichen Polizeizeichner im Yard nicht mithalten, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Miss Rhys ist ein absoluter Glückstreffer. Wobei auch Mr. Woolton ein idealer Zeuge ist. Clive hatte ganz recht bei seiner Beurteilung.« Er rollte das Blatt wieder zusammen und stand auf. »Wenn Sie keine andere Anweisung für mich haben, würde ich das Bild dann jetzt zum Abfotografieren und Vervielfältigen an Roddy geben?«
»Ja, John, machen Sie das. Und dann das Übliche, Streifenbeamte, Hafenbehörde, öffentliche Dienststellen und so weiter.« Er sah auf die Uhr. »Haben Sie schon gegessen, John?«
»Nein, Sir, ich wollte gleich runter zu Largo’s am Hafen auf eine Portion Fish’n’Chips. Möchten Sie mitkommen?«
Norcott, der normalerweise kein Liebhaber der fettigen Fischspezialität war, nickte. Largo’s war ein kleiner Stand direkt am Hafen, der nur tagesfrischen Fisch anbot und dessen Qualität unschlagbar war. Der Stand war derart beliebt, dass man munkelte, der Besitzer sei mittlerweile Millionär.
Viele der Angestellten hatten Mittagspause und so dauerte es eine Weile, bis sie bei Largo’s an der Reihe waren. Der nahezu kugelrunde Verkäufer strahlte, er schien Pearson zu kennen.
»Mr. Grantly, einen schönen Tag für Sie«, begrüßte Pearson den Mann. »Wir hätten gern zwei Portionen mit allem bitte.«
»Eine gute Wahl, Sergeant! Zweimal Fish’n’Chips mit Erbsenbrei und eingelegten Zwiebeln, kommt sofort. Mit Mayonnaise die zwei?«
»Mit allem, was Sie uns Gutes zu bieten haben, Mr. Grantly!«
Sie bezahlten, während der runde Mr. Grantly die Pappschalen mit den großzügigen Portionen hinüberreichte. Die Sonne schien an einem makellos blauen Himmel und so beschlossen sie, ihr Essen mit dem Blick auf den Hafen zu genießen. Nicht weit entfernt lag die große Hafenmole. Wie an jedem Tag während der Erntezeit staute sich eine endlos scheinende Reihe von Lkws. Vor allem Tomaten, aber auch anderes Gemüse und Blumen wurden nach England exportiert.
»Das wird uns vielleicht noch leidtun«, sagte John Pearson unvermittelt.
Norcott, der einen Moment lang die Lider geschlossen hatte, um die Sonne zu genießen, war überrascht. »Was meinen Sie?« Er öffnete die Augen und schaute in die Richtung, in die der Sergeant sah.
»Na, das.« Pearson machte mit seiner Holzgabel eine Bewegung in Richtung Hafenmole. »Das alles.« Und als sein Vorgesetzter nicht antwortete, sagte er: »Sehen Sie sich den Hafen doch einmal genau an. So wie Sie einen Tatort betrachten würden. Schauen Sie auf die Zeichen.«
Norcott schwankte für einen Moment zwischen Amüsiertheit und Ärger. Übersah er wirklich Dinge, die vor seinen Augen passierten? Die Lkws, gelangweilte Fahrer, die sich die Beine vertraten und schwatzten. Fischerboote, die am Kai vertäut waren. Die flachen Gebäude der kleinen Fabriken, die am Rande des Hafens standen. Er wollte schon die Achseln zucken, als eine kleine Gruppe Menschen aus der Stadt kommend auf die Mole und an den Lkws vorbeilief.
»Sehen Sie«, sagte Pearson, »noch mehr Leute, die wegwollen. Jede Stunde verlassen mehr Menschen die Insel.«
Norcott kannte die Meldungen. Jeder, der die Insel verließ, musste sich bei der Verwaltung abmelden. Er wollte gerade etwas antworten, als Pearson seine Gedanken unterbrach.
»Und da sehen wir auch gleich die Folgen!«
»Tut mir leid, John, aber ich weiß wirklich nicht …«
»Sehen Sie sich die Lkw-Fahrer mal genauer an. Die Hälfte davon sind Frauen. Die Frauen und Töchter der Bauern fahren jetzt, weil die meisten Erntearbeiter und Fahrer zur Armee eingezogen wurden.«
Jetzt bemerkte auch Norcott die Frauen, die zwar alle Hosen und viele von ihnen Kappen trugen, aber bei genauerem Hinsehen doch zu erkennen waren.
Pearson ließ nun seinem Ärger freien Lauf. »Jeden Tag gehen uns junge kräftige Männer verloren. Zurück bleiben die Alten und Kranken. Und die Frauen, es muss sich ja jemand um die Alten kümmern. Sehen Sie die Fischerboote? Was tun die hier, jetzt um diese Tageszeit? Es ist Flut, die Sonne scheint. Liegen alle an der Kette wegen Treibstoffmangel. Hinten rechts die Fischkonservenfabrik. Kein Rauch aus dem Schornstein. Warum? Kurzarbeit, weil kein Weißblech für die Dosen mehr geliefert wird. Tee wird in den Geschäften nur noch Halb-Pfund-weise verkauft, Kaffee gibt es in einigen Läden gar nicht mehr zu kaufen. Ich wollte gestern ein paar Schnürsenkel kaufen. Ein Paar gottverdammte schwarze Schnürsenkel. Ausverkauft wegen Lieferengpässen. Produziert und geliefert wird ans Militär. Und im Gegenzug? Was machen wir? Liefern unser Gemüse weiter brav wie die Lämmer ans Festland ab.« Pearson atmete ein paarmal betont ein und aus und lächelte dann ein wenig. »Tut mir leid, Chief. Ich wollte Ihnen nicht die Mittagspause verderben.«
»Machen Sie sich darüber keine Gedanken, John. Denken Sie nicht, ich würde mir nicht mindestens genauso große Sorgen machen.« Grinsend fügte er hinzu: »Auch wenn mir vielleicht der Blick für die speziellen Inselgegebenheiten noch fehlt.«
Die beiden Männer warfen die Pappschalen in einen Mülleimer und schlugen den Weg Richtung Hospital Lane ein. Norcott nahm den Faden wieder auf: »Sie haben ja Recht mit Ihren Sorgen. Wir haben nach Schätzungen der Verwaltung ungefähr fünf- bis siebentausend leer stehende Wohnungen und Häuser. Von der Mehrzahl dieser Wohnungen wissen wir wenig bis nichts. Wir wissen nicht, was die Evakuierten zurückgelassen haben – vom Essen in der Speisekammer bis zu Haustieren, offen herumliegenden Wertsachen – weiß der Teufel, was für Überraschungen da noch auf uns warten! Daneben haben wir zwei leere, unbewachte Kasernen und einen leeren und unbewachten Flugplatz. Und das ist erst der Anfang. Denn über eines müssen wir uns im Klaren sein: Dieser Krieg kann dauern und wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass die Nazis uns mal eben so mit verpflegen, gleichgültig ob sie nun herüberkommen oder nicht. Also werden wir zusehen müssen, alle Ressourcen zu registrieren und bestmöglich zu nutzen. So lächerlich es klingt, aber die Verwaltung wird in den Gärten der verlassenen Häuser nach Obstbäumen suchen müssen und schauen, wo zum Beispiel brauchbare Gewächshäuser stehen.« Norcott blieb einen Moment stehen und sah den Sergeant mit ernstem Gesicht an. »Und ich hatte heute die erste offizielle Anfrage der Zivilverwaltung, ihnen hierfür Beamte zur Verfügung zu stellen.«
John Pearson blies die Backen auf. »Aber das sind doch Aufgaben der Verwaltung. Kümmern die sich denn nicht darum?«
»Natürlich ist das Aufgabe der Verwaltung. Aber wenn die dann gezwungen sein werden, in Privathäuser einzudringen, Türen aufzubrechen, Dinge womöglich im großen Stil zu beschlagnahmen, wer wird dann mit Sicherheit dabei sein? Und was ist, wenn die Verwaltungshengste die Probleme nicht in den Griff bekommen? Was ist, wenn die Deutschen sich Zeit lassen mit der Besetzung und der Winter kommt? John, wenn Sie meine Meinung hören wollen – wenn ich Hitler wäre, würde ich mich nicht mit ein paar Felsen im Kanal aufhalten. Ich würde direkt nach Kent übersetzen!«
Pearson schien nachdenklich. Er war bei der unangenehmen Vorstellung, bald unter Nazi-Herrschaft leben zu müssen, überhaupt nicht auf die Idee gekommen, die Deutschen könnten sich vielleicht direkt mit dem Kuchen beschäftigen und die Krümel einstweilen liegen lassen.
»John, ich bin kein Politiker und ich möchte auch keiner sein. Offen gesagt, habe ich nicht einen Funken Sympathie für die Allermeisten. Vielleicht steht mir diese Meinung nicht zu, ich schulde der Regierung seiner Majestät Loyalität, aber bei aller Zurückhaltung kann man doch wohl festhalten, dass wir hier ganz schön allein gelassen worden sind. Nach dem Fall von Paris konnte man sich doch gar nicht schnell genug zurückziehen! Wie wir hier dann hinterher klarkommen, darüber hat sich in der Hast doch niemand wirklich Gedanken gemacht.«
Kapitel 6
St. Peter Port, Stadtzentrum
Freitag, 21. Juni 1940, später Nachmittag
Der Mann betrat die Telefonzelle, nachdem er sich eine ganze Weile vergewissert hatte, nicht beobachtet zu werden. Kein bekanntes Gesicht war in der Nähe zu sehen. Die Zelle lag für seine Zwecke ideal in einer ruhigen Sackgasse im Zentrum von St. Peter Port. Die meisten umliegenden Häuser waren Hintereingänge von Geschäftshäusern, die an einer parallel verlaufenden Hauptstraße lagen. Er hob ab und gab der Vermittlung eine Londoner Nummer, dann warf er das verlangte Kleingeld in den Apparat. Es klingelte nur zweimal, bevor am anderen Ende abgehoben wurde. Eine Männerstimme meldete sich mit der Nennung der Telefonnummer.
Der Mann in der Zelle sagte: »Hier Griffin.«
»Schön, von Ihnen zu hören, altes Haus«, wurde fröhlich-vertraulich am anderen Ende geantwortet. Der harmlose Tonfall war Teil der Tarnung und sollte allzu neugierige Vermittlungsdamen vom Zuhören abhalten. Falls sich jemand in die Leitung einschaltete, hörte er nur das langweilige Geplauder zweier Geschäftspartner.
»Wollte mal nachfragen, ob weiter Interesse besteht, dass ich die Firma hier unten vertrete«, fragte Griffin.
»Aber natürlich, alter Junge. Dachten Sie, weil die Burschen von der anderen Firma bald bei Ihnen auftauchen, haben Ihre Kunden keinen Bedarf mehr?«
»Nun, die Lieferanten aus Frankreich werden jedenfalls so schnell nicht wieder auf dem Markt auftauchen«, wandte der Mann in Guernsey ein. »Und außerdem«, er senkte die Stimme noch ein wenig weiter, »vielleicht ist die ›andere Firma‹ schneller bei Ihnen als bei mir.«
Der Mann am anderen Ende schien einen Moment verstört. »Nun, ähm, man muss ja nicht gleich mit dem Schlimmsten rechnen, nicht?« Nach einem Moment fuhr er fort. »Aber hören Sie, wir bekommen gerade Berichte über spannende neue Ideen für ganz neue Programme aus Irland. Wir haben das Gefühl, da bahnt sich eine völlig neue Lieferkette an.«
Es herrschte einen Moment Stille, während Griffin nachdachte. »Vielleicht keine ganz neue Idee. Hatten wir nicht schon einmal so einen Versuch?«
Bei der Antwort klang der zweite Mann ernster. »Wiederholungen sind langweilig, möchte man sagen, aber ich fürchte im Ernst, dass beide Seiten seitdem ein Stück professioneller geworden sind.«
Wieder herrschte einen Moment bleierne Stille in der Leitung, bis Griffin leise hinzufügte: »Oder eine Spur gewissenloser.« Wieder eine kleine Pause. »Okay. Ich werde hierbleiben und mir die neue Firma ansehen, sofern sie auftauchen.«
Der Mann am anderen Ende war merklich erleichtert. »Danke, alter Junge. Ich bin mir bewusst, dass das nicht in unserem Vertrag steht. Noch eine andere Sache. Natürlich freue ich mich immer, wenn wir miteinander telefonieren, aber das wird in Zukunft nicht mehr so leicht werden, denken Sie nicht auch? Ich würde Ihnen gern in den nächsten Tagen einen Vertreter deswegen vorbeischicken.«
»Ja, versteh schon. Wir modifizieren die Verbindung etwas. Wann können Ihre Jungs kommen? Vielleicht kann ich so bald keinen Besuch mehr empfangen.«
Der Mann in London räusperte sich. »Nun ja, ich will Sie nicht mit den Einzelheiten langweilen, aber die Transportorganisation ist hier noch verbesserungsfähig. Falls bis dahin kein Besuch gekommen ist, rufen Sie mich zum nächsten Termin wieder an. Und Griffin … wenn die Konkurrenzlage zu gefährlich wird, schicke ich Ihnen ein Taxi!«
»Ich melde mich dann«, war die knappe Antwort.
Das Gespräch wurde beendet und Griffin verließ die Telefonzelle. Er steckte sich einigermaßen umständlich eine Zigarette an und blickte sich dabei unauffällig in der Sackgasse um. Gut, Sie würden ihm also eine andere Verbindungsmöglichkeit schaffen, wahrscheinlich einen Kurzwellensender. Aber wieso, zum Teufel, war es so schwer, das jetzt noch zu erledigen? Wenn die Inseln erst von den Nazis besetzt waren, würde alles viel schwieriger werden. Der Mann versuchte durchzuatmen und seine Gedanken zu ordnen. Er konnte im Moment nichts tun, als abzuwarten und hier weiter seinen Beobachtungen nachzugehen. Er wartete, still und geduldig, wie ein Reiher in einem Teich. Irgendwann würden die Fische sich bewegen. Er zog noch kurz an der grauenvollen Zigarette und trat sie dann angewidert aus. Dabei huschte sein Blick wieder durch die Sackgasse und die Hauseingänge. Als er mit dem Ergebnis zufrieden war, bog er in die lebendigere Hauptstraße ein und war schnell zwischen den Menschen verschwunden.
Kapitel 7
St. Peter Port, Polizeizentrale
Samstag, 22. Juni 1940, gegen neun Uhr
Der frühe Samstag kleidete sich in feuchtes Grau. Ein träge fließender Ärmelkanal schickte seine morgendlichen Nebelschwaden noch bis tief in die Straßen der Stadt und der wenige Sonnenschein hielt sich trüb hinter den Wolken. Norcott hatte sich zu einem kurzen Frühstück gezwungen und war dann doch schon gegen acht Uhr früh in der Hospital Lane eingetroffen. Ein kurzes Gespräch mit dem diensthabenden Sergeant der Nachtschicht ergab nichts Neues. Die Nacht war gespenstisch ruhig, Straßen und Pubs waren menschenleer gewesen. Die schwebende Kriegssituation legte sich langsam, aber immer drückender über die Insel.
Norcott durchwanderte die Räume der Dienststelle, fand sie aber verwaist, ebenso wie das Büro der Sergeants. Ohne Enthusiasmus stellte er sich vorerst den Papierbergen auf seinem Schreibtisch.
Ungefähr eine Stunde und zwei Becher dünnen Tees später klopfte es an Norcotts Bürotür. Noch bevor er antworten konnte, steckte schon Sergeant Mulgrave seinen Kopf durch die Tür.
»Guten Morgen, Chief. Doktor Hamilton hat eben angerufen. Er lässt Ihnen ausrichten, der Obduktionsbericht ist fertig und Sie könnten auf einen Sprung vorbeikommen.«
»Guten Morgen, Clive. Ist der Doc noch im Krankenhaus oder schon wieder zu Hause?«, fragte Norcott zurück. Immerhin war es Samstag.
»Entschuldigung. Hätte ich gleich sagen sollen. Er wartet im Krankenhaus. Falls Sie nicht direkt rüberfahren wollen, möchten Sie bitte anrufen.«
»Nein, nein, ich werde das gleich erledigen. Und Clive«, Mulgrave hatte sich schon zum Gehen gewandt, »ich hätte Sie gern dabei. Ich möchte vom Krankenhaus direkt noch einmal bei Mr. Henley vorbei.«
Mulgrave trat einen Schritt weiter in Norcotts Büro und senkte etwas die Stimme. »Darf ich Sie was fragen?«
Norcott zog als Antwort nur fragend die Augenbrauen hoch.
»Glauben Sie, er war’s? Ich meine, dass Henley seine Frau erwürgt hat?«
»Erdrosselt.«
»Ja, richtig, erdrosselt. Glauben Sie, er war’s?«
»Glauben Sie es nicht?« entgegnete Norcott und lehnte sich in seinem Bürostuhl zurück. »Spricht denn etwas dagegen? Was haben wir denn, was ihn entlasten würde?«
Mulgrave machte ein nachdenkliches Gesicht. Tatsächlich war es allein das bisher fehlende Motiv, das William Henley vor einer Verhaftung bewahrt hatte. In die Wohnung war nach bisherigem Erkenntnisstand nicht eingebrochen worden. Was wiederum bedeutete, dass Nora Henley ihren Mörder gekannt hatte oder er einen Schlüssel gehabt haben musste. Dass Henleys Vater mit dem Ersatzschlüssel eingedrungen war, um seine Schwiegertochter zu meucheln, dafür gab es nicht den Ansatz eines Beweises oder den Hauch eines Motivs. Und Henley selbst hatte kein stichhaltiges Alibi. Genau genommen, hat der arme Teufel überhaupt kein Alibi, dachte Mulgrave bei sich. Er machte ein verdrossenes Gesicht. Der stille Bankbeamte William Henley hatte für ihn so gar nichts von einem brutalen Frauenmörder.
Norcott lächelte freundlich und lehnte sich über seinen Schreibtisch. »Ich weiß genau, was Sie denken, Clive. Henley wirkt so verdammt korrekt und reserviert, dass man ihm nicht einmal zutraut, beim Bingo zu betrügen. Aber lassen Sie sich nicht täuschen. Der Mensch ist seines Nächsten Wolf!«
Sergeant Mulgrave kratzte sich über den Zweitagebart und grinste verlegen.
»Thomas Hobbes«, grinste Norcott zurück, »Leviathan.«
»Ah ja«, machte Mulgrave.
»Gehen wir es doch einmal systematisch an«, sagte Norcott. »Wenn wir bei Henley anfangen, dann haben wir aus meiner Sicht drei Möglichkeiten: Eifersucht, begründet oder auch unbegründet, oder er hat eine neue Liebe. Oder das alte Motiv Gier, das heißt Erbe oder Versicherung. Gier, mit all seinen Untermöglichkeiten, können wir im Moment als Motiv vernachlässigen. Zu erben gab’s nach unserem Wissensstand nichts bei Mrs. Henley. Wir haben das ja überprüft. Noras Eltern sind kleine Leute, auch in der weiteren Verwandtschaft weit und breit kein Vermögen in Sicht. Und Henley scheint mir auch nicht so dumm zu sein, so ein Vorhaben in der momentanen Situation durchzuziehen. Viel zu unsicher! Wer weiß, ob er in ein paar Tagen überhaupt an das Geld kommen würde. Wenn die Deutschen einmarschieren, kommt sicher kein Geld mehr vom Festland und damit musste er rechnen.«
Mulgrave nickte.
»Dann die beiden anderen Möglichkeiten: Entweder er hat etwas Neues oder sie hatte. Dass er seine Frau ausgerechnet jetzt umbringt, um frei für eine Geliebte zu sein, will mir nicht einleuchten. Warum gerade jetzt? Eine andere Geschichte, die ich für deutlich wahrscheinlicher halte, nach allem, was wir über Mrs. Henley wissen, ist Eifersucht. Deswegen versuchen wir ja auch, im Hafenamt endlich an die Verschiffungslisten der Evakuierten zu kommen. Ich will wissen, ob Nora Henley auf der Liste stand. Die Evakuierung wäre doch eine gute Möglichkeit, alles hinter sich zu lassen und mit ihrem Liebhaber auf und davon zu gehen.«
»Und bei ihm könnten die Sicherungen durchgebrannt sein, als er mitbekam, dass sie ihn verlassen wollte«, sagte Mulgrave.
Norcott nickte. »Vielleicht konnte er über die gelegentlichen Seitensprünge sogar noch hinweg sehen, aber dann …«
»… war das Maß voll, als sie ihn verlassen wollte«, ergänzte der Sergeant.
»Aber das, Clive, das müssen wir beweisen!« Norcott stand auf und zog sein Jackett vom Bügel. »Gehen wir und hören uns an, was der Doc für uns hat.«
Die Fahrt dauerte nicht lang, bis zum Métivier-Krankenhaus waren es nur knapp zwei Meilen. Oberflächlich wirkte die Stadt wie an einem ganz gewöhnlichen Samstag. Wie in jedem Jahr verbreitete die für Guernsey so wichtige, laufende Tomatenernte bereits ausreichend Hektik. Ein langsamer, aber beständiger Strom von Lkws quälte sich durch die Straßen der Stadt zum Hafen, um die Massen an leicht verderblichen Tomaten schnellstmöglich auf das britische Festland zu verschiffen. Wenn man aber genauer hinsah, entdeckte man eine ganze Reihe von Pferdefuhrwerken und sogar großen Handkarren. Die Benzinrationierung zeigte Wirkung.
Sergeant Mulgrave steuerte den Wagen auf die Auffahrt, die zu dem Parkplatz direkt vor dem Haupteingang des Krankenhauses führte. Mitten auf dem Platz stand ein altersschwacher Bean-Kleinlaster, von dem Luftschutz-Freiwillige Sand herunter schippten, während andere Männer damit beschäftigt waren, den Sand in Säcke zu füllen und anschließend zum Haupteingang zu tragen.
»He … Sie da!« Einer der Männer fuchtelte mit einem Klemmbrett in der Hand in Richtung der beiden Beamten, die gerade aus dem Wagen stiegen. »Sie können da nicht stehen bleiben! Sehen Sie nicht, dass hier gearbeitet wird?«
Mulgrave und Norcott griffen beim Näherkommen fast gleichzeitig in ihre Jacketts, als vom Laster her eine Stimme kam. »Chief Inspector! Wie schön, Sie zu treffen.«
Hinter dem erzürnten Luftschutzwart tauchte die kugelrunde Gestalt von Mr. Grantly, dem Besitzer der Fish’n’Chips-Bude am Hafen auf. Mr. Grantly schien komplett aus Kugeln zu bestehen. Auf dem kugeligen Körper saß ein ebenso kugelförmiger Kopf und darauf ein offensichtlich zu kleiner halbrunder Tellerhelm. Während er schnaufend auf die Polizisten zukam, wischte er sich mit einem überdimensionalen Taschentuch die Stirn ab. Trotz der immer noch spürbaren Kühle des Morgens hatte Mr. Grantly bereits einen puterroten Kopf vor Anstrengung. Der Luftschutzwart hatte sich zu ihm umgedreht. »Du kennst die Gentlemen, Sidney?« Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte er sich wieder nach vorn und schaute unmittelbar in zwei Dienstausweise vor seiner Nase. Ohne weiter das Wort an den Luftschutzwart zu richten, der ohnehin froh war, nicht noch eine saftige Antwort zu kassieren, schüttelten die beiden Kriminalbeamten Mr. Grantly die Hand.
»Mr. Grantly, ich stelle fest, nicht nur Ihr hervorragendes Erbsenpüree ist bemerkenswert, an Ihnen gibt es noch mehr Interessantes«, neckte Norcott ihn und deutete auf die Gruppe schaufelnder Männer.
Sidney Grantly schaute sich kurz um und machte dann eine müde Handbewegung. »Das? Ach, wissen Sie, Chief Inspector, auch wenn man uns in London schon abgeschrieben hat, wir halten hier zusammen und so tut eben jeder, was er kann. Na ja«, er sah an sich herunter, »und ein bisschen Bewegung tut mir ja vielleicht ganz gut. Ich esse eben so furchtbar gern. Hoffnungsloser Fall, sagt meine Frau immer, hoffnungslos.« Seine Augen funkelten mit kindlicher Neugier. »Und Sie sind an diesem schönen Samstag doch bestimmt auch nicht hier, nur um eine kranke Tante zu besuchen, oder?«
»Nein, Mr. Grantly, das sind wir in der Tat nicht. Jeder tut das, was er kann.« Norcott grinste und legte verschwörerisch den Zeigefinger an die Lippen. Mr. Grantly kehrte lachend zu seiner Schaufel zurück und die beiden Polizisten stiegen die Treppe zum Haupteingang hoch, immer wieder Männern mit Sandsäcken ausweichend.
Sie fanden Dr. Hamilton in dem Büro, das an den Obduktionssaal angrenzte.
»Morgen, Charles, guten Morgen, Sergeant. Schön, dass ihr direkt kommen konntet, dann können wir ja gleich anfangen.« Er sprang auf die Füße und scheuchte Charles Norcott, der sich gerade in einem der Bürosessel niedergelassen hatte, wieder hoch. »Komm, Charles, wir wollen doch nicht über die gute Nora hinter ihrem Rücken sprechen. Ich habe sie extra für euch liegenlassen.«
Tatsächlich war eines der zwei großen Edelstahlbecken mit einem Körper belegt. Dr. Hamilton nahm einen Aktendeckel von einem der Stahltische. »Das allgemeine Drumherum erspare ich uns mal, du weißt ja, wen wir hier liegen haben.« Er schlug den oberen Teil des weißen Lakens vom Körper und der Kopf Nora Henleys kam zum Vorschein. »Für ihr Alter war ihr Körper perfekt in Schuss, innere Organe, Zähne, alles im Normalmaß in Ordnung und unauffällig. Kommen wir gleich zum Spannenden: Sie war gerade dabei, unserem guten König Georg einen neuen Untertanen zu schenken. Oder, um es profan auszudrücken: Sie war schwanger. Nach den Abmessungen des Fötus schätze ich Mitte bis Ende vierter Monat. Also hat sie es mit Sicherheit gewusst. Und ebenfalls mit Sicherheit ist William Henley nicht der Vater.« Hamilton genoss den Moment der Überraschung sichtlich, bevor er fortfuhr. »Wir haben eine Krankenakte von William Henley, er hat sich hier im Haus behandeln lassen und so konnte ich seine Blutdaten direkt zum Vergleich heranziehen. Das scheint mir doch ein schöner Ansatzpunkt für euch zu sein, oder?«
Norcott nickte nachdenklich. Nicht, dass ihn die Schwangerschaft von einem anderen Mann überrascht hätte. Auf Anzeichen von Seitensprüngen waren sie bei Nora Henley ja nun mehrfach gestoßen. Ihre nächste Station nach dem Krankenhaus war jetzt umso dringender William Henley.
»Charles, hörst du mir zu?« Norcott schrak aus seinen Gedanken hoch und der Arzt sprach weiter. »Das ist nicht ihre erste Schwangerschaft. Sie war schon früher schwanger und hat es wegmachen lassen. Leider ist dabei erheblich gepfuscht worden.« Er ging an das Ende der Wanne und machte Anstalten, das Tuch auch vom Unterleib der Toten zu ziehen. »Auf ihrer Gebärmutter ist deutlich Narbengewebe erkennbar.« Als er das erschreckte Gesicht der beiden Kriminalbeamten sah, ließ er das Tuch wieder sinken. »Ihr wollt das nicht sehen, nein? Na dann.«
Mulgrave hüstelte, während Norcott fragte: »Und die Todesursache, gibt es da noch neue Erkenntnisse?«
Dr. Hamilton spitzte die Lippen, als müsse er einen Moment nachdenken. »Nein, es ist so, wie ich es dir am Donnerstag schon gesagt habe. Äh, die technischen Details kannst du natürlich im Bericht nachlesen. Ja, die Todesursache, also wie gesagt, sie ist mit einem etwa 1,2 Inch breiten Ledergürtel erdrosselt worden. Sie hat sich nicht in nennenswerter Weise gewehrt, unter den«, er nahm eine der Hände der Toten unter dem Tuch hervor, »durchaus beachtlichen Fingernägeln habe ich so gut wie keine Gewebereste gefunden, nur Lederabrieb. Tja, meine Herren, das war’s. Wie gesagt, im Bericht steht alles noch exakt. Ich nehme an, es reicht, wenn du ihn Montag bekommst, Charles?«
»Ja, natürlich Brian, vielen Dank. Letzte Frage: Kann der Leichnam aus deiner Sicht dann jetzt zur Bestattung freigegeben werden?« Hamilton nickte zustimmend.
Norcott steckte sein Notizbuch ein. »Gut, dann wollen wir dich auch nicht länger von deinem wohlverdienten Wochenende abhalten.«
Hamilton lachte fröhlich. »Ja, mein Wochenende wird voller ehrlicher Arbeit sein!« Er grinste, als er Norcotts fragendes Gesicht sah. »Ich werde zu meinen Schwiegereltern in Les Buttes fahren und bei der Tomatenernte helfen. In Notzeiten zählt jede Hand. Hatte ich das nicht schon einmal erwähnt, dass sie einen Hof haben? Nein? Na, jetzt weißt du es. Auch mal schön, etwas anderes in der Nase zu haben, als Formalin und Äther.«
Die beiden Kriminalbeamten verabschiedeten sich und verließen das Krankenhaus. Am Haupteingang war die Arbeit erstaunlich schnell vorangekommen. Der schützende Sandsackwall war bereits bis auf Hüfthöhe angewachsen. Norcott und Mulgrave blieben einen Moment stehen. Auf dem Dach des Seitenflügels waren Männer gerade damit beschäftigt, ein überdimensionales Rotes Kreuz aufzumalen. Sie sahen sich an. Den beiden Beamten ging derselbe Gedanke durch den Kopf: Dass diese Arbeiten hoffentlich nie notwendig würden.
Sie fuhren schweigend die kurze Strecke bis zur Wohnung der Henleys in der Parnell Road. Mittlerweile hatte es die Junisonne geschafft, den Nebel aus den höher gelegenen Straßen der Stadt zu vertreiben und es schien ein weiterer schöner Frühsommertag zu werden.
Die kurze Straße wirkte ausgestorben. Mehrere Häuser waren verlassen, Türen und Fensterläden verrammelt. Zwei streunende Hunde duckten sich in den Schutz einer staubigen Hecke. Sie beobachteten eine alte Zeitung, die ein träger Sommerwind über den Asphalt trieb.
Nachdem er zweimal vergeblich auf die Türklingel gedrückt hatte, flüsterte Sergeant Mulgrave: »Ich glaube, wir stehen unter Beobachtung.« Norcott drehte sich zum Fenster neben der Haustür und sah eben noch eine flüchtige Bewegung an der Gardine. Er seufzte und setzte dann entschlossen seinen Finger auf die zweite Klingel an der Haustür. Es dauerte doch noch eine Weile, bis die Tür von einer atemlosen Mrs. Dobbs geöffnet wurde.
»Chief Inspector! Was für eine schöne Überraschung«, flötete sie. »Guten Morgen. Und gleich zwei Herren. Was kann ich denn für Sie tun?« Mulgrave wäre nicht überrascht gewesen, wenn Sie ganz nach Hollywood-Manier einen Kussmund gemacht und dazu mit den Augen geklimpert hätte.
»Guten Morgen, Mrs. Dobbs«, antwortete Norcott. »Wir wollten eigentlich Mr. Henley sprechen. Er ist wohl nicht zu Hause?«
»Nein, da haben Sie aber kein Glück. Er ist um kurz nach neun Uhr aus dem Haus gegangen.« Ohne, dass Norcott erst fragen musste, setzte sie hinzu: »Wohin er gegangen ist, weiß ich leider nicht. Er ist ja so verschlossen. Der arme Mann.«
Norcott schnitt ihr das Wort ab: »Mrs. Dobbs, wo wir gerade hier sind, dürfen Sergeant Mulgrave und ich vielleicht hereinkommen? Wir würden gern auch mit Ihnen noch ein paar Fragen klären.«
Mrs. Dobbs’ Wohnzimmer entsprach dem Stil, den Charles Norcott erwartet hatte. Alles wirkte gepflegt, aber alles war auch ein wenig zu bunt, zu fröhlich. Vom in gelb-rosa Streifen bezogenen Sofa, über zahlreiche Nippes-Figuren, bis hin zu einem Prachtteller – hergestellt zur Krönung George VI. – der einen Ehrenplatz auf dem Kaminsims einnahm, wurden alle Befürchtungen erfüllt.
Sergeant Mulgrave lehnte an einer gelb gestrichenen Kommode und hielt sich im Hintergrund. Er hatte seinen Notizblock gezückt.
Norcott wollte sich nicht lang mit Vorreden aufhalten. »Mrs. Dobbs, vielen Dank, dass Sie uns noch einmal Ihre Zeit schenken. Es geht mir eigentlich nur um einen Punkt: Sie hatten gegenüber Sergeant Pearson ausgesagt, nur einmal einen Fremden gesehen zu haben, der aus der Wohnung der Henleys kam. Ist das richtig? Nur einen Mann in Uniform.«
Mrs. Dobbs Augen flatterten fast unmerklich. »Ja, einmal. Nur den Mann in Uniform. Wie ich es gesagt hatte.«
Norcott wartete noch einen Moment, aber sie setzte nichts hinzu. Und sie blieb bei ihrer Aussage. Gleichgültig, mit welchem Ansatz er es auch versuchte – Mrs. Dobbs schien entschlossen, keine weiteren Beobachtungen preiszugeben. Nach verschiedenen Versuchen brach Norcott die Befragung ab.
Kaum wieder im Wagen, platzte es aus Sergeant Mulgrave heraus. »Sie weiß etwas! Sie hat jemanden gesehen, darauf wette ich einen goldenen Sovereign. Ich verstehe nur nicht, warum sie es nicht erzählt!« Er sah seinen Chef an. »Verstehen Sie das, Chief?«
Norcott brütete über derselben Frage, die ihn schon seit den Ergebnissen der ersten Besprechung am Donnerstagabend beschäftigte. Wieso wollte die Zeugin, außer der etwas nebulösen Gestalt des Uniformierten, keinen anderen Mann gesehen haben? »Ich weiß es selbst nicht, Clive. Kennt sie den Betroffenen und will ihn schützen? Dadurch, dass sie als nächste Nachbarin aussagt, keine Männer gesehen zu haben, nimmt sie indirekt Nora Henley in Schutz. Aber wozu? Was würde sie dadurch gewinnen?« Er schüttelte mit dem Kopf und strich sich ratlos über die Haare. Dann straffte er sich. »Aber so leicht geht uns die Dame nicht von der Angel. Wir werden wiederkommen!«
Als sie an der Hospital Lane angekommen waren, hielt Norcott seinen Sergeant zurück. »Clive, wir können jetzt erst einmal nichts tun. Es ist Samstag, warum fahren Sie nicht nach Hause? Nehmen Sie den Wagen.«
Mulgrave wollte protestieren.
»Keine Widerrede. Kleiner Ausgleich für die Samstagsarbeit. Wir treffen uns heute Abend gegen acht Uhr wieder. Vielleicht können wir dann ja Mr. Henley erwischen.«
Sie verabschiedeten sich und Norcott sah Mulgrave einen Moment nach, der jetzt zu seiner Familie fuhr. Er fühlte sich auf eine schmerzhafte Weise leer.
Kapitel 8
St. Peter Port, Polizeizentrale
Samstag, 22. Juni 1940, früher Abend
Norcott hatte versucht, auf einem längeren Spaziergang oberhalb der Stadt, Ordnung in seinen Kopf zu bringen. Dabei musste er sich eingestehen, dass er seit gestern ab und zu auch an Vicky Rhys gedacht hatte. Er kannte sich selbst zu genau und wusste, dass es nichts brachte, den Gedanken einfach wegzuschieben. Schuld war auch der kommende Sonntag. Bis vor zwei Jahren waren Sonntage für ihn und Heather heilige Tage gewesen. Spätes Aufstehen, gefolgt von einem selbst für britische Verhältnisse ausgedehnten Frühstück und dann waren sie zu zweit aufs Land gefahren. Nach Kent oder Essex, Hauptsache raus aus London, weg vom Yard und weg von der Schule. Die Sonntage waren das Scharnier zwischen zwei unruhigen Leben gewesen. Er drängte den Gedanken zurück, dass es jetzt nur noch ein Leben war.
Als er kurz vor acht Uhr Sergeant Mulgrave abholen wollte, fand er das Büro der beiden Sergeants leer. Auf der Suche nach ihm schlenderte er in den vorderen Teil der Hauptwache und fand Mulgrave, zusammen mit anderen Polizisten, um einen Radioempfänger versammelt.
»Sondersendung von BBC London«, raunte ihm einer der Constables zu.
»… soeben zu erfahren war, hat General Charles Huntziger in Vertretung der französischen Regierung heute Abend im Wald von Compiègne ein Waffenstillstandsabkommen mit dem Deutschen Reich geschlossen. Damit wird die Kapitulation Frankreichs endgültig. Wie Außenminister Lord Halifax sagte, habe Herr Hitler bereits deutlich gemacht, es werde sich nun das ganze Gewicht der Deutschen gegen Großbritannien richten. Das Königreich hingegen werde nicht aufhören zu kämpfen, bis die Freiheit, für uns selbst und andere, sicher ist.«
Es erhob sich eine wilde allgemeine Diskussion und die Stimme des BBC-Sprechers ging darin unter. Norcott gab Sergeant Mulgrave ein Zeichen und sie verließen die Hauptwache. Im Auto herrschte zunächst Stille, bis es aus Mulgrave herausplatzte. »Glauben Sie, die Nazis landen bald, Chief? Was wird dann aus uns werden?«
Charles Norcott behielt seine Meinung, die Deutschen würden sich nicht weiter mit den Inseln aufhalten und gleich an der englischen Südküste landen, für sich. Er wusste, Mulgrave machte sich Sorgen um seine Frau und seine Töchter, deshalb versuchte er die Risiken herunterzuspielen.
»Was mit uns wird, wenn sie kommen? Nun, sie werden überall ihre Nasen reinstecken und uns Vorschriften für alles machen. Die Deutschen lieben Vorschriften und sie werden sie säckeweise mitbringen. Für unsere tägliche Arbeit wird es keinen großen Unterschied machen, vermute ich. Wir können bis dahin nur den Rücken gerade machen und unsere Pflicht erfüllen.«
Mulgrave nickte stumm.
»Woran denken Sie, Clive? Machen Sie sich Sorgen um Ihre Familie?«
»Ja und nein. Ich musste nur gerade an meine Frau denken, die in unserem Garten heute Morgen ihre geliebten Gladiolen herausgerissen hat, um Karotten und Spinat anzupflanzen. Dig for Victory!, Sie wissen schon.« Er wurde ernster. »Ich glaube, sie hat geweint. Sie hatte ganz rote Augen, als ich nach Hause kam.«
»Ich denke, Sie haben Glück, Clive. Genießen Sie es!«
Fast hätte Norcott ein schlechtes Gewissen bekommen, dieser Frau am Samstagabend den Mann zu entführen. Aber dann musste er an die Gefahr denken. Was, wenn Nora Henley nicht von ihrem Ehemann im Rausch der Eifersucht ermordet wurde? Wenn es doch ein unbekannter Täter war, der vielleicht gerade sein nächstes Opfer belauerte? Wenn sie vielleicht in die völlig falsche Richtung ermittelten? Beklemmung beschlich ihn. Die ewige Unrast, etwas zu übersehen. Hatte ihn das Insel-Idyll schon eingelullt? Warum sollte es nicht auch hier, zwischen Strand und Ferienhotels, einen wahnsinnigen Killer geben?
Das Bremsen des Wagens löste Norcott aus seinen trüben Gedanken. Mulgrave zog die Handbremse und deutete zum Haus Nr. 7. Im ersten Stock brannte Licht, Sie hatten Glück.
Es dauerte nur einen Moment nach dem Läuten, bis die Tür geöffnet wurde. William Henley schien nicht erstaunt zu sein, die Kriminalbeamten am Samstagabend vor seiner Haustür zu finden. Er trat wortlos beiseite, um sie hereinzulassen.
»Sie scheinen nicht verwundert, uns zu sehen, Mr. Henley?«
»Nein, Chief Inspector, das bin ich in der Tat nicht. Wenn ich nicht sowieso einen funktionierenden Nachrichtendienst im Haus hätte, der mir Ihren Besuch von heute Vormittag sofort brühwarm hinterbracht hat«, er deutete auf die Wohnungstür von Mrs. Dobbs, während sie gemeinsam die Treppe hochstiegen, »auch dann wäre ich nicht erstaunt, da Sie mich ja ganz offensichtlich für den Mörder meiner Frau halten.« Er sah Norcott an dabei, wirkte aber eher müde, als erregt über den Vorwurf. Sie standen im Flur der Wohnung.
»Vielleicht wäre es möglich, dass wir uns kurz setzen, Mr. Henley?«
Stumm wies Henley in Richtung Wohnzimmer. Norcott fiel auf, dass die Wohnung verändert aussah. Er konnte es eine Weile nicht festmachen, bis er die zahlreichen Modemagazine vermisste, die noch am Donnerstag überall in der Wohnung herumgelegen hatten.
Norcott hatte sich vorgenommen, Henley langsam und behutsam anzugehen. Also versuchte er zuerst, sein schiefes Bild geradezurücken. »Mr. Henley, Sie sollten nicht glauben, wir würden uns unsere Arbeit leicht machen. Wir ermitteln in alle Richtungen und meine Männer sind seit Donnerstag quasi im Dauereinsatz, um alle nur erdenklichen Spuren zu verfolgen. Ich bin einzig und allein am wirklichen Täter interessiert und nicht an einem Schuldigen. Und wenn ich Sie bitte, mir zu offenen Fragen, Sie und Ihre Frau betreffend, zu helfen, dann dient das dieser Suche. Nichts anderem.« Norcott sah Henley fragend an.
Der nickte, ohne Norcott anzusehen. »Was wollen Sie wissen?« Die Frage kam tonlos.
»Mr. Henley, ich konnte mir bisher noch kein wirkliches Bild von Ihrer Frau machen. Was war sie für ein Mensch? Mit wem hatte sie Umgang? Womit hat sie ihre Zeit verbracht? Nur wenn wir diese Antworten bekommen, können wir klären, ob sich hier die Verbindung zum Täter verbirgt.« Wieder verstummte Norcott und wieder sah er Henley fragend an. Mulgrave hatte sich auf einen weiter hinten stehenden Sessel zurückgezogen und hielt sein Notizbuch schreibbereit.
Geduldig, wie ein sanfter Lehrer einen verstockten Schüler, versuchte Norcott den Ehemann langsam zu den richtigen Antworten zu bringen. Aber nachdem über eine Stunde vergangen war, musste sich der Chief Inspector eingestehen, dass sie keinen Viertel-Inch vorwärts gekommen waren. Henley hatte wie ein Fremder das Bild einer Frau skizziert, deren Leben zu einem großen Teil daraus bestand, auf dem Sofa zu liegen, Modemagazine zu lesen und Schellack-Platten zu hören. Freundinnen habe sie auf der Insel nicht gehabt und sich auch nicht darum bemüht.
William Henley hatte seine spätere Frau während ihres Sommerurlaubs kennengelernt. Sie war zusammen mit zwei Freundinnen aus London für eine Woche nach Guernsey gekommen. William und Nora hatten sich verliebt, nach dem Urlaub wurde eine Wochenendbeziehung daraus. »So gut es eben ging«, wie Henley sich ausdrückte. Dann hatten ihre Eltern auf eine Legalisierung der Beziehung gedrängt und sie heirateten schließlich. Die anfangs noch langen Telefonate mit ihren Londoner Freundinnen waren mit der Zeit immer weniger geworden und schließlich ganz abgebrochen. Aber auch für die Ehe erlahmte Noras Engagement schnell. Aus der vorehelichen Verliebtheit war das Paar ohne Umweg in die distanzierte, kalte Langeweile gerutscht, wie sie manche alten Ehepaare in späten Jahren befiel.
Oberflächlich war Nora Henley, so wollte es Norcott scheinen, wenig mehr als eine weibliche Drohne gewesen. Sie hatte es sich in ihrem kleinen Nest bequem gemacht. Die junge Frau war scheinbar zufrieden damit, so gut wie nichts zu tun und versorgt zu sein. Selbstverliebt und sich selbst genügend. Aber dieses Bild wirkte seltsam eindimensional. Norcott musste durchatmen. William Henley wirkte so distanziert, so kühl in seinem Bericht, dass man jeden Ansatz eines Gespräches verlor. Es war, als lauschte man einem Nachrichtensprecher im Radio, einer körperlosen Stimme, der man zuhört, der man aber keine Fragen stellt. Und die kein Gesicht hat, schoss es Norcott durch den Kopf. Henley hatte keine greifbare Persönlichkeit, er verschwand wie eine Figur im Nebel. Norcott versuchte, ihn zu greifen, aber fasste ins Leere. Wer ist William Henley? dachte Norcott. Wer bist du wirklich?
Norcott fand es jetzt an der Zeit, ein heikles Thema anzuschneiden. »Sagen Sie, Mr. Henley, hat sich Ihre Frau denn keine Kinder gewünscht?«
Henley schaute hoch und sein Gesichtsausdruck spiegelte eine ungewöhnliche Mischung aus Erstaunen und Distanz, so als beträfe ihn die Frage nicht. Ebenso gut hätte er fragen können, ob Nora Henley nicht den Wunsch verspürt hatte, Zarin von Russland zu werden, so schien es Norcott. Fast mechanisch schüttelte der Ehemann den Kopf. »Nein. Meine Frau wollte nie Kinder! Um ehrlich zu sein … ich hatte auch nicht wirklich den tiefen Wunsch danach. Eigentlich habe ich damals nur einen Vorstoß gemacht, weil meine Eltern nicht aufgehört haben zu bohren und irgendwie gehören doch Kinder auch zu einer richtigen Ehe.«
Hinter dem letzten Teil des Satzes war ein winziges Fragezeichen spürbar, so als sei er sich dieses Punktes nicht sicher. Als sei dies ein ihm fremdes Ritual.
»Sie hat nur gelacht und mich gefragt, wieso sie sich die Figur ruinieren sollte, um einen lästigen Hosenscheisser großzuziehen. Sie hat genau das gesagt und meine Hand auf ihren Bauch gelegt. Hier, sehen Sie? Hier hat sie meine Hand auf ihren Bauch gelegt und gefragt, ob er mir so flach nicht lieber wäre.«
Sergeant Mulgrave hielt für einen Moment den Atem an und versuchte gleichzeitig so unauffällig wie möglich, Henleys Gesicht im Auge zu behalten. Er wusste, welche Frage nun kommen würde.
»Mr. Henley, dann erstaunt es Sie vielleicht, zu erfahren, dass Ihre Frau guter Hoffnung war. Und zwar fast im vierten Monat.« Norcott hatte ganz ruhig gesprochen. Eine kühle Feststellung, scheinbar ohne das Verlangen einer Antwort.
Was immer die beiden Kriminalbeamten als Reaktion erwartet hatten, es trat nicht ein. Bestürzung, Trauer um den nun doppelten Verlust, ungläubige Ablehnung, alles wäre eine denkbare Reaktion gewesen. Norcott wusste, er musste die Stille nun um jeden Preis ertragen. Es war ein Pokerspiel mit hohen Einsätzen und er musste seinem Gegenüber die Gelegenheit zum Zug geben, bevor er seinen finalen Trumpf zog. Er sah William Henley an und wartete ab, wartete auf seinen nächsten Zug.
Als die Stille schier unerträglich zu werden drohte, räusperte sich Henley. Mit einer lahmen Handbewegung sagte er: »Vielleicht hat sie es sich anders überlegt. Vielleicht hat sie in irgendeinem Magazin hübsche Babysachen gesehen und sich anders entschieden. Meine Frau hat öfter mal ihre Meinung geändert.«
Norcott unterbrach Henley. Er war entschlossen, das Skalpell nun endgültig bis zu dem wuchernden Tumor aus Lügen und Selbstbetrug zu treiben. »Das Kind war nicht von Ihnen, Mr. Henley. Sie sind nicht der Vater. Das hat die Obduktion zweifelsfrei ergeben.« Es dauerte so lange, bis Henley überhaupt eine feststellbare Reaktion zeigte, dass Norcott nachfasste. »Haben Sie verstanden, was ich eben gesagt habe, Mr. Henley?«
Wieder verging ein Moment, dann hob der betrogene Ehemann den Kopf und sah Norcott aus trüben Augen an. Er stand unvermittelt auf. »Haben Sie noch weitere Fragen, Chief Inspector? Falls nein, würde ich jetzt gern allein sein.« Ohne ein weiteres Wort und ohne Eile war er zur Wohnungstür gegangen und neben der geöffneten Tür stehengeblieben.
Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als seiner Aufforderung nachzukommen. Noch war die Beweislage zu dürftig, um härtere Maßnahmen zu rechtfertigen. Als Norcott auf der Höhe Henleys war, blieb er wieder kurz stehen. »Mr. Henley, von unserer und von Seiten der Gerichtsmedizin ist der Leichnam dann ab jetzt freigegeben. Sie können Ihre Frau jetzt begraben!« Falls der Chief Inspector gehofft hatte, mit dem zweiten Satz noch irgendeine Regung provozieren zu können, sah er sich enttäuscht. Henley sah wortlos durch ihn hindurch.
Als die beiden Männer das Haus verließen, war die Sonne schon vor über einer Stunde untergegangen, die kleine Straße nur noch trüb vom schmutzig-gelben Nachleuchten des Sommerhimmels beschienen. Sie setzten sich in ihren Wagen und schwiegen eine ganze Weile. Plötzlich musste Norcott an den morgigen Sonntag denken und startete den Wagen.
»Schluss mit dem Gegrübel, Clive. Ich fahre Sie jetzt nach Hause und dann versuchen Sie mit Ihrer Frau das zu retten, was noch vom Wochenende übrig ist.« Mulgrave wollte protestieren. »Aber Chief, wir können ihn doch damit nicht davonkommen lassen!«
»Clive, menschlich gesehen kann ich seine Reaktion ebenso wenig verstehen wie Sie. Aber Gefühlskälte oder Gleichgültigkeit oder wie Sie es auch immer nennen wollen, ist nicht strafbar. Er ist wie ein kalter Fisch, aber das macht ihn offiziell immer noch nicht zum Verdächtigen.« Er schnaubte verächtlich und strich sich mit der Hand über die grauen Haare. »Im Grunde entkräftet seine unbeteiligte Haltung unseren Verdacht ja noch! Wenn es ihm herzlich egal war, mit wem seine Frau rummacht, warum sollte er sie dann umbringen?« Dass da ein anderer Verdacht tief in seinem Kopf zu wachsen begann, damit wollte er Mulgrave heute Abend nicht mehr belasten. Aber er würde diesen Verdacht wachsen lassen und er würde William Henley nicht aus den Fängen lassen!
Sergeant Mulgrave wohnte in L’Islet, einem kleinen Ort unmittelbar an der Nordküste, ungefähr drei Meilen vom Stadtzentrum St. Peter Ports entfernt. Mulgrave lotste seinen Chef bis in eine ruhige Wohnstraße und vor ein niedliches kleines Haus im französischen Stil. Mit viel Sorgfalt waren auf dem sandigen Boden Büsche und kleinere Bäume gezogen worden, in deren Schutz sich ein kleiner, aber offenbar gepflegter Garten duckte. Hier an der Nordküste der Insel konnte man den Seewind schon empfindlich spüren. Alle Versuche, Charles Norcott noch kurz zum hereinschauen zu überreden, wehrte der gutmütig ab. »Ehrlich, Clive, ich möchte nur noch in mein Hotel, einen Happen essen dann direkt ins Bett gehen. Grüßen Sie Ihre Frau und gute Nacht für Sie beide.« Er schob den Sergeant freundlich aus dem Auto. »Ach, und Clive: Dass Sie sich ja nicht morgen in die Hospital Lane verirren, hören Sie?« Er lachte und drohte freundschaftlich mit dem Finger, dann fuhr er an. Im Rückspiegel sah er, wie warmes Licht aus der Haustür fiel und Mulgrave langsam hineinging. Das Bild versetzte ihm einen kurzen Stich.
Er würde mit dem Dienstwagen direkt ins Hotel fahren. Für heute hatte er genug Odyssee hinter sich. Schließlich war es nach dreiundzwanzig Uhr, als er den Wagen auf dem winzigen Hotelparkplatz des Guillaume de Beauvoir abschloss. Inoffiziell saß noch eine kleine Gruppe befreundeter Gäste in der gemütlich engen Bar des Hotels, auch wenn offiziell schon geschlossen war.
Der Hotelbesitzer, der selbst hinter der Bar gestanden hatte und Norcott den Hintereingang öffnete, sah ihm mit Stirnrunzeln ins Gesicht. »Chief Inspector, Sie sehen aus, als wenn Sie eine gute Portion Scotch gebrauchen könnten. Und gegessen haben Sie heute Abend wohl auch noch nicht, oder?« Norcott konnte nur müde mit den Schultern zucken. »Ich würde zu beidem nicht nein sagen.«
»Na, dann setzen Sie sich mal. Es sind nur ein paar Freunde da, das stört Sie doch nicht?« Er drehte sich zur Bar: »Hetty, schenkst du dem Chief Inspector mal von meinem Balvenie ein? Er braucht ein wenig Aufmunterung.« Norcott setzte sich auf einen Stuhl an der Bar. Er freute sich auf den Scotch und auf das Essen. Aber er wusste auch: Seine Ruhe würde er erst wiederfinden, wenn der Täter gefasst war.
Kapitel 9
St. Peter Port, Hotel »Guillaume de Beauvoir«
Sonntag, 23. Juni 1940, morgens
Erst als er gegen neun Uhr aufwachte, einer Zeit zu der er gewöhnlich bereits eine ganze Weile am Schreibtisch saß, merkte Charles Norcott, wie erschöpft er am Samstag schließlich gewesen war. Auch wenn der angebotene schottische Whisky wirklich unerhört gut gewesen war, hatte er ein zweites Glas abgelehnt. Und wenn er zu müde war, um am Ende des Tages noch einen solchen Whisky zu genießen, war dies ein Warnsignal. Norcott war vernünftig genug, es ernst zu nehmen.
Obwohl er, wie immer am Morgen, Lust auf eine frische Tasse Tee hatte, drehte er sich lieber noch einmal im Bett herum. Er legte sich auf die Seite, so dass er zu den beiden hohen französischen Fenstern sehen konnte, die auf den winzigen Balkon führten. Die Sonne war lange aufgegangen und die Sonnenstrahlen lugten durch die Vorhänge. Er genoss die warme Schläfrigkeit, die wie ein dämpfender Schutzwall vor all den Fragen und Gedanken lag, mit denen ihn sein Verstand überfallen wollte. Es war eine beinahe buddhistisch anmutende Übung, die sie beide, Heather und er, in den vielen gemeinsamen Jahren fast bis zur Perfektion gebracht hatten: Sich an diesem einen Tag Ruhe vor den Problemen der Woche zu nehmen. Nicht, um den Problemen auszuweichen, sondern weil man wusste, dass die Kraft zu ihrer Bewältigung Zeit zum wachsen brauchte.
Er drehte sich versuchsweise wieder auf den Rücken, aber seine Schmerzen hielten im Moment Ruhe und so genoss er weiter das Nichtstun. Auch im Hotel rührte sich kaum etwas. Nur weit entfernt und kaum hörbar hatte das Personal vor einiger Zeit begonnen, den Tag vorzubereiten. Norcott war erstaunt, wie sehr ihn ein schönes stilles Hotelzimmer und der frühmorgendliche Sonnenschein abzulenken vermochten. Er hatte noch keinen wirklich ernsthaften Gedanken an seinen Mordfall verschwendet und nahm sich tapfer vor, dies auch bis wenigstens nach dem Frühstück durchzuhalten. Wie weit sein Gehirn aber auf die Jagd nach dem Täter getrimmt war, musste er sich nur einen Moment später eingestehen. Denn gerade noch mitten in Gedanken an ein ausgiebiges Frühstück, hatte er überlegt, am Nachmittag den Ortspfarrer der Henleys zu besuchen, den man bisher nicht erreicht hatte. Norcott musste über sich selbst den Kopf schütteln. Gestern Nacht hatte er Sergeant Mulgrave noch verboten, heute in der Hospital Lane aufzutauchen. Nun plante er selbst schon wieder Dienstliches. Norcott verschob den Gedanken an den Pfarrer auf später und beschloss, sich vorerst ganz dem Frühstück zu widmen. Nachdem er geduscht und sich gemächlich rasiert hatte, verbrachte er nur wenig Zeit vor dem Kleiderschrank. Er hatte ohnehin nur einen weiteren unbenutzten Anzug dabei. Schließlich war am Donnerstag alles schnell gegangen und so hatte er nur wenig Kleidung zum Wechseln.
Als er auf die sonnenbeschienene Hotelterrasse kam, trug er einen leichten, beigefarbenen Leinenanzug, ein weißes Hemd mit einer himmelblauen Krawatte und fühlte sich hervorragend. Außer ihm war nur ein Pärchen auf der Terrasse. Sie wirkten nervös und unterhielten sich leise auf Französisch.
Norcott bestellte bei einer freundlichen älteren Bedienung seinen Tee. Trotz der langsam spürbaren Lebensmittelknappheit bot das Hotel noch ein akzeptables Frühstück. Eine ordentliche Portion Rührei mit Speckscheiben und frischen gegrillten Champignons. Dazu gab es knusprigen Toast und hausgemachte Orangenmarmelade. Die Sonne war inzwischen am Himmel ein kleines Stückchen höher gewandert und ihre Wärme erfüllte die gesamte Terrasse. Norcott schloss immer wieder die Augen und konzentrierte sich auf die warmen Düfte, vermischt mit einer angenehm leichten Brise von See her.
Nach dem Frühstück blieb Norcott sitzen und las gründlich in den beiden Lokalblättern, der Evening Press und im Star. Die Zeitungen waren zwar von gestern, aber die politisch-militärische Lage war ohnehin unverändert schlecht. Die deutsche Wehrmacht drang immer tiefer in Frankreich ein, scheinbar ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Das Leben auf den Inseln pendelte zwischen Aktionismus und Agonie. Die Bauern versuchten, mit den wenigen verbliebenen Arbeitskräften die Ernte einzubringen und die Verwaltung schien sich in endlosen Diskussionen aufzureiben. Wirkliche Lösungen für die zahlreichen offenen Fragen hatten auch die Zeitungen nicht zu bieten. Weder für die tägliche wachsende Flut der französischen Flüchtlinge, noch für die immer drängender werdende Versorgungslage. Norcott faltete die Zeitung frustriert zusammen. Er sah auf die Uhr. Es war Viertel nach elf und er konnte die Zwölf-Uhr-Fähre nach Jersey noch erreichen. Aus dem Impuls heraus stand er auf und ging auf sein Zimmer. Schnell nahm er den seit gestern vorbereiteten Koffer und einen leichten braunen Hut, nur wenige Minuten später war er schon auf dem Weg in Richtung Hafen. Den Gedanken, mit dem Wagen zu fahren, hatte er gleich wieder beiseitegeschoben. Es war nicht einmal eine Meile bis zum Fähranleger und die Bewegung an frischer Luft würde auch seinem Rücken gut tun – zumindest hoffte er das.
Als Norcott den Anleger erreichte, hatte der Wind von See etwas aufgefrischt. Trotz des strahlenden Sonnenscheins gab es leichten Wellengang und die meisten Passagiere zogen es vor, in der Kabine Schutz vor Wind und Wasser zu suchen. Norcott war sicher, auch die wenigen Tapferen, die noch zum Anfang der Fahrt außenbords standen, würden bald hereinkommen. Immerhin dreieinhalb Stunden dauerte die Fahrt und da drang der Wind letztlich durch jede noch so feste Kleidung.
Er richtete es sich im hinteren Teil der kleinen Fähre ein und hing seinen Gedanken nach. Er war in seinem Leben erst zweimal geflogen und mochte Flugzeuge ebenso wenig wie Schiffe oder Boote. Dabei schreckte ihn nicht Flugangst oder Seekrankheit, sondern das Eingesperrtsein an Bord. Seine ewige Ruhelosigkeit rebellierte dagegen, nicht im nächsten Moment den Kurs ändern zu können. Um seine Nerven zu beruhigen, begann er über den Mordfall nachzudenken. Nur wenige enge Freunde und Kollegen wussten, wie selbstkritisch Charles Norcott seine eigene Arbeit wirklich sah. Und so begann er auch jetzt, wie immer, wenn er Zeit zu einer grundlegenden Betrachtung hatte, zuerst Fehler und Nachlässigkeiten in seinem eigenen Vorgehen zu analysieren. Natürlich war es ärgerlich, dass es dem Ehemann bisher gelungen war, sich aus nahezu jeder Frage herauszuwinden. Was die Informationen über das Umfeld des Opfers anging, wären sie ganz ohne Ehemann auch nicht schlechter dran. Aber andererseits, dachte Norcott, muss ich mir immer wieder vor Augen führen, dass Henley kein offiziell Verdächtiger ist. Er durfte sich nicht zu früh auf den Ehemann festlegen und womöglich die Daumenschrauben zu fest andrehen. Die Verführung, schnell einen Täter zu präsentieren, war gerade bei Gewaltverbrechen groß. Norcott begann, das gesamte Vorgehen des Untersuchungsteams gebetsmühlenartig auf Lücken abzuklopfen.
Die Fähre legte schließlich nach fast vier Stunden teilweise stürmischer Fahrt in St. Helier an. Norcott war heilfroh, von den schwankenden Planken herunterzukommen und festen Boden zu spüren. In St. Helier stellte sich die Frage eines Taxis nicht. Ein Schild am Taxistand informierte darüber, dass aufgrund der Benzinrationierung bis auf Weiteres der Taxidienst eingestellt war. Das war für andere Fahrgäste schlimmer als für ihn. Bis zu seiner Wohnung war es nur eine knappe Meile. Zu den Ortschaften an der Nord- oder Westküste der Insel betrug die Strecke dagegen mehr als zehn Meilen. Und sich nach vier Stunden auf See noch eine Dreiviertelstunde im Bus durchschütteln zu lassen, schien wenig verlockend.
Die Sonne hatte sich tapfer gehalten und so konnte man in den windgeschützten Straßen und engen Gassen der Inselhauptstadt weiterhin die Wärme des beginnenden Sommers genießen.
Als Norcott seine Wohnungstür aufschloss, atmete er einen Moment durch und sah dann auf die Standuhr. Es war gegen halb fünf Uhr, eigentlich fast Teezeit. Er hängte seinen Hut an die Garderobe und überlegte, wie bereits während der Überfahrt ein paarmal, wie er sich entscheiden sollte. Um achtzehn Uhr legte die Fähre für die Rückfahrt ab. Er konnte natürlich auch den Abend zu Hause verbringen und morgen früh das erste Boot um sieben Uhr nehmen. Niemand würde ihm einen Vorwurf machen, wenn er erst gegen Mittag im Dienst wäre. Aber Norcott wusste, er belog sich selbst mit diesem Gedankenspiel. Er würde um keinen Preis den halben Montag damit verschwenden, im Ärmelkanal herumzufahren. Entschlossen ging er in die kleine Küche am Ende des Flures, stellte eine große Kanne Teewasser auf den Herd und kehrte in den Flur zurück. Dort griff er nach seinem Koffer und nahm die Treppe in den ersten Stock. Im Schlafzimmer holte er zwei größere Koffer aus dem Schrank und füllte sie mit allen notwendigen Utensilien für mindestens eine Woche. So schnell wollte er nicht wieder acht Stunden auf dem Wasser verbringen, nur um sich mit Kleidung zu versorgen. Denn eins war klar, nichts verband ihn mit dieser Wohnung außer ein paar persönlichen Erinnerungsstücken. Fast alles fand seinen Weg in die beiden Koffer, zwei gerahmte Bilder von Heather, ein paar seiner Lieblingsbücher. Seine komplette Einrichtung befand sich ohnehin immer noch in der Londoner Wohnung, die er nicht aufgegeben hatte. Angesichts der Lage zweifelte Norcott daran, sie so bald wiederzusehen. Der Teekessel meldete sich mit schrillem Pfeifen aus der Küche und Norcott ging hinunter, um den Tee aufzugießen. Er trank mit Vorliebe Earl Grey Tea. Zum einen, weil er den Bergamotte-Geschmack liebte und andererseits, weil ein Tee, der nur kurz ziehen durfte, perfekt zu jemand so Ungeduldigem passte. Während der Tee zog, warf Norcott einen Blick in den Eisschrank, was eigentlich überflüssig war, da er ihn fast nie benutzte. Dann holte er seine Thermoskanne aus dem Küchenschrank und füllte den Tee ein. Im Schlafzimmer packte er die letzten Kleidungsstücke ein, dann brachte er die beiden Koffer nach unten. Nach einer Dreiviertelstunde in seiner Wohnung war er wieder auf dem Weg zum Anleger und nach Guernsey. Falls sich die kleine Besatzung der Fähre wunderte, Norcott so bald wiederzusehen, ließ niemand etwas erkennen.
Es war noch Zeit bis zur Abfahrt, aber der Chief Inspector zog sich gleich wieder in seinen Winkel der Kabine zurück. Aus einem der Koffer holte er die Thermoskanne und einen Roman, den er noch in London gekauft hatte. Wickford Point von John P. Marquand schien genau die Art beißenden Spotts zu enthalten, die Norcott liebte. Als nach zehn Minuten der Diesel angelassen wurde und sich die Fähre vom Anleger löste, schaute Norcott nur kurz hoch. Marquands liebevoll-spöttische Abrechnung mit der besseren Neu-England-Gesellschaft hatte ihn schon ganz gefangen.
Sie hatten Jersey westlich umrundet und geraden Kurs auf St. Peter Port genommen, als die Passagiere plötzlich unruhig wurden. Norcott sah von seinem Buch auf und brauchte nur den Blicken der Menschen zu folgen, um den Grund der Unruhe zu erkennen. Von Osten näherte sich ein einzelnes Flugzeug. Ein weiteres Mal verfluchte sich Norcott, auf diesem Boot gefangen zu sein. Falls es eine deutsche Maschine war und sie angreifen wollten, gab es für die Passagiere keine Chance. Als die Maschine noch knapp eine halbe Meile entfernt war, drückte der Pilot sie in einem Bogen nach unten und umrundete die Fähre wie ein hungriger Wolf sein Wild. An dem dreimotorigen Flugboot mit dem schlanken Schwimmerrumpf waren jetzt deutlich die schwarz-weißen Balkenkreuze der deutschen Luftwaffe erkennbar. Ebenso deutlich sichtbar waren die Bomben, die unter den Tragflächen aufgehängt waren. Wulstige, hässliche Apparate des Todes.
Die anfängliche Nervosität der Fahrgäste schlug rasch in offene Angst um. In immer engeren Kurven zog das Flugboot seine Kreise um die kleine Fähre. Kinder begannen zu weinen, die Menschen drängen sich in die Ecken des Bootes. Norcott war in den vorderen Steuerstand der Fähre gehetzt und beriet sich mit dem Kapitän. Konnten sie irgendetwas tun? Dem Flugzeug signalisieren, dass hier nur verängstige Zivilisten um ihr Leben fürchteten? Es gab einen Aufschrei bei den Passagieren, als sich der Maschinengewehrstand im Heck des Flugbootes zur Fähre drehte und sie anvisierte. Ohne weiter zu überlegen, hechtete Norcott in den Fahrgastraum zurück und riss eine der weißen Tischdecken herunter. Mit drei, vier langen Schritten war er draußen auf dem Vorschiff und schwenkte die Tischdecke minutenlang wie eine Fahne. Schließlich ließ er den Arm sinken, hörte auf, das kreisende Flugzeug mit den Augen zu verfolgen. Er wünschte sich nur noch, es möge endlich etwas passieren, etwas das diesem ewigen Umfliegen, dem Belauern ein Ende machte.
Kapitel 10
St. Peter Port, Hotel »Guillaume de Beauvoir«
Sonntag, 23. Juni 1940, später Abend
Er hatte die Augen geschlossen. Versuchte, auch die letzten leisen Geräusche in der Hotelbar auszuschließen, wegzudrücken, zu sich zu finden. Und doch blieb dieses eine Geräusch in seinen Ohren: das Gebrumm der Flugzeugmotoren. Dunkel und drohend. Immer noch peinigte ihn die Hilflosigkeit. Der Moment, in dem das Flugboot einfach wieder gestiegen und in Richtung Westen verschwunden war. Ihn achtlos zurückgelassen hatte. Auch wenn er inzwischen seine äußere Ruhe wieder gewonnen hatte, innerlich war er noch aufgewühlt, voll hilfloser Wut. Über den Krieg, die Regierungen, aber vor allem über sich selbst. Über seine Wahnsinnsidee, sich nur wegen ein bisschen Kleidung und ein paar Erinnerungsstücken acht Stunden lang zur Zielscheibe zu machen. Er hielt das schwere Kristallglas mit beiden Händen und sog den warmen Duft des Whiskys ein, als er sanft an der Schulter berührt wurde.
»Nicht erschrecken.«
Als er aufsah, lächelte ihn Vicky Rhys-Lynch an, mit einer Mischung aus Frage und Sorge.
»Ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, Sie anzusprechen. Sie waren so versunken. Als Waliserin weiß ich, was für eine Sünde es ist, jemanden bei so einem Genuss zu stören. Aber ich habe das Gefühl, sie genießen gar nicht.« Sie hatte es so ernsthaft gesagt, dass er lächeln musste.
»Miss Rhys, nein, Sie stören nicht. Ich … wie hat es Sie …?« Er sah sich in der Bar nach ihrer eventuellen Begleitung um, aber niemand schien sich für sie zu interessieren. »Wollen Sie sich nicht einen Moment setzen?«
Vicky musste lachen. »Vielen Dank, Chief Inspector. Die Freunde, mit denen ich gegessen habe, sind bereits gegangen. Ich wollte mich auch gerade auf den Heimweg machen, aber dann sah ich Sie hier sitzen und da fand ich es doch unhöflich, meinem neuen Chef nicht wenigstens einen guten Abend zu wünschen.« Sie strahlte ihn aus ihren blauen Augen an und er war wieder von der souveränen Energie, die sie ausstrahlte, beeindruckt.
Er kam sich wie ein Trottel vor und fragte sich, wo seine Souveränität blieb, sobald Sie in seine Nähe kam. Zu allem Überfluss beugte sie sich auch noch zu ihm herüber und er konnte den dezenten Duft ihres Parfums riechen.
»Was trinken Sie denn Gutes?«
»Balvenie, aus dem persönlichen Vorrat des Hotelbesitzers.« Wie er jetzt erst bemerkte, bildeten sich zwei kleine Grübchen, wenn sie lächelte.
»Oh, in Toddys Privatbesitz wildere ich besonders gern.« Sie lehnte sich wieder in ihrem Sessel zurück und strich sich nachdenklich die blonden Wellen aus dem Gesicht. »Geben Sie mir Polizeischutz, wenn ich nachher nicht mehr allein gehen kann?«
Wenigstens jetzt hätte er eine Antwort parat gehabt, wenn nicht in diesem Moment Hetty, die Bedienung, am Tisch aufgetaucht wäre.
»Ich wusste gar nicht, dass Sie Miss Rhys-Lynch kennen, Chief Inspector!« Norcott setzte zu einer Antwort auf die mit einem winzigen Fragezeichen versehene Bemerkung an, als Vicky Rhys der Bedienung schon vertraulich eine Hand auf den Arm gelegt hatte. »Hetty, alles dienstlich! Und natürlich streng geheim.«
»Schade«, war der einzige trockene Kommentar, den Hetty dafür übrig hatte. Den begleitenden Blick konnte Norcott ebenso wenig deuten, wie Hettys plötzliche Einsilbigkeit. Einen kurzen Moment gingen Blicke zwischen den beiden Frauen hin und her, dann sah Vicky Rhys auf den Tisch und Hetty erklärte, sie werde mal schauen, wo das Essen bliebe. Auch wenn Charles Norcott das kleine Geplänkel nicht deuten konnte, wollte er doch wieder in sicherere Gewässer zurückkehren und sagte: »Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, mich richtig bei Ihnen zu bedanken. Wir sind froh, jemanden für die Zeichnungen zu haben.« Er hatte versucht, so viel Wärme wie möglich in seine Worte zu legen und Vicky Rhys lächelte freundlich-verlegen. »Haben Sie denn mit den Bildern etwas anfangen können, Chief Inspector?«
Norcott wurde es warm und er fühlte sich wie ein Halbstarker, so nervös war er. Aber er sagte endlich: »Vicky, wollen Sie nicht Charles sagen?« Er machte dabei ein so zweifelndes Gesicht, dass Vicky Rhys lachen musste. »Aber Charles, nun schauen Sie doch nicht so skeptisch. Natürlich gern. Dachten Sie, ich würde nein sagen?« Als sie ihn ansah, verschwand ihr Lächeln für eine Sekunde, aber da erschien schon Hetty aus der Küche und servierte Norcotts Essen. Er entschuldigte sich bei Vicky Rhys höflich und begann hungrig zu essen.
»Und du? Auch noch einen Scotch?«, fragte Hetty.
»Nein, dank dir. Ich würde lieber zu Weißwein wechseln, sonst muss mich Charles wirklich nachher nach Hause tragen.«
Die resolute Hetty quittierte die Bemerkung mit einem Blick auf Norcott, als hielte sie das für das Mindeste. Aber den Weißwein servierte sie prompt.
Der Wildauflauf, den Norcott bestellt hatte, war hervorragend und der Chief Inspector spürte nun schmerzhaft, wie ausgehungert er gewesen war. Vicky war eine aufmerksame Gesellschafterin, die sich mit ihm unterhielt, ohne lange Beiträge von ihm zu erwarten.
Er legte das Besteck beiseite. »Vicky, es tut mir leid. Ich esse Ihnen hier etwas vor und lasse Sie noch für das Gespräch sorgen.«
»Unsinn, Charles. Nach allem, was ich von Ihnen weiß, waren Sie heute den ganzen Tag auf den Beinen und haben noch nichts Vernünftiges zu essen bekommen.« Sie drehte sich scherzhaft zur Bar um, als vermute sie Hetty als Ursache hinter diesem skandalösen Missstand.
Es war schließlich deutlich nach Mitternacht geworden, als Sie gemeinsam beschlossen, nun auch Hetty den Feierabend zu gönnen und die Bar zu räumen. Vickys kurz aufflammenden Protest, sie könne durchaus auch allein nach Hause finden, unterdrückte Charles Norcott und schob sie sanft in den Dienstwagen, der immer noch quasi vor der Hintertür geparkt war. Es war nur eine kurze Strecke, aber da zur Verdunkelung nur Standlicht erlaubt war, ging es langsam und gemächlich. Vickys Cottage lag oberhalb der Farmain Bay, am Ende einer ruhigen Sackgasse. Norcotts schlechtes Gewissen wegen der Benzinverschwendung hielt sich in Grenzen.
Das Cottage sah aus, so viel Norcott im Mondschein erkennen konnte, wie ein Modellbeispiel aus dem Katalog Ländliche Cottages in Südengland. Das weiß-blau gestrichene Haus duckte sich, wie viele der alten Häuser an der Küste, in eine künstliche Senke. Die Eingangstür hinter einem niedlichen kleinen Glasvorbau führte dann zu einer kurzen Treppe mit drei Stufen. Während Vicky die Eingangstür aufschloss, räusperte sich Charles Norcott. Sie drehte sich um und sah ihn interessiert an. »Ja?«
»Ich … ähm … ich wollte Ihnen nur Gute Nacht wünschen.«
Sie betrachtete ihn, ruhig. Als sähe sie ihn das erste Mal. Dann schüttelte sie ganz leicht, nur angedeutet den Kopf. »Seien Sie nicht töricht, Charles.«
Kapitel 11
St. Peter Port, Polizeizentrale
Montag, 24. Juni 1940, morgens, kurz nach halb sieben Uhr
Seit die Sonne vor knapp zwei Stunden aufgegangen war, schien es, als wolle sie heute mit aller Macht jeden trüben Montagsgedanken im Keim ersticken. St. Peter Port war in strahlendes Morgenlicht getaucht, von See kam eine leichte Brise mit frischem Salzgeruch. Ein Tag, wie geschaffen, um Dinge in Bewegung zu bringen, dachte Charles Norcott bei sich, während er aus seinem Wagen stieg. Dass er gerade einmal drei Stunden geschlafen hatte, spürte er kaum noch und eine frische Tasse Tee würde den Rest Müdigkeit vielleicht beseitigen.
Wie immer sprach der Chief Inspector zuerst mit dem diensthabenden Sergeant der Wache, aber es war wieder eine ereignislose Nacht gewesen. Die Ruhe erinnere ihn an die stillen Wintermonate, meinte der Sergeant. Die Insel verfiel dann fast in eine Art Winterschlaf. Wenn alle Felder abgeerntet und die letzten Urlauber abgereist waren, dann war es, als wenn alles und jeder auf der Insel sich nach innen wandte, um neue Kraft zu sammeln. Der Kanal hüllte die Inseln regelmäßig in grauen Nebel oder lang andauernden diesigen Regen und die Straßen wurden menschenleer.
Norcott ertappte sich wieder dabei, zu wünschen, dieser verdammte Krieg möge endlich den nächsten Schritt tun, statt wie eine dunkle, aber ferne Gewitterwolke ständig zu drohen.
Er warf einen Blick in das Büro der Sergeants, aber entweder waren Pearson und Mulgrave noch nicht im Dienst oder im Haus unterwegs. Er ging in sein Büro, hängte seinen Hut an den Kleiderständer und nahm sein Notizbuch aus der Tasche. Bereits bei seinem schnellen Frühstück war er die Punkte durchgegangen, die heute angepackt werden mussten. Die nächste Viertelstunde würde er nutzen, um die Fallakte mit seinen Aufzeichnungen abzugleichen.
Nach einem kurzen Umweg über die Teeküche betrat Norcott gegen sieben Uhr den Besprechungsraum. Wie immer bei der Montagsbesprechung waren die beiden Detective Sergeants, Mulgrave und Pearson, der leitende Sergeant der Kriminaltechnik, Roderick Alleyn sowie Hubert Haydon als dienstältester Detective Constable anwesend. Bevor sie sich dem Fall Nora Henley widmen konnten, waren einige andere Dinge zu besprechen und eine ganze Reihe von Aufträgen zu verteilen. Von der Inselverwaltung war, noch am Freitag, eine Reihe von Fragen eingetroffen, für die von der Polizei Vorschläge erarbeitet werden sollten. Norcott verteilte diese Extraarbeit so gleichmäßig es ging, um dann zur aktuellen Mordermittlung überzugehen.
Norcott fasste das Ergebnis der Obduktion zusammen, dann kam er zu den Aufträgen. »Die Befragung in den Ladengeschäften in der Wohngegend der Henleys, die wir am Freitagnachmittag abgebrochen hatten, muss fortgesetzt und abgeschlossen werden. Clive, das ist Ihre Baustelle!« Mulgrave nickte und hob gleichzeitig fragend den Bleistift.
»Ja, Clive?«
»Ich habe auch den Pfarrer noch auf der Liste. Dazu die Frage: Wenn der Leichnam zur Beerdigung freigegeben wurde – wissen wir schon, wann und wo sie beerdigt wird?«
»Gute Frage. Nein, das wissen wir noch nicht. Ich gehe aber davon aus, dass die Beerdigung heute oder morgen stattfinden wird.« Er sah auf die Uhr. »Sobald wir eine halbwegs christliche Zeit erreicht haben, rufen Sie bitte im Pfarramt an und fragen nach. Ich möchte mir das nicht entgehen lassen! Das wird eine der wenigen Chancen sein, eventuelle Freundinnen abzufangen und auch sonst möchte ich gern sehen, wer sich auf dieser Beerdigung blicken lässt. Es wäre gut, wenn Sie auch dabei wären, Clive, vier Augen sehen mehr als zwei.«
»Ja, Sir, wer macht dann mit den Befragungen weiter?«
»Constable Haydon?« Norcott sah ihn an. »Und Sie können den jungen Robertson mitnehmen.«
Der Angesprochene nickte. »Kein Problem, Sir.«
»Gut, das wäre geklärt. Dann noch eine Sache. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass Mrs. Henley schon einen Schwangerschaftsabbruch hatte, der mit Sicherheit nicht im Krankenhaus oder von einem Arzt vorgenommen wurde. John, können Sie herausfinden, wer dafür infrage kommt? Gibt es Engelmacherinnen, von denen wir wissen? Sobald wir Namen haben, müssen die abgeklappert werden. Kernfragen dabei sind klar: Wer war der Vater? Warum hat sie abgetrieben? Vielleicht kommt dabei auch ein bisschen mehr Licht in die Frage, wieso sie dieses Kind jetzt offensichtlich bekommen wollte. Obwohl ihr Mann vehement behauptet, sie hätte so gar keine Lust auf Mutterfreuden gehabt.«
»Ja, kein Problem«, sagte Sergeant Pearson. »Ich kümmere mich darum.«
»Ach, und John. Sie hatten doch schon einmal mit den Eltern von Nora Henley telefoniert. Rufen Sie sie noch einmal an und versuchen Sie, Namen und Telefonnummern von diesen Freundinnen herauszufinden, die Mr. Henley erwähnt hat. Von ihm haben wir da keine weiteren Details zu erwarten, aber wir müssen unbedingt mehr über Mrs. Henley herausfinden. Dabei können uns die Freundinnen vielleicht weiterhelfen. Auch wenn, laut Aussage von Mr. Henley, kein Kontakt mehr bestand. Ich will das überprüft haben!«
Norcott sah auf seine Aufzeichnungen, dann kam er auf einen anderen Punkt. »Was ist mit den Evakuierungslisten aus dem Hafenamt? Sind wir da schon einen Schritt weiter mittlerweile?« Er sah John Pearson an, der mit genervtem Blick die Luft einsog. Norcott schaute ihn amüsiert und gleichzeitig fragend an.
Pearson atmete nochmals tief ein, dann antwortete er: »Zuerst, um Ihre Frage zu beantworten, Chief, nein, wir sind keinen Schritt weiter! Ich habe am Freitag sage und schreibe fünf Mal einen Constable zum Hafenamt laufen lassen, um nach den Listen zu fragen. Nachdem er das zweite Mal mit leeren Händen zurückkam, weil die Listen angeblich noch nicht fertig seien, bin ich selber runter.« Sein Gesichtsausdruck verriet, dass nun wieder eines seiner gefürchteten Urteile kommen würde. »Das gesamte Hafenamt ist ein einziges, gottverdammtes Chaos! Wenn man eine Bande Paviane mit einer Kiste Handgranaten dort einen Tag einsperren würde, könnte das Ergebnis nicht schlimmer sein als der Zustand jetzt.« Pearsons bildhafter Vergleich führte zu einem kurzen Heiterkeitsausbruch in der Runde, aber der Sergeant schien ehrlich erschüttert.
»So wie ich die Lage beurteile, sind überhaupt keine richtigen Listen im eigentlichen Sinne geführt worden. Durch die Eile bei der Organisation hat man sich mit einem minimalen Standard zufrieden gegeben. Und das hieß, dass die Namen derjenigen, die evakuiert werden wollten, auf irgendwelche Zettel notiert wurden und man hat dann, gleichzeitig zu den ständigen Änderungen, versucht, daraus Listen zu basteln. Gut, das lässt sich nun nicht mehr ändern. Jedenfalls habe ich dem Hafenmeister gesagt, ich will die vollständigen Listen heute auf dem Schreibtisch haben, gleichgültig, ob er durcharbeitet.«
Norcott nickte zustimmend. »Gut, John. Es hilft nichts, wir müssen das in den Griff bekommen. Die Frage, ob sie weg wollte, ist zu wichtig. Notfalls muss ich über den Bailiff Druck machen.«
Sie beendeten die Besprechung und jeder ging an seine Aufgaben. Für den Chief Inspector hieß das auch, zurück an den Schreibtisch und zurück zum Papierkrieg. Zuerst würde er jedoch routinemäßig Kontakt zu den unterstellten Polizeistellen auf den anderen Inseln aufnehmen. Er begann mit seinem Stellvertreter auf Jersey. Zu seiner Erleichterung war die Lage dort noch verhältnismäßig ruhig. Leider stieg auch auf Jersey die Zahl von Flüchtlingen, die versuchten, sich aus Frankreich zu retten, nahezu stündlich. Dieses Problem baute sich immer drohender auf. Als Norcott das Gespräch mit seinem Stellvertreter beendet hatte, telefonierte er sofort danach mit der kleinen Polizeiwache auf Sark. Von Alderney, wo sich bisher auch ein Polizeiposten befunden hatte, waren alle Constables abgezogen, nachdem so gut wie alle Einwohner evakuiert worden waren. Auf Sark war alles ruhig geblieben. Nach einem Appell der Dame of Sark, der Feudalherrin der Insel, waren die ungefähr fünfhundert Bewohner alle geblieben und igelten sich in ihrer kleinen Gemeinschaft ein. Wahrscheinlich, dachte Norcott bei sich, das Beste, was sie tun konnten.
Um kurz nach acht Uhr schaute Sergeant Mulgrave herein. »Ich habe eben die Sekretärin der Kirchengemeinde erreicht. Die Beerdigung von Nora Henley ist schon auf heute, zehn Uhr, festgelegt; auf dem Hauptfriedhof an der Foulon Road.«
»Na, da hat sich Mr. Henley ja nicht viel Zeit gelassen.« bemerkte Norcott nachdenklich. Er sah Mulgrave an, der sich mit einem Bleistift über dem Ohr kratzte.
»Das hab ich auch gesagt. Also, es ist mir rausgerutscht, als ich mit der Sekretärin telefoniert habe.« Norcott zog fragend die Augenbrauen hoch. »Sie meinte, er sei äußerst eindringlich gewesen, was den Termin anging.«
Norcott sah einen Moment abwesend aus dem Fenster und sagte dann langsam: »Was immer das bedeuten mag.« Er straffte sich. »Gut. Nehmen wir das in das Gesamtbild auf. Dann fahren wir in einer knappen Stunde los. Das gibt uns Zeit, um rechtzeitig vor den Trauergästen auf dem Friedhof zu sein.«
* * *
Sie fuhren dann zu dritt aus der Stadt in Richtung Friedhof. Sergeant Mulgrave hatte vorgeschlagen, auch Albert Lancer mitzunehmen, der in St. Peter Port geboren und aufgewachsen war und eine Menge Leute kannte.
Es war kein leichter Gang für Charles Norcott. Er war vor zwei Jahren nicht auf der Beerdigung seiner Frau gewesen, weil er es einfach nicht fertiggebracht hatte, sie in einer Holzkiste liegen zu sehen, und in den Monaten danach war er nur zweimal an ihrem Grab gewesen. Das zweite Mal an dem Tag, an dem er von seiner Versetzung nach Jersey erfahren hatte. Allein die Vorstellung, dass die Frau, die er geliebt hatte, jetzt in der kalten Friedhofserde lag, hatte ihn dabei fast um den Verstand gebracht. Auch darüber hatte er gestern Nacht gesprochen, aber diesen Gedanken schob er jetzt von sich.
Um sich abzulenken, fing er mit Constable Lancer ein Gespräch über dessen neu geborene Zwillinge an. Wie öfter bei jungen Ehepaaren, war die Schwangerschaft nicht so früh geplant gewesen, aber sie hatten es als unverhofftes Geschenk betrachtet und sich gefreut. Albert Lancer schien unbändig stolz darauf, Vater zu sein und auch Clive Mulgraves frotzelnde Bemerkungen über seine eigenen wilden Töchter konnten seinen Enthusiasmus nicht bremsen.
»Na ja. Als wir dann aber beim Arzt waren und er uns gesagt hat, wir sollen uns auf mehr als ein Baby einstellen, war es schon erst ein Schlag.« Lancer schüttelte lächelnd den Kopf. »Ich hab’s erst gar nicht verstanden. Und dann konnte ich immer nur daran denken, dass wir alles zweifach kaufen müssen.«
»Söhne oder Töchter?«, wollte Norcott wissen.
»Von jedem eins sozusagen. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass sie nicht eineiig sind. Das ist mir immer ein wenig unheimlich gewesen.«
Sie hatten inzwischen eine Stelle erreicht, von der sie das Grab und den Weg dorthin überblicken konnten. Als der Trauerzug schließlich in Sicht kam, war es eine herbe Enttäuschung. Dem Sarg folgten nur etwa ein Dutzend Menschen. Neben William Henley gingen seine Eltern, ein jüngeres Paar dahinter waren sein Bruder mit dessen Ehefrau. Außerdem im Familienkreis ein deutlich älteres Paar, höchstwahrscheinlich die Großeltern. Mrs. O’Meare war ebenfalls gekommen und ein Herr im grauen Anzug.
»Das ist der Filialleiter der Western Channel Bank«, sagte Lancer. »Ein Mr. Carthing oder Carthwright oder so ähnlich.«
»Den möchte ich mir nachher gleich mal schnappen«, erwiderte Norcott. Wir müssen endlich mehr über dieses Paar erfahren, das niemanden kannte und mit niemandem befreundet war.«
Die restlichen vier Personen, zwei Paare, waren ganz augenscheinlich mehr mit den Eltern William Henleys befreundet, als mit ihm. So kurz der Trauerzug gewesen war, so kurz war die Beerdigung.
»Es scheint fast so, als wüsste der Pfarrer noch weniger über Mrs. Henley zu sagen als wir«, bemerkte Mulgrave in bitterer Ironie. Und tatsächlich war es eine der kürzesten und schmucklosesten Beerdigungen, die Charles Norcott je gesehen hatte.
»Er hat seine Trauer aber gut im Griff«, meinte Lancer und Norcott nickte. »Selbst wenn er wusste, dass sie ihn betrügt und er sich damit abgefunden hat – er wirkt absolut unbeteiligt. Er ist überhaupt nicht wirklich da …« Er suchte nach einem Vergleich.
»Wie ein Statist«, ergänzte Mulgrave. »Er wirkt wie ein Statist, der seine Rolle nicht verstanden hat.«
Die kleine Trauergemeinde löste sich bereits am Grab auf. Während die Familienangehörigen und die zwei älteren Paare noch stehenblieben und sich leise unterhielten, verabschiedeten sich Mrs. O’Meare und der Filialleiter schnell.
»Clive, bleiben Sie noch einen Moment? Nur falls noch etwas passieren sollte? Ansonsten halten Sie bitte den Pfarrer auf, den möchte ich auch gleich noch sprechen. Lancer? Wir werden mal den Bankmenschen und Mrs. O’Meare abfangen.«
Sie hielten beide am Haupteingang des Friedhofs an der Foulon Road auf. Mr. Carthwright wirkte so unbeteiligt wie sein Angestellter, willigte aber in ein Gespräch mit Norcott am Nachmittag ein. Mrs. O’Meare schien die einzige zu sein, die ein paar echte Tränen um die Verstorbene vergossen hatte. Auch mit ihr verabredete sich Norcott, diesmal für die Teezeit. Blieb noch der Pfarrer. Aber auch hier kam Sergeant Mulgrave mit einer Enttäuschung.
»Keine guten Nachrichten, Chief. Der Pfarrer sagte, er hätte gestern das erste Mal überhaupt bewusst mit Mr. Henley gesprochen. Sie, Nora, hat er seiner Aussage nach nie zu Gesicht bekommen und wusste auch ansonsten nichts über das Paar. Keine Gerüchte, Gerede oder Sonstiges. Eine absolute Niete, um es so zu sagen. Falls Sie ihn doch noch selbst sprechen wollen, Sir, er ist ab heute Abend ab circa halb sieben im Pfarrhaus. Die Adresse habe ich aufgeschrieben.« Er sah Norcott enttäuscht an.
»Ein Punkt weniger auf der Liste, Clive. Keine Zeit unnötig verschwenden.« Norcott lächelte aufmunternd. »Dann wollen wir mal wieder zurück.«
Kapitel 12
St. Peter Port, Polizeizentrale
Montag, 24. Juni 1940, nach elf Uhr
Als die drei Polizisten schließlich wieder in der Hospital Lane ankamen, hatte Charles Norcott das Gefühl, wertvolle Zeit vertan zu haben. Fast vier Tage waren seit dem Mord vergangen und sie hatten nichts wirklich Greifbares vorzuweisen.
Auf dem Flur kam ihnen Pearson entgegen. »Der Obduktionsbericht ist gekommen, Chief.«
»Danke John. Wo ist er?«
»Unter den Tomaten, Sir«, antwortete Pearson leutselig und griff nach hinten, um die Bürotür des Polizeichefs zu öffnen. Norcott warf einen erstaunten Blick in sein Büro.
»Allmächtiger!«
»Nein, Chief, nur Dr. Hamilton.« Pearson schmunzelte. Auf dem Schreibtisch standen drei aufgetürmte Holzstiegen mit leuchtend roten Tomaten. Norcott strich sich ratlos über den Kopf. »Dieser Verrückte.«
Mulgrave hatte die ganze Zeit feixend dabei gestanden, als sich Pearson zu ihm umdrehte und auf die Brust tippte. »Du isst doch bestimmt auch gern Tomaten?«
Wortlos ging Mulgrave einen Schritt zur Seite und öffnete seine eigene Bürotür. »Na, meine Frau wird sich freuen …«
Pearson konnte seine Heiterkeit kaum bezähmen. »Möchte einer der Herren vielleicht einen Tee zu seinen Tomaten? Ich war gerade auf dem Weg.« Er hielt seinen Teebecher hoch.
Wie Pearson dann berichtete, war Dr. Hamilton kurz vor Mittag mit einem kleinen Lieferwagen vorgefahren, randvoll mit Tomaten. Alles Überschüsse von der Farm seiner Schwiegereltern und nicht mehr exportfähig. Die hatte er dann freigiebig unter den Polizisten verteilt.
Charles Norcott hatte sich nach dem wenig ergiebigen Morgen erst einmal in sein Büro zurückgezogen und betrachtete die rote Pracht auf seinem Schreibtisch. Kurz entschlossen griff er zum Telefonhörer und wählte.
»Vicky? Charles hier. Ja, guten Morgen. Eine Frage: Kannst du einkochen?«
Nachdem sie erst einmal eine Minute in den Hörer geprustet hatte, sagte sie, immer noch lachend: »Charles, nach gestern Abend hätte ich sicher mit allem Möglichen gerechnet, wenn du mich heute anrufst, aber nicht damit!«
Norcott räusperte sich verlegen. »Hm, wir sollten vielleicht auch über andere Dinge sprechen.« Erneutes Räuspern. »Aber kannst du einkochen?«
Nachdem sich ihre Heiterkeit etwas gelegt hatte, verabredeten sie sich für den Abend, bis dahin wollte er auch seine Termine hinter sich haben.
Während er noch kopfschüttelnd auf die Kisten starrte, fiel ihm siedend heiß der Obduktionsbericht ein. Wo war der denn abgeblieben? Er schichtete die Kisten von seinem Schreibtisch und tatsächlich lag der Bericht, wie John Pearson gesagt hatte, unter der untersten Kiste. Erwartungsgemäß enthielt der Bericht nur die schriftliche Bestätigung für das, was Dr. Hamilton ihnen schon am Samstag im Krankenhaus erzählt hatte. Auf echte Überraschungen hatte Norcott auch nicht mehr gehofft.
Wieder sah Norcott auf die Uhr. Der Tag war definitiv halb herum und an keiner Front gab es irgendwelche Fortschritte. Er überlegte gerade, kurz etwas essen zu gehen, als das Telefon klingelte. Als Norcott abhob, meldete sich sein Stellvertreter aus Jersey.
»Entschuldigung, Chief. Ich weiß, wir hatten eigentlich heute Morgen schon alles besprochen, aber ich hatte gerade ein ausgesprochen langes Gespräch mit der hiesigen Verwaltung. Können wir das noch klären?«
Der Chief Inspector, froh darüber, wenigstens hier etwas bewegen zu können, bejahte. Es wurde dann doch eine lange Liste von Punkten, die besprochen werden mussten. Es begann gleich mit einem, aus Norcotts Sicht ärgerlichen und überflüssigen Punkt. Die Verwaltung von Jersey hatte sich indirekt über Norcotts lange Abwesenheit beklagt. Mein Gott, ich bin gerade seit Donnerstagnachmittag hier, dachte Norcott bei sich. Offiziell ließ man anfragen, ob er nicht an der morgigen Sitzung des Verwaltungsrates teilnehmen könne. Norcott platzte der Kragen und den ersten Sturm bekam sein Stellvertreter ab.
»Entschuldigen Sie, Richard. Sie haben ja keine Schuld, ich werde gleich mit dem Bailiff telefonieren und das klären. Sie sind mein offizieller Vertreter und man wird lernen müssen, Sie zu respektieren.«
Sie gingen wieder zu der Liste offener Punkte zurück und tauschten sich aus. Nach einer Dreiviertelstunde hatten sie alles besprochen. Norcott legte nur auf, um gleich wieder zu wählen. Er wollte den Bailiff von Jersey, Alexander Coutanche, direkt anrufen, musste sich aber mit dessen Stellvertreter zufriedengeben. In seinem Gesprächspartner sammelten sich alle unangenehmen Eigenschaften, die Norcott an Berufspolitikern ablehnte. Und dieser Mann, das war zumindest Norcotts Eindruck von wenigen Begegnungen auf Jersey, hatte ganz persönlich für sich noch ein paar schlechte Eigenschaften zusätzlich erfunden. Trotzdem versuchte der Chief Inspector, die Form zu wahren, was ihm allerdings nur bedingt gelang. Es gipfelte schließlich darin, dass er es rundheraus ablehnte, sich acht Stunden lang in einer kleinen Fähre durch Kriegsgebiet kutschieren zu lassen, nur um an einer Verwaltungssitzung teilzunehmen. Die Fahrt vom Sonntag lag ihm noch im Magen und er ärgerte sich weiterhin über seinen eigenen Leichtsinn. Da er gerade so schön in Fahrt war, stellte er den Fährdienst zwischen den Inseln generell infrage.
»Es ist absolut unverantwortlich, die Leute völlig ungeschützt durch den Kanal schippern zu lassen. Was? Natürlich sind das Zivilisten! Das sind die Seeleute auf Handelsschiffen auch. Die deutschen U-Boote torpedieren sie trotzdem. Wir haben Krieg, guter Mann, falls Ihnen das noch nicht aufgefallen ist! Ja, beschweren Sie sich ruhig bei Sir Philip. Viel Erfolg dafür!«
Er knallte den Hörer auf die Gabel. Ein Blick auf die Uhr und er fluchte gleich noch einmal kräftig. Es war bereits kurz vor drei und er musste sich auf den Weg zur Western Channel Bank machen. Mit dem Wagen wäre er in den engen Straßen der Innenstadt nicht schneller gewesen, deshalb ging er zu Fuß zur Bank. Knurrend meldete sich sein Magen zu Wort und er fluchte ein weiteres Mal.
Norcotts Stimmung hätte sich sicher noch weiter verdüstert, wenn er nicht in diesem Moment an die Tomaten und damit an seine abendliche Verabredung mit Vicky gedacht hätte.
So kam er doch mit halbwegs guter Laune in der Bank an und wurde direkt zum Filialleiter geführt. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass Mr. Carthwright wenig über seinen Angestellten und nichts zu dessen verstorbener Ehefrau sagen konnte.
»Es tut mir außerordentlich leid, Chief Inspector, aber ich werde ihnen wenig Persönliches zu William Henley sagen können. Es ist zwar richtig, dass persönliche Kontakte unter den Angestellten im Hause ohnehin nicht gern gesehen werden, aber …« Carthwright zögerte einen Moment, »Aber Henley … Henley ist irgendwie noch ein Sonderfall.« Er nahm einen Brieföffner und begann gedankenverloren damit zu spielen.
Als die Pause zu lang wurde, setzte Norcott nach. »Sonderfall? Wie darf ich das verstehen?«
Der Filialleiter schüttelte leicht den Kopf. »Ich wünschte, ich könnte Ihnen diese Frage beantworten. Henley ist eine blasse Person. Nichtssagend, fast würde ich sagen einfältig.« Er hob die Hand. »Bitte nicht missverstehen. Nicht einfältig im Sinn von naiv oder dumm – auch wenn ich ihn nicht für sonderlich intelligent halte – nein, eher im Sinne von in sich gekehrt.«
Carthwright war eine stattliche Persönlichkeit, dessen graue Schläfen fast zu perfekt seine Kompetenz zu unterstreichen schienen. Jetzt jedoch wirkte er unzufrieden mit sich.
Er setzte neu an. »Ich hatte vor ungefähr einem halben Jahr ein Gespräch mit meiner Stellvertreterin, rein routinemäßig sind wir die Personalakten durchgegangen. Es scheint so, als wenn Henley wenig mehr mit den Kollegen austauscht als Guten Morgen und Guten Abend. Sie hat damals eine Bemerkung gemacht, die ich jetzt, im Zusammenhang, interessant finde. Sie sagte, bei Henley komme es ihr so vor, als spiele er nur den Bankbeamten, als habe er quasi eine Rolle auswendig gelernt. Sicher eine Taktik, durchzukommen. Er beobachtet seine Kollegen und kopiert ihr Verhalten. Meinen Sie nicht?«
Norcott beeilte sich, zuzustimmen, fühlte aber gleichzeitig das Aufglimmen einer Warnlampe.
So blieb noch die dienstliche Beurteilung William Henleys, die aber auch so durchgängig unauffällig mittelmäßig war, dass sich daraus überhaupt kein Ansatzpunkt ergab.
Norcott hatte sich schon vom Besuchersessel erhoben, als Mr. Carthwright gerade sagte: »Damit wir uns nicht missverstehen, ich meine das absolut nicht negativ, aber Mr. Henley ist ein mittelmäßig guter Angestellter und wird es auch immer bleiben.«
Norcott horchte auf. »Ich verstehe Sie also richtig, um es einmal auf den Punkt zu bringen: Mr. Henley wird höchstwahrscheinlich in derselben Position in Pension gehen, in der er jetzt arbeitet? Ist das so richtig?«
Carthwright überlegte einen Moment. »Chief Inspector, natürlich habe ich keine Kristallkugel in meinem Schreibtisch und Wunder geschehen immer wieder, aber um Ihrer Frage nicht auszuweichen: Ich bin nun seit über fünfundzwanzig Jahren Filialleiter und habe eine Menge Filialen und eine Menge Angestellte gesehen. Nach meiner Meinung hat Mr. Henley mit seiner derzeitigen Position als Angestellter im Schalterdienst den Zenit seiner beruflichen Laufbahn erreicht. War das deutlich genug?«
Norcott streckte ihm die Hand hin. »Ja, vielen Dank, Mr. Carthwright, Sie haben mir sehr geholfen.« Sie verabschiedeten sich.
Auch wenn es schien, als habe sich an diesem Montag alles gegen die Ermittlungen verschworen, so konnte er mit dieser Aussage dem Mosaik doch wieder ein Steinchen hinzufügen: Für William Henley war seine berufliche Karriere in einer Sackgasse gelandet. Leider ergab sich daraus wieder eine Reihe von Fragen. Hatte er sich damit abgefunden? Hatte Nora sich damit arrangiert? Was, wenn sie eine der beiden Fragen mit nein beantworten mussten? Aus einer Eingebung heraus kehrte Norcott noch einmal in die Bank zurück.
Nur einige Momente später trat Norcott zum zweiten Mal auf die North Esplanade hinaus. Nachdenklich ging er durch die engen Straßen St. Peter Ports zurück. Das warme Sommerwetter stand im krassen Gegensatz zur überall spürbaren Stimmung. Unübersehbar waren nun die Kriegsfolgen in dem sonst so lebendigen Stadtzentrum. Zahlreiche Geschäfte waren geschlossen, Schilder an den noch offenen Läden verwiesen auf Rationierungen oder fehlende Waren. Die wenigen Passanten wirkten gehetzt, die frühere Leichtigkeit des Ortes begann langsam aber sicher zu ersticken.
Von der Hospital Lane aus fuhr Norcott mit dem Wagen zu Mrs. O’Meare, die etwas außerhalb im Stadtnorden wohnte. Er war ein bisschen zu früh, aber Kleinigkeiten wie unpünktlicher Besuch konnten eine Frau wie Libby O’Meare nicht aus der Ruhe bringen. Die kleine Wohnung umfing ihn sofort mit warmer Gemütlichkeit. In der Küche erledigten zwei Mädchen gerade ihre Schularbeiten. Sie wurden aber trotzdem verdonnert, artig Guten Tag zum Chief Inspector zu sagen.
Mrs. O’Meare servierte im behaglichen Wohnzimmer Tee und stellte auch einige Kekse dazu. Norcott war heilfroh, endlich etwas in den Magen zu bekommen. Wie es ihre Art zu sein schien, kam Mrs. O’Meare übergangslos auf Nora Henley zu sprechen.
»Ja. Mrs. Henley. Schreckliche Sache.« Sie setzte sich zurecht. »Was wollen Sie wissen, Herr Inspector?«
Norcott schenkte ihr ein aufmunterndes Lächeln. »Mrs. O’Meare, erst einmal vielen Dank, dass Sie uns weiterhelfen wollen. Ich weiß, dass die Erinnerung an den Tod von Mrs. Henley für Sie schrecklich sein muss.« Er machte eine winzige Pause. »Wissen Sie, ich beschäftige mich jetzt seit fünf Tagen mit Nora Henley. Und ich habe immer noch keine Vorstellung davon, was für ein Mensch sie war. Dasselbe gilt für ihren Mann. Worüber haben Sie gesprochen, wenn Sie sich denn unterhalten haben? Haben Sie auch über persönliche Dinge geredet? Und wenn ja, welche Dinge waren das?«
»Tja, Inspector, wo fang ich da an? Persönliche Dinge, wie soll ich das sagen. Das ist wirklich keine leichte Frage.« Sie errötete und Norcott konnte die Reaktion zuerst gar nicht zuordnen. Schließlich fasste sie sich ein Herz. »Wie sagen die im Theater immer? Sie war eine schöne Larve, wenn Sie mich fragen.«Norcott unterbrach sie nicht, hörte nur ganz still zu.
»Wissen Sie, ich habe zwei Jahre für die Henleys gearbeitet. Zweimal die Woche war ich für den Nachmittag bei ihr. Aber wirklich Persönliches haben wir nie miteinander besprochen und ich glaube, es gab einfach nichts zu besprechen. Oh Gott, steh mir bei, ich werde für das was ich sage, gewiss in der Hölle landen, aber sie war ein absolut berechnendes, egoistisches Ding. Sie hat Stunden damit zugebracht, auf dem Sofa zu liegen, Sie haben ihr Ankleidezimmer ja sicher gesehen. Schallplatten zu hören und die immer gleichen Modemagazine zu lesen war scheinbar ihre Hauptbeschäftigung. Ich glaube …«, wieder musste Mrs. O’Meare etwas Anlauf nehmen, »Mrs. Henleys einzige Bestimmung im Leben war ein möglichst bequemes Leben. Alles andere, ihr Ehemann, ihre Familie, im Grunde die ganze Welt existierte in ihrer Sicht nur zu diesem Zweck.«
Norcott ließ noch einen Moment Stille zu, trank erst noch einen langen Schluck Tee, bevor er nachfasste. »Sie meinen also, sie war sich selbst genug und solange sie das tun konnte, was sie tat, war sie zufrieden? Verstehe ich Sie so richtig?«
Wieder wand sich Mrs. O’Meare etwas, bevor Sie antwortete. »Ja und nein, Inspector. Ich glaube schon, dass sie mit dem Leben, das ihr Mann ihr bieten konnte, zunächst zufrieden war, aber ich glaube auch, nein, ich bin sicher, sie hatte höherfliegende Pläne.«
Jetzt wurde Norcott noch hellhöriger. »Höherfliegende Pläne? Was meinen Sie, wie hätten die aussehen können?«
Die Antwort platzte förmlich aus Libby O’Meare heraus: »Na, ein anderer Mann natürlich! Beziehungsweise, einer mit mehr Geld! Für das Maß an Bequemlichkeit, für das ihr Mann sorgen konnte, gab es noch eine Steigerung, aber eben nicht mit ihm … dem armen Kerl.« Sie seufzte. »Er kann einem leidtun. Sie hatte wirklich kein schlechtes Leben, weiß Gott nicht, aber das war noch lange nicht ihre Endvorstellung vom Paradies!«
Norcott fasste nach: »Mrs. O’Meare, haben Sie je andere Männer in der Wohnung der Henleys gesehen oder Mrs. Henley woanders mit anderen Männern?« Als sie nicht gleich antwortete, beugte sich Norcott ein wenig zu ihr hinüber. »Bitte, Mrs. O’Meare, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, vielleicht der wichtigste. Ich bin kein Sittenwächter, ich bewerte nicht das Privatleben von Nora Henley, aber wir müssen wissen, ob sie ihren Mann betrogen hat.« Er hoffte inständig, Mrs. O’Meare würde jetzt nicht plötzlich eine Art falsch verstandener weiblicher Solidarität entwickeln.
Sie schüttelte den Kopf. »Machen Sie sich keine Sorgen, Inspector, ich sage Ihnen schon was ich weiß. Es ist eher das Problem … ich kann Ihnen nicht wirklich etwas Konkretes sagen. Also zuerst einmal, nein, ich habe Mrs. Henley nie mit anderen Männern zusammen gesehen. Weder in ihrer Wohnung noch sonst wo. Ganz ehrlich: Dafür war sie auch zu schlau, es so offen zu machen.«
»Hm … Sie glauben also nicht, dass sie die oder den Mann zu Hause empfangen hat?«
»Doch … das glaube ich schon und ich sage Ihnen auch gleich warum, aber ich meinte, sie hätte es mir gegenüber nie so offen getan. Wissen Sie, Inspector, als Putzfrau lernt man die Menschen, in deren Wohnung man sich bewegt, sehr gut kennen. Selbst wenn ich zum Beispiel Mr. Henley nur selten begegnet bin, könnte ich Ihnen eine Menge über seine täglichen Gewohnheiten erzählen. Worauf ich hinaus will: Da war eine dritte Person und ich glaube auch eine vierte. Aber wenn Sie mich jetzt nach … wie heißt das? Handfesten Beweisen fragen …«
Norcott blieb weiter still und unterbrach Mrs. O’Meare nicht.
»Also …« Sie setzte sich in ihrem Sessel auf. »Mr. Henley liest so eine teure Zeitschrift für Vogelbeobachter, groß, mit vielen Farbfotos. Er hat sie immer ordentlich nach Nummern geordnet auf einem Haufen im Wohnzimmer. Mrs. Henley fasst die Dinger … fasste die Dinger aber nie an. Trotzdem habe ich zwei-, dreimal aufgeschlagene Exemplare im Wohnzimmer gefunden. Wer hat sie gelesen? Freunde habe ich in zwei Jahren nicht einmal getroffen in der Wohnung und die Familie, seine Familie erst recht nicht. Aber irgendwer hat in den letzten Monaten in diesen Zeitschriften geblättert.« Mrs. O’Meare sah ihn unglücklich an. »Verstehen Sie, was ich meine? Solche Sachen fallen einem eben auf.«
Der Chief Inspector nickte. »Ja, Mrs. O’Meare ich weiß sehr gut, was Sie meinen. Und danke, dass Sie es mir erzählt haben.« Norcott beschloss, noch ein anderes Thema anzuschneiden. »Noch eine andere Sache. Hat Mrs. Henley je über Kinder gesprochen?«
»Kinder?« Mrs. O’Meare rief das Wort fast und wollte sich ausschütten vor Lachen.
Sofort schaute eins der Kinder um die Ecke. »Hast du uns gerufen, Ma?«
»Was? Ich? Nein, meine Schätzchen, ich habe euch nicht gerufen. Der Inspector hat nur einen Scherz gemacht. Geht schön wieder an eure Schularbeiten.« Mrs. O’Meare fixierte den Chief Inspector jetzt mit einer Art grimmiger Entschlossenheit. »Inspector. Ich habe drei Kinder geboren und wenn Gott mir und meinem Mann gnädig ist, so werde ich auch noch einem vierten das Leben schenken. Ich bin da, wenn sie Hunger haben, wenn sie krank sind, ich habe sie gewindelt und gefüttert und tue dies alles gern, weil ich glaube, dass das Gottes Wille und unsere Bestimmung ist. Aber, Inspector, Mrs. Henleys Bestimmung war nur sie selbst. Da war ja nicht mal Platz für einen Hund oder eine Katze, wie das manche Leute heute so haben.«
Charles Norcott war nicht wirklich überrascht von der Aussage, die drastische Deutlichkeit gab ihm aber doch zu denken. Er entschied sich, noch einen Trumpf in die Runde zu werfen. »Also würde es Sie überraschen, wenn Mrs. Henley im vierten Monat schwanger gewesen wäre?«
In Mrs. O’Meares gutmütigen Gesicht spiegelten sich nacheinander Erstaunen, Überlegung und Erkenntnis wider, bevor sie antwortete und es klang fast resigniert. »Inspector, ich sage Ihnen jetzt nur, was ich wirklich aus ehrlichem Herzen glaube. Sie sind ein intelligenter Mensch und wissen inzwischen bestimmt genug von ihr, um sich dasselbe zu denken: Wenn Mrs. Henley ein Kind austragen wollte, dann nur, um den Vater des Kindes an sich zu binden und daraus ihren Vorteil zu ziehen. Ist es nicht so?«
Norcott nickte zwar, aber lenkte das Gespräch lieber in eine andere Richtung. »Eine andere Frage noch, Mrs. O’Meare: Was halten Sie von William Henley? Wie würden Sie ihn charakterisieren?«
Sie trank einen Schluck Tee, richtete ihre Schürze. Fühlte an der Teekanne. Schließlich sah sie Norcott direkt an. »Entschuldigen Sie, Inspector, haben Sie Kinder?«
Er war überrascht, berührt. Aber die Frage war so freundlich gestellt. »Nein, Mrs. O’Meare, ich habe keine Kinder.«
Sie legte den Kopf schräg, als wenn sie seiner Antwort noch einen Moment nachlauschen wollte. »Schade. Ich hätte es Ihnen leichter erklären können. Es gibt Fragen, Inspector, die sind so leicht zu stellen und so furchtbar schwer zu beantworten. Kinder stellen oft solche Fragen.« Sie seufzte. »Ich arbeite nun seit zwei Jahren für die Henleys. Ich sollte mir einen Standpunkt gebildet haben. Natürlich habe ich Ihnen zu Nora Henley meine Meinung gesagt und natürlich kann ich Ihnen sagen, dass ich Mr. Henley für den typischen überkorrekten Bankbeamten halte. Penibel, engstirnig und als Mann so spannend wie ein alter Teebeutel.«
Er ließ einen Moment Stille zu, bevor er nachfragte: »Aber …?«
»Aber das ist alles nur Oberfläche, alles nur ein Bild.« Sie rang mit den Händen, hilflos, als versuche sie dieses Bild zu fassen. Wieder entstand eine Pause. »Da ist mehr. Bei ihm … es ist wie ein … wie ein verschlossenes Zimmer, das er hütet.« Sie seufzte tief. »Es tut mir leid, Inspector, ich kann es Ihnen nicht besser beschreiben. Mir fehlen die Worte dafür. Er verbirgt etwas. Einen Teil von sich.« Sie seufzte wieder. »Ich fürchte, ich habe Sie mehr verwirrt, als Ihnen geholfen zu haben.«
Norcott erhob sich. »Machen Sie sich bitte keine Gedanken, Mrs. O’Meare. Sie haben mir geholfen.« Er spürte, es war besser, sie für den Moment nicht weiter zu drängen. Er verabschiedete sich. Die ersten Stufen der Treppe hatte er bereits hinter sich, als sie ihn noch einmal ansprach.
»Inspector?«
»Ja, Mrs. O’Meare?«
»Bei ihr war es genauso. Sie hatte auch so ein verschlossenes Zimmer.«
Kapitel 13
St. Peter Port, Polizeizentrale
Montag, 24. Juni 1940, gegen sieben Uhr abends
Zurück vom Gespräch mit Mrs. O’Meare hatte Norcott beschlossen, dass es genug für einen Tag sei. Er musste über das, was er gehört hatte, nachdenken, die Informationen einen Moment lang ruhen lassen. Ruhe, sein altes Problem. Aber er konnte und musste es kontrollieren, die fiebrige Nervosität im Zaum halten. Schnelligkeit war wichtig, aber Hast konnte tödlich enden.
Er hinterließ beim Wachhabenden Vickys Telefonnummer, falls sich im Laufe des Abends doch Wichtiges ergab. Dann wuchtete er mit Hilfe eines Constables die drei Tomatenkisten in seinen Wagen und machte sich zunächst in Richtung Hotel auf.
Er duschte, rasierte sich noch einmal frisch und zog sich um. Er hatte ein unbestimmtes Bedürfnis nach Bequemlichkeit und so fiel seine Wahl auf ein paar weiche Chinos und ein bequemes Leinensakko. Und obwohl er sich beeilt hatte, ging es schon deutlich auf halb neun zu, als er in Richtung Farmain Bay startete.
Die Küstenstraße Richtung Süden bot einen atemberaubenden Blick auf den Kanal und, weit am Horizont entfernt, die bretonische Küste. Die Sonnenscheibe würde bald in einem Gespinst von tiefroten Wolkenstreifen untergehen. Norcott bremste langsam ab und hielt den Wagen am Straßenrand an. Für einen Moment betrachtete er fasziniert das Schauspiel, wollte einen Augenblick die sich langsam verdunkelnden Farben, die Veränderung der Wolkenformationen genießen.
Bis er sie sah. Drei schwarze Punkte, die in V-Formation westwärts flogen. Schnurgerade zogen sie ihre Bahn, unbeirrt und unbehelligt, durch die Entfernung lautlos. Sie gaben dem Himmel einen weiteren Akzent. Und plötzlich erkannte er das Muster, in dem alles verwoben war: Schönheit und Grausamkeit, Ende und Anfang. Er sah die lange Kette von Ereignissen, deren Teile sie alle waren. Heather, er, Vicky, die Menschen auf den Inseln, die Flüchtlinge, die Soldaten.
Norcott fasste das Lenkrad fester und startete den Motor. Er lächelte entschlossen, als er den Wagen zurück auf die Straße lenkte. Minuten später bog der Wagen in die Sackgasse ein und parkte dicht an der dunklen Hecke. Norcott stieg aus und war auch jetzt, wo nur noch die letzten Strahlen des Tages das Anwesen beschienen, von der Schönheit dieses Stückchen Erde beeindruckt. Hinter der dichten Eibenhecke, die das Eingangstor wie ein kleines Dach überwachsen hatte, teilten sich blauer Sommersalbei und weiße Heckenrosen den Vorgarten. Nur ein schmaler Backsteinweg war frei. Alles strahlte Wärme und Harmonie aus. Noch bevor er die Tür des kleinen Glasvorbaus öffnen konnte, hatte Vicky sie schon von innen geöffnet und lächelte ihm neugierig entgegen.
»Hallo, Charles«
»Mein Tag war grauenvoll«, sagte er zur Begrüßung mit halb ernster, halb gespielter Leidensmiene.
»Schön! Das freut mich«, gab sie lächelnd zurück. Sie stupste ihn mit dem Finger auf die Brust. »Selbst schuld, wenn du mich mittags anrufst, mich mit deinen geheimnisvollen Andeutungen neugierig machst und dann bis«, sie sah auf die Uhr, »8:47 Uhr warten lässt! Willst du mich jetzt vielleicht endlich aufklären?«
Er sah sie an und wollte hundert Dinge gleichzeitig sagen, aber all dies musste bis später warten. Er lächelte wieder, ein wenig verlegen. »Besser, du kommst mit zum Wagen und siehst es dir selbst an.«
Sie gingen zum Auto und er öffnete den Kofferraum.
»Heilige Maria!«
»Ja, so ähnlich habe ich auch reagiert.« Er schmunzelte und sah sie dann fragend an. »Meinst du, wir können damit etwas anfangen?«
Vicky schob die Ärmel ihres Maler-Overalls hoch. »Charles, wir bringen die ganze Pracht vielleicht erst einmal in die Küche und dann erzählst du mir, woher das kommt.«
Nachdem sie die Holzkisten gemeinsam in die Küche verfrachtet hatten, entschied Vicky, dass sie nun erst einmal ein Glas Wein benötige und er dabei gleich die Herkunft der Tomaten erklären könnte.
Nach einigen Minuten und den ersten Erklärungen hatten sie sich in die gemeinsame Arbeit gestürzt und zwischen der ganzen roten Tomatenmasse, zwischen Tiegeln und Töpfen wieder zu dieser unverhofften Vertrautheit gefunden, jenem unerklärlichen Gefühl, eine neue Chance im Leben geschenkt zu bekommen.
* * *
Die Standuhr im Flur neben der Küche schlug. Es war ein Uhr morgens, und beide lösten sich aus ihren Gedanken. Stunden waren vergangen und alle Tomaten verarbeitet. Vickys Anrichte in der Küche stand voller Gläser mit Tomatensoße und Chutney. Sie nahm die Flasche Muscadet aus dem Kühler und schenkte ihnen beiden nach.
Charles Norcott betrachtete sie dabei und lächelte. »Ich glaube, ich habe noch tausend Fragen an dich.« Er strich sich fast verlegen über die Haare. »Schlimm?«
Sie sah ihn mit sanften, ruhigen Augen an und schüttelte dann den Kopf. »Nein. Nein, nicht mehr.«
Er nahm sein Glas. »Stoßen wir an auf die neuen Chancen?«
Das war nun ihr zweiter gemeinsamer Abend und seine Gedanken gingen zurück zum gestrigen, der sich so unendlich weit weg und gleichzeitig so nah anfühlte.
Er dachte daran, wie er ihr ins Haus gefolgt war. Bewogen von ihrer Ernsthaftigkeit. Wie sie das Licht in der Küche angeschaltet hatte. Wie sie sich an diesen alten knorrigen Küchentisch gesetzt und Weißwein aus Wassergläsern getrunken hatten. Wie zwei Pokerspieler hatten sie sich in den ersten Momenten gegenüber gesessen, an ihren Gläsern genippt und auf die Bewegungen des anderen geachtet. Die erste Flasche war halb geleert, als Vicky das Schweigen gebrochen hatte.
»Was ist heute passiert, Charles?«
Er berichtete ihr von seinem Erlebnis auf See und von seiner unbändigen Wut. Dem Zorn auf die Situation, durch die Laune eines namenlosen Piloten zu leben oder zu sterben. Sie sprachen auch über Heather, über ihren sinnlosen Tod und über sein Verlangen in der Zeit danach, ebenfalls zu sterben. Darüber, dass er jedes Risiko bewusst gesucht hatte.
Auch Vicky hatte von sich erzählt. Von ihr hatten sich die Männer regelmäßig zurückgezogen, weil sie ihre Energie nicht mehr aushielten oder sie in eine Rolle drängen wollten. Irgendwann hatte sie resigniert und es aufgegeben.
Aber der Krieg veränderte vieles. Er schärfte auf grausige Weise den Blick dafür, wie schnell das Schicksal einem Menschen den Lebensfaden abschnitt. Das war es, was sie beide in ihrer Begegnung gespürt und was er in dem Moment an der Landstraße so deutlich erkannt hatte. Es gab keine Zeit zu verlieren.
Der zweite Abend, heute, war nun die Generalprobe, ob das Gefühl der Vertrautheit wieder da sein würde. Dieses völlig unlogische Gefühl, jemandem vertrauen zu können, den man erst seit drei Tagen kannte.
»C-h-a-r-l-e-s?« Er schreckte aus seinen Gedanken.
»Du lächelst wie ein Honigkuchenpferd. Woran hast du gedacht?«
Er streckte seinen Rücken und sah sie an. »An gestern Abend.«
»Ah«, sie schmunzelte und drehte ihr Weinglas in der Hand. »Ich hatte gerade gefragt, ob du noch fahren kannst.«
»Hab ich eine Alternative?« Er hatte so vorsichtig gefragt, dass sie lachen musste.
»Mein Sofa nebst Decke und Frühstück.«
»Gekauft!«
Kapitel 14
St. Peter Port, Polizeizentrale
Dienstag, 25. Juni 1940, gegen Mittag
Charles Norcott hatte den Morgen mit einem wahren Marathon an Besprechungen hinter sich gebracht. Nach einer kurzen morgendlichen Einsatzbesprechung in der Hospital Lane hatte er an diversen Besprechungen mit dem Büro des Bailiff und der Verwaltung teilgenommen. Er hatte das Gefühl, für wirklich jedes, auch nur annähernd nach Öffentlicher Sicherheit riechende, Problem zu Rate gezogen worden zu sein.
Als Norcott dann endlich wieder in seinem Büro eintraf, gab es keine positiven Nachrichten. Mulgrave und Pearson waren immer noch auf der Suche nach den Engelmacherinnen und irgendwo in der Stadt oder der Insel unterwegs. Ihr Streifzug vom Vorabend hatte nichts außer Gerüchten und unsicheren Andeutungen gebracht
Die Evakuierungslisten sollten nun endlich gegen Mittag kommen. Sergeant Pearson hatte bei einem letzten Besuch im Hafenamt am Abend festgestellt, dass sich der Hafenmeister auf einem der letzten abgehenden Frachter nach England abgesetzt hatte. Nach einem Wutanfall hatte Pearson noch am Abend Constable Haydon in das Hafenamt abgestellt. Dem stellvertretenden Hafenmeister war klar gemacht worden, dass er die Listen zu liefern hatte, wollte er jemals wieder das Hafenamt verlassen.
Die Mittagsstunden in Norcotts Büro zogen sich quälend langsam dahin. Das Telefon schwieg und auch sonst kamen weder gute noch schlechte Nachrichten. Der Chief Inspector saß an seinen Schreibtisch und machte wieder einmal einen neuen Ansatz, um dem ungeliebten Papierberg auf seinem Schreibtisch zu Leibe zu rücken.
Es war gegen halb zwei, als ihm der Geduldsfaden riss. Er beschloss, den Eltern William Henleys einen Besuch abzustatten. Vielleicht würde er von ihnen etwas mehr über Nora und William Henley erfahren. Die verborgenen Zimmer, wie Mrs. O’Meare es genannt hatte, der beiden Henleys beschäftigen Norcott. Irgendjemand in dieser Familie musste doch zum Reden zu bringen sein. Er nahm seinen Hut vom Haken, öffnete schwungvoll die Bürotür und wäre fast mit Constable Haydon zusammengestoßen, der davor stand.
Wenn nicht schon sein triumphierendes Gesicht Bände gesprochen hätte, so behielt er die gute Nachricht nicht lange für sich: »Ich hab sie! Sie ist auf der verdammten Liste. Sie wollte weg und ihn verlassen.«
»Und er ist nicht auf der Liste?«
Haydon war Feuer und Flamme und noch ganz außer Atem. »Entschuldigung, Sir … ich … muss erst mal wieder Luft bekommen.« So atemlos er war, so sehr strahlte er die Zufriedenheit des Anglers aus, wenn nach zähem Warten der Fisch an der Angel hing. »Nein, Mr. Henley ist sicher nicht auf den Listen. Alle, die sich evakuieren lassen wollten, mussten ausdrücklich angeben, ob und welche Familienangehörigen sich ebenfalls evakuieren lassen wollten. Und sie hat angegeben, dass sie allein geht. Und ich habe auch alle anderen Listen doppelt kontrolliert. Aber …« Er musste wieder nach Luft schnappen und Norcott war sich nicht sicher, ob immer noch der Dauerlauf vom Hafen die Ursache war oder die Neuigkeiten. »Aber das ist sowieso nicht der Knaller! Die Leute mussten auch angeben, ob sie Verwandte oder Freunde haben, wo sie in England unterkommen können oder ob sie sonst wie versorgt sind. Und jetzt lesen Sie mal, Sir, was die kleine …«, er schluckte das Wort herunter. »Ich wollte sagen, was Mrs. Henley geschrieben hat!« Er hielt Norcott den Registerbogen hin.
Norcott las den Eintrag. Dann ging er zu einem Stahlschrank in seinem Büro, schloss ihn auf und nahm seine Dienstwaffe samt Holster heraus.
»Nehmen Sie Ihre auch mit, wir gehen jetzt Mr. Henley besuchen!«
Sie gingen die kurze Strecke bis zur North Esplanade zu Fuß. Da die Bank zur Mittagszeit geschlossen war, klingelten sie am Personaleingang. Eine Mitarbeiterin öffnete und ihre Dienstausweise verschafften ihnen Zugang. William Henley saß an einem kleinen Schreibtisch hinter dem Schalter und las in einer Zeitschrift, während er Tee trank.
»Mr. Henley?«
Er sah auf, sagte aber nichts. Wieder schien er nicht weiter überrascht zu sein, zwei Kriminalbeamte in seiner Pause zu treffen. Norcott dagegen war erstaunt, dass Henley seine mangelnde Überraschung so wenig bemäntelte.
»Inspector. Was kann ich heute für Sie tun?«
»Mr. Henley, wir hätten noch ein paar Fragen. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten?«
Henley lehnte sich in seinem Drehstuhl zurück. »Hätte das nicht bis zu meinem Feierabend Zeit gehabt?«
Norcott stützte sich auf den Schreibtisch und lehnte sich zu Henley hinüber. »Mr. Henley, Sie haben noch genau dreißig Sekunden, für uns einen netten ruhigen Platz hier in der Bank zu finden, sonst lasse ich Ihnen hier coram publico Handschellen anlegen und wir unterhalten uns auf dem Revier weiter. Ist das angekommen bei Ihnen?«
Henley nickte stumm und stand dann auf. Nur einen Moment später saßen sie zu dritt in einem kleinen Besprechungsraum mit einem winzigen vergitterten Fenster zum Hof.
»Mr. Henley, lassen wir das Drumherum. Ihre Frau erwartete ein Kind von einem anderen Mann und sie wollte Sie verlassen. Haben Sie das gewusst?«
»Ich sagte Ihnen schon, dass meine Frau nichts für Kinder übrig hatte«, entgegnete Henley mechanisch.
»Mr. Henley, Ihre Frau war im vierten Monat schwanger und sie war kein Kind mehr. Also wusste sie, dass sie schwanger war und da sie nichts dagegen unternommen hat, wie bei der früheren Schwangerschaft, wollte sie das Kind zur Welt bringen. Aber ich meinte auch gar nicht die Schwangerschaft – ich meinte, ob Sie wussten, dass Ihre Frau vorhatte, Sie zu verlassen?«
Henley schwieg.
»Haben Sie gewusst, dass sie Sie verlassen wollte? Ja oder nein, Mr. Henley?«
»Nein, ich habe es nicht gewusst! Da gab’s auch nichts zu wissen. Weil mich meine Frau nie verlassen hätte. Das denken Sie sich alles nur aus, um mir einen Mord anzuhängen!«
Mit einem Krachen knallte Norcott den Registerauszug aus dem Hafenamt auf den Tisch. »Das, Mr. Henley, ist der Auszug aus dem Evakuierungsregister des Hafenamtes, laut dem sich ihre Frau Nora Henley am Mittwoch, dem 19. Juni 1940 hat eintragen lassen! Und hier steht, zu wem sie wollte in England!« Norcott hielt dem bleichen Henley das Papier vor die Augen. »Lesen Sie, was da steht, Mr. Henley!«
Er drehte den Kopf beiseite. »Alles gefälscht, ich lese gar nichts vor.«
Norcott rückte noch ein klein wenig näher und flüsterte: »Lesen Sie Henley, lesen Sie oder ich lese es.«
Henley hatte den Kopf zur Seite gedreht wie ein trotziges Kind.
»Sie wollen nicht? Dann lese ich es. Da steht unter der Rubrik Unterkunftsmöglichkeit nach der Evakuierung der Eintrag: Bei der Familie meines Verlobten, Mr. Henley. Sie wollte sich nicht nur von Ihnen scheiden lassen. Der nächste Mann stand sogar schon bereit!«
Die Momente verrannen, aber Henley hielt stand. Er war blass und seine Stirn glänzte feucht, aber er brachte ein Achselzucken zustande. Der Augenblick, von dem Norcott gehofft hatte, dass er die Wende bringen würde, verging. Der Chief Inspector stand unvermittelt auf und für den Bruchteil einer Sekunde schien Henley unsicher zu werden, aber auch dieser Moment ging vorüber.
»Mr. Henley, wir werden uns sehr bald noch sehr viel ausführlicher mit Ihnen unterhalten. In der Zwischenzeit verlassen Sie St. Peter Port nicht. Ich werde dem Staatsanwalt empfehlen, Anklage gegen Sie zu erheben und ich rate Ihnen dringend, sich einen Anwalt zu nehmen.«
Sie ließen Henley ohne ein weiteres Wort sitzen und verließen die Bank, so wie sie gekommen waren, durch den Personaleingang. Auf der Straße vor der Bank blieb Norcott stehen. »Hubert, Sie bleiben hier und versuchen, die Ausgänge im Auge zu behalten. Wenn er die Bank verlässt, folgen Sie ihm. Er kann Sie ruhig sehen, aber halten Sie Abstand.«
»Ja Sir. Sir, eine Frage.«