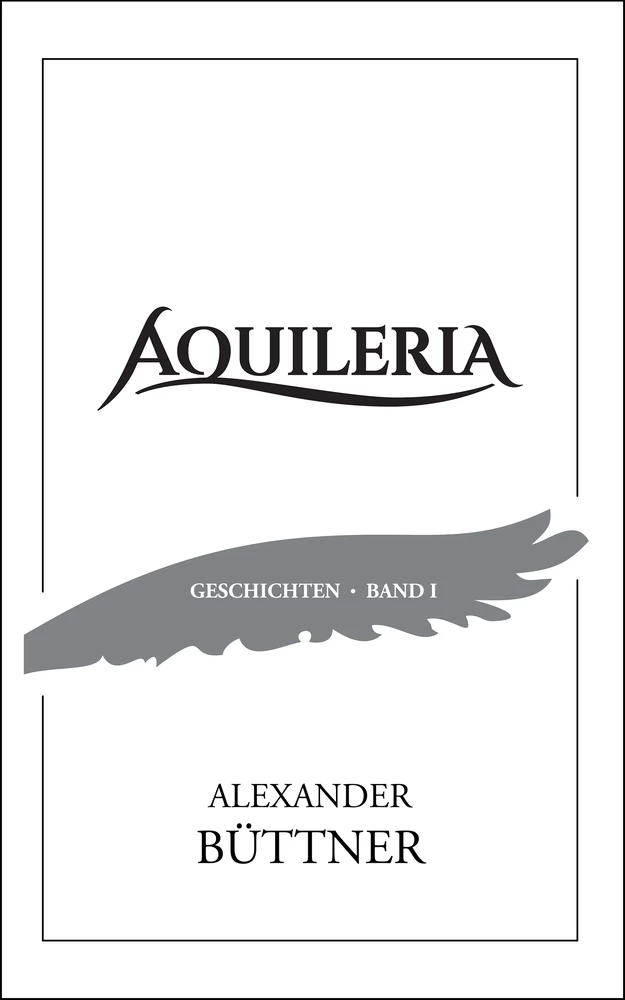Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
AQUILERIA • Geschichten Band I
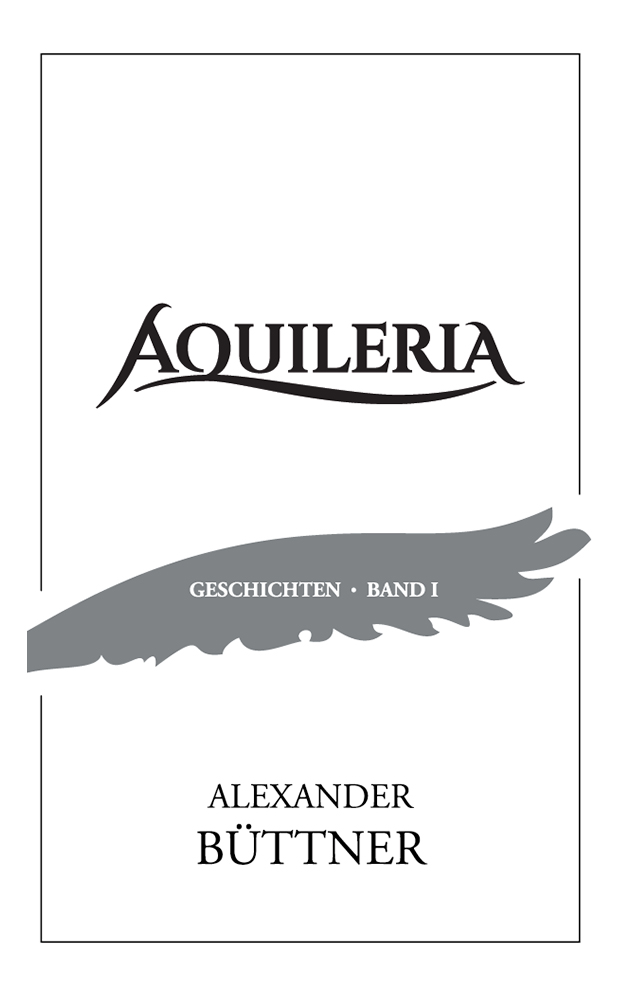
Widmung
Für Matti,
der mir bewusst macht, wie viel Abenteuer im Alltag steckt, wenngleich er noch kein Wort sprechen kann.
Danke, dass ich dir Geschichten erzählen darf.
Und für den kleinen Jungen,
der mit acht Jahren auf einem Windows 3.1-Laptop mit Schwarz-Weiß-Bildschirm seine erste Dino-Geschichte und mit neun Jahren einen Thriller über Robbenfänger in Kanada zu schreiben begann, bevor er das Mittelalter entdeckte und eine epische Trilogie ersann.
Dein Traum ist wahr geworden.
Inhaltsverzeichnis
Willkommen in AQUILERIA
Willkommen in einer fantastischen, mittelalterlichen Welt, die es genau so hätte geben können, wenn sich unsere Erde ein wenig anders entwickelt hätte.
AQUILERIA ist eine Welt mit eigenen Landschaften, Königreichen, Kulturen, Religionen und Zeitrechnungen. Eine Welt, in der es Orte, Pflanzen, Tiere und allerlei Phänomene gibt, von denen man bisher vielleicht noch nicht so viel gehört hat. Eine Welt, in der man Ritter und Burgen und auch die ein oder andere Prinzessin findet, ebenso Spielleute, Bauern, Händler und Spione, in der Krieg geführt und Frieden geschlossen wird, in der Herzen erobert und gebrochen werden, Freunde sich in Verrat und Feindschaft verlieren und Gegner sich die Hand reichen. Eine Welt voller Geschichten, die von Menschen und ihren Schicksalen handeln, von ihren Stärken und Schwächen, ihren Entscheidungen und deren Konsequenzen. Manche prägen ganze Zeitalter, manche Königreiche oder ihre Dynastien, manche nur einzelne Personen und ihr Umfeld. Und eine jede ist es wert, erzählt zu werden.
Drei dieser Geschichten wurden in diesem ersten Band gesammelt. Sie spielen in unterschiedlichen Zeitaltern an unterschiedlichen Orten, und ihre Helden stehen vor unterschiedlichen Herausforderungen.
Ein kleiner Überblick über die Besonderheiten von Geografie, Kultur, Religion und Zeitrechnung in AQUILERIA ist im Anhang aufbereitet.
Willkommen in AQUILERIA, willkommen in einer neuen Welt!
Edvards Versprechen
Kapitel 1
Zerota,
im ersten Jahr des vierten Zeitalters, das mit der Verabschiedung des Kronenediktes von Eperia und dem Zusammenbruch des Vereinigten Königreiches von Litona seinen Anfang nahm.
***
»Verdammt, Frances, wo warst du denn die ganze Zeit?«, rief Edvard, als er endlich den feuerroten Haarschopf erspähte, nach dem er seit einer gefühlten Ewigkeit Ausschau hielt. Missmutig blieb er stehen und wartete, bis sein Freund zu ihm kam. Frances antwortete ihm mit einem breiten Grinsen, das Edvard quer über den halben Hof erkennen konnte. Er kannte es nur zu gut; es war das Grinsen, das Frances’ Eroberungsgeschichten begleitete. Und obwohl diese Geschichten stets allseits für Heiterkeit sorgten, hatten sie schon das ein oder andere gebrochene Herz und so manchen vor Wut schäumenden Vater zurückgelassen.
Doch Edvard stand nicht der Sinn nach Weibergeschichten. »Das kannst du dir sparen«, murrte er vorsorglich, als Frances endlich heran war. »Ich renne dir schon den halben Tag hinterher.«
»Ach komm, was hat dir denn die Laune verdorben?«, lachte sein Freund. Übermütig rempelte er Edvard an. Doch seine unverhohlene Hochstimmung machte es für Edvard nur noch schlimmer.
»Du, verdammt!«, blaffte er. »Ich bin doch nicht dein Kindermädchen!«
»Und mir war nicht bewusst, dass ich mich jedes Mal abmelden muss, wenn ich mein Zimmer verlasse«, entgegnete Frances ruhig. »Entspann dich, Edvard.«
»Ja, sicher!« Edvard wurde zynisch. »Bei den Göttern, ich habe schon genug um die Ohren!«
»Das ist mir nicht entgangen, lieber Freund. Mittlerweile bevorzugst du ja eher deinen Schreibtisch als Gesellschaft. Ich mache mich nun mal nicht so gut als Wandteppich.«
Edvard erwiderte den Vorwurf mit eisigem Schweigen, und so überquerten sie ohne ein weiteres Wort den Innenhof. Erst als ihn Edvard in Richtung der großen Halle führte, gab Frances endlich nach.
»Warum hast du mich gesucht? Und wohin gehen wir?«
»Du hast mir noch nicht geantwortet. Wo warst du?«, entgegnete Edvard. Er konnte sehen, wie es in Frances zu brodeln begann. Sein Freund hasste es, wenn er so kühl zu ihm war.
»Blumen pflücken«, presste Frances missmutig zwischen den Zähnen hervor.
»Blumen pflücken? Hinter dem Stall?«
»Oh ja. Die hübschesten Blumen wachsen an den Stellen, an denen man es am wenigsten erwartet, weißt du.«
»Und wo sind deine Blumen? Ich sehe keine.«
»Da war nur eine, um ehrlich zu sein. Ich habe sie stehen lassen. Gewissermaßen.« Frances schielte zu Edvard herüber. Lange regte sich nichts in seinem Gesicht, doch dann zuckten die Mundwinkel nach oben.
»Ein Gänseblümchen?«, fragte er.
»Nein, eher eine ... Butterblume. Ja, ich denke, eine Butterblume.«
»Eine Butterblume? Was wird da nur die Rose sagen, der du noch vor ein paar Tagen ewige Treue geschworen hast?«
»Oh die Liebe, Edvard!«, jaulte Frances auf. »Die Liebe lässt uns schwärmen und träumen und hinterlässt doch nichts als einen fahlen Nachgeschmack, nicht wahr?« Er machte eine höfische Verbeugung. »Und dabei sind es doch die kleinen und alltäglichen Dinge, die uns so viel Freude bereiten. Wer will schon eine Rose, an deren Dornen man sich die Finger blutig sticht, wenn sich vor deinen Augen eine ganze Wiese voll fröhlicher, bunter Wildblumen ausbreitet?«
»Der Schmetterling, schätze ich. Denn die Rose riecht viel besser.«
»Dann nenne mich eine Kuh, mein Freund, denn ich grase lieber eine ganze Weide ab, anstatt ein Leben lang der Unerreichbaren nachzutrauern.«
»Nicht so laut, Mann«, wies ihn Edvard zurecht. Sie hatten die große Halle erreicht, in der sich ein Großteil der wichtigsten Männer des Landes eingefunden hatte. Nicht wenige warfen ihnen geringschätzige Blicke zu, denn Frances’ lautstarke Schwärmerei für Blumen passte nicht zu dem ernsten Anlass, der sie hier hatte zusammenkommen lassen.
Frances und er waren zwar Ritter, doch Teil dieser Runde waren sie nur, weil sie Edvards Vater vertreten sollten. Genau genommen war sogar nur Edvard geladen, doch Frances und er waren seit frühester Kindheit wie Brüder, und so war es wie selbstverständlich, dass Frances ihn begleitete.
»Ein Rindvieh, ja, das bist du«, raunte er Frances zu. »Und ich bin der Depp, der hinter dir her rennt und aufpassen muss, nicht in deine Fladen hineinzutreten. Wusstest du, dass Kühe die Stellen mit den prächtigsten Blumen meiden?«
»Und warum sollten sie das tun?«, fragte ihn Frances ungläubig. Er dachte anscheinend nicht einmal im Traum daran, seine Stimme zu senken.
»Weil sie wissen, dass die Blumen vor allem dort wachsen, wo im Jahr zuvor ein anderes Rindvieh hingeschissen hat.«
Frances brach in schallendes Gelächter aus. »Und ich dachte schon, ich hätte dich an all deine Pflichten und Aufgaben verloren!«
Man hatte die große Halle umgeräumt, in der sonst gegessen, getrunken und geschlafen wurde. Die Tische waren an den Rand geschoben worden, während man die Bänke so aufgestellt hatte, dass sie von links und rechts schräg zu dem erhöhten Podest hin standen, auf dem König Aldan mit seinen Beratern Platz nehmen würde. Edvard und Frances suchten sich einen Platz in den hinteren Reihen. Die vorderen waren ohnehin den engsten Vertrauten und denen, die genau das gerne wären, vorbehalten, und zumindest die letzteren hatten sich ihre Plätze schon längst gesichert.
»Was meine Pflichten angeht, so wird sich das erledigen, wenn sie meinen Vater wieder freigelassen haben«, griff Edvard den Vorwurf wieder auf, mit dem ihn sein Freund nicht zu Unrecht konfrontiert hatte. Sein Vater war Jovan Thornholm, ein bedeutender und vermögender Ritter mit weitreichenden Ländereien im Süden, und Edvard war an seiner statt Aldans Einladung gefolgt. Jovan befand sich noch in litonaischer Gefangenschaft. Seine Freilassung stand jedoch unmittelbar bevor.
Seit Edvard seine Aufgaben übernommen hatte, war nicht viel Zeit für die schönen Dinge des Lebens geblieben. Das war ihm bewusst. Und er wusste auch, dass es Frances nicht so gemeint hatte. Doch vielleicht war es der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. »Ich weiß im Moment nicht, wo oben und wo unten ist. Jeder scheint etwas von mir zu wollen. Es ist, als wäre im Krieg alles liegengeblieben. Also, wenn mein Vater –«
»Falls«, murmelte Frances.
»Bitte?«
»Nichts«, entgegnete sein Freund, und sprach schnell weiter. »Ist schon in Ordnung, Edvard. Ich beneide dich gerade nicht um den Krempel, mit dem du dich rumschlagen musst.«
»Was hast du gesagt?« Edvard ließ nicht locker. Frances seufzte.
»Falls. Falls sie deinen Vater freilassen.«
Edvard sah seinen Freund eindringlich an. »Sie werden ihn freilassen. Die Verträge sind unterzeichnet. Warum zweifelst du daran?«
»Weil das alles seltsam ist, Edvard. Braut und Bräutigam und eitel Sonnenschein. Alle haben sich lieb, obwohl sie sich gestern noch die Köpfe eingeschlagen haben. Und plötzlich reist die Braut ab, ohne Erklärung. Was meinst du, was als nächstes passieren wird?«
»Dafür gibt es bestimmt eine einfache Erklärung. Der Krieg ist vorbei.«
»Ja, natürlich ist er vorbei. Aber wie lange noch? Und solange bleibe ich lieber ein bisschen pessimistisch und grase jede Wiese ab, an der ich vorbeikomme. Bei Joselia, die Weiber werden im Krieg hässlich genug.«
Edvard verstand, was Frances sagen wollte. Der Frieden war noch keine zwei Monate alt und er sollte mit der Hochzeit der jüngeren der beiden litonaischen Prinzessinnen und dem jüngsten Sohne eines bedeutenden zerotischen Herren besiegelt werden. Aus diesem Grund hatte König Aldan Braut und Bräutigam zu einem vorhochzeitlichen Treffen eingeladen. Als Treffpunkt war Burg Sommerhain bestimmt worden, die nur einen straffen Tagesritt von der litonaischen Grenze entfernt lag. Es waren vergnügliche, frühsommerliche Tage gewesen. Die Hoffnung auf einen lang anhaltenden Frieden erblühte zusammen mit den ersten zarten Blumen – echten Blumen, wohlgemerkt – auf den vielen Gräbern, die niemanden vergessen ließen, mit wie viel Blut die neue Freundschaft bezahlt worden war.
Doch vor nicht ganz zwei Wochen war die litonaische Prinzessin ohne Vorankündigung und Erklärung abgereist. Seitdem war es seltsam still. Ganz Zerota, so schien es, hielt den Atem an und wartete auf den Sturm – oder zumindest auf eine Nachricht aus Litona. König Aldan hatte umgehend die wichtigsten Männer seines Reiches zusammengerufen und heute war der Tag, an dem auch der letzte eingetroffen war.
»Gibt es eigentlich etwas Neues von dem kleinen Jungen?«, wechselte Frances das Thema.
»Du meinst Robyn?«
»Ja.«
»Nein. Aldan hat wohl eine Untersuchung angeordnet, aber mehr habe ich auch nicht gehört.«
»Und was ist mit dem Kindermädchen?«
»Kerker.«
Frances schüttelte verständnislos den Kopf.
Am Tag nach der Abreise des litonaischen Hofstaates hatte man in einem nahen Waldsee die Leiche von Robyn gefunden, dem einzigen Sohn von Dorian Herthweyn, dem Bruder Königin Raenas.
Robyn war ein aufgeweckter Knabe von gerade einmal sieben Jahren, der nie hatte still sitzen können. Er war der Sonnenschein aller Küchenmägde, der Stolz seiner Eltern und der Fluch eines jeden Kindermädchens, denn noch lieber als die Burg hatte Robyn die Welt um sie herum erkundet. Auch die Tage während des litonaischen Besuches hatte er mit seinem Kindermädchen überwiegend im Freien verbracht, denn Burg Sommerhain trug ihren Namen nicht ohne Grund.
Die Festung lag auf einem Hügel, um den sich ein je nach Tageszeit silbern, golden oder rosa glänzendes Flussband legte. Das Tal war eingebettet in ein buntes Meer von verschiedenen Laub- und Nadelbäumen, die hier und da ein wenig Luft und Licht für kleine, mit Blumen in allen Farben übersäte Wiesen ließen. Jeder einzelne Baum, jede einzelne Blume, wahrscheinlich sogar jeder einzelne kümmerliche Grashalm, der irgendwo zwischen einem Stein und einem alten Tannenzapfen aus dem Boden kroch, konnte Zeugnis von der Wehrhaftigkeit des strategisch wichtig gelegenen Bollwerks ablegen. Denn es war das Blut unzähliger Schlachten, das den Boden hier so fruchtbar machte. An manchen Tagen lag ein schwerer, grauer Nebel über dem Tal, sodass es den Anschein hatte, die Geister der Toten würden ihre Schlachten erneut austragen. Es war ein Ort der Gegensätze, von Leben und von Tod, und mit Robyns Tod hatte er ein neues tragisches Kapitel seiner Geschichte geschrieben.
Sein Kindermädchen war in diesen Tagen die jüngste Tochter eines unbedeutenden Landritters. Ihr Name war Blanche und sie hatte sich mit Robyn angefreundet, kaum dass sie in den Dienst der Herthweyns getreten war. Wie kein Kindermädchen vor ihr hatte sie es verstanden, den Jungen zu bändigen. Umso überraschter reagierte der Hof, als sie eines Abends kreidebleich berichtete, dass ihr der Kleine beim Versteckspiel im Wald fortgelaufen sei. Am darauffolgenden Tag war die litonaische Prinzessin abgereist.
»Der Kerker ist kein Ort für eine junge Frau«, meine Frances.
»Nein, und erst recht nicht der Kerker von Sommerhain. Wo auch immer du Blumen suchst, dort wirst du sicher keine finden«, antwortete Edvard.
»Nein, sicher nicht. Und ich werde auch bestimmt nicht dort danach suchen«, stimmte ihm Frances zu. »Aber das können sie doch nicht machen. Als ob das Mädchen den Jungen umgebracht hätte! Dann eher noch die Litonaer.«
»Glaubst du wirklich, dass sie so dumm wären?«, fragte ihn Edvard. Manchmal machte es sich sein Freund zu einfach.
»Es sind Litonaer«, zuckte der mit den Schultern. »Was erwartest du?«
»Trotzdem, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn sie Krieg wollten, dann hätten sie nur danach fragen müssen. Warum der Umweg über den Jungen?«
»Aus reiner Böswilligkeit. Die wissen doch genauso gut wie wir, dass sie auf Kurz oder Lang den Krieg verloren hätten. Vielleicht warten sie nun auf eine bessere Gelegenheit – nachdem sie beispielsweise unseren gesamten Adel ermordet haben.«
»Das ist Wahnsinn, Frances.«
»Denk an meine Worte. Hast du denn eine bessere Erklärung?«
»Nein. Aber die Litonaer waren es nicht. Zumindest nicht so. Und Blanche war es auch nicht, bestimmt nicht.«
In diesem Moment betrat König Aldan die Halle, gefolgt von Dorian und einigen anderen Männern. Es dauerte eine Weile, bis alle Platz genommen hatten und die letzten Gespräche ein vorläufiges Ende fanden. Als der König die Hand hob und die Versammlung eröffnete, kehrte schlagartig Stille ein.
»Ihr Herren von Zerota, ich danke Euch, dass Ihr meinem Ruf gefolgt seid. Ich hatte mir für Euch und die Euren eine längere Ruhepause gewünscht, auf dass Ihr Euch Euren Angelegenheiten widmen könnt, die im Krieg vernachlässigt werden mussten. Mir ist bewusst, dass manchem von Euch keine drei Nächte im eigenen Bett vergönnt waren.« Aldan nickte in Richtung von Bertrand Tornheym, dem Mann, der erst vor wenigen Stunden auf Sommerhain eingetroffen war.
»Zwei Nächte, mein König, um genau zu sein«, erwiderte Bertrand. »Fluch und Segen, wenn der Krieg fern der eigenen Ländereien geführt wird.« Aldan nahm den Einwurf mit einem weiteren Nicken zur Kenntnis, fuhr dann jedoch unbeirrt fort.
»Wir haben uns in diesem letzten Krieg gegen Litona unsere Unabhängigkeit erstritten und bewahrt. Unsere Krone ist nur Zerota verpflichtet, seinem Land, seinem Volk und den Herren, die es schützen und bestellen. Der Königsbund ist zerschlagen und begraben, und Freundschaft sollte an die Stelle von Unterdrückung treten. So war es verabredet, und noch immer halten wir an diesem noch so jungen Frieden fest.
Gleichwohl gibt es Anlass zur Sorge und zur Wachsamkeit. Ihr alle wisst von dem Treffen, das wir hier veranstalteten, um Braut und Bräutigam einander vorzustellen und die verbleibenden Fragen der Friedensverträge zu klären.
Dieses Treffen wurde unvermittelt durch die Abreise der litonaischen Gesandtschaft abgebrochen, wofür wir bis vor wenigen Tagen keinerlei Erklärung fanden. In meinen Händen halte ich jedoch einen Brief, der uns vor drei Tagen überbracht wurde. Es ist ein Schreiben aus Litona, und in ihm steht, dass Litona keinen Grund sieht, nach den jüngsten Vorkommnissen weiterhin an den Hochzeitsplänen festzuhalten. Die Friedensverträge seien nichtig und die Schmach, die wir ihrer Gesandtschaft zugefügt hätten, erlaube kein anderes Handeln. Zerota soll sich darauf gefasst machen, dass uns Litona dafür und für den Verrat im Zuge der Unabhängigkeitserklärung zur Rechenschaft ziehen werde.«
Aldan hatte kaum ausgesprochen, da erhob sich eine hitzige Diskussion.
»Das ist doch alles verlogener Humbug«, hörte Edvard jemanden rufen.
»Litona wollte nie einen Frieden, das habe ich doch schon immer gesagt! Wir hätten sie gleich niederbrennen sollen!«
»Mein König, meine Männer stehen bereit! Auf mich könnt Ihr zählen!«
Aldan erstickte die Diskussion mit einem einzigen Wink seiner Hand.
»Ihr Herren, vieles von dem, was Ihr sagt, kann ich nachvollziehen, und doch trägt es nicht dazu bei, die Sache aufzuklären. Daher frage ich Euch: Kann mir jemand sagen, von welcher Schmach in diesem Schreiben die Rede ist? Kann mir einer von Euch sagen, was hier vorgefallen ist? Was hat die Litonaer so erzürnt?«
Unter den Rittern erhob sich leises Gemurmel, doch niemand schien dem König eine direkte Antwort geben zu wollen. Alles, was Edvard hörte, waren die selbstgerechten Schimpftiraden alternder Kriegstreiber, die so vergessen lassen wollten, dass ihnen der Krug mittlerweile besser in der Hand lag als das Schwert. Glücklicherweise hielt auch Frances sich mit dem Ausdruck seiner Abscheu gegenüber Litona zurück.
»Mein König, vielleicht ist das alles nur ein Missverständnis.« Ein älterer Ritter, dessen Name Edvard nicht gleich einfallen wollte, hatte sich erhoben. »Bevor wir uns weiter in Schuldzuweisungen verlieren, sollten wir das Gespräch mit Litona suchen. Wir können keinen weiteren Krieg brauchen.«
»Das werden wir nicht tun«, sprang ein anderer auf die Beine. »Litona hat uns den Krieg erklärt, als wir ihnen die Hand gereicht haben, und jetzt sollen sie ihren Krieg haben! Ich sage, wir sammeln unsere Truppen und marschieren nach Eperia! Dann haben sie eine Schmach, über die sie lamentieren können, während sie im Staub zu unseren Füßen liegen! Nie war Litona so schutzlos wie jetzt! Mein König, lasst uns marschieren und diese Angelegenheit ein für alle Mal erledigen!«
»Ihr seid ein kurzsichtiger Hornochse, wenn Ihr glaubt, dass wir auch nur in die Nähe von Eperia gelangen! Litona mag geblutet haben, aber das haben wir auch! Und ich erinnere mich gut an die litonaischen Festungen, an denen wir uns aufgerieben haben. Soll ich Euch etwas verraten? Sie stehen immer noch! Und, verdammt, vergesst nicht, dass hier auch irgendjemand die Felder bestellen muss!«
Immer mehr Männer erhoben ihre Stimmen, bis die gesamte Halle in zwei Lager gespalten schien. König Aldan beobachtete die Diskussion eine Weile. Seine ursprüngliche Frage hatten sie alle vergessen.
Schließlich hob er erneut die Hand, und wieder kamen die Männer zur Ruhe, wenn auch nicht ganz so schnell wie beim vorherigen Mal.
»Ich werde noch heute einen Boten nach Eperia schicken und um Aufklärung bitten«, beschloss er mit ruhiger Stimme. Sofort regte sich Unmut, doch er unterband den Protest mit einer Geste, die klarmachte, dass er kein weiteres Wort hören wollte. »Gleichzeitig werden wir die Grenzen wieder bemannen und das Heer vorbereiten. Wenn Litona Krieg will, so werden wir bereit sein, doch wir werden nicht den ersten Stein werfen und bis dahin alles in unserer Macht Stehende tun, um diesen Krieg zu verhindern. Ich danke Euch für Eure Meinungen.
Es gibt jedoch noch eine zweite Angelegenheit, die unserer Aufmerksamkeit bedarf. Der Rat möge über das Schicksal des Kindermädchens entscheiden, welches den Tod unseres geliebten Neffen zu verantworten hat. Dorian, möchtet Ihr dem Rat berichten, was geschehen ist?«
Edvard sah, wie Robyns Vater müde mit dem Kopf schüttelte. So war es erneut Aldan, der diese Bürde auf sich nahm.
»Man fand den Jungen tot in einem kleinen Weiher nahe der Burg, nicht weit von dem Ort, wo er mit seinem Kindermädchen wohl gespielt hatte. Sein Körper trieb im Schilf, bedeckt von einem großen Ast, der in der Zwischenzeit von einem Baum abgebrochen und in den Teich gefallen sein muss. Mein Leibarzt hat die Untersuchung dann selbst durchgeführt und ist sich sicher, was die Todesursache angeht. Der Junge ist ertrunken. Wahrscheinlich ist er beim Spielen im Übermut gestolpert und in den See gestürzt, wo er sich im Schilf verfing und ertrank.« Der König machte eine kurze Pause. Sein Seufzen war deutlich vernehmbar. »Nunja. Wahrscheinlich.«
Er hatte dieses letzte Wort kaum ausgesprochen, da erhob sich erneut energisches Gemurmel. Ein paar Ritter, die in Dorians Nähe saßen, legten dem unglücklichen Vater die Hand auf die Schulter. »Dies alles«, fuhr Aldan schließlich fort, »ist ein höchst tragisches Unglück, und für unsere Trauer lassen sich keine Worte finden. Doch entbindet dieses Unglück nicht das Kindermädchen von ihrer Schuld, denn in ihrer Verantwortung lag es, auf den kleinen Robyn aufzupassen. Wir wollen die Geschehnisse aus ihrem Munde hören, auf dass der Rat über ihr Schicksal entscheiden möge. Führt sie herein.«
Auf sein Zeichen hin öffneten die Wachen die schwere Tür und ließen das unglückliche Mädchen eintreten. Schweigend und mit hängenden Schultern hielt sie den Blick auf ihre Füße geheftet, und verharrte auch in dieser Haltung, als sie vor dem König niederkniete.
Blanche war wahrlich ein hübsches Mädchen, schlank und zierlich von Gestalt, mit schwarzem, langem, glattem Haar und einem freundlichen Gesicht mit sanften Zügen und haselnussbraunen Augen, die heute tiefschwarz schimmerten. Doch zwei Wochen Kerker hatten ihre Spuren hinterlassen.
Ihr Anblick versetzte Edvard in Aufruhr. Seinem Freund blieb das nicht verborgen, und nun war es Frances, der Edvard leise zur Ruhe mahnte.
»Ihr wisst, was man Euch vorwirft, Blanche«, sprach Aldan. »Wir geben Euch hiermit die Gelegenheit, zu schildern, was geschehen ist. Danach werden wir ein Urteil fällen. Doch seid gewarnt: Sagt die Wahrheit und verschweigt uns nichts. Die Götter werden Eure Worte bezeugen. Sprecht.«
»Es war schönes Wetter, die Sonne schien und es war warm«, antwortete Blanche mit leiser Stimme. Edvard konnte sie kaum verstehen. »Er wollte unbedingt in den Wald und Verstecken spielen, wie auch schon am Tage zuvor. Und woher sollte ich denn wissen ...« Ihre Stimme brach ab. Blanche schlug sich mit beiden Händen vors Gesicht, verweilte so einen kurzen Moment und wischte sich dann mit einer verzweifelten Bewegung die Tränen von den Wangen. »Wir haben den ganzen Vormittag gespielt, er blieb stets in meiner Nähe. Dann war er an der Reihe sich zu verstecken, und als ich laut bis Zwanzig gezählt hatte, bin ich ihn suchen gegangen. Aber ich habe ihn nicht mehr gefunden! Ich habe ihn gerufen, ganz oft! Ich habe unter jedem Busch geschaut, zu jedem Baum hochgesehen, aber ich habe ihn einfach nicht mehr gefunden!« Blanches Stimme wurde lauter. »Und dann habe ich es mit der Angst bekommen. Ich hatte gehofft, dass er vielleicht allein zur Burg zurückgelaufen sei, und ich glaube, ich habe auch kurz seine Stimme gehört. Also habe ich mich auch auf den Weg gemacht – und dann war da nur noch dieser kurze Schrei.«
Blanche hatte es kaum ausgesprochen, da sprangen schon einige Männer auf.
»Du litonaische Hure!«, riefen sie. »Du hast ihn umgebracht! An den Galgen mit dir!«
Daraufhin sah Blanche zum ersten Mal auf. Sie schaute zu Dorian, der ihrem Blick aber auswich. »Niemals«, sagte sie. »Niemals hätte ich Robyn etwas antun können! Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass ich nie auf den Gedanken gekommen wäre, mit ihm im Wald Verstecken zu spielen!« Blanches Stimme bekam einen flehenden Unterton, was ihre Ankläger noch lauter rufen und die Atmosphäre im Saal noch hitziger werden ließ. Doch Blanche fuhr unbeirrt fort, klammerte sich verzweifelt an diese letzte ihr verbliebene Hoffnung und beschwor weiter den unglücklichen Vater. »Ich würde alles dafür geben, noch einmal vor ihm zu knien und ihn zu fragen, worauf er Lust hat. Und ich würde alles dafür geben, dann nicht mit ihm in den Wald zu gehen. Bitte, Herr, das müsst Ihr mir glauben! Es tut mir so leid!« Dann füllten sich ihre Augen erneut mit Tränen.
Edvard verstand nicht, wie man ihr nicht glauben konnte. Er wusste, dass sie die Wahrheit sprach, dass sie nichts mit dem Tod des Jungen zu tun hatte. Doch es waren nicht wenige, die anderer Meinung waren.
»Es gibt doch überhaupt keine Beweise für einen Mord!«, ergriff er plötzlich das Wort, und bevor ihn Frances daran hindern konnte, sprang er von seinem Platz auf. »Der Galgen ist als Strafe für dieses Unglück, und von nichts anderem reden wir hier, maßlos und willkürlich! Habt Ihr denn keine Ehre im Leib?« Es waren nur drei Sätze, die er sprach, doch sie zeigten Wirkung. Einige andere Ritter, vornehmlich der jüngeren Generation, pflichteten ihm bei, und so hatte Blanche am Ende genauso viele Verteidiger wie Ankläger.
Während die Diskussion sich zwischen den zwei Lagern, die nahezu die gleichen waren wie bei der Frage nach der Kriegserklärung, erneut hochschaukelte, beobachtete Edvard, wie sich Aldan mit seinen engsten Vertrauten beriet. Er fragte jeden einzelnen nach seiner Meinung, nickte hier und da, runzelte die Stirn und schien schließlich genug gehört zu haben. Dann erhob er sich und wartete, bis Stille einkehrte. Dieses Mal verzichtete er auf eine Geste.
»Allein die Götter wissen, was geschehen ist, und die Götter werden über das Schicksal von Blanche entscheiden. Wir werden ein Gottesurteil ansetzen«, verkündete er. Doch sein Gesicht sagte etwas anderes.
Er ist auch nicht davon überzeugt, dass das die beste Entscheidung ist, schoss es Edvard in den Sinn. Es ist ein Kompromiss, um sie von der Kriegserklärung abzulenken. Sein Entschluss traf indessen in beiden Lagern auf lautstarke Zustimmung, wobei die Lautstärke durch wenige laute Kehlen zustande kam, nicht durch eine breite Masse an Stimmen. Edvard sah, dass sich auch Aldan und seine Berater mehr Befürworter versprochen hatten. Es war eine seltsame Situation.
Plötzlich sprang Frances neben ihm auf und verurteilte mit wütender Stimme die Kurzsichtigkeit der Entscheidung des Rates. »Sollte es wirklich zu einem erneuten Krieg kommen, so brauchen wir jedes einzelne Schwert!«, rief er. »Etwas besseres, als dass wir uns nun auch schon selbst an die Kehle springen, kann Litona doch gar nicht passieren! Und ich sehe noch keinen Beweis dafür, dass sie es nicht sogar selbst so inszeniert haben. Verzeiht, mein König, aber dieses Urteil schadet vor allem unserem Reich. Denn den kleinen Jungen wird das Gottesurteil auch nicht wieder zurückbringen.« Bei diesen letzten Worten sah er zu Dorian, der seinen Blick erwiderte und schließlich vorsichtig nickte. Viele der Ritter griffen seine Zustimmung umgehend auf, und nicht wenigen stand die Erleichterung deutlich ins Gesicht geschrieben. Vielleicht bildete er es sich auch nur ein, doch Edvard meinte, auch Aldan erleichtert aufatmen zu sehen.
»So sei es!«, beschied er. »Blanche wird im Kerker bleiben, bis uns die Götter einen klareren Blick auf die Dinge gestatten. Führt sie ab.« Damit war die Versammlung beendet und Aldan winkte ein paar Wachen herbei, um Blanche fortzuschaffen. Doch Frances erhob erneut das Wort.
»Mein König, gestattet Edvard und mir, sie dorthin zu geleiten«, rief er. Um sie herum brandeten bereits wieder Gespräche auf, sodass jede weitere Erklärung vom Lärm verschluckt wurde. Der König runzelte die Stirn. Offensichtlich war er von der ungewöhnlichen Bitte ebenso verwirrt wie Edvard. Schließlich zuckte er jedoch mit den Schultern und nickte kurz, was Frances als Zustimmung ausreichte. Er packte Edvard und zog ihn mit sich zu Blanche, die noch immer regungslos vor dem behelfsmäßigen Thron kniete. Behutsam zogen sie sie auf die Beine und führten sie so schnell es ging aus der Halle.
Der Kerker lag auf der gegenüberliegenden Seite des Innenhofes. Auf dem Weg dorthin fühlte sich Edvard so, wie Blanche aussah: Blass und benommen, ein Schatten ihrer selbst, in dem kein Leben mehr war. Seine Gedanken irrten unablässig zwischen dem Kerker, in den er Blanche jetzt führen würde, und jenem, in dem sein Vater seit Wochen auf den Abschluss der Friedensverhandlungen und seine Freilassung wartete, hin und her. Ob sein Vater schon von dem erneuten Rückschlag erfahren hatte? Er konnte nicht sagen, welcher der beiden Kerker für ihn schwerer zu ertragen war – mit dem Unterschied, dass das Verlies seines Vaters allein seiner Vorstellungskraft entsprang, während er Blanche gleich selbst in der Dunkelheit einer nassen, kalten Zelle zurücklassen würde.
Und dafür würde er Frances ewig hassen.
Natürlich wusste Edvard, was Frances im Sinn gehabt hatte, als er Aldan darum bat, Blanche selbst abführen zu dürfen. Er wollte ihr etwas von ihrer Würde erhalten, ihr vielleicht auch ein paar aufmunternde Worte mitgeben und ihr versprechen, sich für sie einzusetzen. Doch all das blieb er ihr bislang schuldig. Oder wartete er darauf, dass Edvard das übernahm?
Blanche schien das, was um sie herum geschah, gar nicht wahrzunehmen. Benommen ließ sie sich von Edvard und Frances über den Innenhof führen. Ein Spatzenpärchen flatterte vor ihnen vergnügt durch die Luft. Zwitschernd jagte es über den Hof, neckte sich und nahm keinerlei Rücksicht auf die schreiende Ungerechtigkeit, die Blanche hier widerfuhr.
Edvard beobachtete die zwei Vögel, wie sie sich in die Höhe schraubten, nur um kurz darauf in steilem Sinkflug nach unten zu schießen und schließlich im dichten Grün der alten Eiche bei den Ställen zu verschwinden. Er wünschte sich etwas von ihrer Unbeschwertheit, um wenigstens einen einzigen Satz des Trostes zustande zu bringen. Doch alles, was ihm in den Sinn kam, waren platte und leere Floskeln, an die er selbst nicht glaubte. Daher zog er es vor, zu schweigen.
»Trotzdem, das Ganze ist doch nur ein Aufschub«, begann Frances unvermittelt. »Am Ende werden sie Blanche an den Galgen bringen, denk an meine Worte, Edvard. Wenn die Götter ein Zeichen geben wollten, so wie es Aldan hofft, dann hatten sie schon reichlich Gelegenheit dazu.« Frances machte eine kurze Pause. »Ich meine, überlege doch mal: Warum befragt Aldan den Rat? Solche Urteile fällt er doch sonst zwischen Frühstück und Morgenschiss.« Er wartete gar nicht auf Edvards Antwort. »Ich sage dir, warum! Er muss den Wölfen ein Schaf vorführen, an dem sie sich satt fressen können. Denn nur hungrige Wölfe gehen auf die Jagd, und so eine Meute kann Aldan ganz bestimmt nicht gebrauchen, während die Litonaer wieder die Messer wetzen.« Frances warf ihm einen erwartungsvollen Blick zu, doch Edvard zeigte keine Regung. »Und sollte man sie doch freisprechen, so wird sich schon ein Wolf finden, der das Blut gerochen hat und seinem Appetit nicht widerstehen kann«, fügte Frances schließlich noch hinzu.
Blanche schwieg, doch ihre Hände zitterten. In Edvards Kopf überschlugen sich die Gedanken. Frances hat recht. Er hat recht. Was soll ich tun? Was übersehe ich? Soll ich – nein, das kann ich nicht tun. Aber ich kann sie auch nicht im Kerker einsperren. Das kann ich nicht.
Er hatte eine vage Idee. Es wäre Wahnsinn, doch Edvards Herz verkrampfte sich bei dem Gedanken, dass Blanche etwas angetan werden könnte. Alles andere rückte dabei in den Hintergrund. Frances mochte eine Kuh sein und seine Wildblumen lieben – er selbst hielt es lieber wie der Schmetterling, und Blanche war seine Rose. Er hatte sein Herz an sie verloren, als er sie das erste Mal gesehen hatte, und nicht einmal mit Frances hatte er darüber gesprochen.
»Frances, lass uns fliehen!«, platzte es plötzlich aus ihm heraus. Er packte ihn an der Schulter und hielt ihn fest. Sein Freund starrte ihn überrascht an; offenbar war er sich nicht sicher, ob er sich verhört hatte. »Lass uns fliehen«, wiederholte Edvard. »Blanche kann nichts für den Tod des Jungen, das weißt du genauso gut wie ich. Lass sie uns in Sicherheit bringen und darüber nachdenken, wie wir sie retten können.«
»Edvard, ich ...«, setzte der völlig überrumpelte Frances an, doch Edvard unterbrach ihn.
»Frances, seit ich denken kann, sind wir Freunde. Wir haben stets zueinander und uns gegenseitig den Rücken freigehalten – ich bitte dich, die Zeit drängt! Bringen wir Blanche in den Kerker, wird sie diesen nie mehr verlassen. Ich ertrage das nicht! Lass uns fliehen!«
Frances zögerte. Er kannte Edvard gut genug, um zu wissen, dass es sein Ernst war. Doch dann lächelte er.
»Edvard, im Namen unserer Freundschaft: Ich werde bleiben. Wenn dir so viel an Blanche liegt –«, ein Blick in seine Augen schien ihm als Antwort auszureichen, »Verdammt, Edvard, du weißt, wo die Pferde stehen.«
Edvard zögerte noch einen Augenblick, bevor er eine Entscheidung traf. Blanche sah ungläubig vom einen zum anderen, gerade so als sei sie gerade aus einem Traum erwacht und wisse noch nicht so recht, ob sie nicht doch noch träume. Jetzt oder nie, dachte Edvard und packte sie am Arm. Ohne sich zu wehren, ließ sie sich von ihm zu den Ställen zerren.
Und ausgerechnet hier offenbarte sich nun der Wille der Götter, auf den Aldan warten wollte: Im Stall standen zwei gesattelte, ausgeruhte Pferde. Edvard half Blanche aufsteigen und schwang sich auf das zweite Pferd. Dann schnappte er sich die Zügel und trieb die Tiere aus dem Stall über den Burghof zum Tor.
»Ich versuche, euch Zeit zu verschaffen!«, hörte er Frances rufen, als sie an ihm vorbeiflogen. Die Wachen am Tor sahen ihnen nur verdutzt nach.
Kapitel 2
Sie waren kaum außer Sichtweite, da hörte Edvard drei tieftönende Hornstöße, die die Vögel aus den Baumwipfeln trieben. Edvard hätte sich ein bisschen mehr Vorsprung von Frances gewünscht, doch vielleicht war ihre Flucht auch anderweitig entdeckt worden. Jedenfalls musste er nun alle Sinne zusammennehmen, wenn sie unentdeckt ihr Ziel erreichen wollten. Und in diesem Moment wurde ihm auch mit aller Deutlichkeit bewusst, dass längst nicht mehr nur das Leben von Blanche auf dem Spiel stand, sondern auch sein eigenes. Jeder Schritt ihrer Pferde, der sie weiter von Sommerhain wegführte, brachte ihn näher zum Hochverrat.
Sein Ziel war Sonnau. Sonnau war ein kleines, verstecktes Dorf – eigentlich mehr eine Ansammlung einer Hand voll Hütten –, das sich keiner besonderen Bekanntheit und eben deshalb großer Beliebtheit bei Edvard und Frances erfreute. Es war nach so manchem jugendlichen Abenteuer ein gelungenes und willkommenes Versteck gewesen, wenn die beiden Heißsporne eine Weile hatten untertauchen müssen, bis sich die ein oder andere väterliche Woge geglättet hatte.
Sie erreichten das Dorf bei Einbruch der Dämmerung. Den ganzen Tag waren sie geritten, hatten dabei kein Wort gesprochen und nur dann gerastet, wenn sie einen kleinen Bach kreuzten. Es war wundervolles Wetter, das im lichten Wald kaum Schutz vor möglichen Verfolgern bot. Edvard konnte sich nicht erklären, warum sie nicht längst eingeholt und entdeckt worden waren. Vielleicht war das Frances’ Verdienst. Vielleicht hatte er eine falsche Spur gelegt oder sie anderweitig in die falsche Richtung geschickt. Vielleicht aber hatten auch die Götter ihre Hände im Spiel.
So standen sie nun vor einer alten, verlassenen Scheune am Rande des Dorfes, die schon vor Jahren dem Einsturz geweiht gewesen war. Der Zahn der Zeit hatte auch weiterhin stark an dem maroden Bauwerk genagt, das nur noch der gute Wille zusammenzuhalten schien.
»Hast du Durst? Da vorne ist ein Bach und das Wasser ist klar«, sagte Edvard. Es waren die ersten Worte seit ihrer Flucht, und so fühlten sie sich sperrig und dumm in seinem Mund an. Doch alles war besser als das ewige Schweigen.
Edvard konnte sehen, wie sich Blanche langsam aus ihrer Starre löste. Schüchtern schaute sie sich um, betrachtete ihre Herberge und dehnte kaum merklich die Finger, mit denen sie sich den ganzen Tag an den Zügeln festgekrallt hatte. Eine Antwort blieb sie ihm jedoch schuldig.
Das war zu viel für Edvard. »Blanche, du musst was trinken!«, blaffte er sie an, heftiger als beabsichtigt, und sofort bereute er seinen harschen Tonfall. »Bitte, geh zum Bach und trink etwas. Wir haben nichts zum Essen und allein Kol weiß, wann wir das nächste Mal etwas auftreiben werden. Darum müssen wir wenigstens trinken, damit der Magen ruhig bleibt. Bitte, trink etwas.« Blanche blickte zu Boden, doch ein paar Augenblicke später rührte sie sich und ging zum Bach.
Edvard überprüfte in der Zwischenzeit die Stabilität der Holzbalken, die die Scheune trugen. Er suchte etwas, das noch fest genug war, um die Pferde daran anbinden zu können. Als Blanche vom Bach zurückkehrte, kam sie langsam zu ihm, und als sie nah genug heran war, legte sie ihm eine Hand auf den Unterarm. Edvard wagte nicht, ihr in die Augen zu schauen. Einen Moment lang, in dem die Zeit kurz still zu stehen schien, verblieben sie in dieser Haltung – einander abgewandt, doch über diese vorsichtige Geste miteinander verbunden. Dann löste sich Blanche wieder von ihm und setzte sich vor die Scheune, lehnte sich an das morsche Holz und ließ das Wasser auf ihrem Gesicht von der Abendsonne trocknen.
Edvard machte sich daran, die Pferde abzusatteln, mit altem Stroh notdürftig abzureiben und an dem kleinen Bach saufen zu lassen. Während er das tat, sah er immer wieder zu Blanche hinüber. Das rotgoldene Licht des Sonnenuntergangs umgab sie mit einer verzaubernden, melancholischen Aura – ein Anblick, der ihn gefangen nahm. Es war ihm unmöglich, den Blick länger als ein paar Herzschläge von ihr abzuwenden. Ein sanfter Windhauch flüsterte durch die Wiesen, aus dem nahen Dorf hörte man das Quieken von Schweinen und ein paar vereinzelte Rufe der Dorfbewohner, und auf dem First der Scheune besang eine Amsel den scheidenden Tag.
Edvards Verärgerung über Blanches Schweigsamkeit verflüchtigte sich nun vollends und ihm wurde bewusst, wofür er sein bisheriges Leben so bereitwillig aufs Spiel gesetzt hatte. Alle zweifelnden Gedanken, die den ganzen Tag über an ihm genagt und ihn gefoltert hatten, verblassten. Er fühlte, dass er das Richtige tat, dass sie im Recht waren und dass Frances alles zum Guten wenden würde. Davon war er fest überzeugt. Er schenkte Blanche ein kleines Lächeln, als sich ihre Blicke trafen, und sie erwiderte es, wenn auch mit traurigen Augen. Dann wandte sie sich wieder ab. Im schwindenden Tageslicht sah Edvard feine, silbrig glänzende Linien auf ihren Wangen.
Der Tag war für Edvard zermürbender gewesen als manch anderer in Kriegszeiten. Und die Nacht war noch tausendmal schlimmer.
Edvard beneidete Blanche um den Schlaf, den ihr die Erschöpfung verschaffte. Er selbst lauschte und starrte in die Dunkelheit, unfähig, auch nur ein Auge zu zu tun. Zu seinem rastlosen Geist gesellte sich alsbald auch ein quälender Hunger, der ihm die Übelkeit den Hals hoch trieb. Edvards letzte Mahlzeit war das karge Frühstück auf der Burg gewesen. Wann Blanche das letzte Mal etwas gegessen hatte, wollte er sich gar nicht ausmalen. Am nächsten Tag musste er etwas zum Essen für sie besorgen; vielleicht ließen sich die Bauern von Sonnau etwas abkaufen. Seine Geldbörse trug er jedenfalls bei sich.
Er achtete auf jedes noch so leise Geräusch. Er misstraute jedem Rascheln, jedem Zirpen – selbst die Rufe eines Uhus waren für ihn verdeckte Zeichen ihrer Häscher. Und in jedem leisen Knacken erkannte er die schleichenden Schritte von Wachen, die die Scheune umstellten und sie jeden Augenblick stürmen würden.
Es vergingen viele Augenblicke, in denen das jedoch nicht geschah, und irgendwann begann er schließlich, sich über seine Hirngespinste zu ärgern. Der Einzige, der sie hier vermuten könnte, war Frances – und der würde ihre Verfolger mit Sicherheit in weitem Bogen um Sonnau herumführen.
Der Gedanke beruhigte ihn ein wenig, und je länger er sich mit ihm befasste, umso tröstender wurde er. Edvard hätte in diesem Moment viel dafür gegeben, Frances bei sich zu haben. Sie hatten schon viele Nächte abwechselnd über den Schlaf des anderen gewacht, mitunter weit hinter den feindlichen Linien. Fast glaubte er, ihn seinen Namen rufen zu hören. Edvard lächelte kurz. Vielleicht fand er nun doch noch ein wenig Schlaf.
Dann hörte er es wieder.
»Edvard?«
Der Ruf war leise, aber deutlich. Und er war keine Einbildung.
Edvards Herz begann zu rasen und er riss die Augen auf, um die körperlosen Schatten und Schemen der Dunkelheit erkennen zu können. Sein Griff schloss sich fest um das Heft seines Schwertes. Dann lauschte er wieder. Er hörte Blanche atmen, ruhig und gleichmäßig. Vielleicht hatte er es sich doch nur eingebildet. Er war sich nicht einmal sicher, ob er nicht doch kurz eingeschlafen war und die Rufe nur im Traum gehört hatte.
»Edvard«, flüsterte die Stimme wieder. »Edvard, bist du hier? Ich bin es, Frances. Sag doch was. Bist du hier?« Die Stimme gehörte seinem Freund, dessen war sich Edvard sicher, doch was zum Teufel hatte Frances hier verloren? Er klopfte nach einigem Zögern leise mit dem Schwertknauf auf einen nahe liegenden Holzbalken. »Dachte ich es mir doch«, hörte er Frances murmeln. »Edvard, komm raus. Ich muss mit dir reden. Beeile dich. Mir läuft die Zeit davon!« Edvard fragte sich, warum Frances noch immer flüsterte, doch er erhob sich und trat vorsichtig zum halb offen stehenden Tor, wo sein Freund auf ihn wartete. Sein Schwert hielt er noch immer fest in der Hand.
»Frances, was – «
»Edvard, hör mir bitte zu. Ich bin nicht allein, das Dorf ist umstellt«, unterbrach ihn Frances, noch immer flüsternd. Seine Stimme bebte vor Nervosität.
»Wie habt ihr uns gefunden?«, fragte Edvard, einem plötzlichen Impuls von Misstrauen folgend, der auch Frances nicht entging.
»Dafür haben wir jetzt keine Zeit, Edvard. Ich will euch helfen. Ich habe den Männern gesagt, dass ich versuchen werde, dich zu überzeugen, das Ganze ohne Blutvergießen abzuwickeln. Gib mir dein Schwert und komme mit. Und Blanche auch. Macht keine Dummheiten. Wenn wir dann im Wald sind, werde ich dafür sorgen, dass ihr fliehen könnt. Nur jetzt müsst ihr mit mir kommen, sonst seid ihr des Todes!« Frances’ Ton hatte etwas Drängendes. Edvard gefiel das nicht. Doch wenn Frances recht haben sollte, und warum sollte er ihn anlügen, dann musste er sich auf ihn verlassen.
»Wie stellst du dir das vor, Frances? Wie sollen wir euch entkommen?«
»Wir werden unterwegs kurz rasten, da wirst du mich als Geisel nehmen. Wir reiten zusammen ein Stück, dann lässt du mich gehen, und ihr beide flieht. Und nun kommt!« Das klang irrwitzig und dumm, aber war die ganze Flucht von Anfang an nicht genau das gewesen?
Edvard sah ein, dass ihm keine andere Wahl blieb. Gerade als er sich umdrehte um Blanche zu holen, hörte er ihre Schritte hinter sich. Er warf Blanche einen hilflosen Blick zu, und im spärlichen Licht des Mondes erahnte er ein kurzes, trauriges Nicken. Dann trat er mit ihr aus der Scheune und wandte sich Frances zu, der ihm wartend die offene Hand hinhielt.
»Was ist?«, fragte Edvard, nun nicht mehr flüsternd. Frances fuhr zusammen.
»Dein Schwert, Edvard. Gib mir dein Schwert. Los!« Das letzte Wort war mehr ein Zischen denn ein Wispern.
Edvards Miene hingegen war versteinert. Ohne jede Regung starrte er Frances an, der seinem Blick kaum standhalten konnte. Allein das schüchterne Plätschern des Baches erinnerte daran, dass die Zeit nicht stehengeblieben war.
Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, doch irgendwann ließ Frances die Hand langsam sinken. Nervös schaute er sich nach allen Seiten um, als wolle er sich versichern, dass sie niemand beobachtete. Edvard schien plötzlich auch verlegen. Blanche war es, die das Schweigen brach.
»Edvard. Wir haben keine Wahl. Frances weiß, was er tut. Gib ihm dein Schwert«, sagte sie. Wieder legte sie ihre Hand auf seinen Arm, doch diesmal einen Herzschlag länger.
Edvard war darüber genauso überrascht wie Frances, doch schließlich reichte er seinem Freund das Schwert. Frances schien ein Stein vom Herzen zu fallen. Zusammen sattelten sie im Dunkeln die zwei Pferde, dann führte Frances Edvard und Blanche an das andere Ende des Dorfes, wo tatsächlich ein halbes Dutzend Reiter auf sie wartete. Es war noch ein weiterer Ritter unter ihnen, der Edvard mit besorgter Miene, aber freundlich zunickte.
Edvard kannte ihn. Wolter Mallard war ein Mann, den man in der Schlacht gerne an seiner Seite wusste und der nie ein übereiltes Urteil fällte. Ihm gehörten ein paar Ländereien im Westen, und soweit Edvard wusste, ging es den Menschen dort gut. Erleichtert, dass sie keinem Bluthund in die Fänge gelaufen waren, schöpfte er etwas Zuversicht. Dann löste sich ein Soldat aus der Gruppe, kam ihnen mit grimmiger Miene entgehen, nahm Edvard und Blanche entschlossen die Zügel ihrer Pferde ab, hieß sie mit einer verächtlichen Kopfbewegung aufsteigen und band ihnen dann die Hände hinter dem Rücken zusammen. Er roch nach zu viel saurem Wein, Zwiebeln und einem langen Tag im Sattel. Edvard widerstand nur schwer dem Impuls, sich gegen diese Behandlung zu wehren. Es war erniedrigend. Kurz darauf gab Frances das Zeichen zum Aufbruch, ohne Edvard und Blanche noch eines weiteren Blickes zu würdigen.
Kapitel 3
Im Wald war es stockfinster. Weder Mond noch Sterne spendeten genug Licht, um weiter als ein paar Schritte sehen zu können. Eine einzige Fackel leuchtete ihnen den Weg, und das flackernde Licht weckte unheimliche Schatten zwischen den Bäumen. Die Soldaten unterhielten sich über Wein, Frauen und den Krieg, doch keiner richtete das Wort an die Gefangenen. Edvard war das recht, denn er hatte genug mit sich selbst zu tun. Mühsam kämpfte er gegen den Gedanken, dass Frances sie auch hätte fliehen lassen können. Er war allein zur Scheune gekommen. Er allein hatte gewusst, wo sich Edvard und Blanche versteckten. Warum hatte er sie nicht einfach nur gewarnt und den Wachen dann erzählt, dass er sie nicht gefunden hätte? So sehr sich Edvard auch den Kopf darüber zerbrach, er kam stets nur auf eine Antwort: Sie waren entdeckt worden und jemand erpresste Frances – oder wollte seine Loyalität auf die Probe stellen. Was auch immer es war, sein Freund riskierte mittlerweile genauso viel wie er selbst. Und er tat es ohne zu zögern.
Es dämmerte bereits, als sie schließlich auf einer kleinen Lichtung am Wegesrand rasteten. Edvard ließ seinen Freund nicht aus den Augen, um ja nicht ein heimliches Zeichen zu verpassen, das ihnen die erneute Flucht ankündigen sollte.
Er wurde herb enttäuscht. Eine Wache fesselte Edvard und Blanche die Füße und setzte sie ein Stück weit abseits an einen Baum, wo man sie dann nicht weiter beachtete. Frances teilte Wolter und sich als Wachen ein, die anderen durften sich ins kalte Gras legen und eine Weile ausruhen. In den letzten Stunden waren die Männer immer ruhiger geworden. Die meisten mussten seit der vorletzten Nacht keinen Schlaf mehr gehabt haben, und da sie noch ein gutes Stück Weg vor sich hatten, war es eine gute Gelegenheit für eine Pause. Im Licht des anbrechenden Tages hätten sich Blanche und Edvard schon unsichtbar machen müssen, um fliehen zu können. Und selbst dann wären sie noch an Händen und Füßen gefesselt gewesen. Edvard schüttelte resignierend mit dem Kopf. Wäre der Trupp unter seinem Kommando gewesen, hätte er nicht anders gehandelt.
Und doch konnte Edvard ihrer Situation etwas Gutes abgewinnen. Ein kleiner Teil seines Herzens wünschte sich sogar, dass sich Frances mit ihrer Befreiung noch Zeit lassen würde. Blanche war neben ihm eingeschlafen. Ihr Kopf ruhte auf seiner Schulter. Er spürte ihr weiches Haar an seiner Wange, fühlte die sanften Bewegungen, wenn sie atmete. So nah war er ihr noch nie gewesen. Sein Herz tanzte, und zerbrach doch wieder im selben Moment.
Um sie herum durchbrachen die ersten Sonnenstrahlen das Unterholz und ließen den Wald glitzern, wo sich Tau auf Blättern und Halmen gesammelt hatte. Der nächtliche Dunst begann in hauchfeinen Nebelschwaden aufzusteigen, und der ganze Wald verwandelte sich in ein wundervolles Meer aus allen denkbaren Grüntönen. Es wirkte so ruhig und friedlich, und pulsierte doch vor Leben. Edvard roch das Gras, die Bäume und die Pferde hinter ihnen und hörte die ersten Vögel des Tages. Die Sonne streichelte sein Gesicht. Zum ersten Mal sah er den Wald auf diese Weise, beobachtete, wie der Tag um sie herum anbrach. Selten hatte er sich so friedlich gefühlt, und endlich kam er zur Ruhe und sank in einen leichten Schlaf.
Als Edvard wieder aufwachte, hatte Frances Wolter von der Wache abgelöst. Während ihnen Wolter noch den ein oder anderen nachdenklichen Blick zugeworfen hatte, vermied es Frances lange Zeit, auch nur in ihre Richtung zu schauen. Ein einziges Mal schielte er zu ihnen herüber, wandte sich aber sofort ab, so als ob er sich ertappt fühlen würde. Dann stierte er weiter vor sich hin, bis sich Wolters Schnarchen schließlich zu dem der anderen Männer gesellte.
Kurz darauf erhob er sich endlich von dem Baumstumpf, auf dem er saß, und schlich zu Edvard und Blanche hinüber. Edvard stieß Blanche vorsichtig an, um sie zu wecken. In der einen Hand hielt Frances einen Wasserschlauch, in der anderen einen halben Laib Brot. Er kniete sich vor ihnen hin, zerschnitt ihre Handfesseln und reichte ihnen die kümmerliche Mahlzeit.
»Macht keine Dummheiten«, flüsterte er ihnen zu. »Edvard, verhalte dich ruhig. Esst das auf. Auch du, Blanche. Ihr müsst bei Kräften bleiben. Esst und trinkt, und dann sagt Bescheid, wenn ihr mal kurz hinter die Büsche müsst.« Frances zwinkerte ihnen zu und kehrte dann zu seinem Platz auf dem Baumstumpf zurück. Die Männer grunzten weiter auf ihren Satteldecken. Edvard brach das Brot in zwei Teile und wollte Blanche das größere Stück reichen, doch Blanche schüttelte nur den Kopf und nahm ihm das kleinere aus der Hand.
Als sie das trockene Brot hinuntergewürgt hatten, räusperte sich Edvard. Er hoffte, Frances’ Plan richtig gedeutet zu haben. Doch erst als sich Edvard ein zweites Mal, dieses Mal vernehmlicher, räusperte, erhob sich Frances schwerfällig und schritt mit genervtem Gesichtsausdruck in Richtung seiner Gefangenen. Edvard bemerkte, dass das Schnarchen um sie herum leiser geworden war. Ein paar der Männer waren aufgewacht und blinzelten müde in ihre Richtung. Deswegen also dieses Spiel, erkannte Edvard. Verlasse dich nie auf das Schnarchen eines Mannes. Frances baute sich vor ihnen auf und fragte: »Was ist los, was wollt ihr? Mehr Brot kriegt ihr nicht, das könnt ihr vergessen.«
Es war Blanche, die ihm antwortete. »Frances, ich würde gerne einem dringenden Bedürfnis nachkommen. Würdet Ihr mir für einen Moment die Fesseln abnehmen?« Ihre Augen waren gerötet von den Tränen der letzten Tage und dem wenigen Schlaf. In ihrem Blick jedoch funkelten Hoffnung und ein wenig von jenem Trotz, mit dem sich die ersten Blumen im Jahr durch die gefrorene Erde kämpfen und sich dem rettenden Sonnenstrahl zuwenden, der sie geweckt hat. Frances reagierte ein wenig verlegen auf die Art und Weise, wie sie ihn ansah, überlegte einen Moment, nickte dann jedoch und zerschnitt ihre Fesseln. Als er wieder aufstand, ließ er das Messer an Ort und Stelle liegen, und machte sich dann auf, Blanche zu begleiten. Edvards entsetzter Blick entging ihm nicht, doch er schüttelte nur leicht den Kopf. In angemessenem Abstand blieb er stehen und wandte Blanche den Rücken zu. Die übrigen Wachen schienen wieder zu schlafen. Zumindest war das Schnarchen und Grunzen wieder lauter geworden.
Als Frances und Blanche zurückkehrten, hatte sich Edvard von seinen Fesseln befreit und stand mit dem blanken Messer in der Hand vor ihnen. Frances nickte und gab ihm mit knappen Gesten zu verstehen, ihn nun als Geisel zu nehmen. Edvard war alles andere als wohl dabei, doch er verließ sich auf seinen Freund. Frances wandte ihm den Rücken zu, sodass Edvard ihm die Hände auf den Rücken binden und von hinten am Oberkörper umfassen konnte. Dann setzte er ihm das Messer an die Kehle. Blanche hielt sich dicht an seiner Seite. Rückwärts schlichen sie zu den Pferden, ohne das Lager auch nur einen Moment aus den Augen zu lassen. Es war Frances, der so über seine Füße stolperte und die Wachen weckte.
»Was zum Teufel macht ihr da?«, rief einer der Männer, der sofort auf den Beinen war. Edvard fluchte kurz und sah sich ruckartig nach den Pferden um. Es waren nur noch wenige Schritte. Frances sog dabei die Luft zwischen den Zähnen ein. Das Messer war scharf und die Haut an seiner Kehle dünn.
»Bleibt, wo ihr seid!«, rief Edvard den Wachen zu, die mittlerweile alle aufgeschreckt waren und alarmiert zu ihren Waffen gegriffen hatten. »Bewegt euch auch nur einen Schritt, und Frances wird dran glauben! Waffen weg!«
Es folgte ein Moment ratlosen Schweigens. Die Männer sahen von Frances zu Edvard, von Edvard zu dem Messer und vom Messer zu Wolter. Der verzog jedoch keine Miene und sah Edvard einfach nur an.
Die kleine Lichtung war von einer unheimlichen Stille erfüllt. Selbst die Vögel in den Bäumen schienen die Gefahr zu spüren und wagten nicht, auch nur einen Ton von sich zu geben.
Schließlich senkte Wolter sein Schwert und ließ es langsam aus den Fingern gleiten. Edvard ließ er dabei nicht einen Atemzug aus den Augen. Die anderen Männer folgten jedoch seinem Beispiel. Ihre Schwerter landeten mit einem dumpfen Klirren auf dem weichen Waldboden.
»Edvard, macht es doch nicht noch schlimmer. Warum tut Ihr das?«, fragte Wolter.
»Warum ich Blanche beschütze? Verdammt, weil sie unschuldig ist! Das wisst Ihr genauso gut wie ich. Ihr habt Euch auch für sie ausgesprochen!«, erwiderte Edvard.
»Ja, das habe ich. Doch mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher. Warum zum Henker seid Ihr geflohen, Edvard? Wenn Blanche unschuldig wäre, dann hätte sie doch nichts zu befürchten und –«
Das war zu viel für Edvard. Er wollte es nicht hören. Er wollte nicht hören, dass die Flucht ein Fehler gewesen sein könnte. Ungehalten fiel er dem Ritter ins Wort. »Blanche, binde die Pferde los und treibe sie in den Wald – bis auf zwei. Nein, vier, halte vier zurück. Beeile dich!«
Ohne zu zögern tat Blanche, was er sagte. Sie band die Pferde los und scheuchte sie mit energischen Klapsen auf die Hinterteile in den Wald. Als das getan war, gab Edvard ihr zu verstehen, dass sie aufsitzen solle. Er nahm das Messer zwischen die Zähne, warf einen warnenden Blick in Richtung der Wachen, half seinem gefesselten Freund auf ein Pferd und bestieg dann selbst ein drittes.
»Wagt es nicht, uns zu folgen. Sollte ich einen von euch hinter uns sehen, hören oder auch nur riechen, dann stirbt Frances! Das ist mein Ernst, nehmt mich beim Wort«, drohte Edvard den Männern. Der Ton seiner Stimme ließ keinen Zweifel daran, dass er genau das tun würde. Er war selbst überrascht, wie überzeugend es klang. Das Gefühl, noch Herr der Lage zu sein, hatte er längst verloren.
Ohne ein weiteres Wort drückte er seinem Pferd die Absätze in die Flanken. Der Wald um sie herum erwachte nun vollends zum Leben. Die Vögel in den Bäumen, die Frösche in den Tümpeln, selbst die Käfer und Fliegen um sie herum schienen sie anfeuern und ermutigen zu wollen.
Sie ritten nicht weit, aber schnell. Edvard hatte darauf verzichtet, sich durch den wilden Wald zu kämpfen und war stattdessen der breiten Straße gefolgt, die Frances ein paar Stunden zuvor auch gewählt hatte. Sie kamen gut voran. Von ihren Verfolgern war nichts zu sehen. Und so stoppte Edvard schließlich, als sie einen kleinen Bach kreuzten.
»Frances, was meinst du? Ist es in Ordnung, wenn ich dich hier gehen lasse? Ich schätze, deine Männer suchen schon nach dir – es dürfte nicht lange dauern, bis sie dich hier finden.« Edvard löste Frances’ Fesseln und wartete auf eine Antwort. Sein Freund rieb sich einen Moment die Handgelenke und sah sich kurz um. Dann nickte er seufzend.
»Ja, ich denke schon. Ich werde ihnen entgegenlaufen, und notfalls schaffe ich es wohl auch bis nach Sommerhain«, meinte Frances.
»Gut, dann soll es so sein«, sagte Edvard. Müde lächelte er seinen Freund an. »Ich danke dir für alles, Frances.« Frances nickte und schluckte.
»Wohin werdet ihr jetzt reiten, Edvard? Litona?«
»Nein, da kämen wir vom Regen in die Traufe. Zwei Tagesritte östlich von hier ist die Burg eines alten Freundes meines Vaters. George, du kennst ihn. George Barsteen. Dort sollten wir eine Weile untertauchen können, bis ich eine Idee habe, wie es weitergehen soll.«
»Und du meinst, du kannst dem alten Barsteen vertrauen?« Frances Skepsis kratzte nur an der Oberfläche, und als Edvard nickte und ihm die Hand auf die Schulter legte, schien sie verflogen.
»Ich kann auf den alten George genauso zählen wie auf dich, mein Freund.« Er schloss Frances zum Abschied kurz in die Arme und saß wieder auf. Blanche verabschiedete sich mit einem dankbaren Nicken.
Dann ritten sie davon.
»Viel Glück euch beiden«, rief ihnen Frances hinterher. Als sich Edvard umdrehte, um ihm ein letztes Mal zu winken, sah er gerade noch, wie sich Frances auf einen Stein setzte und das Gesicht in den Händen vergrub. Dann bogen sie um eine Kurve und er war außer Sichtweite. Was blieb, war Edvards schlechtes Gewissen.
Kapitel 4
Edvard hatte sich in dem alten George Barsteen nicht getäuscht. Im Gegenteil. Edvard und Blanche hatten sich kaum der diensthabenden Wache am Tor vorgestellt, als der alte, graubärtige Ritter schon auf den Stufen seiner Halle erschien und seine Gäste lauthals begrüßte.
»Edvard, mein Junge, ja spinn’ ich denn? Was tust du hier? Sei mir willkommen, mein Junge! Komm von deinem Gaul runter und reich mir die Hand! Ich habe sogar mein Abendbrot unterbrochen, als ich gehört habe, wer da vor meiner Tür steht!« Ein paar vereinzelte Brotkrumen, die sich in den dünnen Fäden seines Bartes verfangen hatten, legten Zeugnis davon ab.
Edvard lachte. Er stieg von seinem Pferd und umarmte den alten Mann, bevor er Blanche aus dem Sattel half.
»Und sag, mein Junge, wer ist denn die hübsche Dame da? Möchtest du uns nicht einander vorstellen?« Der alte George zwinkerte Blanche freundlich zu. Wenn ihm die Umstände ihres Besuches merkwürdig vorkamen, so ließ er es sich nicht anmerken. »Und ihr da, steht nicht so faul rum! Richtet für unsere Gäste das Turmzimmer her – ach, wie es dort aussehen muss! Vielleicht nehmt ihr ein Stück Käse mit, damit ihr die ganzen Mäuse bestechen könnt euch beim Putzen zu helfen. Los, los! Und bereitet Wasser für ein heißes Bad!« George scheuchte die umstehenden Mägde und Knechte mit aufgeregten Gesten auf, die sich in alle Richtungen zerstreuten, um seinen Anweisungen nachzukommen. »Ein heißes Bad, ja, ihr seht so aus, als könntet ihr das gut vertragen«, sagte er, wieder an Edvard und Blanche gewandt. »Ihr müsst mir verzeihen. Das letzte Mal, dass ich Gäste hatte, lebte meine liebe, gute Frau noch, müsst ihr wissen. Die Gäste waren immer ihre Aufgabe. Ich glaube, seither hat niemand überhaupt auch nur einen Fuß in unser schönes Turmzimmer gesetzt. Der Staub muss dort schon bis zur Decke reichen. Aber das Bett ist sehr bequem, das kann ich euch sagen. Ihr bleibt doch über Nacht, nicht wahr?«
»Gerne, wenn es keine Umstände –«, setzte Edvard an.
»Keine Umstände, jetzt hör sich einer den Jungen an!«, polterte George. »Natürlich macht es Umstände! Aber schöne Umstände! Endlich kommt mal wieder ein bisschen Leben in diese toten Mauern, mein Junge!« Der alte Mann lachte, und nickte dann in Richtung von Blanche. »So, und nun stell uns doch bitte vor, mein Junge. Ich bin George Barsteen, mein Fräulein. Aber das wisst Ihr sicherlich bereits. Und bevor Ihr etwas sagt, meine Dame, muss ich sagen, dass Edvard einen außerordentlich guten Geschmack bei der Wahl seiner Braut bewiesen hat.«
Für einen kurzen Moment überlegte Edvard, ob er George in dem Glauben lassen sollte, dass Blanche seine Frau war, doch dann siegte der Kopf über das Herz und er klärte das Missverständnis auf.
»Blanche, Ihr Name ist Blanche«, antwortete Edvard. »Und wir sind nicht verheiratet, George. Wir sind ... Sagen wir es so: Blanche ist auf der Reise, und ich sorge dafür, dass sie wohlbehalten dort ankommt.«
»Oh, wie geheimnisvoll«, kicherte George. »Und Blanche, einen wirklich schönen Namen habt Ihr da. Das muss ich schon sagen. Nun denn, dann verzeiht einem alten Mann seine voreiligen Schlüsse! Wir finden sicherlich noch ein eigenes Zimmer für Euch, mein Mädchen. Die Klatschmäuler müssen ja nicht unbedingt mehr zu schnattern bekommen als so schon, nicht wahr?« Der alte Mann kicherte erneut und wies einen zufällig gerade vorbeilaufenden Dienstboten an, noch eine zweite Kammer vorzubereiten.
»Vielen Dank, Herr Barsteen«, sagte Blanche. »Ihr seid sehr freundlich. Ich freue mich sehr, Eure Bekanntschaft zu machen.«
»Ganz meinerseits, ganz meinerseits, mein Mädchen«, entgegnete George. »Aber nennt mich doch bitte George, seid so gut, ja? Meine Knochen sind zwar genauso bröckelig wie diese Mauern hier, aber im Geist, da bin ich noch ein junger Hüpfer. Herr Barsteen klingt so sehr nach meinem Vater, nicht wahr? Und da fühle ich mich so alt. Nein, nennt mich einfach George.«
Blanche antwortete mit einem Nicken. Dann legte der alte Ritter Edvard einen Arm um die Schulter und zog ihn ein Stück zur Seite, sodass Blanche sie nicht hören konnte. »Mein Junge, in diesem Punkt unterscheidest du dich doch sehr von deinem Vater. Das muss ich schon sagen. Nie, hörst du, nie im Leben hätte er sich so eine Gelegenheit entgehen lassen. Nicht im Traum wäre ihm das eingefallen! Ein so hübsches Mädchen, und dann in zwei getrennten Betten schlafen. Also wirklich.« Edvards bedienter Gesichtsausdruck löste eine weitere Welle kauzigen Kicherns aus.
Als Blanche ihnen daraufhin fragende Blicke zuwarf, räusperte er sich, lächelte ihr freundlich zu und fragte: »Blanche, mein Mädchen, wohin soll denn die Reise gehen? Ich sehe gar kein Gepäck? Oder seid Ihr Eurer Dienerschaft vorausgeritten? Muss ich noch mehr Zimmer herrichten lassen?« George warf Edvard einen vielsagenden Seitenblick zu.
»Blanche gehört zum Hofstaat der Königin und ihrer Schwägerin. Wir reisen allein«, antwortete Edvard schnell. George antwortete ihm mit einem Stirnrunzeln. Er öffnete den Mund, um eine weitere Frage zu stellen, überlegte es sich dann jedoch scheinbar anders. Edvard wich seinem Blick nicht aus, sondern gab dem alten Ritter mit einem kurzen, ernsten Nicken zu verstehen, dass sie es für den Moment dabei belassen sollten. Es folgte ein Moment des Schweigens. Blanche schaute schüchtern zu Boden und klopfte sich aus Verlegenheit den Staub aus der Kleidung.
Plötzlich hörte man im Stall ein Pferd wiehern. Ein Bursche fluchte lautstark über dessen Hinterlassenschaften, in die er scheinbar gerade getreten war. Dann hörte man einen anderen, der keinen Hehl daraus machte, dass er das sehr lustig fand. Als ihn der Pechvogel daraufhin mit einem Schwall böser Worte bedachte, wurde das Lachen noch lauter.
Der alte George grinste plötzlich verschmitzt und klatschte auffordernd in die Hände. »Ich verstehe, ich verstehe. Ich bin mir sicher, Eure Reise ist nicht zum Vergnügen und das Ziel nicht für jedermanns Ohren gedacht. Nun Blanche, ich freue mich jedenfalls sehr, dass Ihr den Weg zu mir gefunden habt.« Er nickte ihr zu, wieder mit einem herzlichen Lächeln im Gesicht. »Bleibt solange, wie Ihr möchtet. Je länger, desto besser. Und wenn es Euch an irgendetwas fehlt, so scheut Euch nicht, danach zu fragen.«
»Habt vielen Dank, George. Seid versichert, dass das Einzige, was mir im Moment fehlt, ein Bett ist«, erwiderte Blanche. »Eure Gastfreundschaft ist ein Segen. Die Reise war lang und anstrengend und ich glaube, ich könnte wohl sofort hier vor Euren Augen einschlafen.«
»Nun, und das wollen wir ja nicht, oder? Es wäre jammerschade um das Bad, das auf Euch wartet, mein Mädchen. Am Ende müsste ich es dann selber nehmen, und das habe ich doch erst vor zwei Wochen über mich ergehen lassen.« Wieder zwinkerte der alte Mann. Von den Brotkrumen in seinem Bart abgesehen, machte er nicht den Eindruck, dass er nur wenig auf Körperpflege geben würde. »Wie dem auch sei. Lasst Euch nicht von dem Gefasel eines alten Greises aufhalten, mein Mädchen. Geht nur und ruht Euch aus. Ihr seht wirklich müde aus, mein Mädchen. Sehr hübsch, aber müde.« Blanche wollte sich gerade abwenden und einer Magd folgen, die schon an der Tür auf sie wartete, da fügte der alte George noch mit sanfter Stimme hinzu: »Und Blanche, Ihr seid hier sicher. Darauf gebe ich Euch mein Wort.«
Blanche wandte sich noch einmal um. Zum ersten Mal lächelte sie.
Am späten Abend saß Edvard mit George in dessen geräumigem Gemach am Kamin. Blanche hatte er seit ihrer beider Ankunft nicht mehr gesehen. Die Mägde sagten, sie wäre nach dem Bad sofort im Bett eingeschlafen. Edvard hatte sie nicht wecken wollen.
Es gab viel zu bereden. Edvard hatte einen Teller mit Brot, Käse und etwas kaltem Braten vor sich und trank mit dem alten Ritter roten Wein aus Saranien. Das löste die Zunge.
George hielt sich für zu alt, um seine Burg zu verlassen und die Strapazen einer Reise auf sich zu nehmen. »Solange man meine Leute in Frieden lässt, jeden Abend was Warmes zum Essen auf dem Tisch steht und ich meinen Morgenschiss nicht im Bettlaken wiederfinde, können sich die Jungen in der Welt da draußen austoben«, waren seine Worte. Doch trotzdem interessierte er sich für das, was außerhalb seiner Mauern geschah, und nicht selten entfuhr ihm ein bissiger Kommentar zu dem, was ihm Edvard berichtete. Und so sprachen sie schon bald über den Krieg mit Massalon und Litona, die erkämpfte Unabhängigkeit, die Gefangenschaft von Edvards Vater, die geplante Hochzeit mit dem Gefangenenaustausch, und schließlich über die Geschehnisse auf Burg Sommerhain, den Tod des königlichen Neffen, die plötzliche Abreise der Braut und den nun wieder drohenden Krieg.
George hörte aufmerksam zu. Nachdenklichkeit und Sorgen trieben tiefe Furchen in die ohnehin schon von Falten veredelte Stirn. Und seine Miene wurde umso bedrückter, je länger Edvard sprach. Schließlich erhob er sich und trat an einen kleinen Tisch in der hintersten Ecke des Zimmers, auf dem ein kleines Fass und ein kleiner Becher standen. Er zog den Pfropfen aus dem Fass und füllte einen winzigen Becher, den er sodann in einem Zug leerte.
»Der gute alte Bärenfäller«, seufzte George. »Trinke einen davon, und du fühlst dich wie ein neuer Mensch. Trinke zwei, und du hast vergessen, wer du warst. Trinke drei, und du hast vergessen, wer du warst, wer du bist, wo du bist, was du bist und warum du es bist. Willst du auch einen?« Edvard schüttelte den Kopf. »Hm.« Nachdenklich drehte George den Becher in seiner Hand. »Und Blanche, mein Junge? Welche Rolle spielt Blanche dabei? Erwähntest du nicht, dass das Mädchen zum königlichen Hofstaat gehört?«
Edvard kaute eine Zeit lang unbehaglich auf seiner Unterlippe, bevor er antwortete. Er wusste nicht, ob es eine gute Idee war, George einzuweihen. Schlimm genug, dass schon Frances seinetwegen in Schwierigkeiten steckte.
George drängte ihn nicht, doch er musterte ihn aufmerksam. Am Ende war es der brennende Wunsch, sich jemandem anzuvertrauen, der ihn George die ganze Geschichte erzählen ließ.
Er begann bei der königlichen Versammlung, berichtete von ihrer wilden Flucht, von Sonnau und Frances und der scheinbaren Entführung auf der Lichtung, ließ nichts aus und sprach immer schneller.
»George, ich weiß, wie sich das anhört. Das Ganze ist dumm, es ist Wahnsinn, es grenzt an Hochverrat und Was-weiß-ich-nicht-alles noch. Ich bereite meinem Vater und meinem Namen Schande, bringe zudem meinen besten Freund in Bedrängnis – nein, nicht nur das, ich mache ihn sogar mit zum Verräter!« Edvard holte kurz Luft. »George, verurteile mich nicht, bitte! Ich weiß, was ich riskiere, was ich aufs Spiel setze. Aber ich schwöre dir, ich schwöre dir bei meiner Ehre, bei der Ehre meines Vaters und unserer Ahnen, ich schwöre dir aus ganzem Herzen: Blanche ist unschuldig! Ich weiß es! Ich spüre es! Sie hat den Jungen nicht umgebracht, und ich kann nicht mit ansehen, wie sie den Wölfen zum Fraß vorgeworfen wird, nur damit diese ihren Blutdurst eine Weile länger im Zaum halten können. Lieber hänge ich am höchsten Galgen, George! Ich kann das nicht, ich kann das nicht!«
Erschöpft stützte sich Edvard auf das Fensterbrett, völlig überrumpelt von seinem Ausbruch. Am Horizont verschwand der letzte schmale Streifen Tageslicht, verblasste langsam von warmem Orange in kaltes Blau und war nach kurzer Zeit nur noch eine Erinnerung, die flüchtig dahinschied. George stierte gedankenverloren vor sich hin.
Schließlich setzte sich Edvard wieder hin; der Wein ließ ihn die Anstrengungen der letzten Tage doppelt und dreifach spüren.
»Blanche, dieses Mädchen – dir liegt sehr viel an ihr, nicht wahr?«, fragte er. Edvard nickte zur Antwort. »Sie ist hübsch. Ein guter Fang, mein Junge. Die Tochter eines Ritters, sagtest du?« Edvard nickte abermals. »Verstehe, verstehe«, murmelte George. Er wirkte nachdenklich. Dann fragte er ganz unvermittelt: »Und? Hast du vor, sie zur Frau zu nehmen?«
»Ob ich was?«, fragte Edvard mehr überrascht denn entsetzt. Er war nicht sicher, ob er den alten George richtig verstanden hatte, oder ob der sich einen Scherz erlaubt hatte. Doch George sah ihm ernst in die Augen.
»Wirst du sie heiraten, Edvard?«, wiederholte er leise, ruhig.
»Darüber habe ich noch nicht nachgedacht«, antwortete Edvard zögernd.
»Verdammt, Junge, antworte mir wie ein Mann! Willst du mir weiß machen, dass du sie aus purem Ehrgefühl heraus entführt und – so wie du es nennst – gerettet hast?« George schien auf einmal dreißig Jahre jünger. »Edvard, du hast Hochverrat begangen! Sehen wir der Wahrheit ins Auge! Hochverrat! Wenn sie dich fassen, dann wirst du genauso hängen wie sie! Ist sie dir das wert, Junge?«
»Ja ... ja, ich denke schon«, stammelte Edvard.
»Sicher?«, lauerte George. »Bist du dir wirklich sicher? Dann antworte auf meine Frage, Edvard. Willst du sie zur Frau nehmen? Ist Blanche das Mädchen, das du bis ans Ende deiner Tage an deiner Seite haben willst?« George hielt einen Moment inne und ließ Edvard Zeit sich zu sammeln. Er schien die Antwort auf seine Frage bereits zu kennen, doch er wollte sie wohl aus seinem Mund hören.
»Ja, ich will Blanche zur Frau nehmen. Und das lieber heute als morgen«, sagte Edvard schließlich. Seine Stimme hatte ihre Ruhe und Festigkeit zurückgewonnen, seine Schultern waren straff und der Blick seiner Augen klar. George lächelte.
»Das ist gut«, beschied er. »Hör auf, daran zu zweifeln, dass du das Richtige getan hast, mein Junge. Du hast das Herz am rechten Fleck und jemand wacht über dich, ganz sicher.« Er legte Edvard eine Hand auf die Schulter und sein Blick strahlte Wärme und väterlichen Stolz aus. »Blanche ist wirklich zu beneiden.«
Am nächsten Tag fand Edvard Blanche auf der südlichen Wehrmauer. Er hatte die ganze Nacht wachgelegen und über sein Gespräch mit George nachgedacht.
Der alte Mann hatte ihn in eine Falle gelockt. Er hatte ihn dazu gebracht, seine Gefühle für Blanche beim Namen zu nennen. Das war auf eine gewisse Art und Weise befreiend gewesen. Allerdings hatte er ihn auch dazu gebracht, einen Plan für die Zukunft auszurufen – und das war der entscheidende Punkt. Denn bei aller Liebe, die er für Blanche empfand, und bei allem, was er für sie aufs Spiel gesetzt hatte, hatte er keine Ahnung, wie ihre Gefühle für ihn selbst aussahen. Und das war beängstigend.
George hatte ihm damit Kraft geben wollen. Das war ihm klar. Das war ihm für den Moment auch gelungen. Doch was, wenn Blanche ihn lediglich als noblen Ritter sah, der sich nur aus Prinzip für sie einsetzte? Würde ihm das reichen?
»Ich liebe diesen Ausblick«, sagte er, als er neben sie an die Brüstung trat. »Georges kleine Burg kommt einem manchmal ein bisschen wie der letzte Außenposten der Zivilisation vor, wenn man so über den See und die Hügel schaut.« Blanche folgte seinem Blick. »Als kleiner Junge habe ich mich immer gefragt, was dahinter liegt. Das edle Königreich Litona klang immer so mystisch, wie eine andere Welt.« Edvard wartete ab, ob Blanche den Faden aufnehmen würde. Einen Moment lang schwieg sie, ließ ihn selbst seinen Erinnerungen nachhängen, doch dann sah sie ihn an.
»Wie ist es in Litona?«, fragte sie leise. »Ich war noch nie da.«
»Nicht? Wie ungebührlich für eine litonaische Spionin«, witzelte Edvard. Blanche antwortete mit einem Lächeln, das ihre Augen nicht erreichte. Nicht so schnell, mahnte er sich selbst. Streu kein Salz in ihre Wunden. »Es ist wie hier«, fuhr er schnell fort. »Das gleiche Wasser, die gleichen Bäume, dieselbe Sonne. Wenn man weiter nach Osten geht, dann gibt es auch ein paar Berge. Nicht so hoch wie das Anvaligebirge in Aquistea, aber immerhin noch mehr als unsere paar Hügel hier. Im Südosten soll es dann auch viele Sümpfe geben, da, wo die Grenze zu Massalon verläuft. Aber da war ich noch nicht. Nur die Städte, die sind anders, glaube ich. Größer. Lauter. Irgendwie voller. Und alle geben sich Mühe, wichtig und reich auszusehen. Wie bei einem Maskenball. Aber die Hintergassen ersaufen im Unrat.«
»Das möchte ich gerne mal sehen«, sagte Blanche. »Also nicht den Unrat. Aber die Märkte. Ich habe gehört, dass es dort Sachen gibt, von denen man sich gar nicht vorstellen kann, dass es sie gibt.«
»Ja, das kann gut sein. Litona lebt von seinen Händlern. Deswegen haben sie auch den Krieg verloren.«
Blanche erwiderte nichts darauf, sondern sah wieder zum Horizont. Falsches Thema, Edvard, erkannte er. Worüber haben wir gerade noch gesprochen?
»Was würdest du dir denn auf so einem Markt kaufen?«, fragte er. Großartige Frage. Woher soll sie das wissen, wenn sie noch nie auf einem war und es dort Sachen gibt, die es gar nicht gibt? Blanche ließ sich Zeit mit ihrer Antwort und hielt den Blick in die Ferne gewandt.
»Von allem etwas. Etwas für gleich, und etwas zum Erinnern.«
Diese Antwort berührte Edvard. Er rief sich in Erinnerung, dass Blanche nicht aus der wohlhabendsten Familie stammte. Adlig zwar, aber nicht reich. Und gerade unter den jungen Damen am Hof war nichts so wichtig wie das, was viel kostete.
»Bringst du mir etwas mit? Wenn du dann mal auf so einem Markt bist.«
»Was möchtest du denn haben?« Sie sah ihm wieder in die Augen. Er meinte fast so etwas wie ein neckisches Blinzeln zu erkennen. Er überlegte kurz, bevor er antwortete.
»Etwas zum Erinnern.«
Auf Blanches Gesicht stahl sich erneut ein Lächeln, und dieses Mal erreichte es auch ihre Augen. Edvards Herz machte einen kleinen Sprung. Einen Moment lang sahen sie sich in die Augen, dann, wie auf ein geheimes Zeichen hin, wieder zum Horizont.
»Es ist so ruhig hier. Wie in einem Traum. So friedlich«, sagte Blanche in die Stille hinein.
»Du träumst nicht«, antwortete Edvard unbeholfen.
»Nicht? Habe ich dann vielleicht nur die letzten Tage geträumt?«
»Nein, aber ich wünschte, dem wäre so.«
»Ja. Ich auch.«
»Aber jetzt bist du in Sicherheit.«
»Ja, George und du, ihr gebt euch große Mühe, mich das glauben zu lassen. Aber bin ich das wirklich? Und wovor bin ich in Sicherheit? Das ganze Reich will meinen Kopf ...«
»Nein, nicht das ganze Reich. Das stimmt nicht. Es gibt genug, die sich auch für dich einsetzen.«
»Ich habe also nichts zu befürchten?« Blanche sah ihm ernst in die Augen.
»Nein.«
»Und warum sind wir dann geflohen?«
In Blanches Stimme lag kein Vorwurf. Im Gegenteil, Edvard bekam das Gefühl, dass sie ihre Rollen getauscht hatten und nun sie es war, die ihm erklärte, was gerade geschah. Doch er spürte, dass sie keine Antwort von ihm erwartete.
»Ich werde nicht zulassen, dass sie dich wieder in einen Kerker werfen. Und wenn das bedeutet, dass wir zusammen nach Massalon gehen, dann soll es so sein.«
»Ach, das ist doch Wahnsinn, Edvard«, unterbrach ihn Blanche. »Nach Massalon? Mit nichts als dem, was wir am Leib tragen? Und was ist mit deiner Familie, deinem Erbe? Was ist mit Frances, und was mit deinem Schwur gegenüber der Krone? Was sollen wir denn in Massalon machen? Ich kenne dich doch auch gar nicht!
Du hast für mich sowieso schon zu viel aufs Spiel gesetzt, und wenn ich in dem Moment bei klarem Verstand gewesen wäre, hätte ich mich im Stall nie von dir auf das Pferd setzen lassen. Vielleicht sollten wir einfach umkehren. Aldan wird dir sicherlich verzeihen.«
Das traf Edvard mitten ins Herz.
»Willst du mir jetzt vorwerfen, dass ich dein Leben gerettet habe?«
»Nein, natürlich nicht. So war das nicht gemeint.« Blanche holte tief Luft. »Tut mir leid. Ich verstehe nur nicht, warum du das alles auf dich genommen hast. Und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und ich will nicht, dass du dein Leben für mich wegwirfst. Das kann ich nicht zulassen.«
»Ich werfe doch mein Leben nicht weg.« Jetzt hörte er sich an wie ein kleiner Junge.
»Nicht? Dann erkläre es mir. Was tun wir hier?«
Edvard wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Er war enttäuscht.
»Ich rette dich. Nicht mehr und nicht weniger«, antwortete er schließlich. Es war, als hätte ihm jemand die Tür vor der Nase zugeschlagen. Mit einem Mal war da ein großes, schwarzes Loch, das in seiner Brust klaffte.
Übermannt von Müdigkeit und Erschöpfung ließ er den Kopf hängen. Er wusste, dass er in genau diesem Moment Kraft und Zuversicht ausstrahlen sollte, egal, ob Blanche seine Gefühle erwiderte oder nicht. Er hatte sich entschieden sie zu retten, und wenn er dabei gehofft hatte, ihr Herz zu gewinnen, so hatte ihm bewusst sein müssen, dass sie es ihm nicht nur allein aus Dankbarkeit schenken würde. Andere Frauen hätten das vermutlich schon für viel weniger getan. Aber neben ihm stand eben Blanche. Und auf eine furchtbare Art und Weise war er sogar froh darüber, dass sie es ihm so schwer machte.
»Der edle Ritter, der die Jungfrau rettet?«, fragte sie schließlich leise. Edvard schreckte aus seinen Gedanken auf. Blanche musste ihn beobachtet haben. Er konnte darauf nichts erwidern. »Sag mir, warum du mich gerettet hast. Was hast du davon? Hat dich jemand dafür bezahlt? Mein Vater vielleicht?« Ihr Tonfall war sanft und gutmütig. Versöhnlich.
»Nein. Ich kann dir nicht sagen, was mich dazu getrieben hat, Blanche. Es war nicht geplant. Und ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Aber ich verspreche dir, dass mir etwas einfallen wird.«
»Verstehe«, sagte sie leise, und drehte sich wieder zur Brüstung.
»Bereust du wirklich, dass du mitgekommen bist?«
»Was willst du denn hören, Edvard?«, entgegnete Blanche. »Dass ich lieber wieder im Kerker säße? Natürlich nicht! Aber wie viel besser geht es mir denn jetzt? Ich bin auf einer Burg, die ich nicht kenne, mit einem Mann, von dem ich nicht weiß, was er im Sinn hat, während man mich beschuldigt, ein Kind ermordet zu haben und mich der König selbst am Galgen sehen möchte!
Und ja, jetzt gerade bereue ich, mitgekommen zu sein! Denn im Kerker wusste ich wenigstens, was mich erwartet, und ich hatte die Hoffnung, dass sich alles zum Guten wenden würde! Und jetzt sieht es vielleicht so aus, als würde ich fliehen wollen, weil ich wirklich schuldig bin – wer wird mir denn jetzt noch glauben?«
»Ich tue es. Frances. George.« Edvard sah sie nicht an, als er ihr antwortete. Er hielt den Blick starr zum Horizont. Sie musste nicht sehen, dass er mit den Tränen kämpfte.
»Oh Edvard, ich schwöre dir bei den Göttern – nach allem, wie ich Frances, George und dich kennengelernt habe, würde mir das reichen!« Blanche hat sich von der Brüstung gelöst und sich ihm voll zugewandt. »Aber was ist mit meiner Familie? Wer sagt mir, dass sie nicht für das, was wir tun, zur Rechenschaft gezogen werden? Verstehst du nicht? Ich habe Angst! Wäre ich im Kerker, könnte ich mich verteidigen und den Schaden abwenden. Und wenn sie mich hängen lassen wollen, so wäre die Schuld damit wenigstens getilgt und aus der Welt geschafft! Aber so, ich weiß doch gar nicht –«
»Blanche!« Edvard fiel ihr ins Wort. Er hatte genug gehört. »Für das, was sie dir vorwerfen, gibt es keine Sühne. Wenn sie dich für schuldig befinden, wird das trotzdem Auswirkungen auf deine Familie haben. Euer Name wäre für immer befleckt! Und dein Tod wäre sinnlos, einfach nur sinnlos, und diesen Gedanken ertrage ich nicht!«
Edvard sah, wie sich ihre großen, braunen Augen, in denen er sich so verlieren konnte, mit Tränen füllten. Natürlich hatte sie Angst. Wie hatte er nur so blind sein können? Einen Moment lang zögerte er noch, doch dann machte er einen Schritt auf sie zu und schloss sie in seine Arme. Sie wehrte sich nicht.
»Blanche, Aldan ist kein Monster. Ich werde einen Weg finden, ihn davon zu überzeugen, dass du unschuldig bist. Ich habe Freunde am Hof, und sie werden uns helfen. Aber erstmal müssen wir dafür sorgen, dass du in Sicherheit bist.«
Blanche sagte nichts mehr. Eine ganze Weile standen sie so regungslos auf der Mauer, bis Edvard sie dann ein kleines Stück von sich wegschob. Er nahm ihre Hand und ging in die Hocke, und als sie ihm folgte, setzte er sich auf den Boden. Gemeinsam lehnten sie sich an die Mauer.
Lange Zeit sagten sie nichts. Edvard versuchte sich einzureden, dass er seine Enttäuschung ausblenden und sich alleine mit der Frage beschäftigen müsse, wie es weitergehen sollte. Er versuchte sich einzureden, dass es letztlich egal war, wem Blanche einmal ihr Herz schenken würde – solange er sie vor dem Henker bewahren konnte. Er versuchte sich einzureden, dass er ein nobler, selbstloser Mann war, der seine eigenen Gefühle hinten anstellen konnte. Er versuchte sich einzureden, dass er nicht nur versuchte, sich das alles einzureden.
Vergeblich.
»Im Kerker«, begann Blanche irgendwann. »Im Kerker war dieser eine Kerl.«
»Ein Gefangener?«, fragte Edvard, froh darüber, seinen kreisenden Gedanken entkommen zu können.
»Nein, ein Wächter. Der, der mich in Ketten gelegt hat.« Blanche machte eine lange Pause, bevor sie weitersprach. Sie schien mit sich zu ringen, ob sie weitersprechen sollte. Edvard ließ ihr die Zeit. »Er hatte diesen Gesichtsausdruck ... so ... bösartig. Ich sehe es vor mir und finde doch nicht die richtigen Worte.
Mir ist kalt.« Blanche zog die Beine an und umschlang sie mit ihren Armen. »Er hat mich mit diesem Blick angesehen, so ... gierig. Und er war so nah, die ganze Zeit auf dem Weg in den Kerker. Ich habe seinen Atem gespürt. Im Nacken. Ich spüre ihn sogar jetzt.« Wieder machte sie eine Pause. Edvard verlagerte unbehaglich sein Gewicht. Er hatte Angst vor dem, was nun kommen würde.
»Was ist passiert?«, fragte er sie leise. Seine Stimme war rau und belegt.
»Ich weiß es nicht. Als wir bei der Zelle ankamen, hat er mich am Arm gepackt und mich festgehalten. Und er hat mich angesehen, vom Kopf bis zu den Füßen. Wie man ein Pferd mustert, das man kaufen will. Und dann hat er gelacht, so ein höhnisches Grinsen, richtig böse und hämisch. Er hatte auch so eine Narbe im Gesicht, quer über die Wange. Die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich musste sie die ganze Zeit anstarren.«
Edvard biss die Zähne zusammen. Er war froh, dass er Blanche gerettet hatte. Und er schickte ein Stoßgebet in den Himmel. Oh ihr Götter, bitte lasst es nicht zu spät gewesen sein. »Aber er hat mich nur in die Zelle gestoßen, so plötzlich, dass ich gestolpert und vor ihm auf den Boden gefallen bin. Dann hat er sich über mir aufgebaut und mich angestarrt. Ohne was zu sagen. Er hat mich einfach nur angestarrt, und gegrinst. Die ganze Zeit. Tagelang. Wochenlang. So kam es mir vor. Ich habe sogar kurz gedacht, dass er es endlich hinter sich bringen soll.«
»Hat er dich ... angefasst?« Edvard traute sich kaum, die Frage auszusprechen.
»Nein«, antwortete Blanche ruhig. »Irgendwann hat er sich einfach umgedreht und ist gegangen.« Edvard schloss dankbar die Augen. »Aber ich bin mir sicher, dass er es das nächste Mal, wenn er mich in die Hände bekommt, nicht dabei belassen wird.«
»Es wird kein nächstes Mal geben.« Die Worte fühlten sich dumm und taub auf der Zunge an, so, als hätten sie sich dagegen gewehrt, ausgesprochen zu werden. Er meinte das, was er gesagt hatte, doch er wusste, dass es ein Versprechen war, das er kaum wagen durfte, halten zu können. Und er wusste, dass Blanche sich dessen bewusst war. Schnell versuchte er, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken.
»Als ich noch ein Junge war, wollte ich immer ein edler Ritter werden. Einer, der allein ganze Schlachten entscheidet. Dessen Wort beim König Gewicht hat. Der von allen geachtet und bewundert wird. Der Drachen tötet und Jungfrauen rettet.
Ich war immer furchtlos, immer mutig, stark, aufrichtig, klug, treu, loyal, der beste Kämpfer, der beste Reiter. Ein Ritter, wie er in den Liedern besungen wird.« Seine nächsten Worte wählte er mit Bedacht. »Jetzt bin ich nichts davon, aber irgendwie doch.«
»Warum rettet ein Ritter Jungfrauen vor Drachen?«
»Was meinst du?«, fragte er, irritiert, dass sie ausgerechnet auf diesen Teil der Liste einging, und nicht auf seinen letzten Satz.
»Na, warum rettet ein Ritter Jungfrauen vor Drachen? Ich verstehe das nicht. Macht er es, weil Drachen böse sind und Jungfrauen gut? Macht er es, um eine Trophäe nach Hause bringen zu können? Und wer ist dann die Trophäe? Der Drache, oder das Mädchen? Oder muss er etwas beweisen? Und wenn ja, wem?«
Edvard stutze. »Ich schätze, weil er es geschworen hat.«
»Weil er es geschworen hat? Hast du Aldan geschworen, seine Krone zu verteidigen, das Recht zu wahren, diesen ganzen Kram, und Drachen zu jagen?«
»Nein, natürlich nicht. Aber ich habe geschworen, die Schwachen zu schützen und Unrecht zu bekämpfen.«
»Also ist der Drache im Unrecht?«
»Ja, denn er frisst die wehrlose Jungfrau.«
»Aber warum ist die Jungfrau denn wehrlos?«
»Sie ist gefesselt. Und selbst –«
»Ja, aber es war doch nicht der Drache, der sie gefesselt hat, oder? In Geschichten sind es immer die Menschen, die eine Jungfrau opfern. Der Drache selbst hat doch nur Hunger. Und wir töten auch Schweine, Rinder, Schafe.«
»Also soll ein Ritter die Menschen jagen, die die Jungfrau zum Drachen bringen?«
»Nein, natürlich nicht. Obwohl sie es vielleicht verdient hätten.«
»Sie machen es doch nur, um einen größeren Schaden abzuwenden. Sonst würde der Drache vielleicht das ganze Dorf auslöschen. Manchmal muss man Opfer bringen.«
»Ja, mag sein. Aber immer sind es Jungfrauen. Und so ein Drache ist doch uralt. Warum müssen immer erst ganze Generationen von Jungfrauen geopfert werden, bis sich endlich mal ein Ritter findet, der den armen Drachen von seinem leeren Magen befreit? Und warum kommt eigentlich immer nur ein Ritter? Warum schickt man nicht gleich ein ganzes Heer? Dann wäre es doch eine klare Angelegenheit.«
»Dann wäre es aber auch nicht so ruhmreich.«
»Also geht es doch um die Trophäe?«
»Was möchtest du hören, Blanche?« Edvard wusste nicht, worauf sie hinauswollte. Er wurde unsicher. Das nervte ihn.
»Ich möchte wissen, warum Ritter Jungfrauen vor Drachen retten. Haben sie nicht eigentlich Wichtigeres zu tun? Kriege führen, zum Beispiel. Das Land regieren.«
»Du kennst die Antwort.«
»Ich will deine Antwort.« Blanche sah ihn eindringlich von der Seite an.
»Das, was dir passiert ist, sollte niemandem widerfahren«, antwortete er ausweichend.
»Du wusstest bis gerade eben nicht, was passiert ist.«
»Es hat mich aber auch nicht überrascht.«
»Das zählt nicht.«
Das war der Moment. Edvard spürte es. Sie wollte es hören, das sah er in ihren Augen, und er wollte es ihr sagen. Aber wie? Er hatte nicht viel Zeit zum Überlegen.
»Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann säßen wir genau hier, genau so, und würden weiter über Drachen und die Pflichten eines Ritters streiten«, begann er. Seine Stimme klang ruhig, doch sein Herz raste. Sie musste es hören, so nah wie sie bei ihm saß. »Aber wir würden nicht darüber nachdenken, wie wir König Aldan von deiner Unschuld überzeugen können. Wir würden einfach nur George besuchen, und in ein paar Tagen wieder nach Hause zurückkehren.«
Er überließ es ihr, in seinen Worten zu lesen. Es war unmöglich zu sagen, ob sie verstanden hatte, was er sagen wollte. Sie schien darüber nachzudenken, und er meinte an ihrer Mimik zu erkennen, dass sie mit so einer Antwort nicht gerechnet hatte.
Es gefiel ihm, sie zu beobachten. Sie sah an ihm vorbei ins Nichts, doch sie kaute auf ihrer Unterlippe, und ab und zu verengten sich ihre Augen, als würde sie blinzeln wollen, doch kurz davor sprangen sie wieder auf. Ein Windhauch fuhr ihr in die Haare, und ohne es zu merken, hielt sie eine Strähne davon ab, ihr ins Gesicht zu fallen. Sie war so bildhübsch.
Dann seufzte sie. Sie warf ihm ein flüchtiges Lächeln zu, das alles und nichts bedeuten konnte, und schien nun wieder in der Wirklichkeit angekommen. Edvard hätte gern gewusst, was ihr durch den Kopf ging. Wenn sie seine Gefühle erwiderte, hätte sie dann nicht etwas aufgewühlter wirken sollen?
Andererseits bot ihre Situation auch nicht gerade viel Raum für Romantik. Vielleicht erwartete er zu viel. Sie kannte ihn ja gar nicht, das hatte sie klar und deutlich gesagt. Und er sie auch nicht, auch wenn er sich sicher war, dass seine Gefühle für sie kein Trugbild waren. Da war etwas zwischen ihnen. Und immerhin hatte sie ihm auch anvertraut, was im Kerker geschehen war. Oder hatte sie es nur jemandem erzählen müssen, um nicht daran zu ersticken? Doch hatte sie kurz danach die Diskussion mit den Drachen angefangen.
Während Edvards Gedanken sich immer schneller im Kreis zu drehen begannen, legte Blanche plötzlich ihren Kopf auf seine Schulter. Oh ihr Götter!
»Ich will nicht wieder in den Kerker«, flüsterte sie nach einer Weile. »Danke.«
Kapitel 5
»Oh, Aldan erinnert sich an den alten Mann, der seine teure Grenze bewacht? Was für ein bemerkenswerter Zufall!« Die Nachricht, dass sich ein Trupp unter dem Wappen des Königs der Burg näherte, erreichte George, Edvard und Blanche beim Frühstück. »Ob er wohl Törtchen als Geschenk mitbringt? Diese mit kleinen Apfelstückchen und Honig, die man nirgendwo auf der Welt bekommt, in den Straßen von Resenzia aber an jeder Ecke? Die sind herrlich! Und er hat mir jedes Mal welche mitgebracht, wenn er mich besucht hat.«
Die Wache, die das gemütliche Frühstück so unverhofft ruiniert hatte, war ein junger Bursche, der den ersten Flaum über seinen Lippen mit Würde zu tragen versuchte. Edvard hatte bei seinem Anblick gelächelt, bis er hörte, welche Neuigkeiten er überbrachte. Georges Spott verunsicherte den Jungen. Offenbar war er davon ausgegangen, dass er gute Nachrichten überbrachte. Dass die Stimmung ins Gegenteil umschlug, damit schien er nicht gerechnet zu haben.
»Mein Herr, was sollen wir jetzt tun? Wie lauten Eure Befehle, mein Herr?«, fragte er den alten George.
»Du, mein Junge, tust gar nichts. Du gehst zurück auf deinen Posten und passt auf, dass dir dein Schwert nicht runterfällt. Husch!« Mit einer Geste, mit der man lästige Fliegen verjagt, schickte George die Wache wieder auf ihren Posten. Dann sah er nachdenklich zu Edvard und Blanche. »Die Frage ist eher, was wir jetzt mit euch machen. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr Aldan persönlich die Hand schütteln wollt, oder?«
»Vielleicht wäre es klüger, wenn wir zunächst einmal abwarten, wie ... sich das Wetter entwickelt«, antwortete Edvard vorsichtig.
»Das sehe ich genauso. Mein Schlafgemach hat einen wunderbaren Ausblick. Sicher wollt ihr euch den nicht entgehen lassen, nicht wahr, mein Junge? Und kümmert euch nicht um die Tür. Die ist so alt und krumm wie ich und lässt sich nicht mehr richtig schließen. Nur anlehnen. Ihr werdet doch ruhig sein und mein Gespräch mit dem König nicht stören, nicht wahr, mein Junge? Nicht, dass noch jemand auf die Idee kommen würde, dass ihr uns belauscht.«
Es bedurfte keiner weiteren Worte. Edvard warf George einen dankbaren Blick zu und ging mit Blanche in das Nachbarzimmer. Die Tür ließen sie einen Spalt breit offen stehen.
Sofern es einen Ausblick gab, den sie hätten bewundern können, so verpassten sie ihn. Ohne auch nur einen Blick aus dem Fenster zu werfen, setzten sie sich gleich hinter der Tür an die Wand und warteten. Sie hörten, wie George eine Magd anwies, das Frühstück abzuräumen, und dann schlurfende Schritte und ein kurzes Plätschern von Flüssigkeit in einem kleinen Gefäß. Der Bärenfäller, schlussfolgerte Edvard im Stillen.
Eine gefühlte Ewigkeit lang geschah dann nichts. Edvard versuchte sich einzureden, dass Aldans Besuch tatsächlich nur ein Zufall war. Sie konnten nicht schon wieder entdeckt worden sein. Doch jeder seiner Gedankengänge endete mit einer Überlegung, wie sie aus der Falle, in der sie saßen, erneut entkommen konnten.
Irgendwann hörte er, wie die Tür zu dem Zimmer, in dem sie gerade noch gefrühstückt hatten, geöffnet wurde. Er schreckte aus seinen Gedanken auf und versuchte, jedes Wort zu verstehen, das gesprochen wurde. Erst jetzt bemerkte er, dass Blanche direkt an ihn herangerutscht war. Ihre Haut war eiskalt.
»George Barsteen, nehme ich an?«, eröffnete der Besucher das Gespräch. Er klang unfreundlich und kalt, aber es war nicht die Stimme der Königs, das konnte Edvard mit Sicherheit sagen.
»In der Tat, das ist mein Name«, antwortete George ruhig. »Und da wir das geklärt haben, seht es einem alten Mann bitte nach, wenn sein Gedächtnis löchrig geworden ist. Aber leider erinnere ich mich nicht an den Euren.«
»Ich stehe vor Euch im Auftrag der Krone. Euch ist ein gewisser Frances Veinthart bekannt?«
»Frances, Frances ... Nun, da Ihr so fragt, ist das sicherlich nicht Euer Name, nicht wahr?«
»Rote Haare.«
»Das ist Euer Name? Wie ungewöhnlich.«
»George Barsteen, wie ich bereits –«
»Ja, das ist mein Name«, fuhr ihm George ins Wort. Seine Stimme hatte nichts mehr von der eines alten, vergesslichen Mannes. »Und Ihr tut gut daran, mir jetzt endlich Euren zu verraten. Denn egal, ob Euch der König schickt, Eure Mutter, die Dirne aus der Schenke oder der Esel aus der Mühle, Ihr steht hier in meiner Burg. Und in dieser Burg haben sich Besucher vorzustellen, sobald Sie einen Fuß über die Schwelle setzen! Das ist heute so, das war schon so, lange bevor Ihr aus dem Nest gefallen seid, und das wird auch noch so sein, wenn man Euren Namen schon längst wieder vergessen hat. Also nutzt die Gunst der Stunde und nennt ihn mir, damit er wenigstens in diesem Moment von Bedeutung ist!«
Einen Moment lang herrschte Stille. Dann brummte der Besucher ein paar Worte. Vermutlich sein Name, doch Edvard konnte ihn nicht verstehen.
»Sehr gut. Es ist mir eine Freude, Eure Bekanntschaft zu machen«, fuhr George fort. »Nun, Ihr wolltet eine Frage stellen, nicht wahr?«
»Kennt Ihr Frances Veinthart?«
»Ja, in der Tat, den kenne ich. Ein junger Mann, ein Heißsporn zwar, aber ein guter Mann. Und rote Haare. Schickt er Euch?«
»Ja. Nein. Der König schickt mich. Allerdings auf den Rat von Veinthart hin.«
»Oh, der junge Heißsporn hat es zum Berater von Aldan geschafft? Das ist bemerkenswert! Wie macht er sich denn?«
»Die Krone ist auf der Suche nach Edvard Thornholm. Vermutlich in Begleitung einer jungen Dame.«
»So so«, entgegnete George. »Und was hat Veinthart damit zu tun?«
»Er ist wohl ein Freund von Thornholm. Er hat König Aldan davon überzeugt, dass es gut möglich sei, dass Thornholm und seine ... Begleiterin Eure Gastfreundschaft in Anspruch nehmen. Ist dem so?«
»Nein.« Zu schnell, dachte Edvard.
»Verstehe. Ihr habt also zur Zeit keine Gäste?«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Aber nicht Thornholm?«
»Stellt Ihr mein Wort infrage?«
»Würdet Ihr die Krone belügen, George Barsteen?«, lauerte der Besucher.
»Ihr bewegt Euch auf sehr dünnem Eis!« Es mochte Einbildung sein, doch Georges Stimme hatte etwas von ihrer Selbstsicherheit verloren.
»Ihr werdet es mir nachsehen, dass ich den Auftrag, den mir König Aldan höchstpersönlich übertrug, sehr ernst nehme. Also, habt Ihr derzeit Gäste?«
»Ja, ich habe zur Zeit Gäste.«
»Werdet Ihr mir auch die Namen der drei Herren verraten? Es sind doch drei Herren?«
»Ja«, antwortete George. »Und nein, denn ich weiß nicht, ob sie damit einverstanden sind.«
»George Barsteen, gewährt Ihr litonaischen Spionen Zuflucht unter Eurem Dach?«
»Wie kommt Ihr denn nun darauf?«
»Nun, da Ihr nicht bereit seid, mir zu sagen, wen Ihr beherbergt, muss ich wohl davon ausgehen, dass Ihr versucht, etwas vor der Krone zu verheimlichen.«
»Diese Unterstellung ist unerhört! Königlicher Auftrag oder nicht, packt Euch fort und richtet Aldan aus, dass er mir gefälligst jemanden schicken soll, der sich zu benehmen weiß!« Selbst Edvard konnte hören, dass dieser Ausbruch nur gespielt war.
Er schloss die Augen. Er wusste, was jetzt kommen würde. Sie hatten verloren.
»George Barsteen, ich gebe Euch hiermit eine letzte Chance, das Ansehen Eures Hauses wiederherzustellen«, entgegnete der andere mit gefährlich ruhiger Stimme. »Führt Thornholm und seine Begleiterin vor und übergebt sie mir, und ich werde in meinem Bericht nicht erwähnen, dass Ihr offensichtlich Teil dieses Komplotts wart.«
»Edvard und Blanche –«
»– weilen in Euren Mauern. Ich weiß. Und es wird Zeit, dass Ihr das zugebt. Euer Fußvolk war in der Hinsicht sehr auskunftsfreudig. Und ja, Blanche ist der Name der Frau, die Edvard Thornholm begleitet.«
Man brachte sie in den Burghof, in ein nicht genutztes Nebengebäude, das die Wachen in der kurzen Zeit ausfindig gemacht und als provisorisches Gefängnis vorbereitet hatten. Edvard und Blanche hatten es George erspart, sie auszuliefern. Genau genommen war es sogar Blanche gewesen, die aus ihrem Versteck hinter der Tür hervorgetreten und sich zu erkennen gegeben hatte. Edvard war keine Zeit geblieben, sie zurückzuhalten – und er war sich auch sicher, dass sie das nicht zugelassen hätte.
Der Besucher war niemand anderes als der Hauptmann der Kerkerwache; der Mann, der Blanche schon das erste Mal in Ketten gelegt hatte. Die Narbe auf seiner Wange trug er wie eine Trophäe, und die Blicke, die er Blanche zuwarf, rissen an Edvards Selbstbeherrschung. Den ganzen Weg hinab in den Burghof wartete er auf den richtigen Moment, um auf ihn loszugehen und mit Blanche das Weite suchen zu können.
Doch kaum hatten sie einen Fuß in den Hof gesetzt, sahen sie sich von einem Dutzend Wachen umzingelt. Edvard war dennoch nicht bereit gewesen, sich kampflos zu ergeben und hätte sich auf den erstbesten Mann gestürzt, wenn Blanche nicht seinen Gedanken erraten und nach seiner Hand gegriffen hätte. Das hatte zwar nicht gereicht, um ihn gänzlich von seinem Vorhaben abzubringen, überraschte ihn aber lang genug, dass sie ihn mit sich ziehen konnte.
Der Hauptmann selbst warf die Tür hinter ihnen zu, und als er sich überzeugt hatte, dass die Tür fest verriegelt war, postierte er eine Wache davor. Dann wandte er sich an den alten George, der das ganze Geschehen kreidebleich und ohne ein Wort verfolgt hatte.
»George Barsteen, Ihr habt einer Mörderin und einem Verschwörer Unterschlupf gewährt. Der König ist der Ansicht, dass Ihr nichts von der Schuld dieser beiden Verräter wusstet, weshalb er gegen Euch keine Anklage erhebt. Noch nicht.« Edvard hörte förmlich, wie er dem alten Ritter einen vielsagenden Blick zuwarf, bevor er hinzufügte: »Doch ich rate Euch, bis zu seinem Eintreffen am heutigen Abend die Burg nicht zu verlassen.«
»Ihr sagt, der König kommt hierher?«, fragte George schnippisch.
»Ja, in der Tat, so ist es. Doch macht Euch keine Umstände deswegen. Er wird Eure ... Gastfreundschaft nicht beanspruchen. Er befindet sich auf der Durchreise nach Litona, und er wird dieses kleine ... Ärgernis auf dem Weg dorthin aus dem Weg räumen.
Wenn Ihr mich nun entschuldigen wollt, meine Männer warten auf Anweisungen. Die Pferde müssen versorgt werden.« Durch einen Spalt zwischen den Türbrettern sah Edvard, wie der Hauptmann George zunickte, als wolle er ihn aus dem Weg scheuchen. Als sich der alte Ritter jedoch nicht einen Zoll weit zur Seite bewegte, trat der Hauptmann so knapp an ihm vorbei, dass unmissverständlich war, dass er ihn auch hätte umwerfen können, wenn es die Etikette nicht verbieten würde.
»Die Stallungen findet Ihr nicht weit von hier«, rief George ihm hinterher, schäumend vor Wut. »Immer der Nase nach, hoch genug sitzt sie ja.«
Kapitel 6
Der Trupp des Königs traf am Nachmittag ein. Aldan reiste nur mit seiner Leibgarde und einem guten Dutzend seiner Ritter. Frances und Wolter waren unter ihnen.
Kurz darauf holte man Edvard und Blanche und führte sie in die Halle, die man in Windeseile zu einem Gerichtssaal umfunktioniert hatte. Ein Großteil der langen Tische und Bänke war zur Seite geschoben worden, an sämtlichen Eingängen waren Wachen postiert und in der Mitte des Raumes hatte man ein kleines Podest errichtet. Auf dem Podest stand der prunkvollste Stuhl, den man in der ganzen Burg hatte auftreiben können. Vor einigen Stunden war es noch der Stuhl gewesen, in dem ein alter Ritter mit seinen Gästen beim Frühstück gesessen hatte.
Der König war als Richter der einzige, der bei der Verhandlung saß. Zu seiner Rechten stand George. Ein Bediensteter wollte ihm gerade einen Hocker bringen, doch der alte Ritter scheuchte ihn mit wütenden Gesten wieder davon. Zur Linken des Königs stand Frances, blass, in sich gekehrt und mit tiefen, rotblauen Augenringen. Er sah müde und erschöpft aus, gezeichnet wie nach einem schweren Kampf. Die anderen Ritter hatten sich zu beiden Seiten der Halle verteilt. Das schaulustige Burgvolk hielt sich eingeschüchtert und leise tuschelnd im Hintergrund.
Trotz der anwesenden Menschen wirkte die Halle kalt, leer und bedrohlich. Die Wachen führten Edvard und Blanche bis zur Hälfte des von Tür und Richterstuhl begrenzten Weges und traten dann zurück. Es war nun an Edvard und Blanche, die letzten Schritte bis zu ihrem Schicksal zu gehen.
Edvard tat dies mit erhobenem Haupt, doch ohne Trotz. Sein Blick ruhte ohne Unterlass auf Frances. Er wollte wissen, welche Rolle sein Freund hier spielte. Wenn er einen weiteren Plan hatte, wie er Blanche und ihn hier herausholen würde, so ließ er es sich nicht anmerken. Im Gegenteil, sein Blick war leer und ins Nichts gerichtet. Blanche hielt mit ihm Schritt, vermied es jedoch, sich ihm zu sehr anzunähern.
Kurz vor dem Podest knieten sie schließlich nieder. Aldan ließ sie einen Moment so verharren, dann erhob er sich.
»Blanche, Ihr seid vor Eurem Richtspruch geflohen, noch bevor wir ein Urteil über Eure Schuld am Tod unseres Neffen fällen konnten. Es fällt mir schwer, Eure Flucht nicht als Schuldeingeständnis zu verstehen«, trug er mit knappen Worten vor. »Edvard, Ihr habt sie dabei unterstützt. Und was auch immer Euch dazu gebracht hat, mögen es die Götter geben, dass Ihr eine gute Erklärung dafür habt. Hört nun, was wir Euch vorwerfen.« Sein Ton war wesentlich kälter, als er es beim ersten Mal gewesen war, als nur Blanche vor ihm gestanden hatte. Edvard schwante, dass der König sein Handeln vor allem als eine persönliche Beleidigung empfand. Das tat ihm leid, das hatte er nicht gewollt und daran hatte er bis jetzt auch noch nicht einen Gedanken verloren. Ihr Verhältnis war immer gut gewesen.
Diese Zeiten schienen nun vorbei zu sein. Das wurde Edvard schlagartig bewusst, als er ungläubig die Worte der Anklage vernahm. Die einleitenden Worte hatte er gar nicht mitbekommen, und die darauffolgenden Worte hörte er zwar, verstand sie aber nicht.
Vor seinem inneren Auge spielte sich eine Geschichte ab, deren Hauptpersonen er nicht kannte und deren Handeln ihn verstörte. Irgendwo im Hintergrund wusste er, dass man von Blanche und ihm sprach, doch in der Geschichte ging es um eine kaltblütige Mörderin, einen abtrünnigen Ritter und ihre gemeinsame Flucht. Erst täuschte die Frau mit gespielten Unschuldstränen den Rat des Königs, dann schlug der Mann vor den Stallungen seinen besten Freund nieder, nachdem dieser sich der Flucht und bösen Drohungen widersetzt hatte. Als ehemals bestem Freund des Abtrünnigen bekam der edle Ritter die Aufgabe, die Flüchtigen aufzuspüren und zurückzubringen. Beinahe wäre seine Mission von Erfolg gekrönt gewesen, denn seine Intuition sagte ihm, wo er würde suchen müssen. Doch auch nachdem er den erbitterten Widerstand des gefallenen Ritters mit Waffengewalt brach und die Geflohenen endlich in Ketten gelegt hatte, gelang es den beiden erneut, sich ihrer gerechten Strafe zu entziehen. Und so wurde der edle Ritter selbst zur Geisel, musste um sein Leben fürchten und wurde schließlich in einem Akt höhnischer Gnade im Wald zurückgelassen – ausgeraubt, zerschunden und zusammengeschlagen und mit nichts als der Hoffnung, bald gefunden zu werden. Im letzten Akt der Geschichte täuschten der Abtrünnige und die Mörderin noch einen altehrwürdigen Ritter von tadellosem Ruf, nutzten seine Gutgläubigkeit zu ihrem Vorteil und waren dabei doch zum Scheitern verdammt, denn dem wachsamen Auge der Ewigen Familie könne man nicht entrinnen.
Und so standen sie nun vor dem König, das kaltblütige Kindermädchen und der verlorene Ritter, Blanche und Edvard, Sinnbilder aller Verbrechen, die man gegen Ehre und Tugend zu vollbringen vermag.
Guten Geschichten folgt Applaus. Dieser folgte Stille.
Keine Stille, in der man ein nervöses Räuspern oder das ferne Zwitschern eines Vogels hörte, sondern Stille, die alles Leben verneinte. Bleierne, frostige Totenstille.
Edvard war speiübel. Alles um ihn herum begann sich zu drehen. Fassungslos sah er zu Frances, doch dessen leerer Blick ging weit an ihm vorbei. Blanche neben ihm starrte zu Boden. Edvard sah, dass sie zitterte. Sein Blick schnellte nun zu George, der kaum sichtbar den Kopf schüttelte. In den Augen des alten Ritters lag ein Ausdruck, der Edvard unmissverständlich klarmachte, dass George weiterhin zu ihm hielt, und nicht der Anklage Glauben schenkte. Doch damit stand er trotzdem allein da; um sich herum sah Edvard nur in verachtende, verständnislose Gesichter. Er spürte, wie die Hoffnung auf einen Geniestreich von Frances und ein gutes Ende für sie mit jedem Herzschlag weiter schwand.
Sie waren allein.
Edvard rang um Fassung und wollte etwas sagen; ein Widerspruch, eine Erklärung, eine Klarstellung, irgendetwas – Hauptsache, diese dunkle Wolke aus Lügen und Halbwahrheiten wurde aus der Halle getrieben. Doch seine Zunge war taub. Ein nutzloser, schwerer Lappen zwischen zwei Reihen Zähnen, die sich durch unmenschlichen Druck ineinander verkeilt zu haben schienen. Hilflos musste er diesen Albtraum weiter über sich ergehen lassen.
»Wir beschuldigen die Angeklagte des Mordes an einem unschuldigen Kind sowie der Flucht vor dem Gesetz. Edvard Thornholm beschuldigen wir des Eidbruchs gegenüber der Krone, Untreue gegenüber des ritterlichen Ehrenkodexes sowie des Überfalls auf Ritter des Reiches und Flucht vor dem Gesetz und seinen Vertretern. Beide Angeklagten sind als Hochverräter zu verurteilen.«
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752144079
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (Mai)
- Schlagworte
- Indie Freundschaft Abenteuer Verrat Fantasy Spannung Geschichten Liebe Mittelalter Ritter Roman