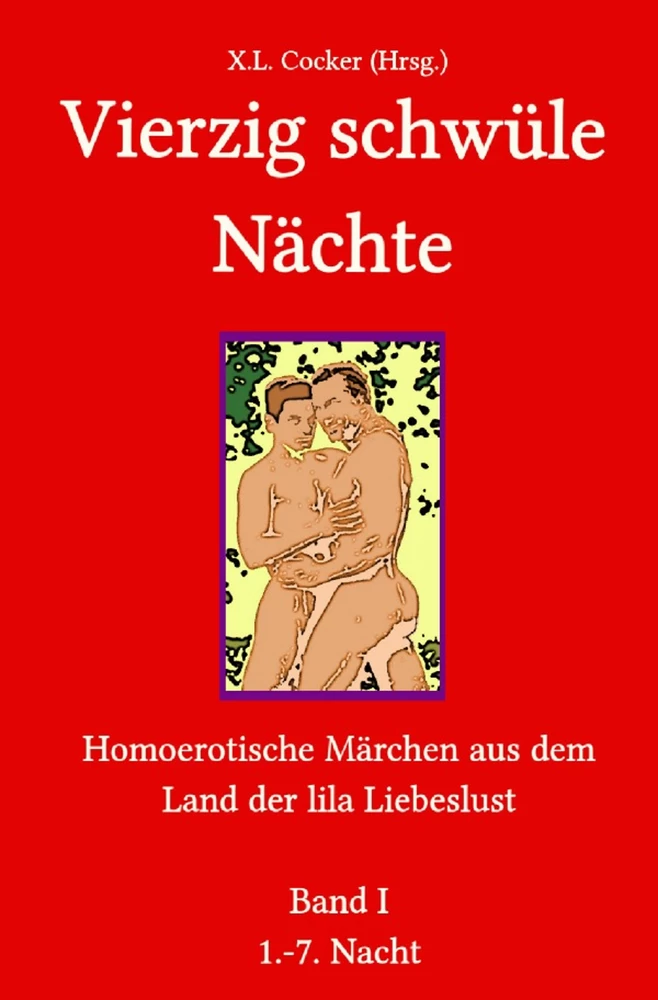Vorwort des Herausgebers
Werte Leser*Innen,
vorliegende Sammlung schwuler Märchen gelangte nur zufällig und über mysteriöse Umwege in den Besitz des wissenschaftlichen Instituts für homoerotische Literatur- und Kulturforschung. Als mein Kollege, der renommierte Dr. C. Harness, ein Ferienhaus für sich und seinen Lebensgefährten suchte, fand er inmitten eines Wäldchens ein baufälliges Anwesen, das zum Verkauf stand. Nachdem er es erworben hatte, kam es zu diversen Umbauten und ausgerechnet in einer der Wände, die eingerissen wurden, fand man das handschriftliche Manuskript. Über dessen Zustandekommen werden Sie, liebe Leser*Innen, in der Einführung des anonymen Verfassers alles erfahren, was wir wissen – mehr Informationen liegen uns nicht vor. Weder konnte der vorherige Besitzer des Anwesens ermittelt werden, noch haben Handschrift- und Papieranalysen zu einem befriedigenden Resultat geführt, was die Datierung des Fundes angeht.
Im Manuskript werden mehrere Namen genannt, die angeblich bei der Genese des Textes beteiligt waren. Die Recherche nach diesen Menschen verlief bisher ergebnislos; zwar existieren amtliche Akten und Eintragungen zu einigen der Genannten, aber es gibt keinerlei Beweise, ob es sich wirklich um diejenigen handelt, die im Manuskript genannt werden. Sie kennen das sicherlich: Es kommt öfter vor, als einem lieb ist, dass zwei unterschiedliche Personen denselben Namen tragen. Hinzu kommt, dass es sich bei den Bezeichnungen im Manuskript auch um Decknamen oder Pseudonyme handeln könnte. Die Ermittlungen dauern an.
Wie dem auch sei, Dr. Harness und ich haben stellvertretend für das Institut für homoerotische Literatur- und Kulturforschung entschieden, das Manuskript einem breiten Lesepublikum zugänglich zu machen. Dank gilt hier insbesondere Gerd Neek, einer wissenschaftlichen Hilfskraft. Er hat sich nächtelang mit der Entzifferung der Handschrift (Teile davon waren sogar stenografiert) beschäftigt und uns die Digitalisierung des Textes damit erheblich erleichtert.
Das Manuskript umfasst über tausend Heftseiten und ist z.T. mit Bleistift, z.T. mit Kugelschreiber verfasst worden. Es kann nicht als Gesamtwerk in einem Band erscheinen, weil es schlichtweg zu umfassend ist. Der Lesefreundlichkeit wegen hat uns der YEOJ-Verlag geraten, den Stoff in mehrere Bände zu gliedern; da die Veröffentlichung nachträglich bebildert werden sollte (das Original sieht keine Illustrationen vor), schien dieser Rat auch uns sinnvoll.
Als Titel hat der anonyme Autor »Kerle- und Herrenmärchen« vorgesehen. Dr. Harness und ich haben nach mehrmaligem Überlegen entschieden, von dieser etwas sperrigen Textüberschrift (die nicht mehr als ein Arbeitstitel des Projekts gewesen sein kann) abzuweichen und im Hinblick auf das fertige Gesamtwerk »Vierzig schwüle Nächte« als die bessere Variante anzusehen. Wir hoffen, dass die Leserschaft beipflichten wird.
Eine letzte Bitte: Wenn Sie es nicht schon ohnehin gemerkt haben sollte, so seien Sie an dieser Stelle gewarnt und lassen dieses Buch und seine Nachfolgebände bitte nicht in die Hände von Kindern fallen. Obwohl von »Märchen« die Rede ist, war das Manuskript von Anfang an für ein erwachsenes, vornehmlich männliches Publikum gedacht.
Nun wünsche ich Ihnen aber viel Spaß beim Lesen!
X.L. Cocker
Professor für homoerotische Kulturgeschichte
Einführung und erste Nacht
Es ist eine schlechte Zeit für uns angebrochen, eine erheblich schlechte. Der Meinung ist auch Giovanni, einer meiner besten und ältesten Freunde. Unlängst hat er zu mir gesagt:
»Es sah die letzten Jahre so gut aus! Wir haben mehr Rechte bekommen, müssen uns nicht mehr verstecken. Wir sind in letzter Zeit in den Medien nicht nur akzeptiert worden, sondern werden wie gewöhnliche Menschen wahrgenommen. Und nun das!«
Was er mit »das« meint, lässt sich schwer in Worte fassen. Plötzlich finden wieder Anfeindungen und Schulzuweisungen statt. Einzelnen Etablissements ist es gestattet, uns auszugrenzen. Als »individuelle Lesermeinung« getarnt, veröffentlichen Zeitungen diskriminierende Äußerungen. Und keiner von uns kann den Finger auf eine bestimmte Ursache legen.
»Sind es die Politiker?«, fragt mich Giovanni. »Ist es eine extreme Gruppierung, die die Gesellschaft unterwandert? Oder gibt es eine neue Geschlechtskrankheit, vor der sich jedermann fürchtet und für die man einen Buhmann braucht?«
Er weiß es nicht und ich ebenso wenig. Mir scheint, es ist eine Mischung aus allem, was Giovanni nennt. Andere Bekannte hingegen meinen, wir als Schwule seien zu schnell vorgeprescht, zu weit gegangen. Was das Einfordern der Rechte sowie der Teilhabe am Alltagsleben angeht, hätten wir bescheidener auftreten sollen – sagen sogar Stimmen aus unserem eigenen Lager.
»Unser eigenes Lager«, klagt Giovanni. »Das klingt erstens, als seien wir im Krieg, und zweitens ist unsere schwule Lebenswelt zu vielfältig, als dass ein gemeinschaftliches Lager möglich ist.«
Ich wage die Äußerung, dass in seinen Worten die Antwort liegen könnte: Vielfältigkeit entzweit Gemeinschaft.
»Interessante These«, schmunzelt Giovanni. »Hilft uns aber konkret nicht weiter.«
Das stimmt. Soziologische Erklärungsmuster helfen uns nicht aus der Not. Die Stimmung wirkt aggressiv und es ist nicht klar, wann die verbale Gewalt in physische umschlagen wird.
»Die Facta und Realia lassen sich nicht schönreden«, sagt Giovanni. »Ich schlage deshalb vor: Wir müssen uns zurückziehen und hoffen, dass der Sturm sich bald legt. Wenn unsere Gesichter eine Zeitlang von der Bildfläche verschwinden, wird den Leuten eventuell bewusst, was sie Gutes an uns hatten. Oder sie merken wenigstens, dass ihre Probleme nicht aufhören, nur weil sie uns Schwule verjagt haben.«
Ich frage nach dem Wie und Wohin. Giovanni verrät mir, dass er in einem Wald ein Grundstück besitzt, das seit Jahren leer steht. Der Zugang sei vernachlässigt worden und mit dem Auto komme man durch das Dickicht kaum durch. Dort stehe ein Haus, das von außen wie eine Ruine wirke.
»Innen drin habe ich es aber herrichten lassen. Die Keller sind voller Konserven und Trinkwasser gibt es auch. Die Heizung ist zwar abgestellt, aber bei diesem heißen Sommer brauchen wir sie nicht. Die Fenster nach vorn sind beschlagen und zugenagelt, sodass kein Licht nach außen dringt.«
»Klingt, als würde dein Versteck nur wenig besser sein als der Knast«, witzele ich.
»Denkste!«, kichert Giovanni. »Nach hinten raus hat das Haus einen Garten, der mit hohen Mauern umgeben ist. Streift man außen entlang durch den Wald, glaubt man nicht, dass dahinter jemand wäre, und dort können wir es uns gut gehen lassen.«
Ich wende ein, dass für den Wald ein Förster oder ein Amt zuständig ist und man uns früher oder später finden würde. Giovanni winkt ab. Einen Förster gebe es zwar, aber der stünde auf unserer Seite. Solange wir uns ruhig verhielten, würden wir niemandem auffallen.
»Es ist keine gute Pilz- oder Jagdgegend«, beruhigt er mich.
Damit ist es entschieden – wir werden der Stadt den Rücken kehren und uns in seinem Waldhäuschen verbergen, als ob wir vor der Pest fliehen müssten.
»Wie viele Leute kannst du unterbringen?«, frage ich. »Es gibt da jemanden, den ich gern mitbrächte.«
Ich erzähle ihm von Margarete, einer Drag Queen der alten Schule. Viel Humor, viel Tand. Aber unter der schrillen Diva befindet sich ein verängstigter älterer Herr ohne viele Freunde, der momentan nicht weiß, wohin mit sich. Giovanni stellt fest, dass er Margarete gut kennt und sie/ihn gern mit aufnehmen möchte.
»Auch ich werde noch eine weitere Person einweihen«, sagt er. »In Zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten. Vier Leute passen ohne Weiteres ins Haus.«
Als wir wenige Tage später nachts durch den Wald wandern (langsam, leise und ohne Licht), ist unsere Zahl allerdings von vier auf sieben Personen angewachsen. Mundpropaganda hat trotz aller Verschwiegenheitsschwüre dazu geführt, dass sich weitere Betroffene unserer Gruppe anschließen wollen. Giovanni ist kein guter Nein-Sager und hat sie alle aufgenommen. Auf dem dornigen Weg zum Versteck zerkratzen wir uns Ärmel und Hosen, aber keiner meckert. Nicht mal Margarete. Das gibt Hoffnung, dass in unserer Truppe kein Stressmacher steckt.
Erst unmittelbar vor dem Haus trauen wir uns, die Taschenlampen einzuschalten. »Giovanni Fortini« steht an der Haustür, aber der Besitzer reißt das Schild schnell ab.
»Muss ja keiner lesen, der hier vorbeikommt«, sagt er. »Das umliegende Buschwerk ist sehr dicht. Unsere Lichtstrahlen dürften kaum durchdringen.«
»Sicher?«, frage ich.
»Vor zwei Nächten ausprobiert«, erwidert Giovanni.
Er dreht den Schlüssel herum und lässt uns ins Haus. Nur zögerlich gehen wir über die Schwelle, weil selbst bei der spärlichen Beleuchtung alles recht baufällig wirkt. Drinnen beruhigen wir uns, denn Wände, Decke und Boden wirken stabil und die Räume riechen angenehm. Ich habe mit muffigem Schimmelgestank gerechnet.
Giovanni verschließt hinter uns die Tür und sagt:
»Stellt eure Rucksäcke und Taschen erst einmal hier ab. Wenn die Sonne aufgeht, können wir die Zimmer einteilen und ich zeige euch Bad, Küche, Keller und Garten. Jetzt stellen wir uns erstmal gegenseitig vor, ja?«
Er macht den Anfang, obwohl die meisten von uns ihn kennen. Dann ist Margarete dran. Der Rest unserer Truppe besteht aus den folgenden Personen:
Charles, ein fröhlicher Kerl Mitte Dreißig (wir sollen ihn bitte »Charlie« nennen); Max, ein schüchterner Mittvierziger; Arne, der jüngste von uns – gerade einmal 21! Dann ist da Basil, ein temperamentvoller, junger Typ mit Nasenring, Tattoo und bunten Haaren, sowie Wilko, sein Gegenteil: Graue Schläfen, Hemd und Anzug, prinzipiell eine akkurate, ernsthafte Erscheinung.
Ich, der diese Zeilen zu Papier bringt, befinde mich unter den Genannten. Mehr will ich aus persönlichen Gründen nicht verraten und es tut in der momentanen Situation auch nichts zur Sache. Es reicht zu sagen, dass ich nicht Max bin, denn dessen Anwesenheit überrascht mich. Ich kenne ich flüchtig. Er ist bi, hat das aber lange vor sich und der Welt verheimlicht. Seit Kurzem lebt er von Frau und Kindern getrennt und gehört zu jenen schüchternen Männern, um die sich Giovanni liebevoll kümmert. Sogenannte »Neulinge« in die schwule Lebenswelt einzuführen – und das meine ich nicht sexuell – ist nämlich Giovannis Spezialität.
Wir plaudern Belangloses, bis der Tag anbricht. Im oberen Stockwerk gibt es drei Zimmer, von denen Giovanni eines Margarete zuweist. Das zweite Zimmer erhält Wilko, das dritte teilen sich Max und Charles.
»Keine Sorge, ihr werdet kaum Zeit miteinander im gleichen Raum verbringen müssen«, sagt Giovanni, »außer natürlich, ihr legt es darauf an. Einer von uns sieben muss nachts aufbleiben und oben im Türmchen Wache halten, ob sich Feinde nähern.«
»Wache halten?«
»Türmchen?«
»Feinde?«
Wir sind verwundert und ich denke, es ist eben doch ein bisschen wie im Krieg. Tatsächlich verfügt das Haus über ein kleines Türmchen, aus dem man durch vier Fenster in alle Himmelsrichtungen schauen kann.
»Sollte die Aggression in der Stadt zunehmen und sich ein Mob bilden, ist es durchaus denkbar, dass man sich an mein hiesiges Domizil erinnert und sich an die Verfolgung macht«, meint Giovanni. »Darum müssen wir Wachtposten einteilen, um rechtzeitig gewarnt zu sein.«
»Was machen wir denn in so einem Fall?«, fragt Arne und sein Jungengesicht wirkt besorgt.
»Wir ziehen uns in den Keller zurück«, antwortet Giovanni. »Der ist sehr sicher. Schalldicht, abschließbar und so weiter. Es gibt angeblich sogar einen Geheimtunnel von dort nach draußen in den Wald. Vielleicht findet ihn jemand von uns, solange wir uns hier aufhalten.«
Er wirkt gelassen und gut gelaunt, was von den anderen nicht zu sagen ist. Max, Charles, Margarete und Wilko beziehen ihre Zimmer. Nicht jeder von ihnen hat in der Kürze der Zeit ausreichend Wäsche einpacken können (beunruhigende Nachrichten hatten uns alle zu einer etwas abrupten Flucht aus der Stadt veranlasst) und es wird schnell ausgemacht, sich gegenseitig auszuhelfen.
»Im Garten ist ein Brunnen, da können wir zur Not die Kleider waschen«, sagt Giovanni und führt Basil und Arne zum Dachboden. »Ihr seid noch jung und fit, ihr könnt doch hier oben schlafen?«
Die beiden sind einverstanden.
»Aber wohin mit dir?«, frage ich Giovanni.
Der Hausbesitzer lächelt und sagt, er mache es sich im Erdgeschoss zwischen Flur und Küche bequem.
»Und wenn es warm wird, auch auf der Terrasse«, fügt er hinzu.
Giovanni hat in dem Moment nicht geahnt, welch wahre Worte er da spricht – es wird wirklich sehr warm. Die sommerlichen Temperaturen steigen im Laufe des Tages sprunghaft an. Nachdem sich jeder eingerichtet hat, finden wir uns alle mehr oder weniger leicht bekleidet im Garten wieder und dösen vor uns hin. Die aufregende Nacht hatte uns den Schlaf geraubt und wir holen etwas davon nach.
Giovanni hat nicht gelogen: Die Mauern rund um uns sind wirklich hoch und geben ein Gefühl von Schutz und Abgeschiedenheit. Neben einem kleinen Brunnen gibt es im Garten eine wilde Wiese, einen leicht eingefallenen Pavillon sowie kleine Beete, wo Erdbeeren, Radieschen, Zucchini und Tomaten wachsen. Auf der Terrasse stehen ein langer Tisch und ringsum ein paar Stühle und eine Sitzbank. In einem Schuppen, der sich an der äußersten Ecke des Grundstücks befindet, lagern Gartengeräte und eine alte Hollywoodschaukel.
»Ich kann die Schaukel und den Pavillon reparieren, wenn du willst«, bietet Basil an.
Max erklärt sich bereit, ihm dabei zu helfen.
»Und ich kümmere mich um den Garten«, sagt Margarete. »Ich habe den passenden Hut dafür und aus einem alten Fetzen kann ich leicht eine Schürze machen.«
Der alte Fetzen ist in Wahrheit ein ausgedienter, paillettenbestickter Rüschenrock. Mich amüsiert es, dass Margarete sogar ihren Nähkasten mitgebracht hat. Gerade sitzt sie auf einem Stuhl und liest.
»Bücher hast du auch dabei?«, frage ich. »Clever! Wenn wir länger hier eingesperrt sind, braucht man Ablenkung. Einen Fernseher gibt es nicht und das Kofferradio muss der Batterie wegen geschont werden.«
»Ist nicht meins«, sagt Margarete. »Das Buch hat Arne oben im Dachboden gefunden, als er sein Zeug ablud. Da liegen wohl einige Kinderbücher herum.«
Sie hält es hoch, sodass ich den Titel lesen kann.
»Kinder- und Hausmärchen«, erkenne ich. »Wusste gar nicht, dass Giovanni sowas besitzt.«
Tut er auch nicht, wie es sich herausstellt. Auf den Bücherfund angesprochen, gibt er zu, dass die noch vom Vorbesitzer stammen, der beim Auszug einige Dinge im Speicher liegenließ.
Später, als Charles und Margarete das Abendbrot zubereiten und immer wieder von der schönen Küche schwärmen (sie ist tatsächlich das besterhaltene Zimmer des Hauses und sowohl praktisch wie gemütlich), kommt der Rest unserer Truppe wieder auf das Märchenbuch zu sprechen. Wir sitzen auf der Terrasse und decken den Tisch, während das Buch herumgereicht wird und jeder darin blättert.
»Keiner von uns hat an Bücher gedacht«, sagt Wilko. »Solche Geschichten bieten Ablenkung und Zerstreuung. Ein Glück, dass Arne sie gefunden hat.«
»Ich bin weniger begeistert«, sagt Max. »Ich lese nicht gern. Hörbücher, das wäre was!«
»Außerdem kennt man die meisten Märchen ja«, fügt Basil hinzu. »Sie sind kindlich, spießig und heteronormativ. Von sowas will ich mich nicht ablenken lassen!«
Während wir das schmackhafte Essen genießen, das uns Margarete und Charles zubereitet haben, stellen wir fest, wie anhaltend warm es ist.
»Unsere erste Nacht in unserem Hort wird recht schwül«, warnt Giovanni. »Ehe das Haus die gespeicherte Hitze abgegeben hat und ihr nicht mehr an den Laken klebt, wird es eine Weile dauern. Bestimmt bis Mitternacht.«
»Was machen wir solange?«, fragt Arne.
Giovanni schlägt vor, beim Thema Märchen zu bleiben. Jeder soll in dem Buch blättern und sich eines herauspicken, dass er möglichst schwul nacherzählt.
»Möglichst schwul?«, wiederholt Charles und scherzt: »Wohl ganz nasal und wild gestikulierend?«
»Nein«, lacht Giovanni. »Die Handlung soll umgedeutet werden. Der Held umwirbt keine Prinzessin, sondern einen Prinzen! Weg von der Heteronorm, ganz nach Basils Geschmack.«
Er zwinkert Basil zu und der grinst:
»Dann bitte auch weg mit der Spießigkeit! Es darf ruhig mehr als bloß ein kitschiger Kuss vorkommen. Zur Sache soll es gehen!«
»Aber die Wache im Türmchen«, wirft Arne ein.
Giovanni bleibt gelassen.
»Bis die Sonne untergeht, brauchen wir keinen Wachtposten. Sobald ein Mensch in der Nähe spaziert, wird der Eichelhäher rufen – der ist die Alarmanlage des Waldes und nistet nicht weit von hier. Den ganzen Tag lausche ich schon, ob er schreit.«
Arne ist beeindruckt. Trotzdem kann er sich nicht vorstellen, wie das Märchenerzählen vor sich gehen soll.
»Dann will ich den Anfang machen«, sagt Giovanni, »und gleich das erste Märchen erzählen.«
»Und ich übernehme das zweite«, ruft Basil dazwischen.
»Aber bitte nicht so primitiv, als ob es eine Story für einschlägige Pornoseiten wäre«, bittet Margarete. »Ein bisschen stilvoll darf es bleiben.«
»Gut«, sagt Giovanni. »Dann lasst mich euch willkommen heißen in unserer Erzählrunde. Es war einmal ein großes Reich, welches man das Land der lila Liebeslust nannte. Dort lebte es sich schier märchenhaft. Wunderschöne Schlösser und altehrwürdige Burgen schmückten Berg und Hügel. Breite Straßen führten durch idyllische Dörfchen und stolze Städte. Dichte Wälder boten den Tieren Schutz vor den Jägern und dem Wandersmanne Flucht vor dem Alltagstrott. Grüne Wiesen und mit Wildblumen übersäte Heiden luden zum Spielen und Tummeln ein.
Das schönste aber am Land der lila Liebeslust war, dass dort ein jeder den Menschen lieben durfte, für den sein Herz schlug. Nicht nur Knabe und Mägdelein konnten einander freien, wie überall sonst üblich; nein, ein Bursche durfte ebenso einen anderen Burschen ehelichen, eine Maid um eine andere Maid buhlen. Daher war es keine Seltenheit in jenem Reich, wenn ein Königssohn das Herz des Prinzen aus dem Nachbarland eroberte oder ein Graf nach dem Gliede seines Lakaien gierte.
Weil nun die Menschen im Lande der lila Liebeslust genau wussten, wie gut die Erfüllung fleischlichen Verlangens der Seele tat, nahm auch keiner Anstoß am wollüstigen Wandersmann, der am Waldesrand dem Jäger über die Wade strich, oder am Ritter, der auf seiner Burg fröhlich mit seinem Knappen im Bette raufte. Von solcherlei Begebenheiten wollen die folgenden Märchen erzählen – mal sinnlich und sehnsüchtig, mal frech und fidel, jedoch alle angehäuft mit liebenden lila Lüstlingen.«
Seine Augen glänzen, seine Stimme fesselt uns, die gewählte Ausdrucksweise macht neugierig. Der Märchenabend beginnt!
Der Froschfreier und der eiserne Heinrich
In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat und ein jeder Mann stattlich von Gestalt und edel von Sinnen war, lebte eine Königin, deren Kinder waren alle schön. Ihre zwei Töchter hatten langes, wallendes Haar, entzückende Gesichter mit liebreizenden Äuglein und schlanke, zarte Arme. Ihr Sohn, das jüngste ihrer Kinder, war aber noch schöner als sie. Rot wie aufblühende Sommerrosen waren seine Wängelein, seine Augen leuchteten so blau wie Vergissmeinnicht und sein gelocktes Haar schien so hell, dass selbst die Sonne sich verwundern musste, so oft sie ihre Strahlen darin spielen ließ. Die drei Königskinder wuchsen sorglos und in tiefer, geschwisterlicher Liebe zueinander auf und teilten alles Spielzeug und alle Freude, die ihnen im Schlosse ihrer Mutter zur Verfügung stand.
Nahe bei dem Schlosse lag ein dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen. Wenn nun der Tag recht heiß war, lief der Königssohn hinaus und spielte dort allein, denn seine Schwestern waren zu ängstlich, um sich so weit fort von den sicheren Mauern zu entfernen. Manchmal setzte er sich an den Rand des Brunnens und ließ auf dem Wasser ein Schiffchen fahren. Ein andermal badete er seine Füße darin. In jüngster Zeit aber, als er bereits zu einem schönen Jüngling herangewachsen war, rannte er hastig um den Brunnen herum, kletterte mal hinauf und mal hinab und wusste selbst nicht, womit er die Stunden füllen sollte. Die alten Spiele erschienen ihm langweilig und in seiner Brust wuchs ein Sehnen nach neuem Zeitvertreib.
Nun trug es sich zu, dass er einmal seinen Schwestern beim Spiel mit ihren Püppchen zusah. Sie kleideten ihre Porzellanprinzessinnen an und aus, ließen sie in winzigen Kutschen hin- und herfahren oder auf Spielzeugpferdchen reiten. Da sah er abseits eine Puppe liegen, die ihm wohl gefiel. Es war eine Prinzenfigur mit strahlendem Gesicht und dunklem Haar, ausstaffiert mit Spielzeugsäbel und gekleidet in ein fein gearbeitetes Gewand. Die Pluderhose glänzte von Gold, der Gansbauch war purpurrot und der Duttenkragen von reinstem Weiß. Der Königssohn nahm diese Puppe heimlich an sich, er wusste nicht warum, und lief damit zu dem Brunnen. In einem letzten Anflug von Kinderspiel setzte er die Figur auf den Brunnenrand, verneigte sich vor ihr und stellte sich vor und tat alles in allem so, als säße ein echter Prinz vor ihm, mit dem er ein Hofgespräch führen würde. Dem Königssohn gefiel es, nicht in Gesellschaft seiner Schwestern, sondern in der eines Jünglings zu sein, und er nahm das Püppchen in die Hand, warf es hinauf in die Luft und fing es wieder auf. Er behielt das Prinzchen und es wurde ihm sein liebstes Spielzeug, wenngleich er niemandem etwas davon verriet.
Eines Tages wusste er nichts mehr, was er dem Püppchen anvertrauen konnte, da fiel ihm ein:
»Ich möchte doch mal die Tanzschritte üben, die der Zeremonienmeister mir beigebracht hat, und will dabei so stolz und herrlich aussehen wie die Prinzenpuppe.«
Also tanzte er anmutig um den Brunnen herum und bald tanzte er gar mit dem Püppchen in der Hand. Und wie er sich vorstellte, er würde auf einem Ball mit einem echten Prinzen tanzen, klopfte ihm das Herz wilde und er wurde kühn und küsste das Püppchen auf den Mund. Zwar gefiel ihm das Spiel, aber zugleich wurde ihm der Kopf rot und er schämte sich dieser Albernheit. Obschon niemand ihn bei seinem Kuss gesehen hatte, ließ ihn die Scham aufbrausen und der Königssohn stieß die Puppe zornig von sich, indem er rief:
»Weiche von mir, solch Betragen ziemt sich nicht für meinesgleichen!«
Die Prinzenpuppe fiel jedoch nicht auf die Erde, sondern geradewegs ins Wasser des Brunnens hinein. Der Königssohn folgte ihr mit den Augen nach, aber die Puppe verschwand, und der Brunnen war so tief, dass man keinen Grund erkennen konnte.
»Ach je«, seufzte der Königssohn, »nun habe ich das Prinzchen in die Untiefe gestoßen und niemand vermag es zu retten!«
Seine Scham wandelte sich in Betrübnis und trotz seines Alters – ohne Weiteres hätte er den Thron besteigen können, sollte ein Trauerfall im Königsschloss ihn dazu veranlassen – begann er zu weinen. Der Tanz mit Prinzen, die Sehnsucht nach einem Kuss, die hitzige Abwehr und der Verlust seines Spielzeugs brachten seine Sinne durcheinander und verengten ihm das junge Herz. Er schluchzte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Wie der Königssohn klagte und jammerte und nicht wusste, wie er damit aufhören sollte, da rief ihm eine tiefe Stimme freundlich zu:
»Was hast du, liebster Königssohn? Du weinst ja, dass sich ein Stein erbarmen möge.«
Er sah um sich, woher die Stimme käme, da erblickte er an dem Brunnen eine Gestalt, wie sie ihm noch nie zuvor begegnet war. Es war ein Mann, dessen Haut im Sonnenlicht ganz grün schimmerte. Langes, wirres Haar hing ihm vom Haupt und reichte bis zum Boden, das meiste seines Leibes verdeckend. Zwischen den Fußzehen und den Fingern hatte er grüne Häutchen und sein Kopf mit den großen Augen und dem breiten Mund war eher der eines Frosches als eines Menschen.
»Was bist du?«, fragte der Königssohn. »Grün glänzt du, tief quakt deine Stimme und viele dunkle Wassergräser finden sich in deinem Haar. Ein Krötengespenst? Ein Unkendämon?«
Der Froschmann aber lachte nur und erwiderte mit tiefer Stimme:
»Ich bin der Bewohner dieses Brunnens, wo du so gerne spielst. Ich habe dich heranwachsen sehen von einem Kinde zu einem schönen Jüngling, und ein schöner Jüngling darf doch nicht weinen. Was ist geschehen?«
Der Königssohn, obgleich die lieben Worte von einem Ungetüm stammten, fühlte sich geschmeichelt und fasste Vertrauen zu dem Fremden. Er erzählte von dem Püppchen und war nicht gering erfreut, als der Froschmann sprach:
»Ich kann wohl Rat schaffen und dir dein Prinzchen wieder heraufholen. Doch versprichst du mir, hernach mit mir ein neues Spiel zu spielen?«
Der Königssohn willigte bedenkenlos ein und hätte dem Froschmann wohl noch Edelsteine, Perlen oder seine goldene Krone versprochen, wenn nur seine Schwestern davor bewahrt blieben, vom Verbleib ihrer Puppe zu erfahren. Der Froschmann, nachdem er die Zusage erhalten hatte, hockte sich an den Brunnenrand und sprang ins Wasser. Über ein Weilchen kam er wieder heraufgerudert, hatte die Puppe in den Händen und reichte sie dem Königssohn. Dieser nahm sie dankbar an und dabei berührten seine zarten Finger die kalten Glieder des Froschmanns.
»Glitschig fühlst du dich an, Wasserpatscher«, entfuhr es dem Königssohn, doch er meinte das nicht böse.
Der Froschmann erwiderte:
»Zart fühlst du dich an, schöner Jüngling.«
Und er lächelte, jedenfalls glaubte das der Königssohn, weil sein Maul breiter und breiter wurde.
»Deine Prinzenpuppe hast du zurück, doch wüsste ich bessere Spiele für dich als sie hinauf in die Höhe zu werfen und sie wieder aufzufangen.«
»Ein schöneres Spiel? Was denn für eines?«, fragte der Königssohn.
»Komm ein bisschen näher zu mir an den Brunnenrand, ich will dir’s schon zeigen.«
»Nun sag schon!«
»Nur wenn du ganz nah zu mir kommst.«
»Etwa so?«
»Ja, genau so.«
Da standen sie nun ganz nahe beieinander, der Froschmann über den Brunnenrand gelehnt und sein frischer Duft von klarem Wasser und grünem, feuchten Moos drang dem Königssohn in die Nase.
»Und nun?«
»Nun nehme ich dich in die Hand.«
Und der Froschmann griff sacht an die Pluderhose, öffnete einen Knopf und einen zweiten und der Königssohn fühlte die nassen, kühlen Schwimmfinger auf seiner nackten Haut. Er wollte zunächst zurückweichen, blieb aber letztlich stehen.
»Gib dich mir ganz in meine Hand«, bat der Froschmann.
»Ich trau mich nicht«, stotterte der Königssohn. »Du bist so glibberig, so schleimig, so feucht!«
»Ja, das bin ich. Und nun bist du auch ein bisschen glibberig und schleimig und feucht, nicht wahr?«
Der Königssohn nickte, denn die Schwimmfinger waren derart abenteuerlich, dass es ihm die Stimme nahm.
»Nun spiele ich mit dir«, quakte der Froschmann.
»Wie? Etwa so?«, hauchte der Königssohn.
»Ja, genau so.«
Und der Froschmann spielte am Königssohn, der ihn gern gewähren ließ und verzückt war von diesem neuen Spiel, das seine Sinne auf völlig neue Weise betörte. Am Ende war der Jüngling viel glibberiger und schleimiger und feuchter als der Froschmann, aber er störte sich nicht daran und sprach:
»Das war schön! Tu das noch einmal!«
»Wir wollen dieses Spiel morgen wiederholen«, entgegnete der Froschmann. »Du kommst an meinen Brunnen und ich greife mit meinen glitschigen, kühlen Fingern zu, bis es nass wird auf deiner nackten Haut. Doch will ich mit dir speisen!«
Begierig, das Spiel noch einmal erleben zu dürfen, erklärte sich der Königssohn damit einverstanden, nahm seine Prinzenpuppe und sagte dem Froschmann artig »Auf Wiedersehen«. Der kletterte zurück ins Brunnenwasser und mit einem neuen, fröhlichen Schlagen in der Brust kehrte der Königssohn zum Schlosse zurück. Dort trocknete er das Püppchen, legte es ins Spielzimmer seiner Schwestern und ging zu Bett.
Aber ach! Wie unstet ist der Sinn eines heranwachsenden Jünglings und wie wechselhaft sein Gemüt. Des Morgens erwachte der Königssohn mit übler Laune. Unfreundlich sprach er mit den Dienern, die Gesellschaft der Schwestern mied er und argwöhnisch schaute er aus den Schlossfenstern gen Wald. Sollte er wirklich zum Brunnen gehen und sich auf einen Froschmann einlassen, der so anders war als die feinen Herren, anders auch als das Porzellanprinzchen? Das Spiel hatte ihm, dem Königssohn, zwar Freude bereitet, aber er zweifelte an der Würde solchen Benehmens.
»Nein, ich werde jenen Wasserpatscher nicht besuchen und den Brunnen fortan meiden«, versprach er sich fest. »Jenes Erlebnis bleibt besser einmalig!«
Doch kaum hatte er diesen Schwur ausgesprochen, drang es von ferne an sein Ohr:
»Königssohn, o jüngster,
such mich auf!
Weißt du nicht, wie dir gefiel
am Brunnen unser schönes Spiel?«
Die tiefe, quakende Stimme erkannte er sofort und ein Schauder ergriff ihn. Er brauchte nicht erst an sich herabzublicken, denn er spürte schnell, wie heftig sein Leib sich veränderte. Er setzte sich und all die herrlichen Gefühle des Vortages kamen ihm in Erinnerung. Schön war es am Brunnen gewesen, verwirrend und reizvoll, sich in die Hände eines fremden, grünlichen Wesens zu geben. Schon wollte der Königssohn versuchen, mit seinen eigenen zarten Fingern die Knöpfe zu lösen und auf seiner nackten Haut spielen zu lassen, als seine Mutter das Gemach betrat, sich ihres Sohnes zu erkundigen.
»Was ist mit dir los, mein lieber Heinrich?«, klagte sie. »Du ziehst dich zurück, meidest deine Schwestern und sitzest auf deinem Bett wie angenagelt! Du wirst ja ganz rot, mein lieber Heinrich.«
Die gute Königin wusste ja nicht um den Zustand ihres Sohnes und dass es ihm schlicht nicht möglich war aufzustehen, ohne sich bloßzustellen. Sie fühlte seine Stirn mit der Hand, gab ihm einen mütterlichen Kuss auf die Wange und ermutigte ihn, die Laune zu bessern, denn am Abend sollte es seine Lieblingsspeise geben. Sobald sie aber sein Gemach verlassen hatte, schimpfte der Königssohn über sich selbst und auch über den Froschmann, denn es ärgerte ihn fürchterlich, dass allein der Gedanke an den Vortag seinen Leib derart willenlos werden ließ. Er bedachte sich eine Zeit und glaubte schließlich, eine Lösung für seinen peinlichen Zustand zu haben. Er lief in den Schlosskeller zu den Handwerkern, suchte den Schmied auf und sprach:
»Fertige mir ein eisernes Band an und lege es um die Wurzel meines Schaftes, auf dass er sich nicht mehr gegen meinen Willen regen kann!«
Seine zarten Finger knöpften die Pluderhose auf, die rauen Finger des Schmiedes nahmen Maß und bereits am selben Abend trug der Königssohn ein schweres eisernes Band um seinen Schaft, das selbigen schlaff hielt. Zwar drückte es und zwickte ihn, aber er wollte das gern ertragen, wenn er dafür nur nicht mehr in eine peinliche Lage geraten wollte.
Des Abends, als er sich mit der Königin, den Schwestern und den Hofleuten zur Tafel gesetzt hatte und von seinem goldenen Teller aß, da schallte es »plitsch, platsch« durch die Schlosshallen, als ob jemand regennass die Marmorstufen heraufgestiegen käme. Die Schritte kamen näher und endlich klopfte jemand an die Tür und rief mit quakender, dunkler Stimme:
»Königssohn, o jüngster,
mach mir auf!
Weißt du nicht, wie dir gefiel
am Brunnen unser schönes Spiel?«
Da wurde es dem Jüngling wieder heiß unter den Wangen und das eiserne Band spannte und drückte stärker denn zuvor. Sein Schaft regte sich gegen seinen Willen und er konnte sich nicht von der Tafel erheben. Seine Mutter sorgte sich um ihn und fragte, was vor sich gehe.
»Ach Mutter«, beichtete da der Königssohn, »vor der Tür steht ein garstiges Ungetüm.«
»Etwa ein Riese, der dich fressen will?«
»Nein, ein Wasserpatscher ist’s, der mit mir gestern am Brunnen spielte und sich für seine Gesellschaft erbat, mit mir speisen zu dürfen.«
Indem klopfte es ein zweites Mal und die Königin, die sehr viel auf gutes Benehmen hielt, meinte:
»Was du versprochen hast, das musst du auch halten. Wir wollen den Gast hereinbitten und er soll mit dir von deinem goldenen Teller essen.«
Die Diener öffneten die Tür und der grüne Froschmann trat herein. Er verbeugte sich vor der Königin und den Schwestern und bewegte sich dabei höfisch und grazil, sodass die Frauen ganz angetan kicherten. Der Froschmann setzte sich dem Königssohn gegenüber und bat:
»Nun schiebe mir dein Tellerlein näher, damit wir zusammen davon essen.«
Dem Königssohn blieb nichts anderes übrig, als selbiges zu tun, und so speisten sie zusammen. Der Froschmann ging geschickt mit dem Besteck um und ließ sich die Gerichte gut schmecken. Die Hofleute duldeten das fremdartige Wesen, weil es sich seiner Hässlichkeit zum Trotz vornehm zu geben wusste. Der Königssohn aber saß da und schaute zu, wie ein köstliches Mahl nach dem anderen in dem breiten Maul verschwand, und er konnte nicht umhin zu überlegen, welches Spiel er heute wohl am Brunnen verpasst haben mochte. Darüber vergaß er das eiserne Band um seinen Schaft und eng wurde es in seiner Pluderhose. Lediglich seine Scham gebot ihm, sich nichts anmerken zu lassen. Nachdem der letzte Gang verspeist war, säuberte der Froschmann sein Maul, erhob sich und verbeugte sich vor den Anwesenden.
»Das Mahl mundete mir sehr, verehrte Königin, und ich freue mich darauf, Euch und Euren Kindern gleich morgen um dieselbe Zeit wieder Gesellschaft zu leisten. Ich möchte nämlich um Euren schönen Sohn freien.«
Keine Antwort abwartend verließ er den Saal und das Schloss. Der Königssohn war von den Worten aber derart bestürzt, dass er Hals über Kopf in sein Gemach lief, sich aufs Bett warf und sich ans Ende der Welt wünschte. Von einem Froschmann umworben zu werden, der so gar nicht wie die hübsche Prinzenpuppe ausschaute, rief tiefe Abscheu in ihm hervor, und nimmer wollte er sich vor anderen mit einem grünen Ungetüm sehen lassen. Und wie er im Bette lag und schluchzte, ward ihm bewusst, wie aufrecht sein Schaft war und nach wie vor gegen das eiserne Band drückte, was ungemein schmerzte. Da nahm er das weiche Kissen und drückte seinen Leib hinein, immer und immer wieder, und spürte dabei wohlige Heilung, beinahe wie beim Spiele mit dem Froschmann. Und der Königssohn kam nicht umhin, an ihn zu denken, und eigentümliche Bilder entstanden in seinem Kopf. Das Kissen wurde zum Froschmann und die weichen Federn waren das breite, warme Maul, welches nun ebenso abenteuerlich wie seine Glitschfinger auf der nackten Haut spielte. Es wollte nicht lange dauern, bis das Kissen glibberig, schleimig und feucht war, das eiserne Band nicht mehr drückte und der Schmerz nachließ. So fiel der Königssohn in tiefen Schlaf.
Am folgenden Tag bedachte er sich und entschied, sich von dem Froschmann nicht locken zu lassen. Er lief zum zweiten Male zum Schmied und forderte ein weiteres eisernes Band, welches er um die Schaftspitze legen wollte, damit jene sich nicht aufrichten konnte. Zum zweiten Male knöpften seine zarten Finger die Pluderhose auf und die rauen Finger des Schmiedes nahmen Maß an jener empfindlichen Stelle. Bereits am Abend trug der Königssohn zwei schwere eiserne Bänder, um sich zur Sittlichkeit zu zwingen. Das erste Band spürte er kaum noch, das zweite jedoch presste gar kalt und dumpf. Der Königssohn ertrug dies tapfer und glaubte, kein Wort des Wasserpatschers könne noch etwas in ihm bewirken.
Zum Abendmahl saß er wieder mit der Königin, den Schwestern und den Hofleuten an der reich gedeckten Tafel und trank aus seinem goldenen Becher, und wieder schallte es »plitsch, platsch« durch die Schlosshallen. Der Froschmann stand vor der Türe, klopfte daran und quakte mit seiner dunklen Stimme:
»Königssohn, o jüngster,
mach mir auf!
Weißt du nicht, wie dir gefiel
am Brunnen unser schönes Spiel?«
Dem Jüngling glühten die Wangen wie am Abend zuvor, und die eisernen Bänder spannten sogar stärker. Er konnte sich beim besten Willen nicht von der Tafel erheben und musste sitzen bleiben. Die Königin hingegen sprach:
»Man führe den Freier herein und gebe ihm denselben Platz wie gestern, denn es ziemt sich nicht, einen Spielgefährten abzuweisen.«
Die Diener taten wie geheißen und der grüne Froschmann verbeugte sich, einen angenehmen Abend wünschend. Zum Königssohn sagte er freundlich:
»Nun gieße frischen Wein in deinen goldenen Becher und wir wollen beide daraus trinken.«
Der Königssohn gehorchte, und so schlürften sie gemeinsam köstlichsten Wein. Man sah des Froschmanns grüne Finger um den Becher greifen und der Königssohn konnte sich des Gedankens nicht erwehren, zu welch anderen Spielen eben jene kühlen, nassen Glitschglieder fähig sein mochten. Darüber vergaß er seine eisernen Bänder und alles regte sich und richtete sich auf innerhalb seiner Pluderhose. Er war kaum fähig, sich nichts anmerken zu lassen. Nachdem der letzte Umtrunk getan war, erhob sich der Froschmann und verbeugte sich vor den Hofleuten.
»Ihr habt in Eurem Schlosse den besten Wein, doch am köstlichsten schmeckt der Anblick Eures anmutigen Sohnes, Frau Königin«, lobte er. »Auch morgen werde ich Euch und Euren Kindern um dieselbe Zeit Gesellschaft leisten. Der schöne Königssohn hat mit mir gespeist und hat mit mir getrunken, was die Hoffnung auf ein glückliches Ende meiner Freite stärkt.«
Er ging. Der Königssohn sah ihm verwirrt nach und senkte dann den Kopf. Der Froschmann hatte fein gesprochen und die Worte gut gewählt, sodass er seinen Bemühungen nichts entgegenzusetzen hatte. Darüber hinaus duldeten seine Mutter und Schwestern dieses fremde Wesen ohne Widerworte und der Königssohn fühlte sich mit der Entscheidung, was zu tun sei, vollends allein gelassen. Männlicher Stolz, der dem Heranwachsenden bereits in der Brust schwoll, hinderte ihn jedoch daran, sich bei den Frauen Hilfe und Rat zu ersuchen. Mit den Händen die Mitte seiner Hose bedeckend, entfernte er sich vom Saal und zog sich in sein Gemach zurück, wo er sich in die warmen Decken hüllte und sich einbildete, es wären die Arme und Beine des Froschmanns, die ihn da umschlangen. Fast fühlte er die kalten Glitschfinger auf seiner nackten Haut und meinte, sie würden über seinen Rücken streicheln, hinab zu einem Flecken, den er selbst noch nie derart sanft berührt hatte, weil er abseits lag von allen anderen seiner Stellen. Aber gerade darum bereitete ihm dort die Berührung wohlige Schauer, und schon bald wurden Königssohn und Bettdecke glibberig, schleimig und feucht.
Am dritten Morgen ärgerte sich der schöne Jüngling, sich solchen Träumereien hingegeben zu haben. Er fand sich abermals beim Schmied ein und sprach:
»Die bisherigen Bänder tun ihre Aufgabe nicht zufriedenstellend. Zwar drücken sie schwer und lassen alles an Ort und Stelle, doch abends verlieren sie ihre Macht und das Eisen ist ebenso schwach wie mein Wille. Weißt du nicht einen Rat?«
Der Schmied meinte daraufhin, dass ein drittes Band helfen möge, welches er eng und fest um die Hoden legen wollte. Er machte sich gleich an die Arbeit, nahm mit seinen rauen Fingern das rechte Maß und fertigte, was er dem Königssohn versprochen. Und wahrhaftig: Kaum war das dritte Band umgelegt, fühlte der schöne Jüngling, wie alles an ihm schwer herabhing. Keine Kraft der Welt könnte es gegen seinen Willen schaffen, den gefangenen Schaft wieder aufzurichten.
»Ein eiserner Heinrich will ich nun sein«, sprach der Königssohn, »den niemand brechen kann. Ich danke dir, Schmied.«
Als nun am Abend allesamt an der königlichen Tafel saßen und den Froschmann empfingen, schoss dem schönen Jüngling keine Hitze in die Stirn, seine Wangen glühten nicht und er konnte sich ohne Schwierigkeiten von seinem Stuhl erheben, wann immer es ihm danach gelüstete. Nach Speis und Trank verneigte sich der grüne Gast und bat:
»Ich habe mich satt gegessen und getrunken und bin nun müde. Erlaubt Eurem Sohne, hochverehrte Königin, mich in sein Gemach zu führen. Dort soll er sein seidenes Bett zurechtmachen, da wollen wir uns schlafen legen.«
Der Königssohn machte ein bitterböses Gesicht und erwiderte:
»Dieser kalte Wasserpatscher soll nicht in meinem reinen Bettlein schlafen! Hatte er an den vergangenen Abenden wohl noch Macht über mich, will ich heute nach meinem eigenen Willen entscheiden und diesen Freier abweisen!«
Und er stampfte mit dem Fuß auf wie ein kleines, unartiges Kind. Seine Mutter aber ward darüber zornig und sprach:
»Wer dir geholfen hat, als du einsam am Brunnen dich nicht zu beschäftigen wusstest, und dir ein treuer Spielkamerad war, den sollst du hernach nicht verachten!«
Sie nickte dem Froschmann freundlich zu und gab somit ihre Erlaubnis, dass beide Männer sich zurückziehen durften. In dem Gemach wies der Königssohn dem grünen Gast eine Ecke zu und legte sich selbst auf die warmen Decken. Der Froschmann begehrte jedoch, ebenfalls ins Bett zu kommen und drohte, es der Mutter zu verraten, würde der Königssohn es ihm verwehren. Grollend ließ er also den grünen Gast zu sich ins Bett.
»Willst du heute nicht spielen, wie wir es am Brunnen taten?«, fragte der Froschmann sacht.
»Ich bin müde, ich will schlafen«, entgegnete der Königssohn.
»Magst du meine Finger nicht mehr?«, fragte der Froschmann und streichelte dem schönen Jüngling über die nackte Haut. »Willst du nicht noch einmal so glibberig, schleimig und feucht werden wie ich?«
Er nahm die Hand des Königssohns und führte dessen zarte Finger über seine grüne, kühle Haut. Unter der Führung des Froschmanns glitt der Königssohn mit den Fingerspitzen über das breite Maul, durch die wirren Haarsträhnen, die glitschigen Arme hinab, entlang der Brust und des Bauchs. Ein tiefes Quaken entfuhr dem grünen Gast und zeigte, wie sehr ihm dieses Spiel gefiel. Da wuchs die Neugierde in dem schönen Jüngling, wie es wohl bei dem Froschmann zwischen den Beingliedern aussehen möge. Wie er aber das lange Haar, welches bisher eben jenen Flecken verdeckt hatte, zur Seite schob, erschrak er fürchterlich, denn dort hatte der Froschmann nichts als eine hässliche Kloake.
»Hab keine Angst und keinen Ekel«, bemühte sich der Froschmann den Königssohn zu beruhigen, »diese Ausstattung gehört zu uns Fröschen wie das Quaken und die grüne Haut. Magst du die Stelle nicht einmal berühren, ob sie auch glibberig, schleimig und feucht werden kann?«
Er nahm die zarte Hand des Jünglings und wollte sie an die Kloake führen, doch der Königssohn zierte sich und weigerte sich eisern, dorthin zu fassen. Das ergrimmte den Froschmann und er drohte, auch diese Ungastlichkeit der Mutter zu verraten. Das erboste wiederum den Königssohn und in seiner Wut rief er:
»Dann hab deinen Willen und sieh, was du davon hast!« Und er schlug mit der Faust gewaltsam und mit allen Kräften wider die Kloake. »Nun wirst du wohl Ruhe geben, du garstiger Wasserpatscher!«
Er wandte sich von dem grünen Gast ab, denn obgleich er den Schlag nicht bereute, mochte er das schmerzverzerrte Gesicht des Froschmanns nicht ansehen. Als aber gar kein Schmerzschrei ertönte und es überhaupt ganz still wurde, sorgte sich der Königssohn und drehte sich doch noch einmal zu seinem Gast herum. Dort lag aber kein Froschmann mehr auf dem Bette, sondern ein stattlicher, junger Mann mit dunklem Haar und schmucken Gewändern. Der lächelte ihm freundlich zu, blickte ihn mit liebevollen Augen an und erzählte:
»Hab keine Scheu vor mir, Königssohn, denn ich bin der Froschmann gewesen, der um dich gefreit hat. Ich bin ein Königssohn wie du, doch war ich ein arger Herumtreiber und hatte versucht, den Sohn einer Hexe gegen seinen Willen zu verführen. Zur Strafe hatte sie mich in einen Froschmann verwandelt, der tief im Brunnen hausen musste. Nur du allein hast mich davon erlösen können. Wenn ich dir zum Dank auf ewig ein lieber Geselle und Gemahl sein darf, so will ich das gern tun und fortan jede Nacht das Bett mit dir teilen.«
Der schöne Jüngling besah sich den Fremden und wollte zunächst nicht glauben, dass er der Froschmann gewesen. Doch die tiefe Stimme klang ebenso fein in seinen Ohren und die dünnen Finger, nun nicht mehr grün und vollends ohne Häutchen dazwischen, griffen ebenso sacht nach seiner Pluderhose und lösten erst einen, dann zwei Knöpfe. Da sank der Königssohn zu dem Erlösten hinab, ihre Lippen trafen zusammen und wo sie sich berührten, entstand ein langer, zärtlicher Kuss voller Liebe und Zuneigung.

Ihre Arme schlangen sich umeinander, ihre Hände streichelten sich gegenseitig und ein Kleidungsstück ums andere fiel vom Bette herab. Wie der Fremde ganz nackend war, erkannte der Königssohn, dass es die hässliche Kloake nicht mehr gab und an deren Stelle alles gesund und aufrecht stand, wie es sich für einen Mann gehörte. Das freute den Königssohn ungemein und sie begannen, im Gemach zu spielen wie einst am Brunnen, und das Spiel wurde munterer und wilder und brachte das ganze Bett zum Wackeln. Mit großer Hingabe kosteten der Königssohn den mächtigen Schaft des Erlösten und berauschte sich an dem würzigen Geruch, den jener ausströmte. Der Fremde selbst glitt mit seiner Zunge den Rücken hinab, vergrub sie dort, wo er endete, und schmeichelte dem abseits gelegenen Flecken, bis der Jüngling vor Verzücken laut wimmern musste. Wie sie einander verwöhnten, fand der Erlöste die drei eisernen Bänder, fragte nach ihrem Zwecke und meinte, nachdem er alles erfahren:
»Gleich morgen früh sollst du zum Schmied eilen, damit er dir dieses Gefängnis wieder abnehme. Sie stören unser Beisammensein gewaltig.«
Solange die Bänder die Vollendung des Spieles behinderten, blieb dem Fremden nichts weiter übrig, als seinen Retter zu bewundern. Seiner Kleider entledigt, sah man nun erst, wie stattlich und schön er war und wohl jeder hätte ihn gern zum Freund und Gefährten gehabt. Voller Ungeduld warteten sie auf den nächsten Morgen, und als der endlich kam, lief der Königssohn schnurstracks zum Schmied. Ehe er ihn aber erreichen konnte, traf er auf seine Mutter, die sogleich zu wissen begehrte, was die Eile bedeute. Um sie nicht zu beschämen, verschwieg der brave Sohn die Einzelheiten und berichtete ihr lediglich, dass der Froschmann seine wahre Gestalt zurückerhalten habe. Da schlug die Mutter vor Staunen die Hände über den Kopf zusammen, besann sich aber schnell und sprach dann:
»Ich hörte über Boten aus dem Nachbarreich vom Schicksal eines verschwundenen Prinzen. Das mag wohl dein Gast sein. Wenn er es aber ist, muss ich ihn schleunigst sprechen.«
Sie nahm den Sohn an die Hand und lief mit ihm zurück zu dessen Gemach. Tatsächlich erkannte sie in dem Gast den verschollenen Thronfolger des Nachbarreiches und musste eine unangenehme Pflicht tun: Sie brachte ihm die Nachricht, dass der Vater des einstigen Froschmanns todkrank läge und sich grämte, seinen einzigen Sohn vor seinem Ende nicht mehr sehen zu können. Da löste der Gast die Hand vom Königssohn und sprach zu ihm:
»Ich muss fort in meines Vaters Schloss und dich verlassen, denn vielleicht kann die Kunde über meine Erlösung sein Leben retten. Doch lass mich dir einen Ring zu meinem Andenken geben. Sobald ich die rechten Vorkehrungen in meinem Reich getroffen habe, komme ich wieder und hole dich heim, und wir werden miteinander noch viele Wonnen teilen.«
Da zog er sich an und ritt fort. Mit Wehmut sah ihm der Königssohn hinterher und die Mutter wusste sonst keinen Trost, außer mit ihm die Kisten zu packen, die er zur Aussteuer mitführen sollte. Während sie damit beschäftigt waren, langte der erlöste Prinz bei seinem Vater an. Dieser war wirklich sterbenskrank und dem Tode nahe. Der König sprach zu seinem Sohne:
»Wohl weiß ich von deinen Vorlieben, werter Sohn, und dass eben jene dazu führten, dass du mir beinahe verloren gingst. Du vergnügst dich mit anderen Männern in fremden Betten, und auch wenn mir dies missfällt, weil sich solch Verhalten nicht ziemt, so bin ich froh, dich vor meinem Ende noch einmal zu sehen. Versprich mir hier an meinem Sterbebette, dich nach meinem Willen mit einer Frau zu verheiraten, damit das Volk – wie es sich gehört – eine Königin hat. So kann keine sinnliche Wonne mehr zu weiterem Verderben führen.«
Der Prinz war ob des Sterbens seines Vaters so betrübt, dass er sich gar nicht bedachte, sondern gleich erwiderte:
»Ja, lieber Vater, was Euer letzter Wille ist, soll geschehen.«
»Darüber freue ich mich«, sagte der alte König, »und vermache dir meinen schwarzen Panter, der mir ein weiser Ratgeber war. Er soll darauf achten, dass du dein Versprechen nicht vergisst.«
Daraufhin schloss der König zufrieden die Augen und starb. Als nun der Prinz zum König ausgerufen und die Trauerzeit verflossen war, musste er das Versprechen halten, welches er seinem Vater gegeben hatte. Obwohl es ihn zutiefst traurig stimmte, seinen Thronsaal, seine Gemächer und sein Bett mit einer Frau teilen zu müssen, ließ er um eine Königstochter aus einem fernen Land werben, und sie ward ihm auch zugesagt. Nachdem dies über Boten unserem Königssohn zu Ohren kam, grämte er sich über die Untreue seines Freiers so sehr, dass er fast verging. Sollte er etwa umsonst auf seiner Kiste gesessen und der Abholung geharrt haben? Da sprach seine Mutter zu ihm:
»Liebstes Kind, sei nicht traurig! Was du dir wünschest, das sollst du haben.«
Der Königssohn bedachte sich einen Augenblick, dann sprach er:
»Liebste Mutter, ich wünsche mir elf Jünglinge, von Angesicht, Gestalt und Wuchs mir völlig gleich.«
Sprach die Mutter:
»Wenn’s möglich ist, soll dein Wunsch erfüllt werden. Ich werde in den umliegenden Dörfern und Städten nach ihnen suchen.«
Und sie zog los, bis sie elf Jünglinge gefunden hatte, die ihrem Sohne von Angesicht, Gestalt und Wuchs völlig gleich waren. Die Schwestern nähten derweil zwölf ihrer schönsten Gewänder um, damit sie ihrem Bruder passen sollten. Es waren schöne Kleider in den Farben von Gold und Silber, gefertigt aus Seide und Samt, wie sie hohe Damen beim Tanzball trugen. Der arme Königssohn konnte sich bei den Schwestern nicht genug bedanken, doch die lächelten freundlich und übten ihm zuliebe gern diesen Verzicht. Als der Königssohn von ihnen einen Eid verlangte, niemandem etwas von den Gewändern zu verraten, bedachten sie sich nicht lange und schworen bereitwillig. Als die Mutter nun mit den elf Jünglingen wiederkehrte, ließ der Königssohn sie alle in die Frauenkleider steigen, ihre Lippen rot bemalen und ihre Locken hübsch frisieren. Er selbst zog das zwölfte Gewand an, schmückte sich mit Kette und Reifen, rötete seine Lippen und steckte sein Haar mit glitzernden Bändern zusammen.
»Nun, Mutter, sag, wie wir aussehen.«
Da sprach die Mutter staunend:
»Du siehst aus wie eine hohe und schöne Tänzerin, die ihre Gefährtinnen zum Ball eingeladen hat.«
»Und ihr, meine lieben Schwestern, was sagt ihr?«
»Kein Mann wird je erkennen, dass ihr keine Damen seid«, versicherten beide.
Der Königssohn war es zufrieden, nahm von seiner Mutter und den zwei Schwestern Abschied und ritt mit den elf Jünglingen an den Hof seines ehemaligen Freiers, den er so sehr liebte. Unterwegs betrachteten die Jünglinge einander unentwegt, denn sie waren erstaunt darüber, wie weiblich und elegant sie wirkten. Das Samt und die Seide gefiel ihnen auf ihrer hellen Haut und die engen Strümpfe schmeichelten ihren Schenkeln, sodass sinnliche Wonne in ihnen aufkeimte.
»Wir sind Herren und Damen zugleich«, sagten sie und fanden den Gedanken sehr betörend. Sie strichen sich gegenseitig über die Gewänder und über die Strümpfe und kicherten: »Welch Glück, dass die Königstöchter die Kleider recht weit geschnitten haben, denn der Stoff streichelt unsere Leiber so zärtlich während des Rittes, dass unsere Schafte sich emporrecken wollen und weit abstehen.«
»Hält dies denn das Unterhöschen aus?«, fragte einer, besorgt um sein Kostüm.
Der Königssohn antwortete:
»Oh ja, meine Schwestern wählen stets beste Stoffe.«
Dermaßen erregt waren die elf Jünglinge, dass sie sich bei einer Rast gegenseitig unter die Gewänder fassten und sich am Gefühl erfreuten, das der feine Stoff hervorrief. Sie küssten und streichelten einander, ohne sich auszuziehen, um den neuen Reiz gänzlich auszukosten. Daher dauerte es nicht lange, bis die Jünglinge in ihren Frauengewändern den Gipfel ihres Rausches erreichten und ein lautes, kicherndes Gestöhn durch den Wald schallte. Der Königssohn tat als einziger nicht mit, denn sein Herz war zu betrübt und die eisernen Bänder zu schwer. Er sprach aber freundlich zu den anderen:
»Mich erleichtert, dass ihr euch in euren Gewändern so wohlfühlt, Freunde, denn wir werden sie oft und lange tragen müssen.«
»Das soll uns wiederum eine Wonne sein«, antwortete einer der Jünglinge, »denn wir spüren, wie du siehst, einen aufregenden Reiz dabei, als Männer Frauengewänder zu tragen, die so anders sind und uns so weich umhüllen.«
So gelangten sie, ohne dass man ihre abstehenden Schafte sehen konnte, an den Hof des jungen Königs und stellten sich als Frau Heinrich und ihre Gesellinnen vor. Da fragte der Königssohn mit verstellter, hoher Stimme, ob der neue Herrscher sie nicht als Tänzerinnen in den Dienst nehmen wolle. Der König sah ihn an und erkannte ihn in den Frauengewändern nicht. Weil sie aber alle gleichermaßen schöne Frauen zu sein schienen und er für seine Ritter und Höflinge noch keine Unterhaltung für festliche Gelage zu bieten hatte, sprach er ja, er wolle sie gerne als Tänzerinnen aufnehmen. Und so wurden sie die zwölf Balldamen des Hofes.
Der junge König aber vergaß, den schwarzen Panter zu fragen, den er von seinem Vater geerbt hatte. Das war ein wunderliches Katzenwesen, denn es wusste alles Verborgene und Heimliche und konnte dies seinem Herrn in menschlicher Sprache verraten. Es trug sich zu, dass er eines Abends zum König kam, ihm um die Waden schlich und schnurrte:
»Du meinst, du hättest da zwölf Tänzerinnen?«
»Ja«, sagte der König, »zwölf Tänzerinnen sind es und sie gefallen meinem Hofstaat gar sehr. Weil ich sie wählte, sind alle mit mir als ihren Herrscher zufrieden.«
Sprach der Panter weiter und in seinen Augen flackerte es:
»Du irrst dich, das sind zwölf Jünglinge!«
Antwortete der König:
»Das ist nimmermehr wahr, wie willst du mir das beweisen?«
»Oh, lass nur wie jeden Abend zwölf Pötte an die Betten stellen, verstecke dich hinter dem Vorhang ihres Gemaches und sieh hin: Stehen sie beim Wasserlassen, statt zu hocken, so sind es Jünglinge.«
Dem König gefiel dieser Rat und er ließ die Pötte an die Betten stellen und versteckte sich, wie geheißen, hinter dem Vorhang. Es gab jedoch einen Mann an dem Hofe, der war Hofschneider und hatte schon am ersten Abend gemerkt, dass es sich um Jünglinge und keine echten Tänzerinnen handelte. Er hatte nämlich die Tanzgewänder begutachtet und gesehen, welche Ausbuchtungen ein jedes von ihnen im mittleren Bereich aufwies. Derlei kannte er von den Kleidern, die er bisher für hohe Damen zu fertigen hatte, nicht.
»Diese Beulen können nur von stolzer Männlichkeit herrühren«, dachte der Schneider bei sich, »aber getragen werden die Kleider von zwölf Jungfrauen. Was mag das Geheimnis sein?«
Und er hatte sich heimlich vor die Tür des Gemachs gestellt und nachts durch das Schlüsselloch gesehen, wie elf der Tänzerinnen sich in ihren Betten miteinander vergnügten und sich gegenseitig zwischen den Beinen streichelten und küssten. Da sah der Hofschneider, dass sich unter ihren Röckchen und Höschen tatsächlich versteifte Schafte befanden.
»Die Tänzerinnen sind halbe Männer«, staunte er, doch störte ihn diese Erkenntnis keineswegs. Im Gegenteil, als er kurz an sich heruntersah, verriet ihm sein eigener Zustand, dass der Gedanke einer Jünglingsdame ihm sehr gefiel.
Fortan beobachtete der Schneider die Tänzerinnen jeden Abend und sah, wie aufregend es jene fanden, einander in Frauengestalt zu bewundern, ihre Gewänder nur zur Hälfte abzulegen und sich in solch unfertigem Aufzug einander hinzugeben. Sie streichelten über die feinen Strumpfhosen, leckten ihre zarte, von Spitze umhüllte Brust und schenkten einander mit roten Lippen die leidenschaftlichsten Küsse. Der Hofschneider fand diese Schauspiele erregend genug, dass er jede Nacht nach seinem Gaffen eine helle Pfütze vor dem Gemach der Tänzerinnen zurückließ. Um aber nach der Offenbarung durch den Panter auf dieses Vergnügen nicht verzichten zu müssen, durfte der König das Geheimnis nicht erraten, und deshalb warnte der gute Schneider die falschen Tänzerinnen:
»Frau Heinrich, Ihr und Eure Gesellinnen sollt auf die Probe gestellt werden! Der Panter kennt euer Geheimnis und der König wartet hinter dem Vorhang. Tut euch Gewalt an und hockt euch auf die Pötte, anstatt beim Wasserlassen zu stehen!«
Da dankte ihm der verkleidete Königssohn und sprach hernach seinen Jünglingen zu, sie sollten gar weiblich und mit Zierde in die Pötte austreten. Am Abend sah der König nun, wie die zwölf Tänzerinnen ihre Röcke nur bis zu den Knien lüfteten und sich zierlich hinhockten. Der junge Herrscher war enttäuscht, denn es gelüstete ihn schon lange danach, endlich wieder junge, schöne Schafte zu betrachten. Diese Tänzerinnen aber schienen ihm echte Damen zu sein. Da ging er zum Panter und sprach:
»Du hast mich belogen! Sie lassen ihr Wasser hockend, wie es sich für Damen geziemt.«
Der Panter fauchte gekränkt und antwortete:
»Sie haben gewusst, dass sie auf die Probe gestellt werden, und haben sich Gewalt angetan. Lass ihnen zwölf Spinnräder ins Vorzimmer bringen. Wenn es wirklich Frauen sind, so werden sie sich an den Spinnrädern erfreuen, sich gar neue Stoffe spinnen für ihre Gewänder. Wenn es aber Männer sind, wie ich es dir sage, so werden sie mit dem Spinnrad nicht umgehen können.«
Der Hofschneider aber, der es redlich mit den Jünglingen meinte, ging wieder hin und entdeckte ihnen den Anschlag. Da sprach der Königssohn zu seinen elf Freunden:
»Tut euch Gewalt an und blickt gebannt und verzückt auf die Spinnräder. Wer etwas davon versteht, mag damit umgehen, der Rest spreche über neue Stoffe und Kleider für den Tanz! Gar weiblich müssen wir wirken, damit man unser Geheimnis nicht entdeckt.«
Wie nun der König hinter dem Vorhang stand, um zu sehen, was passieren würde, so sah er, wie die zwölf Tänzerinnen um die Spinnräder standen, einander erzählten, welche neuen Kleider sie sich wünschten, und die eine oder andere sich dransetzte und das Spinnen begann. Da sprach der König wiederum zum Panter:
»Du hast mich belogen, es sind Frauen, denn sie haben die Spinnräder gern angesehen.«
Der Panter antwortete abermals unter Fauchen:
»Sie haben gewusst, dass sie auf die Probe gestellt werden.«
Der König aber wollte der schwarzen Katze fortan nicht mehr glauben. Stattdessen lud er die Tänzerinnen ein, ihn und seine Leute auf die Jagd zu begleiten, um nach dem Erfolg der Hatz auf der Lichtung für die Jäger zu tanzen. Die zwölf sagten gerne zu, schmückten sich auf dem Weg zur Lichtung mit bunten Blumenkränzen und so manche wurde rot bei dem Gedanken, was wohl geschähe, würde sie mit einem strammen, grünen Jäger hinter einem Busch verschwinden und ihm das Geheimnis ihrer Schenkel offenbaren. Aber dem Königssohn zuliebe verhielten sie sich artig und tanzten, nachdem Schwein und Reh erlegt waren, einen hübschen Reigen miteinander. Da rief der erste Jäger:
»Die Tänzerinnen verstehen ihre Kunst, aber warum sieht man unseren Herrscher nie mit einer von ihnen sich drehen?«

Die anderen Jäger stimmten zu und so musste der König wider Willen in die Mitte des Reigens schreiten, um seine höfische Erziehung unter Beweis zu stellen. Seine Wahl für eine Gesellin fiel auf die Frau Heinrich und er drückte deren zarten Leib fest an sich. Das gefiel dem verkleideten Königssohn und all die Erinnerungen an das Spiel am Brunnen kehrten zurück. Plötzlich ertönte ein lauter Knall und der junge Herrscher rief erschrocken:
»Frau Heinrich, Ihr Schuh zerbricht!«
»Nein, mein Guter, mein Schühlein nicht!
Ein eisern Band sprang mir vom Schaft,
das hielt bis eben ihn erschlafft.«
Das gab dem jungen König Rätsel auf. Sie begannen zu tanzen, drehten sich unzählige Male und fanden viel Freude daran. Wenn ein Tanz geendet war, wusste der Herrscher gleich einen anderen, und wenn er einmal keinen wusste, erdachten sie gemeinsam einen völlig neuen und probierten Schritte und Figuren dafür aus. In all dem Treiben knallte es ein zweites Mal und wieder rief der König:
»Frau Heinrich, Ihr Schuh zerbricht!«
»Nein, mein Lieber, mein Schühlein nicht!
Ein Band sprang mir von meiner Mitte,
das zwang bis eben mich zur Sitte.«
Das gab dem jungen König zu denken. Und sie drehten einander aufs Neue, obgleich der Tag schon fortgeschritten war und in der Ferne die Abendsonne leuchtete. Da wurde es am Rocke und an den Strümpfen glibberig, schleimig und feucht, und die beiden mussten sich darüber wundern. Über ihr Staunen knallte es zum dritten Mal und der König erschrak:
»Frau Heinrich, Ihr Schuh zerbricht!«
»Nein, mein Teurer, mein Schühlein nicht!
Ein Band sprang mir von meinen Hoden,
das zog bis eben sie zu Boden.«
Damit waren alle eisernen Bande vom Königssohn gelöst, und als der junge Herrscher ihn abermals an sich drückte, spürte er, woher die Spuren an Rock und Strümpfen stammten. Ehe er etwas sagen konnte, kam plötzlich ein Bote aus dem fernen Land geritten mit der Nachricht, dass die Braut des Königs im Anzug wäre. Wie der Königssohn das hörte, tat ihm das Herz so weh, dass er ohnmächtig zur Erde fiel. Der junge Herrscher meinte, seiner lieben, geheimnisvollen Tänzerin sei etwas Schlimmes zugestoßen und wollte ihr helfen, da zog er ihren Handschuh aus, um den Pulsschlag zu fühlen. Es fiel sein Blick auf den Ring, den er dem Jüngling einst gegeben, und er erkannte deutlich, was er während des Tanzes bereits geahnt hatte: Unter den Gewändern und der Farbe im Gesicht verbarg sich sein treuer Heinrich. Sein Herz war gerührt davon, dass er ihn küsste, und da schlug der Königssohn die Augen auf und sprach:
»Ich bin dir gefolgt und habe mich verkleidet, um jeden Tag in deiner Nähe zu sein, auch wenn du dich gegen mich entschieden hast.«
Der König antwortete:
»Du bist mein und ich bin dein und kein Mensch und kein Wille auf der Welt kann das ändern.«
Zum Boten gewandt, sprach er:
»Dir will ich ein Rätsel aufgeben, das deine Herrin lösen soll. Ich habe einen Schrank mit allerlei Kostbarkeiten darinnen und besaß einen alten Schlüssel dazu, der mir jedoch verloren ging. Daher beauftragte ich die besten Schmiede des Landes, mir einen neuen Schlüssel anzufertigen. In der Zwischenzeit fand sich der alte Schlüssel wieder ein. Welchen soll ich aber nun verwenden?«
Der Bote besann sich kurz und erwiderte dann:
»Gern überbringe ich meiner Herrin Euer Rätsel, aber mir scheint es allzu leicht. Sie wird sagen, dass Ihr den alten Schlüssel verwenden sollt, so er noch brauchbar ist, und das gute Metall der Schmiede nicht verschwenden dürftet.«
»Ist dies deine und ihre Antwort«, sagte der König, »so will ich erklären, dass der Schlüssel in Wahrheit meine holde Geliebte ist, die ich wiedergefunden habe. Nun, wo ich bereits eine Gemahlin gefunden habe, muss ich dich zu deiner Herrin zurückschicken. Bestelle ihr, dass ich sie nicht zur Braut nehmen kann.«
Der Bote verstand und ritt unverdrossen fort, die Hochzeit aber feierte der Königssohn mit der ersten der zwölf Tänzerinnen. In der Brautnacht vereinigte er sich mit seinem neuen Gemahl, und es wurde beiden ein Genuss, nach so langer Zeit ihr Spiel endlich zu vollenden. Nun war der Königssohn kein eiserner Heinrich mehr, sondern gab Leib, Herz und Seele dem Liebsten hin, und in steter Treue und Liebe waren die beiden fortan glücklich. Der schwarze Panter aber kam wieder in Gnade, weil er doch die Wahrheit gesagt hatte, und erhielt die höchsten Ehren am Hof.
Dem Volke verrieten sie jedoch nichts von ihrem Geheimnis, damit der Wille des verstorbenen Königs weiterhin als erfüllt gelten möge. Der junge Herrscher gewöhnte sich an seinen Gemahl in Damenkleidern und fand es des Nachts recht aufregend, ihn ins königliche Bett zu tragen, ihm langsam mit Händen und Zähnen das Gewand abzuziehen und ihn in seiner weiblichen Wäsche zu bewundern. Weiße Klöppelspitze umrandete die Brust, an der er zärtlich knabberte. Die feine Strumpfhose glänzte an den Beinen und der König küsste den heimlichen Flecken durch die Seide hindurch. Auf diese Weise bestaunte er all die weibliche Seiten seines Gemahls und entdeckte zugleich die echte Männlichkeit, die darunter lag. Oft genug aber, im Rausche der Wonne, stieß er seinen mächtigen Schaft in die Rückseite der Strumpfhose, welche einriss und den Weg in tiefere Gefilde freigab. Dann gruben sich seine Hände in die mit Seidenfetzen umhüllten Backen, während er die Blöße des Fleckens spürte und aus seinem Bettgenossen, der so frauenhaft und elegant gekleidet war, das tiefe, raue Schnaufen eines Mannes hervorlockte.
Den beiden Liebenden gefiel dieser Wechsel zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit so sehr, dass der Hofschneider ihnen fortan jeden Abend eine neue Strumpfhose nähen musste. Dafür durfte er im Gemach der anderen elf Jünglinge sooft nächtigen, wie es ihm beliebte, und so kam es, dass die hellen Pfützen auf dem Schlossboden noch zahlreicher wurden als je zuvor.
***
Niemand von uns hat daran gedacht, beim Zuhören den Nachtisch zu verzehren, nun aber stürzen wir uns darauf. Lediglich Margarete verzichtet, weil sie auf Diät sei, und dankt Giovanni besonders für die positive Einarbeitung der Travestiekunst in das Märchen.
»Eigentlich ist der zweite Teil einer anderen Geschichte entnommen«, gibt er zu. »Aber es schien mir passend, ihn hier beizufügen.«
»Warum auch nicht?«, sagt Wilko. »Der schwule Volksmund verbindet eben zwei Märchen, die anderswo getrennt sind. Einzelne Motive begegnen den lesenden Kindern fein säuberlich getrennt in ihren unschuldigen Büchlein, damit ihr junger Geist nicht überfordert wird. Dem seiner kindlichen Unschuld entwachsenem Publikum jedoch, so scheint’s mir, darf zugetraut werden, komplexeren Handlungen zu folgen.«
»Das hast du schön gesagt, Herr Professor«, grinst Basil neckend. »Mal sehen, ob du mit meiner folgenden Variation über ein Märchen genauso einverstanden sein wirst!«
Schon legt er los.
Heinz in kluger Gesellschaft
Der holde Otto hatte Bekanntschaft mit Heinz und Kunz gemacht und ihnen in einer heimlichen Stunde anvertraut, dass er noch unberührt sei und sich nach einem Buhlen sehne, der ihn zu sich nähme. Weil ihn aufgrund seiner Jugend und seiner Reize nun Heinz und Kunz beide gleichermaßen begehrten, erzählten sie ihm gar viel von der großen Liebe und Freundschaft, die sie ihm zutragen wollten. Sie überboten einander derart mit schmeichelnden Worten und außergewöhnlichen Versprechungen, dass der holde Otto endlich einwilligte, mit einem von beiden in einem Hause zu wohnen; jeden Abend sollte der Fleiß in der gemeinschaftlichen Wirtschaft mit reichlicher Hingabe belohnt werden.
»Aber noch weiß ich nicht, wen von euch beiden ich lieber habe«, sagte Otto.
»Darüber kannst du in unserem Beisein nicht in Ruhe entscheiden«, meinte Kunz. »Schließe dich für drei Wochen in die einsame Kapelle oben auf dem Berg ein. Dort kannst du im Einsiedlertum bedenken, in wessen Haus du ziehen magst.«
Heinz stimmte dem Vorschlag seines Nebenbuhlers zu und versicherte, dass sie beide geduldig im Dorfe auf Ottos Rückkehr warten wollten und keiner auf den Berg steigen werde, um den Holden in seinem Grübeln zu stören. Otto erklomm also den Berg und zog sich in die Kapelle zurück, und Kunz meinte, dort oben wäre er gut aufgehoben und niemand würde sich getrauen, ihm seine Unschuld wegzunehmen. Aber es dauerte nicht lange, so gelüstete es Heinz nach dem jugendlichen Fleisch und er sprach zu seinem Nebenbuhler:
»Lieber Kunz, ich bin von meiner Base zu Gevatter gebeten worden. Sie hat ein Söhnchen zur Welt gebracht, ganz blond, das soll ich aus der Taufe heben. Wundere dich also nicht, wenn ich heute ausgehe und erst morgen wiederkehre.«
»Ja«, antwortete Kunz, »geh in Gottes Namen, und wenn du etwas Gutes isst oder sich dein Auge an einem hübschen Mannsbild labt, so denk an mich. Von dem süßen roten Kindbettwein tränke ich auch gern ein Tröpfchen, am liebsten im Beisein eines unberührten Grünschnabels.«
Es war aber alles nicht wahr; Heinz hatte keine Base und war nicht zu Gevatter gebeten worden. Er ging geradewegs hinauf zur Bergkapelle, schlich zum schlafenden Otto und fing an, dessen unschuldige Haut zu lecken. Der Holde seufzte im Traume und meinte wohl, sanfte Regentropfen täten ihn streicheln, wo in Wahrheit Heinzens kecke Zunge bis in die Spalte des Gesäßes vordrang und versuchte, den Eingang zur Lust mit ihrer Spitze zu erweichen. Es schmeckte ihm vorzüglich, was er dort kostete, und da die Spalte schon bald weich war, wagte es Heinz, seinen Finger hinzuzunehmen. Zu seinem Glück zog der schlummernde Otto seine Knie zur Brust und erleichterte dem heimlichen Besucher damit den Zugang. Heinz führte seinen Finger zunächst zum Mund, um ihn großzügig zu befeuchten. Hernach führte er ihn an eine Stelle, wo es rosarot und runzlig war. Er berührte sachte jenes Ziel. Ottos Leib zuckte sogleich und seine kleine Runzelstelle kräuselte sich noch stärker.

»Hoffentlich erwacht er nicht«, dachte sich Heinz im Stillen und gewährte dem Holden Zeit, sich wieder zu entspannen.
Erst nach einer Weile berührte er ihn sanft noch einmal und diesmal bewegte sich Otto nicht. Heinz begann, langsam seinen Speichel zu verreiben, rund um die rosarote Stelle herum und hin und her. Und wie er rieb, merkte er, dass der Schlafende seine Augen geschlossen hielt und lediglich ein leichtes Lächeln auf den Lippen lag. Er schien das Geschehen im Traume zu genießen.
»Dann will ich mal meinen Finger ein bisschen hineinstecken«, entschied Heinz und schob sachte nach innen.
Sein Herz schlug heftiger, als er sah, wie sein Fingerglied in dem Gesäß verschwand. Er drückte und kreiste damit, bis er bis zum obersten, dann bis zum mittleren Knöchel drinsteckte.
»Wenn mein Zeigefinger reinpasst, dann vielleicht auch etwas anderes«, meinte Heinz und wurde mutig.
Er rückte mit dem Becken an Ottos Gesäß heran, hielt seinen Freudenspender an den Spalt und versuchte einen ersten Stoß in die feuchte Enge. Otto erwachte beinahe, und die Aufregung um die verbotene Tat fügte ihr Übriges hinzu: Alsbald verspürte der heimliche Nachtbesucher das erlösende Lendenzucken und verzierte den Lusteingang mit seinen hellen Sahnehäubchen, obgleich seine Stöße kaum ins Innere vorgedrungen waren.
In aller Stille verließ Heinz die Kapelle wieder, machte sich auf einen Spaziergang über den Berg, besah sich die Täler von oben, streckte sich hernach in der Morgensonne aus und kratzte sich am Freudenspender, so oft er an den holden Otto dachte. Erst als es Abend wurde, kam er wieder zurück ins Dorf.
»Nun, da bist du ja wieder«, grüßte ihn Kunz arglos, »du hast gewiss einen lustigen Tag gehabt?«
»Es ging wohl ganz gut«, antwortete Heinz.
»Was hat denn das Kind für einen Namen bekommen?«
»Anstoß«, erwiderte Heinz trocken.
»Anstoß?«, rief Kunz. »Das ist ja ein wunderlicher und seltsamer Name. Ist der in eurer Familie gebräuchlich?«
»Was ist da weiter dran«, fragte Heinz zurück. »Der Name ist nicht schlechter als die deiner Paten sein mögen!«
Nicht lange danach überkam ihn wieder die Lust auf den holden Otto. Er sprach zu Kunz:
»Du brauchst dich nochmals nicht zu wundern, ich bin zum zweiten Mal zu Gevatter gebeten worden. Weil das Kind mit einem Glücksmal auf die Welt gekommen ist, kann ich es nicht absagen.«
Der gute Kunz wünschte ihm eine gute Zeit, Heinz aber schlich aus dem Dorf zur Bergkapelle hin, legte sich neben Otto und begann sein feuchtes Fingerspiel von Neuem. Diesmal führte er zwei Finger auf einmal an die rosarote Stelle und verwendete sie dazu, den kräuslichen Kranz nach allen Richtungen auseinanderzuziehen, bis er schön glatt war. Erst dann rückte er näher an den Schlummernden und vollbrachte es, seinen wagemutigen Freudenspender diesmal bis zur Hälfte hineinzubohren. Sein holder Buhle aber erwachte nicht und schlief still wie ein Unschuldslämmchen, lediglich sein Schwänzchen wedelte fröhlich hin und her. Heinz grübelte, wovon Otto wohl während dieses Nachtbesuchs träumte, und darüber quollen die Sahnehäubchen abermals aus seinen Lenden.
»Es kitzelt keine Feder besser als die, welche man selbst führt«, sagte Heinz zu sich und war mit dem nächtlichen Werk zufrieden. Als er ins Dorf kam, begegnete ihm Kunz, der ihn fragte:
»Wie ist denn dieses Kind getauft worden?«
»Halbtief«, antwortete Heinz.
»Halbtief! Was du nicht sagst! Den Namen habe ich mein Lebtag noch nicht gehört.«
Heinz ließ den Kunz stehen und sich am Kopfe kratzen. Indessen lachte er sich eins und beglückwünschte sich, in derart kluge Gesellschaft geraten zu sein.
»Der eine merkt’s nicht, wenn man sich an ihm vergeht, der andere denkt nichts Arges, wenn man ihm den Rücken zudreht«, feixte er.
Dem lüsternen Heinz juckte der Freudenspender bald wieder nach Ottos feuchten Spalt, und was den holden Schlafenden in zwei Nächten nicht geweckt hatte, würde ihn auch das dritte Mal gewiss nicht stören.
»Aller guten Dinge sind drei«, sprach er zum Nebenbuhler, »da soll ich wieder Gevatter stehen, das Kind ist ganz blass und hat bloß weiße Glieder, sonst kein Haar am ganzen Leib, das trifft sich alle paar Jahr nur einmal! Du stimmst mir doch zu, dass ich ausgehen muss?«
»Anstoß! Halbtief!«, antwortete Kunz. »Es sind in deiner Familie so kuriose Namen, die machen mich ganz nachdenklich.«
»Du sitzest eben bloß daheim auf deiner dunkelgrünen Ofenbank«, sprach Heinz, »und kommst kaum noch unter die Leute. All das üble Grübeln rührt daher, wenn man bei Tage nicht ausgeht.«
Der Kunz verharrte treu und tatenlos im Dorfe, der gierige Heinz aber lief geschwind den Berg hinauf zur Kapelle, warf sich neben den Schlafenden und meinte zu sich selbst:
»Wenn erst der Eingang in seiner ganzen Tiefe erobert ist, kann ich meine Ruhe haben.«
Der holde Otto blieb erneut ohne Sinnen und gewahrte kaum der Freuden, die ihm Heinz spendete; der hatte umso mehr Lust daran und fuhr nun vollständig in die enge Spalte ein. Satte, dicke Tropfen ließ er darinnen und beinahe wäre er vor selbstgefälliger Zufriedenheit in der Kapelle eingeschlafen und am Morgen von Otto aufgefunden worden, hätte er sich nicht zusammengerissen. Erst gegen Mittag fand Heinz den Weg nach Haus. Kunz fragte gleich nach dem Namen, den das dritte Kind bekommen hätte.
»Er wird dir wohl auch nicht gefallen«, sagte sein Nebenbuhler, »denn er heißt Ganzdrin.«
»Ganzdrin!«, rief Kunz. »Das ist der allerbedenklichste Name, er ist mir noch nicht vorgekommen. Ganzdrin! Was soll das bedeuten?«
Er schüttelte den Kopf, steckte die Hände in die Taschen und ging gedankenvoll seiner Geschäfte nach. Von nun an wollte niemand mehr den Heinz zum Gevatter bitten und die drei Wochen waren herum. Da war die Zeit herangekommen, dass Otto die Kapelle verließ und den Berg hinabstieg. Da gedachte Kunz der Abmachung und sprach:
»Komm, Heinz, wir wollen den holden Otto empfangen und fragen, wen von uns er erwählt hat.«
»Jawohl«, antwortete jener, »du leckst ja bereits deine Lippen nach ihm, als ob du seiner heißen Küsse sicher wärst.«
Sie machten sich auf den Weg und trafen auf Otto, der sie herzlich grüßte und doch ein trauriges Gesicht machte. Heinz und Kunz fragten nach dem Beweggrund und der Einsiedler jammerte über das trostlose Leben auf dem Berg, welches nur durch süße Träume erträglich gewesen sei.
»Die lange Zeit dort droben allein hat meine Sehnsüchte nach einem Buhlen gesteigert, mir aber jeglichen Rat verwehrt«, sprach er. »So will ich mich für denjenigen entscheiden, der mir meine Unschuld geschickter raubt.«
Er warf sich die Kleider vom Leibe und stand im Sonnenlicht, all seine Reize und seine Jugend zur Schau stellend. Seine Verehrer zögerten nicht und fielen über ihn her. Als es jedoch darum ging, wer der feuchten Einladung des Gesäßes schneller folgen konnte, stellte Kunz fest, dass sein Freudenspender nicht so recht in den Eingang passen wollte. Heinz stieß ihn zur Seite, setzte den seinigen an und rutschte ohne jede Schwierigkeit hinein. Da stöhnte der holde Otto laut:
»Oh Heinz, du passt meisterlich in mich rein! Dein Anstoß ist schmerzfrei, die Hälfte meines engen Spalts eroberst du mit Leichtigkeit und dich ganz drin zu spüren, lässt mein Schwänzchen von allein wedeln! Dich, mein Lieber, will ich mir zum Buhlen wählen. In dein Haus ziehe ich, um jeden Abend mit Hingabe deinen Fleiß zu lohnen.«
»Ach«, sagte da Kunz traurig, »jetzt merke ich, was geschehen ist. Jetzt kommt es an den Tag, du bist mir ein wahrer Freund! Heimlich vergangen hast du dich an dem Schlafenden, als du zu Gevatter gestanden bist: Erst versuchtest du die ersten Anstöße, dann stecktest du deinen Freudenspender bis zur Hälfte in ihn hinein und zuletzt warst du…«
»Willst du schweigen«, rief Heinz. »Noch ein Wort, und es setzt was!«
»…ganz drin«, hatte Kunz bereits auf den Lippen, und kaum war es heraus, so tat Heinz einen Satz nach ihm und drosch ihm die Faust ins Gesicht, auf dass er nie wieder Schimpf und Schande über ihn verbreiten sollte. Siehst du, so geht es in der Welt!

Zum Otto gewandt aber sagte der Heinz:
»Wir wollen nun heiraten und einen zünftigen Polterabend ausrichten.«
»Ja«, antwortete Otto, »und das ganze Dorf soll kommen und auf unser Wohl anstoßen.«
Alsbald war die Feier auf Heinzens Hof ausgerichtet und jedermann aus dem Dorfe kam, schüttelte dem Paar die Hände und beglückwünschte sie zu ihrem Schritt. Da gab es süßen Wein und frisches Bier, fetten Schweinebraten und zarte Hühnerbeinchen für allesamt. Wenngleich Kunz in dem Wettstreit um die Buhlschaft den Kürzeren hatte ziehen müssen, ließ er es sich nicht nehmen, der Feier beizuwohnen. Als zum dritten Male die Krüge zum Prosit gehoben und geleert worden waren, sagte Heinz zu seinem Schatz:
»Otto, geh in den Keller und hol mir frisches Bier.«
Da nahm der holde Otto den Krug, ging in den Keller und setzte sich aufs Stühlchen vor das Fass, damit er sich nicht zu bücken brauchte, denn das, so meinte er, würde er in den kommenden Nächten noch genug tun. Er stellte den Krug unters Fass, drehte den Hahn auf und merkte während der Zeit, wie das Bier hineinlief, nicht den Kunz, der ihm nachgeschlichen war und nun sagte:
»Ts, ts, ts – armer Otto, oh armer Otto!«
Der Angesprochene schaute sich nach der Stimme um, und als er Kunz entdeckt hatte, fragte er ihn, was seine Worte bedeuten täten. Aber Kunz schüttelte nur den Kopf und seufzte wiederum:
»Armer Otto, oh armer Otto. Wo mag das alles nur enden?«
»Nun sprich, was du damit meinst, und schau nicht so traurig drein, Kunz!«, bat Otto, und Kunz trat an ihn heran und flüsterte ihm Bedenkliches zu:
»Da sitzest du hier und tränkst deinen Heinz mit einem Krug Bier nach dem anderen. Weißt du nicht, was dadurch bald geschehen wird? Dein Heinz wird einen dicken Bierbauch kriegen. Und kriegt er einen dicken Bierbauch, so wird er mit seinem Freudenspender nimmer mehr an deinen Eingang heranreichen und kein Anstoß wird mehr erfolgen, geschweige denn, dass er ganz drinnen ist. Und wenn er nimmer an deinen Eingang heranreicht, musst du dir heimlich einen Fremden suchen, der dies an seiner statt tut. Und wenn du dir heimlich einen Fremden gesucht hast, so ist dies ein Fehltritt, der deinem Heinz das Herz bricht. Und ist deinem Heinz das Herz gebrochen, gibt es keinen mehr im Hause, der dich vor Raub und Unfall bewahren kann. Und gibt es keinen mehr im Haus, der dich vor Raub und Unfall mehr bewahren kann, wer weiß, was jener Fremde, den du gesucht, dir antun wird!«
Der holde Otto bedachte sich diese Worte, und weil Kunz sie gut und klug gesprochen hatte, glaubte er gleich, dass alles nur so kommen könne und nicht anders. Da ward der Jungvermählte empfindlich, fing an zu weinen und jammerte:
»Wenn ich den Heinz kriege und ich bringe ihm Bier, so bekommt er einen Bierbauch und spendet mir nimmermehr Freude, und ich muss ihm mit einem Fehltritt das Herz brechen und dann ist keiner mehr da, der mich vor Raub und Unfall bewahren kann!«
Heinz wartete derweil oben auf den Trank, aber Otto kam nicht. Da sprach er zu seiner Schwester:
»Geh doch in den Keller und sieh, wo mein Buhle bleibt!«
Seine Schwester ging und fand ihn vor dem Fasse sitzend und laut schreiend.
»Otto, was weinst du?«, fragte sie.
»Ach«, antwortete er, »soll ich nicht weinen? Wenn ich den Heinz kriege und ich bringe ihm Bier, so bekommt er einen Bierbauch und spendet mir nimmermehr Freude, und ich muss ihm mit einem Fehltritt das Herz brechen und dann ist keiner mehr da, der mich vor Raub und Unfall bewahren kann!«
Da sprach die Schwester:
»Was bist du für ein kluger Otto!«
Und sie setzte sich zu ihm und fing ebenfalls an, über das kommende Unglück zu weinen. Über eine Weile, als weder seine Schwester noch Otto wiederkamen und er selbst durstig nach dem Trank war, sprach Heinz zu seinem besten Freund:
»Geh doch hinunter in den Keller und sieh, wo Otto und meine Schwester bleiben.«
Der Freund ging hinab und fand Otto und die Schwester, wie sie zusammen weinten. Da fragte er:
»Was weint ihr denn?«
»Ach«, antwortete Otto, »soll ich nicht weinen? Wenn ich den Heinz kriege und ich bringe ihm Bier, so bekommt er einen Bierbauch und spendet mir nimmermehr Freude, und ich muss ihm mit einem Fehltritt das Herz brechen und dann ist keiner mehr da, der mich vor Raub und Unfall bewahren kann!«
Da ward dem Freunde das Herz gerührt und er sprach:
»Was bist du für ein kluger Otto!«
Er setzte sich zu ihnen und fing auch an, laut zu heulen. Oben wartete man auf ihn, und als der Freund nicht zurückkehren wollte, sprach Heinz zu seiner Mutter:
»Geh doch hinunter in den Keller und sieh, wo Otto, meine Schwester und unser guter Freund bleiben!«
Die Mutter stieg hinab und fand alle drei in Wehklagen. Als sie nach der Ursache fragte, erzählte ihr Otto abermals, dass Heinz dick werden würde und er ihm darum das Herz werde brechen müssen, woraufhin er selbst Raub und Unfall wehrlos ausgesetzt sein werde. Da sprach die Mutter gleichfalls:
»Ach, was bist du für ein kluger Otto!«
Und sie setzte sich hin und weinte mit. Heinz wartete oben noch ein Weilchen. Als aber seine Mutter nicht wiederkam und sein Durst nach frischem Biere immer stärker ward, sagte er zu sich:
»Ich muss nun selbst in den Keller gehen und sehen, wo sie alle bleiben!«
Als er hinabgestiegen war und sah, wie sie alle beieinandersaßen und weinten, fragte er nach der Ursache. Und wie er hörte, dass sein eigener Bierdurst ihm den Otto abspenstig machen und das Herz brechen solle, erkannte er, in welch kluge Gesellschaft er da geraten war und konnte nicht umhin, laut aufzulachen.
»Ich hab schon viel in der Welt gesehen«, sagte er, »aber noch nie einen Grünschnabel, welcher derart törichte Gedanken hat, die von purer Einfalt strotzen, und der mit seiner Empfindlichkeit alle anderen anstecken kann! Nein, Otto, einen wie dich kann ich nicht zum Buhlen haben, wenn ich nicht vorher drei Dummköpfe treffe, die noch törichter, noch einfältiger und noch empfindlicher sind als du!«
Nun war Heinz keiner, der solcherlei Worte in den Wind sprach. Er setzte sich auf sein Pferd, um wahrhaftig durchs Land der lila Liebeslust zu reiten, auf der Suche nach drei Kerlen, die den Otto übertreffen konnten. Kunz allerdings, der die ganze Zeit über hinter dem Fass gehockt und sich versteckt hatte, frohlockte insgeheim.
»Findet er niemanden, der sich mit unserem holden Otto messen kann, wird Heinz ihn schmähen«, meinte er, »ich aber werde ihn hernach umso leichter für mich gewinnen.«
Heinz ritt auf seinem Pferd dahin und kam nach drei Tagen an das Haus eines Mannes, der ein Seil über den Mast der Laterne warf, die an seiner Außenwand angebracht war. Ein Ende des Seils band er um seinen entblößten Freudenspender, das andere Ende nahm er in seine Hände und zog daran. Heinz hielt mit seinem Ritt inne und fragte den Mann, was er mit diesem Vorhaben bezwecke.
»Nun, schau her«, sprach jener, »mit jedem Male, wie ich am Seil ziehe, verengt sich der Knoten um meinen Spender. Der wird dadurch immer dicker und dunkler. Eben dies gefällt mir außerordentlich gut. Darum stehe ich hier Abend für Abend, bevor ich meine Laterne entzünde, und knautsche an mir, bis das angestaute Blut meinen Freudenspender derart empfindlich gemacht hat, dass eine einzige Berührung ihn zum Zucken und Spucken bringt!«
»Was bist du töricht«, rief Heinz aus. »Du brauchst solch einen Seilzug nicht, noch dazu in aller Öffentlichkeit! Leg das Seil einfach um deinen Spender und zieh an beiden Enden mit den Händen. Das kommt aufs selbe raus, und du kannst dies im stillen Kämmerchen tun, wann immer dir danach ist.«
Nachdem er diesen Rat gegeben hatte, setzte Heinz seinen Weg fort. Aber der Mann bestand darauf, dass seine Handhabe die klügere sei, und zog weiter am Seil, welches über den Laternenmast hing. Sein Freudenspender verdickte und verdunkelte sich auf wahrhaft eindrucksvolle Weise, das Eisen des Mastes aber scheuerte am Seil, bis es riss. Heinz sah von Weitem noch, wie der Mann mit seinem dicken Spender heulend vor dem Hause stand und nicht wusste, wie er nun sein ersehntes Zucken und Spucken herbeiführen sollte.
»Der ist ja noch törichter als jemand, der einen Fehltritt als schicksalhafte Bestimmung ansieht«, meinte Heinz und hatte den ersten Dummkopf gefunden.
Er ritt weiter, immer der Nase nach, bis er an ein Wirtshaus kam, wo er die Nacht zubringen wollte. Da das Wirtshaus gut besucht war, musste er sich das Zimmer mit einem anderen Reisenden teilen, der ein junger Spund war, aber angenehm und liebenswürdig im Umgang. So verbrachten sie den Abend freundschaftlich miteinander, aber am nächsten Morgen, als sie aufstanden, war Heinz sehr überrascht, den anderen weinend zu sehen.
»Warum laufen dir denn die Tränen über die Wangen, junger Freund?«, fragte er besorgt.
Der andere nahm sein Taschentuch und wischte sich das Gesicht trocken.
»Was soll ich nicht weinen? Jeden Morgen erwache ich mit einem harten, aufgerichteten Schwänzchen und muss es, damit’s in die Hose passt, mit den Händen umschlingen. Viele Male hintereinander muss ich dann das Becken schwingen – vor, zurück, vor, zurück – bis es wieder klein ist. Dabei packt mich jedoch die pure Erschöpfung und der Rücken beginnt, fürchterlich zu schmerzen.«
Heinz aber dachte sich nur:
›Der ist ja noch einfältiger als jemand, der glaubt, ein Bierbauch könne den Spender daran hindern, ganz drinnen Freude zu spenden.‹
Zum Zimmergenossen gewandt aber sprach er lachend:
»Du dummer Junge scheinst ja gar nicht zu wissen, wie man mit einem harten Schwänzchen umzugehen hat! Lass dir vormachen, wie’s angeht. Schau nur! Das Umschlingen ist der rechte erste Schritt, doch der zweite ist das Auf und Ab der Hände, nicht das Vor und Zurück des Beckens. Siehst du, wie gemütlich ich in meinem Bette liege, während meine Finger die fleißige Arbeit verrichten? Kein Rücken kann mich schmerzen und es droht kaum Erschöpfung. Stattdessen, du wirst es gleich erschauen, gibt es ein fröhliches Wedeln und helle Häubchen springen aus den Lenden, mir zum morgendlichen Genusse.«
Der Jungspund war schier begeistert von dieser Lehrstunde und versprach, Heinz sogleich zu zeigen, was er gelernt hatte. Er legte sich aufs Bett, griff nach seinem Schwänzchen und arbeitete tüchtig mit den Händen, bis alles hübsch wedelte, wie es sich gehört.
»Niemals hätte ich gedacht, dass man sich selbst eine solche Freude machen kann«, gab der Junge danach zu. »Ich stehe tief in deiner Schuld und bin dir zu großem Dank verpflichtet. Fortan werde ich jeden Tag auf diese Weise beginnen.«
Heinz verabschiedete sich von ihm und wusste, dass er in dem Jungspund den zweiten Dummkopf gefunden hatte. Er stieg auf sein Pferd und ritt wieder durchs Land; und er kam in ein Dorf und hinter diesem Dorf lag ein Teich. An dem Teich standen zwei halbnackte Kerle, und von denen heulte einer laut und herzzerreißend, während der andere ihn vergeblich zu beruhigen versuchte. Neugierig geworden, lenkte Heinz sein Pferd zu jenen Zweien und fragte, was los sei.
»Mein Buhle ist angeblich hierher zum Fischen gekommen«, schluchzte der weinende Kerl, »aber ich ahnte, dass er mich hintergehen will, also folgte ich ihm. Und wie ich ins Wasser blicke, sehe ich darin einen anderen Mann, der gewisslich ins Wasser getaucht ist, um dort auf meinen Buhlen zu lauern. Er bietet sich ihm regelrecht an, halbnackt wie er ist. Die beiden haben ein heimliches Stelldichein und ich soll der Betrogene sein!«
Heinz tat einen Blick in den Teich, sah dort aber nichts als sein eigenes Spiegelbild, denn die Wasseroberfläche war glatt und die Sonne schien hell. Wie er aber erklären wollte, dass der heulende Kerl wohl nur seine eigene Spiegelung im Wasser gesehen haben müsse, begann jener, nun ausgerechnet ihn anzuklagen:
»Wahrscheinlich bist du es, der mir meinen Buhlen stehlen will? Ans andere Ufer bist du getaucht, hast dich angekleidet und bist mit deinem Pferd hergeritten, um ganz unschuldig zu tun. Was seid ihr Männer doch schäbig zu mir!«
Weder Heinz noch der andere Kerl konnten die Tränen zum Versiegen bringen, und so schnalzte unser Reiter mit der Zunge und ritt auf seinem Pferde davon. Nachdem das Dorf und der Teich weit hinter ihm lagen, sagte er zu sich:
»Der war ja noch empfindlicher als jemand, der über die ferne Zukunft heult.«
Damit hatte Heinz den dritten und letzten Dummkopf gefunden. Zufrieden kehrte er zurück zu seinem holden Otto, hielt Hochzeit mit ihm und erfreute sich daran, jeden Morgen mit ihm tüchtig zu wedeln, mittags mit ihm am Teich zu fischen und abends enge Knoten um die Freudenspender zu ziehen, damit sie dick und dunkel zuckten. Am schönsten war es aber nachts, wenn er ohne Heimlichtuerei anstoßen durfte, halb tief eindrang und ganz drinnen die höchsten Freuden spendete. Und wenn Kunz kein zweites Mal dazwischengefunkt hat, so leben Heinz und Otto noch heute glücklich miteinander.
***
Wir loben den Einfallsreichtum Basils und staunen, wie er auf sinnvolle Weise den bekannten Hergang des schlichten Märchens verändert und erweitert hat. Nur Wilko bleibt skeptisch.
»Was sich dein Heinz am Anfang der Geschichte geleistet hat, ist nichts anderes als eine Vergewaltigung«, sagt er ernst. »Du verharmlost den Missbrauch, dem manch schlafender Mensch ausgeliefert ist!«
»Hoho, der Professor Groll hat gesprochen«, spöttelt Basil. »Er kennt wohl den Unterschied zwischen Fiktion und Wirklichkeit nicht.«
»Basil Thompson, ich dulde an diesem schönen Abend keine bissige Ironie«, tadelt Giovanni und Basil verstummt. »Aber ich gebe dir in einem Punkt recht: Märchen sind Produkte der Fantasie und daher darf man darin Dinge erzählen, die sich in Wahrheit nicht gehören. Danke, Wilko, dass du uns darauf aufmerksam machst, was man aus Basils Geschichte nicht lernen sollte.«
»Müsste das Märchen dann nicht anders enden?«, fragt Arne. »Heinz wurde für seinen Betrug sogar belohnt.«
»So geht es eben manchmal zu im Leben«, sagt Basil. »Ich wollte ein bisschen Realitätsnähe einstreuen.«
»Immerhin bringt uns dein Märchen zum Nachdenken und Diskutieren«, sagt Charles. »Aber wer macht jetzt weiter?«
»Ich natürlich«, ruft Margarete. »Während ihr alle die Nachspeise vertilgt habt, hatte ich ja genügend Zeit, mir was auszudenken. Mein Märchen wird dir gefallen, Wilko, es ist politisch sehr korrekt und up to date.«
Wir spitzen gespannt die Ohren und rücken näher zusammen.
Mischkind
Vor einem großen Walde lebte ein Holzhacker mit seiner Frau, die waren aber so arm, dass sie nicht mal das tägliche Brot hatten und nicht wussten, was sie morgen essen würden. Dennoch wünschten sich die beiden ein Kind, weil sie fest daran glaubten, es würde ihrem Elend ein Ende bereiten.
»Es würde unsere trüben Tage erhellen«, meinte der Holzhacker.
»Es kann uns im Alter eine Stütze sein«, meinte die Frau.
Und weil gerade der Maimond schien und die erste Frühlingshitze sie zur nahe gelegenen Quelle gelockt hatte, stand ihnen der Sinn danach, während des Bades noch einmal ihre beiden Leiber zu einem verschmelzen zu lassen in der Hoffnung, Nachwuchs zu zeugen. Da hörten sie die Wasser rauschen:
»Nimmer werdet ihr Kinder bekommen! Nimmer werdet ihr Kinder bekommen!«
Darüber wurde die Frau des Holzhackers sehr betrübt. Sie verließ das Bad und ging, ohne sich abzutrocknen oder anzukleiden, im Walde spazieren. Sie war ganz in Gedanken versunken, als ihr eine plötzlich eine Dame begegnete. Sie steckte in einem langen, kostbaren Kleid, welches über und über mit Diamanten, Rubinen und anderen glitzernden Steinen bestickt war. Ihr blaues Haar rahmte ihren runden Kopf in dicken Locken ein und ihre Augen leuchteten genauso freundlich wie die Zähne ihres breiten Mundes. Sie trat zu der armen Frau und fragte mit einer Stimme, die wundersam tief klang:
»Warum läufst du barbusig und traurig hier umher, wo doch der Maiwuchs allenthalben zur Freude einlädt?«
Die Frau des Holzhackers blickte auf und erwiderte:
»Ach, es hat keinen Zweck, wenn ich Euch das sage. Ihr könnt mir doch nicht helfen.«
»Oh, das ist gar nicht so sicher«, sagte die Dame und bat die Frau, es ihr doch zu verraten.
Da willigte die andere ein und erzählte der Dame, was die Wasser zu ihr und ihrem Manne geflüstert hatten, eben dass sie keine Kinder haben sollten. Und deshalb sei sie so traurig.
Da würde sie schon Rat schaffen, meinte die Dame und riet:
»Am Abend, wenn die Sonne untergeht, sollst du einen Krug nehmen und ihn in der Nordwestecke deines Gartens umstülpen. Danach gebe dich deinem Gatten hin, dass er dich beschläft. Am nächsten Morgen, wenn die Maiensonne aufgeht, nimmst du den Krug wieder hoch. Dann wirst du eine Rose darunter sehen, die rosarot blüht. Wenn du nun die rosarote Blüte nimmst und isst, wirst du ein Mädchen gebären. Wählst du aber statt der Blüte das lange, dicke grüne Blatt, dann wird es ein Knabe. Aber wisse: Du darfst nicht beides zugleich essen! Dann wirst du empfangen.«
Die Frau des Holzhackers wollte den guten Rat beherzigen, lief zurück zur Quelle und erzählte ihrem Manne alles. Wie sie nun nach Hause kamen, nahmen sie einen Krug, gingen in den Garten und machten alles, wie die Dame es gesagt hatte. Des Nachts konnten beide nicht schlafen und berieten, welchen Teil der Rose die Frau nun essen solle.
»Wenn’s eine Tochter wäre, würde sie tanzen und singen und mit unserem Holzbesteck wie mit Puppen spielen«, sagte der Holzhacker und schlang seine starken Arme um seine Frau.
»Wenn’s ein Sohn wäre, könnte er dir zur Hand gehen und wir würden zweimal so viel Holz verkaufen können«, sagte die Frau und schlang ihre zarten Beine um ihren Mann.
»Wenn’s eine Tochter wäre, würde sie uns einen reichen Eidam bescheren und wir wären unserer Sorgen los«, sprach der Holzhacker und presste seinen Maibaum tief in seine Frau.
»Wenn’s ein Sohn wäre, brächte er gar eine fleißige Schnur ins Haus, die mir die Arbeit abnimmt«, sprach die Frau und zog ihren blühenden Maienkranz weit auseinander.
Und so stritten ihre Zungen, ob sie nun lieber einen Sohn oder eine Tochter haben wollten, während ihre Leiber einander Wohltat um Wohltat erwiesen. Schließlich hatte der Holzhacker einen Einfall und schlug vor, sie sollten sich sowohl einen Buben als auch ein Mädchen wünschen.
»Somit werden wir gewiss mit Zwillingen gesegnet und doppeltes Glück kehrt in unsere Stube ein!«
Die Frau war einverstanden, und so schritten beide tapfer jenem Ziele der fleischlichen Vereinigung entgegen, welches dem Manne erlaubte, die Feuersbrunst seiner Lenden wie einen glühenden Ball in die Ferne zu schießen, und dem Weibe gestattete, Sturmwehen des Föhns in ihrem Schoße einzulassen, um das letzte Wintereis darinnen zum Schmelzen zu bringen. In der Brust aber blieb dem Holzhacker der Wunsch nach einem Töchterlein verhaftetet, der Frau hingegen war das Herz voller Sehnsucht nach einem Sohne.
Am anderen Morgen, als sich die Sonne erhob, lief die Frau wieder in den Garten und hob den Krug hoch. Da stand dort wirklich eine blühende Rose. Sie erinnerte sich an die Worte ihres Mannes, nahm also die rosarote Blüte und das grüne Blatt und aß beides. Es schmeckte ihr ausgezeichnet und sie dachte bei sich, wenn sie nun Zwillinge bekäme, dann wäre sie zweifach gesegnet und die Dame aus dem Walde brauchte das ja nicht zu wissen.
Und ob’s nun die laue Mainacht war, der Zauber der Rose oder irgendetwas anderes – des Holzhackers Weib ward bald darauf gesegneten Leibes. Im folgenden Winter kreißte sie und kam, aller Hoffnungen zum Trotz, mit nur einem Kinde nieder. Wiewohl es auf den ersten Blick gesund zu sein schien, offenbarte sich den frischen Eltern schon beim zweiten die ungeheuerliche Erfüllung ihres Wunsches: In diesem einen Kinde hatten sie wahrhaftig sowohl Sohn als Tochter, denn dort, wo das Geschlecht des Menschen eindeutig zu erkennen ist, wuchsen ihm Bubenmal ebenso wie Mädchenzug.
»Unser Herzenswunsch war anmaßend und sündig«, rief die Frau erschüttert aus. »Weil wir mit dem einen nicht zufrieden sein konnten und uns auch das andere herbeisehnten, ist dieses Kind nun mit Makel und Schande gestraft. Ach, hätte ich von der Rose doch besser nicht einen einzigen Bissen genommen!«
Die Eltern weinten und jammerten, doch all ihr Klagen nützte nichts; der Unterleib des Kindes blieb mit beiderlei Geschlecht behaftet. Da wuchs in ihnen die Furcht vor den Freunden und Nachbarn.
»Werden sie dem Kind nicht mit Hohn und Spott begegnen, wenn sie erst sein Geheimnis erfahren?«, fragte sich der Holzhacker. »Wird nicht gar ihr Argwohn geweckt, das Unglück könne sie und ihre Kinder anstecken?«
»Ehe sie uns mit Verdammnis drohen«, warf seine Frau ein, »nimm das Kind und trag’s in den Wald. Noch ist es zu klein, um Leid zu kennen. Erlöse es dort von der Aussicht auf ein bitteres Leben.«
Der Holzhacker nahm also das Kind mit zweierlei Geschlecht auf seinen Arm, ging mit ihm in den Wald, wo er einst mit seiner Frau in der Quelle gebadet hatte, und wollte es dort ertränken. Da kam ein Wagen aus dem Dickicht auf ihn zu, der schillerte von vielerlei Farben. Vier Pferde zogen ihn, deren lange Mähnen und Schweife in ihrer Farbenpracht dem Wagen in nichts nachstanden. Sie hielten vor dem Holzhacker und der Wald, so dunkel er eben noch war, leuchtete in ihrem Umkreis hell und freundlich. Eine Dame stieg aus dem Wagen, die steckte in einem kostbaren Kleid voller Diamanten und Rubine. Blaue Locken umgaben ihr freundliches Gesicht. Da wusste der Holzhacker, dass es dieselbe Dame war, die neun Monate zuvor seine Frau getroffen hatte. Sie trat zu dem armen Mann und sprach mit einer Stimme, die rauchig aus ihrem Adamsapfel brummte:
»Du kennst mich nicht, Holzhacker, aber ich bin eine gute Fee, die sich um all die sonderlichen Seelen kümmert, die keiner haben will. Du bist arm an Geld und dürftig an Mut und Verstand. Dein Weib ist unstet und töricht. Hättet ihr meinen Rat doch aufs Wort befolgt! Gib mir nun euer Kind, ehe du es tötest, und ich will es mit mir nehmen und für es wie eine Mutter sorgen.«
Der Holzhacker gehorchte, denn er glaubte, dies sei die rechte Rettung vor der vermeintlichen Schmach. Dankbar reichte er der fremden Fee sein Kind und die nahm es mit sich in den Wagen. Die Pferde zogen an und trabten, ohne dass Kutscher oder Peitsche nötig wären, durchs Dickicht zurück in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Der Vater schaute noch hinterher, solange er etwas von den hellen Farben erkennen konnte. Anschließend seufzte er, wie von einer großen Last befreit, und ging heimwärts.
Die Kutsche indessen fuhr aus dem Walde und einer großen Wiese zu, in deren Mitte sich ein wunderschöner, bunter Palast befand. Das Tor inmitten der gewölbten Mauer war von einem goldenen Rahmen umsäumt, der dick und schwülstig war wie die Lippen eines wohlgenährten Kindes. Das Tor selbst glich einem eiförmigen Spalt. Links und rechts der Mauern waren runde Türme angebracht, die breit und dick wirkten und deren runde Kuppeln violett in der Sonne glänzten. Auf jeder Kuppel prangte eine weiße Perle, so groß, dass man sie schon von Weitem erkennen konnte. Hinter der Mauer standen zwei riesenhafte Walnussbäume und das Laub ihrer Kronen war gleichmäßig geschnitten, sodass sie wie grüne Bälle wirkten. In ihrer Mitte ragte ein hoher Turm empor, viel schlanker und höher als die beiden anderen. Seine Spitze ähnelte einer Zipfelmütze, nur war sie nicht rot, sondern von feinem Silber. Der Efeu rankte sich wie Adern an der Mauer hoch und gab ihr ein eigenartiges Ornament zur Zier. Wie die Kutsche herankam, öffnete sich das Tor von selbst und die Pferde schlüpften samt Wagen durch den Spalt. Die Fee stieg aus, noch immer das Kind auf dem Arm, und betrat das Innere ihres Palastes, wo es dem Kleinen fortan wohl erging. Mit Zuckerbrot und süßer Milch wurde es gefüttert, seine Kleider waren von Gold und viele kleine Spielsachen gehörten ihm.
Die Jahre vergingen und es wuchs auf in dem Glauben, die freundliche Fee wäre ihm eine Mutter, und als es sprechen konnte und einen Namen brauchte, wurde es Mischkind genannt. Obgleich von klugem Verstande, fragte das Kleine niemals, warum es jenen seltsamen Namen trug, und es traf niemals andere Kinder. Weil es nun glaubte, es gäbe niemanden auf der Welt als die Fee, vermisste es auch niemals die Gesellschaft der Menschen oder empfand Sehnsucht nach der Welt draußen vor dem Palast. Als Mischkind schon fast zwei volle Jahrzehnte in dem bunten Palast gelebt hatte, rief es einmal die Fee zu sich und sprach:
»Liebes Kind, ich habe eine große Reise vor. Da nimm die Schlüssel zu allen Türen des Palastes in Verwahrung. Sieben davon darfst du aufschließen und die Herrlichkeiten darin betrachten, aber die letzten fünf, wozu dieser kleine Schlüssel gehört, die sind dir verboten! Hüte dich, sie aufzuschließen, sonst wirst du unglücklich.«
Das Mischkind versprach, gehorsam zu sein, und als nun die Fee weg war, fing sie an und besah die Kammern des Palastes. Jeden Tag schloss es eine auf und entdeckte eine noch größere Herrlichkeit. In der ersten Kammer lagen Schätze, zu Schmuck und Zierrat geformt, in Kästchen und Truhen und erfreuten das Auge. In der zweiten Kammer erklang himmlische Musik. In der dritten Kammer waren Pflanzen und Blumen jeglicher Form und Größe angeordnet, und jede einzelne sandte ihren Geruch in ein betörendes Duftgemenge. Hinter der vierten Türe befanden sich Stapel dicker Bücher voll wertvollem Wissen. In der fünften Kammer fand Mischkind wunderbare Kleider und Röcke, Mäntel und Hüte, mit denen es sich schmücken konnte. In der sechsten Kammer war ihm ein Festessen bereitet mit Fleisch jeglicher Art, frischem Fisch, leuchtendem Obst und schmackhaften Gemüse, aber auch süßen Kuchen und Torten. In der siebten Kammer endlich stand wohl das größte und weichste Bett der Welt, in das Mischkind sich kuschelte und die abenteuerlichsten Träume genoss. Als die sieben Türen aufgeschlossen waren, freute sich Mischkind über all die Pracht und Herrlichkeit und verbrachte seine Tage mal hier, mal da. Mit der Zeit aber fiel ihm ein, dass nun noch fünf verbotene Türen übrig waren. Da empfand es eine große Lust zu wissen, was dahinter verborgen wäre. Zunächst verhielt es sich still und blieb den Türen fern, doch der kleine Schlüssel klimperte in seinem Täschchen und die Neugierde klimperte in seinem Herzen und nagte und pickte ordentlich daran und ließ ihm keine Ruhe. Schließlich sprach es zu sich:
»Ganz aufmachen will ich sie nicht und will auch nicht hineingehen, aber ich will sie aufschließen, damit ich ein wenig durch den Ritz sehen kann. Ich bin ja ganz allein und es weiß es ja niemand, wenn ich’s tue.«
Es suchte den Schlüssel heraus und sobald es ihn in der Hand hielt, steckte es ihn auch schon in das erste verbotene Schloss, und als es ihn hineingesteckt hatte, drehte es auch um. Da sprang die Türe auf und es erblickte ein Fest, an dem eine Gruppe Edelritter teilnahm, die auf einem aufgerollten Teppich alle Arten von Speise und Trank zu sich nahmen und dabei völlig unverhüllt waren. Trunkene Paare boten sich seinen Augen: Dort teilten zwei junge Ritter die Liebkosungen eines älteren Geliebten, gaben ihm gemeinsam wieder, was er jedem einzeln schenkte; hier lagen zwei umschlungen und erschöpft; dort rüstete sich ein Paar zu neuem Liebeskampfe. Alle in der Kammer wiesen den gleichen baumähnlichen Stamm auf, wie Mischkind ihn selbst in seiner Mitte trug; nicht aber den Garten dabei. Als die Gruppe des Mischkindes ansichtig wurde, mischte sich das Feuer der Becher mit ihrem Blut und der Älteste rief:
»Seht den neuen Jüngling! Unser Ehrengast soll er sein und unsere Sinne soll er erfrischen. Komm her zu uns und lass dich hier auf dem weichen Teppich nieder.«
Mischkind trat zu ihnen und wurde sogleich von unzähligen kräftigen Armen umschlossen, die es zum ersten Mal die Leibesliebe fühlen ließen. Unbekannte Leidenschaft durchglühte seine Adern, rasch ward es entkleidet und tauchte in den Fluten all der Mannheit unter. Die Laute der Küsse klangen wie Musik und die hitzigen Leiber tranken in langen Zügen den Liebeswein, den die Edelritter einander spendeten. Mischkind war entzückt und fühlte sich wohl und geborgen im Kreis ihrer Horde, aber insgeheim dachte es:
»Diese Ritter verwöhnen nicht meinen gesamten Leib. Es bleibt jener versteckte Garten unbeachtet, den nur ich besitze, nicht aber sie. Sollte er nutzlos sein?«
Das betrübte Mischkinds Herz und es entfernte sich von der Gruppe, um das kleine Schlüsselchen in die zweite verbotene Tür zu stecken. Dahinter nun erwartete es ein Schwarm Jungfern, die dort ihr Lager auf Kissen und Blumen hatten. Ihre Gewänder waren offen und schleiften auf dem Boden, den feinen Busen preisgebend. Die Luft war angereichert mit aufreizenden Gerüchen. Die Jungfern gebärdeten sich ebenso freudig wie vormals die Ritter, als sie Mischkind erblickten.
»Seht unsere neue Gespielin! Lasst uns ihr von der Einsamkeit ausgetrocknetes Gärtlein besprengen!«
Sie warfen sich ihm an den Hals und Mischkind verging in Wollust, dass seine Tulpenwangen leuchteten. Reichte es einer Jungfer seinen Mund, wurde es von der nächsten anderswo am Leibe mit weichen Lippen berauscht. Nach einer Weile aber dachte Mischkind:
»Diese Gespielinnen verwöhnen nicht meinen gesamten Leib. Jener Baumstamm, den in diesem Kreis nur ich besitze, nicht aber sie, bleibt unbeachtet. Sollte er nutzlos geworden sein? Was sie mit ihren Fingern tun, könnten sie ebenso mit meinem Stamme bewältigen, aber sie scheuen sich wohl vor der Form und Größe.«
Das betrübte Mischkinds Herz aufs Neue und es entfernte sich von dem Schwarm, um nunmehr die dritte verbotene Tür zu probieren. Dort fand sie eine Schar Damen vor, die saßen rings um einen sprudelnden Springbrunnen und juchzten:
»Endlich besucht uns ein Jüngling, wo wir der Liebeswonne schon ewig darbten. Reiche uns deinen frühlingsholden Maibaum dar!«
Und Mischkind wurde von wogenden Brüsten umhüllt und musste seinen Stamm in blühende Rosen stechen. Seine Wollust entzückte sich abermals und war heftig wie zuvor; allein sein Verstand gewahrte, dass wiederum sein Garten übersehen wurde und nur der Baum Beachtung fand. Als die Kraft des Liebesspiels versiegte, stahl es sich aus der Damenrunde fort und öffnete die vorletzte verbotene Kammer. Dort vertrieb sich eine Horde lustiger Gesellen die Zeit mit laut schallender Musik und rauen Gesängen. In Mischkind sahen sie eine holde Maid, die sich ihnen schenkte, und sie tobten ihre Tollheit in ihm aus. Zum vierten Male wurde dabei nur eine seiner beiden Gaben begehrt, die andere blieb abermals nutzlos. Da verschloss Mischkind die Türen, wurde nachdenklich und meinte:
»Überall galt ich als hübsch, doch nirgends gehörte ich hin. Besaß ich etwas, das keiner sonst hatte, wurde es entweder übersehen oder überdeckte jenes Merkmal, das ich mit den anderen gemein hatte. Niemand jedoch glich mir völlig. Drum muss hinter der fünften Tür endlich meinesgleichen stecken.«
Und sie öffnete die Kammer, welche in der Gesamtheit aller die dreizehnte war, und fand sie beinahe leer vor. Lediglich ein großer Spiegel stand dort, der war ganz aus Elfenbein und war geformt wie der Spalt, der in Mischkinds maienlindes Gärtlein führte. Der Fuß, auf dem der kostbare Spiegel stand, besaß die gleiche Form, wie Mischkinds Stamm sie gehabt hatte, als er sich in den anderen Kammern zu einem Baum der Wollust gestreckt hatte. Nun sah es jedoch im Glas, dass er traurig zu Boden hing. Und auch Mischkinds Herz schien nach unten zu sinken.
»Hier gibt es nichts als mein Abbild im Spiegel. Wo also finde ich meinesgleichen, wenn nicht hier? Welches soll mein Platz sein?«
Über diese Fragen, auf die es keine Antwort fand, wurde Mischkind immer unglücklicher. Es blieb ein Weilchen für sich stehen und die Traurigkeit kletterte von seinem Herzen in seine Augen und blieb dort. Sie wollte auch nicht wieder weichen, es mochte weinen, was es wollte; die Trauer blieb in ihrem Blicke und ging nicht fort, es mochte die Augen waschen und reiben, so viel es wollte.
Gar nicht lange, so kam die Fee von ihrer Reise zurück. Sie rief Mischkind zu sich und forderte ihm die Schlüssel des bunten Palastes wieder ab. Als es den Bund hinreichte, blickte ihm die Fee in die Augen und fragte:
»Hast du auch nicht die verbotenen Türen geöffnet?«
»Nein«, antwortete es.
Die Fee hatte aber die Traurigkeit schon entdeckt und wusste wohl, dass es gelogen hatte. Da fragte sie noch einmal:
»Hast du es gewiss nicht getan?«
»Nein«, sagte Mischkind zum zweiten Mal.
Noch hoffte die Fee, Mischkind würde ehrlich sein, damit sie auch ehrlich zu ihm sein könne. Also fragte sie zum dritten Male:
»Hast du es nicht getan?«
»Nein«, sprach Mischkind.
Da brummte die Fee mit falscher Freundlichkeit:
»Dann wird es dir gewisslich leicht fallen zu sagen, wer du denn eigentlich bist!«
Diese Aufgabe brachte Mischkind derart durcheinander, dass es nichts erwidern konnte, denn die gleiche Frage hatte es sich ja selbst bereits gestellt. Wie es nun schwieg, sprach die Fee mit strenger Stimme:
»Du hast mir nicht gehorcht und hast noch dazu gelogen. Meine Hilfe bleibt dir fortan versagt. Ohne zu wissen, wer du bist, kannst du in meinem Palast nicht bleiben.«
Sie schlug Mischkind auf den Mund, dass es ihm die Stimme raubte, und versenkte es in einen tiefen Schlaf. Als es erwachte, lag es auf dem Waldboden mitten in einer Wildnis. Es wollte rufen, aber es konnte keinen Laut hervorbringen. Es sprang auf und wollte fortlaufen, aber wo es sich hinwendete, immer ward es von dichten Dornenhecken zurückgehalten, die es nicht durchbrechen konnte. Ein alter, hohler Baum musste seine Wohnung sein. Da kroch es hinein, wenn die Nacht kam, und schlief darin, und wenn es stürmte und regnete, fand es darin Schutz; aber es war ein jämmerliches Leben. Wenn es daran dachte, wie es im Palast so schön gewesen war, so weinte es bitterlich. Nicht lange, so zerrissen seine Kleider und ein Stück nach dem anderen fiel vom Leib herab. Mischkinds Haupthaar aber wuchs wallend und lockig und bedeckte bald den ganzen Rücken und wärmte es. Im Herbst sammelte es die herabgefallenen Nüsse und Blätter und trug sie in die Höhle; die Nüsse gereichten ihr im Winter zur Speise, und wenn Schnee und Eis kam, so hüllte es sich wie ein armes Tierchen in seine Locken, die ihm wie ein Pelz waren, damit es nicht fror. Sobald die Sonne wieder wärmer schien, ging es heraus und setzte sich vor den Baum, und seine langen Haare bedeckten es von allen Seiten wie ein Mantel. Wurzeln und Waldbeeren waren seine einzige Nahrung. So saß es ein Jahr nach dem anderen und fühlte den Jammer der Welt, und hätten die Männer und Frauen ihm in den geheimen Kammern nicht gezeigt, welch Freude einem der eigene Leib bereiten konnte, es wäre wohl an dem Elend zugrunde gegangen.
Einmal, als die Bäume wieder in frischem Grün standen, jagte der König des Landes in dem Wald und verfolgte ein Reh, und weil es in das Gebüsch geflohen war, das den Waldplatz einschloss, schickte er seine beste Jägerin hinterher. Jene riss das Gestrüppe auseinander und hieb sich mit dem Schwert einen Weg. Als sie endlich hindurchgedrungen war, sah sie unter dem Baum eine Gestalt mit wunderschönem, wallendem Haar, welches es bis zu den Fußzehen bedeckte. Die Jägerin stand still und betrachtete es. Mischkind blickte schweigend zurück, und auch wenn ihm Rettung nah zu sein schien, glänzte in seinen Augen noch immer das Unglück. Dann lüftete die Jägerin ihren Hut, dass das kurzgeschorene blaue Haar zum Vorschein kam, und fragte mit ungewöhnlich tiefer Stimme:
»Wer bist du?«
Mischkind gab keine Antwort, denn es konnte keine Antwort darauf finden, und schüttelte zum Zeichen, dass es nicht reden konnte, seinen Kopf. Da senkte auch die Jägerin den Blick und wollte bereits umkehren, als der König hinzukam; es verwunderte ihn nämlich, warum seine beste Jägerin so lange ausblieb. Wie er Mischkind gewahrte, sah er gleich seine treuen Rehaugen und sein zartes, rosengleiches Antlitz und war sofort verzaubert von ihm. Unter dem langen Haar sah er eine feine Brust, zweier Maiglöckchen gleich, hervorschimmern, und er meinte, sie müssten seinem Liebesmunde süß schmecken und nimmer wollte er die Lippen davon trennen, hatten sie sich erst den Weg dorthin gebahnt.
»Willst du mit mir auf mein Schloss gehen?«, fragte er in seiner Lust.
Da nickte Mischkind nur ein wenig mit dem Kopf. Der König nahm es auf seinen Arm, trug es auf sein Pferd und ritt mit ihm heim. Wie er auf das königliche Schloss kam, ließ er ihm schöne Kleider anziehen und gab ihm alles im Überfluss: Wein, Kuchen, Diener, Musikanten. Und ob es gleich nicht sprechen konnte, so war es doch schön und holdselig, dass er es von Herzen lieb gewann, und es dauerte nicht lange, da vermählte er sich mit ihm. In der Hochzeitsnacht öffneten seine Hände, die wie aufgeregte Maikäferchen zitterten, zuerst die Kleider und dann den Mantel aus Lockenhaar, um endlich den Weg freizumachen für die Wonne und Lust, die ein Brautlager verspricht. Seine Augen traten vor Überraschung beinahe aus den Höhlen, als er in Mischkinds Mitte beiderlei Geschlecht erblickte. Schon fürchtete Mischkind, es würde ihm schlecht ergehen, aber der König fand Gefallen an der Bereitstellung gleich zweier Liebesgaben, wo andere ihm sonst nur eine boten.
»Ich verstehe mich im Umgang mit beidem«, sagte er, und dass dies keine bloße Behauptung war, bewies er in der Hochzeitsnacht wiewohl in den kommenden drei Nächten. Seinen Stamm maß er mit jenem des Mischkinds, dessen Garten wusste er gut zu versorgen und er konnte sowohl die Kraft einer ganzen Horde aufbringen als auch die Wonnen eines zarten Schwarms hervorrufen.
Als die berauschenden Nächte verflossen waren, kam eines Tages die Mutter des Königs ins Schlafgemach und wollte dem Paar ein Bad bereiten. Sie sah mit Schrecken das Geheimnis, ekelte sich und verleumdete Mischkind beim Gericht:
»Das stumme Ding ist kein Mensch, sondern ein Ungeheuer! Es ist der Ehe mit dem König nicht würdig.«
Der König verteidigte Mischkind, weil er es so lieb hatte, aber am anderen Morgen war das Geheimnis im Volke bereits ruchbar geworden und alle Leute riefen laut:
»Die Braut ist oben Mann und unten Frau! Das darf es nicht geben!«
Wieder andere schimpften:
»Nein, die Braut ist oben Frau und unten Mann! Das darf es auch nicht geben!«
Da konnte der König seine Räte nicht mehr zurückweisen. Es ward Gericht über Mischkind gehalten und eine Richterin mit blauem Schopfe fuhr sie mit dunkler Stimme an:
»Das Volk schimpft, die Mutter des Königs ist verschreckt! Wir wissen nicht, wer und was du bist. Weißt du’s?«
Mischkind konnte es aber nicht sagen und schüttelte nur den Kopf. Weil es sich nicht verteidigen konnte, ward es zum Scheiterhaufen verurteilt. Das Holz wurde zusammengetragen, und als es an einen Pfahl festgebunden war und das Feuerholz rings umher bereitlag, kam die Henkerin in blauer Kapuze und mit brennender Fackel heran und fragte es ein letztes Mal:
»Wenn du endlich weißt, wer du bist, kann ich dich erretten!«
Da begann im Angesicht der Fackel das Unglück in den Augen Mischkinds zu schmelzen und es nickte zögerlich. Wie die Henkerin das sah, warf sie die Fackel weit von sich, nahm Mischkinds Hand und alsbald standen beide im bunten Palast. Dort führte die Henkerin Mischkind in jene dreizehnte Kammer, in welcher der elfenbeinerne Spiegel stand. Sein Glas zeigte es nackend und bloß, wie es nun einmal geschaffen war, und das Abbild fragte leise:
»Wer bist du?«
Und Mischkind antwortete ihm:
»Ich bin ich.«
Seine Stimme war dabei so laut und mächtig, dass sie den Spiegel zerspringen ließ, und die letzte Spur von Traurigkeit verschwand aus Mischkinds Augen, denn es verstand nun alles. Es drehte sich zur Henkerin hin, die sich nun in ihrer wahren Gestalt der Fee zeigte und freudig in den Arm nahm und die Stirn küsste. Mit einem Mal merkte Mischkind, dass all seine Freunde aus den verbotenen Kammern es umringten: Die Edelritter waren da und die Jungfern, die feinen Damen und die rauen Gesellen. Sie alle freuten sich mit ihm und Mischkind musste laut lachen, so sehr hüpfte ihm das Herz. Es dankte der Fee und zog mit all ihren Freunden zum König zurück.
Das Volk staunte, als es den bunten, farbenfrohen Zug ins Schloss kommen sah. Die Horde aus der vierten Kammer beschenkte Mischkind mit tausend Kostbarkeiten, die Damenschar aus der dritten Kammer sang Preislieder auf dessen Schönheit. Der Schwarm Jungfern aus der zweiten Kammer löschte das böse Feuer auf dem Scheiterhaufen und die Edelritter aus der ersten Kammer verhöhnten die Mutter des Königs so lange, bis sie ihre Machtlosigkeit erkannte und fortan schwieg. Die Zunge Mischkinds hingegen war gelöst und der König erfuhr sein ganzes Schicksal. Da dankte er der guten Fee, hieß die neuen Freunde in seinem Reiche willkommen und jagte jeden davon, der sich als Feind ihres Glückes entpuppte.
***
»Na, alles in Ordnung?«, fragt Margarete.
Wilko nickt und seine Augen funkeln belustigt. Ganz ohne Selbstironie ist er wohl doch nicht.
»Mir war ein bisschen zu wenig Sex drin«, sagte Basil, »aber der Grundaussage deiner Geschichte stimme ich definitiv zu!«
»Mit einer oder zwei Prisen mehr Sex kann ich dir vielleicht dienen«, ergreift Charles das Wort und beginnt zu erzählen.
Märchen von einem, der auszog die Geilheit zu lernen
Ein Vater hatte zwei Söhne, davon war der älteste gescheit und wollüstig und wusste es wohl, die Köpfe der Mädchen und Jungen des Dorfes zu verdrehen, dass jeder seinen verführerischen Worten lauschte und sich nach seinen Berührungen sehnte. Der Jüngste aber war dumm, wenn es um sinnliche Freuden ging, und wenn im Dorf wieder getanzt und gefeiert wurde und der Wein das Blut der Leute erhitzte, da saß er nur da und beobachtete achselzuckend das Geschehen.
»Mit dem ist keine Fröhlichkeit zu teilen«, sprachen da alle im Dorf, und auch der Vater seufzte schwer.
Wenn es nun etwas zu erledigen gab, schickte der Vater immer den Ältesten los, und der sprach:
»Wenn ich ein verlockendes Gesäß sehe, das eindringlich betreut werden möchte, wird mich meine Geilheit erst dorthin schicken, bevor ich wiederkommen kann. Die Besorgung kommt schließlich nicht nur im Alphabet vor der Erledigung. Warte also nicht auf mich!«
Woraufhin der Jüngste verständnislos dreinglotzte, weil er nicht verstand, wovon sein Bruder sprach.
Oder wenn abends beim Feuer Geschichten erzählt wurden, bei denen einem die Lenden glühten und die Zuhörer manchmal riefen: »Wie geil!« oder »Das macht mich scharf, erzähl weiter!«, so saß der Jüngste in der Ecke und hörte das mit an und konnte nicht begreifen, was es heißen sollte.
»Immer sagen die Leute: Ich bin geil! Das macht mich geil! Geile Sau und geiles Luder. Das muss wohl eine besondere Kunst sein, diese Geilheit, von der ich nichts verstehe.«
Nun geschah es, dass der Vater einmal zu ihm sprach:
»Hör zu, du bist das Gespött im ganzen Dorf. Ein jeder weiß die Wollust zu schätzen und Spaß mit dem eigenen Leib und mit anderen zu haben. Sieh, wie fleißig dein Bruder die Mägde und Landarbeiter betreut, Tag für Tag! Er verdient sich ein hübsches Sümmchen, das ihn seine Freier zukommen lassen. An dir aber ist Hopfen und Malz verloren.«
»Ei, Vater«, antwortete der Sohn, »ich will gerne auch etwas dazu verdienen. Ja, dafür will ich lernen, was Geilheit ist!«
Der Vater beäugte den Jüngsten und dachte bei sich:
›Der redet dumm, doch ist etwas Wahres dran an seinem Wunsch. Schlank und stattlich sieht er aus, und wenn seine Wollust endlich erwacht und er es anderen gut besorgen kann, werde wiederum ich beide Söhnen gut versorgt wissen.‹
Nachdem er dies gedacht, entschloss er sich, den Jüngsten zur Dorfhure zu bringen, eine vollbusige Frau mit einem Kistchen voll schmutzigem Werkzeug und einem Kasten reichhaltiger Erfahrung.
»Die und ihr Gespons, der alte Bock, werden dich schon irgendwie zur Geilheit bringen.«
Die Dorfhure war sehr erfreut, ihre fachkundigen Künste unter Beweis stellen zu dürfen.
»Euer Sohn ist wahrhaftig eine Herausforderung, aber ich werde eine Nacht vorbereiten, die in dem Jungen schon die Geilheit wecken wird. Ich sehe bereits, er ist gewiss keiner, den die holde Weiblichkeit hinterm Ofen hervorlocken würde. Nein, da muss ich meinen Gespons dazu holen.«
So begab sich der Sohn in das Haus der Dorfhure, wo ihm ein weiches Bett zugewiesen wurde. An den Wänden seiner Kammer fanden sich allerlei schlüpfrige Malereien, die er nirgendwo vorher gesehen hatte: Da ging es nicht um schüchterne Andeutungen romantischer Annäherungen, sondern um die freimütige Darstellung der leiblichen Liebe – geradewegs und ohne Umschweife. Jüngling und Magd schmachteten einander nicht an, sie fielen übereinander her. Kameraden umarmten sich nicht in freundschaftlicher Zuneigung, sondern hatten sich gegenseitig an die lockeren Lenden gepackt, um sie gehörig zu untersuchen. Die Bilder erzählten von der ersten zarten Begegnung zweier Geschlechtsteile bis hin zur groben Liebe, wenn man sich fest ineinander verschlingt, um die Enge und Tiefe jedweder Berührung vollends auszukosten. Mit großer Eindringlichkeit und derber Geilheit zogen sie den Blick des Betrachters auf sich und inspirierten ihn zu frischen frivolen Taten; nur auf den Jungen hatten sie keinerlei Wirkung.
Auf dem Nachttisch stand zudem anrüchiges Spielzeug: Ein schnabelförmiges Werkzeug half beim Weiten von Öffnungen, verschiedene Stäbe in vielfältigen Größen sollten selbige füllen. Weiche Kissen in Form von Gesäßen, Brüsten und Lippen luden den männlichen Pflock zur fröhlichen Einfuhr ein. Die Dorfhure glaubte, dass bereits die Zurschaustellung solcherlei Dinge die wollüstige Neugier des Jungen wecken und er all das Spielzeug an sich selbst ausprobieren würde; ihr Gespons und sie hätten dann leichtes Spiel gehabt. Doch weit gefehlt! Nach drei Tagen kam sie auf den Hof des Vaters und klagte:
»Euer Junge hat großes Unglück angerichtet! Weder von mir noch von meinem Gespons hat er sich verführen lassen; weder die weiblichen Schenkel noch ein Herrengesäß konnten ihn reizen. Mein Gespons, den bisher jeder um seinen riesigen Lendenpfahl bewunderte, hegt nun Zweifel an seiner Männlichkeit und kann darum keinen Liebesdienst mehr leisten. Die halbe Kundschaft wird mir deshalb fortbleiben! Mein Ruf ist geschädigt wegen dieses Taugenichts!«
Der Vater erschrak, kam herbeigelaufen und schalt den Jungen aus.
»Was sind das für unerhörte Streiche? Du bringst nur Schaden!«
»Vater«, antwortete der Sohn, »hört nur an, ich bin ganz unschuldig: Er stand da in der Nacht, mit seinem unverhüllten Pflock vor meiner Nase. Ich wusste nicht, was los war, und wies ihm einfach nur den Weg zum Abtritt, da ich glaubte, er wäre danach auf der Suche. Zuerst lachte er, doch als er merkte, dass ich nichts anderes zu sagen und zu tun wusste, wurde er zornig und am Ende wehleidig. Aber was stellt er sich auch in diesem Zustand vor mich, wenn niemand ihn darum gebeten hat?«
»Ach«, sprach der Vater, »mit dir erlebe ich nur Unglück! Geh mir aus den Augen, ich will dich nicht mehr ansehen.«
»Ja, Vater, recht gerne. Ich will ausgehen und die Geilheit lernen. Bin ich nicht ohnehin alt genug, allein in die Welt zu ziehen? So versteh ich doch eine Kunst, die mich ernähren kann.«
»Lerne was du willst«, sprach der Vater, »mir ist alles einerlei. Da hast du fünfzig Taler, damit geh in die weite Welt und sage keinem Menschen, wo du her bist und wer dein Vater ist, denn ich muss mich deiner schämen.«
Als nun der nächste Tag anbrach, steckte der Junge seine fünfzig Taler in die Tasche, ging hinaus auf die große Landstraße und sprach immer vor sich hin:
»Wenn mir’s nur geil wäre! Wenn mir’s nur geil wäre!«
Da kam ein Fuhrmann heran und hörte das Gespräch, das der Junge mit sich selber führte. Der nun schritt hinter ihm her und fragte:
»Wer bist du? Wo läufst du her?«
»Ich weiß nicht«, antwortete der Junge.
Der Fuhrmann fragte weiter:
»Wer ist dein Vater?«
»Das darf ich nicht sagen.«
»Was brummst du beständig in den Bart hinein?«
»Ei«, antwortete der Junge, »ich wollte, dass mir’s geil wäre, aber niemand kann mich’s lehren.«
Da dachte der Fuhrmann nach. Ein Junge, der nicht geil wurde, davon hatte man seines Wissens im ganzen Land der lila Liebeslust noch nie etwas gehört. Doch da fiel ihm ein, wie seinem Reisegefährten geholfen werden könnte.
»Nicht weit von hier ist ein Wirtshaus, in dem ich schon öfter von geilen Dingen hörte«, sprach er. »Komm, geh mit mir, ich will sehen, dass ich dich darin unterbringe. Vielleicht kann dort jemand deine Lüste wecken?«
Der Junge ging mit dem Fuhrmann und abends gelangten sie zu dem Wirtshaus, wo sie übernachten wollten. Da sprach er beim Eintritt in die Stube wieder ganz laut:
»Wenn mir’s nur geil zumute wäre! Wenn ich nur geil wäre!«
Der Wirt, der das hörte, lachte und sprach:
»Wenn dich danach gelüstet, dazu sollte hier wohl Gelegenheit sein.«
»Ach, schweig stille«, sprach die Wirtsfrau, »so mancher Vorwitzige hat schon seine Lebenspläne eingebüßt. Es wäre Jammer und Schande um die schönen Augen, wenn die das Tageslicht nicht wiedersehen sollten.«
Der Junge aber sagte:
»Wenn’s noch so schwer wäre, ich will’s einmal lernen, deshalb bin ich ja ausgezogen.«
Er ließ dem Wirt auch keine Ruhe, bis dieser Folgendes erzählte:
»Nicht weit von hier steht ein verwünschtes Schloss, wo einer wohl lernen könnte, was echte, ausschweifende Geilheit wäre, wenn er nur drei Nächte darin wachen wollte. Der König hat dem, der’s wagen wollte, seinen Sohn zum Gemahl versprochen, und der ist der schönste Jüngling, welchen die Sonne bescheint. In dem Schlosse stecken auch große Schätze, von wollüstigen Geistern bewacht, die würden dann frei und könnten einen Armen reich genug machen. Schon viele Freier sind wohl hineingegangen, aber nachdem sie herauskamen, erzählten sie, dass sie so viel Wollust und Geilheit erlebt hätten, dass sie davon übersatt wären.«
Die Wirtsfrau fiel ein:
»Schier ausgesaugt müssen die Geister des Schlosses jene Freier haben. Sie lehnten die Hochzeit mit dem Königssohn allesamt ab und endeten entweder als Einsiedler auf Bergesgipfeln oder verschwanden hinter Klostermauern. Das Land hat damit eine große Anzahl arbeitstüchtiger, starker Männer verloren!«
Davon ließ der Junge sich nicht schrecken. Er ging am andern Morgen vor den König und sprach:
»Wenn’s erlaubt wäre, so wollte ich wohl drei Nächte in dem verwünschten Schlosse wachen.«
Der König sah ihn an, und weil er ihm gefiel, sprach er:
»Du darfst dir noch dreierlei ausbitten, aber es müssen leblose Dinge sein, und die darfst du mit ins Schloss nehmen.«
Da antwortete der Junge:
»So bitte ich um ein Feuer, eine Drehbank und eine Schnitzbank mit Messer.«
Der König ließ ihm das alles bei Tage in das Schloss tragen. Als es Nacht werden wollte, ging der Junge hinauf, machte sich in einem Saal ein helles Feuer an, stellte die Schnitzbank mit dem Messer daneben und setzte sich auf die Drehbank.
»Ach, wenn es nur geil wäre«, sprach er, »aber hier werde ich’s auch nicht lernen.«
Gegen Mitternacht wollte er sich sein Feuer einmal aufschüren; wie er so hineinblies, da schrie’s plötzlich aus einer Ecke:
»Ja! Mach uns heiß!«
»Ihr Narren«, rief er, »was schreit ihr? Wenn ihr es heiß haben wollt, kommt, setzt euch ans Feuer und wärmt euch.«
Und wie er das gesagt hatte, kamen mit einem gewaltigen Sprung zwei große, schwarze Kraftprotze in engen Kleidern herbei, setzten sich ihm zu beiden Seiten und sahen ihn mit feurigen Augen an. Die dunkle Haut ihrer starken Arme glitzerte samtig, das Haar lockte sich dicht, und die Schenkel und Waden waren von imposanter Dicke. Am meisten beeindruckten aber die ausufernden Beulen in den knappen Höschen, die gewiss doppelt so groß waren wie jene, die der Junge in seinem Heimatdorf gesehen hatte. Über ein Weilchen, als sie sich gewärmt hatten, sprachen sie:
»Kamerad, wollen wir nicht Karten spielen? Wir kennen ein Spiel, dass sehr reizvoll ist. In jeder Runde muss der Verlierer eines seiner Kleidungsstücke ablegen und sich die entblößte Stelle von den anderen belecken lassen.«
»Warum nicht?«, antwortete der Junge. »Ich bin zwar kein guter Spieler, aber auf diese Weise wird mein Leib wenigstens gereinigt.«
Sie spielten also eine Weile Karten und der Junge verlor in jeder zweiten Runde, sodass er bald splitterfasernackt dasaß. Auch die schwarzen Kraftprotze entledigten sich ihrer Gewänder und ließen ihre Zungen auf der Haut des Jungen tanzen.
»Das erfrischt, muss ich zugeben«, sagte der Junge, »doch weiß ich noch immer nicht, was Geilheit ist.«
Da schauten ihn die Kraftprotze böse an und riefen:
»Das sollst du gleich erleben!«
Der eine spreizte die Beine des anderen, spuckte auf dessen Kuhle und ließ seinen hart gewordenen, dunkelköpfigen Pfahl tief hineingleiten. Derjenige, welcher einfuhr, knurrte sonderbar, als die Enge seines Kameraden ihn umhüllte. Unterwürfig hob der andere ihm sein Gesäß entgegen und lud ihn geradezu ein, noch tiefer zu forschen. Nicht sehr behutsam begann der schwarze Stoßer, sich zu bewegen. Soweit der Junge es erkennen konnte, kostete er jeden Ruck genüsslich aus. Der andere hingegen schien Schmerzen zu erleiden, denn er verzog krampfartig das Gesicht; aber er ertrug die Stöße und war fest entschlossen, sich von dem Kameraden besteigen zu lassen, solange wie der eben wollte. Der Junge erkannte das Verlangen, welches den beiden Kraftprotzen ins Antlitz geschrieben stand. Er erahnte, wie der eine den anderen mit Beständigkeit stieß, und ein Schrei, der kein böser war, bestätigte den Eindruck.
»Das Gleiche tun wir mit dir, denn wir bleiben stets hart«, drohte der Stoßer und grinste, seine strahlend weißen Zähne zeigend, »und dann wirst du lernen, was Geilheit ist.«
Doch der Junge besah sich die schwarzen Pfähle und entgegnete:
»Das nennt ihr ordentlich hart? Lasst mich euch etwas zurecht machen, das viel besser sein dürfte. Bei der Dorfhure in meiner Heimat habe ich ähnliche Werkzeuge gesehen, und wenn ich auch keine Verwendung für mich darin sehe, könnte es euch Freude bringen.«
Er setzte sich an die Schnitzbank und fertigte aus den Holzscheiten, die neben seiner Feuerstelle lagen, zwei prächtige, glatte Holzpflöcke von anrüchiger Gestalt. Er hieß die zwei Kraftprotze, ihm ihre Gesäße entgegenzustrecken, spuckte auf die Kunstwerke und führte sie jeweils in die Kuhlen ein. Die Kraftprotze staunten und juchzten, denn so etwas Großes hatten sie noch nie vorher verspürt.
»Stoß uns damit, Junge!«, riefen sie, und weil er freundlich war, gehorchte er. Die schwarzen Kraftprotze leckten einander die dicken Lippen, während sie sich mit jedem Stoß, den sie empfingen, immer wilder gebärdeten. Ihre Zungenspiele wurden ungezähmter, Speichel tropfte vom Kinn zu Boden und sie verloren offenbar die Sprache, denn sie grunzten wie zwei Eber im Rausch. Ihre Nasenflügel bebten und die deutlich sichtbaren Adern an ihren Hälsen pulsierten schneller und schneller. Endlich gossen ihre langen Pfähle den hellen Sud der Männlichkeit aus, und sie erfuhren einen heftigen Glückstaumel. Aber noch ehe der Junge nachfragen konnte, wie es den beiden ginge, verschwanden sie und der Spuk war vorbei.
»Hm«, sprach der Junge nachdenklich, »vermutlich gefällt ihnen solch eine Behandlung und macht sie geil. Ich hingegen bemerke in meinen Lenden keinerlei Veränderung. Die Geilheit wird für mich ein Rätsel bleiben!«
Und als er so saß, wollten ihm die Augen nicht länger offen bleiben und er wünschte zu schlafen. Da blickte er um sich und sah in der Ecke ein großes Bett.
»Das ist mir eben recht«, sprach er und legte sich hinein.
Als er aber die Augen zutun wollte, fing das Bett von selbst an zu zittern und ein Kitzeln fuhr über seinen Leib.
»Recht so«, sprach er, »nur besser so.«
Da wiegte das Bett, als wären sechs Ammen darum und schaukelten es. Die Schlafdecke ward lebendig und wollte ihm die Haut streicheln, doch da ward es dem Jungen genug. Er schleuderte die Decke ins Feuer, sprang vom Bett und sagte:
»Solche Späße sind zum Einschlafen nicht gemacht.«
Er legte sich an seine Feuerstelle auf den Boden und schlief, bis es Tag war. Am Morgen kam der König, und als er ihn da auf der Erde liegen sah, meinte er, die Gespenster hätten ihn totgeliebt.
»Es ist doch schade um den schönen Menschen«, seufzte er betrübt.
Das hörte der Junge, richtete sich auf und sprach:
»Soweit ist’s noch nicht!«
Da verwunderte sich der König, freute sich aber und fragte, wie es ihm gegangen wäre.
»An und für sich gut«, antwortete er, »eine Nacht wäre herum, die zwei andern werden auch herumgehen. Aber von Geilheit nicht die Spur!«
Als er zum Wirt kam, da machte der große Augen.
»Ich dachte nicht«, sprach er, »dass ich dich so frisch und munter sehen würde. Hast du nun gelernt was Geilheit ist? Haben die Geister der Wollust nicht an deinen Kräften gezehrt?«
»Nein«, sagte der Junge, »es ist alles vergeblich! Wenn mir’s nur einer erklären könnte!«
Die zweite Nacht ging er abermals hinauf ins alte Schloss, setzte sich zum Feuer und fing sein altes Lied wieder an:
»Wenn ich nur geil würde! Wenn ich nur geil würde!«
Als die Mitternacht herankam, ließ sich plötzlich ein Schmatzen und Stöhnen hören, erst sachte, dann immer stärker. Der Junge spürte den Lauten nach und fand, dass sie aus dem Kamin stammten. Er näherte sich der Feuerluke und vernahm, wie eine Stimme hauchte:
»Halt ein, sonst kommt mir’s!«
Der Junge hielt aber nicht inne, sondern trat dicht heran. Da hauchte es noch einmal von oben herab:
»Halt ein, sonst kommt mir’s!«
Ohne sich irre machen zu lassen, hockte sich der Junge vor die Luke, steckte den Kopf in den Kamin und schaute in die finstere Höhe. Abermals hauchte es ihm entgegen:
»Halt ein, sonst kommt mir’s!«
»Ei, so kommt’s halt!«, rief er zurück, denn langsam riss ihm die Geduld.
Justament rutschte mit einem lauten »Ja!« ein Mensch den Schornstein herab und fiel breitbeinig vor den Jungen. Der Fremde hatte sinnliche, rote Lippen, eine zierliche Gestalt und war vollkommen nackt. Seine Brust schien die Kälte des Schlosses zu spüren, denn die Nippelchen darauf waren verhärtet und standen vom Rest des Leibes deutlich ab. Kein einziges Haar hatte er auf der Haut, die Achseln waren kahl und ebenso die Lenden, wo der Pflock hin- und herschaukelte.
»Wer bist denn du? Pünktlich zum Abendbrot wohl, aber welch Auftritt!«, staunte der Junge.
Da packte ihn der Fremde, riss ihm die Kleider herunter und legte ihn auf den Rücken. Er setzte sich auf ihn, sein Gesäß auf das Antlitz pressend, beugte sich vornüber zum Pflock und begann, an selbigem zu saugen, bis es zischte. Flink war seine Zunge und klamm sein Speichel, der links und rechts zwischen Bein und Pflock hinablief, bis hin zur engen Senke, wo er den trockenen, unberührten Ausgang benetzte.
»Leck meine Kuhle!«, rief der Fremde. »Ich will derweil deinen Sud kosten!«
Er drückte sein Gesäß noch dichter vor des Jungen Gesicht, bis alle Teile der unbehaarten Lenden auf dessen Kinn lag und dort ihren strengen, doch frischen Geruch ausströmten. Aber der Junge, unerfahren in den Reden der Geilheit, antwortete ruhig:
»Wenn du mit mir speisen willst, bin ich gern dein Gastgeber. Doch komme ich aus einer Gegend mit anderen Sitten.«
Ob dieser Antwort war der Fremde so überrascht, dass er in seinem Tun innehielt und der Junge ihn von sich heben konnte. Derweil sprach jener seelenruhig:
»Von deiner Kuhle möchte ich nicht lecken, denn mein Abendbrot nehme ich von anderer Stelle ein. Wenn du Sud willst, so musst du welchen brauen. Doch trink ruhig von meinem frischen Wasser!«
Der zierliche Fremde war noch immer verwundert, da setzte ihn der Junge auf die Drehbank und begann ihn zu füttern.
»Nackt, wie du bist, musst du vollkommen erfroren sein. Wärme dich an meinem Feuer.«
Doch der Fremde war ein Geist der Wollust und so erschrocken darüber, dass weder seine Zunge noch sein Gesäß die Neugierde des Jungen weckten, dass er aufschrie und über den Schornstein floh, um nie wieder gesehen zu werden.
»Undankbare Gäste«, bemerkte der Junge trocken. »Ob heute noch mehr geschieht?«
Kaum hatte er diese Worte vor sich hin gemurmelt, ertönten Trommeln und Musik. Mehrere Männer erschienen, in verschiedene Kleider gehüllt, im Saal und begannen zu tanzen. Es waren Kerls in Kriegskleidern dabei, Spielmänner, Zimmermannsgesellen und Jünglinge in höfischen Gewändern. Sie bewegten sich zur Musik, berührten einander an den unmöglichsten Stellen und ließen langsam Stück um Stück ihrer Hüllen fallen. Glänzende Schultern und stählerne Brustkörbe kamen zum Vorschein und die Männer begannen einander zu liebkosen. Hände streckten sich aus, um nackte Haut, ob haarig oder blank, zu berühren; sie wanderten über die Bäuche, hinunter in die Lenden und walkten das dort Befindliche mit Inbrunst. Zu dritt, zu viert, gar zu fünft rollten Grüppchen geiler Männer auf dem Boden in seliger Umarmung herum. Ein jeder schien die Wärme aller anderen zu begehren, sie aufnehmen und speichern zu wollen; manch einer strahlte regelrecht, wenn ihn ein Blick des anderen traf.
Gerade hatten sich ein Spielmann und ein Zimmermann aneinander festgesogen. Ein Krieger trat hinzu, ließ seinen heißen Atem zu des Spielmanns Hals wandern und hauchte ihm ins Genick, was dieser mit einem sehnsüchtigen Stöhnen erwiderte. Dann schleckte wiederum ein anderer in der Hörmuschel des Kriegers und knabberte an dessen Ohr. Das musste große Freude bereiten, sah der Junge, und dennoch kam er nicht umhin festzustellen, dass er seine Ohren viel lieber zum Hören verwendete, als sie jemand anderem zum Imbiss zu leihen.
Der Kopf des Kriegers wanderte weiter und seine Lippen landeten auf dem Bauch des Spielmanns. Während er mit der linken Hand an dessen Nippelchen spielte, umkreiste seine Zunge den Bauchnabel und sein Mund eroberte auf diese Weise Stück für Stück den ganzen Rumpf. Bald war er am entblößten Pflock angekommen, benässte ihn gehörig mit seinem Speichel und lutschte zärtlich daran. Anderswo gab es heftiges Rubbeln oder gieriges Saugen, hier einfach nur ein munteres Lecken, dort ein wohliges Schlabbern. Der Junge begriff, dass ein jeder eine andere Spielart mündlichen Austauschs bevorzugte.
Der Spielmann legte sich entspannt zurück und ließ sich verwöhnen. Er murmelte, wie geil es sich anfühle, was man da mit seinem Pflock anstellte, wie scharf man seine Lenden reizte. Der Krieger blickte zum Jungen und winkte ihn heran, um an dem Gelage teilzunehmen. Doch der lehnte ab und sprach:
»Es ist zwar unhöflich, eine Einladung zu Feierlichkeiten abzulehnen, doch versteht, dass ich müde bin. Wenn ihr stöhnt und keucht, so tut dies bitte leise, denn geil machen könnt ihr mich leider nicht.«
Da waren die Männer bestürzt, die Musik setzte aus und plötzlich war alles leer und dunkel wie vorher. Der Junge zuckte die Schultern und legte sich zum Schlafen hin.
Am andern Morgen kam der König und wollte sich erkundigen:
»Wie ist dir’s diesmal gegangen?«
»Ich habe Musik gehört und geschmaust«, antwortete er, »aber es ist mir nicht geil geworden.«
»Haben dich denn keine wollüstigen Geister besucht?«
»Ei was«, sprach er, »wenig Ahnung von Sitten und Anstand hatten die. Gingen, ohne sich zu verabschieden, einfach ihrer Wege. Wenn ich nur wüsste, was Geilheit wäre?«
In der dritten Nacht setzte er sich wieder auf seine Bank und sagte verdrießlich:
»Ach, wenn ich doch nur geil wäre!«
Als es spät ward, kamen sechs gewaltige Männer herein. Sie trugen lederne Geschirre und schwarze Hauben und brachten Peitschen, Ketten und schwarze Stöcke mit sich. Sie banden einen aus ihrer Mitte mit Riemen fest, legten eine Kette um seine Brust und schoben einen schwarzen Stock in sein Gesäß, sodass er ächzte und jammerte. Einen anderen schmiedeten sie an die Wand und schlugen mit Händen und Stöcken auf seine festen Backen, bis sie rot glühten. Ein Dritter ließ es sich gefallen, mit der Peitsche auf Brust und Rücken gefoltert zu werden. Der älteste unter ihnen, ein Glatzkopf, sprach:
»Den Zärtlichkeiten und Verführungen hast du widerstanden, aber unsere harte Weise der Wollust wird die Geilheit in dir schon entfachen!«
Der Junge besah sich das Schauspiel. Den Gefesselten schien es zu gefallen, wie sie erbarmungslos benutzt wurden, und offenbar nahmen sie es in Kauf, dass die Ketten und Peitschen deutliche Spuren auf ihrer Haut hinterließen. Der Schmerz, den sie hörbar herausschrien, trieb sie an, von ihren Meistern noch mehr Erziehung, noch mehr Schläge zu fordern. Jene wiederum geilten sich an der Macht auf, die sie über ihre wimmernden Gefangenen hatten; sie bespuckten und beschimpften sie, und doch funkelte aus ihren Augen liebevolle Dankbarkeit dafür, dass die drei Gefangenen sich ihnen hündisch ergaben. Obgleich die Pflöcke der Männer mit dem Grad des Schmerzes wuchsen, den sie einander zufügten, empfand der Junge rein gar nichts dabei.
»Tut mir leid, liebe Leutchen, aber auch euer Tun bringt mich zu keiner Erkenntnis.«
»Noch sind wir nicht fertig«, lachte der Älteste, nahm seinen fetten Pfahl in die Hand und richtete ihn auf den Kerl, der an die Wand gekettet war.
»Zeit für Erfrischung«, rief er und seichte auf den Rücken des anderen.
Der stöhnte laut, denn die schmutzige Dusche schien ihm zu gefallen. Die anderen ließen ihrem Bedürfnis ebenfalls freien Lauf und seichten sich gegenseitig auf ihre Leiber, verrieben das Wasser und gaben sich hernach umso hemmungsloser dem Verlangen hin. Der Duft schwitzender Männer wurde langsam von einem deutlichen Harngestank überdeckt. Der Junge stutzte, als er sah, wie die Nüstern der Gefangenen nach jener würzigen Luft gierten, die ihnen entgegendampfte.
Der Glatzkopf ging auf den Jungen zu und schob den Pfahl ein wenig vor, so dass er fast auf den unberührten Lenden saß. Plötzlich merkte der Zuschauende, wie es warm über seine Beinkleider zu rinnen begann – der lederne Kerl seichte ihm über all seine Kleider, so viel, dass es die Leinen durchtränkte und warm seinen eigenen Pflock umspülte!
Völlig verwirrt schaute der Junge zu dem Glatzkopf auf. Jenen überfiel jedoch mit einem Male ein heftiger Glückstaumel: Er musste die Zähne zusammenbeißen und die Augen schließen, damit er nicht die Beherrschung verlor, und trotzdem beschmutzten seine Sudspritzer das unschuldige Antlitz des Jungen. Als der letzte Tropfen gefallen war, schaute der Älteste den Jungen fragend in die Augen, doch der schüttelte den Kopf:
»Auch solch derbe Harnspiele vermögen es nicht, mich zur Geilheit zu reizen.«
Da gaben die sechs Kerle auf, ihre Pflöcke schrumpften und sie verließen den Saal.
»Es will mir nicht geil werden«, sagte der Junge betrübt, »hier lerne ich’s mein Lebtag nicht.«
Da trat ein Mann herein, der war größer als alle anderen, aber alt und hatte einen langen weißen Bart. Er jammerte und klagte, man möge ihm doch sein kostbares Fleisch wiedergeben. Dabei öffnete er seinen Mantel und man sah ein pechschwarzes Loch klaffen, wo eigentlich sein männliches Mittelstück prangen müsste.
»Ich muss dieses Gebein wiederhaben«, sagte er, »und wer mir’s bringt, wird ein gut behütetes Geheimnis erfahren!«
Ein Geheimnis!, dachte da der Junge und meinte nicht anders, es müsse zwingend etwas mit der sagenumwobenen Geilheit zu tun haben. Darum fragte er den großen Mann mit dem Loch, wo er sein kostbarstes Stück Fleisch denn verloren habe.
»Es muss hier im Gewölbe gewesen sein«, antwortete jener.
Der Junge sah sich um und fand nichts als die Peitsche, welche die sechs groben Kerle zurückgelassen hatten. Die nahm er auf und steckte sie dem großen, alten Mann ins klaffende Loch. Siehe, da verwandelte sich die Peitsche in menschliches Fleisch: Der Griff ward zu einem heißblütigen Stamm, die Schnur aber zu einem ellenlangen Faden aus Mannessud. Der Alte tauschte seine Klagelaute in Freudenrufe um und wollte sich gegen den Jungen dankbar erweisen.
»O du unschuldiges Küken«, rief er, »nun hast du mich und das Schloss schon beinahe erlöst und sollst darum bald lernen, was Geilsein ist. Komm mit mir und erfahre die Geheimnisse!«
Da führte er den Jungen durch dunkle Gänge zu einer Kammer, in der viele Fläschchen und Kästchen herumstanden.
»In diesen Behältnissen, Junge, finden sich geheime Mixturen, Kräuter und Tränke. Sie rufen bei den Menschen die Wollust hervor, sorgen für einen langen Rausch und helfen älteren Männern, ihre Pfähle stolz zu erheben wie einst in ihrer Jugend. Koste nur!«
Der Junge tat, wie ihm geheißen, und tatsächlich schwoll sein Pflock an. Doch der Junge blickte teilnahmslos nach unten und sagte:
»Er wird hart, aber ist das schon Geilheit? Ich spüre nicht das Bedürfnis, mit diesem Zustand etwas Sinnvolles anzufangen. Ich hoffe, dass er schnell wieder vergeht? Sonst muss ich meine Beinkleider umnähen.«
Da seufzte der Alte traurig und sagte:
»Wenn auch diese Mittel nichts helfen, so ist das Problem nicht in deinem Leib zu suchen, sondern in deinem Verstand. Die Lust an der Lust geht dir abhanden und dafür gibt es keine Lösung. Die Geilheit, mein Junge, wirst du wohl nie erfahren.«
Indem schlug es Zwölfe, und der Geist verschwand, sodass der Junge im Finstern stand.
»Ich werde mir schon heraushelfen können«, sprach er.
Die ellenlange Sudschnur des Alten hatte eine klebrige Spur auf dem steinernen Schlossboden hinterlassen. Die bemerkte er, als er umhertappte, und konnte darum den Weg aus der Kammer in den Saal finden. Dort schlief bei seinem Feuer ein. Am andern Morgen kam der König und sagte:
»Nun wirst du wohl gelernt haben, was Geilheit ist, und völlig erschöpft sein?«
»Nein«, antwortete er, »was ist es nur? Sechs seltsame Herren waren da, und ein bärtiger Mann ist gekommen, der hat mir da unten vielerlei Medizin gezeigt. Aber was Geilheit ist, hat mir keiner gesagt.«
Da sprach der König:
»Du magst enttäuscht sein, aber ich bin froh, denn du hast das Schloss erlöst und sollst meinen Sohn heiraten.«
»Das ist alles recht gut«, antwortete er, »aber ich weiß noch immer nicht, was Geilheit ist.«
Der Königssohn indessen war von dem Jungen angetan, zweifelte aber, ob er ihn wirklich heiraten wolle.
»Vater, dieser Junge tut zwar meinen Augen gut, doch wenn er nicht weiß, was Geilheit ist, wie will er mit mir die Ehe vollziehen? Traurig und kalt wird es in unserem Schlafgemach werden.«
Der König aber drängte auf die Hochzeit, denn was versprochen war, musste auch gehalten werden. Was sollten seine Untertanen denn sonst von ihm halten? Da ward also das Fest vorbereitet, aber der Junge, so lieb er seinen zukünftigen Gemahl auch hatte und so vergnügt er war, sagte noch immer heimlich vor sich her:
»Wenn mir nur geil wäre, wenn mir nur geil wäre.«
Das verdross den Königssohn, doch als die Trauung herankam, so sprach der König:
»Nun sollt ihr beide in Eintracht miteinander leben und einander gute Männer sein. Um die Ehe zu besiegeln, gebt einander einen Kuss.«
Und wie sich der Königssohn zum Antlitz des Gemahls beugte, berührten sich ihre Lippen.
Da durchzuckte ein wohliger Schauer den Jungen. Ihm, dem nie zuvor ein Kuss geschenkt worden war, schwindelte es, als er den warmen, feuchten Atem des Königssohns spürte. Sein Herz begann wild zu pochen, sobald er die fremde Zunge in seinem Munde empfing und sich auf einen liebevollen Kampf mit ihr einließ. Seine Nackenhaare richteten sich auf, es spannte seine Hose wie vormals in der dunklen Kammer, doch diesmal ohne die Hilfe irgendeiner Mixtur. Dafür aber erkannte der Junge nun, was er mit jenem sonderbaren Zustand zwischen seinen Beinen unbedingt ausführen wollte – all die Bilder und Darbietungen der vergangenen Nächte ergaben für ihn plötzlich einen Sinn und er drückte den Königssohn fest an sich.
»Dein Kuss ist das Süßeste und Aufregendste, was mir je in meinem Leben widerfuhr. Merkst du den Druck meiner Lenden an deinem Leibe? Ich will dich in unser Schlafgemach tragen und dir zeigen, was ich alles während der Nächte hier gesehen und erlebt habe, denn nun verstehe, weiß und spüre ich, was die Geilheit ist! Ach, welch herrliches Gefühl!«
Und der Königssohn besann sich nicht lange, ließ sich mit Freuden ins Gemach schleppen und verlebte dort sieben überaus glückliche Tage und Nächte mit seinem Gemahl.
Doch wer nun denkt, hier sei des Märchens Schluss, der merke auf! Denn noch ist nicht alles erzählt. Freilich, die Geilheit hatte der Junge nun gelernt und er lebte sie mit dem Königssohn fröhlich aus. Irgendwann jedoch kamen ihm sein Vater und sein Bruder in den Sinn, und obgleich sie ihn beschworen hatten, nimmer zurückzukehren, bedachte sich der Junge:
»Jetzt, wo ich gefunden habe, wonach ich ausgezogen bin, gibt es keinen Grund mehr für meine Familie, mich von sich zu stoßen. Einer von ihnen bin ich nun, der ebenso gut etwas von der Geilheit versteht wie sie. Drum werden sie mich freundlich empfangen, allzumal ich der Gemahl des Königssohns geworden bin!«
Also ließ er eine Kutsche mit Geld und Gut packen, legte auch die hölzernen Schnitzwerke drauf, die er vormals für die schwarzen Kraftprotze gefertigt, sowie die Kräuter und Mixturen, die der alte Geist ihm in den tiefen Kellern des Schlosses gezeigt hatte. Auch tat er die teuersten Gewänder an; deren goldbestickter Stoff sollte seinen neuen Stand, ihr knapper Schnitt hingegen sein erworbenes, geiles Wissen aufzeigen. Dann nahm er Abschied von seinem lieben Gemahl und begab sich auf den Weg zurück in sein Heimatdorf.
»Gib acht und lass dich zu nichts hinreißen«, rief ihm der Königssohn nach, »denn zu oft wissen wir nicht, was wir tun, wenn wir geil sind.«
Ob’s der Junge gehört hat oder nicht, wer weiß? Er fuhr dahin und kam unterwegs durch einen finsteren Wald. Da standen plötzlich mitten auf dem schmalen Weg zwölf Kerle, die waren bärtig am Kinn und kräftig am Arm und schauten unverhohlen der Kutsche entgegen.
»Was wittert meine Hundsnase?«, sprach einer. »Da drinnen duftet’s nach anregenden Kräutern!«
»Was sieht mein Adlerauge?«, sagte ein anderer. »Da drinnen stehen zwei anregende Holzpfähle!«
»Was hört mein Luchsohr?«, kam ein Dritter zu Wort. »Das Herz des Kutschers klopft laut und das Blut rauscht munter in seinen Lenden!«
Recht hatte er, denn wie der Junge der zwölf Kerle gewahr wurde, erinnerte er sich sogleich an die Tanznacht im verwünschten Schlosse und dachte daran, wie gern er an all dem Treiben teilgenommen hätte, wäre er nur damals schon geil gewesen wie heute. Das brachte sein Blut freilich in Wallung. Er grüßte die Fremden freundlich und brachte sein Pferd zum Stehen. Ein besonders großer unter den Kerlen, der eine schwarze Augenklappe trug, erwiderte den Gruß.
»Wohin des Weges, guter Mann?«, fragte er.
»Zum Dorf, wo mein Vater wohnt«, antwortete der Junge.
»Du hast drollige Holzpfähle in deiner Kutsche«, fuhr der Kerl mit der Augenklappe fort. »Mir scheint, sie eignen sich gut für geile Spielereien?«
»Oh, das tun sie wohl«, sagte der Junge eifrig. »Ich habe die Pfähle selbst geschnitzt und an zwei Kraftprotzen ausprobiert. Sie konnten nicht genug davon haben. Ihr müsst nämlich wissen, ich verstehe mich sehr gut auf die geilen Künste und gelte als ihr Meister.«
Da traten die zwölf Kerle näher an ihn heran und warfen ihm Blicke zu, die er nun, wo er die Geilheit kannte, sehr wohl zu deuten wusste. Der mit der Hundsnase leckte sich die Lippen, der mit dem Adlerauge hob mehrmals die Brauen und der mit dem Luchsohr hob die Arme, um sich gemächlich durchs Haupthaar zu streichen.
›Welch verräterisches Mienenspiel, welch verlockendes Gebaren‹, dachte sich der Junge. ›Ob diese Kerle mich etwa verführen wollen?‹
Als hätte der Einäugige seine Gedanken erraten, sprach er:
»Steige für ein Weilchen zu uns herab und lass dich in unserer Gesellschaft nieder. Dein Weg ist noch weit und wir wollen dir eine reizvolle Rast bescheren, wo du doch solch ein Meister der Geilheit bist.«
Und kann man es dem Jungen übel nehmen, dass er sich von diesen Worten überreden ließ? Schließlich war er erst seit Kurzem zu seinen sinnlichen Erkenntnissen gekommen und glaubte wohl, all die verpassten Stunden der Lust aufholen zu müssen. Er willigte also ein, der Kerl mit der Augenklappe aber sagte:
»Lass mich dir zunächst die Augen verbinden, denn ohne die Last der Sicht wird dein Leib die Freuden des Fleisches viel eindringlicher verspüren können.«
Der Junge stieg vom Kutschbock, ließ sich bereitwillig die Augen verbinden und legte auch auf Geheiß seine kostbaren Kleider ab.
»Sie würden bei deiner Rast nur stören«, behaupteten die Kerle und führten ihn an einen Baumstamm.
Der Junge merkte, wie seine Arme um den Stamm gelegt und an den Händen festgebunden wurden. Er dachte nichts Schlimmes dabei und erinnerte sich an die dritte Nacht im verwünschten Schlosse, in der sich einige Gespenster ebenso hatten fesseln lassen. Erst, als sich die Stimmen der zwölf Kerle entfernten und er seine Kutsche samt Pferd davonfahren hörte, ging ihm auf, dass er in die Hände von Räubern geraten war.
»Sie haben mich überlistet und mir all meine geile Habe genommen«, jammerte er.
Splitterfasernackt stand er am Baum und fürchtete bereits, den wilden Tieren des Waldes zum Opfer fallen zu müssen. Glücklicherweise hatten die Räuber seine Hände jedoch nur lose verstrickt und er konnte sich beizeiten befreien. Auch fand er ein paar Lumpen, die wohl dem Hauptmann mit der Augenklappe gehört haben mochten und der sie gegen die goldbestickten Gewänder ausgetauscht hatte. Die zog er sich über, um seine Blöße zu bedecken, doch waren ihm die Lumpen zu groß und schlabberten.
Jetzt war er so arm und elend wie einst, da er aus seines Vaters Haus verstoßen worden ward, und wusste gar nicht, was er anfangen sollte. Weil er sich aber nun einmal auf den Weg gemacht hatte, beschloss er, sein Heimatdorf zu besuchen und nicht umzukehren, sah er auch wie ein Bettler aus.
»Schämen muss ich mich nicht, denn ich bleibe ein Meister der Geilheit, über die ich so vieles gelernt habe«, sprach er sich selbst Mut zu.
Als er nun aber mit seinen zerrissenen Kleidern bei seinem Vater anlangte und ihm und dem älteren Bruder erzählte, wie er der Gemahl des Königssohns geworden sei, alles über die Geilheit wisse und seinen Angehörigen eine Kutsche voll anregender Mixturen und geschmeidiger Holzpfähle habe bringen wollen und die Räuber ihm dann alles bis aufs Hemd genommen und ihm dafür bloß diese Lumpen gelassen hätten – da meinten sowohl sein Bruder als auch der Vater:
»Das sind schamlose Lügen! Man braucht dich in deinem Schlabbergewand nur anzusehen und weiß, dass du immer noch nichts von der Wollust verstehst. Du ein Gemahl königlichen Geblüts? Ein loser Landstreicher und Lügner bist du, schlimmer noch als früher!«
Als nun der Junge einen heiligen Eid schwören wollte und dabei bitterlich weinte, glaubte sein Vater zu guter Letzt, sein Sohn sei nicht ganz richtig im Kopf.
»Wir müssen ihn irgendwo unterbringen, wo wir uns seiner nicht schämen müssen«, entschied er. »Geben wir ihn zur Dorfhure, damit er ihre Schweine hüte. Wir haben ohnehin bei ihr noch eine Schuld offen.«
Und der ältere Bruder fügte hinzu:
»Dort soll man ihn an seinen Hütestab festketten, damit er unschädlich gemacht ist.«
Also wurde er an die Dorfhure fortgegeben, wo er elendig im Schweinemist stehen musste und von allen, die zufällig vorüber-gingen, verlacht und verhöhnt wurde, sobald er wieder behauptete:
»Ich bin doch des Königssohns Gemahl und ein Meister der Geilheit geworden! Gebt mir nur einen Kuss und ich werde es euch beweisen.«
Denn er wusste, dass gerade das Küssen in ihm alle Geilheit wachrufen würde. Allein seine Bitten waren umsonst, denn wer wollte schon einen schmutzigen Schweinehirten küssen? Und sein Flehen, man möge ihn zum König führen, der würde ihn schon erkennen, führten ebenfalls zu nichts. Man hielt seine Worte für Verrücktheit und der Vater kam des Öfteren vorbei, um die Kette nur noch fester zu ziehen, auf dass er nicht umherlaufe und noch mehr Unsinn verbreiten konnte.
Während dieser Zeit verfiel der Königssohn in eine schwere Traurigkeit und mochte weder essen noch trinken, weil sein Gemahl gar nicht zurückkam und er sich sorgte, ob er überhaupt noch am Leben sei. Eines Nachts hatte er einen schrecklichen Traum: Ein Adler stürzte sich aus der Luft auf einen jungen, bunten Specht herab, der gerade an einem Baumstamm zugange war, und riss ihm sein Gefieder entzwei. Den erzählte er morgens sogleich dem königlichen Traumdeuter, und der sagte:
»Mit Eurem Angetrauten muss es schlimm stehen.«
Daraufhin zog der Königssohn dem Traumdeuter den Mantel aus und legte ihn selbst an, ließ einen Esel vor einen einfachen Wagen spannen und fuhr als Gelehrter gekleidet dem Heimatdorf seines Gemahls zu. Den Wechsel der Gewänder hatte er getätigt, um möglichst unbehelligt voranzukommen. Denn ein Königssohn auf Reisen, den jeder erkannte, hätte ständig anhalten und dem Jubel des Volkes lauschen müssen. Zum Zeichen seiner Herkunft hatte er einzig seine Krone mitgenommen und am Gürtel versteckt, damit er sich im Falle einer Not ausweisen konnte.
Als der Königssohn mitten in dem finsteren Walde war, kamen wieder die zwölf Räuber aus dem Unterholz daher und liefen auf ihn zu. Er hörte sie schon von Weitem sprechen:
»Was wittert meine Hundsnase? Frisches Fleisch, das sich durch den Wald hetzt.«
»Was sieht mein Adlerauge? Einen Reisenden, der sich in den Mantel der Weisen hüllt.«
»Was hört mein Luchsohr? Pustenden Atem von einem, der es eilig hat.«
Der Hauptmann mit der Augenklappe trat dem verkleideten Königssohn mitten in den Weg und versuchte ihn, wie vormals den armen Jungen, zu einer Rast zu überreden.
»Vielleicht kann ein Gelehrter wie deinesgleichen uns helfen?«, sprach er. »Wir haben Holzpfähle, Kräuter und Mixturen gefunden. Die Pfähle wissen wir zu verwenden und die Kräuter helfen uns, falls während der Verwendung das eine oder andere Missgeschick geschieht. Die Mixturen aber trauen wir uns nicht anzurühren, denn wer weiß, was darinnen ist?«
Der Königssohn hatte aber bereits die knappen, goldbestickten Kleider des Hauptmanns als jene erkannt, die einst seinem Gemahl gehört hatten. Da ahnte er, dass die zwölfe den Jungen ausgeraubt hatten. Um nun herauszufinden, was genau geschehen sei, musste er sich zur Höhle der Räuber führen lassen und tun, als wüsste er nicht, wer sie in Wahrheit waren. Auf dem Weg dorthin überlegte er hin und her, mit welcher List er den Räubern begegnen sollte, und als sie endlich in der Höhle standen und der Hauptmann die Fläschchen mit den Tränken und Mixturen vorzeigte, schlug der Königssohn die Hände über dem Kopf zusammen und tat furchtbar verwundert:
»Das ist doch mein Besitz, den mir der vorwitzige Lehrling gestohlen hat!«
Die Räuber horchten auf und fragten, was der vermeintliche Gelehrte mit seinem Ausruf gemeint hatte. Da erzählte der Königssohn:
»Wisset, dass ich ein Meister der Geilheit bin und bis vor einigen Wochen einen Lehrling hatte, der alles andere als tüchtig war. Als ich ihn aus dem Dienst entlassen wollte, büchste er mitten in der Nacht aus und nahm meine wertvollste Habe mit sich. Darunter waren aber jene Fläschchen, ich erkenne sie wieder! Wie sind sie nur in eure Hände gekommen?«
Der Räuberhauptmann berichtete daraufhin von der Begegnung mit dem Jungen, wohlweislich ohne seine Kerle als die Bösewichter zu entlarven. Am Schluss seines Berichts lachte er:
»Als Meister hat er sich ausgeben wollen. Ein Glück, dass wir ihn aus dem Walde gejagt haben, diesen Lügenbold!«
Nun wusste der Königssohn, dass sein Liebster noch lebte und ihm kein Haar gekrümmt worden war. Er musste wohl mittellos und bar aller Kleider zu seinem Vater weitergereist sein. Wie sollte er ihm aber folgen, wo er nun selber in den Fängen der Räuber steckte? Freilich, sie behandelten ihn ehrerbietig, wollten sie doch wissen, was es mit den Tränken und Mixturen auf sich hatte. Da verfiel der Königssohn auf eine weitere List.
»Der Inhalt der Fläschchen ist gefährlich und nichts für Schwächlinge. Nur echte Kerle, die ordentlich Kraft im Leibe und Ausdauer in den Lenden haben, dürfen davon trinken. Rührt die Tränke also nicht an, liebe Freunde! Wer weiß, ob ihr die Geilheit bändigen könntet, die sie auslösen.«
Der Räuberhauptmann lachte schallend und mit ihm alle anderen.
»Wir sollen nicht kräftig genug sein?«, höhnte er. »Du meinst, wir seien keine echten Kerle? Na, dir werden wir es zeigen!«
Und er griff zum erstbesten Fläschchen, führte es an den Mund und trank es in einem Zug aus. Die anderen machten es ihm nach und soffen und becherten, bis kein Tropfen mehr übrig war. Zunächst vertrugen sie die Mixturen gut und es geschah nichts. Dann aber wurden ihnen die Beinkleider enger und enger. Die Nähte platzten und ihre Räuberknüppel sprangen hervor, feucht und schwitzig, und ihre Spitzen waren prall und leuchteten.
»Oh, dieser Druck, dieser Druck«, begannen sie zu stöhnen und konnten nicht anders, als ihre Hände immer wieder über die Knüppel zu reiben, damit das Blut darin in Wallung bliebe.
Die Verwunderung der Räuber über die Wirkung der Tränke hatte sich der Königssohn zunutze gemacht und war eiligst auf eine hohe Fichte geklettert, die vor der Höhle stand. Von dort rief er herab:
»Um den üblen Druck loszuwerden und bevor sich euer Blut in den Lenden verdickt, müsst ihr eure Knüppelchen versenken! Und zwar tief ins dunkle Reich, wo kein Sonnenstrahl hinfindet!«
Die Räuber erschraken vor diesen Worten, denn unter den zwölfen befand sich keiner, der sein dunkles Reich auch nur einem einzigen Kameraden zur Verfügung stellen wollte. Sie besaßen nämlich alle ausgesprochen dicke Knüppel, viel klobiger noch als die zwei geschnitzten Pfähle, die sie geraubt hatten. Aus diesem Grunde nämlich lauerten sie Durchreisenden auf, in der Hoffnung, das einer darunter war, der gern einmal einen ihrer Knüppel spüren wollte.
»Was sollen wir da tun?«, fragten sie ihren Hauptmann.
Der sagte:
»Hundsnase! Wo witterst du den Meister der Geilheit? Dessen dunkles Reich soll uns vom üblen Druck heilen!«
»Ich wittere ihn nirgends auf dem Boden«, erwiderte der Kamerad und kraulte sich winselnd die Mitte.
»Adlerauge! Wo siehst du den Meister der Geilheit?«, fragte der Hauptmann weiter.
»Ich sehe ihn nirgends in unserer Höhle«, erwiderte der Kamerad und fächelte sich ächzend Luft an die Lenden.
»Luchsohr! Wo hörst du den Meister der Geilheit?«
»Ich höre ihn draußen im Wipfel der Fichte schaukeln!«
Die Räuber stürzten hinaus, fanden den Baum und wollten ihn sogleich fällen, denn spitz und hart genug dafür dünkten ihnen ihre Pfähle zu sein. Der Königssohn merkte das und rief zu ihnen herunter:
»Also gut, ich will euch heilen! Klettert dafür einer nach dem anderen zu mir hinauf, aber hübsch langsam, damit ich mich jedem in Ruhe widmen kann.«
Den Kerlen blieb nichts anderes übrig, als darauf einzugehen. Zuerst durfte das Luchsohr hinauf, denn er hatte den Gelehrten aufgespürt. Als er oben angekommen war, sagte der Königssohn:
»Gib mir erst einen der beiden Holzpfähle!«
Das Luchsohr musste wieder herunterklettern, in die Höhle laufen und den Pfahl suchen. Indessen kletterte das Adlerauge hinauf.
»Gib mir erst den zweiten Holzpfahl«, verlangte der Königssohn.
Das Adlerauge stieg die Fichte wieder hinab, folgte dem Luchsohr in die Höhle und suchte mit ihm gemeinsam.
So kletterte einer nach dem anderen hinauf, nur um wieder fortgeschickt zu werden. Von dem einen verlangte der Königssohn die Kräuter zurück, die man dem Jungen genommen hatte; von dem anderen die leeren Fläschchen; der nächste sollte das gestohlene Pferd neben den Esel des Meisters einspannen; und der Folgende musste die Kutsche des Jungen an den Wagen des Königssohns hängen. So ging es immer weiter, bis alles Geld und Gut beisammen war. Da kam die Hundsnase hinaufgeklettert und der Königssohn sprach:
»Ich will die goldbestickten Kleider des Einäugigen haben.«
»Aber die gehören mir nicht, die gehören unserem Hauptmann«, entgegnete die Hundsnase.
»So kann ich dich auch von dem Druck nicht heilen. Kriege ich aber die Kleider, kann ich mich euch allen endlich in Ruhe widmen.«
Die Hundsnase musste wohl oder übel wieder hinunter.
»Was lasst ihr euch alle einen Bären aufbinden?«, spottete der Räuberhauptmann. »Schnappt euch den Bengel und benutzt ihn, statt seine Laufburschenaufträge auszuführen!«
»Wenn er uns aber anders nicht heilen kann«, gaben die Kerle zu bedenken und die Hundsnase sagte:
»Er braucht nur noch deine Kleider, Hauptmann, dann ist er willens!«
Dem wollte sich der Räuberhauptmann nicht fügen, doch als die anderen von der Bedingung hörten, stürzten sie sich auf ihn und rissen ihm alle Kleider von Leib, bis auf die Augenklappe. Das Blut drückte sie nämlich derart schwer in den Lenden, dass sie alle Achtung vor ihrem Anführer vergessen hatten.
Weil der Hauptmann nun völlig entblößt war und der Eingang zu seinem dunklen Reich weitaus näher schien als jener des Gelehrten hoch oben im Fichtenwipfel, nutzten die Kameraden die Gelegenheit und versuchten, ihre Schmerzen gleich an ihm zu lindern. So sehr der Nackte sich zu wehren suchte, ein jeder seiner Kameraden ließ ihn den Knüppel spüren und fand wohlsame Heilung. Einzig der Räuberhauptmann selbst musste mit einer Erdkuhle vorliebnehmen, in die sein Pfahl sich während der ganzen Rauferei tiefer und tiefer hineinbohrte.
Gerne hätte der Königssohn den Räubern zugesehen, wie sie sich keilten und hieben, doch er wusste, dass die Wirkung der Mixturen nicht mehr lange anhalten würde. Heimlich stieg er auf der anderen Seite der Fichte herunter, sammelte die Kräuter, Holzpfähle und Fläschchen ein, ergriff auch die goldbestickten Gewänder und lud alles in die beiden Wagen. Dann setzte er sich auf den Kutschbock und ließ Pferd und Esel zügig aus dem Walde traben.
Er fuhr ohne Rast, bis er in dem Dorfe angekommen war, wo sein Schwiegervater lebte. Die reich beladene Kutsche erregte großes Aufsehen, und als man die zwei Holzpfähle herauslugen sah, munkelte man:
»Das ist bestimmt ein Händler, der verschiedenes Gerät bei der Dorfhure verkaufen will!«
Einige freundliche Bewohner wiesen dem Königssohn auch gleich den Weg dorthin, und wie jene das sonderbare Gespann vorfahren und den Fremden im Gelehrtenmantel auf sich zukommen sah, wusste sie nicht recht, was sie anfangen sollte.
»Seid Ihr wegen unseres Tanzfestes bei uns, bei dem es immer hoch hergeht?«, fragte sie. »Falls ja, kann ich Euch leider kein Zimmer mehr vermieten, es ist alles voll.«
»Könnt Ihr mir denn kein anderes Haus nennen, wo ich unterkommen kann?«, fragte der Königssohn.
Ehe die Hure etwas zu antworten vermochte, seufzte jemand hinter dem Haus und man hörte es durchs Fenster. Der Königssohn fragte, wer denn da noch sei?
»Ei, das ist nur der Schweinehirt«, sagte die Dorfhure. »Der wird beim Tanze nicht gebraucht, weil er zu dumm ist für die Freuden aller Art.« Da schlug sie sich gegen die Stirn. »Ich weiß, ich werde den Vater dieses schwachsinnigen Jungen fragen, ob er noch ein Quartier für Euch hat!«
Und sie tippelte davon. Der Königssohn schaute derweil heimlich durchs Fenster und sah den Schweinehirten im Mist stehen. Wie er ihn erblickte, erkannte er in ihm seinen lieben Gemahl und hätte beinahe vor Freude geweint. Er tat ihm zugleich so leid, weil er so lumpig angezogen war. Allein er schaute nicht zurück, sondern richtete die Augen wehmütig gegen den Horizont.
»Heda«, rief der Königssohn seinem Gemahl zu, »was starrst du so traurig in die Weite? Sieh doch her!«
»Ach, geht nur, Fremder«, rief der Schweinehirt zurück, ohne sich umzudrehen. »Ihr könnt mir ja doch nicht helfen.«
Und ehe der Königssohn sich zu erkennen geben konnte, kehrte die Dorfhure zurück. Nun konnte der Königssohn seinem Gemahl nichts mehr zurufen, ohne sich selbst zu verraten, also ließ er es bleiben.
›Wollen sehen, was hinter der Angelegenheit steckt‹, dachte er bei sich und hörte mit Entzücken, dass der Vater des Schweinehirten wahrhaftig noch ein freies Zimmer für ihn hätte. Also zog er dort ein, wo sein Gemahl vormals gelebt hatte, und seine Kutsche mit allem Gut und Gerät wurde im Schuppen untergebracht. Der Vater ahnte nicht, dass er seinen eigenen Schwiegersohn als Gast beherbergte.
Wie sie nun am Abend zu dritt beim Essen saßen, der Vater, der ältere Bruder und der Königssohn, unterhielten sie sich über dies und das, und bald hatte der Bruder so viel Mut, dass er den Gast fragte:
»Eure Kutsche ist fein und voll von wertvollem Gut. Ihr seid gewiss sehr wohlhabend und kennt am Ende gar den König und sein Gefolge?«
Der Königssohn verbiss sich ein Kichern und antwortete ernst:
»Oh ja, den König kenne ich wohl. Ich komme gerade von ihm. Wisset, dass ich auf der Suche nach einem Meister der Geilheit bin; nach einem, der bereits mit einem einfachen Kusse die sinnlichste Lust entfachen kann. Den soll ich aufs Schloss führen.«
»Und Ihr nahmt den Weg in unser Dorf auf Euch, weil Ihr auf unserem Tanzfest den zu finden hofft, der auf die Stelle eines solchen Meisters passt?«
»Ganz richtig«, log der Königssohn. »Könnt Ihr mir vielleicht einen Eurer Nachbarn als geeignet empfehlen?«
Da sprang der ältere Bruder des Jungen von seinem Stuhl und rief:
»Ei, suchet nicht länger und wartet nicht erst, bis Ihr auf dem Tanzfest seid. Der Meister der Geilheit steht vor Euch!«
Der Königssohn erhob sich ebenfalls, trat auf seinen Schwager zu und sprach:
»So zeige denn deine Kunst im Kuss!«
Und wie sich die beiden zueinander beugten, berührten sich ihre Lippen. Allein kein wohliger Schauer durchzuckte den Königssohn. Der Atem des Schwagers war trocken und matt, seine Zunge fettig und schwer. Obgleich seine Hände versuchten, den Gast unter die Hüften zu packen, stieß der Königssohn den zudringlichen Burschen sanft von sich und schüttelte den Kopf.
»Du küsst wie viele und kannst kein Meister sein.«
Nun stand der Vater auf und sagte:
»Mein Sohn ist töricht, in seinen jungen Jahren sich Meister schon nennen zu wollen. Ihm fehlt es an Erfahrung, wie umtriebig er auch sein mag. Ich hingegen komme eher in Frage, hab ich doch weitaus mehr geküsst in meinem langen Leben als er.«
»So denn«, gab der Königssohn zurück, »versucht Ihr Euer Glück!«
Und er bot ihm die Lippen dar. Der Vater presste seinen Mund forsch auf den des Gastes, doch wieder tat sich nichts. Kein liebevoller Kampf der Zungen entstand, kein Nackenhaar regte sich, der Luftraum in den Hosen wich keiner wachsenden Anspannung.
»Es hilft nichts«, seufzte der Königssohn mit gespielter Traurigkeit. »Eure Familie scheint von keinem meisterlichen Können gesegnet zu sein, wenn’s zum Kuss und zur Wollust kommt.«
Da senkten Vater und Sohn die Köpfe und schämten sich. Ohne ein Wort zu sagen, setzten sie sich wieder. Der Königssohn aber blieb stehen und sprach:
»Gibt es denn keinen anderen Mann in Eurem Haus, mit dem ich es einmal versuchen könnte? Oder habt Ihr andere Verwandte in der Nähe?«
»Nein, wir sind nur zu zweien«, antwortete der Vater.
Sieh an, dachte sich der Königssohn im Stillen, er verleugnet den eigenen Sohn.
»Dann schafft mir den Sonderling her, der hinterm Haus der Dorfhure steht«, verlangte er laut. »Ich habe nun das Herumküssen begonnen und will nicht ruhen, bis ich nicht wenigstens einen guten Schmatz gekostet habe.«
»Versucht ruhig alle Männer des Dorfes, nur jenen Schweinehirten nicht«, warnten da Schwager und Schwiegervater entsetzt. »Er ist verrückt und versteht nichts von dem, was Ihr sucht.«
›Fahrt nur fort‹, dachte sich der Königssohn, ›und verleumdet euren Sohn und Bruder. Allein ich werde nicht lockerlassen.‹
Der Königssohn bestand darauf, dass der Schweinehirt ihm zugeführt werde. Da sandte der Vater den älteren Sohn zur Dorfhure und der erzählte dort, was los war.
»Wenn der Bote des Königs diesen Schwachsinnigen küsst, wird das übers ganze Dorf Schande bringen«, fürchtete sie, und ihr Gespons fügte hinzu:
»Geh nur und sage dem Gelehrten, der Schweinehirt würde sich weigern.«
Der Bruder kehrte heim und wiederholte die Worte, die ihm aufgetragen. Der Vater nickte und sagte zum Königssohn:
»Seht Ihr? Das Schindluder hütet lieber die Schweine! Da seht ihr, was für ein Dummkopf er ist.«
»Dummkopf oder nicht«, entgegnete der Königssohn, »wenn er ein schöner Mann ist, wird sich sein Besuch lohnen. Bringt ihn mir.«
Und er warf ein paar goldene Münzen auf den Tisch, deren Glanz sich in den Augen des Vaters widerspiegelte. Er griff nach dem Geld, und weil er nun als bezahlt galt und nicht anders konnte, musste er den jüngsten Sohn herbeiholen. So schlurfte er missmutig zur Dorfhure, machte den armen Jungen von der Kette los und führte ihn ins Haus seiner Kindheit zurück. Die Hure und ihr Gespons, neugierig auf den fremden Reisenden, folgten auf dem Fuß.
Sobald der Schweinehirte die Stube betrat, erkannte er in dem Gelehrten seinen Gemahl und wollte schon vor Freude aufjuchzen. Der Königssohn aber zwinkerte ihm zu, das Schweigen zu wahren, und tat, als würde er den Jungen zum ersten Mal aus der Nähe betrachten.
»So, so«, sagte er schließlich. »Auf einen Kuss will ich mich probehalber einlassen. Doch höre, Schweinehirt, willst du vorher vielleicht einen Becher Wein trinken?«
Er reichte ihm von dem besten Wein des Vaters und der Junge trank gierig. Das ging so heftig, dass ihm etwas davon aus den Mundwinkeln lief und die Kinnlade herabtroff.
»Seht, was für ein grober Kerl das ist«, sagte der ältere Bruder. »Von dem könnt Ihr keine Sinnlichkeit erwarten.«
»Das schadet nichts«, entgegnete der Königssohn. »Nun soll er mal seine Kräfte beweisen und irgendetwas umherschleppen.«
Er schaute suchend um sich. Eben wollte er sprechen, da fiel ihm der Junge selbst ins Wort und sagte frech:
»Das Einzige, was ich schleppen will, bist du, o gütiger Gast!«
Blitzeschnell fasste er den Königssohn, schwang ihn auf seine Arme und stürzte mit ihm zur Türe hinaus. Quer über den Hof lief er und eilte in den Schuppen, deren Eingang er von innen verriegelte. Die anderen waren hinterher gestürzt, doch wie sehr sie auch rüttelten und zogen, die Schuppentür gab nicht nach.
»Er wird dem Boten des Königs ein Leid zufügen«, schrie die Dorfhure.
»Er bringt unser ganzes Dorf in Verruf«, schimpfte ihr Gespons.
»Er wird verraten, dass er unser Fleisch und Blut ist«, fürchtete der Bruder.
»Dann wirft man uns zur Strafe in den Kerker«, jammerte der Vater.
Im Schuppen aber wurde es still. Der Junge lag in den armen seines Gemahls und erzählte ihm alles, was ihm zugestoßen war. Auch der Königssohn erzählte, und als sie nun wussten, dass ihre Not und Sorge ein Ende hatte, legten sie Lumpen und Mantel ab und suchten in der Kutsche nach dem goldbestickten Gewand. Der Königssohn nahm seine Krone vom Gürtel, setzte sie aufs Haupt und schritt, Arm in Arm mit seinem Liebsten, aus dem Schuppen heraus.
»Wer sagt, dass der Schweinehirt ein Schwachsinniger sei?«, fragte er streng. »Mein Gemahl ist’s, den ihr auf den Misthaufen gestellt habt, und ich bin kein einfacher Bote, sondern der Sohn des Königs!«
Da staunte der Vater und der Bruder glotzte und die anderen fielen auf die Knie. Sie alle baten inständig um Verzeihung, bis ihnen Tränen in den Augen standen. Der Junge indes zürnte ihnen nicht, sondern beschenkte sie mit Geld und Gut, das er in der Kutsche mit sich geführt hatte.
»Jetzt glaubt ihr mir, dass ich Gemahl des Königssohns geworden bin«, lachte er, »und ihr sollt auch glauben, dass aus mir ein Meister der Geilheit geworden ist!«
Er wandte sich seinem Liebsten zu, beugte sich zu seinen Lippen und schenkte ihm einen Kuss, so innig, dass es alle Zuschauer ringsum hochgradig erregte. Da riss ein Hosenknopf nach dem anderen ab und flog zu Boden, und den Grund dafür, den kann sich jeder denken.
***
»Schon wieder ein Ende, das viel ausführlicher ist als im Original«, staunt Arne. »Ich wusste gar nicht, dass man Märchen so vielfältig umwandeln kann!«
»Das ist nichts Ungewöhnliches«, meint Giovanni. »Viele von uns kennen ein Märchen nur in einer bestimmten Form, dabei gibt es von den meisten verschiedenste Varianten, die voneinander abweichen.«
»Und sofern verschiedene Erzählungen sich ergänzen und zu ihrer Vereinigung keine Widersprüche wegzuschneiden wären, kann man sie als eine ganze mitteilen«, fügt Wilko hinzu.
Die beiden scheinen sich mit Märchen sehr gut auszukennen und in mir keimt der Verdacht, die »Kinder- und Hausmärchen« seien nicht ganz zufällig auf dem Dachboden gefunden worden.
Arne will sich als Nächster im Märchenerzählen versuchen.
Herr Wolf und die sieben jungen Klosterschüler
Es war einmal ein gealterter Koch, dem man während der Pestzeit die Wirtschaft niedergebrannt hatte und der nun nicht wusste, wohin mit sich auf Erden.
»Mit Stehlen oder gar schlimmeren Verbrechen kommst du nicht weiter«, sagte er sich, »dein Leumund aber ist ruiniert, seitdem du den Kessel einem Pestkranken hinhieltest. Wunder genug, dass du dich nicht anstecktest, aber wie überlebst du jetzt in dieser entsagungsreichen Zeit?«
Solcherlei fragte er sich und wanderte ziellos durchs Land. Gewiss hätte er in der Fremde um eine betuchte Witwe freien können, allein nach Heirat stand der Sinn ihm nicht, denn ihm behagte die Beglückung, die seine eigenen Finger ihm boten, sehr viel mehr als das Liegen bei einem Weibe. Oft, wenn es in seiner Mitte zu brodeln begann, setzte sich der Koch unter einen Baum, umfasste seine krumme Schöpfkelle mit der rechten Faust und ließ den Daumen der Linken an seinen Vorratskammern spielen. Und wenn er so unter einem Baume saß und an seinen Kämmerchen zog, den kleinen Finger im Topf steckend, schüttete er heiter sein Süpplein auf die eigene Brust und freute sich des Lebens. Eines Tages erreichte er auf seiner Wanderschaft ein altes Klostergemäuer, das seit der Pest leer stand.
»Hier lässt es sich gut leben«, meinte er bei sich, als er den Garten, den Brunnen und die Schlafzellen sah. »Was ich zum Kochen und Braten benötige, kann ich anbauen und ernten, jagen und erlegen. Nur etwas einsam wird es mir werden.«
Doch der Mann hatte einen Einfall. Er gab sich in den umliegenden Dörfern als Mönch aus, der es sich zur Aufgabe gemacht habe, junge Waisenknaben bei sich aufzunehmen und ihnen ein ruhiges Klosterleben zu bieten.
»So landen sie weder auf der Straße als Bettler, noch verschwinden sie bei irgendwelchen erbarmungslosen Menschenhändlern«, sagte er.
Und obgleich der Mönch keinem bestimmten Orden angehörte, hörten verzweifelte Mütter und ratlose Angehörige erleichtert von seiner menschenfreundlichen Mission und überreichten ihm kleine Kinderchen, für die sonst kein Platz war auf dieser Welt.
Alsbald hatte der Mönch sieben kleine Knaben unter seiner Obhut: Den dunklen Nathanael, den blonden Paul, Ruben mit der Brille auf der Stupsnase, der hagere Simon, der sanfte Jonas mit den abstehenden Öhrchen, der lockige Matthias und der stotternde Lukas. Mit fleißiger Gartenarbeit, einem geregelten Tagesablauf und ordentlicher Haushaltsführung wuchsen sie zu verantwortungsvollen und achtsamen Klosterschülern heran. Der Garten bot ihnen Obst und Gemüse und freundliche Bauern hatten ihnen Hühner geschenkt, sodass es an Eiern und Fleisch nicht mangelte. Das freute den alten Mönch, der beabsichtigt hatte, alle sieben bis ans Lebensende bei sich zu behalten, sodass sie ihn ernähren würden und er keine Alterssorgen haben würde.
»Ich werde ihnen die nötigen Handwerke lehren«, sprach er zu sich. »Dann brauchen sie nie das Kloster zu verlassen.«
Insgeheim fürchtete er nämlich, sie könnten auf andere Leute treffen und sich fortlocken lassen. Doch ach!, eben jenes Einsperren brachte am Ende nichts, denn je länger es währte, desto mehr zerrissen sich die Leute die Mäuler darüber, was aus den Knaben nach all den vielen Jahren, die ins Land gegangen waren, wohl geworden sei. Das kam einem Landstreicher zu Ohren, der sogleich das Geheimnis um das entlegene Kloster lösen wollte, und das war der Herr Wolf. Er war groß, kräftig und behaart und litt außerdem unter unbändigem Heißhunger auf junge Männer, von denen er allzu gern kostete. Seitdem er in einem Dorf von den sieben Klosterschülern erfahren hatte, war er mehr als neugierig auf jenes Gemäuer.
›Wenn die Knaben bereits herangewachsen sind, möchten sie gewiss Erfahrungen sammeln, wie man sich laben und sättigen kann. Dabei könnte ich ihnen helfen!‹, dachte er sich und suchte das Kloster auf, unweit dessen er am Waldrand einen versteckten Verschlag zimmerte und sich dort auf die Lauer legte. Er konnte die Schüler bei ihrer Gartenarbeit und den Spaziergängen im Hof heimlich beschauen und stellte mit Freuden fest, dass sie dem herkömmlichen Lehrlingsalter bereits entwachsen waren und somit seinem Geschmacke vollkommen entsprachen. Zügig lernte er nun ihre Gewohnheiten und Sitten auswendig, um zur rechten Zeit einem jeden auflauern zu können.
Da waren zunächst Nathanael und Paul, die ihm ins Auge fielen. Sie zeichneten sich innerhalb der Klostermauern für das Schmiede- und Tischlerhandwerk verantwortlich. Drum wiesen sie eine recht stattliche Statur auf: Ihre Arme und Brust waren kräftig, die Schultern breit und gerade. Auch wenn der Mönch ihnen beigebracht hatte, dass Eitelkeit keine Tugend war, konnten beide nicht widerstehen, sich heimlich ab und an im spiegelnden Wasser des Brunnens zu bewundern. Nicht selten geschah es dabei, dass unter ihrer Kutte eine verräterische Wulst entstand. Unwissend, wie damit umzugehen sei, lösten sie diese Verlegenheit schlicht mit kaltem Wasser; den Unmut, der sie daraufhin befiel, wussten sie nicht zu deuten. ›Würden sie ahnen, wozu ihre Hände fähig sind, hätten sie schon oft ihr eigenes Spiegelbild im Brunnen mit frischer Knabensuppe begossen‹, dachte sich Wolf. Doch in die körperlichen Freuden hatte der falsche Mönch seine Schützlinge nie eingeweiht.
Ruben derweil lernte das Lesen und Schreiben. Sein Körper war längst nicht so männlich wie Pauls und Nathanaels, aber seine verschmitzten Augen hinter der Brille gaben ihm etwas Liebenswertes, fand Wolf. Gepaart mit einer angenehmen, tiefen Stimme war es kein Wunder, dass der Mönch und die anderen sechs Klosterschüler ihm gerne zuhörten, wenn er aus der Bibel vorlas. Manchmal blätterte Ruben zum Hohelied Salomons, aber er trug es nie laut vor, weil er sich die sonderbaren Zeilen nicht erklären konnte. In seinem Kopfe gleichwie in seiner Körpermitte schwelte zwar eine Ahnung, dass die Worte darinnen eine gewisse Verzückung verhießen, doch war er zu unsicher, um sich näher damit zu beschäftigen.
Simons zarte, dünne Hände hatten das Schneidern erlernt, sodass er jede Kutte und jedes Hemd seiner Klosterbrüder flicken, ausbessern oder erneuern konnte. Er liebte es zu reden, und wann immer er glaubte, eine besonders geistreiche Bemerkung gemacht zu haben, leuchteten die Knopfaugen in seinem schmalen Gesicht auf. Da musste jeder lächeln und Simon genoss das sehr. Bereitwillig hätte er sich jedem freundlichen Mund genähert, doch da er nicht wusste, was Küssen war, hielt er sich zurück, verwirrt über sein Bedürfnis.
Jonas schien Wolf etwas klein für sein Alter, aber aus seinem Versteck heraus erkannte er dessen freundliche und hilfsbereite Wesensart, da er alle Haushaltspflichten übernahm. Seine Haut war geschmeidig und jeder, der ihn ansah, hätte ihn am liebsten streicheln mögen, selbst wenn es nur seine abstehenden Ohren wären. Aber weil der Mönch es unterließ, sie in ihrer Unerfahrenheit aufzuklären, blieb den Schülern nur heimliches Schauen. Keiner von ihnen wusste, ob es richtig wäre, einander zu liebkosen.
Matthias und Lukas, die vielleicht knapp achtzehn Lenze zählten und somit am jüngsten waren, galten als die Sorgenkinder des alten Mönchs, denn Matthias liebte die Faulheit, Lukas hingegen stotterte aufgrund einer ausgeprägten Schüchternheit sehr. Matthias war hochgewachsen und hatte volles, lockiges Haar, in das Herr Wolf mit Wonne seine Pranken vergraben wollte. Er sah zu, wie beide dem Alten mit verschiedenen Botengängen und kleineren Arbeiten halfen, denn für ein eigenes Handwerk schienen sie ungeeignet. Der Mönch selbst herrschte in der Küche, kochte und briet schmackhafte Gerichte und sorgte für die Verpflegung. Allabendlich predigte er seinen sieben Schülern Zusammenhalt, Fürsorge und Anerkennung. Sie sollten einander achten, denn nur gemeinsam konnten sie für ein stilles, gutes Leben im Kloster sorgen.
Der Mönch wusste nicht, dass er eben wegen des Gebots der gegenseitigen Achtung den Keil der Scheu zwischen seine Schüler trieb. Da sie nicht wussten, was die anderen erwidern würden, traute sich keiner von ihnen, einem Kameraden etwas Zärtlichkeit zu schenken, geschweige denn dem körperlichen Appetit nachzugeben. So wunderte es nicht, dass die Mitte all ihrer Körper, in denen es schon seit geraumer Zeit brodelte, langsam überzukochen drohte und sich der Hunger nach dem Unbekannten in ihnen mehr und mehr anstaute.
»Nur der alte Greis beaufsichtigt sie, sonst ist keine Menschenseele vorhanden. Die Verführung dieser sieben Unschuldslämmer wird ein Kinderspiel«, grinste Wolf und leckte sich die Lefzen voller Vorfreude.
Während dieser Zeit, als der Landstreicher im Walde lauerte, fand der alte Mönch, dass einige Besorgungen für den nahenden Winter notwendig waren. Also sprach er zu den sieben jungen Klosterschülern:
»Liebe Jungen, ich muss für einige Tage hinaus in die Welt, vor der uns diese guten Mauern schützen. Seid auf der Hut, während ich fort bin, denn vielerlei Halunken treiben sich draußen herum, die unseren Garten plündern, uns berauben und unsere Hallen entweihen würden. Solch Bösewichte verstellen sich oft, aber ihr werdet sie gewiss erkennen.«
Nathanael antwortete:
»Lieber Vater«, denn so nannten alle den alten Mönch, »wir wollen uns schon in acht nehmen, Ihr könnt ohne Sorge fortgehen.«
Da nickte der Alte zufrieden und machte sich anderntags getrost auf den Weg. All das hatte Wolf gehört, der hinter der Mauer lauschte, denn das Fenster der Klosterstube war offen gewesen. Er wartete am nächsten Morgen, bis der Mönch sich entfernt hatte, und näherte sich dann dem Kloster. Durch einen schmalen Ritz im Gemäuer konnte er in den Hof sehen, worin Nathanael gerade mit Schmieden und Paul mit Holzhacken beschäftigt waren. War das ein Pläsier, ihnen zuzusehen! Nathanael hatte aufgrund der Flammenhitze seine Kutte ausgezogen und stand mit entblößtem Oberkörper am Amboss. Der Schweiß rann ihm vom Genick, die Wirbelsäule hinunter, bis zwischen die zwei festen Deckel seines runden Töpfchens.
»Wie gern würde ich die Brühe aus deinem Topfe lecken, Kleiner«, grunzte Wolf.
Seine Augen wanderten zu Paul, dessen kräftige Arme die Axt auf und nieder schwangen. Die Sonne ließ sein blondes Haupthaar funkeln. Mit jeder Bewegung konnte man erkennen, wie unter seiner Kutte etwas auffällig baumelte.
›Offenbar hat er für sein junges Alter bereits eine ordentliche Kelle‹, dachte sich Wolf. ›Das werde ich mir noch heute näher ansehen!‹
Er wusste, dass die Schüler alle in der Klosterküche ihr Mittagsmahl einnehmen würden, sobald die Sonne hoch am Himmel stand. Während dieser Mahlzeit kletterte Wolf über die Klostermauer und schlich sich in den dunklen schmalen Gang, wo es zu den Schlafzellen ging. Unterwegs kam er an einem Wäschekorb vorbei, schnappte sich eine Kutte und zog sie über den Kopf. Falls ihn jemand sähe, würde man ihn für den Mönchsvater halten.
Nach dem Mittagsmahl legten sich die Schüler stets für anderthalb Stunden zur Ruhe, jeweils zwei in einer Zelle. Auch das wusste Wolf aus seinen heimlichen Beobachtungen. Nur Matthias, der faulste, suchte sich jedes Mal einen anderen Ort zum Schlummern – mal war es der Strohhaufen, mal die Bank am Küchenofen. Ihm war jeder Platz recht, wo ihn niemand suchen würde, denn auf diese Weise kam der Müßiggänger um die lästige Pflege einer Schlafzelle herum.
Herr Wolf beobachtete aus seinem Versteck heraus, in welche Zelle Paul und Nathanael verschwanden. Er wartete kurz und klopfte dann leise an ihre Tür:
»Macht auf, meine Schüler, euer Mönchsvater ist da und hat aus dem Dorfe jedem von euch etwas mitgebracht.«
Nathanael und Paul lagen auf ihren Betten und waren über das Gehörte überrascht. So bald sollte der Alte zurückgekommen sein? Nathanael erhob sich, öffnete die Tür und wich im Nu zurück, entsetzt und fassungslos. Wolf stürzte herein, schlug die Tür zu und verriegelte sie. Er schnappte den sprachlosen Nathanael und hielt mit der anderen Hand Pauls Mund zu, der eben erschrocken um Hilfe rufen wollte.
»Keinen Mucks, meine Lieben«, warnte er, »sonst entgeht euch eine lehrreiche Erfahrung!«
Eingeschüchtert schwiegen die zwei. Als Wolf jedoch begann, Nathanael die Kutte abzuziehen und kleine, brühwarme Schweißperlen von seinen Schulterblättern zu schlürfen, wandelte sich ihre Angst in Neugier.
»Was Ihr da tut, fühlt sich sonderbar und schön an«, murmelte Nathanael.
»Deine Brühe schmeckt himmlisch nach Knabensalz«, erwiderte Wolf und leckte gierig über den Hals, die Achselhöhlen und den Rücken des Schülers.
Nathanael seufzte angetan, schloss die Augen und genoss das neue Gefühl auf seinem Körper. Paul glotzte die beiden an, beleckte sich die Lippen und spürte, wie eng es unter seiner Kutte wurde. Als Wolf schließlich den Topfdeckel Nathanaels mit seinen Lefzen liebkoste und seine Zunge den engen Rand erreichte, winselte Nathanael geradezu auf. Paul war davon derart entflammt, dass er seine Kutte abwarf und rief:
»Fremder, so verwöhnt auch mich! Seht doch meinen kräftigen Körper, gefällt er Euch nicht genauso wie der meines Zellenbruders?«
Der ungebetene Besucher ließ sein wölfisches Grinsen sehen, gab Nathanael einen Klaps auf sein Topfdeckelchen und befahl ihm, nun seinen haarigen Körper zu lecken.
»Ich kümmere mich derweil um deinen blonden Freund hier«, sagte er und beugte sich über Paul. Seine Zungenspitze kitzelte an dessen Schöpfkelle, welche zu zucken begann. Paul staunte über die Wirkung, empfand aber die feuchten Schmatzer des Fremden auf seinem Stiel als Wohltat. Er ahnte, dass dies genau die Gefühle waren, die er beim Anblick seines Spiegelbildes im Brunnen bisher vermisst hatte.
»Lecke weiter, bitte«, flehte er und wurde erhört; Wolf nahm die prächtige Kelle nun ganz in seinen Schlund und züngelte daran. Gleichzeitig kostete Nathanael zaghaft das Salz der behaarten Arme des Fremden, schmiegte sich immer enger an ihn und streichelte den mächtigen Kessel.
Paul und Nathanael gaben Töne von sich, an denen Wolf leicht merkte, wie lang die zwei nach Zuneigung gehungert haben mussten. Während Pauls Hände seinen Kopf packten, um den Stiel tiefer in den Rachen zu senken, klammerte sich Nathanael liebesbedürftig an den breiten Männerrücken.
»Die zwei haben zu lange darben müssen«, erkannte Wolf. »Wird Zeit, dass sie gesättigt werden!«
Er lutschte stärker und noch stärker an Paul und jener fuhr unwillkürlich zusammen. Nathanael hatte indessen herausgefunden, wie es seinem steifen Löffel wohltat, sich an der haarigen Haut des großen Fremden zu reiben. So dauerte es nicht mehr lange, bis sich Pauls warmes Knabensüppchen in das Maul des Fremden ergoss, der alles gierig aufnahm und schluckte, während Nathanael den Rücken des Besuchers beträufelte und ein hörbarer Atemzug, eine Mischung aus Verwunderung und Wohlgefallen, seiner Kehle entfuhr.
Ausgeschöpft und ermattet von dieser überraschenden Beglückung glitten die zwei Schüler auf den Boden hinab und versuchten, mit geschlossenen Augen das eben Erlebte zu verarbeiten. Ihre Brust hob und senkte sich vom schweren Atem, ein Bild, welches Wolf so sehr gefiel, dass er nun endlich seine eigene Rute in die Hand nahm und kräftig umfasste, bis schwere Tropfen heißer Wolfsmilch auf die Klosterschüler fielen und sie endgültig zu gereiften Männern machten. Sie verrieben die fremde Flüssigkeit auf ihrer entblößten Haut, rochen daran und waren verzückt. Der würzige Duft vernebelte ihre Sinne. Wolf sah den beiden zu, wie sie glücklich lächelnd auf dem Boden lagen und in einen leichten Schlummer fielen.
»Ihr werdet noch aufregende Rezepte kochen«, murmelte er, entriegelte die Tür und schlich sich davon.
Der Zauber der ersten Erfahrung hielt jedoch nicht lange an. Paul und Nathanael begannen, sich für ihre Taten zu schämen.
»Wenn sie gut und erlaubt wären, hätte unser Mönchsvater solcherlei Dinge nie vor uns verheimlicht. Nein, wir dürfen so etwas nie wieder tun«, schworen sie.
Und um ihre Klosterbrüder zu schützen, erzählten sie ihnen am Abendbrottisch von dem Fremden.
»Er schleicht sich lautlos an die Tür«, erklärte Paul, »aber ihr könnt ihn an seiner rauen Stimme erkennen. Öffnet ihm nicht!«
Wolf hingegen hatte sich zufrieden in seinem Versteck hingelegt und schnarchte. Paul und Nathanael hatten ihm gut geschmeckt, ihr Knabenduft war herrlich und ihr Getön Musik in seinen Lauschern gewesen. Als er wieder erwachte, war es Abend geworden und durch die erleuchteten Fenster des Klosters konnte er sehen, dass der alte Mönch noch nicht zurückgekehrt war. Also nahm er sich vor, den Abend für eine weitere Verführung zu nutzen.
»Diesmal nehme ich mir den Dünnen und den Verschmitzten mit der Brille vor«, sagte er und leckte sich das Maul, während er die Wolfsrute in seiner Hose zurechtrückte.
Doch als er später an der Zelle von Simon und Ruben anklopfte und Einlass begehrte, antworteten ihm die beiden:
»Wir machen nicht auf! Du bist unser Mönchsvater nicht. Der hat eine sanfte und liebe Stimme, aber deine ist rau!«
Wolf knurrte in sich hinein.
»Sollten die zwei Großen mich verraten haben? Sollte die keusche Erziehung des Mönchs ihnen noch immer körperliche Beglückung verbieten?«
Er zog ab und überlegte die ganze Nacht, wie er die Schüler täuschen könne. Als die Sonne aufging, kam ihm ein Einfall.
»Der Kantor der Dorfkirche wird mir helfen, der versteht was von Gesang und kann meine Stimme schulen«, sagte er sich und stattete besagtem Manne einen Besuch ab. Dort kam er ohne Umschweife auf sein Begehr:
»Hört, Kantor, meine tiefe Männerstimme verrät mich zu sehr. Ich will in höheren Lagen sprechen können. Bringt mir bei, wie ich meine Stimme steigern kann!«
Der Kantor wunderte sich, weshalb ein Mann mit solch einer schönen tiefen Stimme unbedingt höher sprechen wollte, sagte aber nichts, sondern fragte lediglich nach der Bezahlung. Nun war Wolf zurzeit nicht gut bei Kasse und befürchtete schon, abgewiesen zu werden. Doch der Kantor sprach:
»Ich schlage Euch einen Handel vor, Wolf. Ich werde Euch ein paar Kniffe zeigen, ohne dass Ihr bezahlen müsst, aber dafür will ich Eure heiße Wolfsmilch trinken. Schon lange möchte ich mich einem haarigen Biest wie Euch hingeben!«
Wolf war freudig überrascht über jene Worte, denn gleichgesinnte Männer begegneten ihm nicht oft. So öffnete er seine Hose und der Kantor stürzte mit gierig aufgerissenem Mundstück auf die Rute, die er leckte und besabberte, bis sie von Spucke ganz nass war.
»Für den Kniff, die Stimme zu heben, muss alles schön triefen«, behauptete der Kantor und schlürfte nun an Wolfs dickem Vorratsspeicher.
Der ließ ein wohliges Knurren hören. Schließlich nahm der Kantor seine Hände dazu, knetete den Speicher zuerst zärtlich, dann immer fester und zog daran. Wolf musste aufjaulen, aber es war nicht nur Schmerz, den er da empfand. Der Kantor nahm eine Kordel zur Hand und band sie geschickt um beide Vorratsspeicher. Eine zweite trennte die beiden Kammern voneinander, sodass sie groß und blau herausquollen.
»Das ist der erste Schritt zu einer höheren Stimme«, erklärte er. »Jetzt bücke ich mich und deine Rute muss mich so wacker begatten, dass deine Kammern an die meinen klatschen und mein Taktstock sich ohne Zutun hebt und senkt!«
Gesagt, getan: Der Kantor entledigte sich seiner Hose, ging auf alle viere herunter und präsentierte seinen gefälligen Rücken dem Besucher. Herr Wolf, dessen Vorratskammern drängend und drückend zwischen den Schenkeln baumelten, grinste wieder räuberisch, beschaute sich die einladende Öffnung, setzte seine aufgerichtete Rute an und ließ sie hineinfahren. Es ging auffallend leicht – der Kantor musste Übung darin haben, Männer in sich aufzunehmen.
»Du kleiner Notenständer, dich werde ich nun zum Jubilieren bringen!«, rief Wolf und bewegte sein Becken ruckartig im zügigen Marsch. Der Kantor sang und trällerte vor Begehren, denn ein solch wildes Biest hatte er lange nicht mehr in sich gespürt.
Wolf verstand sich aufs Begatten, sodass sein abgebundener Speicher wie gefordert laut an die Sackpfeife des Kantors klatschte, wieder und wieder. Das war Wohlklang in den Ohren der beiden! Doch kurz bevor die Wolfsmilch spritzte, drehte sich der Kantor um.
»Lass mich alles schlucken«, rief er und öffnete sein Mundstück abermals.
Wolf, der es ohnehin nicht länger aushielt, gehorchte und ließ seine Milch in den Rachen des anderen laufen, dem es sichtlich schmeckte. Als kein Tropfen mehr herausgequetscht werden konnte, erhob sich der Kantor und sprach:
»Jetzt öffne auch du dein Maul, Wolf, und lass mich deinen Gaumen beträufeln! Diese Art von Gurgelwasser ist der zweite Schritt zu einer lieblicheren Stimme.«
Der Kantor richtete sich auf und Wolf sank auf die Knie. Allein das war ihm ein wundersames Gefühl, denn jede Bewegung ließ ihn seinen abgebundenen Vorratsspeicher deutlich spüren. Er packte den Taktstock des Kantors, führte ihn an seine Lefzen und spürte, wie er zunehmend zuckte. Da steckte er sich alles tief in den Schlund und ließ das Kantorensüpplein in seine Kehle rinnen, bis der Taktstock völlig leer war. Wolf schmatzte und gestand sich ein, dass der Besuch beim Kantor allemal ein guter Einfall gewesen war.
»Lass die Kammern gebunden und trink nichts, um das Gurgelwasser in der Kehle zu behalten. So bleibt deine Stimme für die nächste Stunden geschmeidig«, erklärte der Kantor. »Wenn du ihre Höhe erhalten oder erneuern willst, komm wieder bei mir vorbei.«
Wolf bedankte sich für den Rat und lief zurück zum Kloster, denn es war beinahe Mittagsstunde. Durch den Ritz in der Mauer betrachtete er Simon und Ruben, wie sie im Garten arbeiteten. Als er sah, wie Simons zarte Hände eine lange, dicke Gurke reinigten, dachte er sich im Stillen:
›Deine Finger werden bald ganz woanders reiben!‹
Kurz darauf versammelten sich die Klosterschüler in der Küche für ihr Mittagsmahl, während Wolf sich, erneut in eine Kutte gehüllt, hinter den Säulen des Flures versteckte, der zu den Schlafzellen führte. Als die sieben sich zur mittäglichen Ruhe legten, suchte er die Tür von Rubens und Simons Zelle heraus, klopfte an und flüsterte:
»Macht auf, liebe Schüler, euer Mönchsvater ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht!«
Die beiden Insassen hörten die sanfte Stimme und glaubten, dass endlich der Alte zurückgekehrt sei. Ruben sprang in freudiger Erwartung an die Tür und entriegelte sie. Sofort packte ihn die Pranke des Herrn Wolf, der in die Zelle stürzte, abschloss und Ruben auf die Knie zwang.
»Mir drückt es ungemein, abgebunden wie ich bin«, hechelte er, »nun lecke und lutsche an mir, bis ich schön nass bin!«
Ruben, der noch nie einen dicken Vorratsspeicher, geschweige eine solch prächtige Rute gesehen hatte, war wie verhext und tat, wie ihm geheißen. Simon dagegen wollte sich unter seiner Decke verstecken, doch die Männerpranken packten auch ihn und lenkten ihn dem haarigen Kessel zu.
»Zeig, was deine Finger können, mein Klosterschüler, und walke mich dort so fest, wie man einen Teig zu kneten versteht!«
Simons dünne Finger griffen in den festen Kessel und irgendwie gefiel es ihm, so einen menschlichen Teig zu walken.
»Fester!«, befahl Wolf. »Und vergiss den brühenden Rand nicht! Stippe deine Finger hinein, ja! Spuck drauf! Genau so! Nun tu deine Greifer tiefer hinein!«
Simon war zunächst gehemmt, doch der Fremde war so groß und stark, dass er Angst hatte, ihm nicht zu gehorchen. Außerdem war Ruben fleißig dabei, an der Rute des Fremden zu lutschen; wenn sein Zellenbruder gehorchte, musste er es auch. Also schob er seine Finger, einen nach dem anderen, in den Kessel hinein. Es fühlte sich warm und weich darin an und Simon hörte, wie Wolf jaulende Töne von sich gab.
›Es muss ein schönes Gefühl sein‹, dachte er bei sich, ›und um den Fremden gnädig zu stimmen, will ich ihm weiterhin schöne Gefühle schenken.‹
Beide Schüler verwöhnten also Wolfs Rute und Teigkessel und konnten nicht verhehlen, dass sie ein großes Behagen bei der Sache empfanden. Ihre Kutten glitten wie von selbst von ihren Körpern und entblößten ihre steifen Löffelstielchen, die beide zu funkeln begannen. Wolf setzte sich inmitten der zwei und sie mussten ihre Köpfe auf seine Schenkel legen, während ihre Hände den Vorratsspeicher des Fremden verwöhnten. Wolf selbst wollte seine Lehrlinge an der Freude teilhaben lassen, kraulte ihre bloße Brust, knetete ihre jungen Topfdeckelchen und umfasste endlich ihre steifen Löffel – etwas, das sie sich selbst nie zuvor getraut hatten. Da staunten die beiden in den höchsten Tönen, begannen zu zittern und Wolf spürte, wie sich der zarte Flaum ihrer Haut aufrichtete.
»Das regt euren Appetit an, wie? Aber es gibt noch weitere schmackhafte Rezepte, wie ich unlängst selbst gelernt habe«, grinste er und ließ seine Finger zu den Vorratskämmerchen der beiden wandern. Zart drückte er zu, dann zog er etwas daran. »Spürt ihr, wie sich eure Löffelstiele dadurch noch weiter emporrecken? Ist das nicht herrlich, wenn einem vor Druck und Drang fast die Rute platzt?«
Er kraulte mit seinen Pranken die Stiele von Simon und Ruben und benetzte sie auf diese Weise mit dem Vorsüppchen, welches daraus hervorquoll. Dann steckte er seine feuchten Zeigefinger den beiden in den Mund, sodass sie ihren eigenen Geschmack kosten konnten. Hungrig nuckelten sie daran und Simon, der mutigere der beiden, fasste sich schließlich ein Herz und fragte:
»Was wir hier tun, behagt mir ungemein, doch langsam schmerzt mich die Steifheit meines Löffelchens und mir deucht, irgendetwas müsse folgen, müsse getan werden!«
Da lachte Wolf und streichelte ihre Häupter.
»Schön, dass ihr so lernwillig seid. Zuerst sollt ihr mich vom Druck befreien: Lutscht an meiner Rute noch etwas mehr, und wenn etwas Weißes herausquillt, so erschreckt nicht, sondern trinkt. Eine heiße Milch ist’s, die euch munden soll!«
Die Schüler gehorchten, leckten noch inniger an Wolfs Rute und schon bald entlud sich seine Wolfsmilch in hohen Fontänen, welche Ruben und Simon versuchten, mit dem Munde aufzufangen. Ihr Schmatzen verriet, dass der herbe Geschmack tatsächlich ihren Gefallen fand.
»So wie ich könnt auch ihr euch entladen«, versprach Wolf, hieß seine zwei Schüler aufstehen und nahm beide Knabenlöffel zugleich in sein Maul. Erfahren, wie er war, schlürfte er gekonnt an ihnen, und Ruben und Simon konnten vor Erregung kaum auf ihren Beinen stehen. Daher stützten sie sich gegenseitig mit den Armen, während sie ihre Hüften an die starken Schultern ihres Besuchers lehnten. Beinahe gleichzeitig verschütteten sie ihr Süpplein und Wolf trank gierig davon.
›Welch Glück, so viel an einem Tag zu kosten‹, dachte er sich dabei.
Ruben und Simon waren von diesem Gelage ausreichend gesättigt, sodass sie müde in sich zusammensackten und nur Wolfs starke Pranken sie auffangen konnten. Er legte jeden von ihnen in sein Bett und streichelte sie zum Abschied. Während die zwei Klosterschüler langsam einschliefen, zog er sich seine Kleider an und schlich aus dem Kloster.
Doch wenn Wolf dachte, dass nun vier von sieben Schülern auf seiner Seite stünden, hatte er sich geirrt. Wie die beiden anderen am Vortag plagte Ruben und Simon schon bald das schlechte Gewissen. Nicht nur, dass der Fremde auch sie verführt hatte, nein – er hatte sie sogar gezwungen, seine Wolfsmilch zu trinken und ihre Finger in seinen kochenden Kessel zu stecken.
»Das ist schlimmer als das, was er Paul und Nathanael antat«, meinte Ruben. »Wir müssen die anderen warnen!«
Und das taten sie während des Abendbrotes auch.
»Er hat keine raue Stimme mehr«, erzählte Simon, »sondern verstellt sich gekonnt. Man kann ihn nur an seinen vielen Haaren erkennen, denn unser echter Mönchsvater hat zarte, rosige Haut. Am besten lasst ihr euch erst seine Hand zeigen, bevor er ihn einlasst. Ist sie behaart und kräftig, muss es der Fremde sein.«
Die anderen nickten. Als es Abend wurde und Wolf an die Tür von Lukas und Jonas klopfte, verlangten sie, dass er zunächst seine Hand unter dem Türschlitz zeige. Wolf wunderte diese Bitte, aber er tat es. Da rief Jonas:
»Du bist unser Mönchsvater nicht! Er hat eine rosafarbene Hand. Deine ist aber haarig und groß!«
Und Lukas stotterte:
»D-du b-bist der-der-der Fremde! G-geh fort!«
Da musste Wolf unverrichteter Dinge gehen und fragte sich, wieso die Klosterschüler so schwer von den Freuden der körperlichen Zuneigung zu überzeugen waren. Doch noch war der alte Mönch nicht zurückgekehrt. Somit blieb ihm noch Zeit, auch den Rest zu verführen. Über Nacht kam ihm im Schlaf ein Einfall, wie er Jonas und Lukas täuschen könne. Er lief am folgenden Tag zu einem Barbier in einem nahen Dorf und bat:
»Bitte rasiere meinen Körper, er muss glatt und geschmeidig sein!«
Der Barbier war ein stämmiger Mann mit Spitzbart und Glatze. Er beäugte den stattlichen Herrn und erwiderte:
»Das will ich gern tun, denn Eure Statur gefällt mir und wird prächtig zur Geltung kommen, wenn sie rasiert und eingeschmiert ist. Doch verzeiht mir, wenn sich während der Arbeit in meiner Hose etwas regt – schöne Männer lassen mein Gehänge stets wachsen.«
»Das soll dein Schaden nicht sein«, sagte Wolf. »Ich will mich nach getaner Arbeit gern um dein Gehänge kümmern und meine Wolfsmilch soll deine Glatze zieren!«
Das hörte der Barbier mit Freuden und begann seine Arbeit. Er befreite Wolf aus den Kleidern, befeuchtete seinen Körper und seifte ihn mit sanften Griffen ein. Dann nahm er sein Rasiermesser und ließ es über Wolfs breite Brust gleiten, über die kräftigen Arme und großen Pranken. Vorsichtig entfernte er die Haare um die Brustwarzen, noch vorsichtiger das Achselhaar und am vorsichtigsten rasierte er das Schamhaar rund um die Rute.
»Ihr habt wirklich einen schönen Körper«, lobte der Barbier den Kunden, als er schließlich das Haar und die Seife abspülte. »Jetzt muss ich Euch einfach auf die neuen freien Stellen küssen!«
Sprach es, beugte sich über die Vorratskammern und schlürfte ausgiebig daran. Dann rutschte er mit der Zunge die Rute entlang bis zur Spitze und nahm sie in den Mund, kräftig daran nuckelnd. Wolf hielt den Kopf des Barbiers fest und drang fordernd in dessen Rachen.
»Lass mich in dein Süßholz raspelndes Maul einfahren«, knurrte er.
Der Barbier lutschte immer kräftiger an Wolfs Rute, zog sich dabei aus und entblößte seine stämmige Figur. Wolf kniff ihm in die Brustwarzen, zog ihn an sich heran und raunte:
»Jetzt will ich mich, wie versprochen, um dein Gehänge kümmern!«
Er nahm des Barbiers Bürstenkopf in sein Maul und zeigte sich sehr erkenntlich. Wie beim Kantor gelernt, knetete er den Gespielen, der heißhungrig hechelte und immer wilder wurde. Endlich sprühte er seinen ureigenen Rasierschaum auf Wolfs frisch enthaarte Brust, der ihn großzügig darauf verrieb.
»Jetzt kann meinem Körper keiner mehr widerstehen«, sagte er, stand auf und zwang den Barbier auf die Knie. »Hier noch dein Lohn, mein Freund«, lachte er und schleuderte ihm eine gehörige Ladung weißer Wolfsmilch auf die Glatze.
Der Barbier schien das durchweg zu genießen, ließ die Flüssigkeit über den Kopf ins Gesicht laufen bis in den Spitzbart hinein, wo sie kleben blieb.
»Danke«, hauchte er und sog den Geruch tief mit der Nase ein. »Das ist besser als jedes Duftwasser!«
Wolf machte sich zufrieden auf den Weg ins Kloster. Obwohl er gerade ein aufregendes Abenteuer erlebt hatte, spannte ihn der Gedanke an die zwei neuen Unschuldslämmer dermaßen auf die Folter, dass seine Rute nicht abschwellen wollte, sondern halb aufrecht blieb. Flink wie er war, brauchte er nicht lange, bis er vor der Türe stand und anklopfte.
»Euer Mönchsvater ist zurückgekehrt und hat jedem von euch etwas mitgebracht«, sagte er mit heller Stimme und ließ seine haarfreie Brust durch die Kutte sehen.
Jonas und Lukas glaubten, der Alte stünde vor ihrer Zelle und öffneten ihm. Da packte Wolf den kleinen Jonas, zwang ihn auf alle viere und zog ihm die Kutte ab. Seine samtene Haut schimmerte im Sonnenschein, der seine Strahlen durch das Fenster schickte, und Lukas, der zugleich erschrocken und hingerissen war, konnte seinen Blick nicht mehr von ihm wenden. Wolf befahl, dass auch er sich entblößen solle.
»Eure Klosterbrüder haben dir bereits erzählt, was ich mit ihnen angestellt habe. Nun stecke dein kleines Löffelchen zwischen die Lippen deines Kameraden, und der soll zeigen, was er kann!«
Lukas wollte stotternd etwas entgegnen, doch Wolf sah ihm so streng ins Gesicht, dass er artig seine Augen niederschlug und gehorchte. Jonas musste den Löffel seines Zellengenossen abschlecken, bis der Stiel immer größer wurde. Lukas gab eine Art »Huch!« von sich, als er unbekannte Gefühle in seiner Mitte spürte. Wolf aber bückte sich zu Jonas’ Rücken herunter, leckte den engen Topfdeckel, bis er triefte, und tunkte seinen Daumen hinein. Jonas erschrak und musste sein Tun unterbrechen, doch Wolfs Pranken waren unerwartet zärtlich, wenn es um die erste Begattung eines Neulings ging. Schon bald konnte er zwei Finger hineinlassen und schließlich sogar drei.
»Nicht nur deine Haut fühlt sich weich und schön an, Jonas, auch dein Töpfchen ist verlockend«, lachte er, setzte seine Rute an und senkte sie hinein. »Wird Zeit, dass dort ein Schlemmer abschmeckt!«
Jonas fuhr laut auf und hielt sich an den Beinen von Lukas fest. Der starrte mit seinen dunklen Augen auf das Geschehen und streichelte das Haupt seines Klosterbruders, ohne es zu merken. Die Zärtlichkeiten auf seinem Haar und das robuste Rühren in seinem Töpfchen verwirrten Jonas auf angenehme Weise, und bald fanden die drei einen einheitlichen Takt. Die Knabenenge schmiegte sich wohlig um Wolfs Rute, bei jedem Abschmecken ging ein aufregendes Zittern durch Jonas und er leckte immer gekonnter Lukas’ Löffelstiel, welcher bald seinen Hals fütterte.
Da zog Wolf seine Rute aus Jonas heraus und befahl den zwei Schülern, die Stellungen zu tauschen. Nun war es an Lukas, zuerst den dicken Männerdaumen und schließlich die Prachtrute in sich aufzunehmen, während er am Schöpfkellchen von Jonas lutschte. Der war inzwischen so aufgeregt, dass er recht hurtig sein siedendes Süpplein ausgoss, und mit ihm verschüttete auch Wolf eine Ladung auf Lukas’ schmalen Rücken. Er tunkte seine Rute hinein, badete sie geradezu darinnen und die Wärme klebte an ihm.
»Nun lasst euch füttern, diese Milchsuppe macht fein satt«, feixte er und schob die Überreste des Gelages in die hungrigen Mäulchen, die folgsam Wolfs Rute säuberten, bis alles fort geschlemmt war. Wie schon die Klosterbrüder vor ihnen betörte der herbe Duft der Wolfsmilch die beiden und sie sanken verstört zu Boden, einander umschlingend. Wolf aber war zufrieden: Endlich hatte er zwei Klosterschüler vollends begatten dürfen.
»Spätestens diese hier werden den Verlockungen weiterer körperlicher Abenteuer nicht widerstehen können«, dachte er bei sich und verließ die Klostermauern.
An diesem Abend aber kehrte der alte Mönch endlich von seiner Reise zurück. Er wunderte sich, dass nur noch Matthias auf den Beinen war, um ihn zu begrüßen.
»Du freust dich so, mich zu sehen, mein Sohn, und doch merke ich, dass du etwas auf dem Herzen hast«, sprach er.
Da senkte Matthias den Kopf und erzählte:
»Ein Fremder trieb hier sein Unwesen. Er hat sich in die Zellen der anderen gestohlen und seltsame Dinge mit ihnen gemacht. Wir versuchten, ihn fortzuschicken, doch ihm fielen stets neue Verstellungen ein, um uns zu täuschen. Nur ich bin noch übrig, mich hat er nicht gefunden, denn ich habe im Kasten der alten Standuhr gesteckt.«
»Warum ausgerechnet dort?«, fragte der Mönch.
»Ganz einfach«, erwiderte Matthias. »Im Uhrwerk schwingt das Pendel so lustig hin und her und stupst meinen Löffel an, dass er aufgeregt von der linken zur rechten Seite hüpft und wieder zurück.«
Solch unflätiger Missbrauch von Möbeln und ihrer Mechanik missfiel dem Mönch, doch der Bericht über den Eindringling bescherte ihm weitaus größeres Unbehagen. Also wollte er nach den anderen sehen und Matthias erst später eine Predigt erteilen.
Indessen hatten sich Paul und Nathanael in ihrer Zelle entkleidet. Seit Wolf dagewesen war, taten sie das jedoch nicht mehr so zwanglos wie früher, sondern schauten einander verstohlen an. Am heutigen Abend überwand sich Paul und sprach zu Nathanael:
»So sehr ich mich anfangs schämte, wie der Fremde uns verführt hat, so sehr hungere ich danach, noch einmal solche Gefühle zu erleben.«
Nathanael nickte:
»Vielleicht tat er das nicht, um uns zu schänden, sondern um uns zu zeigen, wie wir unsere Körper beglücken können?«
Sie sahen einander das erste Mal seit Tagen ins Gesicht, tief in die Augen. Unwillkürlich lächelten sie sich an und Paul ging einen Schritt auf Nathanael zu.
»Weißt du, Nathanael, früher bewunderte ich nur meinen eigenen Körper im Spiegel des Brunnens. Aber nun merke ich, wie schön auch du bist!«
Er berührte Nathanaels Brust und strich mit den Händen darüber. Nathanael überfiel eine Gänsehaut.
»Kraule mich weiter«, bat er, »das ist so schön! Auch sehe ich, dass deine und meine Kelle wieder mit Blut gefüllt aufrecht stehen, wie damals, als der Fremde uns verwöhnte. Lass unsere Körper in enger Umarmung aneinanderschmiegen – ich erinnere mich, wie herrlich das war, als ich dem Fremden so nahe sein durfte.«
Paul willigte ein und sie nahmen sich in die Arme. Ihre Schöpfkellen trafen sich, und feucht von kleinen Perlen des Vorsüppchens rieben sie aneinander. Sie seufzten leise vor Glück, legten sich auf Pauls Bett und schmusten innig. Ausgerechnet in jenem Moment schaute der alte Mönch durch die Tür. Die Schüler bemerkten ihn nicht, doch er erschrak:
»Der Fremde hat ihnen das Schlemmen beigebracht!« Er schloss die Tür und ließ Nathanael und Paul bei ihrem Tun allein. »Ich hoffe nur, dass die anderen noch unversehrt sind!«
Doch als er in die nächste Zelle schaute, bot sich ihm ein noch schlimmeres Bild: Ruben und Simon lagen auf dem Boden, der eine mit dem Kopf nach Norden, der andere mit dem Kopf nach Süden. Während Simon seine Finger in Rubens Töpfchen tunkte und darin rührte, sodass dieser immer wieder laut auffuhr, hielt Ruben Simons steifen Löffel umklammert und lutschte daran. Seinem Schmatzen war deutlich zu entnehmen, wie sehr ihm dieses Knabenteil mundete. Es war offensichtlich: Auch Ruben und Simon hatten über das Erlebte gesprochen und es nicht mehr ausgehalten – sie mussten wiederholen, was sie mit dem Besucher erlebt hatten.
»Der Fremde hat sie das Füttern und Sättigen gelehrt«, erschrak der Mönch, abermals von seinen Schülern unbemerkt. »Ich hoffe nur, dass die letzten beiden noch unversehrt sind!«
Doch als er in die dritte Zelle sah, bot sich ihm das schlimmste Bild: Jonas war gerade dabei, Lukas vehement ins Töpfchen zu stippen. Lukas hatte sich seinen Daumen in den Mund gesteckt, um nicht lauthals zu hecheln. Beide Körper waren in ihrer eigenen Schweißbrühe gebadet – offenbar waren sie schon eine ganze Weile mit diesem Tun beschäftigt, und der Mönch konnte sehen, dass all die Zeit über Lukas’ Löffelstielchen steif vom Körper abstand.
»Er wird doch nicht…«, hoffte er, doch vergebens. Lukas stotterte gerade, er wolle die Rollen tauschen, und Jonas zog sein Kellchen aus ihm heraus und legte sich willig auf den Rücken.
»Dieses Gewürz haben wir noch nicht probiert«, lächelte er Lukas an und der tunkte seinen Stiel in den schäumenden Topf seines Klosterbruders; das Abschmecken ging von vorne los.
Der Mönch schloss auch diese Tür unbemerkt und seufzte:
»Sie nun hat er zur Fresssucht getrieben, und dahin ist ihre Unschuld!«
Matthias war ihm gefolgt und hatte das Tun der anderen Klosterbrüder mit angesehen. Nun legte er tröstend den Arm um den Alten und sprach:
»Ihr habt doch noch immer mich, Vater!« Er legte seinen Kopf an des Mönchs Schulter. »Eure Betrübnis macht mich traurig, aber es verwirrt mich, dass Ihr plötzlich eine solche Wulst unter Eurer Kutte habt.«
Es stimmte – obgleich der Alte entsetzt war, hatte das Bild der innigen Liebkosungen und enthüllten Körper seinen Appetit geweckt. Noch bevor er antworten konnte, spürte er Matthias’ Hand auf seiner Wulst. Verwundert sah er seinen Schüler an, der aber lächelte und sprach:
»Nicht mit diesem behaarten Fremden möchte ich die körperlichen Freuden kennenlernen, sondern mit Euch. Deshalb hatte ich mich vor ihm versteckt. Ihr seid es, Mönchsvater, der mich schon seit Wochen und Monaten durcheinanderbringt. Bitte gönnt mir Eure Zuneigung!«
Der Mönch war von dem Flehen gerührt und wurde nachdenklich. Wie die anderen war auch Matthias in den letzten Monaten zu einem jungen Manne gereift und wirklich kein Kind mehr. Zudem knetete er die Wulst so gekonnt, dass der Mönchsvater schwach wurde und auch dem Schüler mitten in die Beine griff. So umfassten sie gegenseitig ihre harten Schöpfkellen, eng beieinanderstehend und sich das Genick kraulend. Und als es aus den anderen Zellen laut zu hecheln begann, weil die Insassen den Siedepunkt ihrer köchelnden Suppen erreicht hatten, da schüttete es auch in die Kutten des ungleichen Paares, die danach völlig verschmiert waren.
Am nächsten Morgen hielt der Mönch am Frühstückstisch eine ernste Rede. Er gab zu, das Wissen über körperliche Begierden vor seinen Schülern geheim gehalten zu haben, weil er fürchtete, sie würden ihn verlassen und woanders ihr Glück suchen. Doch wie aus einem Munde versicherten ihm seine sieben Schützlinge, dass er sich geirrt hatte.
»Wir finden es behaglich hier und wir leben in Eintracht«, sprach Simon, »wir sehnen uns nicht nach Gelagen außerhalb der Mauern, denn wir haben einander.«
Und Ruben fügte hinzu:
»Jetzt gesellt sich zur Eintracht auch Schlemmerei und Wohlgefallen, denn jeder von uns will den anderen beibringen, was der Fremde uns beigebracht hat.«
»S-so i-ist … es!«, bestärkte Lukas stotternd, und Matthias, fest die Hand des Alten haltend, schwor:
»Wir werden Euch nie verlassen, Vater!«
Da freute sich der falsche Mönch und war erleichtert, denn nun konnte er auch seinen eigenen Lüsten wieder ungehemmt freien Lauf lassen, wenn ihm danach war.
»Dieser Fremde muss trotzdem für seine Freveltat büßen«, meinte er. »Lasst uns gemeinsam in den Wald gehen und ihn suchen!«
Gesagt, getan. Die acht verließen die Klostermauern und fanden Wolf, wie er zufrieden schnarchend unter einem Baum lag.
»Er ist sicherlich noch ausgelaugt von dem ganzen Tun«, vermutete der Mönch. »Seinen tiefen Schlummer nutzen wir aus!«
Sie entledigten Wolf seiner Hosen, schmierten seinen Kessel mit Spucke ein und begannen, einer nach dem anderen, in seine Öffnung zu dringen. Zuerst durfte Matthias seine Schöpfkelle versenken. Er tunkte und tunkte und goss endlich sein Süppchen in den Wolf. Danach waren Lukas und Jonas an der Reihe. Die beiden waren schon erfahrener und es dauerte etwas, bis auch sie Wolfs offenen Kessel mit ihrer Knabensuppe füllten. So ging es weiter: Simon brauchte nicht lang zu löffeln, Ruben kostete seinen Gang fröhlich aus, Paul protzte dabei. Nathanael seufzte mehrmals, während er stippte, und der Mönch schließlich war der Letzte, der zum Zuge kam und tüchtig umrührte. Sie alle schütteten ihren Anteil in Wolf hinein, bis das fertige Gemisch von selbst wieder aus ihm herauslief. Als sie fertig waren, regte Wolf sich, gähnte und sprach:
»Was rumpelt und pumpelt in meinem Kessel herum? Ich meint, es wären acht Mönche fein, sie schütten mir ihre Suppe rein!«
Da lachten die Klosterschüler und sangen »Der Wolf ist voll! Der Wolf ist voll!«, und auch der Mönch schmunzelte. Herr Wolf betrachtete sie alle, tat zuerst erschrocken, grinste dann aber verräterisch.
»Ihr glaubt, ich hätte geschlafen? Mitnichten. Gern habe ich mir eure Bestrafung gefallen lassen, und ich freue mich, dass ihr nun alle zu echten Männern geworden seid. Doch eine Zutat fehlt in dieser Mahlzeit, die muss ich euch noch verraten.«
Da hielten die Klosterschüler mit ihrem Gesang inne, setzten sich um ihn herum und warteten gespannt.
»Paul und Nathanael sollen die Geheimzutat zuerst kosten!«
Er nahm Nathanael zu sich, setzte ihn auf seine Knie, näherte sich seinem Gesicht und berührte die Lippen mit dem Mund. Langsam schob er seine Zunge in den Knabenschlund und ein feuchter Leckerbissen verzückte Nathanaels Sinne.
»Das nennt man einen Kuss und ist die richtige Würze für jedes Rezept, egal ob Gelage oder Imbiss«, erklärte Wolf. »Nathanael, zeige Paul, was ich dir gerade vorgemacht. Ich will derweil Ruben unterrichten.«
Und so lernten sie neben allen Zutaten und Rezepten, die es für den Austausch körperlicher Zuneigung gab, auch das Küssen, und alle waren sich darin einig, dass dies die allerschönste Speise war. Nur Matthias übte lieber mit dem alten Mönch statt mit Wolf, denn zwischen dem Alten und dem Jungen hatte sich ein besonders zartes Band gesponnen.
Von nun an durfte Wolf im Kloster leben und brachte dort seinen gelehrigen Schülern viele weitere Künste bei, die das Schlemmen noch würziger, das Kochen noch siedender und die Süpplein noch sättigender machten. Der geheime Ruf des Gemäuers, ein Sündenkloster zu sein, verbreitete sich schnell bei den darbenden Männern der Umgebung, die nun öfter vorbeischauten, um ihren Hunger bei den Klosterbrüdern zu stillen. Besonders häufig waren freilich der Barbier und der Kantor zu Gast, und wenn sie alle nicht gestorben sind, dann lutschen und küssen und tunken sie wohl noch heute.
***
Arnes Märchen kommt bei allen Zuhörern gut an und er erntet Lob, Beifall und wohlmeinendes Gelächter. Auf die Frage, woher er all die Namen für seine Figuren habe, schweigt er errötend. Basil hilft ihm über die peinliche Stille hinweg und sagt:
»Anfangs fürchtete ich ja noch, du würdest dich hinsichtlich der Altersfrage um Kopf und Kragen reden, aber die Frage nach der Verführung Minderjähriger hast du gekonnt umschifft. Ist dem Herrn Doktor Professor Groll noch was aufgefallen?«
»Nein«, schüttelt Wilko den Kopf und lächelt milde. »Ich habe keine Bedenken anzumelden. Stattdessen melde ich mich freiwillig für die nächste Geschichte.«
Während er den Tisch abräumt, die Teller stapelt und das Besteck sortiert, erzählt er.