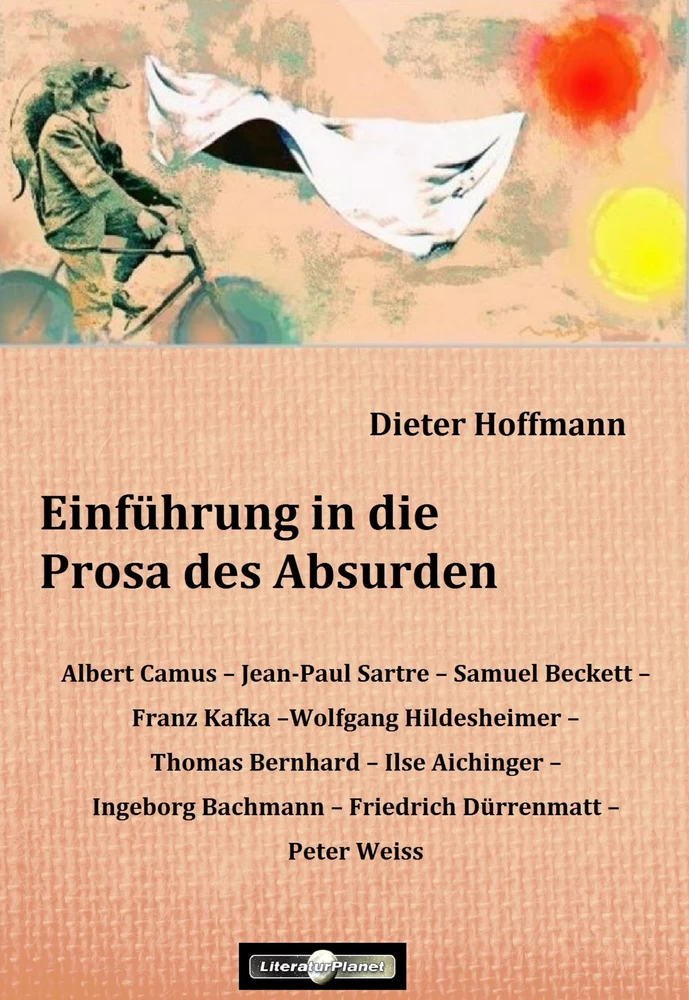Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis

Impressum
© LiteraturPlanet
Erste Auflage 2021
LiteraturPlanet
Im Borresch 14
6606 St. Wendel
Cover-Bild: © Gary Manzo: Ride into the Absurd; Mai 2016 (Wikimedia commons)
Über dieses Buch:
Im Vergleich zum Theater des Absurden wird die Prosa des Absurden in der Literaturwis-senschaft oft recht stiefmütterlich behandelt. Dabei finden sich auch in ihr vielfältige Spiegelungen der absurden Grundstruktur unseres Daseins und der zahllosen absurden Aspekte unseres Alltags. In diesen Spiegelungen können wir lesen wie in einem Spiegel, der uns zu einem tieferen Verständnis unserer selbst und unserer Existenz verhilft
Informationen über den Autor auf Wikipedia
Einleitung
Prosa des Absurden – nur eine Begleiterscheinung des absurden Theaters?
Wer in den einschlägigen literaturwissenschaftlichen Lexika und Werken zur Literaturgeschichte nach dem Stichwort "absurd" sucht, wird in der Regel zunächst auf Ausführungen zum Theater des Absurden stoßen. Die Prosa des Absurden spielt dagegen meist allenfalls eine untergeordnete Rolle.{1}
Dies ist insofern erstaunlich, als beispielsweise für Samuel Beckett – der mit seinen Stücken Warten auf Godot und Endspiel das Theater des Absurden besonders nachhaltig geprägt hat – das "Theater (...) zunächst eine Erholung von der Arbeit am Roman" war (vgl. Haerdter 1968: 88). Ebenso markieren auch im Falle Wolfgang Hildesheimers, einem der bedeutendsten deutschsprachigen Autor des Theaters des Absurden, die absurden Theaterstücke lediglich eine kurze Übergangsphase zwischen dem satirisch-grotesken Frühwerk und seiner in den 60er und frühen 70er Jahren verfassten Prosa des Absurden. Dieser maß Hildesheimer, nicht anders als Beckett, wesentlich mehr Bedeutung bei als seinen Theaterstücken.
Auch die wenigen Monographien, die sich der Literatur des Absurden widmen, stellen – wie etwas Martin Esslins bahnbrechende Studie über das Theater des Absurden aus dem Jahr 1961 (erw. Neuausgabe 1985) – zumeist das dramatische Werk der betreffenden Autoren in den Vordergrund. Sofern die Prosa Berücksichtigung findet, wird oft zu wenig zwischen dem Ausdruck des Absurden auf der Bühne und in der Prosa unterschieden, so dass die spezifischen Gestaltungsmöglichkeiten der Prosa nicht deutlich genug hervortreten (vgl. Dücker 1976).
Wird gesondert auf die Prosa eingegangen, so geschieht dies zudem in der Regel im Rahmen von Studien zu einzelnen Autoren – wobei neben Hildesheimer vor allem Ilse Aichinger Berücksichtigung findet (vgl. Blamberger 1985/1986; Stanley 1979). Dadurch tritt gerade die für die Beschreibung übergreifender Merkmale der Prosa des Absurden entscheidende Frage nach Verbindungslinien zwischen einzelnen Autoren in den Hintergrund.
Als weiteres Problem erscheint schließlich die mangelnde Differenzierung zwischen dem Absurden und dem Grotesken bzw. die unzureichende Herausarbeitung der hier fraglos vorhandenen Wechselbeziehungen. Wo dieser Fragestellung mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, geschieht dies überdies eher in Bezug auf das Drama oder im Rahmen von Einzelstudien zur nichtdeutschen Prosa des Absurden (vgl. Heidsieck 1969; Fritsch 1990).
Zur Aktualität des Absurden
Die Tatsache, dass die meisten Veröffentlichungen zur Literatur des Absurden schon etwas älteren Datums sind, verweist aber auch darauf, dass die Philosophie des Absurden ebenso wie die Bemühungen um einen adäquaten literarischen Ausdruck des Absurden heute einer vergangenen Epoche der europäischen Geistesgeschichte zugerechnet werden. Implizit wird so unterstellt, dass sie zur Diskussion der Gegenwartsprobleme keinen bedeutenden Beitrag mehr leisten könnten.
Dem ist zunächst entgegenzuhalten, dass das Nachdenken über die Absurdität des menschlichen Daseins insofern kaum je etwas von seiner Aktualität einbüßen kann, als diese Absurdität selbst unvergänglich ist. Vergänglich kann allenfalls die Motivation zur Beschäftigung mit dem Absurden sein, die offenbar in einem prozyklischen Zusammenhang mit übergreifenden konjunkturellen und politischen Konstellationen steht.
Nun ist allerdings das Absurde gerade in der deutschsprachigen Prosa des Absurden nie allein als existenzielle Kategorie verstanden worden. Hildesheimer leitete es vielmehr unmittelbar aus dem Holocaust und der durch ihn bewirkten Verzweiflung ab – die hierdurch zu einer "kontinuierliche[n] Lebenshaltung" geworden sei (FV 59).
Der Holocaust ist jedoch keineswegs der einzige Ausgangspunkt für eine soziohistorische Begründung des Existenzgefühls des Absurden. So ist etwa im Rahmen der Kritischen Theorie (vgl. Adorno 1961) schon früh der Versuch unternommen worden, das Existenzgefühl des Absurden mit bestimmten, durch den Zweiten Weltkrieg krisenhaft verstärkten Merkmalen der spätkapitalistischen Ökonomie in Zusammenhang zu bringen. Die Empfindung des Absurden wäre demnach darauf zurückzuführen, dass der Einzelne sich anonymen Mächten ausgeliefert fühlt und die konkreten Wirkungen seines eigenen Handelns angesichts der Unübersichtlichkeit der sozioökonomischen Strukturen, in denen er zu handeln hat, nicht angemessen einschätzen kann.
Diese Konstellation ist indessen nicht zwingend an das Leben in einem totalitären Staat oder an die Nachkriegsjahre gebunden, als die Menschen von dem zerstörten Boden Europas aus das fortgesetzte atomare Wettrüsten der Supermächte mit ansehen mussten. Auch das Zeitalter der Globalisierung ist durch eine Unübersichtlichkeit der Wirk- und Handlungszusammenhänge gekennzeichnet. Diese bedingen, dass die global handelnden Akteure in ihrer Anonymität etwas buchstäblich "Unfassbares" haben und das konkrete Alltagshandeln in seinen Auswirkungen undurchschaubar und dadurch kaum kontrollierbar ist.
So kann das Einkaufsverhalten der Menschen in den Industrieländern unabsehbare Folgen für das Leben der Menschen in ärmeren Ländern haben, ohne dass die Käufer sich dessen immer bewusst wären oder über ausreichende Möglichkeiten verfügen würden, die negativen Wirkungen ihrer Konsumpraxis abzustellen. Denn zwischen ihnen und den Verkäufern der entsprechenden Produkte stehen die global operierenden Konzerne und die staatlichen Kontrolleure des Welthandels, d.h. weitgehend anonyme, im Alltag unsichtbare Mächte, denen die Einzelne in ihrem Handeln ausgeliefert sind. Diese Konstellation ist durch die fortschreitende Digitalisierung noch einmal verstärkt worden.
Nicht anders ist die Situation für die bei der Zusammenlegung von Konzernen entlassenen Angestellten, oder auch für diejenigen, die die monetaristische Politik des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank dazu verdammt, zu hungern, damit ihr Staat in ferner Zukunft eine ausgeglichene Haushaltsbilanz aufweist. Auch in diesen Fällen sind es nicht konkrete Gewaltherrscher, die das Unglück der Menschen verursachen, sondern im Alltag unsichtbare Entscheidungsträger, die in ihren Beschlüssen selbst wieder einer unabhängig von ihnen existierenden Logik folgen.
Klima der Absurdität
Was sich in solchen Mechanismen letztlich abzeichnet, ist nicht nur die Dialektik, sondern der Bankrott der Aufklärung und der aus ihr abzuleitenden Moral. Denn alle oben genannten Beispiele stehen in krassem Widerspruch zur kantischen Ethik. Diese geht von der Grundannahme aus, dass der Mensch, wie "überhaupt jedes vernünftige Wesen, (…) als Zweck an sich selbst" anzusehen sei. Deshalb müsse jedes menschliche Wesen, so Kant,
"nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen, sondern (…) in allen seinen, sowohl auf sich selbst, als auch auf andere vernünftige Wesen gerichteten Handlungen jederzeit zugleich als Zweck betrachtet werden" (Kant, W VII: 59 f.).
Kants "praktische[r] Imperativ" leitet hieraus die Forderung ab, stets so zu handeln, dass wir die Menschheit sowohl in der eigenen "Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel" betrachten (ebd.: 61). Dagegen implizieren die oben genannten Mechanismen nicht nur, dass andere Menschen als Mittel für fremde Zwecke betrachtet werden. Vielmehr führen sie auch dazu, dass wir nie wissen können, wann wir selbst als Mittel gebraucht werden, um andere Menschen zum Mittel zu machen für die Zwecke unsichtbar bleibender Dritter.
Darüber hinaus manifestiert sich in diesen Mechanismen auch ein Denken, das sich nur graduell von der Logik des Krieges unterscheidet, in der das Elend und ggf. auch der Verlust des Lebens anderer Menschen nicht nur billigend in Kauf genommen, sondern gezielt zur Erreichung der eigenen Ziele eingesetzt wird. Ähnlich, wie es Albert Camus für die Zeit des Zweiten Weltkriegs beobachtet hatte, weitet sich die existenziell verstandene Absurdität des Daseins so zu einem allgemeinen "Klima der Absurdität" aus (vgl. Camus, MS 16). Die immer stärkere Konzentration der ökonomischen Macht – und die daraus folgende Abhängigkeit der Politik von den global agierenden Konzernen – verstärkt das Gefühl, anonymen Mächten ausgeliefert zu sein, die das Alltagshandeln aus der Ferne steuern und für ihre Zwecke nutzen. Auch in dieser Hinsicht beschleunigt die Digitalisierung nur Prozesse, die bereits früher eingesetzt haben.
Die Tatsache, dass die zentralen Werke der Philosophie und Literatur des Absurden bereits vor längerer Zeit verfasst worden sind, lässt somit nicht notwendig darauf schließen, dass sie heute keine Aktualität mehr besitzen. Denkbar wäre vielmehr auch, dass lediglich die Menschen in einem bestimmten Teil der Welt eine Zeit lang in der glücklichen Lage waren, das in ihnen zum Ausdruck gebrachte "Klima der Absurdität" in ihrem Alltag nicht spüren zu müssen. Geht man indessen von einer ungebrochenen Aktualität des Absurden als einer Bestimmungskategorie des menschlichen Daseins aus, so kann auch die Untersuchung von dessen literarischem Ausdruck dazu verhelfen, die "Wirklichkeit des Absurden" (Hildesheimer, FV 43 ff.) besser zu verstehen und für seine Erscheinungsweisen im Alltag zu sensibilisieren. Eben hierzu möchte die vorliegende Arbeit einen Beitrag leisten.
Zum Aufbau dieses Bandes
Ausgangspunkt der Überlegungen wird Albert Camus' Essay über die Philosophie des Absurden sein. Die Studie ist nicht nur allgemein von entscheidender Bedeutung für das Verständnis des Absurden in der Nachkriegszeit, sondern war auch für viele Autoren der Prosa des Absurden ein zentraler Orientierungspunkt. So hat etwa Wolfgang Hildesheimer sich in seinen Frankfurter Poetik-Vorlesungen über die Prosa des Absurden ausdrücklich auf dieses Werk berufen.
Hieran schließt sich logischerweise die Frage an, wie Camus selbst in seinen literarischen Werken sein Verständnis des Absurden umgesetzt hat. Daraus ergibt sich wiederum die Frage nach weiteren nichtdeutschen Vertretern der Prosa des Absurden. Neben Camus' langjährigem geistigen Weggefährten Sartre ist dabei insbesondere Samuel Beckett mit seiner Molloy-Trilogie von Bedeutung, die für viele nachfolgende Autoren des Absurden Vorbildcharakter hatte.
Im zweiten Teil dieser Arbeit steht die deutschsprachige Prosa des Absurden im Mittelpunkt. Zentral ist dabei jeweils die Frage, ob die betreffenden Werke einen eigenständigen Gestaltungsentwurf des Absurden darstellen. Diese Abgrenzung ist wichtig, da in der spezifischen zeithistorischen Situation des Kriegsendes und der Nachkriegszeit das vorherrschende "Klima der Absurdität" auch in zahlreichen anderen Werken widergespiegelt wurde. Dies musste jedoch nicht notwendigerweise mit einer bewussten literarischen Gestaltung des Absurden einhergehen.
Dass hier ein Unterschied besteht, ist bereits den Reaktionen auf die während der Tagung der Gruppe 47 in Bad Dürkheim im Jahr 1951 vorgelesenen Texte zu entnehmen.{2} So enthielt etwa der Beitrag Milo Dors – ein Kapitel aus seinem ein Jahr darauf veröffentlichten Roman Tote auf Urlaub – durchaus Elemente des Absurden.{3} In dem Text wird ein Geschäftsmann, der während des Krieges mit den deutschen Besatzern Belgrads kooperierte, hingerichtet, weil er es das Pech hat, einen rebellischen Namensvetter zu haben – der an seiner Stelle aus der Haft entlassen wird. Die Absurdität des Daseins tritt hier in ähnlicher Weise vor Augen wie in Sartres 1937 erschienener Erzählung Die Wand.
Wie in dieser, bleibt die Erzählweise dabei jedoch realistisch, so dass Dors Werk von den Tagungsteilnehmern noch nicht als Bruch mit der "Kahlschlagliteratur" der unmittelbaren Nachkriegszeit wahrgenommen wurde. Ilse Aichingers auf derselben Tagung vorgelesene Erzählung Der Gefesselte empfand man dagegen als "Einbruch in das Gewohnte" (Richter 1979: 61), da in ihr die Erfahrung des Absurden in einer von der Alltagsrealität abgelösten Form vermittelt wird.
Hieraus ergibt sich auch die Frage, welche literarischen Mittel konkret dazu genutzt werden können, das Absurde darzustellen. Um diese Frage zu beantworten, wird es auch notwendig sein, das Absurde vom Grotesken abzugrenzen bzw. die Berührungspunkte zwischen beiden aufzuzeigen. Dazu dient in der vorliegenden Arbeit ein eigenes Kapitel. Außerdem wird auf die Wechselbeziehungen und Differenzen zwischen dem Absurden und dem Grotesken auch im Rahmen der Einzeluntersuchungen zu Peter Weiss und Friedrich Dürrenmatt eingegangen.
Ein geistiger Reiseführer
Der vorliegende Band ist aus meiner 2006 veröffentlichten Habilitationsschrift zum selben Thema hervorgegangen. Während in dieser eine möglichst erschöpfende Behandlung des Untersuchungsgegenstands angestrebt wurde, bemüht sich die aktuelle Arbeit um eine exemplarische Darstellung der literarischen Gestaltung des Absurden bei ausgewählten Autorinnen und Autoren. Ziel ist also nicht die Beleuchtung aller Facetten, sondern eine Einführung in die jeweiligen Besonderheiten im Umgang mit dem Absurden.
Dem Einführungscharakter des Werkes entspricht auch die Bemühung um eine übersichtliche Darstellung und eine klarere Ausdrucksweise. Zu diesem Zweck wird auch auf Exkurse und Seitenäste der Thematik verzichtet. Einen Ausflug in die Welt des Theaters des Absurden hielt ich ebenfalls für entbehrlich, zumal es hierzu bereits andere einschlägige Veröffentlichungen gibt.
So ist dieser Band eine Art Reiseführer in das Land des Absurden. Es werden mögliche Reiseziele vorgestellt, Sehenswürdigkeiten beschrieben und zueinander in Beziehung gesetzt. Dies kann es Interessierten ermöglichen, das, was sie sehen, bewusster wahrzunehmen. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie sich selbst auf die Reise begeben.
1. Albert Camus' Philosophie des Absurden
Herkunft des Begriffs "absurd"
Der Begriff "absurdes" (lat. "misstönend", "unrein klingend") stammt ursprünglich aus dem Bereich der Musik. In der Philosophie wurde er anfangs auf dem Gebiet der Logik und Rhetorik verwendet, im Sinne von "etwas ad absurdum führen". Die heute vorherrschende Begriffsbedeutung geht zurück auf die Glaubensmaxime des "credo quia absurdum" ("Ich glaube daran, weil es absurd ist").{4}
Der Glaube wird hier gerade aus der Tatsache hergeleitet, dass er mit den Mitteln der menschlichen Vernunft nicht fassbar ist bzw. ihr sogar widerspricht.{5} Systematisch begründet wird dieser Gedanke in der Philosophie Sören Kierkegaards, der auf seiner Grundlage den Versuch Hegels, den Glauben aus der Betrachtung der Geschichte abzuleiten, zurückweist.
"Sprung in den Glauben": Das Verständnis des Absurden bei Kierkegaard
Hegel betrachtet die Geschichte als Selbstentäußerungsprozess des göttlichen Geistes. Der Verlauf der Geschichte dient aus dieser Perspektive als Prozess, der zur Wiederherstellung der Einheit des göttlichen Geistes auf einer höheren Bewusstseinsstufe dient. Gott wäre demnach aus seinem Wirken in der Geschichte zu erkennen.
Dem widerspricht Kierkegaard, weil er historische und göttliche Wahrheit für nicht miteinander vereinbar hält. Die geschichtliche Entwicklung ist ihm zufolge nicht denkbar ohne einen "Moment von Zufälligkeit", der ja "gerade der eine Faktor in allem Werden" sei (UN 229). Eben deshalb ist nach Kierkegaard auch der Glaube nicht aus einer geschichtlichen Wahrheit abzuleiten. Vielmehr sei er nur durch einen "qualitativen Sprung" (BA: 58) in jene andere Begriffssphäre zu gewinnen, die der Glaube repräsentiert.{6}
Wenn der Glaube sich nur außerhalb des konkreten historischen Entwicklungsprozesses ereignen kann, so bedeutet dies aber zugleich auch, dass weder der Weg zu ihm noch sein Erleben sprachlich vermittelbar sind. Denn dies würde den Glauben ja wieder auf die Ebene des Geschichtlichen herabzwingen.
Religiöse und historische Wahrheit treten demnach bei Kierkegaard – in fundamentalem Gegensatz zu Hegel – radikal auseinander. Nur die historische Wahrheit lässt sich ihm zufolge mit den Mitteln des abstrakten Denkens aus den Ereignissen ableiten und folglich auch sprachlich vermitteln. Die religiöse Wahrheit hält er dagegen nur auf dem Wege einer rückhaltlosen Verinnerlichung für erreichbar. Dem entspricht auf der Ebene des konkreten Subjekts die Bereitschaft, das, "was sich gerade nicht denken lässt, (…) kraft des Absurden (…) glaubend anzunehmen" (UN 232), also eben 'in den Glauben zu springen'.
Das Absurde ist demnach für Kierkegaard zum einen "der Gegenstand des Glaubens und das einzige, was sich glauben lässt" (UN 354). Zum anderen ist es aber auch das, was dem Einzelnen – wenn er sich zu seinem Glauben bekennt – die Kraft gibt, an diesem festzuhalten:
"Das Absurde ist gerade durch das objektive Abstoßen der Kraftmesser des Glaubens für Innerlichkeit." (ebd.)
Kierkegaard bestreitet dabei nicht den Kern des christlichen Glaubens, wonach "die ewige Wahrheit in der Zeit geworden ist", Gott also "geworden ist, geboren, gewachsen und so weiter ist, ganz und gar wie der einzelne Mensch geworden ist" (UN 353). Was er Hegel und seinem Versuch einer "Approximation" an die göttliche Wahrheit über die Suche nach deren Spuren in der Geschichte vorwirft, ist jedoch, dass eben hierdurch "das Absurde" und damit das Wesen dieses Prozesses negiert werde:
"Insofern dem Absurden das Moment des Werdens innewohnt, wird ein Weg der Approximation auch der sein, der das absurde Faktum des Werdens, das der Gegenstand des Glaubens ist, mit einem einfachen geschichtlichen Faktum verwechselt und also historische Gewissheit für das sucht, was gerade das Absurde ist, weil es den Widerspruch enthält, dass, was nur gerade strikt gegen allen menschlichen Verstand das Geschichtliche werden kann, es geworden ist. Dieser Widerspruch ist eben das Absurde, das nur geglaubt werden kann; bekommt man eine historische Gewissheit, so bekommt man bloß die Gewissheit davon, dass dies Gewisse nicht das Erfragte ist." (UN 355)
Sisyphos als "Held des Absurden"
Eine Wende in dieser Sichtweise des Absurden ergab sich erstmals durch Friedrich Nietzsche. Im Anschluss an Schopenhauer bezog dieser das Absurde nicht mehr auf den Glauben bzw. auf das Sein Gottes, sondern auf die menschliche Existenz selbst:
"Zu der Demuth, welche spricht: credo quia absurdum est [Ich glaube <daran>, weil es absurd ist] und ihre Vernunft zum Opfer anbietet, brachte es wohl schon mancher; aber keiner, soviel ich weiß, bis zu jener Demuth, die doch nur einen Schritt davon entfernt ist und welche spricht: credo quia absurdus sum." ("Ich glaube, weil ich absurd bin"; Nietzsche 1881: 273)
In ähnlicher Weise kritisiert auch Camus die von Kierkegaard aus der Absurdität des Glaubens abgeleitete Notwendigkeit eines "Sprungs" in diesen als ein "Ausweichen" vor der Absurdität der menschlichen Existenz. Außer auf Kierkegaard bezieht er sich dabei in seiner Kritik auch auf Lev (Léon) Schestow und Karl Jaspers. Ihnen wirft er vor, zwar von dem Absurden auszugehen und sich scheinbar auf "eine geschlossene, auf das Menschliche begrenzte Welt" zuzubewegen, dann jedoch "durch eine sonderbare Überlegung (...) das, was sie zerschmettert", zu vergöttlichen:
"Sie finden einen Grund zur Hoffnung in dem, was sie hilflos macht. Diese gewaltsame Hoffnung ist bei allen wesenhaft religiös." (MS 32)
Diese Haltung kritisiert Camus als "philosophischen Selbstmord" (MS 39). Was er damit meint, verdeutlicht er durch eine Auseinandersetzung mit Kierkegaards Sprung-Metapher. Kierkegaard wollte hiermit die Angst des Menschen vor den Folgen eines Bekenntnisses zu Gott – das für ihn gleichbedeutend war mit dem Bekenntnis zum eigenen Selbst – veranschaulichen. Camus hält dem entgegen, der Sprung selbst bedeute gerade "keine äußerste Gefahr", sondern stelle "das Ewige und dessen Behaglichkeit wieder her":
"Die Gefahr liegt im Gegenteil in dem kaum messbaren Augenblick vor dem Sprung. Die Redlichkeit besteht darin, sich auf diesem schwindelnden Grat zu halten; alles andere ist Ausflucht." (MS 46)
Diese Ausflucht trägt nach Camus wesenhaft mystischen Charakter. Damit aber ist die Freiheit ihm zufolge hier auch nur begrenzter Natur. Camus führt sie darauf zurück, dass die Mystiker sich in ihren Gott "versenken" und dessen Geboten 'zustimmen'. In der "freiwillig anerkannten Abhängigkeit" entdeckten sie so subjektiv "eine tiefe Unabhängigkeit". In Wahrheit seien sie aber "weniger frei als befreit", da sie eben durch diesen 'Sprung in den Glauben' von der beängstigenden Freiheit des Absurden entlastet würden. Wenn auch "die Rückkehr zum Bewusstsein, die Flucht aus dem täglichen Schlaf", am Anfang ihrer Überlegungen stünden, so ziele ihre Philosophie letzten Endes doch nur auf "die existenzielle Predigt" ab und mit ihr "auf den geistigen Sprung, der im Grunde dem Bewusstsein entschlüpft" (MS 53).
Dem stellt Camus seine eigene Philosophie des Absurden gegenüber. Diese betrachtet zum einen das Absurde nicht als Charakteristikum des Göttlichen bzw. des Glaubens, sondern als Grundzug der menschlichen Existenz. Zum anderen erhebt sie das Bewusstsein dieser Absurdität zum Maßstab einer freien, selbstverantwortlichen Lebenspraxis. Die hieraus abzuleitende Lebenshaltung veranschaulicht Camus anhand des Sisyphos-Mythos:
"Sisyphos ist der Held des Absurden. Dank seinen Leidenschaften und dank seiner Qual. Seine Verachtung der Götter, sein Hass gegen den Tod und seine Liebe zum Leben haben ihm die unsagbare Marter aufgewogen, bei der sein ganzes Sein sich abmüht und nichts zustande bringt. Damit werden die Leidenschaften dieser Erde bezahlt." (MS 99)
Mit dieser Interpretation des Mythos von Sisyphos spielt Camus nicht nur auf dessen sinnleere Tätigkeit an – darauf also, dass er von den Göttern dazu verurteilt worden war, "unablässig einen Felsblock einen Berg hinaufzuwälzen, von dessen Gipfel der Stein von selbst wieder hinunterrollte" (MS 98). Von gleicher Bedeutung für seine Sicht des Sisyphos ist vielmehr dessen revoltierender Geist, wie er in seinem Aufbegehren gegen die Götter zum Ausdruck kommt.
So hebt Camus besonders die Tatsache hervor, dass Sisyphos die Geheimnisse der Götter preisgegeben und den Tod in Ketten gelegt haben soll (vgl. ebd.). Die Tatsache der Absurdität seines Tuns sieht Camus zudem mit dem Bewusstsein dieser Absurdität verknüpft, das sich während des periodischen Rückzugs "in die Ebene" notwendig habe einstellen müssen. Ein "Held des Absurden" aber ist Sisyphos für Camus vor allem deshalb, weil er sich trotz der Einsicht in sein absurdes Dasein zu diesem bekannt habe:
"Dieses Universum, das nun keinen Herrn mehr kennt, kommt ihm weder unfruchtbar noch wertlos vor. Jedes Gran dieses Steins, jeder Splitter dieses durchnächtigten Berges bedeutet allein für ihn eine ganze Welt. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen." (MS 101)
So wird Sisyphos für Camus zu einer Art Meta-Symbol für "das Denken unserer Zeit", das er – "wie selten ein Denken – von einer philosophisch begründeten Sinnlosigkeit der Welt durchdrungen" sah (MS 44). Folglich bestand für ihn die zentrale Aufgabe der Philosophie darin, sich auf dieses "Klima der Absurdität" (MS 16) einzulassen und es näher zu untersuchen.
Soweit "die Handlungsweise eines aufrichtigen Menschen (...) von dem bestimmt werden [sollte], was er für wahr hält", müsse, so Camus, auch "der Glaube an die Absurdität des Daseins" ein diesem gemäßes Handeln generieren (MS 11). Vor diesem Hintergrund legt er sich die Frage vor, ob ein als absurd erkanntes Dasein notwendigerweise in den Selbstmord führen müsse. Die "Entscheidung, ob das Leben sich lohne oder nicht", beantworte "die Grundfrage der Philosophie". Und da "ein Philosoph, der ernst genommen werden will, mit gutem Beispiel vorangehen" müsse, gehe es für ihn hierbei nicht um theoretische Überlegungen, sondern um eine Entscheidung auf Leben und Tod (MS 9).
Das Absurde und die Entfremdung
Nun bedingt die Feststellung, dass das Dasein des Menschen grundsätzlich absurd ist, noch nicht notwendigerweise bei jedem Einzelnen die Erkenntnis und die Anerkennung dieser Tatsache. Hierfür muss vielmehr zunächst ein Gefühl für das Absurde in ihm wach werden. Die zentrale Voraussetzung dafür ist nach Camus die Empfindung der Entfremdung von der Welt, in der der Mensch lebt:
"Eine Welt, die sich – wenn auch mit schlechten Gründen – deuten und rechtfertigen lässt, ist immer noch eine vertraute Welt. Aber in einem Universum, das plötzlich der Illusionen und des Lichts beraubt ist, fühlt der Mensch sich fremd. Aus diesem Verstoßensein gibt es für ihn kein Entrinnen, weil er der Erinnerungen an eine verlorene Heimat oder der Hoffnung auf ein gelobtes Land beraubt ist. Dieser Zwiespalt zwischen dem Menschen und seinem Leben, zwischen dem Schauspieler und seinem Hintergrund ist eigentlich das Gefühl der Absurdität." (MS 11)
Camus differenziert zwischen verschiedenen Arten der Entfremdung, die sich zum einen nach der Intensität der Empfindung und zum anderen nach dem jeweiligen Bezugspunkt voneinander unterscheiden. Im Einzelnen handelt es sich dabei um
- eine Entfremdung des Menschen von seinem Alltag:
"Aufstehen, Straßenbahn, vier Stunden Büro oder Fabrik, Essen, Straßenbahn, vier Stunden Arbeit, Essen, Schlafen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, immer derselbe Rhythmus – das ist sehr lange ein bequemer Weg. Eines Tages aber steht das 'Warum' da, und mit diesem Überdruss, in den sich Erstaunen mischt, fängt alles an. (...) Der nächste Schritt ist die unbewusste Umkehr in die Kette oder das endgültige Erwachen." (MS 16)
- eine Entfremdung des Menschen von der Wirklichkeit, d.h. die blitzhafte Einsicht in die Tatsache, dass die Welt nicht das ist, als was sie sich der menschlichen Wahrnehmung darstellt:
"Eine Sekunde lang verstehen wir die Welt nicht mehr: jahrhundertelang haben wir in ihr nur die Bilder und Gestalten gesehen, die wir zuvor in sie hineingelegt hatten, und nun verfügen wir nicht mehr über die Kraft, von diesem Kunstgriff Gebrauch zu machen. Die Welt entgleitet uns: sie wird wieder sie selbst." (MS 18)
- eine Entfremdung des Menschen von sich selbst, d.h. die Empfindung der nie zu überbrückenden "Kluft zwischen der Gewissheit meiner Existenz und dem Inhalt, den ich dieser Gewissheit zu geben suche":
"Das Herz in mir kann ich fühlen, und ich schließe daraus, dass es existiert. Die Welt kann ich berühren, und auch daraus schließe ich, dass sie existiert. Damit aber hört mein ganzes Wissen auf; alles andere ist Konstruktion. Wenn ich nämlich dieses Ich, dessen ich so sicher bin, zu fassen, wenn ich es zu definieren und zusammenfassend zu bestimmen versuche, dann zerrinnt es mir wie Wasser zwischen den Fingern. Ich kann nacheinander alle Gesichter nachzeichnen, die es annehmen kann, auch alle Gesichter, die man ihm gegeben hat – Erziehung, Herkunft, Leidenschaft oder Ruhe, Größe oder Niedertracht. Addieren aber kann man Gesichter nicht. Selbst dieses Herz, das doch meines ist, wird mir immer unerklärbar bleiben." (MS 21 f.)
- eine Entfremdung des Menschen von seinem Dasein:
"Auch die Menschen sondern Unmenschliches ab. In gewissen hellsichtigen Stunden lässt das mechanische Aussehen ihrer Bewegungen, ihre sinnlos gewordene Pantomime alles um sie herum stumpfsinnig erscheinen. Ein Mensch spricht hinter einer Glaswand ins Telefon, man hört ihn nicht, man sieht nur sein sinnloses Mienenspiel: man fragt sich, warum er lebt." (MS 18)
Das Zum-Tode-Sein und das "Heimweh nach der Einheit"
Der Ermöglichungsgrund für das Gefühl der Entfremdung im oben genannten Sinn ist zunächst das Faktum des 'Zum-Tode-Seins' des Menschen. Vor dem Hintergrund des Sterben-Müssens erscheint die Befolgung der Alltagsroutine als sinnlos. Auch alle moralischen Maßstäbe verlieren vor diesem Hintergrund ihren imperativischen Charakter:
"Aus dem leblosen Körper, auf dem eine Ohrfeige kein Mal mehr hinterlässt, ist die Seele verschwunden. Diese elementare und endgültige Seite des Abenteuers ist der Inhalt des absurden Gefühls. Im tödlichen Licht dieses Verhängnisses tritt die Nutzlosigkeit in Erscheinung. Keine Moral und keinerlei Streben lassen sich a priori vor der blutigen Mathematik rechtfertigen, die über uns herrscht." (MS 19)
Auch das Gefühl der Entfremdung von der eigenen Existenz hat für Camus hier seine Wurzel. Das "Unbehagen des Menschen vor der Unmenschlichkeit des Menschen selbst, dieser unberechenbare Sturz vor dem Bilde dessen, was wir sind", wird deshalb von ihm auch mit der Empfindung von "Ekel" in Verbindung gebracht (MS 18).{7}
Das abstrahierende (Selbst-)Bewusstsein{8} des Menschen hat in den alltäglichen Denkprozessen zur Folge, dass er sich als geistiges Wesen begreift. Dem steht der Ekel als unmittelbares Seinserleben entgegen. Er resultiert aus der konkreten sinnlichen Erfahrung, als lebendes Wesen nicht aus Geist, sondern aus progressivem Verfall anheimgegebener Materie zu bestehen.
Hieraus leitet sich die Erkenntnis ab, dass für den Menschen das Zum-Tode-Sein seine "Beziehung zum Leben bestimmt" (MS 23). Dies kann dem Denken, so Camus, eine paradoxe Struktur verleihen: Einerseits erzeugt die bewusste Einsicht in die Endlichkeit der eigenen Existenz ein "Heimweh nach der Einheit", ein "Verlangen nach dem Absoluten". Andererseits ist gerade die Tatsache dieses Verlangens ein Beleg für die Kluft, die den Menschen vom Ganzen des Seins trennt:
"Denn wenn wir den Abgrund zwischen Wunsch und Erfüllung überspringen und mit Parmenides die Wirklichkeit des 'Einen' (wie immer es beschaffen sein möge) behaupten, dann geraten wir in den lächerlichen Widerspruch eines Geistes, der die totale Einheit behauptet und gerade durch die Behauptung sein eigenes Anderssein und die Mannigfaltigkeit beweist, die er angeblich aufgehoben hat. Dieser weitere circulus vitiosus genügt, um unsere Hoffnungen zunichte zu machen." (MS 20)
Je mehr der Einzelne also sein "Verstoßen-Sein" aus dem "Paradies" der Einheit beklagt (MS 11), desto deutlicher muss er gerade einsehen, "dass die Welt 'dicht' ist", desto stärker wird er spüren, "wie sehr ein Stein fremd ist, undurchdringbar für uns, und mit welcher Intensität die Natur oder eine Landschaft uns verneint" (MS 17). Denn diese Überlegungen setzen einen nur dem Menschen möglichen Reflexionsgrad voraus. So führt paradoxerweise gerade die Erkenntnis, selbst nichts anderes als Materie zu sein, dazu, dass der Einzelne sich aus dem Ganzen des Seins ausgeschlossen fühlt:
"Wenn ich Baum unter den Bäumen wäre, Katze unter den Tieren, dann hätte dieses Leben einen Sinn oder vielmehr: dieses Problem bestünde überhaupt nicht, denn dann wäre ich ein Teil dieser Welt. Ich wäre diese Welt, zu der ich mich jetzt mit meinem ganzen Bewusstsein und mit meinem ganzen Anspruch auf Vertrautheit in Gegensatz befinde. Eben diese so höhnische Vernunft setzt mich in Widerspruch zur ganzen Schöpfung." (MS 47)
Der Vergleich als strukturelle Basis von Absurdität
Diese "Gegenüberstellung des Menschen, der fragt, und der Welt, die vernunftwidrig schweigt" (MS 29), ist für Camus die Grundkonstellation des Absurden. Daraus folgt zugleich, dass es unzulässig wäre, von der Welt selbst zu behaupten, sie sei absurd:
"An sich ist diese Welt nicht vernünftig – das ist alles, was man von ihr sagen kann. Absurd aber ist die Gegenüberstellung des Irrationalen und des glühenden Verlangens nach Klarheit, das im tiefsten Innern des Menschen laut wird. Das Absurde hängt ebensosehr vom Menschen ab wie von der Welt." (MS 23)
Die aus dem "gemeinsamen und gleichzeitigen Vorhandensein" von Mensch und Welt (MS 31) resultierende Absurdität ist nun allerdings für Camus nur eine unter vielen anderen Erscheinungsformen des Absurden. Zwar mag diese für die menschliche Existenz von zentraler Bedeutung sein. Grundsätzlich entsteht das Absurde nach Camus jedoch immer "durch einen Vergleich". Camus veranschaulicht dies u.a. am Beispiel eines unschuldig zum Tode Verurteilten oder am Beispiel eines durch und durch tugendhaften Menschen, den man einer unmoralischen Tat bezichtigt. Hieraus folgert er:
"Ich darf also wohl sagen, dass das Gefühl der Absurdität nicht aus der einfachen Untersuchung einer Tatsache oder eines Eindrucks entsteht, sondern dass es seinen Ursprung in einem Vergleich hat, in einem Vergleich zwischen einem Tatbestand und einer bestimmten Realität, zwischen einer Handlung und der Welt, die stärker ist als sie. Das Absurde ist im Wesentlichen ein Zwiespalt. Es ist weder in dem einen noch in dem anderen verglichenen Element enthalten. Es entsteht durch deren Gegenüberstellung." (MS 30 f.)
Im Falle von Mensch und Welt betrifft diese Gegenüberstellung das Bedürfnis des Menschen nach Sinn, das notwendig entsteht, wenn der Einzelne sich seiner existenziellen Situation bewusst wird. Mit seinen Fragen trifft er dabei jedoch auf eine Welt, die "vernunftwidrig schweigt" (s.o.).
Die so entstehende Absurdität ist nach Camus "das einzige Band" (MS 23 und 31), das Mensch und Welt miteinander verbindet. Daraus schließt er, "dass der Begriff des Absurden etwas Wesentliches ist und als meine erste Wahrheit gelten kann" (MS 31). Konsequenterweise hätte ich also "gerade das, was mich vernichtet, festzuhalten und infolgedessen das, was ich darin für wesentlich halte, zu respektieren" (ebd.). Wahre Freiheit ist für den Menschen vor diesem Hintergrund nur durch die ständige Konfrontation mit dem Absurden – als dem zentralen Aspekt seines Daseins – möglich:
"Leben heißt: das Absurde leben lassen. Das Absurde leben lassen heißt: ihm ins Auge sehen." (MS 49)
Die Auflehnung als adäquater Umgang mit dem Absurden
Dem Absurden ins Auge zu sehen, bedeutet für Camus nun allerdings gerade nicht, sich mit ihm abzufinden. Als die einzig adäquate Form der Auseinandersetzung mit ihm ist sieht er vielmehr die ebenso absurde, sisyphoshafte "Auflehnung" (ebd.) gegen es an:
"Das Absurde hat nur insoweit einen Sinn, als man sich mit ihm nicht einverstanden erklärt." (MS 32)
Die Auflehnung gegen das Absurde sieht Camus dabei nicht als einmaligen Akt, sondern als einen "pausenlosen Kampf" (MS 31) an. Das "Motiv der permanenten Revolution" übertrage sich so "auf die individuelle Erfahrung" (MS 49).
Die nach Camus zentrale philosophische Frage, ob die absurde Grundstruktur der menschlichen Existenz notwendig den Selbstmord zur Folge haben müsse, kann vor diesem Hintergrund verneint werden. Denn der Selbstmord ist ja gerade nicht von Auflehnung gegen das Absurde geprägt, sondern erkennt die dem Menschen durch das Absurde gesetzten Grenzen in einem absoluten Sinne an. Er bedeutet die Kapitulation vor der "einzige[n] und furchtbare[n] Zukunft", auf die jedes menschliche Dasein zuläuft. Dadurch hebt er "das Absurde auf seine Art auf":
"Er zieht es mit in den gleichen Tod. Ich weiß aber, dass das Absurde, um sich zu behaupten, sich nicht auflösen darf. Es entgeht dem Selbstmord in dem Maße, wie es gleichzeitig Bewusstsein und Ablehnung des Todes ist." (MS 49)
Aus der zentralen Prämisse seines Denkens – das menschliche Dasein ist absurd – ergibt sich für Camus damit notwendig die Schlussfolgerung, dass Freiheit für den Menschen nur über die Anerkennung dieses Faktums zu erlangen ist. Alles andere ist für ihn – konkretes oder philosophisch-abstraktes – Ausweichen vor der Realität des eigenen Lebens.
Die Konfrontation mit dem eigenen Zum-Tode-Sein wird demzufolge nach Camus' Auffassung bei einem Menschen, der bereit ist, "das Absurde leben [zu] lassen" (s.o.), auch nicht zum Selbstmord, sondern gerade zur Erkenntnis der eigenen Freiheit führen. Denn "der absurde Mensch, der ganz und gar dem Tode zugewandt ist (der hier als die offensichtlichste Absurdität verstanden wird)", fühlt sich "losgelöst von allem, was nicht zu dieser leidenschaftlichen Aufmerksamkeit gehört, die sich in ihm kristallisiert" (MS 53).
Gerade die Fremdheit gegenüber dem eigenen Leben, die das Bewusstsein des Sterben-Müssens dem Menschen vermittelt – als Grundmerkmal des absurden Lebensgefühls – sieht Camus dabei als Ermöglichungsbedingung der menschlichen "Handlungsfreiheit" an. Diese "neue Unabhängigkeit" sei zwar "zeitlich begrenzt". Gerade dadurch, dass sie "keinen Wechsel auf die Ewigkeit"{9} ausstelle, befreie sie den Menschen jedoch von unrealistischen Freiheitsideen. Diese zeichnen sich nach Camus durch ein Verschweigen des Zum-Tode-Seins aus. Sie sind für ihn deshalb nicht nur illusionär, sondern führen auch zur Errichtung zusätzlicher "Schranken" für das eigene Leben:
"Bevor er dem Absurden begegnet, lebt der Mensch täglich mit Zielen, mit einer Sorge um die Zukunft oder um eine Rechtfertigung (in welcher Hinsicht, danach fragen wir nicht). Er wägt seine Chancen, er rechnet mit der spätesten Zukunft, mit seiner Pensionierung oder mit der Arbeit seiner Söhne. Er glaubt noch, dass irgendetwas in seinem Leben gelenkt werden könne. Tatsächlich handelt er, als wäre er frei, wenn auch alle Tatsachen gegen diese Freiheit sprechen." (MS 51 f.)
Erst "der Tod und das Absurde" geben dem Menschen nach Camus "die Prinzipien der einzig vernünftigen Freiheit" an die Hand (MS 53). Das "genaue Gegenstück" zu dem Resignieren des Selbstmörders vor der Aufgabe seiner Existenz sieht Camus folglich "in der äußersten Spannung des Gedankens dessen, der zum Tode verurteilt ist", in dem "Schuhband, das er trotz allem ein paar Meter entfernt liegen sieht, am Rande seines schwindelnden Sturzes" (MS 50).
Die "göttliche Verfügungsmacht des zum Tode Verurteilten, vor dem sich einmal im frühesten Morgenlicht die Gefängnistore öffnen, diese unglaubliche Interesselosigkeit allem gegenüber, außer der reinen Flamme des Lebens" (MS 53), kann dabei zunächst ganz allgemein als Bild für den von Geburt an zum Tode "verurteilten" Menschen verstanden werden.
In seiner konkreten Ausführung verweist das Bild aber auch auf die historische Realität, vor deren Hintergrund Camus' Schrift entstanden ist. Über die allgemeine Bedeutung des Essays für die menschliche Existenz hinaus wird dadurch seine Funktion erkennbar, die Résistance-Kämpfer in ihrem Widerstand gegen die nationalsozialistischen Besatzer zu ermutigen und etwaige Anwandlungen von Resignation überwinden zu helfen. Dabei geht es auch um den Mut, notfalls das eigene Leben im Interesse höherer Ziele aufs Spiel zu setzen:
"Was man einen Grund zum Leben nennt, das ist gleichzeitig ein ausgezeichneter Grund zum Sterben" (MS 9).
Camus' Feststellung, es gehe dem absurden Menschen darum, "unversöhnt und nicht aus freiem Willen zu sterben" (MS 50), erhält so einen zusätzlichen, zeithistorisch begründeten Sinn. Gerade das unbedingte Bekenntnis zum Wert des Lebens – trotz oder gerade wegen seiner Absurdität – kann den Einzelnen dazu ermutigen, es gegen diejenigen zu verteidigen, die seine Freiheit mit Füßen treten. Dabei vermittelt gerade die Einsicht in die grundsätzliche Absurdität des Daseins jene innere Unabhängigkeit, die den absoluten Wert der Freiheit und des Lebens höher ansetzt als das eigene Überlebensbedürfnis und so im Notfall auch den Einsatz des eigenen Lebens für die Verteidigung der Freiheit bejaht. Auch dies kann in einer bestimmten historischen Situation der Verwirklichung jener Lebensmaxime dienen, die Camus als das "Ideal des absurden Menschen" bezeichnet:
"Sein Leben, seine Auflehnung und seine Freiheit so stark wie möglich empfinden – das heißt: so intensiv wie möglich leben." (MS 56)
Die Kunst und das Absurde
Im Rahmen seines "Versuchs über das Absurde" beschäftigt sich Camus auch mit der Frage, inwieweit "ein absurdes Kunstwerk möglich" sei (MS 81). In diesem Zusammenhang weist er zunächst die Annahme zurück, das Kunstwerk könnte "als eine Flucht vor dem Absurden betrachtet werden". Er betrachtet es vielmehr selbst als "ein absurdes Phänomen" und versucht es als solches zu beschreiben. Dabei stellt er insbesondere die unterstützende Funktion des Kunstwerks bei der Auseinandersetzung des Einzelnen mit der Absurdität seiner Existenz heraus. Das Kunstwerk, so Camus, lasse
"zum ersten Mal (...) den Geist aus sich selbst herausgehen und stellt ihn etwas anderem gegenüber, nicht damit er sich darin verliere, sondern um ihm einen genauen Fingerzeig von dem aussichtslosen Weg zu geben, den alle gehen müssen. In der Zeit der absurden Überlegung führt das Kunstwerk die Gleichgültigkeit und die Enthüllung weiter. Es bezeichnet den Punkt, von dem die absurden Leidenschaften ausgehen und bei dem die Überlegung anhält." (MS 80 f.)
Camus betont insbesondere die Möglichkeit der Kunst, einen Gedanken sinnlich-ummittelbar erfahrbar zu machen – eine ästhetische Position, die in ähnlicher Form bereits im deutschen Idealismus{10} postuliert worden war:
"Damit ein absurdes Werk möglich ist, muss das Denken in seiner hellsten Form daran beteiligt sein. Dieses Paradox erklärt sich aus dem Absurden. Das Kunstwerk entsteht aus dem Verzicht des Verstandes, das Konkrete zu begründen. Es bezeichnet den Triumph des Sinnlichen. Das klare Denken ruft es hervor, leugnet aber in diesem Akt sich selbst." (MS 82)
Camus tritt in diesem Kontext für eine Kunst ein, "in der das Konkrete nichts anderes bedeutet als sich selbst" (ebd.). Damit plädiert er allerdings keineswegs für eine 'konkrete Kunst', also eine Befreiung des von dem Künstler verwendeten Materials aus den Strukturen, in die es jeweils eingebunden ist (im Falle der Literatur also eine Emanzipation der sprachlichen Zeichen von ihrer Bindung an konkrete Bedeutungen).
Wenn Camus vom Vorrang des 'Konkreten' in der Kunst spricht, so ist dieses für ihn offenbar gleichbedeutend mit dem 'Sinnlichen'. Mit dessen Betonung grenzt er sich ab von jenen "Thesen-Schriftstellern" (MS 84), deren Werke nur der Exemplifizierung dessen dienten, was ihre Schöpfer für den "tieferen Sinn" des Lebens hielten:
"Der Thesenroman, das beweisende Werk, das hassenswerteste von allen, lässt sich am häufigsten von einem zufriedenen Denken inspirieren. Man beweist darin die Wahrheit, die man zu besitzen glaubt." (MS 96)
Ein solcher Roman bezeichnet nach Camus das Gegenteil eines absurden Kunstwerks. Wenn dieses die Absurdität des Daseins vor Augen führe, wolle es in keinem Fall "Sinn" und "Trost" vermitteln (MS 82), sondern lediglich "Symbole eines begrenzten, sterblichen und aufrührerischen Denkens" (MS 96) bieten. Dies gilt zum einen für die Inhalte der betreffenden Werke, zum anderen aber auch für den schöpferischen Prozess, wie er sich im absurden Kunstwerk manifestiert:
"Von allen Schulen der Geduld und der Klarheit ist das Schaffen die wirksamste. Es ist zudem das erschütternde Zeugnis für die einzige Würde des Menschen: die eigensinnige Auflehnung gegen seine Lage, die Ausdauer in einer für unfruchtbar erachteten Anstrengung. Sie erfordert eine tägliche Anstrengung, Selbstbeherrschung, die genaue Abschätzung der Grenzen des Wahren, Maß und Kraft. Sie begründet eine Askese. Und das alles 'für nichts', nur um zu wiederholen und um auf der Stelle zu treten." (MS 95){11}
Der Künstler als exemplarische Sisyphos-Gestalt
Sowohl in dem, was er erschafft, als auch in seinem Tun selbst ist der Künstler für Camus somit ein herausragendes Beispiel für die sisyphoshafte Natur des menschlichen Daseins. Dies schließt für ihn allerdings nicht aus, dass der Schriftsteller sich in seinen Werken um die Exemplifizierung der Philosophie des Absurden bemüht. Vielmehr sieht er "die großen Romanciers" gerade deshalb als "das Gegenteil von Thesen-Schriftstellern" an, weil sie "philosophische Romanciers" seien (MS 84).
Camus verlangt demnach von einem absurden Kunstwerk lediglich, dass es nicht falschen "Illusionen huldigt". Es soll die "Gebote des Absurden" beachten sowie "den Zwiespalt und die Auflehnung sichtbar" machen, von denen Camus zufolge die menschliche Existenz geprägt ist (MS 85 f.). Die Beachtung der "Gebote des Absurden" ist für ihn folglich durchaus mit einer konventionellen Erzählweise vereinbar.
In diesem Sinne ist auch Camus' Bemerkung zu verstehen, dass die absurden Kunstwerke "im Konkreten triumphieren und dass das ihre Größe ist" (MS 96). Gemeint ist damit offenbar, dass die Künstler in ihren Werken die Absurdität der menschlichen Existenz als solche sinnlich darstellen und der "Versuchung", dieser Existenz "einen tieferen Sinn unterzulegen" (MS 82), widerstehen sollten. Mit anderen Worten: Eine künstlerische Darstellung des Absurden im Sinne Camus' muss nicht in sich selbst absurd sein. Was er propagiert ist damit eine Kunst und Literatur des Absurden, nicht aber eine absurde Literatur. Genau dieser Maxime ist er auch in seinem eigenen literarischen Werk gefolgt.
Künstlerische Revolte als Antwort auf das Absurde
Camus' in Der Mythos von Sisyphos entfaltete Kunsttheorie entspricht in wesentlichen Punkten seiner später in Der Mensch in der Revolte (1951) vertretenen Position. In beiden Fällen bleibt die Frage nach der Möglichkeit eines der Erfahrung des Absurden nicht nur inhaltlich, sondern auch formal entsprechenden künstlerischen Ausdrucks unberücksichtigt.
In Der Mensch in der Revolte sieht es Camus allerdings auch in inhaltlicher Hinsicht nicht mehr als Ziel der Kunst an, die Absurdität des Daseins zu gestalten. Stattdessen legt er den Akzent hier ganz auf den Aspekt der Auflehnung bzw. der "Revolte" gegen diese Absurdität. Entscheidend ist für ihn nun das künstlerische Streben danach, "dem Leben die Form zu geben, die es nicht hat":
"Es genügt nicht zu leben, man braucht ein Schicksal und dies, ohne den Tod abzuwarten. Es ist also richtig, zu sagen, der Mensch habe eine Vorstellung einer besseren Welt als dieser. Allein besser bedeutet nicht verschieden, sondern zur Einheit gebunden." (MR 297).
Dieses Einheitsverlangen sieht Camus in exemplarischer Weise im Roman verwirklicht:
"Der Mensch gibt sich hier schließlich selbst die Form und die beruhigende Grenze, die er vergeblich in seinem Leben verfolgt. Der Roman fertigt Schicksal nach Maß an. So macht er der Schöpfung Konkurrenz und triumphiert vorübergehend über den Tod. Eine eingehende Analyse der berühmtesten Romane würde in jedes Mal verschiedener Perspektive zeigen, dass das Wesen des Romans in dieser unaufhörlichen Korrektur besteht, immer in gleicher Richtung verlaufend, und die der Künstler nach seiner eigenen Erfahrung vornimmt. Weit entfernt davon, moralisch oder rein formal zu sein, zielt diese Korrektur zuerst auf die Einheit und drückt damit ein metaphysisches Bedürfnis aus." (MR 300)
Um Ausdruck der "Revolte" im Sinne Camus' zu sein, muss das im Roman widergespiegelte Gestaltungsverlangen allerdings stets die Balance halten zwischen der Ablehnung der Absurdität des Daseins und der grundsätzlichen Bejahung des Lebens:
"Durch die Behandlung, die der Künstler der Wirklichkeit aufzwingt, behauptet er seine Kraft der Ablehnung. Doch was er von ihr in seiner erschaffenen Welt bewahrt, deckt die Zustimmung auf, die er mindestens für einen Teil des Wirklichen hegt, den er aus dem Schatten des Werdens zieht, um ihn ins Licht der Schöpfung zu stellen. " (MR 304)
Die vollständige Ablehnung der Wirklichkeit führt nach Camus zu rein formalen Werken, die er als "nihilistisch" verwirft. Die Leugnung des Absurden habe dagegen den Versuch zur Folge, "die rohe Wirklichkeit zu verherrlichen" (ebd.). Der "Ehrgeiz" des Künstlers sei dabei "die Einübung nicht der Einheit, sondern der Totalität der wirklichen Welt" (MR 306). Der in Camus' Augen eben hierauf abzielende Realismus sei deshalb – wie er unter Anspielung auf die Doktrin des sozialistischen Realismus ergänzt – auch "die offizielle Ästhetik einer Revolution der Totalität" (ebd.).
Reiner Realismus – im Sinne einer vollständigen und objektiven Wiedergabe der Wirklichkeit – ist zudem nach Camus ebenso unmöglich wie reiner Formalismus. Die realistischen Romane müssten "gegen ihren Willen aus dem Wirklichen eine Auswahl" treffen, da "Auswahl und Übersteigung der Wirklichkeit (…) die Hauptbedingungen des Denkens und des Ausdrucks" seien (ebd.).
Ebenso sei auch dem Formalismus immer "eine Grenze (…) gesteckt", da "selbst die reine Geometrie, in der die abstrakte Malerei manchmal endet, (…) der Außenwelt die Farben und die perspektivischen Beziehungen" entnehmen müsse (MR 305). So verleugne sich "der schöpferische Akt (…) in diesen beiden Arten von Werken" in eben dem Maße, in dem er "in der absoluten Verneinung oder der absoluten Bejahung" die Wirklichkeit selbst verleugne (MR 304).
Absurde Kunst und die Kunst des Absurden
Camus' Kunst- und Literaturtheorie ist nicht unwidersprochen geblieben. Indem sie nämlich die Revolte gegen die Wirklichkeit zum Maßstab für ein im Sinne der Philosophie des Absurden gelungenes Kunstwerk macht, muss sie notwendigerweise von der Annahme einer prinzipiell vorhandenen Form und Formbarkeit der "Außenwelt" ausgehen.
Demgegenüber verknüpfen sowohl Jean-Paul Sartre als insbesondere auch Samuel Beckett die Erfahrung des Absurden gerade mit der Einsicht in den grundsätzlichen Konstruktcharakter dessen, was wir als "Realität" bezeichnen. In ihren Werken dekonstruieren sie folglich gerade die scheinbar klaren Konturen der Wirklichkeit, indem sie deren Bindung an die sprachlich vermittelten Kategorisierungs- und Beziehungsmuster des menschlichen Denkens vor Augen führen.
Für Beckett ergab sich hieraus die Frage, inwieweit die Erfahrung der Absurdität des Daseins sprachlich überhaupt adäquat ausgedrückt werden könne. Denn die sprachlichen Strukturen und die in sie eingeschriebenen Denk- und Deutungsmuster verleugnen ja gerade die Absurdität des Daseins. Wie sollen dieselben sprachlichen Strukturen dann dazu dienen können, diese Absurdität zum Ausdruck zu bringen?
Die "Revolte" Becketts und Sartres bestand vor diesem Hintergrund gerade nicht in dem Versuch, eine real nicht vorhandene Einheit zu erschaffen. Stattdessen richteten sie ihre künstlerische Arbeit gerade an dem Ziel aus, die durch die Sprache suggerierte Einheit der Realität in ihrem trügerischen Charakter vor Augen zu führen.
Camus' Poetologie des Absurden ist indessen nicht nur in epistemologischer Hinsicht fragwürdig. Problematisch ist vielmehr auch, dass hier – anders als noch in Der Mythos von Sisyphos – die künstlerische Revolte vollständig von der Ebene der historischen Realität getrennt wird. Camus' Kunsttheorie gerät so in eine bedenkliche Nähe zu dem konservativen Konzept eines sich in der Kunst manifestierenden Reichs des reinen Geistes, in dem sich die menschliche Freiheit unabhängig vom Gang der Geschichte offenbare.
Dies geht etwa aus Aussagen hervor, die der Kunst die Aufgabe zuschreiben, die "Schönheit [zu] erhalten" – weil einmal "der Tag kommt, da die Revolutionen ihrer bedürfen" (MR 314). Gleiches gilt für die Forderung, die Kunst solle den Menschen lehren, dass er "sich nicht mit der Geschichte erschöpft und (…) auch in der Natur einen Lebensgrund findet" (MR 313).
Wie problematisch eine solche ahistorische Konzeption von Kunst ist, wird deutlich, wenn Camus ausgerechnet eine Passage aus dem in russischer Gefangenschaft verfassten Tagebuch des Nazi-Autors Edwin Erich Dwinger als Beispiel für sein künstlerisches Ideal anführt. Dwingers Freikorpsroman Die letzten Reiter (1935) zählt nach Ernst Loewy (1966: 344) "zum Blutrünstigsten, was diese Art 'Schrifttum' hervorgebracht hat". Camus dient das Dwinger-Zitat dennoch als Beleg dafür, dass "geheimnisvolle Melodien und grausame Bilder entschwundener Schönheit inmitten von Verbrechen und Wahnsinn das Echo jenes Aufstandes" vermitteln könnten, "der während der Jahrhunderte für die menschliche Größe zeugte" (MR 313).
Camus' Mensch in der Revolte wurde so auch zum Anlass des Bruchs zwischen Camus und Sartre. Dieser warf seinem einstigen Weggefährten vor, sein Konzept der Revolte beruhe auf der Vorstellung eines "zeitlosen Kampf[s] gegen die Ungerechtigkeit unseres Schicksals" bzw. gegen die "blinden Mächte des Universums" (KiF 45; vgl. hierzu auch Royle 1982; Koechlin 1990).
2. Das Absurde und das Groteske
Das Absurde weist zahlreiche Berührungspunkte mit dem Grotesken auf, unterscheidet sich von diesem aber auch in vielfältiger Hinsicht. Für eine genauere Bestimmung der Prosa des Absurden erscheint es daher notwendig, Wechselbeziehungen und Differenzen zwischen dem Absurden und dem Grotesken zumindest überblicksartig herauszustellen. Hierfür muss zunächst das Groteske näher bestimmt werden.
Herkunft des Begriffs "grotesk"
Der Begriff "grotesk" (ital. "grottesca") geht zurück auf die römischen Grotten (ital. "grotta", Plural "grotte"), in denen Ende des 15. Jahrhunderts eine bestimmte Art von antiker Ornamentik entdeckt worden war. Deren zentrales Kennzeichen war eine Vermischung unterschiedlicher Sphären. So konnten an die Stelle von Säulen Blumenstängel treten, die manchmal mit Tier- oder Menschenköpfen versehen waren.
Als in der Renaissance Maler wie Raffael die neu entdeckten antiken Gestaltungsformen zu adaptieren begannen, wurden die entsprechenden Elemente der Gemälde als "sogni dei pittori" (Malerträume) bezeichnet (vgl. Kayser 1957: 14). Dies unterstrich den Bruch mit den konventionellen Deutungsmustern der Realität, der die neuen bildnerischen Elemente auszeichnete.
Darin, dass die Traumlogik hier der Alltagslogik gleichberechtigt an die Seite gestellt wurde, lag für die Zeitgenossen Raffaels wohl auch das Beunruhigende der neuen Malweise. Denn in dieser wurde dem Verdacht Ausdruck verliehen, dass die menschliche Wirklichkeitswahrnehmung nicht notwendig der Wahrheit entsprechen muss. Insofern war es wohl auch kein Zufall, dass die Malweise gerade in der Renaissance – die ja in vielerlei Hinsicht das bisherige Weltbild revidierte – auf fruchtbaren Boden fiel.
Interessant sind in diesem Zusammenhang die von Luca Signorelli zwischen 1499 und 1504 am Dom zu Orvieto angebrachten Grotesken, bei denen die in sich verschlungene, ungeordnete Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt des unteren Bildteils im oberen Bildteil mit einer klaren, wohlgeordneten Welt kontrastiert wird. Beide Welten sind dabei allerdings nicht klar voneinander geschieden, sondern gehen in der Mitte ineinander über.
Das Groteske dient damit hier der Gestaltung eines bestimmten Aspekts der menschlichen Existenz, der sich auf die Teilhabe des Menschen an der Welt der Materie, seine Natur- und Triebhaftigkeit, bezieht. Dem wird im oberen Bildteil die hellere Welt des Geistes gegenübergestellt, an der die menschliche Existenz – wie der gleitende Übergang zwischen den beiden Bildteilen vor Augen führt – ebenfalls Anteil hat.
Das Groteske und das Erhabene
Aus dieser Vermischung der Sphären ergibt sich zugleich, dass dem Menschen in seinem subjektiven Erleben sowohl das "Oben" als auch das "Unten" zugänglich sind. Der Erfahrung des "Oben" entspricht dabei das "Sich-Erheben" über die eigene Verstrickung in das chaotisch erscheinende Brodeln der Materie.
Während dem "erhebenden" Gefühl die spezifischen Darstellungsweisen des Erhabenen korrespondieren, entsprechen der Erfahrung des "Unten" gerade Gestaltungsformen, die dem vollständigen Versinken im Chaos der Welt Ausdruck verleihen. An die Stelle der Empfindung größtmöglicher Klarheit tritt hier das Gefühl einer umfassenden Entgrenzung. Dem entspricht auf der Ebene der subjektiven Erfahrung der Rausch und auf der Ebene der künstlerischen Darstellung eine Gestaltungsform, bei der sich alles unterschiedslos miteinander vermengt, bei der die Grenzen der Dinge aufbrechen und ineinander übergehen. Eben dies wurde in der Renaissance auf den Namen "grottesca" getauft.
Das Erhabene und das Groteske lassen sich damit auch als anthropologische Konstanten verstehen, die sich als solche mit den religionsgeschichtlichen Begriffen des Apollinischen und des Dionysischen berühren.{12} Vor diesem Hintergrund lassen sich dann auch noch weitere Kunstformen und kulturelle Praktiken des späten Mittelalters dem Bereich des Grotesken zuordnen.
So lebten seinerzeit etwa im Karneval typische Elemente des dionysischen Kultes wieder auf.{13} Zu denken ist dabei nicht nur an Rausch und Maskerade, sondern vor allem auch an die vorübergehende Suspension oder Umkehrung der Alltagskonventionen. Ein besonders eindrückliches Beispiel dafür ist die Eselsmesse, bei der ein Esel an die Stelle des Geistlichen trat und die Gemeinde statt Gebeten und Gesängen nur Eselslaute von sich gab (vgl. Zacharias 1982: 70).
Karneval und Totentänze als "groteske" Praktiken
Noch enger sind die Affinitäten zur Groteske im Falle der danses macabres (Totentänze){14}, die im Gefolge der großen Pestepidemien (ab 1347) kreiert wurden. Die Vermischung sonst voneinander getrennter Daseinssphären wird hier dadurch auf die Spitze getrieben, dass der Tod nicht nur als lebende Gestalt in Erscheinung tritt, sondern dabei auch noch wilde, oft obszön wirkende Tanzsprünge vollführt. Seine Darstellung wird hier also gerade mit besonders intensiven Formen der Lebensäußerung verbunden.
Sowohl im Karneval als auch im Totentanz kam es damit zu einer Überschreitung der Grenzen des Gewohnten und Alltäglichen. Im Karneval stand dabei allerdings eher der Versuch im Vordergrund, für sonst unterdrückte Triebe bzw. Verhaltensweisen eine begrenzte Zeit lang ein Ventil zu öffnen. Zugleich wurden etwaige Unzufriedenheiten mit den gesellschaftlichen Verhältnissen in Lachen aufgelöst. So hatte der Karneval eine kathartische Wirkung und trug im Endeffekt gerade zu einer Stärkung der herkömmlichen Ordnung bei.
Demgegenüber überwog im danse macabre von Anfang an das Grauen. Nicht nur schien der Tod mit seinem Grinsen die Lebenden hier auszulachen. Mit seinen Tanzgebärden äffte er sie vielmehr auch nach und verspottete sie so gerade in ihrer Lebenslust. Diese Wirkung beruhte außer auf seinen Bewegungen auch auf der bloßen Vorstellung des tanzenden Todes. Diese führte auf sehr anschauliche Weise das Enthaltensein des Todes im Leben vor Augen und fasste so den Vanitas-Gedanken in einem einprägsamen Bild zusammen.
Dem spöttisch-hämischen Grinsen des Todes entsprach dabei die lachhafte Erscheinung derer, die in vollem Ornat, mit den Insignien ihrer Macht oder ihrem Goldschatz in der Hand vom Tod in sein Reich überführt wurden. In anderen Fällen – wie etwa in den Darstellungen von Mädchen in der Blüte ihrer Jahre, die in sehnsuchtsvoller Gebärde den wollüstig grinsenden Tod umarmen – stand stärker der Aspekt der Vergänglichkeit irdischer Lüste im Vordergrund.
Die Totentänze hatten damit zwar einerseits die didaktische Funktion, die Zuschauer von der Notwendigkeit einer gottgefälligen Lebensführung zu überzeugen. Schließlich überraschte der Tod seine Opfer stets mitten im Leben und ließ ihnen somit keine Zeit, sich den Höllenstrafen durch eine rechtzeitige Buße zu entziehen.
Andererseits enthielten die danses macabres aber zugleich auch ein befreiendes, sozialkritisches Element. Dies ergab sich daraus, dass die Totentänze die Gleichheit aller Stände vor dem Tod besonders hervorhoben. Dabei führten sie zugleich die Lächerlichkeit derer vor Augen, die im Glauben an ihre gesellschaftliche Unentbehrlichkeit darauf zu vertrauen schienen, dass der Tod sie verschonen würde. Indem die Totentänze so ein Ventil für sozialen Unmut schufen, verhinderten sie freilich auch den offenen Ausbruch sozialer Unruhen und wirkten sich insofern ebenso stabilisierend auf die herrschende Ordnung aus wie der Karneval.
Das Makabre als Sonderform des Grotesken
Das Makabre lässt sich damit als Sonderform des Grotesken beschreiben, bei der das für dieses charakteristische Ineinanderfließen sonst voneinander getrennter Daseinssphären sich speziell auf die Vermischung von Leben und Tod bezieht.
Als das radikal Andere des Lebens ist der Tod allerdings selbst in besonderer Weise mit der Nachtseite des Ichs verbunden. So gesehen, stellt das Makabre letztlich nur eine extreme Variante des Eindringens des Anderen in den Alltag des Menschen dar. Die Bilder vom tanzenden Tod erinnern denn auch selbst an die Struktur von Träumen, in denen ja ebenfalls die Alltagslogik durch die frei assoziierende Logik der Phantasie ersetzt wird. Makabre und andere groteske Gestaltungsweisen treffen sich demzufolge auch in der spezifischen Mischung aus Erheiterung und Grauen, die entsprechende Kunstwerke auslösen können.
Die enge Verknüpfung beider Empfindungen resultiert zum einen aus der Tatsache, dass in der Groteske der illusionäre Charakter des menschlichen Glaubens, das eigene Leben in der Hand zu haben und selbst über es bestimmen zu können, als solcher entlarvt wird. Zum anderen vermitteln groteske Darstellungsweisen auch stets einen Eindruck von der trügerischen Struktur der menschlichen Wirklichkeitswahrnehmung. Sie nähren den Zweifel, dass die Wirklichkeit nicht so ist, wie wir sie sehen. Daraus ergibt sich unmittelbar das beunruhigende Gefühl, dass unserer Wahrnehmung zentrale Aspekte verborgen bleiben, die aus dieser Verborgenheit heraus unser Dasein (mit-)bestimmen.
Wechselbeziehungen und Differenzen zwischen dem Grotesken und dem Absurden
Für eine Herausarbeitung von Wechselbeziehungen und Differenzen zwischen dem Grotesken und dem Absurden müssen zunächst die verschiedenen Ebenen, auf denen beide diskutiert und analysiert werden können, voneinander abgegrenzt werden. Unterschieden werden kann dabei etwa zwischen
- dem Grotesken bzw. dem Absurden als anthropologischen Grundkonstanten, d.h. als Ausdruck einer bestimmten Sichtweise des menschlichen Daseins und des dieser entsprechenden Empfindungsmodus;
- der Frage nach den strukturellen Voraussetzungen für die Entstehung des Grotesken und des Absurden;
- der konkreten Manifestation des Grotesken bzw. des Absurden auf der Ebene des Individuums und/oder der gesamtgesellschaftlichen Ebene;
- der Frage nach den künstlerischen Gestaltungsmöglichkeiten des Grotesken und des Absurden.
Das Absurde als anthropologische Grundkonstante
Als anthropologische Grundkonstante bezeichnet das Absurde
a) das Faktum, dass der Mensch seine Existenz nur dann in einen metaphysischen Sinnzusammenhang zu stellen vermag, wenn er – im Sinne des "credo quia absurdum" ("Ich glaube daran, weil es absurd ist") – die seine rationalen Kapazitäten übersteigende Eigenart dieses Sinnzusammenhangs gerade als Bestätigung für dessen Vorhandensein ansieht;
b) die nie zum Ziel führende Suche nach einem allgemeinverbindlichen Sinn des menschlichen Daseins, sofern der Einzelne (mit Camus) den nach Kierkegaard hierfür notwendigen "Sprung in den Glauben" für sich ablehnt;
c) den Widerspruch zwischen dem sich selbst als immateriell – und in diesem Sinne "ewig" – wahrnehmenden menschlichen Bewusstsein und dessen materieller und damit vergänglicher Grundlage.
Als diese Aspekte des menschlichen Daseins zusammenfassende mythologische Denk-Bilder können neben dem von Camus genannten Sisyphos (vgl. Kap. 1) auch Prometheus und Tantalos angesehen werden.
Im Falle von Prometheus ist dies in der Strafe begründet, die die Götter ihm für sein anmaßendes Verhalten auferlegen. Als Überbringer des Feuers, dem Bild für Wissen und Erkenntnisfähigkeit, an die Menschen, möchte er sich selbst zum Demiurgen erheben und die Welt aus eigener Machtvollkommenheit neu erschaffen. Zur Strafe lassen die Götter ihn an einen Felsen schmieden, wo bis in alle Ewigkeit ein Adler an seiner Leber frisst.
Da die Leber in zahlreichen Mythologien als Sitz der Seele bzw. des menschlichen Geistes angesehen wird, fasst das Bild in prägnanter Weise die Grundkonstellation des menschlichen Daseins zusammen: Indem der Mensch sich seines Verstandes bedient, muss er zugleich die physische Grundlage seiner geistigen Kapazitäten (und damit deren Instabilität und Vergänglichkeit) erkennen.
Wie Prometheus wird auch Tantalos für seine Auflehnung gegen die Götter bestraft. Während Prometheus für den Diebstahl des Feuers zur Rechenschaft gezogen wird, muss Tantalos für den Raub der Götterspeisen Nektar und Ambrosia büßen. Wie Prometheus hat zudem auch er die Allmacht der Götter in Frage gestellt.{15} Seine Strafe besteht darin, dass er auf ewig Speisen und Getränke vor Augen hat, sich diese ihm jedoch entziehen, sobald er danach greift.
Dies lässt sich zum einen – im Sinne Schopenhauers – als Bild für den rastlos nach immer neuen Zielen strebenden, nie befriedigten menschlichen Willen deuten. Zum anderen kann der Mythos jedoch auch im übertragenen Sinne verstanden werden. Dann spiegelt sich in ihm eine Grundkonstellation des Absurden wider: nämlich ein geistiges Streben, dessen "Ziel" sich im Moment der Annäherung "entzieht" (Wolfgang Hildesheimer, FV 60).
Das Groteske als anthropologische Grundkonstante
Das Groteske bezeichnet demgegenüber – als Gegenpol zum Erhabenen – eine Situation, in der die zentralen Kategorien, mit denen der Mensch seine Welt zu ordnen versucht, zusammenbrechen, ineinander übergehen und/oder verkehrt werden. Es steht demzufolge für
a) den Einbruch des Todes in die Sphäre des Lebens;
b) die Überflutung des Bewusstseins mit Elementen des Unterbewusstseins und ein dem entsprechendes, der rationalen Kontrolle ganz oder teilweise entzogenes Handeln;
c) die Auflösung bzw. Verkehrung der zur Regelung des Alltags entwickelten Deutungsmuster, Normen und Verhaltenskonventionen.
Das zentrale mythologische Denk-Bild hierfür ist – als Gott des ekstatisch die Grenzen des Ichs sprengenden Rausches sowie der Zerstörung und Erneuerung des Lebens – Dionysos.
Strukturelle Voraussetzungen für die Entstehung des Grotesken und des Absurden
Als strukturelle Voraussetzung für die Entstehung des Grotesken und des Absurden erscheint jeweils der Vergleich. So hat Camus dargelegt, dass die Welt bzw. die Existenz des Menschen nicht per se absurd ist, sondern das Absurde erst durch die Konfrontation des Sinnanspruchs des menschlichen Geistes mit der Kontingenz seiner Existenz entsteht (vgl. Kapitel 1).
Ebenso entsteht auch das Groteske durch das Aufeinandertreffen zweier einander ausschließender Elemente – nur dass diese anderer Natur sind als im Falle des Absurden. Das Existenzgefühl des Grotesken vermittelt dem Menschen nicht die Einsicht in die grundsätzliche Sinnlosigkeit seines Daseins. Stattdessen wird hier die Alltagslogik mit der Logik des "Anderen" konfrontiert – sei es des Todes, des Unbewussten oder des kulturell Andersartigen.
Anders als das Absurde, resultiert das Groteske damit nicht aus dem Aufeinandertreffen von Sinnanspruch und Sinnverweigerung. Entscheidend ist vielmehr, dass eine bestimmte Situation den auf der Basis der Alltagslogik an sie gerichteten Erwartungen in fundamentaler Weise widerspricht, indem sie ganz oder teilweise der Logik des "Anderen" folgt.
Zusammenhang von absurdem und groteskem Existenzgefühl mit bestimmten soziokulturellen Konstellationen
Die konkrete Manifestation des grotesken ebenso wie des absurden Existenzgefühls ist grundsätzlich auch unabhängig von gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen denkbar. So kann die Empfindung des Grotesken etwa durch Rauschzustände oder schizoide Bewusstseinsstörungen und das Daseinsgefühl des Absurden durch den Tod eines geliebten Menschen hervorgerufen werden.
Bedeutsamer erscheint im gegebenen Zusammenhang allerdings die Frage, unter welchen gesamtgesellschaftlichen Konstellationen das Existenzgefühl des Grotesken bzw. des Absurden in einer Kultur dominant werden kann.
Dabei scheint das Absurde insbesondere mit Kriegen, Seuchen oder auch schweren Wirtschaftskrisen im Zusammenhang zu stehen. Die Empfindung des Grotesken wird dagegen eher in Zeiten des geistigen Umbruchs sowie bedeutender technischer oder politischer Veränderungen aktiviert. Es resultiert dann daraus, dass die Erwartungen des Einzelnen an die Strukturiertheit seines Alltags nicht mehr Schritt halten können mit den sich vollziehenden Veränderungen. Das Groteske ist insofern ein Indikator bzw. ein "Medium des kulturellen Wandels" (Fuß 2001).
Diese Unterscheidung ist freilich nur idealtypisch zu verstehen. So ist der spätmittelalterliche "danse macabre" etwa vor dem Hintergrund der Pest-Epidemie zu sehen. Die Darstellungen des Todes, der wahllos mit König und Bauersmann, reichem Kaufmann und armem Tagelöhner ins Grab tanzt, sind jedoch im Kern grotesk. So drücken sich hierin zugleich die Umbrüche jener Jahre aus, wie sie sich etwa im Wachstum der Städte und den dadurch bedingten sozialen Umwälzungen manifestiert haben.
In der barocken Vanitas-Dichtung, die vor dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges entstanden ist, steht dagegen das Existenzgefühl des Absurden im Vordergrund – das hier freilich noch von dem ungebrochenen Glauben an Gott abgemildert wird. Dies zeigt, dass beide Empfindungsweisen einander nicht gegenseitig ausschließen müssen.
Sobald der Tod ins Leben einbricht – wie im Krieg oder in Pandemie-Zeiten – werden Leben und Tod nicht mehr als getrennte Bereiche wahrgenommen. Hierdurch kann einerseits die eigene Existenz in ihrer Kontingenz und Absurdität wahrgenommen werden, andererseits aber auch das gesamte Alltagsleben in seiner angemaßten Bedeutungsschwere grotesk erscheinen.
Groteskes und Absurdes hängen demnach hier eng miteinander zusammen. Welche Betrachtungsweise des Daseins jeweils überwiegt, ist dabei eine Frage der Perspektive. Grundsätzlich bleibt die Empfindung des Grotesken stets enger auf das Alltagsleben bezogen, da für sie ja gerade der Vergleich der Logik des "Anderen" mit der Alltagslogik charakteristisch ist. Die Empfindung des Absurden vollzieht sich dagegen jenseits derselben, indem sie nicht eine bestimmte Alltagslogik, sondern allgemein die alltägliche Logik der menschlichen Selbstwahrnehmung mit der Logik des Todes konfrontiert.
Das Groteske als künstlerisches Darstellungsmittel
Als künstlerisches Darstellungsmittel kann das Groteske dazu dienen, die fundamentale Erwartungswidrigkeit des Alltagslebens in Zeiten des Umbruchs sowie die daraus folgende Desorientierung vor Augen zu führen. In diesem Sinne sind groteske Ausdrucksformen etwa im Expressionismus eingesetzt worden.
Das Gestaltungsprinzip, aus dem sich die groteske Wirkung ergab, war dabei die Simultaneität, durch die die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen vor Augen geführt werden konnte. Das hierfür eingesetzte künstlerische Mittel war in der bildenden Kunst die Collage und in der expressionistischen Lyrik der Reihungsstil (vgl. beispielsweise die Gedichte Weltende von Jakob van Hoddis und Die Dämmerung von Alfred Lichtenstein).
Die Funktion dieses Gestaltungsprinzips war es dabei nicht nur, die Geschwindigkeit des Wandels sowie das Herausfallen der Dinge aus den vertrauten Zusammenhängen zu dokumentieren. Vielmehr war mit dem Rückgriff auf das Groteske auch das Bestreben verknüpft, die Entfremdung des Menschen von seiner Umwelt sowie vor allem seine Fremdbestimmung durch den ursprünglich von ihm selbst initiierten technisch-industriellen Entwicklungsprozess kritisch zu hinterfragen.
Groteske Darstellungsformen und das Existenzgefühl des Absurden
Außer in gesellschaftskritischer Absicht können groteske Darstellungsformen auch mit dem Ziel eingesetzt werden, die grundsätzliche Fremdheit des Menschen in der Welt, wie sie sich aus der Tatsache seines Zum-Tode-Seins ergibt, zum Ausdruck zu bringen. Zwar müssen sich – wie der "danse macabre" zeigt – die soziale und die existenzielle Bezugsebene keineswegs gegenseitig ausschließen. Steht indessen die Thematisierung des Zum-Tode-Seins des Menschen im Vordergrund, so resultieren die grotesken Darstellungsmittel unmittelbar aus dem Existenzgefühl des Absurden und dienen dazu, dieses künstlerisch darzustellen.
In diesem Sinne wird der Begriff des Grotesken sowohl von Wolfang Hildesheimer als auch von Jean-Paul Sartre{16} und Eugène Ionesco{17} verwendet. Groteske Ausdrucksformen werden dabei jeweils als Symptom bzw. Spiegel des Existenzgefühls des Absurden gedeutet bzw. eingesetzt. So erzielt Sartre die Wirkung des Grotesken durch das Herauslösen der Dinge aus ihrem üblichen Wahrnehmungs- und Verwendungszusammenhang, Ionesco durch die Darstellung eines aus seinem Funktionszusammenhang herausgelösten Handelns. Ähnlich sieht Hildesheimer (FV 94) die Wirkung des Grotesken u.a. daraus hervorgehen, dass wir bei einem Gespräch nicht "auf die Worte hören", sondern stattdessen nur "auf die Gebärde" achten.
Künstlerische Darstellungsmittel für das Existenzgefühl des Absurden
Groteske Ausdrucksmittel sind indessen nur eine Möglichkeit unter anderen, um das Existenzgefühl des Absurden künstlerisch zu gestalten. Dieses kann daneben auch noch zum Ausdruck gebracht werden
a) über einen von Gleichgültigkeit bestimmten Erzählton, der – wie von Camus in Der Fremde (vgl. 3.1.) vorgeführt – das "Klima der Absurdität" spürbar macht, in dem sich der Protagonist bewegt. Auf der syntaktisch-lexikalischen Ebene entspricht dem häufig ein besonders karger Ausdrucksstil, wie er sich etwa in einem parataktischen Satzbau und einer bilderarmen Sprache manifestiert;
b) durch eine monologisch-monomanische Erzählweise, die, wie in den Werken Thomas Bernhards, das "Entsetzliche" in der "ver-rückten" Geistesverfassung der Protagonisten widerspiegelt;
c) als Kontemplation des Protagonisten über die absurde Konstellation der eigenen Existenz, wie u.a. in Becketts Molloy-Trilogie (vgl. 3.4.) und in Wolfgang Hildesheimers monologischer Prosa (vgl. 4.4.);
d) als Parabel, aus der sich die Absurdität des Daseins per Analogieschluss ergibt, wie etwa im existenzialistischen Theater Jean-Paul Sartres oder in der frühen Prosa Ilse Aichingers (vgl. 4.6.);
e) über eine dem Prosagedicht verwandte Schreibweise, die das Absurde – wie in der späteren Prosa Ilse Aichingers – durch Ausdrucksformen, die die konventionellen Sinngebungsverfahren bewusst konterkarieren, in sich aufnimmt (vgl. 4.6.);
f) mittels einer "poetischen Metaphernsprache" (Esslin 1961: 332), wie sie in zahlreichen Werken des Theaters des Absurden und teilweise auch in der Prosa Ingeborg Bachmanns zu beobachten ist.
Befreiende Wirkung grotesker und absurder Darstellungsformen
Sowohl groteske als auch absurde Darstellungsformen können in befreiender Absicht eingesetzt werden. Dabei ergibt sich die befreiende Wirkung im Falle grotesker Ausdrucksmodi jedoch unmittelbarer als bei absurden Gestaltungsweisen.
Dies liegt zum einen daran, dass groteske Darstellungsformen – wie insbesondere der Surrealismus gezeigt hat – gezielt dafür genutzt werden können, die Präsenz des "Anderen" in der Alltagswirklichkeit künstlerisch zu gestalten und so auf die Befreiung verdrängter Triebe und Wünsche hinzuwirken. Zum anderen kann mit Hilfe grotesker Ausdrucksweisen jedoch auch die "Ver-rücktheit" der realen Verhältnisse vor Augen geführt werden. Dies dient dazu, die Logik des Verkehrten als solche zu erkennen und letztlich zu überwinden. In diesem Sinn ist die Groteske etwa als Mittel der Faschismuskritik (s.u.), daneben aber auch – wie u.a. von Friedrich Dürrenmatt – als (Zerr-)Spiegel der sozialen Verhältnisse in der modernen Industriegesellschaft eingesetzt worden.
Die befreiende Wirkung einer künstlerischen Gestaltung des Absurden ergibt sich hingegen eher indirekt – nämlich aus der durch sie anzuregenden größeren Bewusstheit des Einzelnen, der durch sie zur Einsicht in die Grundbedingungen seiner Existenz und damit zu einer freieren Verfügung über diese gelangen kann.
Auf moralischem Gebiet besteht die Freiheit dabei in der Erkenntnis, dass der Imperativ des gesellschaftlichen Normenkanons angesichts des Zufallscharakters eines jederzeit vom Tod bedrohten Lebens seinen apodiktischen Anspruch einbüßt. Daraus folgt freilich auch die ethische Verpflichtung, einem eigenen, auf universellen Menschenrechten basierenden ethischen Kompass zu folgen und dafür den vorhandenen Gesetzen und moralischen Werten nötigenfalls auch aktiv zu widersprechen.
Die größere geistige Autonomie geht demnach auch mit einer größeren Eigenverantwortung einher. Nicht mehr möglich ist es dann, inhumanes Verhalten mit dem Hinweis auf die Befolgung allgemein anerkannter gesellschaftlicher Normen zu entschuldigen.
Entlarvung der "Logik des Verkehrten" in der Groteske
Sowohl das Absurde als auch das Groteske können als Mittel der Gesellschaftskritik fungieren. Die Zielrichtung ist dabei allerdings jeweils eine andere. Verdeutlichen lässt sich dies am Beispiel des Einsatzes von Schreibweisen des Grotesken und des Absurden im Rahmen faschismuskritischer Literatur.
Grotesker Darstellungsmittel bedienen sich etwa Günter Grass in der Blechtrommel (1959) und Italo Calvino in seinem 1947 erschienenem Roman Il sentiero dei nidi di ragno ("Der Weg der Spinnennester"; dt. 1965 u.d.T. "Wo Spinnen ihre Nester bauen"). In beiden Fällen ergibt sich die Wirkung des Grotesken daraus, dass aus einer kindlichen Perspektive erzählt wird. Die echte oder gespielte Naivität führt hier dazu, dass die Ungeheuerlichkeit dessen, was in der Erwachsenenwelt als normal gilt, offen zutage tritt.
Dies gilt in ähnlicher Weise auch für Camilo José Celas Roman La familia de Pascual Duarte (1942), in dem ebenfalls mit einer naiven Selbstverständlichkeit von den brutalsten Verbrechen berichtet wird. Dieses im Spanischen "Tremendismo" (von "tremendo": schrecklich) genannte literarische Phänomen kann u.a. dazu dienen, die Hilflosigkeit des Protagonisten im Umgang mit der äußeren Gewalt und seinen inneren Gewaltimpulsen zu verdeutlichen. Der Unterschied zwischen ihm und seinen Mitmenschen besteht dann lediglich darin, dass die niederen Instinkte bei ihm ungeschminkter und dauerhafter zum Ausdruck kommen als bei diesen.
Die gewalttätigen Protagonisten erscheinen hier demnach gleichermaßen als Opfer wie als Täter. Sie sind damit ein erzählerisches Konstrukt, das dazu beitragen kann, den Faschismus zu entmystifizieren und in seinem Zusammenhang mit bestimmten sozioökonomischen Strukturen vor Augen zu führen.
In den entsprechenden Romanen geht es also jeweils um die Entlarvung der "Logik des Verkehrten", wie sie für den Faschismus ebenso gilt wie etwa auch für den Krieg. Die grotesken Darstellungsmitteln sollen die Leser die "Verkehrtheit" der realen Verhältnisse erkennen lassen und sie so in die Lage versetzen, diese zu überwinden bzw. dazu beizutragen, dass die für ihr Zustandekommen maßgeblichen innerpsychischen und sozioökonomischen Konstellationen sich nicht wiederholen.
Als impliziter Maßstab für die "Verkehrtheit" der realen Verhältnisse dient hier folglich die Vorstellung einer humanen, auf Frieden und Toleranz basierenden Gesellschaftsordnung. Diese soll durch ein "Zurechtrücken" der "ver-rückten" Verhältnisse wiederhergestellt werden.
Infragestellung der Alltagslogik in der Literatur des Absurden
Eben diese implizite Annahme des Vorhandenseins einer (nur vorübergehend außer Kraft gesetzten) humanen Gesellschaftsordnung wird von den Autoren des Absurden hinterfragt. Wenn sie der "Logik des Verkehrten" den Spiegel vorhalten, so allenfalls in dem Sinne, dass sie die grundsätzliche Verkehrtheit des Glaubens an die Logik des Alltags vor Augen führen wollen.
Dies hat auch zur Folge, dass formal ähnliche Ausdrucksweisen eine grundlegend andere Aussagefunktion erhalten können als in den oben genannten Fällen. So möchte etwa Cela mit dem Tremendismo gerade die extremen Folgen, die das Hineingeraten in die Logik des Verkehrten für den Einzelnen nach sich ziehen kann, veranschaulichen. Dagegen resultiert in Camus' L'Étranger die dem Tremendismo analoge Gleichgültigkeit des Protagonisten gerade aus einer Distanz zu der Logik des Alltags, die diese selbst in ihrer Fragwürdigkeit enthüllt (vgl. 3.1.).
Die "absurde Freiheit" erscheint damit als notwendiges Korrektiv zu dieser Logik. Sie kann dabei helfen, sich den Fallstricken, die der Alltagslogik inhärent sind, zu widersetzen. Denn sofern diese stets auf routinemäßigen Denkschemata, Deutungsmustern und Abläufen beruht, droht stets die Gefahr einer geistigen Erstarrung und der unhinterfragten Befolgung inhumaner moralischer Gebote. Dagegen setzt Camus die sisyphoshafte Auflehnung des seiner Absurdität bewussten Einzelnen, der aus eben diesem Bewusstsein heraus die selbstvergessenen Bahnen der Alltagslogik durchbricht.
3. Die Prosa des Absurden im internationalen Kontext
3.1. Camus' L'Étranger als literarischer "Versuch über das Absurde"
1942, im selben Jahr wie sein "Versuch über das Absurde" (Der Mythos von Sisyphos), erschien auch Albert Camus' Erzählung L'Étranger (dt. Der Fremde, 1948). Die in dem Essay dargelegte Auffassung, das absurde Kunstwerk habe dem Menschen "einen genauen Fingerzeig von dem aussichtslosen Weg zu geben, den alle gehen müssen" (MS 80 f.), erfährt hier eine praktische Umsetzung.
Bereits Sartre setzte in einer frühen Rezension des Werkes die geistige Situation des Protagonisten in Beziehung zu Camus' theoretischen Reflexionen über das Absurde. So bezog er sich dabei auf ein Bild, das Camus zur Veranschaulichung der Entfremdung des Menschen von seinem Dasein gewählt hatte. Camus hatte diese mit der Situation eines Menschen verglichen, der hinter einer Glaswand in ein Telefon spricht. Die Bewegungen dieser Person würden hierdurch 'mechanisch' wirken, wie eine "sinnlos gewordene Pantomime" (MS 18; vgl. Sartre, MD 85).
Ein Mord aus Gleichgültigkeit
In der Tat scheint Meursault, der Protagonist der in Algerien{18} spielenden Erzählung, die Welt ebenfalls wie durch eine Glaswand hindurch wahrzunehmen. Entsprechend unbeteiligt reagiert er selbst auf für ihn de facto äußerst bedeutsame Ereignisse. Ein Beispiel dafür ist eine Passage, in der sein Chef ihn fragt, ob ihn eine "Änderung" in seinem Leben nicht "reizen" würde. Auf das Angebot, bei der Eröffnung eines neuen Büros in Paris mitzuwirken, antwortet Meursault nur lakonisch, "dass man sein Leben nie änderte, dass eins so gut wie das andere wäre und dass mein Leben hier mir keineswegs missfiele" (F 52).
Ähnlich fällt die Reaktion aus, als seine Freundin Marie ihn fragt, ob er sie heiraten wolle. Hierauf entgegnet Meursault, "dass das völlig belanglos wäre und dass wir, wenn sie es wünschte, heiraten könnten" (53). Die Frage, ob er sie liebe, ist für ihn ebenso bedeutungslos wie die Entscheidung, mit wem er zusammenlebt. So gibt er offen zu, dass er "den gleichen Vorschlag auch von einer anderen Frau angenommen hätte, mit der ich auf die gleiche Weise verbunden wäre" (ebd.).
Meursaults Empfindung, "dass das alles ohne wirklichen Belang ist" (52), führt schließlich auch dazu, dass er den arabischen Bruder der ehemaligen Geliebten seines Freundes Raymond erschießt. Als er zusammen mit Raymond am Strand dem Araber und einem Kameraden von diesem begegnet und Raymond ihm seinen Revolver gibt, ist ihm die Frage von Leben oder Tod (bzw. Lebenlassen oder Töten) erneut völlig gleichgültig:
"Ich habe in dem Moment gedacht, man könnte schießen oder nicht schießen" (F 70).
Als die heikle Situation scheinbar glücklich überstanden und er mit Raymond zu der Strandhütte eines Freundes zurückgekehrt ist, laufen "hierbleiben oder weggehen" für ihn abermals "auf dasselbe hinaus" (ebd.). Die Folge ist, dass er wieder zum Strand zurückgeht und dort erneut auf den Algerier trifft. Geblendet von dessen im Mittagslicht funkelndem Messer und betäubt von den "Beckenschläge[n]" der Sonne auf seiner Stirn, die ihn in einen "undurchdringlichen Taumel" hüllen (71 f.), schießt er den anderen nieder.
Die Hinrichtung als Ziel des Lebens
Die Erschießung des Mannes erscheint somit einerseits als Kulminationspunkt einer fortschreitenden Entfremdung des Protagonisten von seinem Dasein. Andererseits kommt dem Ereignis jedoch auch eine Katalysatorfunktion für die geistige Entwicklung Meursaults zu. Denn dadurch wird die von ihm zuvor nur unbewusst empfundene Entfremdung seiner Reflexion zugänglich. Dies verhilft ihm – analog dem von Camus in seinem Versuch über das Absurde beschriebenen Entwicklungsverlauf – zur bewussten Einsicht in das Wesen "dieses ganzen absurden Lebens" (F 141).
So hat der Mord zum einen zur Folge, dass Meursault zum Tode verurteilt und dadurch dazu gezwungen wird, sich mit dem allgemeinen Zum-Tode-Sein des Menschen – als der Grundlage seiner Entfremdungsgefühle – auseinanderzusetzen. Dieser Reflexionsprozess ist zum anderen aber auch unmittelbar in dem Mord bzw. dem Geschehen, das diesem vorausgeht, angelegt. Denn bereits hier ist Meursaults Wahrnehmung des Lebens eindeutig von Tod und Zerstörung geprägt.
Das Meer etwa sieht er "mit den schnellen, erstickten Atemzügen seiner kleinen Wellen" auf dem Sand "hecheln" (70), während es ihm gleichzeitig unter der "rote[n] Explosion" der Sonne (ebd.) "einen zähen, glühenden Brodem" zu verbreiten scheint (73). Und wenn die Sonnenstrahlen sich in einer Muschel oder einer Glasscherbe spiegeln, fühlt er "Lichtschwerter" aus dem Sand "emporschießen" (71).
Das Geschehen am Strand deutet so bereits voraus auf Meursaults spätere Erkenntnis, seine Nächte "genaugenommen (…) damit zugebracht" zu haben, auf das "Morgengrauen" seiner Hinrichtung zu warten (F 132, ähnlich 141). Der Mord am Strand könnte so auch als fehlgeleiteter Versuch der Auseinandersetzung mit der Absurdität des Daseins verstanden werden.
Mit dem Tötungsakt hätte Meursault demnach unbewusst dasselbe Ziel verfolgt wie sein Vater, als er einmal als Zuschauer der Hinrichtung eines Mörders hatte beiwohnen wollen. Die Motive dafür kann Meursault bezeichnenderweise erst vor dem Hintergrund seiner eigenen Verurteilung zum Tode nachvollziehen:
"Er war krank bei dem Gedanken hinzugehen. Er hatte es trotzdem getan, und nach seiner Rückkehr hatte er sich fast den ganzen Vormittag übergeben. Mein Vater stieß mich damals etwas ab. Jetzt verstand ich, das war so natürlich. Wie hatte ich übersehen können, dass nichts wichtiger ist als eine Hinrichtung und dass es alles in allem das einzig wirklich Interessante für einen Menschen ist." (F 129)
So gelangt Meursault schließlich zu der Einsicht in das grundsätzliche 'Zum-Tode-Verurteilt-Sein' jedes Menschen, unabhängig von der moralischen Qualität seines Handelns. Dadurch erscheint es ihm am Ende nebensächlich, ob ein nach dem Todesurteil von ihm eingereichtes Gnadengesuch angenommen wird oder nicht. Entscheidend ist für ihn vielmehr, dass er selbst die Kraft hat, "die Ablehnung meines Gnadengesuchs [zu] akzeptieren" (134) und damit auch sein existenzielles Zum-Tode-Sein anzunehmen.
Ablehnung von Sinnprothesen
Deutlich wird dies etwa bei dem Gespräch mit dem Anstaltsgeistlichen, der den Delinquenten vergeblich dazu auffordert, sich der "Gerechtigkeit Gottes" zu unterwerfen (138). Meursault hält ihm daraufhin vor, "auch die anderen würden eines Tages verurteilt", "auch er würde verurteilt" (142).
Zwar vertritt auch der Gefängnispfarrer die Ansicht, "wir alle" seien "zum Tode verurteilt" (137). Im Unterschied zu Meursault tut dies seinem Glauben an Gott und seinem Vertrauen in dessen Gerechtigkeit jedoch keinen Abbruch. Sein Denken erscheint so als Beispiel für die von Camus im Mythos von Sisyphos als "philosophischen Selbstmord" (MS 39) gegeißelte Einstellung zum Leben.
Camus charakterisiert damit Denker, die "durch eine sonderbare Überlegung" das "vergöttlichen (…), was sie zerschmettert", und "einen Grund zur Hoffnung" finden "in dem, was sie hilflos macht" (MS 32). Dies unterscheidet sich deutlich von der Haltung Meursaults. Für diesen ist gerade die Einsicht, das "immer (…) ich" es bin, der stirbt, zentral. Demgegenüber bleibt die Tatsache des Sterben-Müssens im Falle der von Camus als "philosophischer Selbstmord" eingestuften Denkweise letztlich abstrakt und wird so nicht in ihrer konkreten Bedeutung für das eigene Dasein realisiert.
Das volle Bewusstsein der Sterblichkeit als Wesensmerkmal der eigenen Existenz festigt in Meursault zunächst die Überzeugung, "dass das Leben nicht lebenswert ist" (F 133). Seine zuvor bereits an den Tag gelegte Gleichgültigkeit allem und jedem gegenüber erhält nun sozusagen eine philosophische Begründung. So ist die theoretische Möglichkeit, dass er auch "anders" hätte leben können (141), für ihn ebenso belanglos wie zuvor schon die Frage seines Chefs, ob ihn eine "Änderung" in seinem Leben nicht "reizen" würde (52):
"Ich hätte das eine getan, und ich hätte das andere nicht getan. Ich hätte die eine Sache nicht gemacht, während ich eine andere gemacht hätte. Na und?" (F 141)
Freiheit durch Selbstannahme
Auf der anderen Seite verhilft die geistige Durchdringung seiner eigenen Entfremdungsgefühle Meursault jedoch auch dazu, "die Freiheit des Menschen ernst zu nehmen" (MS 52). Erst die unverrückbare Tatsache, dass es "kein Morgen" mehr gibt (ebd.), ermöglicht ihm die vollständige Einsicht in die Absurdität seines Daseins. Und erst dadurch begreift er, dass er auch früher, als er noch nicht im Gefängnis saß, "in Wirklichkeit gar nicht frei war" (ebd.).
In der Folge handelt Meursault gemäß der von Camus im Mythos von Sisyphos formulierten Überzeugung, wonach es nur "umso mehr Schranken" um das eigene Dasein gebe, "je mehr ich mich von einer mir gehörigen Wahrheit, von einer Art zu sein oder zu schaffen, beunruhigen lasse, je mehr ich schließlich mein Leben ordne und dadurch beweise, dass ich ihm einen Sinn unterstelle" (ebd.). So weist er vehement das Sinnangebot des Anstaltsgeistlichen zurück. Dieser wäre, so wirft er ihm, seine eigenen Worte rückblickend paraphrasierend, vor,
"ja nicht einmal sicher, am Leben zu sein, da er leben würde wie ein Toter. Ich schiene mit leeren Händen dazustehen. Aber ich wäre meiner sicher, sicherer als er, meines Lebens sicher und dieses Todes, der bald kommen würde. Ja, ich hätte nur das. Aber zumindest besäße ich diese Wahrheit, genauso wie sie mich besäße." (F 141)
Gesteigerte Intensität des Lebens
Auch hier wandelt Meursault wieder auf den Spuren seines Schöpfers. Konkret erinnern seine Worte an die im Mythos von Sisyphos vertretene Auffassung, wonach "sein Leben, seine Auflehnung und seine Freiheit so stark wie möglich empfinden" bedeute, "so intensiv wie möglich" zu leben (MS 56). Analog hierzu führt auch bei Meursault die aus der Einsicht in die Absurdität seiner Existenz resultierende Freiheit zu einer gesteigerten Intensität der Wahrnehmung.
So bekennt er, "noch nie (…) so viel Geräusche (…), so schwache Töne vernommen" zu haben wie während seines Wartens auf das Morgengrauen, das ihm vielleicht den Tod bringen würde (F 132). Ähnlich führt auch für Camus die Einsicht in die Absurdität des Daseins zu einer besonderen Wachheit des Geistes. Sie offenbare sich "in der äußersten Spannung des Gedankens dessen, der zum Tode verurteilt ist", in "jene[m] Schuhband, das er trotz allem ein paar Meter entfernt liegen sieht, am Rande seines schwindelnden Sturzes" (MS 50).
Die "göttliche Verfügungsmacht des zum Tode Verurteilten, vor dem sich einmal im frühesten Morgenlicht die Gefängnistore öffnen, diese unglaubliche Interesselosigkeit allem gegenüber, außer der reinen Flamme des Lebens" (MS 53), empfindet offenbar auch Meursault. So fühlt er, mitten in der Nacht erwachend, "Landgeräusche" zu sich heraufsteigen und den "wunderbare[n] Frieden dieses schlafenden Sommers (…) wie eine Flut" in sich "eindringen". Sich "der zärtlichen Gleichgültigkeit der Welt" öffnend, gelingt es ihm gerade im Angesicht des Todes, sein Leben uneingeschränkt zu bejahen:
"(…) ich fühlte mich bereit, alles noch einmal zu leben" (F 143).
Distanz zum gesellschaftlichen Normenkanon
Im Mythos von Sisyphos fühlt sich der "absurde Mensch, der ganz und gar dem Tode zugewandt ist", "losgelöst von allem, was nicht zu dieser leidenschaftlichen Aufmerksamkeit gehört, die sich in ihm kristallisiert" (MS 53). Analog dazu manifestiert sich auch Meursaults geistige Freiheit in der zunehmenden Distanz gegenüber dem Denken derer, die ihm den Prozess machen. So begründet etwa der Staatsanwalt seine Ansicht, Meursault habe "im vollen Bewusstsein seines Tuns" getötet, mit dessen angeblicher "Gefühllosigkeit". Diese ergibt sich für ihn daraus, dass der Angeklagte bei der Beerdigung seiner Mutter keinerlei Anzeichen von Trauer gezeigt habe (F 117 f.).
Meursault beurteilt diese Argumentationsweise – in der Art eines unbeteiligten Beobachters seines eigenen Prozesses – als "plausibel" (ebd.). Eben dadurch enthüllt er ihren rein formallogischen und deshalb realitätsfernen Charakter. Dieser ergibt sich daraus, dass der Staatsanwalt Meursaults Handeln auf der Grundlage von "moralischen" und "sozialen Vorurteilen" (MS 52) bewertet, die sich auf den konkreten Fall nur um den Preis einer Verfälschung der Motive des Angeklagten übertragen lassen.
So zieht der Protagonist aus der Tatsache, dass seine Mutter sich am Ende ihres Lebens einen "Bräutigam" zugelegt hatte, die Schlussfolgerung, dass sie, "dem Tod so nahe", sich ebenso wie er "befreit gefühlt" habe und "bereit, alles noch einmal zu leben" (F 143). Weil sie somit seiner Ansicht nach ihren Frieden mit ihrer Existenz und damit auch mit ihrem Sterben-Müssen gemacht hatte, hat für ihn auch "niemand (…) das Recht, sie zu beweinen" (ebd.).
Während Meursault demnach das Leben vom Standpunkt des Existenzgefühls des Absurden aus beurteilt, bewertet der Staatsanwalt sein Handeln auf der Grundlage der "allgemein anerkannten Gebote" (MS 53). Diese erweisen sich dabei als inhuman, weil sie – wie der Staatsanwalt es von den Geschworenen verlangt – die "Tugend der Toleranz" als "ganz negativ" abqualifizieren. An deren Stelle wird ein fragwürdiger Begriff von höherer "Gerechtigkeit" gesetzt (F 119), der jedes Verständnis für ein von der Mehrheitsauffassung abweichendes Denken und Empfinden explizit ausschließt. Der scheinbaren "Seriosität" eines auf dieser Basis gefällten Urteils stellt Meursault denn auch dessen faktischen Willkür- und Zufallscharakter gegenüber:
"Die Tatsache, dass das Urteil um zwanzig Uhr statt um siebzehn Uhr verlesen worden war, die Tatsache, dass es ganz anders hätte sein können, dass es von Menschen gefällt worden war, die das Hemd wechseln, dass es im Vertrauen auf einen so ungenauen Begriff wie das französische (oder deutsche oder chinesische) Volk erlassen worden war – dies alles schien mir einer solchen Entscheidung viel von ihrer Seriosität zu nehmen." (F 128 f.)
Inhumanität aus mangelnder Wahrhaftigkeit
Die Inhumanität der "allgemein anerkannten Gebote" (s.o.) ergibt sich indessen bereits daraus, dass diese den Menschen über die Wahrheit seines Daseins hinwegtäuschen, indem sie ihn in der "Illusion" einer "ewigen Freiheit" wiegen. Dadurch verwehren sie ihm den "Zuwachs an Verfügungsrecht" über seine Existenz, den er durch die Erfassung dieser Wahrheit erlangen könnte (MS 51 f.).
So gesehen, ließe sich die anfänglich unbewusste Gleichgültigkeit Meursaults auch auf die sozial vorgegebene Herangehensweise an die menschliche Existenz und die hierdurch ausgelöste Entfremdung von dieser zurückführen. Aus dieser Perspektive wäre seine Tat auch nicht mehr als Akt des Aufbegehrens gegen die gesellschaftlichen Normen zu verstehen. Sie würde dann vielmehr einer Logik folgen, die in diesen Normen selbst angelegt ist.
3.2. Der Ekel als Ermöglichungsgrund der Empfindung des Absurden bei Jean-Paul Sartre
Sartres Erzählung Le Mur (Die Wand) und Camus' L'Étranger
Bereits 1937, fünf Jahre vor dem Erscheinen von Camus' L'Étranger, hatte Jean-Paul Sartre die Erzählung Le Mur ("Die Wand/Mauer", dt. 1938/39) veröffentlicht.{19} Diese weist einige Parallelen zu Camus' Prosastück auf. So führt in beiden Fällen ein reales Todesurteil dazu, dass der Protagonist sich seines grundsätzlichen Zum-Tode-Seins bewusst wird. Hintergrund für die Verurteilung in Le Mur ist die Beteiligung Pablo Ibbietas, des Ich-Erzählers, am Spanischen Bürgerkrieg, auf Seiten der Gegner Francos.
Der Bewusstwerdungsprozess wird zwar in Sartres Text in viel gedrängterer Form wiedergegeben als bei Camus, da das Geschehen sich im Wesentlichen auf die Nacht vor der erwarteten Hinrichtung konzentriert. Die Konsequenzen sind jedoch im Wesentlichen dieselben wie für den Ich-Erzähler in L'Étranger.
Auch bei dem Protagonisten aus Sartres Erzählung führt die Einsicht, bislang nur "Wechsel auf die Ewigkeit" ausgestellt zu haben{20} und folglich vom Leben "nichts begriffen" zu haben (W 23), zu einer allgemeinen Gleichgültigkeit: "nichts war mehr wichtig" (W 29). Analog zu Meursaults Feststellung, dass es "im Grunde (…) wenig ausmacht, ob man mit dreißig oder mit siebzig stirbt" (F 133), erklärt auch Sartres Ich-Erzähler, dass es ihn "kaltgelassen" hätte, wenn man ihm
"in dem Zustand, in dem ich war, mitgeteilt hätte, dass ich getrost nach Hause gehen könnte, dass man mich am Leben ließe (…): ein paar Stunden oder ein paar Jahre warten, das ist alles gleich, wenn man die Illusion, ewig zu sein, verloren hat." (W 24)
In beiden Fällen wird die Intensität der Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod zudem paradoxerweise gerade durch dessen Unvorstellbarkeit bezeugt. Wie Meursault "vergeblich" versucht, sich "eine bestimmte Sekunde vorzustellen, in der das Schlagen dieses Herzens nicht mehr in meinem Kopf weitergehen würde" (F 132), kann auch Pablo seinen "Tod nicht klar denken" (W 24): "Das ergab keinen Sinn, ich stieß nur auf Wörter oder auf Leere" (W 22). Eben weil sein Denken sich an seinem bevorstehenden Tod wie an einer unüberwindbaren "Wand" bricht, fährt er auch den mit ihm zum Tode verurteilten Tom an, er solle das 'Maul halten', als der diese Tatsache offen ausspricht:
"Ich müsste es schaffen, zu denken … zu denken, dass ich nichts mehr sehen werde, dass ich nichts mehr hören werde und dass die Welt für die anderen weitergeht. Wir sind nicht dafür geschaffen, das zu denken, Pablo." (W 20)
Entfremdungsgefühle eines zum Tode Verurteilten
Wie bei Camus sind dabei auch hier wieder die Entfremdungsgefühle, die mit der bewussten Erfassung des eigenen Zum-Tode-Seins einhergehen, von zentraler Bedeutung. Im Falle von Sartres Protagonist betreffen diese
- die "Dinge", die plötzlich "komisch" aussehen, da sie vor dem Hintergrund des eigenen Todes aus ihren nur für die Lebenden unzweifelhaften Verwendungszusammenhängen heraustreten:
"Ich brauchte nur die Bank, die Lampe, den Kohlenhaufen anzusehen und ich spürte, dass ich sterben würde. Natürlich konnte ich meinen Tod nicht klar denken, aber ich sah ihn überall, auf den Dingen, an der Art, wie die Dinge abgerückt waren und sich auf Distanz hielten, zurückhaltend, wie Leute, die am Bett eines Sterbenden leise sprechen." (W 24)
2. die Mitmenschen, zu denen der Tod den Einzelnen in eine unüberwindbare Distanz bringt. Die Unumstößlichkeit dieses Faktums wird in Le Mur dadurch vor Augen geführt, dass es gerade an einer Pablo besonders nahe stehenden Person – nämlich seiner Freundin Concha – veranschaulicht wird:
"Wenn sie mich ansah, wanderte etwas von ihr zu mir. Aber ich dachte, dass das vorbei war: wenn sie mich jetzt ansähe, würde ihr Blick in ihren Augen bleiben, er ginge nicht bis zu mir. Ich war allein." (W 24)
Paradoxerweise geht die durch das Bewusstsein des nahen Todes bewirkte psychische Entfremdung von den Mitmenschen gerade mit der realen Einebnung aller individuellen Unterschiede einher:
"Ich war in meinem Stolz gekränkt: vierundzwanzig Stunden hindurch hatte ich neben Tom gelebt, hatte ihm zugehört, hatte mit ihm gesprochen, und ich wusste, dass wir nichts gemeinsam hatten. Und jetzt glichen wir uns wie Zwillinge, bloß weil wir zusammen krepieren würden." (W 20 f.)
1. die eigene Vergangenheit und überhaupt das eigene Leben, das Pablo vor dem Hintergrund des eigenen Zum-Tode-Seins ebenso wenig "lebenswert" (Camus, F 133) erscheint wie Meursault: "kein Leben war etwas wert" (W 28). Der Tod habe, so stellt er fest, "allem seinen Reiz genommen":
"Ich erinnerte mich an eine Nacht, die ich auf einer Bank in Granada verbracht hatte: ich hatte seit drei Tagen nichts gegessen, ich war rasend, ich wollte nicht krepieren. Darüber musste ich lächeln. Mit welcher Gier ich dem Glück, den Frauen, der Freiheit nachlief. Wozu? Ich hatte Spanien befreien wollen, (…) ich hatte mich der anarchistischen Bewegung angeschlossen, ich hatte in öffentlichen Versammlungen gesprochen: ich nahm alles ernst, so als wäre ich unsterblich gewesen." (W 23)
2. den eigenen Körper, der Pablo den "Eindruck" vermittelt, "an ein riesiges Ungeziefer gebunden zu sein" (W 25):
"(…) mein Körper, ich sah mit seinen Augen, ich hörte mit seinen Ohren, aber das war nicht mehr ich; er schwitzte und zitterte ganz von selbst, und ich erkannte ihn nicht mehr wieder. Ich musste ihn berühren und ansehen, um zu wissen, was mit ihm war, als wäre es der Körper eines anderen." (W 24)
Vollendete Absurdität
Trotz der fraglos vorhandenen Analogien zwischen den beiden Werken erweist sich Sartres Erzählung bei näherer Betrachtung tendenziell als weitaus unversöhnlicher als Camus' L'Étranger. Zwar ist auch bei Camus der Schluss unversöhnlich. So wünscht sich der zum Tode verurteilte Meursault hier, "dass am Tag meiner Hinrichtung viele Zuschauer da sein würden und dass sie mich mit Schreien des Hasses empfangen" (F 143). Dem steht jedoch der wiedergefundene innere Frieden des zum Tode Verurteilten gegenüber.
Das von Meursault nach seiner eigenen Empfindung durch seine Bluttat zerstörte "Gleichgewicht des Tages" (F 73) stellt er am Schluss, als er die Übereinstimmung zwischen "der zärtlichen Gleichgültigkeit der Welt" und seinem eigenen Inneren verspürt, für sich selbst auf einer höheren Ebene wieder her. Dass er der Gesellschaft und ihrem das Absurde negierenden Wertekanon weiterhin unversöhnlich gegenübersteht, liegt demnach gerade daran, dass es ihm selbst am Ende gelungen ist, die Absurdität seines Daseins anzunehmen.
In Le Mur dagegen wird die Überzeugung des Protagonisten, dass nach der bewussten Erfahrung der Absurdität der menschlichen Existenz "nichts (…) mehr wichtig" und "kein Leben" mehr "etwas wert" sei (W 28 f.), durch den Schluss der Erzählung noch zusätzlich unterstrichen. Von den falangistischen Offiziere gedrängt, ihnen als Preis für sein Leben das Versteck eines für den Widerstand gegen Franco wichtigen Freundes zu verraten, versucht Pablo sie mit einer falschen Ortsangabe lächerlich zu machen. Allerdings stellt sich heraus, dass sein Freund sich aufgrund einer Reihe von Zufällen ausgerechnet an diesen Ort begeben hatte. Als Pablo erfährt, dass sein Freund dort nach einem kurzen Feuergefecht mit den Falangisten getötet worden ist, hat er das Gefühl, dass alles um ihn herum "sich zu drehen" beginne. Am Ende findet er sich
"auf der Erde sitzend wieder: ich lachte so sehr, dass mir Tränen in die Augen traten" (W 31).
Camus' Protagonist empfindet zum Schluss den "wunderbare[n] Frieden" des "schlafenden Sommers" (F 143). Gerade durch seine Einsicht in die Absurdität des Daseins gelingt es ihm, sich dem Leben vorbehaltlos hinzugeben. Pablo dagegen, der Ich-Erzähler aus Sartres Erzählung, gerät durch die Erfahrung der Lächerlichkeit des Daseins am Ende an den Rand des Wahnsinns.
Die "ekelhafte Gegenwart" des Körpers
Dieser Unterschied ist insbesondere darin begründet, dass in Le Mur das Zum-Tode-Sein viel stärker als bei Camus mit der Erfahrung der fleischlichen Natur des Menschen verknüpft wird. Deutlich wird dies insbesondere daran, dass es für die auf ihre Hinrichtung Wartenden nicht mehr möglich ist, die Funktionen ihres Körpers zu kontrollieren. So uriniert der mit Pablo inhaftierte Tom, ohne es zu merken (vgl. W 21). Und Pablo selbst spürt zunächst gar nicht, dass ihm – obwohl es in der Zelle "saukalt" ist – der Schweiß ausbricht (W 17).
Diese körperlichen Symptome der Todesangst machen es Pablo fortan unmöglich, sein Ich unabhängig von seinem Körper zu denken. An die Stelle der zuvor unhinterfragt vollzogenen Aufspaltung der eigenen Existenz in Geist und Körper tritt nun das ständige Bewusstsein von der Bindung an bzw. der Identität mit einer der eigenen Verfügungsgewalt letztlich entzogenen Materie. Der Verlust der Illusion, "unsterblich" zu sein (W 23), manifestiert sich damit hier ganz konkret in der Empfindung der "ekelhafte[n] Gegenwart" des Körpers (W 25).
SARTRES ROMAN LA NAUSÉE (DER EKEL)
Der Ekel als Voraussetzung für ein gesteigertes Existenzgefühl
Ähnlich wie in Le Mur wird auch in Sartres 1939 veröffentlichtem Roman La Nausée (dt. "Der Ekel", 1949) der Zustand des Ekels bestimmt als "Existenz, die sich existieren fühlt" (E 190). Der Protagonist dieses Werkes, Antoine Roquentin, leidet "seit jenem berühmten Tag", als er "Steine übers Wasser hüpfen lassen wollte", unter periodisch wiederkehrenden "Ekelanfällen[n]":
"Ich wollte gerade diesen Kiesel schleudern, ich habe ihn angesehen, und da hat alles angefangen: ich habe gefühlt, dass er existierte." (E 140)
Als dergestalt "die Augen blendende Evidenz" (E 140) bezieht sich auch für Roquentin die "nausée"{21}, ähnlich wie für den Protagonisten aus Le Mur, in besonderem Maße auf "die ekelhafte Gegenwart" des Körpers (W 25). Anders als dort, wird diese hier allerdings nicht über die extremen körperlichen Reaktionen erfahren, wie sie durch die Todesangst ausgelöst werden. Ihr Erleben beruht vielmehr auf etwas, das Sartre später in seinem ersten philosophischen Hauptwerk, Das Sein und das Nichts (1943, dt. 1952/1962), unter expliziter Bezugnahme auf La Nausée beschrieben hat als
"faden Geschmack ohne Distanz (…), der mich bis in meine Bemühungen, mich von ihm zu befreien, begleitet und der mein Geschmack ist" (SuN 597).
In La Nausée führt dieses Phänomen auf Seiten des Ich-Erzählers beispielsweise zu einer bewussteren Empfindung des Speichelflusses:
"In meinem Mund ist schäumendes Wasser. Ich schlucke es herunter, es gleitet durch meine Kehle, es streichelt mich – und schon ist es wieder da, bildet sich neu in meinem Mund. Ich habe für immer eine kleine, weißliche – unaufdringliche – Wasserlache im Mund, die meine Zunge umspült. Und diese Lache, das bin wiederum ich. Und die Zunge. Und die Kehle, das bin ich." (E 114)
Im Alltag enthüllt sich der Körper dem Bewusstsein Sartre zufolge durch einen zwar "unüberwindliche[n]", aber doch "diskrete[n]" Ekel (SuN 597). Roquentins "Ekelanfälle" (s.o.) sind jedoch – ungeachtet der Tatsache, dass auch er den "Normalzustand" des alltäglichen Ekels kennt (E 177) – von solcher Intensität, dass sie zu einer verfremdenden Wahrnehmung des eigenen Körpers führen. So erscheint ihm etwa seine sich auf dem Tisch ausbreitende Hand "wie ein umgefallenes Tier", das ihn an eine "tote Krabbe" erinnert:
"Ich fühle ihr Gewicht auf dem Tisch, der nicht ich bin. Das dauert lange, lange, dieser Eindruck von Gewicht, das vergeht nicht. Es gibt keinen Grund, weshalb das vergehen sollte. Auf die Dauer ist es unerträglich … Ich ziehe meine Hand zurück, ich stecke sie in die Tasche. Aber sofort spüre ich, durch den Stoff, die Wärme meines Schenkels. Sofort reiße ich meine Hand aus meiner Tasche; ich lasse sie an der Stuhllehne herunterhängen. Jetzt spüre ich ihr Gewicht am Ende meines Armes. Sie zieht ein bisschen, kaum, schlaff, schlabberig, sie existiert." (E 114 f.)
Bei Roquentin führt somit gerade ein intensiviertes Existenzgefühl dazu, dass ihm der eigene Körper als etwas Fremdes erscheint. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass das menschliche Bewusstsein durch eine Wahrnehmung der Materialität des Körpers zu der unmittelbaren Einsicht gelangen kann, "dass es nicht sein eigener Grund ist" (SuN 549) – dass es also an den Körper als Voraussetzung seines Daseins gebunden bleibt:
"Das Bewusstsein hört nicht auf, einen Körper 'zu haben'." (SuN 597).
Die Dinge und die Wirklichkeit
Die sich im Ekel enthüllende "Evidenz" der Existenz (E 140) manifestiert sich für Roquentin indessen nicht nur in einer bestimmten Form der Körpererfahrung, sondern auch in einer veränderten Wahrnehmung seiner Umwelt. Als er sich in einer Straßenbahn auf einer Sitzbank niedergelassen hat, versucht er den Gegenstand zwar "wie bei einem Exorzismus" mit dem entsprechenden Begriff zu belegen. Dabei muss er jedoch die Erfahrung machen, dass sich das Wort
"weigert (…), sich auf dieses Ding zu legen. Das Ding bleibt, was es ist, mit seinem roten Plüsch, Tausenden von roten Pfötchen, in die Luft gestreckt, ganz steif, von toten Pfötchen. Dieser riesige, in die Luft gereckte Bauch, blutrot, aufgeblasen – aufgebläht, mit allen seinen toten Pfötchen, dieser Bauch, der in diesem Gehäuse schwebt, in diesem grauen Himmel, das ist keine Sitzbank. Das könnte genauso gut ein toter Esel sein, zum Beispiel, vom Wasser aufgebläht, der dahintreibt, den Bauch nach oben, auf einem großen grauen Fluss; und ich säße auf dem Bauch des Esels, und meine Füße hingen ins klare Wasser." (E 143)
Ebenso wendet in Roquentins Augen das Meer den Spaziergängern nur die Oberfläche so. Es erscheint ihnen daher womöglich frühlingshaft "grün", während "das wirkliche Meer (…) kalt und schwarz" ist und es "unter diesem dünnen grünen Film, der dazu da ist, die Leute zu täuschen", "rumort". Roquentin sieht dagegen stets das, "was darunter ist" (E 141 f.). Dadurch haben sich für ihn
"die Dinge (…) von ihren Namen befreit. Sie sind da, grotesk, eigensinnig, riesenhaft, und es erscheint blöd, sie Sitzbänke zu nennen oder irgendetwas über sie zu sagen: ich bin inmitten der Dinge, der unnennbaren. Allein, ohne Wörter, ohne Schutz, sie umringen mich, unter mir, hinter mir, über mir. Sie verlangen nichts, sie drängen sich nicht auf: sie sind da." (E 143)
Aufgrund der 'Unnennbarkeit' der Dinge erscheint Roquentin deren vermeintliche "Vielfalt" und "Individualität" nurmehr als "Schein, Firnis":
"Dieser Firnis war geschmolzen, zurück blieben monströse und wabbelige Massen, ungeordnet – nackt, von einer erschreckenden und obszönen Nacktheit." (E 145)
Umkehrung des Verhältnisses von esséntia und exístentia
Roquentins Empfindung, dass die Wörter nicht der Wirklichkeit der Dinge entsprechen, hängt eng mit der für den Existenzialismus zentralen Umkehrung des Verhältnisses von Essenz und Existenz zusammen. Bis zum Existenzialismus galt die exístentia als die sich wandelnde und deshalb unbedeutende äußere Erscheinung der Dinge, deren Wahrheit sich allein in ihrem Wesen – der esséntia – enthüllt. Dagegen geht der Existenzialismus von einem Vorrang der Existenz vor der Essenz aus.{22} Dass dieser Wandel auch im Zentrum der sich an Roquentin vollziehenden Veränderungen steht, enthüllt dieser selbst, indem er bekennt:
"Wenn man mich gefragt hätte, was die Existenz sei, hätte ich in gutem Glauben geantwortet, dass das nichts sei, nichts weiter als eine leere Form, die von außen zu den Dingen hinzuträte, ohne etwas an ihrer Natur zu ändern. Und dann, plötzlich: auf einmal war es da, es war klar wie das Licht: die Existenz hatte sich plötzlich enthüllt. Sie hatte ihre Harmlosigkeit einer abstrakten Kategorie verloren: sie war der eigentliche Teig der Dinge." (E 145)
Die Sprache hat nun allerdings die Eigenart, die Dinge unter die abstrakten Kategorien zusammenfassender Begriffe zu subsumieren. Dadurch vernachlässigt sie die konkreten Erscheinungen der Dinge – also ihre Existenz – und kann damit auch deren Wirklichkeit nicht adäquat wiedergeben. Die von der Sprache ebenso vorausgesetzte wie konstruierte "Welt der Erklärungen und Gründe" ist demnach "nicht die der Existenz". Roquentin wird dies im Verlauf einer Kontemplation über die Wurzel eines Baumes klar:
"Ich konnte mir noch so oft wiederholen: 'Es ist eine Wurzel' – das verfing nicht mehr. Ich sah ein, dass man von ihrer Funktion als Wurzel, als Saugpumpe, nicht auf das kommen konnte, auf diese harte und kompakte Seehundshaut, auf dieses ölige, schwielige, eigensinnige Äußere. Die Funktion erklärte nichts: sie ließ in groben Zügen verstehen, was eine Wurzel war, aber keineswegs diese hier. Diese Wurzel, mit ihrer Farbe, ihrer Form, ihrer erstarrten Bewegung, war … unterhalb jeder Erklärung." (E 147)
Trügerische Einheit des Ichs
Im Hintergrund steht auch hier wieder der Gedanke eines Vorrangs der exístentia vor der esséntia. Dieser hat zur Folge, dass die Dinge nicht mehr als abstrakte Summen von Eigenschaftsbündeln zu bestimmen sind und stattdessen die Eigenschaften selbst in den Vordergrund treten. In der Wahrnehmung Roquentins scheinen sie den Dingen zu "entweichen", sich "halb zu verfestigen" und selbst "beinah ein Ding" zu werden (E 147).
Analog dazu ist auch die Einheit des "Ich" aus dieser Sicht nur ein Abstraktum. So kommt es Roquentin auch "hohl" vor, "wenn ich jetzt 'ich' sage":
"Und was ist das, Antoine Roquentin? Das ist etwas Abstraktes. Eine blasse kleine Erinnerung an mich flackert in meinem Bewusstsein. Antoine Roquentin … Und plötzlich verblasst das Ich, verblasst, und es ist aus damit, es erlischt." (E 190)
Das konkret existierende Ich erscheint damit hier lediglich als eine Summe zufällig zusammentreffender Eigenschaften. Es hat keinen Kern, kein Wesen, keine feste Substanz. Es kann so sein, wie es ist – aber es könnte ebenso gut, wie Sartre in Das Sein und das Nichts ausführt, "auch nicht sein". Eben deshalb hat es "die ganze Kontingenz des Faktums" (SuN 180). Indem das Ich sich im Ekel seiner "Faktizität bewusst" wird{23}, hat es zugleich "das Gefühl seiner völligen Grundlosigkeit [gratuité], es erfasst sich als für nichts da seiend, als zu viel" (ebd.).
Entsprechend diesen Ausführungen Sartres münden auch bei Roquentin seine "Ekelanfälle" (E 140) in die Einsicht, dass "das Wesentliche die Kontingenz" sei:
"Ich will sagen, dass die Existenz ihrer Definition nach nicht die Notwendigkeit ist. Existieren, das ist da sein, ganz einfach; die Existierenden erscheinen, lassen sich antreffen, aber man kann sie nicht ableiten." (E 149)
Der für alles Existierende zentralen Kategorie der Kontingenz könnte das Ich nur dadurch entgehen, dass es ein "notwendiges und sich selbst begründendes Sein" (ebd.) als Quelle seines eigenen Daseins postulieren würde. Eine solche metaphysische Begründung der menschlichen Existenz wird indessen von Roquentin ausdrücklich zurückgewiesen:
"Kein notwendiges Sein kann die Existenz erklären: die Kontingenz ist kein Trug, kein Schein, den man vertreiben kann; sie ist das Absolute, folglich die vollkommene Grundlosigkeit. Alles ist grundlos, dieser Park, diese Stadt und ich selbst." (E 149)
Dass jede Existenz – und damit auch das menschliche Dasein – "grundlos" ist, bedeutet konkret, dass der Mensch sich inmitten einer "verschwenderischen Fülle von Seiendem ohne Anfang" befindet:
"All dieses Existierende (…) kam nirgendwoher und ging nirgendwohin. Mit einem Schlag existierte es, und dann, mit einem Schlag, existierte es nicht mehr: Die Existenz ist ohne Gedächtnis; von den Verschwundenen bewahrt sie nichts – nicht einmal eine Erinnerung. Die Existenz überall, bis ins Unendliche, zu viel, immer und überall; die Existenz – die immer nur durch die Existenz begrenzt ist." (E 151)
Absurdität als zentrales Charakteristikum der Existenz
Die Existenz ist somit einerseits eine "Fülle", die "der Mensch nicht verlassen kann". Andererseits entsteht jedoch "alles Existierende (…) ohne Grund" und zerfällt ebenso grundlos ("durch Zufall") wieder (E 152). Dies verursacht in Roquentin "unermesslichen Überdruss" (E 153). Dieselbe innige Verbindung mit der "Fülle" des Seins, die Dichter früherer Zeiten im Sinne des Einsseins mit dem Kosmos gedeutet und entsprechend gepriesen hatten, ist ihm nur Anlass für die Empfindung von Ekel:
"Meine Ohren dröhnten von Existenz, mein eigenes Fleisch zuckte und öffnete sich, gab sich dem allgemeinen Knospen hin, es war abstoßend." (E 151)
Der Grund für diese Umkehrung der poetischen Tradition liegt darin, dass der Gedanke einer grundsätzlichen Sinnhaftigkeit des Daseins, der einer positiven Konnotierung der Vereinigung mit dem Ganzen des Seins unausgesprochen zugrunde liegt, von Roquentin ja gerade zurückgewiesen wird.
Roquentins Dilemma wird dadurch noch verschärft, dass er sich der Unmöglichkeit, die von ihm verabscheute Existenz zu verlassen, vollauf bewusst ist. Einen Ausweg aus dieser hält er noch nicht einmal im Sinne eines Gedankenspiels – einer geistigen Vernichtung des Existierenden, einer Art negativ-prometheischem Akt – für möglich. Denn auch die Antithese zum Existieren – das Nicht-Existieren – erweist sich bei näherem Hinschauen als Teil der Existenz:
"Um sich das Nichts vorzustellen, musste man schon da sein, mitten in der Welt, und die Augen weit offen haben und leben; das Nichts, das war nur eine Idee in meinem Kopf, eine existierende Idee, die in dieser Unermesslichkeit schwebte: Dieses Nichts war nicht vor der Existenz gekommen, es war eine Existenz wie jede andere und war nach vielen anderen erschienen." (E 153)
Selbst der Gedanke, "mich zu beseitigen, um wenigstens eine dieser überflüssigen Existenzen zu vernichten" (E 146), erscheint Roquentin nicht als Ausweg. Denn durch den Selbstmord könnte er ja lediglich seine Existenz selbst vernichten, nicht aber deren Überflüssigkeit – die er durch diesen Akt im Gegenteil gerade besonders hervorheben würde.
Ähnlich heißt es auch bei Camus, dass der Selbstmord "dank der Zustimmung, die ihm zugrunde liegt", das genaue "Gegenteil" dessen bewirke, was er eigentlich bezwecke. Er sei nicht Ausdruck einer Auflehnung gegen die Absurdität des Daseins, sondern bestätige diese vielmehr (MS 49). So ist Roquentins Einsicht, dass "selbst mein Tod (…) zu viel gewesen" wäre (E 146), auch unmittelbar verbunden mit der Erkenntnis, "dass die Existenz absurd" ist (E 234).{24} Die Absurdität wird ihm dabei zu einer so grundlegenden Kategorie für die Bestimmung des Existierenden, dass sie als geradezu synonym mit diesem erscheint:
"Die Absurdität, das war keine Idee in meinem Kopf, keine Einflüsterung, sondern diese lange tote Schlange zu meinen Füßen, diese Holzschlange. Schlange oder Kralle oder Wurzel oder Geierklaue, was auch immer. Ohne etwas deutlich zu formulieren, begriff ich, dass ich den Schlüssel der Existenz, den Schlüssel meines Ekels, meines eigenen Lebens gefunden hatte. Tatsächlich geht alles, was ich anschließend erfassen konnte, auf diese fundamentale Absurdität zurück." (E 146 f.)
Geistige Freiheit durch Einsicht in die Absurdität des Daseins
Im Ekel enthüllt sich dem Existierenden demnach unmittelbar "seine Faktizität und seine Kontingenz" (SuN 597) und damit zugleich auch die Absurdität des Daseins. So meint auch Roquentin in seinen "Ekelanfälle[n]" (s.o.) "die nackte Welt" zu sehen. Dies hat bei ihm zur Folge, dass er glaubt, "ersticken" zu müssen "vor Wut auf dieses dicke, absurde Sein" (E 152). Denn er empfindet nicht nur deutlich, dass das Leben "keinen Sinn" (E 153) hat, sondern ist sich zugleich bewusst, dass es vor dieser Sinnlosigkeit kein Entrinnen gibt. Analog zu dem Protagonisten aus Le Mur, vor dessen Augen sich am Ende alles zu "drehen" anfängt (W 31), führt das Bewusstsein dieser absoluten Grundlosigkeit auch bei Roquentin zu der Empfindung, dass "alles (…) zu schwimmen" beginne (E 149).
Diese Empfindung ist indessen nicht ausschließlich negativ konnotiert. Auch Camus hatte ja in L'Étranger die "Freiheit im Hinblick auf die allgemein anerkannten Gebote" (MS 53) hervorgehoben, die die Einsicht in die Absurdität des Daseins dem Einzelnen vermitteln könne. In ähnlicher Weise wird auch in La Nausée die befreiende Wirkung der Distanz zu den Normen und den unhinterfragten Regeln des Alltagslebens betont, in die Roquentin durch diese Erkenntnis gerät.
Besonders augenfällig wird dies in einer Passage gegen Ende des Romans. Darin beobachtet Roquentin von einem Hügel aus die "kleinen schwarzen Männchen" beim Durchqueren ihrer Stadt – ihres "schöne[n] bürgerliche[n] Gemeinwesen[s]" – und mokiert sich dabei über die fehlende Reflektiertheit ihres Tuns:
"Sie machen Gesetze, sie schreiben populistische Romane, sie verheiraten sich, sie haben die maßlose Dummheit, Kinder zu machen." (E 178)
Was Roquentin an diesem Tun kritisiert, ist die Grundannahme, die es in Gang hält: die Illusion, "dass alles mechanisch abläuft, dass die Welt starren und unwandelbaren Gesetzen gehorcht". Diese für alle anderen selbstverständliche Weltsicht ist für ihn – dem der Ekel zum "Normalzustand" geworden ist – nun ihrerseits fremd geworden (E 177 f.). So imaginiert er auch für die von ihm beobachteten Stadtbewohner Szenen, in denen sich "die große, verschwommene Natur" in ihre Stadt "einschleicht" und sie ihre Faktizität als jenen "faden Geschmack ohne Distanz" (SuN 597) erfassen lässt, als die er selbst sie ohne Unterlass verspürt:
"Sie werden sanfte Berührungen an ihrem ganzen Körper fühlen, wie das Streicheln, mit dem die Binsen im Fluss die Schwimmer streifen. Und ihnen wird klar werden, dass ihre Kleider lebende Dinge geworden sind. Und ein anderer wird merken, dass ihn etwas im Mund kratzt. Er wird vor einen Spiegel treten, den Mund öffnen: und seine Zunge wird ein riesiger, äußerst reger Tausendfüßler geworden sein, der mit den Füßchen strampelt und ihn am Gaumen kratzt. Er wird ihn ausspucken wollen, aber der Tausendfüßler wird ein Teil seiner selbst sein, und er wird ihn mit seinen Händen herausreißen müssen." (E 179)
Absolute Grundlosigkeit alles Existierenden
Das Empfinden der Faktizität und Kontingenz seines Daseins lässt Roquentin zwar freier erscheinen als jene, die – wie es Pablo in Le Mur mit Blick auf sein eigenes früheres Verhalten kritisiert – alles so "ernst" nehmen, als wären sie "unsterblich" (W 300). Auf der anderen Seite gleicht diese Freiheit jedoch, wie Roquentin selbst einräumt, "ein wenig dem Tod" (E 176). Denn sie ist gleichbedeutend ist mit der Einsicht in die absolute Grundlosigkeit alles Existierenden.
"Ich bin frei: ich habe keinen einzigen Grund mehr zu leben" (ebd.).
Deshalb geht die Freiheit hier – wie schon im Falle der Protagonisten aus L'Étranger und Le Mur – mit einer völligen Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben einher. Diese erscheint so als unmittelbare Folge der durch den Ekel vermittelten Existenzgewissheit:
"Jetzt weiß ich: Ich existiere – die Welt existiert –, und ich weiß, dass die Welt existiert. Das ist alles. Das ist alles. Aber das ist mir egal. Merkwürdig, dass mir alles so egal ist: das erschreckt mich." (E 140)
Ebenso wie in Le Mur den Protagonisten angesichts des Zum-Tode-Verurteilt-Seins aller Menschen die Empfindung überfällt, dass "kein Leben (…) etwas wert" sei (W 306), ist auch Roquentin die Überzeugung von dem grundsätzlichen Wert der menschlichen Existenz abhandengekommen.
Besonders drastisch kommt die fehlende Ehrfurcht vor dem Leben der Anderen bei einem Restaurantbesuch des Ich-Erzählers zum Ausdruck. Dabei lässt er weder den Wert des fremden Lebens noch die Tatsache, dass nach einer Mordtat die übrigen Restaurantgäste auf ihm "herumtrampeln" würden, als Grund dafür gelten, seinem Gegenüber nicht das "Käsemesser (…) ins Auge [zu] bohren". Was ihn davon abhält, ist vielmehr die Tatsache, dass damit nur ein weiteres "überflüssiges Ereignis hervorgerufen" würde:
"Es gibt schon genug Dinge, die einfach so existieren" (E 140).
Imagination einer anderen Welt in der Kunst
Trotz seiner Überzeugung, dass es für keinen Existierenden einen Ausweg aus der Existenz geben kann, ist für Roquentin allerdings die Wahrnehmung einer "anderen Welt" möglich, in der "die Kreise, die Melodien ihre reinen und strengen Linien bewahren" (E 146). Diese Welt ist die Welt des Nichtexistierenden und damit auch des Nicht-Absurden:
"Ein Kreis ist nicht absurd, er erklärt sich sehr gut aus der Umdrehung einer Geraden um einen ihrer Endpunkte. Aber ein Kreis existiert auch nicht." (E 147)
So ist zwar "die Welt der Erklärungen und Gründe (…) nicht die der Existenz" (ebd.). Immerhin ist es dem Existierenden jedoch möglich, sich ahnungsweise eine Vorstellung von jener "anderen Welt" zu bilden. Eben hierauf beruht auch die Hoffnung, doch noch "von der Sünde zu existieren reingewaschen" werden zu können (E 198), von der Roquentin am Ende erfasst wird.
Angedeutet wird diese Hoffnung, als der Protagonist in einer Kneipe die Klänge seines Lieblingslieds hört. Dabei kommt ihm zum Bewusstsein, dass zwar all das, was zur Hervorbringung dieser Melodie notwendig ist, der Sphäre des "sinnlos Existierende[n]" zugehört: "die Platte wird verkratzt und nutzt sich ab, die Sängerin ist vielleicht tot". Die Melodie selbst wird jedoch "überhaupt nicht von dem leichten Krächzen der Nadel auf der Platte berührt". Sie befindet sich insofern "auf der anderen Seite der Existenz, in jener anderen Welt, die man von weitem sehen kann, aber ohne ihr je nahe zu kommen":
"Hinter dem Existierenden, das von einer Gegenwart in die nächste fällt, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft, hinter diesen Klängen, die von Tag zu Tag zerfallen, zerkratzt werden und in den Tod gleiten, bleibt die Melodie dieselbe, jung und fest wie ein erbarmungsloser Zeuge." (E 196 f.)
Bezogen auf die Literatur ergibt sich hieraus für Roquentin die Hoffnung, "eine andere Art von Buch" verfassen zu können. Dessen zentrales Charakteristikum bestünde darin, dass man "hinter den gedruckten Wörtern, hinter den Seiten etwas ahnen" würde, "das nicht existierte, das über der Existenz wäre" (E 199).
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752144963
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (Mai)
- Schlagworte
- Wolfgang Hildesheimer Samuel Becket Prosa des Absurden Jean-Paul Sartre Literaturwissenschaften Ilse Aichinger Albert Camus Franz Kafka Ingeborg Bachmann