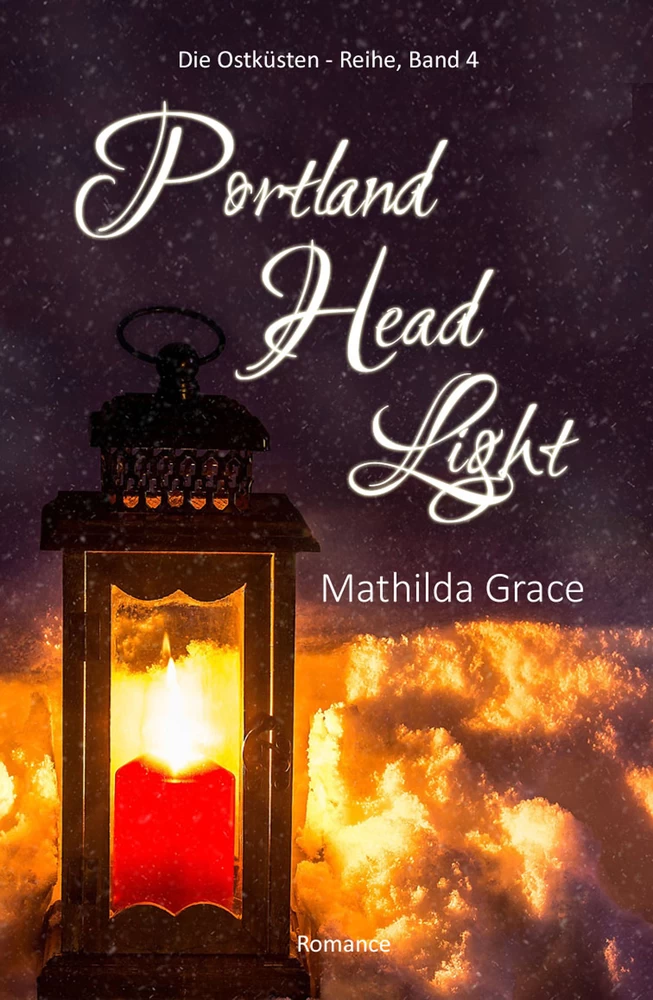Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Lieber Dominic,
wie kann ich mich bei dir, meinem Kind, für etwas entschuldigen, für dass es keine Entschuldigung gibt?
Ich weiß es nicht, also fange ich einfach an, in der Hoffnung, dass du meine Worte eines Tages lesen wirst, immerhin bist du der einzige Grund, warum ich das tue. Und du bist ein toller Grund, Dominic. Das warst du schon als Baby. Meine Güte, wie schnell doch damals die Zeit verging. Aber so war unser Leben mit dir von Anfang an. Gerade erst geboren, warst du plötzlich schon ein Junge, der ganz allein auf seinen stämmigen Beinchen stand. Und mit jedem Tag wurdest du ein Stückchen größer und auch ein wenig erwachsener. Verrückte Welt, aber so war sie nun mal.
Und sehr bald, wenn du erwachsen bist, wirst du deinen eigenen Weg finden und es mit Sicherheit besser machen als ich. Oh, das Allerwichtigste vergesse ich beinahe noch – ich liebe dich, Dominic, das habe und werde ich immer tun. Trotz allem.
Dabei habe ich früher gar nicht daran geglaubt, jemals ein Kind zu haben. Jedenfalls nicht so früh. Als ich mit dir schwanger wurde, gehörten Kinder für mich noch nicht zu meinem Leben. Ich war jung und so verliebt. Weißt du, ich habe in meinem Leben einige Fehler gemacht, und mir ist bewusst, dass es für mich lange zu spät ist, dass ich es nie mehr gutmachen kann. Dennoch möchte ich, dass du weißt, dass ich froh bin, weil unser Staat dir ein Leben ermöglichte, welches ich dir nicht geben konnte.
Aber dazu später mehr. Erst mal möchte ich dir erzählen, wie es überhaupt dazu kam. Ich möchte dir erzählen, wie die Krankheit über mich kam, die unser Leben so abrupt und für immer zerstörte.
Schleichend ist der Ausdruck, den meine Ärzte hier verwenden. In meinen Augen überfiel sie mich von hinten, als ich machtlos war. Das ist Unsinn, ich weiß, aber ich empfinde es noch immer so. Und auch wenn ich weiß, dass meine Phasen der Normalität kürzer werden und die der Schizophrenie immer stärker durchbrechen, gebe ich die Hoffnung nicht auf. Solange wie möglich, möchte ich dir schreiben und dir erzählen, wer ich wirklich bin.
Wer ich bin, wenn diese drängende Stimme tief in meinem Kopf mir keine Dinge zuflüstert.
Ich war ein glückliches Kind. Wie du es warst, bis ich unsere Familie zerstörte. Ich hatte eine schöne Kindheit, war gut in der Schule und beliebt bei meinen Freunden. Ich lernte deinen Vater in der Schule kennen. Er war der Bruder meiner Freundin, jünger als ich und er wollte Karriere machen. Sein Plan war es die Schule zu beenden und nach Los Angeles zu gehen. Als Musiker. Ganz zu Anfang habe ich darüber geschmunzelt. Aber dann hörte ich ihn spielen und änderte meine Meinung. Ich begleitete ihn zu kleineren Auftritten in Bars, unterstützte ihn in seinen Träumen und träumte irgendwann mit ihm, denn er hatte das Talent und vor allem den nötigen Willen, um ganz groß rauszukommen.
An Weihnachten lud er mich zu sich nach Hause ein. Ich werde das Weihnachtsfest bei seiner Familie nie vergessen. Ich liebte diese alte und heimelige Art seiner Eltern, die kitschige Musik und den Weihnachtsbaum, der derart mit Lichtern behangen war, sodass man nur mit abgeschirmten Augen vor ihm sitzen konnte. Aber vor allem liebte ich deinen Vater.
Dann warst du plötzlich auf dem Weg. Es war ein Schock. Für uns beide. Aber wir liebten dich fast sofort und so änderte dein Vater seine Pläne. Er ging nicht nach Los Angeles, um Musiker zu werden, und ich ging nicht auf die Universität, um zu studieren und einen gut bezahlten Job zu bekommen.
Wir bekamen dich, ohne zu wissen, wie begrenzt unsere Zeit mit dir sein würde.
Weißt du, Dominic, es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die Dinge tun, die einfach nur widerwärtig sind, und ich bin zu einem von ihnen geworden. Ich weiß nicht, inwieweit du mit deinen zwei Jahren damals begriffen hast, was ich tat. Und ich weiß auch nicht, wie du heute darüber denkst. Ich kann es nur vermuten und ich glaube, dass du mich hassen musst. Und wer sollte es dir verübeln? Aber vielleicht wirst du mir eines Tages ja schreiben. Und vielleicht wirst du mich sogar einmal besuchen.
Ich würde sehr gerne erfahren, wie du aussiehst und was aus dir geworden ist. Und ich hoffe so sehr, dass ich noch lange genug bei Verstand sein werde, um dir zu erzählen, was damals alles geschah.
In Liebe,
Mum
1. Kapitel
Maine war das komplette Gegenteil seines alten Lebens, das aus dem Reisen von Motorradrennen zu Motorradrennen, von Party zu Party, aber vor allem aus sehr viel Gestank und Krach bestanden hatte.
Vielleicht zog ihn darum diese Stille, die hier herrschte, von dem stetigen Rauschen des Meeres einmal abgesehen, so sehr an. Dominic konnte sich zumindest nicht daran erinnern, dass er früher jemals in der Nacht einfach so mitten auf einer Straße gestanden, die Stille um sich herum genossen und die unzähligen Sterne am Himmel beobachtet hatte. An all den Orten, wo er bisher gelebt hatte, war es sogar in tiefster Nacht oft viel zu hell gewesen, um überhaupt einen einzigen Stern am Himmel ausmachen zu können.
Hier hatte er damit keine Probleme. In Cape Elizabeth wurden die Bürgersteige jeden Abend pünktlich hochgeklappt und spätestens um Mitternacht schlief der gesamte Ort. Das war die Zeit, in der Dominic sich in seinem alten Leben, als Besitzer eines Motorradrennstalls und als Fahrer in selbigem, oft gerade fertiggemacht hatte, um auf die Piste zu gehen.
Aber diese Pisten gab es für ihn nicht mehr.
Statt dem lauten Dröhnen der Motoren, hatte er seit einigen Wochen nur noch das Rauschen des Meeres in den Ohren, und der ständige Geruch nach Abgasen, Öl, Benzin und Leder, war ersetzt worden durch den erdigen Duft der Wälder überall um die Stadt herum und dem salzigen Geruch des Wassers. In den frühen Morgenstunden, die Dominic gern am Hafen verbrachte, kam dann noch der Geruch von Fisch dazu.
Die Bewohner dieses Städtchens führten ein beschauliches Leben, kümmerten sich liebevoll um ihre Touristen und waren auf eine, ihm anfangs recht fremde Art und Weise, freundlich, ehrlich und derartig offen, dass Dominic in den ersten Tagen nach seiner Ankunft die meiste Zeit komplett irritiert gewesen war, da er diese Ehrlichkeit der Menschen nicht einzuschätzen gewusst hatte. Es hatte niemanden hier gekümmert, dass er der Neue in der Stadt gewesen war. Er war von Anfang an genauso willkommen gewesen wie jeder andere, und daran hatte Dominic sich erst einmal gewöhnen müssen.
Mittlerweile kannte er einige der Bewohner bereits mit Namen und sie freuten sich, wann immer er bei ihnen vorbeikam. Egal ob es Charlies Diner am Ende der Straße war, Melissas Bäckerei gleich gegenüber, oder Henry mit seinem Zeitungs- und Tabakgeschäft, der den lieben langen Tag vor seinem Geschäft auf einer wackligen Bank saß, um mit Franklin, dem gutmütigen Besitzer der Videothek nebenan, zu tratschen.
Sie fragten ihn jedes Mal, wie es ihm ging, wenn er vorbeikam, um sich eine Zeitung und Kleinkram zu kaufen, und Dominic mochte diese Menschen von Tag zu Tag mehr. Vermutlich hatte er auch deshalb beschlossen, den Winter hier zu verbringen und war gestern von der gemütlichen Pension, in der er nach seiner Ankunft vor einem Monat untergekommen war, in sein neues Haus an den Klippen gezogen. Andrew, der verwitwete Fischer, dem er erst seinen Laster repariert und dann regelmäßig vorbeigekommen war, um mit dem alten Mann zu plaudern, hatte ihm sein Haus einfach vererbt, als er vor zwei Wochen an seinem schwachen Herzen gestorben war.
Dominic war aus allen Wolken gefallen und hatte das Erbe zuerst ausschlagen wollen, aber da der alte Andrew keine Kinder und keine sonstige Familie hatte, gab es außer ihm niemanden, der an dem Haus interessiert gewesen wäre, und aus dem Grund hatte Dominic dem Bitten des Nachlassverwalters nachgegeben und das Erbe angenommen. Und da war er nun. In einer Kleinstadt in Maine, auf der Suche nach einem neuen Leben, und so neugierig wie ein kleines Kind, das in einem Spielzeugladen abgesetzt worden war.
Dominic lachte leise und legte den Kopf in den Nacken, um die Augen zu schließen und sich vom sanften Wind umwehen zu lassen. Dafür, dass bereits später Herbst war, war es in den langen Nächten noch immer angenehm warm, aber das würde sich recht bald ändern. Der uralte Fred, ein ehemaliger Fischer, der trotz Ruhestand jeden Morgen am Pier zu finden war, hatte ihm gestern gesagt, dass es spätestens in einer Woche empfindlich kälter werden würde, und da Fred dafür berühmt war, das Wetter vorhersagen zu können, hatte Dominic vor, noch in dieser Woche seinen Vorratsraum aufzustocken und sein Haus für den Winter klarzumachen.
»Ha! Unser großer Schweiger. Du bist aber früh dran heute.«
Dominic zuckte überrascht zusammen und drehte sich um, um direkt auf Freds zahnloses Lächeln zu schauen, der einige Schritte hinter ihm auf seinen Gehstock gestützt stand und dabei war, sich aus dem Inhalt seiner Tabakdose eine Zigarette zu drehen. Dominic grinste und deutete auf den Tabak.
»Das wird deiner holden Anna aber gar nicht gefallen.«
Anna war Freds Ehefrau und das seit mittlerweile sechzig Jahren, und die holde Anna, Fred nannte sie immer so, mochte es gar nicht gern, wenn ihr Mann rauchte, deswegen tat Fred es immer heimlich, was sie natürlich wusste. Aber was sie nicht sah, konnte Anna ihm nun einmal nicht vorwerfen.
Diese beiden waren für Dominic der Inbegriff einer funktionierenden Ehe, basierend auf tiefstem Vertrauen und ehrlicher Liebe. So etwas gab es heutzutage gar nicht mehr, jedenfalls nicht in seiner Generation.
»Pah!« Fred steckte sich seine Zigarette an und trat auf ihn zu. »Wenn ich meiner holden Anna erzähle, dass du noch gar nicht im Bett warst, vergisst sie meine Zigarette und hält dir einen Vortrag über Schlaf und seinen Nutzen.«
Dominic versuchte empört auszusehen, gab es aber schnell auf und grinste stattdessen. »Du weißt, dass man das Erpressung nennt, oder? Und woher willst du wissen, dass ich noch gar nicht im Bett war?«
»Ich weiß es eben«, antwortete Fred spitzbübisch und zwinkerte ihm zu. »Lass uns zum Pier gehen. Vielleicht entdecken wir heute endlich eine passende Meerjungfrau für dich. Meine holde Anna ist ja schon vergeben.«
Dominic lachte und folgte Fred gemächlich die Straße runter zum Hafen. Die Art von Gespräch hatten sie in den letzten Wochen oft geführt und er genoss die alberne Neckerei des alten Fred jedes Mal aufs Neue, der es sich zur Aufgabe gemacht zu haben schien, ihn verkuppeln zu wollen. Es war für Fred ein Unding, dass ein Mann wie er, in den besten Jahren, wie Fred sagte, alleine durchs Leben ging, und Dominic würde den Teufel tun und ihm widersprechen. Man widersprach einfach keinem Menschen, der seit sechzig Jahren eine sehr glückliche Ehe führte, auch wenn Dominic nicht vorhatte, an seinem Singledasein in naher Zukunft etwas zu ändern.
Der uralte Fred behielt recht.
Eine knappe Woche später zog ein Küstensturm über Cape Elizabeth hinweg, der die Stromversorgung der Stadt für eine Nacht lahmlegte und mehrere Bäume entwurzelte, die bis weit in den Tag hinein die Straßen blockierten. Ein Dank an seinen Generator, der ohne zu Mucken ansprang und Dominic Strom und Wärme lieferte. Alle, die außerhalb der Stadt lebten, hatten für derartige Fälle Generatoren, die ihre Versorgung sicherstellten, falls man während eines Sturms von der Stadt abgeschnitten wurde, was im Herbst und Winter durchaus der Fall sein konnte. Und sollte Fred weiter recht behalten, würde Cape Elizabeth einen verdammt harten Winter erleben.
Diese Aussicht schreckte Dominic nicht, ganz im Gegenteil. Deshalb war er schließlich hier. Also nicht wegen eines harten Winters, aber um in Ruhe darüber nachzudenken, was er mit seinem restlichen Leben anfangen wollte. Und wie konnte man in Ruhe nachdenken, wenn dauernd Menschen um einen herum waren? Menschen wie David, Adrian oder Nick. So sehr er die Bande mittlerweile zu schätzen wusste, Dominic wollte sie im Moment nicht um sich haben. Deswegen hatte er außer David niemandem erzählt, wo er war, denn die Nachricht, dass er seinen Rennstall und das dazugehörige Team verkauft hatte, war im Sommer wie die sprichwörtliche Bombe eingeschlagen. Aber auf David war in solchen Dingen Verlass. Dominic hatte seinen Freund gebeten zu schweigen und David schwieg.
Es war Dominic nicht leichtgefallen, ihn darum zu bitten, denn ihm war bewusst, dass David und ihre Freunde sich natürlich Sorgen machen würden, wohin er verschwunden war, aber vor allem, warum er das getan hatte, doch derzeit wollte er sich damit nicht befassen. Dominic wusste nur, dass es richtig gewesen war, den Rennstall und sein bisheriges Leben aufzugeben, denn nach Davids Unfall hatte er keine Nacht mehr durchschlafen können, ohne aus schlimmen Albträumen hochzuschrecken, in denen er David verbrennen sah.
Und da er so auf Dauer keinen Rennstall leiten konnte, vor allem nicht, weil er es von Tag zu Tag mit größerem Widerwillen getan hatte, war Dominic die Entscheidung für den Verkauf am Ende nicht schwer gefallen. Seine Jungs würden auch ohne ihn zurechtkommen, das wusste er und deshalb machte er sich diesbezüglich auch keine Sorgen. Die Rennen würden weitergehen, nur eben ohne ihn.
Beginnendes Telefonklingeln riss Dominic aus seinen Grübeleien. Wer rief denn auf seinem Festnetzanschluss an? Diese Nummer kannte doch noch gar keiner. Abgesehen von David, aber der rief immer auf dem Handy an. Dominic zog es aus der Tasche, während er hinüber in die Küche ging, wo sein Telefon an der Wand hing, um einen Blick auf das Display zu werfen. Schwarz. Mist. Der Akku war schon wieder leer. In letzter Zeit vergaß er ständig, sein Handy aufzuladen. Vielleicht sollte er das Ding abschaffen. Außer für die Telefonate mit David benutzte er es ohnehin nicht mehr.
Dominic nahm ab und klemmte sich den Hörer zwischen Schulter und Ohr, um sich nebenbei einen Kaffee zu machen. »Wer stört?«
»Hallo, du großer Schweiger«, begrüßte ihn David amüsiert und Dominic stöhnte auf.
»Ich hätte dir nicht davon erzählen sollen.«
David lachte. »Wieso nicht? Der uralte Fred hat doch recht. Eine Quasselstrippe bist du ja wirklich nicht. Wieso geht dein Handy eigentlich nicht? Hast du wieder das Aufladen vergessen? Wie geht es dir?«
Dominic musste schmunzeln. Seit David Adrian geheiratet hatte und augenscheinlich überglücklich war, hatte er sich von einem ruhigen Typ zu einer echten Labertasche gemausert und er wurde immer noch lebhafter. Gott sei Dank, dachte Dominic nur, denn er hatte noch viel zu gut den David vor Augen, der er im Krankenhaus nach seinem schweren Motorradunfall gewesen war. Ein seelisches Wrack und völlig mit den Nerven am Ende. Aber das war lange her und mittlerweile ging es David wieder gut.
»Hast du Quasselwasser getrunken, bevor du mich angerufen hast?«, neckte er David und lachte, als der schnaubte. »Mir geht es übrigens gut und bei meinem Handy ist der Akku leer. Hab wieder vergessen ihn aufzuladen. Ich sollte das Ding abschaffen, ich benutze es ja doch nicht.«
»Hm, behalte es lieber. Wenigstens für den Notfall, falls du mal eingeschneit bist oder so. Was macht dein Haus? Und vor allem, hat der uralte Fred schon eine Meerjungfrau für dich gefunden? Übrigens, habe ich dir schon erzählt, dass ...«
Guter Einwand mit dem Handy, fand Dominic und nickte schweigend, David weiter zuhörend. Es war entspannend, dessen Stimme zu hören, sich die Neuigkeiten aus Baltimore erzählen zu lassen und nebenbei darauf zu warten, dass der Kaffee durchlief. Seit ihrem letzten Telefonat hatte sich nicht viel verändert, weder in Baltimore, bei David und Adrian, noch bei allen anderen Jungs, die sie zu ihrem Freundeskreis zählten. Es lief alles seine geregelten Bahnen, und als David begann über Weihnachtspläne zu reden, fiel Dominic abrupt ein, dass er keine Ahnung hatte, ob Andrew überhaupt im Besitz von Weihnachtsdekoration war, und falls nicht, dass er sich welche besorgen musste.
»Hörst du mir überhaupt zu?« Davids empörte Frage riss Dominic aus seiner Grübelei, ob er auf dem Speicher wohl fündig werden würde, was weihnachtliche Dekoration betraf.
»Ja, sicher«, antwortete er. »Ich überlege gerade, ob ich den Speicher nach Weihnachtszeug durchsuchen soll. Ich habe keine Ahnung, ob Andrew so etwas besaß.«
»Du meinst diesen Speicher, in dem mehr Spinnen wohnen, als im Wald vor deiner Haustür?«, fragte David amüsiert und Dominic schauderte bei dem Gedanken.
Genau aus dem Grund hatte er bislang jeden Gang auf den Speicher tunlichst vermieden. Spinnen waren widerlich. Diese Viecher mit ihren acht Beinen und den unzähligen Augen, die einen anstarrten und ... Dominic schüttelte die Gänsehaut ab, die ihn bei der Vorstellung befallen wollte, als er David lachen hörte. »Ich wäre lieber still, wenn ich du wäre. Du magst diese Krabbler schließlich genauso wenig wie ich.«
»Ich weiß«, stimmte David ihm zu. »Aber ich muss trotzdem jedes Mal darüber lachen. Tut mir leid.«
»Tze«, maulte Dominic, lächelte aber im nächsten Moment bereits wieder. »Was macht deine neue Ausstellung und, noch viel wichtiger, was macht dein Anwalt?«
»Im Westen nichts Neues«, antwortete David und ehe Dominic reagieren konnte, polterte es durchs Telefon. »Mist. Ich wusste, dass der Nagel nicht hält, aber dieser Sturkopf von Anwalt musste ja wieder seinen Willen durchsetzen.«
Dominic schüttelte grinsend den Kopf. »Sturkopf? Seinen Willen durchsetzen? Das erzählte ich Adrian bei Gelegenheit.« David schnaubte nur, was ihn lachen ließ. »Was ist denn diesmal zu Bruch gegangen?«, wollte er dann neugierig wissen.
David seufzte. »Er hat mir letzte Woche eine von diesen tollen Gartenlaternen zum Aufhängen geschenkt, und wollte sie unbedingt allein an der Veranda festmachen.«
»Allein? Warum hat er denn nicht Nick gefragt?«, wunderte sich Dominic verblüfft, denn wenn Adrian Quinlan eines nicht war, dann handwerklich begabt. Er war wirklich ein erstklassiger Anwalt und er war David auch ein toller Ehemann, aber einen Hammer sollte man diesem Mann niemals freiwillig in die Hand geben. Beim letzten Mal hatte er, statt eines Nagels, ein tiefes Loch in die Wand geschlagen. Davor hatte Adrians Daumen dran glauben müssen und davor wiederum ...
Dominic kicherte bei der Erinnerung daran, wie Adrian, bei dem Versuch ein Bild aufzuhängen, plötzlich nur noch einen Griff in der Hand gehabt hatte, weil sich der Hammerkopf gelöst und beinahe Nick getroffen hatte.
»Sehr witzig«, murrte David, lachte dann aber mit mit ihm. »Tja, die Laterne ist jedenfalls hin.«
»Hat Adrian noch alle Finger?«
»Dom!«
Dominic prustete los. »Sorry, aber du weißt sehr wohl, dass diese Frage berechtigt ist. Irgendwann bringt er sich noch mal um. Erinnere dich nur an seinen letzten Versuch mit der Bohrmaschine.«
»Bloß nicht«, wehrte David beinahe schon entsetzt ab. »Ich hätte niemals gedacht, dass es etwas gibt, von dem Adrian keine Ahnung hat, aber im handwerklichen Bereich hat er eindeutig zwei linke Hände.«
Und das war noch höflich ausgedrückt, fand Dominic, denn die Aktion mit der Bohrmaschine hatte die Garage der beiden fast in ein Trümmerfeld verwandelt, weil Adrian es irgendwie geschafft hatte, über das Stromkabel zu stolpern, mit der Bohrmaschine dabei in ein Regal gekracht war und dieses dann gegen einen Stützbalken gefallen war, der Gott sei Dank gehalten hatte. Und noch mal Gott sei Dank, war Adrian bei der ganzen Aktion nichts passiert. Nun ja, von einem verstauchten Finger einmal abgesehen. Dieser meistens recht ernste und immer so korrekte Anwalt, wurde zum größten Chaoten, sobald Handwerksgeräte im Spiel waren.
»Du solltest das ganze Zeug heimlich verschwinden lassen und es auf Diebe schieben«, überlegte Dominic laut und grinste, als David lachte.
»Das würde er bemerken, dafür kennt er mich zu gut und weiß, was ich davon halte, wenn er wieder einen seiner Anfälle hat und unbedingt etwas bauen will. Möglicherweise hätte ich beim letzten Mal nicht demonstrativ unser Telefon in der Hand behalten sollen, um im Fall der Fälle gleich die 911 anrufen zu können.«
Dominic konnte nicht anders, als erneut zu lachen. Diese beiden, ein Künstler und ein Anwalt, passten so perfekt zusammen wie Topf und Deckel. Obwohl er von solchen Sprüchen eigentlich nichts hielt, in dem Fall stimmte es, denn David war glücklich mit Adrian und der mit David. Und nur darauf kam es schließlich an.
Ein herrisches Kratzen an der Außentür, die von der Küche in seinen Garten hinausführte, erregte Dominics Aufmerksamkeit. Das konnte doch nur einer sein. »Warte mal kurz«, bat er und entriegelte die Tür, um Montana reinzulassen, der ihn aus dunklen Augen vorwurfsvoll ansah, um danach hoheitsvoll zu seinem Napf hinüber zu laufen und sich demonstrativ vor ihn zu setzen. Dominic stöhnte auf. »Du bist so was von verwöhnt, dass du echt glaubst, ich springe, sobald du mich auch nur anguckst, oder?« Der große, graue Kater, den er mit Andrews Haus schlichtweg mitgeerbt hatte, maunzte zustimmend und Dominic musste erneut lachen, genau wie David.
»Du und ein Kater als Haustier, ich kann es immer noch nicht ganz glauben.«
»Es gab ihn nun mal umsonst dazu«, sagte Dominic schulterzuckend und holte die Dose mit dem Katzenfutter aus dem Kühlschrank, bevor Montana noch auf die Idee kam, ihm in die Hacken zu beißen, damit er sich gefälligst etwas beeilte.
Dieser freche Kater war sich wirklich für nichts zu fein, sobald es um seinen Magen ging, das hatte Dominic bereits mehr als einmal schmerzhaft feststellen müssen. Er war immer noch erstaunt darüber, dass das Tier ihn überhaupt ohne Protest als neuen Hauseigentümer und damit als neues Herrchen akzeptiert hatte.
»Hier, du Vielfraß«, murmelte er und stellte den jetzt mehr als vollen Napf auf den Boden.
»Ist er eigentlich pflegeleicht?«, wollte David wissen.
»Keine Ahnung«, antwortete Dominic. »Ich hatte noch nie eine Katze. Er kommt und geht, wie es ihm passt, benutzt das Klo, wenn ich ihn nicht vorher raus lasse, und wird eigentlich nur rabiat, wenn ich das Futter nicht schnell genug hinstelle.«
»Schmust er?«
»Und wie. Aber nur, wenn er will.« Dominic grinste. »Dann ist er allerdings noch schlimmer als dein verrückter Hund. Außer, dass ich bisher keine feuchte Katzenzunge im Gesicht hatte, hat Montana an kuscheln und schmusen alles zu bieten.«
»Bezeichne Minero nicht als verrückt.« David kicherte. »Cameron hat nach dir gefragt«, meinte er im nächsten Augenblick übergangslos und Dominic erstarrte.
Cameron Salt war Davids ehemaliger Physiotherapeut, der David in den ersten Wochen und Monaten nach seinem Unfall das Laufen wieder beigebracht hatte, und obwohl David ihn mittlerweile nicht mehr als Therapeut brauchte, waren er und Cameron Freunde geblieben und trafen sich regelmäßig.
»Warum?«, wollte er schließlich wissen.
»Oh, nur so. Wir waren letzte Woche zusammen essen. Danach hat er mich in einen Buchladen geschleppt und nebenbei gefragt, was du so machst und wie es dir geht.«
»Was hast du gesagt?«, wollte Dominic wissen und kämpfte nebenbei gegen das eben noch nicht dagewesene flaue Gefühl im Magen an.
»Das Übliche«, antwortete David. »Es ginge dir gut und du bist irgendwo in Maine, so wie du mich gebeten hast.«
Dominic ertappte sich dabei, wie er verlegen auf die Bodenfliesen starrte, die dringend gewischt werden sollten, und sich fragte, ob er mit seiner Bitte von David nicht zu viel verlangte. Immerhin log der seinetwegen seit Monaten ihre gemeinsamen Freunde an. »Ich bin ein Arschloch, oder?«
David seufzte. »Ja und nein. Ja, weil ich nicht gern die Leute belüge, die mir wichtig sind. Nein, weil ich verstehe, warum du mich darum gebeten hast. Du brauchst eine Auszeit und ich werde das nicht torpedieren. Ich werde dich auch nicht nach dem Grund fragen, warum du seit einer Weile immer so wortkarg wirst, wenn die Sprache auf Cameron kommt.«
Mist. Dominic verzog das Gesicht.
Er hätte sich denken können, dass es seinem Freund auffallen würde. Sein Problem an der Sache war nur, auch wenn David ihn danach gefragt hätte, Dominic hätte ihm keine Antwort geben können. Er wusste nicht, was der Grund dafür war, dass ihm allein bei der Erwähnung des Namens von Davids Physiotherapeut regelmäßig komisch wurde. Das berühmte, mulmige Gefühl im Magen, oder wie immer man das nennen sollte.
»Willst du vielleicht darüber reden?«, fragte David mitfühlend, als sein Schweigen offenbar zu lange dauerte, und Dominic schüttelte den Kopf.
»Nein«, murmelte er, als ihm einfiel, dass David ihn nicht sehen konnte. »Ich muss erst darüber nachdenken.«
»Okay«, sagte David schlicht und meinte es auch so, und das war einer der Gründe, warum Dominic ihn seinen Freund nannte, denn David bedrängte ihn nicht zum Reden, solange er das nicht wollte. »Mist verdammter.«
»Was ist?«, fragte Dominic alarmiert.
»Ich habe die Zeit vergessen. Adrian kommt gleich und ich wollte kochen.«
Dominic blinzelte irritiert. »Du kochst?«
»Ich versuche es zumindest«, schränkte David amüsiert ein, kein bisschen beleidigt über seine Verwunderung. »Also falls du nachher ein starkes Beben spürst, habe ich vermutlich unsere Küche in die Luft gejagt.«
Sie verabschiedeten sich unter viel Gelächter und einigen frechen Neckereien seinerseits, und Dominic entschied danach, dass er gleich all seinen Mut zusammennehmen und den Speicher erobern würde, auch auf die Gefahr hin, dort einer Armee von dicken Spinnen gegenüberzustehen und schreiend davonzulaufen. Gott sei Dank konnte ihn niemand sehen, dachte Dominic, als er ein paar Minuten später, bewaffnet mit einer Fliegenklatsche und Insektenspray, nach oben ging.
»Was hast du denn gemacht?«, fragte Maggie ihn am nächsten Morgen, die mit ihrem Mann Kyle den kleinen Gemischtwarenladen unterhielt, in dem er gerne einkaufte, und sah ihn verblüfft an. »Bist du überfallen worden?«
Dominic verkniff sich ein Seufzen, da sie schon die siebente Person heute war, die ihn das fragte, und versuchte sich an einem völlig unschuldigen Blick. »Das war ein Unfall.«
Dabei hatte er vorhin nur schnell zur Bank gewollt, um ein paar fällige Rechnungen zu bezahlen, und er war extra früh gegangen, in der Hoffnung, dass ihm dort keiner über den Weg lief, den er kannte, um das Missgeschick von gestern nicht erklären zu müssen.
Natürlich war er auf die halbe Stadt getroffen, beziehungsweise auf genau den Teil, den er kannte. Angefangen vom uralten Fred samt seiner Anna an der Hand, hin zu Franklin, und zuletzt war ihm auch noch Melissa über den Weg gelaufen, die zwar umwerfend Brot backen konnte, aber gleichzeitig leider auch die Klatschbase in der Stadt war. Das war der Nachteil an Kleinstädten. Jeder kannte jeden und Neuigkeiten, ganz egal welcher Art sie waren, verbreiteten sich schneller als die Polizei erlaubte, was auch auf seinen Unfall zutraf.
Maggie kam hinter der Kasse hervor und baute sich mit einem mütterlich strengen Blick vor ihm auf. »Wenn ich das sagen würde, mit meinen gerade mal 1,60m an Körpergröße, und dabei so ein Veilchen im Gesicht hätte wie du, würde irgendwer die Cops rufen, weil man denken würde, Kyle hätte mich verprügelt. Bei dir mit deinen knappen 1,90m zieht das allerdings nicht. Also? Was ist passiert?«
Normalerweise hätte er einfach das Blaue vom Himmel gelogen, nur um nicht die peinliche Wahrheit gestehen zu müssen, aber das würde Maggie ihm mit Sicherheit übel nehmen, so besorgt wie sie ihn und sein Veilchen zurzeit musterte. Dominic seufzte und gab nach. »Die Spinne war schuld.«
Maggie runzelte die Stirn. »Eine Spinne?«
»Ja, die auf Andrews Speicher. Ich habe sie erst gesehen, als das riesige Biest schon auf meiner Schulter saß, und ich hasse Spinnen. Und ... Na ja ... Bei dem Versuch sie loszuwerden, bin ich gegen die Tür gestolpert.« Maggies Mundwinkel begannen verdächtig zu zucken. »Erzähl das bitte nicht Kyle.«
»Zu spät«, meinte der auf einmal hinter ihm und Dominic stöhnte auf. Im selben Moment fingen die beiden an zu lachen.
»Ich kann euch gerade überhaupt nicht leiden«, murrte er und kam doch nicht um ein Grinsen herum, als Maggie ihn unterhakte und dann mit sich durch die Gänge zog, direkt auf die Weihnachtsdekoration zu, dabei immer noch lachend.
»Anna hat mich natürlich längst angerufen und es mir erzählt, aber ich konnte nicht anders, als dich zu necken. Noch dazu kann ich Spinnen genauso wenig leiden wie du, willkommen im Club also.« Sie ließ von ihm ab, stemmte ihre Hände in die Seiten und schaute ihn fragend an. »So! Da wären wir. Was brauchst du denn?«
Dominic sah ratlos auf die Kugeln, Sterne, Holzpyramiden, Rahmen mit Kerzen für das Fenster, Lichterbögen und Unmengen von anderem Glitzer- und Kleinkram. »Alles? Andrew hatte nur eine Holzpyramide auf dem Speicher, die ich aber erst mal in Schuss bringen muss.«
»So eine große?«, überlegte Maggie. »Drei Stockwerke und ein tanzender Engel obendrauf?«
»Genau«, nickte Dominic verwundert. »Du kennst sie?«
»Ja«, antwortete Maggie und lächelte dabei wehmütig. »Die hat seiner Frau gehört. Nachdem sie starb, hat er sie nicht mehr aufgestellt.« Sie zwinkerte ihm zu. »Sag mir Bescheid, wenn du für die Pyramide Ersatzteile brauchst. Sie ist viel zu schön, um nicht wieder benutzt zu werden. Aber erst mal kümmern wir uns jetzt darum, dass dein Haus bald weihnachtlich aussieht.«
2. Kapitel
Mein geliebter Sohn,
man sollte annehmen, dass Menschen ab einem gewissen Alter mit genügend Verstand gesegnet sind, um zu wissen, wann sie Fehler machen. Allerdings sieht die Realität diesbezüglich ziemlich lasch aus. Die meisten Menschen haben zwar den Verstand, machen aber mit Begeisterung ständig kleine und auch große Fehler und nennen ihre Unfähigkeit dann lapidar Erfahrungen sammeln.
Ich nehme mich davon nicht aus, ganz im Gegenteil. Fehler habe ich genug gemacht, aber ich habe wenigstens den Schneid mir selbst einzugestehen, dass ich Blödsinn veranstaltet habe und immer noch veranstalte.
Ich weiß nicht mehr, wann mir das zum ersten Mal bewusst geworden ist, aber ich weiß, wann ich den Punkt überschritt, an dem ich mich nicht länger mit meiner Unfähigkeit herausreden konnte, wie die meisten anderen Menschen es ihr ganzes Leben lang tun. Bin ich zynisch geworden mit der Zeit? Ja, wahrscheinlich. Ziemlich sicher sogar. Wer sein Leben hinter verschlossenen Türen und mit Eisengittern vor den Fenstern verbringt, so wie ich es tue, wird irgendwann entweder zynisch oder verrückt.
Da mir Letzteres bereits vor Jahren als Diagnose gestellt wurde, muss ich mich wohl auf den Zynismus berufen.
Es ist nicht immer leicht, diesen Zynismus stecken zu lassen, um sich keine Feinde zu machen. Davon habe ich auch hier genug. Die Pfleger sind böse zu mir, wenn ich meine Pillen nicht nehmen will. Dabei frage ich mich, was falsch daran ist, einen klaren Kopf behalten zu wollen, um dir weiter schreiben zu können. Aber nein, ich muss ja meine bunten Pillen nehmen.
Wie das Schicksal es so will, haben viele Menschen nicht nur mit dem Thema Unfähigkeit so ihre Probleme, sondern auch mit dem in meinen Augen harmlosen Wort Zynismus. Ich bin keine Frau, die Menschen allgemein hasst, auch wenn es heute wohl danach klingt, ich kann nur mit den meisten Leuten, die hier leben, nicht das Geringste anfangen. Ein paar von ihnen sabbern den ganzen Tag. Oder sie kichern ständig, als wären sie verrückt.
Dein Vater hat nie gekichert. Er hat gelacht. Ein wunderschönes Lachen. Ich kann es immer noch hören.
Es tut mir leid, Dominic. Ich weiß, dass ich heute anders bin, als ich sein will. Und ich weiß auch, dass diese verdammten Pillen mich mehr und mehr in etwas verwandeln, dem die meisten Leute lieber aus dem Weg gehen. Ich will das aber nicht. Ich will nicht zu diesen sabbernden und kichernden Dingern werden, die in all den anderen Zimmern ihr Dasein fristen. Ich will ich sein. Deine Mum.
Und am liebsten würde ich für immer und ewig vergessen, was der Grund dafür ist, dass ich hier sein muss und nie wieder deine Mum sein kann. Doch mein Unterbewusstsein sorgt mit schöner Regelmäßigkeit dafür, dass ich es nicht tue.
Ich liebe dich, mein Sohn, und ich wünschte, diese Albträume würden endlich aufhören.
Sei immer stark,
Mum
Eine Woche später war Dominic immer noch damit beschäftigt, einen Platz für die ganze Weihnachtsdekoration zu finden, die er mit der Hilfe von Maggie für sein Haus ausgesucht hatte, und langsam aber sicher musste er fertig werden, denn das Wochenende stand vor der Tür und damit der erste Advent.
Andrews alte Pyramide stand bereits, denn die hatte er zuerst instandgesetzt und seither wartete sie auf der Kommode im Wohnzimmer darauf benutzt zu werden.
Aber für heute war Schluss mit dem Dekorationsmarathon. Er hatte Hunger und war müde, und deshalb räumte Dominic die letzten beiden Tüten einfach beiseite und ging rüber in die Küche, um sich etwas zu essen zu machen, Montana zu füttern und danach mit einer Kanne Tee ins Wohnzimmer hinüberzugehen, um vor dem Schlafengehen etwas fernzusehen. Dominic hatte es sich gerade auf der Couch gemütlich gemacht, als sein Handy zu klingeln begann. Nach einem Blick auf die Uhr, es war nach neun Uhr abends, entschied er, David zu ignorieren. Wenn es wirklich wichtig war, würde der ihm eine Nachricht schicken, das hatten sie so ausgemacht. Ansonsten konnte es bis morgen waren.
Dominic zappte durchs Programm, als das Klingeln aufhörte, und blieb bei Der Grinch hängen, einer der Filmklassiker für Weihnachten schlechthin. Den kannte er zwar in und auswendig, aber um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen, war der Film genau richtig. Montana sprang zu ihm auf die Couch, maunzte und rollte sich dann auf der Decke zusammen, die er für den Kater hingelegt hatte. Dominic betrachtete den Stubentiger schmunzelnd und trank einen Schluck Tee, um im nächsten Moment die Stirn zu runzeln, als ein lautes Piepen seines Handys ihm eine eingegangene Nachricht ankündigte. Scheinbar war es wichtig. Dominic nahm sein Handy vom Couchtisch und rief die Nachricht auf.
Bitte geh ran!
Noch bevor er sich über die Dringlichkeit wundern konnte, begann sein Handy wieder zu klingeln. Dieses Mal nahm er sofort ab. »Was ist denn los?«, fragte er, ohne einen Gedanken an eine Begrüßung zu verschwenden.
»Cameron ist weg«, antwortete David beunruhigt und Dominic konnte Adrian im Hintergrund mit jemandem diskutieren hören. »Adrian gibt gerade eine Vermisstenanzeige für ihn auf«, erklärte David ihm im nächsten Moment. »Ich dachte mir zuerst nichts dabei, als er heute früh nicht wie verabredet zum Frühstück kam, weil ich vergessen hatte, unseren Anrufbeantworter abzuhören. Er sagt immer Bescheid, falls ihm etwas dazwischenkommt. Aber vorhin war ich noch in der Galerie, weil ich mit Maddison etwas wegen der neuen Ausstellung besprechen wollte, und sie ist doch in Behandlung bei ihm.«
Dominic nickte nur. Das wusste er alles. David konnte langsam mal zum Punkt kommen. »Was hat sie gesagt?«, fragte er, während ihm ein kalter Schauer über den Rücken lief. Cameron wurde vermisst. Großer Gott, wenn dem Mann etwas passiert war, würde es David das Herz brechen.
»Es gab einen Unfall in der Klinik.« David schluckte hörbar für ihn durchs Telefon. »Eines seiner Kinder ist ihm mitten in der Reha an einer Gehirnblutung weggestorben. Er war mit ihr im Wasser und hat es erst gemerkt, als sie schon tot war.«
»Mein Gott«, murmelte Dominic entsetzt und ließ sich nach hinten gegen die Couch sinken. »Wie lange ist das her?«
»Zwei Tage, inklusive heute. Sein Chef hat ihn danach nach Hause geschickt, weil er einen Schock hatte. Kein Wunder. Seither hat ihn niemand gesehen. Adrian war vorhin mit Nick bei Camerons Wohnung. Nichts. Der Vermieter hat ihnen geöffnet, als er erfuhr, worum es ging, aber die Wohnung sieht normal aus. Abgesehen von der Tatsache, dass Kleidungsstücke fehlen. Adrian vermutet, er hat sich abgesetzt, aber das Abklappern von Freunden und Bekannten hat bisher nichts gebracht. Nick klingelt jetzt sämtliche Krankenhäuser, Flughäfen und Bahnhöfe durch, und ich wollte dir ... Also, ich wollte ...«
David geriet ins Stottern und Dominic kam ein Verdacht. »Er weiß, wo ich bin, oder?«
»Ja«, gab David leise zu und sprach gleich weiter, ehe Dominic ihn anschreien konnte. »Bitte sei nicht sauer. Ich brauchte jemand zum Reden und er hat natürlich gemerkt, wie stark es mir an die Nieren geht, weil du weggegangen bist. Und den Anderen durfte ich doch nichts sagen.«
Mist. Wie sollte er David denn jetzt noch böse sein? Immerhin war es seine Schuld, dass der überhaupt erst in die Lage gekommen war, für ihn lügen zu müssen. Dominic seufzte. »Es tut mir leid, David. Ich wollte nicht, dass du ... Ach, Scheiße.«
»Es ist okay«, beschwor ihn David. »Ich weiß, dass du diese Zeit für dich brauchst, und vielleicht taucht Cameron morgen schon wieder auf, wer weiß das schon?« David räusperte sich, was Dominic verriet, dass sein Freund allerdings nicht daran glaubte, dass Cameron allzu bald wieder bei ihnen auftauchte. »Und ... Na ja ... Ich wollte dich wenigstens vorwarnen, falls er zu dir kommt.«
Da war etwas in Davids Stimme, was ihn aufhorchen ließ. »Wieso sollte er ausgerechnet bei mir auftauchen?«
»Keine Ahnung, aber möglich wäre es doch, oder?«
Die Erkenntnis traf ihn wie die sprichwörtliche Faust mitten ins Gesicht. David log ihn an. Dominic konnte nicht erklären, warum er sich dessen so sicher war, aber er wusste es einfach. »Du lügst mich an.« David schwieg, was ein Schuldeingeständnis war. Dominic verkniff sich einen lästerlichen Fluch. »Was verschweigst du mir?«, schaffte er stattdessen ruhig zu fragen, auch wenn es tief in ihm heftig zu brodeln begann.
»Er mag dich«, antwortete David und Dominic ahnte, dass da noch etwas nachkam, als David in der nächsten Sekunde seufzte. »Obwohl mögen nicht gerade das Wort ist, was ich dafür verwenden würde, um ehrlich zu sein.«
Verdammt! Dominic schloss gequält die Augen. Er hatte es gewusst. Schon an dem Tag, als sie sich im Krankenhaus nach Davids schwerem Unfall das erste Mal über den Weg gelaufen waren. Schon damals war da irgendetwas gewesen, das er weder greifen, noch in Worte hatte fassen können. Aber er hatte es von Beginn an gespürt. Vielleicht waren es die merkwürdigen Blicke gewesen, die Cameron ihm immer wieder heimlich zugeworfen hatte, und die er wider besseres Wissen schlichtweg ignoriert hatte, weil er nichts mit ihnen anzufangen gewusst hatte. Jetzt war Dominic klar, warum ihm diese Blicke so seltsam vorgekommen waren. Jetzt kannte er den Grund. Nur was fing er mit der Erkenntnis an, dass Cameron Salt offensichtlich in ihn verliebt war?
Der erste Advent kam und ging.
Genauso wie der erste Schneesturm, der in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder für Stromausfälle und blockierte Straßen sorgte.
Aber auch das Problem war innerhalb von zwei Tagen behoben und zurück blieben nur die knapp fünfzehn Zentimeter Schnee und die minus zehn Grad, die der Sturm mitgebracht hatte. Montana fand die weiße Pracht draußen überhaupt nicht komisch und beschwerte sich lautstark maunzend darüber, um sich schließlich schmollend auf der Couch in die Decke einzurollen und ihn von dort aus misstrauisch zu beäugen, was Dominic recht gut verstehen konnte, denn er verbrachte seit Davids nächtlichem Anruf die meiste Zeit damit, nervös auf und abzulaufen und sich dabei zu fragen, ob es Cameron gutging.
Seit seinem letzten Telefonat mit David, das schon wieder mehrere Stunden her war, gab es absolut nichts Neues zu berichten. Sah man mal von der Tatsache ab, dass David erneut versucht hatte, mit ihm über das zu reden, was Cameron offensichtlich für ihn fühlte, aber Dominic hatte abgeblockt. Er wollte nicht darüber reden. Er wollte nur, dass der blonde Wirbelwind wieder heil nach Hause kam.
David hatte Cameron einmal so bezeichnet und irgendwie war die Bezeichnung bei ihm hängengeblieben. Warum, wusste Dominic nicht. Aber es passte, denn er hatte Cameron als Wirbelwind, ständig redend oder lachend und dabei immer ein begeistertes Funkeln in den dunkelgrünen Augen habend, kennengelernt. Und jetzt war der Kerl weg. Seit mittlerweile einer Woche, und wie hoch die Chancen waren, einen Vermissten zu finden, der länger als drei Tage verschwunden war, sah man ja ständig in den Nachrichten.
Die meisten Vermissten tauchten nie wieder oder tot auf.
Und eben jene Toten waren oft genug noch ausgeraubt, vergewaltigt, gequält und am Ende eiskalt ermordet worden. Ob Mann oder Frau, da machten die meisten Täter keinen Unterschied, und Cameron war mit seinen dunkelgrünen Augen, den blonden Locken und, wie hatte David es genannt, dem Engelsgesicht, genau diese Sorte von Mensch, der in einer Masse herausstach. Cameron fiel auf, weil er schön war und welcher Perverse nahm schon einen versifften Penner, wenn er einen blonden Schönling haben konnte?
Dominic runzelte die Stirn, als ihm auffiel, wie sehr er gerade damit anfing, sich verrückt zu machen, und das würde Cameron kaum helfen. Ganz egal, wo der im Moment war. Es wurde Zeit, dass er ein wenig aus dem Haus kam und sich eine Runde in der Stadt umsah. Vielleicht hatte irgendjemand zufällig einen Fremden gesehen, falls möglich mit blonden Haaren. Einen Versuch war es wert, und für Montana brauchte er noch frisches Futter, wie für sich selbst einiges an Kleinkram fürs Badezimmer. Und Kerzen, sowie ein paar Packungen Kaminanzünder. Diese Sachen hatte er bei seinem Großeinkauf für den Winter völlig vergessen und beides war unabdingbar, sollte in den nächsten Wochen wieder der Strom oder im schlimmsten Fall auch der Generator ausfallen.
Bei Maggie im Geschäft war sprichwörtlich tote Hose, was dem Wetter und der späten Uhrzeit gleichermaßen zuzuschreiben war, und so konnte Dominic in Ruhe seinen Einkaufskorb vollmachen, mit Kyle über das Für und Wider von Gasfeuerzeugen diskutieren und am Ende bei Maggie an der Kasse zu fragen, ob sie jemanden gesehen hatte, auf den Camerons Beschreibung passte.
»Nein, der wäre mir bestimmt aufgefallen«, meinte sie und tippte nebenbei die Preise in die alte Kasse ein. »Der arme Junge. Auf so eine Art ein Kind sterben zu sehen ...« Maggie schüttelte den Kopf. »Das ist furchtbar. Soll ich mich mal ein wenig in der Stadt umhören, ob jemand deinen Freund gesehen hat? Vielleicht hat er sich im Motel eingemietet.«
Dominic nickte dankbar. »Das wäre echt nett von dir. Ich will auch noch etwas herumfahren.«
Maggie nickte. »Gute Idee. Vielleicht hast du ja Glück, ich wünsche es dir auf jeden Fall, und melde mich, sobald ich etwas höre.« Sie deutete auf ihn. »Und vergiss nicht, deine Mütze aufzusetzen. So faszinierend ich deine Glatze finde, du holst dir noch den Tod bei dem Wetter.«
Dominic musste unwillkürlich lachen und tat, was Maggie gefordert hatte, bevor er mit zwei vollen Einkaufstüten nach draußen stapfte und sich wieder auf den Weg machte. Er würde zuerst bei Franklin in der Videothek vorbeischauen und danach zu Henry gehen. Die zwei wussten immer, wenn irgendwer Neues in der Stadt war, und wenn sie es nicht wussten, dann der alte Fred oder Charlie. Und zum Diner, um etwas zu essen, wollte er ohnehin. Auch wenn ihm Kochen an sich Spaß machte, heute hatte er einfach keinen Nerv mehr dafür.
Dominic hatte kein Glück, was Cameron betraf.
Niemand von den Einheimischen, die sich trotz Kälte und Schnee aus den Häusern getraut hatten, hatte einen Fremden in der Stadt gesehen, auf den seine Beschreibung passte. Es war überhaupt kein Neuzugang im Ort gesehen worden. Aber alle versprachen ihm, in den nächsten Stunden und Tagen die Augen offen zu halten, und das war für Dominic beruhigend, obwohl er sich gleichzeitig fragte, ob es richtig war, die Pferde scheuzumachen. Cameron konnte sonst wo sein. Trotzdem. Er galt offiziell bereits als vermisst, also konnte es nicht schlecht sein, nach ihm Ausschau zu halten, wenn er wirklich in Cape Elizabeth auftauchte.
Zu Hause erwarteten ihn drei Nachrichten auf seiner Mailbox, alle von David, der ihm erzählte, dass Adrian herausgefunden hatte, dass Cameron ein Flugticket bei einer kleinen Airline gebucht und vor fünf Tagen nach Boston geflogen war, wo sie seine Spur bis zum Busbahnhof weiterverfolgt hatten. Dominic rief nicht sofort zurück, sondern fuhr stattdessen erst mal den Computer hoch, um nachzuprüfen, wie weit Boston von Cape Elizabeth entfernt war, denn mit der Nachricht hatte sich auf jeden Fall Davids Verdacht bestätigt, dass Cameron in seine Richtung unterwegs war.
Mit dem Auto war die Strecke, wenn man keine Umwege fuhr, in ein paar Stunden zu schaffen. Da die großen Überlandbuslinien wie Greyhound feste Routen und Zeiten hatten, würde Cameron zwar mit großer Wahrscheinlichkeit länger unterwegs sein, aber auf gar keinen Fall mehrere Tage.
Dominic rief die Seite der Buslinie auf. Boston wurde angefahren und in der Nähe von Cape Elizabeth lag Portland, das ebenfalls auf der Liste stand. Und von Portland aus brauchte man mit einem Taxi keine halbe Stunde hierher. Gut, bei dem aktuellen Wetter sollte er wohl mehr Zeit einplanen, aber egal wie Dominic es drehte und wendete, falls Cameron nicht mitten auf dem Weg kehrtgemacht hatte, hätte er schon lange hier sein müssen, und allein bei der Vorstellung, dass Cameron tot in irgendeinem Straßengraben lag, wurde ihm übel.
»Wo steckst du nur?«, murmelte er und griff nach seinem Handy, um David anzurufen, und der ging bereits nach dem ersten Klingeln ran. »Er müsste längst hier sein, das ist dir klar, oder?«, fragte er, ohne sich mit einer Begrüßung aufzuhalten.
David seufzte. »Bist du auch bei Greyhound?«
»Ist das naheliegendste, wenn er sich keinen Wagen gemietet hat«, antwortete Dominic und sah auf den Bildschirm.
»Hat er nicht«, meinte David. »Seine Kreditkarte wurde jedenfalls nicht mehr belastet, seit er das Flugticket gekauft hat, und auch sonst ist er nirgendwo mehr aufgetaucht. Dafür hat er sein Konto leergeräumt. Laut Adrian hat er im Augenblick knapp eintausend Dollar dabei. Hoffentlich geht das gut.«
Fast eintausend Dollar? War Cameron verrückt geworden? Das schrie ja schon danach, überfallen und ausgeraubt zu werden. Kein Mensch, der bei klarem Verstand war, rannte mit so einer Menge Bargeld durch die Gegend. Dominic sparte sich jeden Kommentar dazu.
»Von Boston nach Portland fahren die Busse in zwei Stunden und wenn er danach in ein Taxi gestiegen ist ...« Dominic brach ab, aber was er nicht laut sagen wollte, nämlich die Tatsache, dass Cameron tot sein konnte, war David natürlich auch bewusst. »Hat die Polizei irgendwas herausgefunden?«
»Nein«, meinte David und klang genauso frustriert, wie er selbst sich gerade fühlte. »Allerdings verlasse ich mich in der Hinsicht, um ehrlich zu sein, lieber auf Adrian. Der kennt überall Leute, die ihm einen oder auch mehrere Gefallen schulden. Vielleicht finden die was.«
Dominic nickte und klickte den Browser zu. »Ich habe hier im Ort auch ein bisschen die Pferde scheugemacht. Mal sehen, ob er sich blicken lässt.« Er seufzte, als sein Blick zum Fenster wanderte. Es schneite wieder. »Shit, wir haben in den Nächten teils minus zwanzig Grad. Was, wenn er ...?« Dominic brach ab. Sich noch mehr verrückt zu machen, brachte nichts, obwohl ihm klar war, dass er es trotzdem tun würde. »Hoffentlich ist er irgendwo untergekommen, wo es warm ist.«
»Ja, hoffentlich«, murmelte David und bevor Dominic ihn stoppen konnte, hatte David schon weitergesprochen. »Bist du sicher, dass du nicht darüber reden willst?«
Verdammt noch mal. David war wirklich ein sturer Bock. Ja, er war sich sicher. Da gab es nichts zu bereden und damit basta. »Hast du Adrian von mir erzählt?«
David stöhnte frustriert. »Du bist unmöglich.«
»Nein, du bist unmöglich«, konterte Dominic. »Ich habe dir schon x-mal gesagt, dass es nichts zu bereden gibt. Also? Hast du Adrian gesagt, wo ich bin? Ich will nicht, dass du weiter für mich lügen musst.«
»Ja, habe ich«, antwortete David nachgebend. »Er war nicht sauer, dass ich nichts gesagt habe, aber er macht sich Sorgen. Wie ich. Wie wir alle. Das weißt du.«
Was sollte er denn dazu sagen? Sauer sein ging nicht, da er ihre Sorge gut verstand. Ihm war es schließlich genauso gegangen, als David nach seinem Unfall so lange im Krankenhaus gelegen hatte. Aber ihm gefiel es hier. Dominic fühlte sich wohl in dieser kleinen Stadt, die einerseits direkt an Meer, andererseits aber auch irgendwie im Wald lag. So viel Grün hatte er noch nie um sich herum gehabt und sein letzter richtiger Winter war auch schon ewig her. Es war ein Unterschied, ob man im Westen das Landes lebte oder, wie er jetzt, im Osten. Allein an den Jahreszeiten, die hier drüben deutlich ausgeprägter waren, merkte Dominic es, und auch wenn diese knackige Kälte ungewohnt war, sie gefiel ihm. Genau wie der Schnee.
»Ich bin gern hier, David«, sagte er schließlich. »Auch wenn die Kälte gewöhnungsbedürftig ist. Ich mag den Schnee und mir gefällt die Ruhe, die Menschen, das gemächliche Leben. Es ist ganz anders als diese Hektik, die wir bei den Rennen immer hatten. Ich weiß nicht, wo ich in sechs Monaten oder in einem Jahr sein werde, aber mit Sicherheit nicht auf einer Rennbahn.«
David schwieg einige Zeit, doch bevor Dominic nachhaken konnte, fragte er: »Träumst du noch?«
Ah, deswegen das Schweigen. »Jeder Mensch träumt dann und wann«, wich er einer direkten Antwort aus, obwohl Dominic wusste, dass er damit nicht durchkommen würde. Wie gesagt, David war ein Sturkopf, und nur weil er ihn beim Thema Cameron rigoros abblockte, bedeutete das noch lange nicht, dass David sich das bei jedem Thema gefallen ließ.
»Du weißt, was ich meine«, murrte der dann auch wie erwartet, was Dominic grinsen ließ.
Natürlich wusste er, was David meinte, immerhin hatten sie so oft darüber gestritten, dass es ihm schlussendlich beinahe aus den Ohren gekommen war. Aber er war eben nicht David, der sich am Ende professionelle Hilfe gesucht hatte, um mit den psychischen Folgen des Unfalls klarzukommen. Dominic hatte einen anderen Weg gewählt und solange der funktionierte, gab es für ihn keine Notwendigkeit, sich in einem Raum voller Menschen darüber zu unterhalten, dass er seinen Beruf und sein bisheriges Leben wegen Albträumen aufgegeben hatte. Zwar nicht nur deswegen, aber größtenteils. Wie dem auch sei. Eine Therapie zu machen, wie David es vorgeschlagen hatte, kam für Dominic nicht infrage. Jedenfalls nicht, solange er ohne zurechtkam.
»Es ist besser geworden. Ich weiß nicht, ob meine Albträume wiederkämen, falls ich wieder zurückginge, aber ich habe eh nichts dergleichen vor.« Warum sollte er auch? Allein schon die Vorstellung es auszuprobieren und danach wieder wochenlang jede Nacht schreiend aus dem Schlaf hochzuschrecken, lockte Dominic nun wirklich nicht.
»Vielleicht würde es dir helfen«, murmelte David und Dominic konnte wie immer die Schuldgefühle aus Davids Stimme heraushören, dabei konnte der gar nichts dafür.
»Du musst endlich damit aufhören«, sagte er leise, aber zugleich auch sehr ernst. »Dass ich nach deinem Unfall Albträume hatte, war und wird niemals deine Schuld sein. Und du bist auch nicht schuld daran, dass ich deswegen den Rennstall verkauft habe. Ich wollte dieses Leben auf der Überholspur einfach nicht mehr führen. Es war meine Entscheidung und ich bereue sie nicht. Dein Unfall hat die Sache einfach nur ein wenig beschleunigt.«
»Du meinst, du hättest sowieso irgendwann aufgehört?«
»Du etwa nicht?«, hielt Dominic dagegen und nickte innerlich, als David daraufhin wieder schwieg. »Eben. Ich bin jetzt Achtunddreißig und ich hatte nicht vor, mich auf Motorradrennbahnen herumzutreiben, bis ich an Altersschwäche sterbe oder in eine Wand krache. Ich habe die Rennen geliebt, gar keine Frage, aber ist es an der Zeit, etwas anderes zu versuchen.«
»Und was?«, wollte David wissen.
»Um das herauszufinden, bin ich hier«, antwortete Dominic und sah erneut aus dem Fenster. Der Schneefall hatte nachgelassen, was ihm in die Hände spielte, denn er hatte soeben beschlossen, sich draußen noch eine Runde auszutoben, bevor er ins Bett fallen und hoffentlich auch schlafen konnte. »Und ich weiß zwar nicht, was du jetzt tust, aber ich gehe Holz hacken.«
»Holz hacken? Um die Uhrzeit?«, fragte David verblüfft.
Dominic musste unerwartet grinsen. »Ich brauche frisches Holz für den Kamin, also erledige ich das jetzt gleich und kann danach hoffentlich schlafen. Denn sobald Cameron bei mir auftaucht, kann er sich ordentlich was anhören und dafür will ich wach sein.«
David prustete los und genau das hatte Dominic erreichen wollen. Sein Freund hatte schon genug durchgemacht, als sich jetzt auch noch ständig mit seinen Problemen befassen zu müssen, und sobald Cameron auftauchte, würde sich die gespannte Lage hoffentlich beruhigen. Vorausgesetzt, der blonde Wirbelwind tauchte wieder auf. Aber diesen Gedanken schob Dominic sofort und äußerst energisch beiseite. Solange man keine Leiche fand, war Cameron auch nicht tot. Basta.
»Schlaf gut, David. Und mach es auch, sonst beschwere ich mich bei Adrian.«
»Verräter«, kam zurück, was sie gemeinsam lachen ließ, bevor sie sich verabschiedeten und Dominic aufstand, um zu tun, was er David zuvor gesagt hatte. Nämlich Holz hacken.
Montana schien mit seinem Plan allerdings gar nicht einverstanden zu sein, denn der Kater begann zu fauchen und zu knurren, während er dabei war, sich die Winterjacke anzuziehen, und als Dominic verdutzt zu ihm hinüberging, bemerkte er dann auch das gesträubte Fell. Irgendetwas war hier definitiv im Busch, denn obwohl Dominic keine große Erfahrung mit Katzen hatte, wusste er instinktiv, dass Montana sich bedroht fühlte. Allerdings nicht von ihm, denn sein Kater starrte zum Fenster. Und da begriff er. Irgendjemand war vor seinem Haus und es wäre mit Sicherheit das Klügste gewesen, die Polizei zu rufen. Aber die würden niemals schnell genug hier sein, sollte sein ungebetener Gast plötzlich beschließen, dass es ihm draußen zu kalt war und einbrechen, also konnte er genauso gut selbst nachsehen.
Dominic ließ alles wie es war und ging zurück in den Flur, denn dort hatte er kein Licht eingeschaltet. Wer immer draußen stand, er konnte ihm nicht zusehen, wie er lautlos zur Tür schlich, um dann abrupt das Außenlicht einzuschalten. Im ersten Moment war er zu verdattert, um zu reagieren, als er erkannte, wer da draußen stand und gerade seine Augen gegen das grelle Licht abschirmte. Im nächsten Augenblick hatte er bereits die Haustür aufgerissen, um das zu tun, was er schon seit Tagen wollte.
3. Kapitel
Mein geliebter Junge,
lass mich dir heute von deinem Vater erzählen ...
Gavin Masterson. Begnadeter Gitarrenspieler, mit einem Herz für Tiere, der seinen Lebenstraum, ein berühmter Musiker zu werden, aufgab, um dir ein Vater zu sein.
Das ist die Kurzfassung vom Leben deines Vaters, und würdest du ihn kennen, wie ich es getan habe, wüsstest du, dass dieser Satz alles ist, was man über ihn wissen muss, beziehungsweise ist es das Wichtigste, was man über ihn wissen sollte, denn dein Vater liebte Musik. Schon lange vor deiner Geburt hat er sie geliebt wie nichts sonst auf der Welt, und selbst als du da warst, hat sich daran nichts geändert. Leider kann ich dir nicht sagen, was ihm heute wichtig und vor allem lieb und teuer wäre, denn unsere Wege haben sich vor langer Zeit getrennt, aber ich kann dir versichern, dass dein Dad dich über alles liebte. Und daran hätte sich auch nie etwas geändert.
Menschen wie er, die für jene Dinge leben, die sie lieben, waren schon immer etwas ganz Besonderes, Dominic. Man nennt sie ziemlich oft Spinner und Träumer; manchmal auch Verrückte, was auf mich zutrifft, aber dein Vater war niemals ein Spinner und Verrückter. Gavin war ein Künstler. Mit Sicherheit auch ein Träumer, das sind die meisten Künstler, aber daran finde ich nichts Schlechtes. Träumer gibt es leider zu wenige auf dieser Welt. Was ich damit sagen will, ist, dein Vater war einzigartig.
Ich klinge, als würde ich eine Lobrede über ihn halten, wenn ich meinen letzten Absatz so betrachte, aber ich glaube das wirklich und es zeigt mir gerade wieder einmal, wie sehr Gavin mich damals beeindruckte. Dein Vater hatte Träume, Wünsche und Visionen und er hätte es hinbekommen, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Er hätte hart dafür gearbeitet und gekämpft, um zu bekommen, was er wollte, und auf gewisse Weise hat er das auch. Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber ich war immer stolz auf deinen Vater.
Man kann getrost sagen, dass dein Vater etwas aus seinem Leben gemacht hätte, denn er wäre ein Musiker geworden – sein Traum. Er hätte getan, was er immer tun wollte, wovon er mir vorschwärmte, bis es mir zu den Ohren herauskam, sodass ich ihn schließlich damit aufzog, er würde irgendwann als uralter Rocker in versifften Bars enden, Haschisch rauchend.
Ich bin zum Teil froh, dass es nicht so kam. Dass du nicht mit ihm so ein verrücktes Leben führst, auch wenn dieser Gedanke ziemlich egoistisch von mir ist, immerhin war Gavin dein Vater. Andererseits denke ich mir, wäre ein Leben mit ihm allemal besser, als ein Leben ohne ihn. Man kommt auf komische Gedanken, wenn man zu viel nachdenkt. Aber es ist sinnlos, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, denn ein Leben mit Gavin ist ein Wunschtraum, der nie in Erfüllung gehen wird. Dafür habe ich gesorgt.
Verzeih mir,
Deine Mum
»Du hast doch wohl den Arsch offen, Salt! David dreht seit einer Woche am Rad, weil du einfach abgehauen bist, und jetzt tauchst du mitten in der Nacht hier auf, erschrickst meinen Kater und hast scheinbar vor, dir den Tod zu holen, oder wie hast du vor, mir zu erklären, dass du nicht mal eine Jacke trägst!«, schrie er Cameron an, der ihn erschrocken ansah und dann, als Dominic gerade weiter schimpfen wollte, in Tränen ausbrach. »Äh ...«, machte Dominic hilflos, da er keine Ahnung hatte, wie man mit einem weinenden Mann umging.
Fluchen, schimpfen, toben – damit kannte er sich aus. Das hatten sein Bruder Devin und er oft genug getan, nachdem der im Rollstuhl gelandet war. Aber weinen? Dominic war schlichtweg überfordert. Das war eindeutig nicht sein Terrain, aber er musste etwas tun, sonst holte Cameron sich wirklich noch den Tod. Die Frage, wieso der Kerl nicht mal eine Jacke trug, konnte er ihm später noch mal stellen. Jetzt war das Allerwichtigste, dass Cameron ins Haus und damit ins Warme kam, aber so wie der am Weinen war, konnte er sich jede verbale Aufforderung in der Richtung sparen. Dominic packte Cameron daher wortlos am Arm und zog ihn ins Haus, um sich dann noch mal schnell draußen umzusehen. Ohne Erfolg. Kein Koffer, keine Reisetasche, kein Rucksack, nichts. Kopfschüttelnd ging er zurück ins Haus. Noch eine Frage, aber die würde ebenfalls warten müssen.
»Schuhe ausziehen!«, befahl er und schloss die Tür, um diese auch gleich zu verriegeln. Cameron tat wie geheißen und ließ sich ohne Widerstand von ihm hinüber ins Wohnzimmer auf die Couch bugsieren, wo Dominic ihn umgehend in zwei Decken wickelte und das Feuer im Kamin schürte. Nachdem er einige neue Scheite ins Feuer gelegt hatte, trat er wieder zu Cameron und setzte sich ihm schräg gegenüber in einen Sessel, um sich dabei nach Montana umzusehen. Aber der Kater hatte scheinbar das Weite gesucht. Kein Wunder. »Okay, ich höre!«, forderte er Cameron zum Reden auf, denn der hatte sich mittlerweile soweit beruhigt, dass er nicht mehr weinte. Gott sei Dank. »Warum tauchst du mitten in der Nacht vor meiner Tür auf? Ohne Jacke und überhaupt ... Hast du sie noch alle? Weißt du, wie gefährlich das ist?«
»Ich hatte eine Jacke«, murmelte Cameron unüberhörbar trotzig und brachte ihn damit umgehend auf hundertachtzig.
»Das habe ich nicht gefragt!«, fluchte Dominic und hätte Cameron am liebsten eine reingehauen. »Du hättest erfrieren können, du Vollidiot. Ich will eine Erklärung und zwar gleich!«
»Ich bin überfallen worden.«
Dominic holte lieber Luft, statt wieder loszuschreien. Himmel, er hatte es ja geahnt. »Wo?«, schaffte er es zu fragen, ohne Cameron an die Gurgel zu springen. »Und was ist passiert?«
»Vorhin in Portland. Ich glaube, die beiden waren Junkies. Sie hatten ein Messer und ich habe einfach reagiert. Meine Tasche nach dem einen Kerl geworfen und den anderen Typen dabei abgewehrt. Er hat meine Jacke erwischt und festgehalten. Da habe ich sie mitsamt Rucksack ausgezogen und bin weggerannt. Von meinen letzten Dollars nahm ich mir ein Taxi hierher. Es hat zwar nicht ausgereicht, aber der Fahrer gab sich mit meiner Uhr zufrieden. Er wollte wegen dem Schnee nicht bis zu dir durchfahren, weil er Angst hatte, steckenzubleiben, also bin ich den Rest gelaufen.«
Dominic stand kurz vorm Explodieren. Überfallen von Junkies, die ein Messer und wer weiß was noch gehabt hatten, und dann praktisch ausgesetzt. Mitten in der Nacht, bei Minusgraden und das ohne eine Jacke am Körper. Dieser Irre konnte von Glück reden, dass er nicht eiskalt ermordet worden oder erfroren war. »Wie weit bist du gelaufen?«
Cameron zog die Knie an und wickelte die Decken darum. »Ich weiß nicht ... Eine Meile ... Oder zwei ... Oder mehr.«
Die letzten Worte nuschelte er nur noch und das war auch sein Glück, denn so konnte Dominic sich einreden, sie nicht gehört zu haben. Wäre Cameron nicht dermaßen kaputt gewesen und hätte wie ein Häufchen Elend vor ihm gesessen, dann hätte er ihn jetzt fertiggemacht, und zwar richtig. Wie konnte ein intelligenter Mann wie dieser nur dermaßen leichtsinnig sein? Dominic atmete tief ein und stand auf.
»Wir gehen morgen zur Polizei und erstatten Anzeige. Haben sie deine Papiere mitgehen lassen? Kreditkarte? Führerschein?« Cameron nickte. »Gut, dann kümmern wir uns auch darum und gehen anschließend einkaufen. Du brauchst Kleidung, denn meine passt dir nicht. Aber jetzt will ich erst mal, dass du nach oben gehst. Die Tür zum Badezimmer steht offen. Nimm eine heiße Dusche und danach wirst du etwas essen. Ich mache Tee und lege dir ein paar Sachen von mir raus. Für eine Nacht wird es gehen. Außerdem wirst du David anrufen, damit er weiß, dass du am Leben bist.«
»Dominic, ich ...«, fing Cameron leise an, aber Dominic unterbrach ihn, in dem er mit einer Hand zur Treppe deutete.
»Geh nach oben, bevor ich mich vollkommen vergesse und dich anschreie, bis dir die Ohren bluten. Wie kann man nur so leichtsinnig sein?«
»Aber ...«
»Cameron!«
Es war fast ein Zischen und mehr Aufforderung brauchte Cameron dann auch nicht, um zu erkennen, wie schlecht es im Augenblick um seine Beherrschung bestellt war, und Dominic war froh, als er aus seinem Sichtfeld verschwand. Er brauchte jetzt ganz dringend ein paar Minuten für sich allein, um sich wieder einzukriegen, und die würde er mit Sandwichs und Tee kochen zubringen. Beschäftigung half immer und vielleicht bekam er dabei auch das Bild eines toten Camerons in irgendeiner Gosse aus den Kopf. So viel zum Thema Holz hacken und danach ins Bett fallen, um zu schlafen. In dieser Nacht würde er mit Sicherheit kein Auge mehr zumachen.
Cameron ließ sich Zeit mit der Dusche, während Dominic in der Küche hantierte und dann kurz nach oben ging, um wie versprochen Sachen herauszusuchen, die er vor die Badezimmertür legte, ehe er sich mit einem Teller Sandwichs und der Kanne Tee ins Wohnzimmer verzog, um auf Cameron zu warten. Nach einer knappen halben Stunde fing er an sich Sorgen zu machen, doch bevor er sich entschließen konnte nachzusehen, ob alles in Ordnung war, hörte Dominic leise Schritte auf der Treppe. Kurz darauf kam Cameron zu ihm ins Wohnzimmer und setzte sich auf die Couch, um sich erneut in die flauschigen Decken zu wickeln.
Dominic konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, weil seine Hose und der Pullover für Cameron mit seiner schlanken Statur wirklich viel zu groß waren, aber wie gesagt, für eine Nacht würde es gehen und nur darauf kam es gerade an.
»Iss«, meinte er und zeigte auf den Teller mit den Sandwichs. »Und diskutier nicht mit mir«, setzte er nach, als Cameron den Mund öffnete, um genau das zu tun. »Wir suchen dich seit einer Woche, Cameron, diskutieren kannst du morgen wieder. Heute nicht.« Der seufzte zwar, gab aber nach und nahm sich ein Sandwich, während Dominic ihm Tee eingoss und sich ebenfalls auch eine Tasse nahm. »Wo warst du überhaupt so lange? Du hättest schon vor Tagen hier sein müssen.« Cameron lief rot an und schwieg. Dominic verdrehte die Augen. »Na sag schon. Wenn ich dir den Kopf hätte abreißen wollen, hätte ich es längst getan.«
»Ich war in Boston. Hab mich rumgetrieben«, erzählte Cameron mit Blick auf die Sandwichs und schien zu überlegen, ob er sich noch eins nehmen sollte.
Dominic beugte sich vor und hielt ihm den Teller wortlos unter die Nase. Cameron griff zu und murmelte ein Danke. »Warum hast du dich rumgetrieben?«
»Dom ...«
Er schüttelte den Kopf. »Warum?«
»Weil ich mich nicht hergetraut habe, okay?«, platzte aus Cameron heraus, bevor er sich ein drittes Sandwich nahm und sich tiefer in die Decken verkroch. »Ich wusste ja nicht, ob ich willkommen bin.«
Dominic sparte es sich, Cameron darauf hinzuweisen, dass er seit Tagen offiziell als vermisst galt und er ihn daher kaum einfach so vor der Tür hätte stehen lassen. Stattdessen kramte er kopfschüttelnd sein Handy aus der Tasche, um David anzurufen, und obwohl es schon reichlich spät war, ging der sofort ran. »Ich habe hier jemanden, der dir gerne Hallo sagen möchte«, erklärte er und hielt danach Cameron sein Handy hin, der daraufhin ein Gesicht zog, als wollte er am liebsten tot umfallen. »Da musst du jetzt durch«, sagte Dominic gnadenlos und wedelte mit dem Handy, bis Cameron es in die Hand nahm.
»Hi.«
Und weiter kam Cameron nicht, denn David schimpfte so laut los, dass sogar Dominic das Gesicht verzog, bevor er grinsend in die Küche verschwand, um noch mehr Tee zu machen. Strafe musste bekanntlich sein und Cameron würde es überleben, von David nach Strich und Faden zusammengeschissen zu werden. Als er zurück ins Wohnzimmer kam, schien Cameron unter den Decken ein ganzes Stück geschrumpft zu sein.
»Ja ... Ja, ich weiß ... Es tut mir doch leid ... David, bitte ... Es ist nicht ... Ja ...«
Dominic verkniff sich ein zweites Grinsen und setzte sich wortlos wieder in den Sessel. Im nächsten Moment kam Leben in Cameron.
»Nein ... Nein, David! ... Das machst du auf keinen Fall! ... David, nein!«
Was war denn nun los? Dominic runzelte die Stirn.
»David, bald ist Weihnachten. Genieß lieber deine freie Zeit mit Adrian und hört auf, euch meinetwegen verrückt zu machen. Ja, das macht ihr sowieso, ich weiß ... David, es geht mir gut und Dominic ist wirklich ein toller Gastgeber ... Ja, er hat gemeckert ... Meine Sachen? Äh ...« Cameron sah ihn an, wich seinem Blick aber gleich wieder aus. »Wenn ich was brauche, kaufe ich es mir ... Ja ... Ja ... Nein, ich will nicht, dass du herkommst ... Weil es mir gutgeht ... Ja, ich bleibe erst mal hier.«
Dominic verdrehte die Augen, bevor er nickte, als Cameron ihn flehend ansah. Ihn hier als Gast zu haben, war in jedem Fall besser, als sich mit Davids Überfürsorge befassen zu müssen, wenn der beschloss, in ein Flugzeug zu steigen und herzukommen. Das hätte ihm gerade noch gefehlt und Cameron dachte wohl genauso. Sie würden schon irgendwie miteinander klarkommen, entschied Dominic, denn er hatte nicht vor, Cameron rauszuwerfen. Der blonde Wirbelwind brauchte genauso eine Auszeit wie er, also würde er sie bekommen.
Dominic ließ Cameron schlafen, als er am nächsten Morgen aus dem Haus ging, um bei der Polizei vorbeizufahren und danach Maggie Bescheid zu sagen, dass sie nicht mehr nach Cameron Ausschau zu halten brauchte. Eigentlich hatte er ihn ja mitnehmen wollen, aber nach einem kurzen Blick ins Gästezimmer, in das er Cameron letzte Nacht einquartiert hatte, als der nach dem Telefonat mit David auf seiner Couch innerhalb kürzester Zeit eingeschlafen war, hatte er davon Abstand genommen. Cameron war selbst im Tiefschlaf unruhig und angespannt gewesen und Dominic wusste, was das bedeutete. Der nächste Kandidat für Albträume, aber damit würde er sich befassen, sollte es dazu kommen.
Außerdem hatte Montana ihn vom Fußende verschlafen und zugleich auch irgendwie tadelnd angesehen, als wollte der Kater ihm sagen, dass er Cameron gefälligst in Ruhe zu lassen hatte. Dieses Tier war eine Nummer für sich und Dominic hatte mit einem breiten Grinsen kehrtgemacht, um in Ruhe einen Kaffee zu trinken, dann das letzte Nacht vergessene Holz zu hacken und nach einer Dusche rüber in die Stadt zu fahren.
Dominic brauchte nicht lange und als er eine knappe Stunde später wieder zu Hause ankam, empfing ihn der Duft von Kaffee und gebratenen Eiern. »Cameron?«, rief er.
»In der Küche«, kam prompt zurück. »Ich habe Frühstück gemacht.«
Dominic zog sich Schuhe und Jacke aus und ging in die Küche, wo Cameron ratlos vor dem Küchenschrank stand, in der Hand eine Dose Katzenfutter, was Montanas Anwesenheit erklärte, der gesittet vor seinem Napf saß und auf sein Frühstück wartete. Dominic konnte sich ein empörtes Schnauben gerade so verkneifen. Dieser Kater war wirklich unmöglich. Ihm in die Hacken beißen und bei Cameron einen auf lieb und anständig machen. Montana ignorierte seinen finsteren Blick und miaute.
»Moment, du Rüpel«, murmelte Cameron. »Dominic?«, rief er dann. »Wo hast du den …? Woah!« Cameron zuckte erschrocken zurück, als er sich umdrehte und ihn entdeckte. »Hast du mich erschreckt«, tadelte er halbherzig und deutete dabei auf die Dose. »Dosenöffner?«
Dominic grinste. »Dreh sie mal um.«
Cameron runzelte irritiert die Stirn, tat aber wie geheißen und stöhnte im nächsten Moment auf, als er den Verschluss entdeckte. »Vergiss die Frage.«
Dominic enthielt sich jeden Kommentars und begann stattdessen den Tisch zu decken, als er sah, dass Cameron dazu noch nicht gekommen war. Der machte Montanas Napf voll und kurz darauf saßen sie schweigend beim Frühstück. Es war ein einträchtiges Schweigen, kein unangenehmes, was Dominic anfänglich befürchtet hatte. Und er war froh darüber, dass Cameron offenbar wie David zu der Sorte von Menschen gehörte, mit denen er einfach schweigen konnte, ohne dass es störte. Wäre dem nicht so gewesen, hätte er Cameron nicht lange in seiner Nähe ausgehalten. Trotzdem irritierte ihn irgendetwas an Camerons Ruhe, er konnte nur nicht greifen, was es war.
»Ich war vorhin bei der Polizei«, brach er die Stille irgendwann und goss sich Kaffee nach. »Wir sollen nachher vorbeikommen, wegen einer Anzeige des Überfalls und deiner Vermisstenanzeige. Die müssen wir zurücknehmen und das heißt Papierkram.« Cameron nickte. »Und hinterher gehen wir einkaufen, damit du wieder was zum anziehen hast.«
»Ich brauche nicht viel«, sagte Cameron unbehaglich, was Dominic abwinken ließ.
»Wir besorgen, was du brauchst. Egal ob viel oder wenig.«
Wieder ein Nicken und langsam wurde das unheimlich, da es absolut nicht zu Cameron passte. Dominic merkte auf. Das war es, was ihn momentan so irritierte. Camerons Ruhe. Normalerweise redete der ohne Punkt und Komma, da war dieses Schweigen doch sehr merkwürdig. Aber gut, in Anbetracht der Tatsache, dass sie sich kaum kannten und Cameron noch dazu gestern überfallen worden war, würde es vermutlich ein paar Tage dauern, bis er wieder zu seiner normalen Form zurückfand. Im nächsten Augenblick fiel Dominic etwas ein und er verfluchte sich dafür. Wieso hatte er nicht gestern Nacht schon danach gefragt?
»Diese beiden Typen ...«, fing er an und runzelte die Stirn, als Cameron sofort unruhig wurde. »Haben sie dich verletzt? Brauchst du einen Arzt?« Dass Cameron ihm nicht gleich antwortete, sondern stattdessen erst mal überlegte, was er sagen sollte, ließ bei ihm sämtliche Alarmglocken anschlagen. Diese Hinhaltetaktik kannte er von David noch viel zu gut. »Wo bist du verletzt?«
Cameron schüttelte den Kopf und wurde gleichzeitig knallrot. »Ich bin nicht ... verletzt.«
Dominic schüttelte den Kopf. »Lüg mich nicht an.«
»Ich lüge nicht«, fuhr Cameron ihn an und starrte dann auf die Tischplatte. »Ich bin nur ... Aber das hat nichts mit ...« Er brach ab und erklärte dann: »Ich kann es dir nicht sagen.«
Nein, damit beruhigte Cameron ihn gar nicht. Dominic war versucht, David anzurufen, da der in dieser Situation vielleicht mehr erreicht hätte. Aber er tat es nicht, denn wenn David erfuhr, dass Cameron verletzt war, würde nicht mal Adrian ihn in Baltimore halten können. »Versuchen wir es anders ...«, begann er daher. »Sag mir, ob du einen Arzt brauchst, oder ob ein Besuch in einer Apotheke ausreicht.«
Es dauerte, bis Cameron wagte, seinen Blick von der Tischplatte weg und auf ihn zu lenken. »Die Apotheke reicht. Falls du nicht zufällig eine Heilsalbe hier hast.«
Heilsalbe? Mehr nicht? War das nun gut oder schlecht? Dominic war sich nicht sicher, genauso wenig wie er sich sicher war, ob er es genauer wissen wollte. »Die habe ich da.« Als Cameron ihm verlegen und zugleich dankbar zunickte, runzelte er die Stirn. »Will ich es wissen?«
»Nein.«
»Was hast du bloß angestellt?«, murmelte er mehr zu sich selbst und zuckte erschrocken zusammen, als Cameron so hastig aufstand, dass der Stuhl dabei nach hinten umkippte und Montana fauchend aus der Küche verschwand.
»Mir was zum abreagieren gesucht, klar?« Cameron sah ihn abschätzig an. »Für Unwissende wie dich, ich hatte einen etwas zu wilden Fick. Reicht das, oder willst du noch mehr Informationen haben? Wo? Wie oft? Welche Stellung?«
Dominic schwieg verblüfft. Erstens, da Camerons Ausbruch zu schnell und zu überraschend gekommen war, und zweitens, weil er nicht wusste, wie er reagieren sollte. Vielleicht hätte er doch lieber David anrufen sollen. Der hatte mit solchen Dingen weit mehr Erfahrung als er. Oh, anrufen würde er David auf jeden Fall noch. Allein schon um nachzufragen, ob er Cameron zu einem Arzt bringen sollte. Aber das musste warten, bis das hier zwischen ihnen geklärt war.
»Es tut mir leid«, entschuldigte sich Cameron, ehe er etwas sagen konnte, und begann den Tisch abzuräumen. »Ich hätte das nicht sagen sollen.«
»Ist schon gut«, murmelte Dominic, weil es ihm am sichersten erschien das Thema fallen zu lassen. »Ich hätte nicht fragen sollen.« Er stand auf, um Cameron zu helfen, aber der nahm ihm den Teller aus der Hand.
»Ich mache das ... Lass mich das machen, okay?«, setzte Cameron nach, als er protestieren wollte und sah ihn bittend an.
Dominic nickte schweigend, bevor er sich abwandte und Cameron in der Küche allein ließ. Er musste unbedingt telefonieren, aber weil er nicht wollte, dass Cameron ihn hörte, verzog er sich nach oben in sein Schlafzimmer. Doch statt David, wie er es anfangs gewollt hatte, rief er Adrian an. Er brauchte jetzt einen nüchternen Rat, keinen unruhigen David, der Angst um seinen Freund hatte. Und er hatte Glück, denn Linda, Adrians und Nicks Sekretärin, ging schon nach dem ersten Klingeln in der Kanzlei ans Telefon.
»Kanzlei Kendall & Quinlan, hier spricht Linda. Was kann ich für Sie tun?«
»Linda, hier ist Dominic. Hat Adrian kurz Zeit für mich?«
»Hallo, Fremder.« Sie lachte und brachte ihn damit unwillkürlich zum lächeln. »Einen Augenblick, ich frage nach ... Ja, hat er. Ich verbinde dich.«
»Danke, Linda«, sagte er und hatte in der nächsten Sekunde bereits den Anwalt in der Leitung. »Können wir reden?«, fragte Dominic, ohne sich mit einer Begrüßung aufzuhalten, und das machte Adrian sofort klar, dass die Lage ernst war.
»Sekunde, ich mache die Tür zu ... Okay, was ist passiert?«
Dominic erzählte es ihm und bekam erst mal ein »Hm.« als Antwort, was ihn umgehend nervös machte. »Soll ich ihn zum Arzt schaffen?«
»Nein.« Adrian schwieg einen Moment. »Dominic? Wie viel weißt du über diese Art von Verletzungen?«
»Nichts«, gab er ehrlich zu.
»Das hatte ich vermutet«, meinte der Anwalt und überlege erneut, bevor er weitersprach. »Du kannst ihn nicht zwingen und sofern er keine Probleme beim Gehen oder Sitzen hat, rate ich dir, auf sein Wort zu vertrauen und abzuwarten. Wenn Cameron ernsthaft verletzt wäre, hätte er dir das auch gesagt. Ich vermute, es ist ihm einfach nur unangenehm, dass er sich so gehen lassen hat.«
»Du denkst, das kleine Mädchen ist der Grund?«
»Du nicht?«, fragte Adrian zurück, was ihn seufzen ließ. »Eben. Die überstürzte Flucht und sein Verhalten, es spricht alles dafür, und ich schätze, das war erst der Anfang. Kommst du damit klar?«
Eine gute Frage. Dominic wusste es nicht. »Keine Ahnung.«
»Ruf an, wenn du Hilfe brauchst.«
»Versprochen«, sagte er und wollte sich schon verschieden, als Adrian ihn mit einem »Dominic?« davon abhielt. »Ja?«
»Fang endlich an, dich damit auseinanderzusetzen, dass er in dich verliebt ist.«
Dominic stöhnte frustriert auf. »Nicht du auch noch.«
Adrian lachte kurz. »Das ist kein Vorwurf, Dominic, nur ein Rat. Er ist nicht aus Langeweile zu dir gekommen. Denk mal darüber nach.«
Adrian hatte aufgelegt, bevor er reagieren konnte, und im nächsten Moment klopfte es an seine Tür. Dominic schob das Telefonat beiseite, um sich Cameron zu stellen, der ihn verunsichert anschaute, als er die Tür aufmachte. Und mit dem Blick konnte er noch weniger anfangen, als wenn der Wirbelwind ihn angeschwiegen hätte. Dominic kam Cameron zuvor, denn der sah sehr verdächtig danach aus, sich gleich erneut bei ihm entschuldigen zu wollen.
»Es ist deine Privatsache und ich hätte nicht fragen dürfen. Tu mir nur bitte den Gefallen und sag Bescheid, falls du doch einen Arzt brauchst, in Ordnung?«, bat er und warf Cameron ein Lächeln zu, was den ebenfalls lächeln ließ. Zögernd zwar, aber er lächelte. »Gut. Und jetzt sollten wir zusehen, dass wir in die Stadt kommen, sonst ist es abends und wir haben nichts geschafft.«
Sieben Stunden später, nach dem Ausfüllen des ganzen offiziellen Papierkrams für die Cops, dem Beantworten unzähliger Fragen, da Camerons Auftauchen in der Stadt längst die Runde gemacht hatte, und einem Shoppingtrip, damit der neue Sachen bekam, hatte Dominic die Faxen dicke. Es war ihm ein Rätsel, warum man so viele Zettel ausfüllen musste, um an einen Führerschein und eine neue Kreditkarte zu kommen, aber nun ja. Dagegen war das Einkaufen wahrlich entspannend gewesen, obwohl er da auch erst ewig und drei Tage mit Cameron hatte diskutieren müssen, weil es dem unangenehm war, von ihm Geld zu nehmen.
Dominic hatte Cameron nur einen Vogel gezeigt, als der mit einer Auswahl von gerade mal zwei Hosen, ebenso vielen Pullovern, Shirts und Unterwäsche zu Maggie und ihm an die Kasse gekommen war. Das Nötigste für ein paar Tage, aber nicht für einige Wochen oder gar einen Winter. Maggie hatte kopfschüttelnd geseufzt und damit jedes Wort von ihm im Keim erstickt, bevor sie sich Cameron geschnappt und den wieder zu den Regalen mit Kleidung gezogen hatte, damit er sich vernünftig ausstattete. Dabei herausgekommen waren am Ende sechs Tüten voll Kleidung, die sie gerade ins Wohnzimmer getragen hatten und die Cameron jetzt mit zusammengekniffenen Augen ansah, während er sich noch die Schuhe auszog.
»Was ist?«, fragte Dominic, als Cameron sich leise seufzend durch die Haare fuhr.
»Was ist?«, wiederholte Cameron, sah ihn an und schnaubte. »Hier stehen sechs Tüten mit Klamotten, im Wert von fünfhundert Dollar und du fragst mich, was ist?«
Dominic stöhnte. Nicht das Thema wieder. »Willst du lieber die ganze Zeit nackt herumlaufen? Bitte, tue dir keinen Zwang an, aber beschwer dich dann nicht bei mir, wenn dir empfindlichen Körperteile abfrieren.« Cameron lief rot an, was er ignorierte. »Du hast Kleidung gebraucht, basta. Hör auf, daraus so ein Drama zu machen.«
»Aber fünfhundert Dollar? Weißt du, wie viel das ist?«
»Es ist nur Geld, okay?« Cameron sah ihn finster an, was Dominic die Schultern zucken ließ. »Wie gesagt, du hast Sachen gebraucht. Schwamm drüber.«
»Ich zahle es dir zurück.«
Dominic seufzte. »Wenn du unbedingt willst, tu das. Mir ist es gleich.«
»Mir aber nicht«, murrte Cameron und verschränkte beleidigt die Arme vor der Brust.
Dominic runzelte die Stirn, als ihm ein Gedanke kam. »Du hast nicht mehr viel Geld, oder?«
»Nein.«
Aha. Da lag also das Problem und es passte zu Davids Aussage mit dem leergeräumten Konto. Durch diesen Überfall war Cameron pleite und das war ihm augenscheinlich so peinlich, dass er lieber fror, als um Geld oder Hilfe zu bitten. Dominic zog sich die Jacke aus und ging zu Cameron hinüber, der seinem Blick auswich, anstatt ihn zu erwidern. Was war nur aus dem dauerhaft redenden, immer lustigen Therapeuten geworden, den er nach Davids Unfall kennengelernt hatte?
»Sieh mich an.« Keine Reaktion. »Sieh mich an, wenn ich mir dir rede, du kleiner Dickschädel.«
Das saß, obwohl aus Camerons dunkelgrünen Augen jetzt der pure Trotz sprach. Sehr schön. Er diskutierte ohnehin lieber mit einem trotzigen Cameron herum, als wenn der ihm vor lauter Unsicherheit nicht in die Augen sehen konnte. Dominic verkniff sich ein Grinsen und beschränkte sich auf drei Worte. »Dreizehn Millionen Dollar.«
Cameron sah ihn ratlos an. »Was?«
»So viel Geld habe ich auf verschiedenen Konten«, erklärte Dominic genauer, musste dann aber doch grinsen, als Cameron ihn daraufhin mit offenem Mund anstarrte. »Und jetzt frag mich nochmal, ob mir die paar hundert Dollar für dich etwas ausmachen.«
»Millionen?« Cameron blinzelte, sah auf die Tüten und wieder auf ihn, bevor er misstrauisch verkündete: »Du verarscht mich doch.«
Dominic prustete los und schüttelte den Kopf. »Im Rennsport kann man eine Menge Geld machen, wenn man weiß wie und wenn man die Gewinne anlegt, statt sie zum Fenster rauszuwerfen. Ich habe die letzten zwanzig Jahre so einiges auf die Seite gelegt und der Verkauf des Rennstalls hat mich bis ans Lebensende abgesichert. Für dich fünfhundert Dollar auszugeben ...« Dominic zuckte erneut die Schultern. »Es ist Taschengeld, verstehst du? Deswegen ist es mir auch egal, ob du es mir zurückgibst oder nicht.«