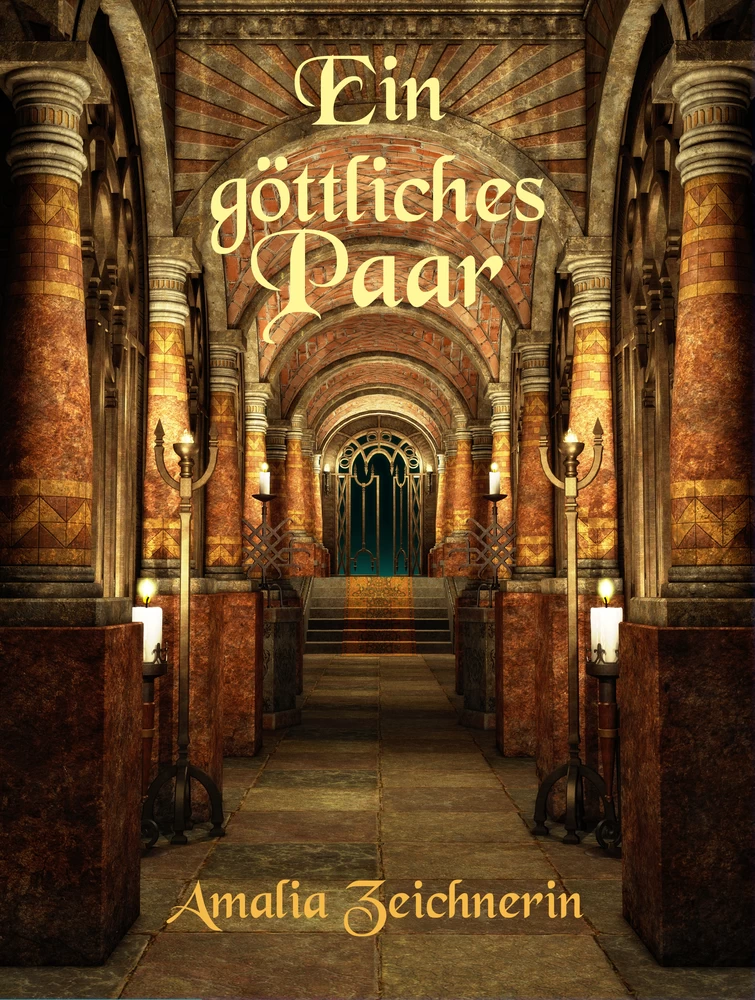Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Table of Contents
Ein göttliches Paar
© Amalia Zeichnerin 2020
Inhaltswarnungen zu diesem Roman
Andeutungen von Queerfeindlichkeit in Bezug auf eine
genderqueere, intergeschlechtliche Person, explizite Sexszenen

Kapitel 1
Der Regen prasselte auf die dampfende Erde, von der Schwüle des Tages war an diesem Abend nichts mehr übrig geblieben. Schlagartig wurde die Straße von einem grellen Blitz erhellt und nur wenige Augenblicke später hämmerte Deons Donnerhall durch die Luft. Eines der Pferde wieherte panisch. Verzweifelt umklammerte Tarys die rutschigen Zügel. Wagen und Kutschbock waren zwar überdacht, doch durch den stürmischen Wind prasselte der Regen seitlich auf ihn ein. Hoffentlich war der furchteinflößende Gott ihm gnädig und würde seinen nächsten Blitz nicht in den Wagen schleudern! Das Gefährt geriet durch das panische Tempo der Pferde ins Schlingern.
„Ruhig”, versuchte Tarys die Tiere zu beruhigen, doch es half nichts, sie flohen vor dem Gewitter, die Landstraße entlang, die von dem dichten Wald gesäumt war. Tarys zerrte an den Zügeln, um ihre Geschwindigkeit zu drosseln, doch sie preschten einfach weiter vorwärts.
Im nächsten Moment fuhr ein Poltern durch die Unterseite des Wagens; selbst durch das Getöse von Wind und Regen hörte Tarys ein lautes Knacken und das kreischende Geräusch der Holzräder, die mit Metall beschlagen waren.
Der Wagen schlitterte ein Stück weit quer über die Straße, Tarys wurde auf seinem Sitz herumgeworfen und fiel fast herunter. Sein Herz raste. Endlich kam das Gefährt zum Stehen, zwang auch die Tiere zum Anhalten. Die braune Stute wieherte erneut und beide Pferde scharrten mit den Hufen.
Tarys sprang vom Kutschbock. Es dauerte nur wenige Augenblicke, bis er völlig vom Regen durchnässt war. Das Unheil, das ihn ereilt hatte, zeigte sich, als er die Achsen des Wagens in der Dunkelheit betastete. Die vordere war entzwei gebrochen. Bei den Göttern…
Beruhigend strich er der durchnässten Stute über die Mähne. „Ruhig, ruhig … ist ja gut”. Sie schnaubte. Die beiden armen Tiere waren völlig durcheinander. Und er selbst auch.
Tarys schaute auf die Straße hinter dem Wagen. Ein weiterer Blitz machte die Umgebung taghell und er sah den kleinen Felsen am Wegrand. In der Dunkelheit, die durch die schweren Gewitterwolken entstanden war, musste er ihn übersehen haben. Sein Vater würde toben und fluchen, wenn er von dem Schaden erfuhr. Und wie sollte Tarys die Tuchwaren aus der Weberei nun in das Handelshaus seiner Familie schaffen?
Bis nach Serdicia waren es mit Sicherheit noch zehn Meilen oder mehr. Wenn er ritt, war er in etwa drei Stunden zu Hause. Aber dieses Wetter war zu gefährlich. Außerdem würde er sich den Tod holen, wenn er stundenlang in dieser Nässe und Kälte unterwegs war; auch den Pferden würde es schaden.
Nachdenklich betrachtete er die dunklen Bäume. Vorhin hatte die Straße einen Weg gekreuzt, der in den Wald führte. Vom Hörensagen aus einer Taverne wusste er, dass es irgendwo dort einen Tempel des göttlichen Paares gab. Diese beiden Gottheiten hießen Amandor und Psiderin. Im Tempel lebte und arbeitete zum einen deren Priesterschaft, zum anderen feierten die Gläubigen Zeremonien und Feste in jenen heiligen Hallen.
Er selbst hatte mit dem göttlichen Paar nichts zu schaffen, denn seine Familie diente schon seit Generationen traditionellerweise dem Gott des Handels. Aber vielleicht konnte er diesen Tempel finden und um Zuflucht für die Nacht bitten? Sicherlich gab es dort auch einen Stall, dann könnte er die Pferde trocken reiben und unterstellen. Morgen, wenn sich das Gewitter verzogen hatte, würde er in die Stadt reiten und sich von seinem Vater eine Standpauke gefallen lassen.
Der Alte war schon immer streng gewesen. Tarys war ihm als Kind zu „weich” erschienen, damals hatte er all das aus ihm mit einem Stock herausgeprügelt, wieder und wieder. Er hatte ihm das Spielen mit den Mädchen aus der Nachbarschaft verboten. Unnachgiebig und hart war sein Vater gewesen, viel härter als gegenüber seinem älteren Bruder, der als Kind ein Wildfang gewesen war. Verdammt, diese Angst von damals saß ihm heute noch manchmal in Nacken, wenn er seinen Vater ansah.
Tarys verscheuchte die hässlichen Gedanken und warf einen Blick in den Wagen. Die Kisten und Taschen waren trocken geblieben, das Dach schien also weiterhin wasserdicht. Allerdings war der Wagen so vollgestellt, dass Tarys den kurzen Gedanken wieder aufgab, darin zu übernachten. Er würde sich nicht einmal ansatzweise ausstrecken können und es kam nicht in Frage, das kostbare Gut dem Regen preiszugeben. Auch war der Wagen zu tief, um etwas darunter zu stellen.
Tarys schickte ein Stoßgebet zu Mercantirsis, dass der Wagen nicht bis zum nächsten Tag geplündert wurde. Aber bei einem solchem Wetter wagten sich gewiss nicht mal Räuberbanden ins Freie. Wenn er noch vor dem Morgengrauen wieder aufbrach, würde gewiss alles gutgehen. Aber so ganz wollte er es lieber nicht drauf ankommen lassen, deshalb nahm er die Beutel mit den teuersten Stoffen aus dem Wagen. Eines der Pferde würde als Packpferd dienen müssen, dann würde es gehen. Er spannte die Pferde aus, und belud das kräftigere der beiden Tiere mit den breiten Stoffbeuteln. Sie würden durchnässen, aber das ließ sich nicht ändern. Daheim würde er die Stoffe aufhängen und trocknen können.
Die Tasche mit dem Geld verstaute Tarys in einer der Satteltaschen und schwang sich auf die braune Stute. Dann ritt er an das andere Pferd heran und griff nach dessen Zügeln, so dass er es daran mit sich führen konnte.
Das Blätterdach des Waldes schützte ein wenig vor dem Regen, aber das half Tarys nicht viel, weil er ohnehin schon völlig durchnässt war. Außerdem war es hier so dunkel, dass er Schwierigkeiten hatte, dem breiten Pfad zu folgen. Aber immerhin dienten ihm die schwarzen Silhouetten der Bäume halbwegs als Anhaltspunkt. Seine Tunika klebte ihm eisig kalt am Leib. Tarys spürte die Wärme des Pferdes an seinen Beinen, aber das war nur ein schwacher Trost.
Wieder krachte Donnerhall tosend durch den Wald und das zweite Pferd schnaubte, riss sich aber glücklicherweise nicht aus seinem Griff los.
Er zitterte vor Kälte, während er weiterritt. Endlich sah er Licht in der Ferne, das diffus durch den Regenschleier drang. Mittlerweile war er so durchgefroren, dass es ihm völlig gleichgültig war, ob da vorn eine kleine Hütte, ein Tempel oder ein Palast zu finden war.
Ein weiterer Blitz aus der Hand Deons beleuchtete ein breites Gebäude auf der Lichtung, die sich vor ihm auftat, mit einem Giebeldach und Säulen vor dem Eingang. Aus mehreren Fenstern schien Licht, doch falls auch Geräusche herausdrangen, so wurden sie vom Regen und fernen Donner verschluckt. Das musste jener Tempel sein.
Tarys ritt direkt bis vor die breite Treppe am Eingang, kletterte schwerfällig vom Pferd und befestigte die Zügel der beiden an einem Baum in der Nähe des Eingangs. Danach stieg er die wenigen Stufen hinauf und trat zwischen den hohen Säulen hindurch. Am Tor pochte er gegen das massive Holz.
Er musste eine Weile warten, dann öffnete ihm eine junge Frau, deren lockiges Haar ihr bis auf die Hüfte fiel.
„Bei Amandors Liebe!”, rief sie aus. „Ihr seid ja völlig durchnässt. Kommt herein. Ihr seid spät dran.”
„Verzeiht, ich verstehe nicht ganz. Was meint Ihr mit spät? Mein Wagen ist auf der Landstraße liegen geblieben und ich wollte um ein Obdach für die Nacht bitten, damit ich nicht im Gewitter heimreiten muss. Und wenn es möglich ist, würde ich meine Pferde und einige Beutel gern in eurem Stall unterbringen, falls Ihr einen habt.”
„Oh. Ich dachte, ihr seid einer der Gäste auf unserer heutigen Feier. Aber wenn das so ist … ja, wir haben einen Stall. Wartet bitte kurz hier. Ich meine, kommt herein. Ich werde unsere Hohepriesterin fragen. Ich bin gleich wieder da.”
Ohne auf eine Antwort von ihm zu warten, drehte sie sich um und durchquerte die kleine Eingangshalle, die von mehreren Fackeln beleuchtet wurde. Aus dem Tempel drangen leise Musik und Gesang. Tarys fuhr sich über die nasse Stirn. Das hatte ihm gerade noch gefehlt, in eine Feierlichkeit hereinzuplatzen, zu der er gar nicht eingeladen war!
Tarys setzte sich auf eine kleine hölzerne Bank, die in der Nähe des Eingangstores stand. Die Nässe und Kälte kroch über seinen ganzen Körper.
„Darf ich bekannt machen?”, hörte er plötzlich die Stimme der jungen Frau. Tarys sprang von der Bank auf. Sie stand auf der Torschwelle. „Das hier ist Gilia, unsere Hohepriesterin. Und mein Name ist Sydia.”
Überrascht musterte er die Hohepriesterin. Es war eine Pumilia, wie sich die Kleinwüchsigen selbst nannten.
Tarys besann sich auf seine gute Erziehung und deutete eine Verbeugung an. Dabei stellte er sich ebenfalls vor.
Die Hohepriesterin hatte glänzendes honigblondes Haar, das sie zu einer kunstvollen Frisur aufgesteckt hatte. Sie trug ein lavendelfarbenes, fließendes Gewand, das ihre üppigen Rundungen sanft umschmeichelte und an den Säumen mit zarten weißen Fäden bestickt war. An ihren Handgelenken klingelten dünne, silberne Armreifen.
„Sydia hat mir von eurer Notlage erzählt, Tarys. Natürlich könnt ihr eure Pferde in unserem Stall unterstellen und dort versorgen. Es dürfte allerdings etwas eng sein, da wir hier eine Feier haben und zahlreiche Gäste, von denen mehrere mit Pferden oder mit Wagen angereist sind. Die Gefährte stehen alle hinter dem Tempel. Deshalb haben wir auch keine Gästezimmer frei. Aber ich werde mit den Priestern sprechen. Sicherlich ist in einem der Zimmer noch etwas Platz für ein Feldbett, wenn es euch nichts ausmacht. Und dann sage ich dem Tempeldiener Bescheid, er wird euch euer Quartier zeigen.”
„Danke, das ist sehr freundlich von euch. Wie kann ich mich dafür erkenntlich zeigen?”
„Wir freuen uns über eine Spende”, sagte sie mit einem Lächeln. „Ihr seid nicht zufällig ein Anhänger des göttlichen Paares?”
Er hob entschuldigend eine Hand. „Meine Familie huldigt eher Mercantirsis, dem Gott des Handels.”
„Nach Eurer Familie habe ich nicht gefragt”, erwiderte sie, ohne dass ihr Lächeln verschwand. Sie wandte sich an die andere Frau. „Sydia, würdest du den Tempeldiener bitten, für unseren Gast frische Kleidung leihweise herauszusuchen? Und wie steht es mit Hunger und Durst?”
Tarys bedankte sich ein weiteres Mal.
Die Pumilia nickte ihm zu. „Wenn Ihr mögt, schließt euch danach gern unserer Feier an. Auch wenn Ihr kein Anhänger des göttlichen Paares seid – vielleicht wird es … euren Horizont erweitern.”
„Ich werde es mir überlegen”, versprach er.
„Sehr gut. Ich möchte euch auch keineswegs dazu drängen, es ist nur ein Angebot. Sydia, bring ihn bitte zum Speisesaal.”
„Ich würde mich gern erst um die Pferde kümmern.”
„Ach ja, natürlich. Der Stall ist offen. Und nun entschuldigt mich, die Feier und ihre Aufgaben rufen.”
„Selbstredend. Habt Dank.”
„Ich helfe euch gern mit den Pferden”, sagte Sydia.
Das war nicht nur so daher gesagt, die junge Frau rieb im Stall die braune Stute trocken, nachdem sie ihr das Zaumzeug abgenommen hatte. Tarys kümmerte sich um das andere Pferd, rieb es gründlich trocken. Die Beutel mit den wertvollen Stoffen stellte er auf Sydias Geheiß hin in einer Ecke im hinteren Bereich des Stalls ab.
„Macht euch keine Sorgen, hier kommt nichts weg, was unsere Gäste mitbringen”, erklärte sie. „Dafür verbürge ich mich.”
Tarys nickte ihr zu. Er warf einen letzten Blick auf die Beutel. Sie waren aus grobem Leinen und verrieten nicht ihren teuren Inhalt. Hoffentlich würde Mercantirsis über sie in der Nacht wachen, wie auch über den kaputten Wagen.
Mehrere Pferde standen im Stall; leises Schnauben und das Knistern von Stroh erfüllten den Raum.
Tarys bedankte sich bei Sydia und lief mit ihr durch den Regen zurück zum Tempel. Kurz darauf saß er in einem kleinen Speisesaal, in dem sie zwei Fackeln entzündete, die in Haltern an der Wand hingen. Danach entschuldigte sie sich bei ihm, da auch sie zur Feier zurückkehren wollte.
Der Tempeldiener, den die Hohepriesterin erwähnt hatte, war schon älter und ging ein wenig gebückt. Doch er hatte klare, freundliche Augen. Er brachte Tarys eine knielange Tunika und auch einen Schurz, den er sich um die Hüfte wickeln konnte. Der Ältere zeigte ihm eine Kammer, in der allerhand Gerätschaften gelagert wurden. „Hier könnt ihr Euch ungestört umziehen. Die nasse Kleidung werde ich für Euch aufhängen.”
Tarys bedankte sich und zog sich rasch um. Was für eine Wohltat, sich den nasskalten Stoff von der Haut zu streifen und ihn durch warme, trockene Kleidung ersetzen zu können! Er hatte nicht mit so viel Entgegenkommen gerechnet, zumal er kein Anhänger des göttlichen Paares war. Andererseits: Die Einwohner von Ithyrios legten viel Wert auf Gastfreundschaft. Tarys war selten so froh über diese Sitte gewesen wie an diesem scheußlichen Abend.
Der Tempeldiener servierte ihm eine kalte Mahlzeit aus kräftigem Brot, einem aromatischen Käse, einer handvoll Oliven und Trauben, sowie einem fruchtigen Gewürzwein, der ihn durch eine leichte Schärfe innerlich wärmte. Die Mahlzeit mundete ihm köstlich nach all diesen Strapazen. Tarys bedankte sich bei dem Diener.
„Ihr könnt bei einem der Priester im Zimmer schlafen. Ich habe dort ein Feldbett hingestellt. Wisst ihr, wie man die aufbaut?”
Tarys nickte.
„Gut, dann zeige ich euch das Zimmer.”
Der Diener entzündete das Licht einer Laterne und führte Tarys quer durch den Tempel. Der Korridor war geschmückt mit Mosaiken und bemalten Säulen, zwischen ihnen marmorne Bögen. Angesichts der schwachen Beleuchtung durch einzelne Fackeln in Wandhaltern und flackernden Kerzen in hohen Bronzeständern konnte Tarys allerdings keine Einzelheiten erkennen.
Der Tempeldiener öffnete eine Tür. Im Licht der Laterne war ein nicht allzu großer Raum zu sehen, der schlicht eingerichtet war: Ein Stuhl, ein kleiner Tisch, ein Bett und ein schmaler Schrank. Neben dem Stuhl lag das Feldbett, eine Konstruktion aus Holz und einer Tragefläche aus einem sehr festen Stoff.
Tarys bedankte sich bei dem älteren Mann, der ihn noch auf eine Decke hinwies, die auf dem Stuhl bereitlag. Danach zog er sich zurück. Er baute das Feldbett auf und setzte sich probehalber darauf. Es wirkte stabil. Danach zog Tarys sich die Sandalen und die Tunika aus, so dass er nur noch den Schurz um die Hüften trug. Eine Erinnerung der gerade durchgestandenen Kälte kroch ihm wieder über den Leib. Ob er sich doch wieder die Tunika anziehen sollte?
Er griff nach der Decke, die aus Wolle gewebt war. Ja, die würde ihn in der Nacht gewiss gut wärmen, also verzichtete er darauf, sich wieder anzukleiden. Er legte sich auf das Feldbett und breitete die Decke über sich aus.
Ein Zittern lief durch seinen Körper, als die Anspannung der vergangenen Stunden nachließ. Er fürchtete sich schon jetzt davor, morgen seinem Vater gegenüberzustehen. Aber wie hätte er anders handeln können, angesichts der Umstände? Hoffentlich hatte sein Vater ein Einsehen. Mit dem Wagen eines Nachbarn würde es sicherlich kein Problem sein, die Waren aus dem kaputten Gefährt zu bergen.
Tarys wälzte sich in dem ungewohnten Feldbett hin und her, während er darüber nachsann. Nein, an Schlaf war vorerst nicht zu denken. Er war viel zu aufgewühlt. Vielleicht wäre eine Ablenkung gut, um auf andere Gedanken zu kommen. Sollte er sich doch der Feier anschließen? Wie hatte die Hohepriesterin es genannt? Vielleicht eine Erweiterung seines Horizonts … das klang verheißungsvoll. In seinem Leben, in dem alltäglichen Trott im Handelshaus der Familie, da gab es nicht viel, das seinen Horizont erweitert hätte. Er hungerte nach neuen Erfahrungen.
Einen Moment zögerte er noch, dann kletterte er aus dem Bett und zog sich wieder an. Sobald Tarys die Tür öffnete, hörte er wieder die leise Musik. Der Gesang war mittlerweile nicht mehr zu hören. Aber gewiss brauchte er nur den Klängen der Mandoline und der Harfe zu folgen und würde den Festsaal finden.
Als er eine Nische im Korridor passierte, schrak er zusammen angesichts eines Paares, das sich dort umarmte. Dann lachte er erleichtert auf, denn das schwache Licht hatte seinen Augen einen Streich gespielt – es war eine Statue in Lebensgröße. Sicherlich waren es die Gottheiten Amador und Psiderin. Neugierig betrachtete er die marmorne Statue näher, auch wenn das im Zwielicht nicht einfach war. Die beiden wirkten merkwürdig geschlechtslos – es war nicht zu erkennen, ob sie Mann, Frau oder von einem anderen Geschlecht waren. Vermutlich war das so beabsichtigt? Er streckte die Hand aus, wollte über den Marmor streichen, hielt dann aber inne. Es gehörte sich nicht, einfach die Statuen von Gottheiten zu berühren. Und das galt mit Sicherheit auch für das göttliche Paar.
Tarys ging weiter, bis er schließlich vor einer massiven, zweiflügeligen Tür stand, die von einigen Fackeln an der Wand beleuchtet wurde. In das Holz waren kunstvolle Muster geschnitzt, sowie weitere Abbildungen von Menschen und dem göttlichen Paar. Ein Meisterwerk der Tischlerkunst. Einen Moment lang fuhr er mit den Finger andächtig über die filigranen Erhebungen und Vertiefungen der Muster. Aber er war nicht hier, um eine Tür zu bewundern. Tarys griff nach den Knauf des linken Flügels und zog ihn einen Spaltbreit auf, weit genug, dass er den gesamten Raum dahinter überblickte konnte.
Tarys stockte der Atem, als er den von Fackeln und Kerzen hellerleuchteten Festsaal durch den Türspalt erblickte. Doch es waren nicht die kostbaren Wandteppiche, der von einem eleganten Mosaik durchzogene Marmorboden und eine weitere Statue des göttlichen Paares in der Mitte, die seinen Blick fesselten. Auch die zarten Harfenklänge und die Reliefbilder an den Wänden nahmen ihn nicht gefangen.
Es waren die Menschen und anderen Wesen, die hier versammelt waren. Elfen mit spitzen Ohren, weitere Kleinwüchsige, blasse Vitrusier – Einwanderer aus dem Norden – bis hin zu Leuten mit dunkleren Hautfarben, ähnlich der seinen. Alle möglichen Völker schienen hier zu sein. Weder saßen die Gäste in diesem Saal, um zu speisen oder eine Andacht zu zelebrieren, noch wurde getanzt.
Stattdessen sah er halbnackte oder völlig nackte, ineinander verschlungene Leiber, die alle der Sinnlichkeit huldigten, auf bunten, weichen Kissen, Matten und Decken.
Der Saal war zudem mit langen Girlanden aus Frühlingsblumen geschmückt, die einen angenehmen Duft verströmten. Ein würziges Räucherwerk betörte seine Sinne; Glut brannte in einer Feuerschale, vermutlich befanden sich darin Harze und Kräuter, die beim Brennen ätherische Öle absonderten. Zahlreiche Kerzen brannten nebeneinander in hohen Haltern, die auf dem Boden standen und dekorativ verschnörkelt waren.
Das erinnerte ihn an Besuche in einem Freudenhaus in Serdicia, allerdings war das viel weniger prächtig eingerichtet und dort hatte er auch keine solche Fülle an Leuten gesehen. Manche von ihnen waren noch leicht bekleidet. Die Luft war erfüllt von dem schwachen Geruch nach duftenden Essenzen und Weihrauch, von Schweiß und den Ausdünstungen der Lust, aber auch von dem Stöhnen der Anwesenden.
Einen Moment lang sank Tarys das Herz und am liebsten hätte er einfach die Tür wieder leise geschlossen und sich wieder in das Schlafgemach zurückgezogen. Doch dann riskierte er einen zweiten Blick, auf die Gefahr hin, dass ihn jemand hinauswerfen würde – ihn, den Fremden, der nicht eingeladen war, der kein Anhänger des göttlichen Paares war.
Die Gäste hatten sich mit ihren Sinnesfreuden nicht nur paarweise zusammengefunden. Manche bildeten kleine Gruppen von drei, vier oder sogar noch mehr Wesen, die sich alle gegenseitig auf die eine oder andere Weise befriedigten.
Die Paare bestanden bei weitem nicht nur aus Männern und Frauen. Er sah Frauen, die einander Lust schenkten und auch Männern, die dies mit anderen Männern taten. Dazwischen war auch ein Mensch mit Brüsten und einem Penis, der einen Elf liebkoste. Tarys starrte die beiden an und schämte sich im nächsten Moment dafür.
Solch einen Mensch hatte er noch nie gesehen, auch wenn er von ihnen gehört hatte: die Semilx. Menschen und andere Wesen, deren Körper, Geister und Seelen die üblichen Geschlechterzuordnungen von „Mann” und „Frau” sprengten. Manche von ihnen verwendeten auch andere Pronomen als „er” oder „sie”.
Einzelne Leute hielten sich allein etwas abseits, beobachteten die anderen. Eine Frau mit schwarzen Locken saß neben zwei Männern, die sich auf einer Matte aneinanderschmiegten und sich leidenschaftlich küssten. Sie war an dem Liebesspiel der beiden Männer unbeteiligt. Allerdings bewegte sie ihre Hand in ihrem nur noch halb von ihrem Gewand bedeckten Schritt und gab ein Stöhnen von sich, während sie ihnen zusah.
Am oberen Ende des Saales waren einige Musiker versammelt, die auf einer Harfe, einer Mandoline und einer Flöte leise, verträumt klingenden Weisen spielten.
Der Anblick dieser leidenschaftlichen Menschen und anderen Wesen ging nicht spurlos an Tarys vorüber. Ihr Anblick und die Laute der Lust, die sie von sich gaben, all das erregte ihn. Ihm wurde immer wärmer, viel zu warm, dazu auch noch eine aufkeimende Erektion. Es war, als ob seine Lenden Feuer fingen. Peinlich berührt verbarg er sein Geschlecht hinter einer Hand.
Oh bei den Göttern, diese Menschen, wie schön sie waren. Natürlich glich keiner von ihnen den wunderbaren, athletischen Statuen in Serdicia. Das waren Idealbilder, absichtlich geschönt von den Kunstschaffenden, um als Vorbilder zu dienen, um den Gottheiten und deren Perfektion zu huldigen, oder um sportliche Idole zu feiern.
Die Leute hier waren weit von solcher Perfektion entfernt; manche von ihnen erschienen etwas dürr, andere rundlich. Ein Mann hatte die Gestalt eines Bären, mit einem dicken Bauch. Auch kräftige, sehnige und muskulöse Leute vergnügten sich mit anderen.
Über dem Ganzen lag bei all der Leidenschaft eine seltsame Ruhe. Eine Art Frieden. Tarys wunderte sich darüber, bis er eine Ahnung hatte, woran es liegen mochte. Niemand hatte es eilig, niemand schien seinem Liebesgefährten etwas beweisen zu wollen. Hier schien es nicht um eine schnelle, animalische Befriedigung der Triebe zu gehen. Selbst die rhythmischen Bewegungen in diesen Akten der Liebe wirkten eher ruhig und langsam, eher forschend als erobernd.
Gar kein Vergleich zu dem Freudenhaus, das er zwei, drei Mal heimlich in Serdicia besucht hatte, um sich dort zu vergnügen. Die Liebesdiener hatten auf ihn einen routinierten, aber gelangweilten Eindruck gemacht.
Tarys war erst vor zwei Jahren volljährig geworden. Ihm war bewusst, dass er kein schöner Mann war. Sein Gesicht war nicht symmetrisch, zu länglich, auch die Nase war zu groß und seine Augen standen ein bisschen zu weit auseinander. Außerdem war eines seiner Knie leicht verdreht, weswegen er ein wenig hinkte, ein Geburtsfehler.
Aber war das ein Grund für die Liebesdiener, nach einem routiniert abgespulten Programm, einem schnellen Akt ohne das kleinste bisschen Zärtlichkeit mit mürrischer Miene ihr Geld zu fordern? Nach drei Besuchen in jenem Haus war er nie wieder hingegangen, auch wenn ihn der Hunger nach dem Körper eines Mannes so manche Nacht um den Schlaf gebracht hatte. Er hatte auch Erfahrungen mit einer Liebesdienerin gemacht, aber oft fühlte er sich eher zu Männern hingezogen.
Seiner Familie konnte er von Letzterem nichts erzählen. Sein Vater war sehr konservativ, sehr traditionell. In anderen Familien wurde es geduldet, wenn eine Tochter oder ein Sohn sich eine Weile mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann vergnügte. Wie es mit den Semilx war, das wusste er nicht, er kannte keine. Gleichgeschlechtliche Beziehungen wurden überall in Ithyrios toleriert, zumindest bis die Betreffenden schließlich heirateten und eine eigene Familie gründeten. Doch sein Vater hatte von Anfang an klar gemacht, dass er in seinem Haus keinen Sohn duldete, der sich mit einem Mann einließ.
Als Tarys noch halbwüchsig gewesen war, hatte er sich einige Male heimlich mit einem Freund getroffen, der in der Nachbarschaft lebte. Anfangs waren sie nur Freunde gewesen, doch später hatten sie sich ineinander verliebt. Sie hatten auch sinnliche Freuden miteinander geteilt, doch es hatte sich immer heimlich abspielen müssen. An verlassenen Orten in der Stadt, immer mit der Angst, entdeckt zu werden.
Ihre Treffen und ihre Liebe endete, als sein Freund sich verlobte. Tarys war so in Gedanken versunken, dass er zusammenschrak, als die Hohepriesterin ihn ansprach.
Sie blickte durch den Spalt der Tür zu ihm hoch und lächelte ihn an. Im Gegensatz zu den meisten der Anwesenden war sie vollständig bekleidet.
„Möchtet Ihr auf mein Angebot zurückkommen und Euch unserer Feier anschließen? Wie Ihr seht, ist hier jede Form der Liebe und Sinnlichkeit willkommen. Und wenn es Euch widerstrebt, braucht Ihr Euch nicht aktiv zu beteiligen. Einige ziehen es vor, anderen zuzusehen und sich dabei selbst zu berühren, oder gar nichts weiter zu tun. Wir alle huldigen hiermit dem göttlichen Paar, denn Amandor und Psiderin sind die Gottheiten der Liebe … und der sinnlichen Freuden.”
Sie sagte das alles mit gelassener Miene, die Geräusche hinter ihnen im Saal brachten sie nicht aus der Ruhe.
„Aber … werde ich denn nicht stören?”, fragte er.
„Warum, weil ihr ein Fremder seid?” Sie lachte leise. „Glaubt mir, Ihr seid uns willkommen.”
Drei teilweise widerstreitende Empfindungen rangen in seiner Brust miteinander. Erregung, Angst und Neugier.
Aber da war auch das sanfte Lächeln der Hohepriesterin und die einladende Geste, die sie nun machte.
Was habe ich schon zu verlieren?
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783739497679
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (August)
- Schlagworte
- queer lgbtq spiritualität genderqueer intersexuell romantasy Romance Fantasy