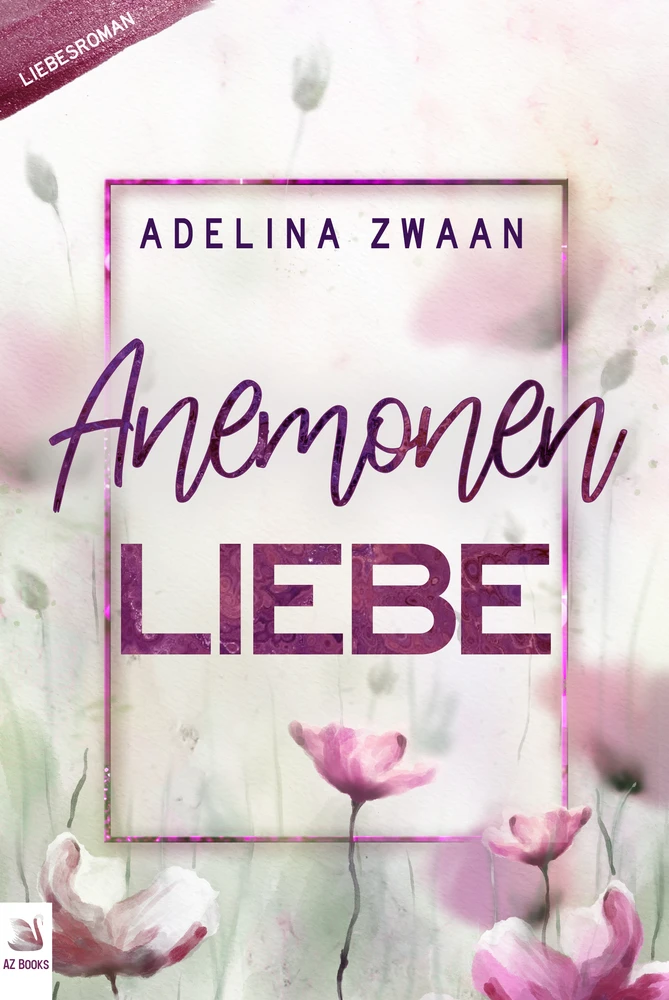Zusammenfassung
Neuer Job, ländliche Idylle und eine neue Liebe?
Amelie winkt eine Versetzung nach München, die ihr gar nicht gefällt, und ihr Ex-Freund nervt zunehmend mit Anrufen. Kurzerhand entschließt sie sich zu einem radikalen Schnitt. Sie arbeitet und lebt für zwei Monate in einer Staudengärtnerei.
Ohne Probleme arbeitet sie sich in die Herzen ihrer Familie. Nur nicht in das ihres Chefs, der weder von ihrer Qualifikation noch von ihrem Charakter überzeugt ist. Amelie spürt, dass mehr dahinter steckt als Ablehnung und kommt einem tragischen Familienschicksal auf die Spur.
Die mitreißende Feelgood-Romance »Anemonen Liebe« von Adelina Zwaan jetzt als eBook bei AZ Books. Wer diesen Roman liest, hat mehr vom Sommerurlaub: AZ Books.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Weitere Erscheinungen & Leseproben
Auszeit Muffins - So tun als ob, ist auch verliebt
Adelina Zwaan
Anemomen
LIEBE

Copyright © 2023 AZ Books
Vertreten durch AZ Books – Leipzig
c/o K. Förster Rosenweg 52 04209 Leipzig
kontakt@az-books.de Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden. Verwendung oder Verbreitung durch unautorisierte Dritte in allen gedruckten, audiovisuellen und akustischen Medien ist untersagt. Die Textrechte verbleiben beim Autor, dessen Einverständnis zu dieser Veröffentlichung vorliegt. Für Satz- und Druckfehler keine Haftung.
@autorin_adelinazwaan
Musik zum Buch
Eine lieb gewordene Tradition ist die Freigabe der Musikliste zum Buch (Spotify), auf der alle Titel gelistet sind, die mich bei diesem Projekt inspiriert haben. Ich wünsche viel Freude mit einer Stunde, dreizehn Minuten purem Musikgenuss für das besondere Roman-Feeling.
Spotify-User: AZ Books
Playlist: Buch – Anemonen Liebe
Speak Easy von Mansionair
Who’s There von Peter Sandberg
Hell To The Liars) von London Grammar
Where’s My Love von SYML
Holland von Novo Amor
One Day von Kodaline
From Gold von Novo Amor
Waves von Canyon City
Saturn (Instrumental) von Sleeping At Last
DNA von Lia Marie Johnson
Unbreakable von Jamie Scott
Sieben Milliarden von Soolo
Refuge (Outro) von Canyon City
Wild Roses von Of Monsters and Man
Crazy – Alex Cruz
Wrecked von Natalie Taylor
Tomorrow Will Be Gone von Axel Flóvent
Give Me You von Jon Guerra, Andrew Belle
Dein Lied von Laith Al-Deen
Vita
Anna Conradi (Pseudonym), 1971 in der Hansestadt Wismar geboren, lebt nach unzähligen Stationen im In- und Ausland heute in Leipzig. Seit Kindertagen von Büchern und dem Theater fasziniert, entdeckte sie ihr Herz für Liebesromane. In ihren bildgewaltigen Romanen gewährt sie einen tiefen Einblick in die innere Zerrissenheit ihrer meist bindungsunfähigen, aber charakterstarken Protagonisten.
Schreibt sie nicht, arbeitet sie bei einem kommunalen Energieversorger oder gestaltet einzigartige Grußkarten.
Widmung
Immer dachte ich, dass Amor mich übersehen hat, vielleicht sogar vergessen. Heute Nacht hat er mit seinem Pfeil voll in die einhundert getroffen. Eben in die eintausend. Alle erwarten von der Liebe, dass sie fanfarenartiges Getöse macht. Tut sie aber nicht. Sie ist ein sehr stilles Wesen, das sich nur in jedem selbst offenbart.
Leise, unscheinbar und doch gewaltig.
Adelina Zwaan
Kapitel 1

Erschöpft drehe ich den Schlüssel im Schloss der Wohnungstür, und sie öffnet sich lautlos. Ein Seufzer entweicht mir, sobald ich endlich die Schwelle meiner Wohnung übertrete. Die Tür fällt ins Schloss und ich lehne mich von innen dagegen, als wäre sie ein Schutzwall, der mich vor der Außenwelt schützt. Erleichtert sacke ich zusammen, schließe die Augen und verbanne die Welt mit einem Wimpernschlag aus meinem Bewusstsein.
Endlich zu Hause. Endlich wieder in meiner Wohngemeinschaft, einem bizarren Dreiergestirn aus einem frustrierten, dem Leben enttäuschten Scheidungsopfer, einem Freigeist, der die Welt bereist, und mir, die zwischen den Welten wandelt. Wir drei sind ein kurioses Zusammentreffen von gebrochenen Seelen und verlorenen Träumen.
Kraftlos streife ich mir die schwarzen Lackpumps von den schmerzenden Füßen. Mit einem befreienden Krachen landen sie in der Ecke. Ich fühle mich erleichtert, wenn ich die Last dieser Schuhe abstreifen und meine Fußsohlen auf dem kühlen Parkett spüren kann. Welch ein Moment der puren Wohltat, wie die Enge weicht und meine müden Glieder sich der Freiheit hingeben.
Behutsam strecke und recke ich meine Zehen. Sie sollen begreifen, dass sie nicht länger in ihrem unbequemen Gefängnis eingesperrt sind. Doch das Leben kehrt nur zögerlich zurück, als hätten meine Füße Angst vor der Realität.
Die Schuhe, die ich auf der Arbeit trage, quälen mich. Ich weiß, dass mein Unbehagen nicht allein an ihnen liegt, aber in diesem Moment nervt mich einfach alles. Diese Schuhe werden zum Symbol meines Scheiterns.
An irgendeiner Weggabelung bin ich falsch abgebogen. Seitdem zwinge ich meine Füße in unbequeme Pumps. Die eigentlich Schuldige für die verkorkste Situation bin ich. Meine Schuhe sind unschuldige Zeugen meiner persönlichen Irrfahrt.
Zweifel haben sich in mir breitgemacht, nicht in Form eines dramatischen Gewitters, sondern leise und unschuldig wie Schatten im Abendlicht. Ich beginne, mir Gedanken zu machen, wie ich bislang mein Leben gestaltet habe. Ehrlich gesagt, gibt es nicht viel Rühmliches zu berichten. Das Bild, das sich mir bietet, ist wie ein unfertiges Gemälde, dessen Konturen noch im Dunkel der Selbstreflexion verweilen.
Ich wohne in einer Wohngemeinschaft. Mit dreißig Jahren gleicht das eher einer ruhmlosen Karriere. Mein Arbeitgeber wirft die Idee einer Versetzung nach München in den Ring und dieser Vorschlag wirft mehr Fragen auf als mein Umfeld erahnen kann. Jedes Mal, wenn ich die Tür hinter mir schließe und nach Hause komme, brodelt es förmlich in meinem Kopf.
Gewiss, die Versetzung wäre auf meinem Lebenslauf ein glänzendes Juwel und würde sich positiv auf meinen Geldbeutel auswirken. Aber meine Familie lebt hier in Berlin, ein entscheidender Faktor gegen einen Umzug nach München. Die Entscheidung steht zwischen den Sternen und den Straßen Berlins, zwischen Karriereglanz und familiärer Geborgenheit.
Die Frage, die sich mir immer öfter stellt, lautet: Was erwarte ich von meinem Leben? Unweigerlich drängt sich mir die bittere Erkenntnis auf, dass ich es bisher in die falschen Bahnen gelenkt habe. Diese ungeschminkte Tatsache überkommt mich mit Wucht, wenn ich die Wohnungstür hinter mir schließe und meine Gedanken nicht mehr von dieser knallharten Realität ablenken kann. Hier, in meinem Zuhause, spüre ich am deutlichsten, dass meine Lebensrichtung dringend einen Kurswechsel braucht.
Niemand empfängt mich mit offenen Armen, nur eine erfrischende, kalte Dusche und mein behagliches Bett warten. Bald schon in einer Stadt, in der ich niemanden kenne und die mich Hunderte von Kilometern von meiner Familie trennt. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. So sieht vermutlich meine Zukunft aus.
Wie trostlos.
Abgekämpft schleppe ich mich ins Badezimmer und befreie mich von meinen Kleidern. Eine belebende Dusche ist dringend nötig. Das kühle Wasser gleitet über meine Haut und spült die unsichtbare Last fort, die sich im Laufe des Tages auf mich legt. Hier zu Hause brauche ich diese Barriere nicht.
Bei diesem vertrauten Ritual finde ich wieder zu mir selbst zurück. Jeden Tag nach der Arbeit träume ich davon, wie befreiend es wäre, wenn ein solches Ritual überflüssig wäre. Stattdessen verkommt die Dusche in letzter Zeit zur ›Hüllenabwaschzentrale‹.
Sowie ich den Wasserhahn öffne, ergießt sich das eiskalte Wasser in die Dusche. Ich tauche meinen Kopf unter den belebenden Strahl und warte, bis die Kälte ihren Zauber entfaltet, den pochenden Kopfschmerz betäubt. Erst dann drehe ich den Wasserhahn zu, bleibe aber unter dem Brausekopf stehen, lehne meinen müden, schweren Kopf gegen die angenehm kühlen Fliesen. Aus meinen Augen gleiten Tränen, so heiß wie Lava, denn der Schmerz verschlingt meine Sinne.
Gott, hilf mir, endlich eine Entscheidung zu treffen, murmele ich in Gedanken. Eine, die mich aus diesem endlosen Trott reißt. Eine, die diese quälenden Kopfschmerzen beendet. Was muss ich also tun, damit es bald bergauf geht? Sag mir, was?
Bedauerlicherweise bleibt eine Antwort auf meine Fragen aus. Ich wickle mich in das Badehandtuch und trete vor den Spiegel. Eine erschöpfte Frau mit geröteten Augen schaut mich an.
Die Stille des Badezimmers scheint meine stummen Rufe zu erwidern. In diesem Moment ist der Spiegel nicht nur ein Abbild meiner Äußerlichkeiten, sondern auch ein stummer Zeuge meiner inneren Schlachten. Ein Echo der Sehnsucht nach Veränderung, das im Raum hängt wie der Duft von frisch gefallenen Tränen.
Wenn ich schmerzfrei bin und mich vor Schmerz keine Heulattacken überkommen, strahlt meine Irisfarbe in ihrer ganzen Pracht. Grünbraun, wobei das Grün dominierend ist und beim Betrachter entweder Be- oder Unbehagen hervorruft. Mein leicht gelocktes, braunes Haar klebt an meinem Kopf. Das kalte Wasser rinnt in dünnen Fäden zum weißen Handtuch hinab, das mich angenehm wärmt. Ich bin nicht sonderlich angetan von meinem Anblick und wende mich gleichgültig ab.
In der Küche lasse ich Wasser in den Wasserkocher laufen. Ich schnappe mir einen meiner Lieblingskekse und erinnere mich daran, wie ich neulich meiner Mutter beim Backen zugesehen habe.
Die Keksbrösel knirschen zwischen meinen Zähnen, und der süße Geschmack der Erinnerung schmilzt auf meiner Zunge. Meine Mutter, mit ihren Händen, die Teig und Zutaten bändigen, hat immer eine Welt voller Wärme und Trost geschaffen. Jetzt, wo die Realität kalt und trostlos wirkt, werden die Erinnerungen an diese Küchentradition zu einem Lichtstrahl in meiner düsteren Welt.
Sie stand am Küchentisch der Wohngemeinschaft, mit einem vertrauten Lächeln auf den wohlgeformten Lippen. Um ihre sanft geschwungene Hüfte trug sie eine grüne Leinenschürze.
Meine Augenfarbe habe ich von ihr geerbt. Sie erinnern an einen üppigen Karamellbonbon. Ihr Blick offen und fröhlich, harmonierend mit den aufwärtsgebogenen Mundwinkeln. Ich schwöre, diese sind von ihrem anhaltenden Lächeln abgewandt. nach oben gebogen. Das sind sie eigentlich immer, seit ich denken kann. Ihre braunen, leicht ergrauten Haare hat sie in einem lockeren Zopf gewunden, der über die Schulter hängt.
In vielerlei Hinsicht ähnele ich ihr, und ich kann mir bildlich vorstellen, wie ich in ihrem Alter aussehen werde. Vermutlich leicht untersetzt, mit noch immer glatter Haut und einigen grauen Strähnen, die nicht nur für ein erlebtes, sondern auch erfülltes Leben stehen. Die Frage bleibt: Werde ich genauso glücklich und zufrieden strahlen wie sie?
Meine Mutter geht mit einer unvergleichlichen Hingabe an alles heran, was sie in die Hände nimmt. Als sie in unserer Küche stand, habe ich sie eine Weile betrachtet, mich dabei immer nachdenklicher gefühlt. Die Scherben meiner Beziehung musste ich gerade erst zusammenfegen, also wagte ich die Frage: »Was mache ich nur falsch?«
Mitten im Kneten des Teigs hielt sie inne und sah mich aus ihren bildhübschen, klaren Augen an. Das einfallende Licht brach sich in ihrer Iris und brachte sie zum Leuchten. Es sah aus, als wären ihre Augen ein grüner Bergsee. Diesen Schimmer fand ich fesselnd.
»Aber Liebes, du machst nichts falsch. Benno war der falsche Mann für dich. Der Rest ist in Ordnung und garantiert kein Grund, monatelang Trübsal zu blasen.«
Sie kam zu mir um den Tisch, auf dem der halbfertige Teig klebte. Mütterlich besorgt schloss sie mich in ihre Arme, hielt mich lange fest, küsste liebevoll meine Stirn und wiegte mich, als wäre ich zehn Jahre alt.
»Aber du und Papa …«
»Wir hatten Glück, weil wir uns früh im Leben begegnet sind.«
»Ich will auch einmal Glück haben und früh im Leben jemandem begegnen«, heulte ich aufgewühlt los, obwohl ich es eigentlich nicht schön finde, unaufhörlich wegen der Trennung zu flennen.
Ich fühlte mich wie eine elende Versagerin, die ein ödes, trostloses Leben im Hamsterrad lebt und von ihrem Arbeitgeber nach Belieben in die Fremde versetzt werden darf. Ein Kind meiner Zeit. Und unglücklich damit.
»Das wirst du«, tröstete sie mich und herzte liebevoll meine klatschnassen Wangen. »Höre einfach auf dein Herz, wenn die nächste Entscheidung ansteht. Dann findest du von allein, wonach du suchst, bleibe aber locker und verkrampfe dich nicht. In der Zwischenzeit genießt du meine Kekse. Die bringen auch Glück.«
Mir blieb nur, die Tränen hinaufzuschniefen. Über ihre kreative Interpretation des Glücksgefühls musste ich lächeln. Natürlich auch darüber, wie mühelos sie die viel zu enge Kurve hinbekam. Ihre liebevolle Art, mich aufzumuntern, funktioniert fast immer. Dazu braucht sie nicht einmal etwas Tiefschürfendes zu sagen. Ihre schlichten, kurzen Sätze treffen immer ins Schwarze und beruhigen mich.
Einen eingängigen Schlager summend tänzelte sie zu dem unfertigen Teig, um ihn weiter zu kneten. Bald schon war das Blech mit dem ausgestanzten Keksteig belegt. Das Lied pfeifend schob ich es kurz darauf in den vorgeheizten Backofen und wurde dabei genauestens aus dem Augenwinkel beobachtet.
Ein Keks, angeblich ein Glücksbringer, zerkrümelt gerade in meinem Mund. Ich beschließe, meine Mutter heute Abend anzurufen. Der Wasserkocher klackt und reißt mich aus meinen Tagträumen. Ich kaue den Keks und gieße den Tee auf.
Hm, er duftet ausgesprochen köstlich.
Nachdem der Tee durchgezogen ist, schlurfe ich schwerfällig in mein Zimmer. Auf dem Schreibtisch thront der Laptop, den ich regelmäßig nach Feierabend anschalte, um im Internet nach Jobangeboten zu suchen. Stellenportale gibt es wie Sand am Meer.
Ich setze mich, stelle die Tasse ab und massiere meine Finger. Wie an jedem Abend gebe ich verschiedene Suchbegriffe ein. Interessante Angebote landen in einem eigens dafür angelegten Verzeichnis. Dort tummeln sich auch einige ältere Anzeigen, die ich lösche.
Zur Abwechslung wähle ich heute irgendeine Nummer, anstatt die Arbeitsangebote nur abzuspeichern. Schließlich soll es nicht länger beim bloßen Sammeln von Stellenanzeigen bleiben. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt lautet eine Binsenweisheit.
Und da habe ich schon die Antwort auf die Frage, die ich mir vorhin unter der Dusche gestellt habe, selbst gefunden. Schließlich wird niemand etwas an meinem Leben ändern. Das kann nur ich. Also gilt es: Einmal kurz die Arschbacken zusammenzukneifen und einen Fuß vor den anderen zu setzen, bevor ich die Weichen stelle. Schön langsam und der Reihe nach. Dann klappt es hoffentlich in absehbarer Zeit mit einer schönen, besseren Zukunft.
Mein Handy klingelt.
Ich lehne mich in dem bequemen Drehstuhl zurück, die Teetasse in meiner Hand, weil ich gerade einen Schluck trinken wollte. Ich stelle sie nicht extra ab, schaue aber neugierig auf das Display, um zu erfahren, wer mich anruft.
Es ist Benno. Mein Ex-Freund.
Ich nehme einen großen Schluck und verspüre keine Eile, den Anruf entgegenzunehmen. So weit kommt es noch.
»Benno«, melde ich mich unhöflich, kurz angebunden und mit vollem Mund.
»Amelie, grüß dich«, trällert er.
Insgeheim stelle ich mir vor, wie er auf einer undefinierbaren, schleimigen Pampe ausrutscht. Seine gute Laune geht mir gewaltig auf den Sender.
»Was los?«, presse ich eine Spur unfreundlicher hervor, als nötig wäre.
»Ich wollte kurz nachfragen, wie es bei dir läuft«, antwortet er vorsichtig und auffallend unterwürfig.
Wir waren lange genug zusammen und er weiß haargenau, wie ich reagiere, wenn die Luft knapp wird. Vor Wochen hätte ich mich vielleicht gefreut, von ihm zu hören. Insgeheim hätte ich gehofft, er würde zu mir zurückkehren. Vor Liebeskummer am Boden zerstört, hätte ich beinahe alles getan, um dieses beschissene Gefühl endlich wieder loszuwerden. Albern, aber leider wahr. Zum Glück bin ich inzwischen über diese beschämende Stufe der Selbsterniedrigung hinweg und endlich auf dem Weg der Besserung.
»Miserabel. Ich brauche einen neuen Job und einmal guten Sex für meine Hormone«, murre ich ins Handy. »Willst du noch etwas wissen oder war es das?«
Ganz sicher hofft er nun, diesen Punkt mit einem gemeinsam verbrachten Schäferstündchen abzuhaken. Entsprechend geräuschvoll schluckt er am anderen Ende der Leitung, was unmissverständlich zu hören ist.
»Du wirkst gereizt«, erkennt der Blitzmerker und tönt dabei einen Hauch enttäuscht. Geht er etwa davon aus, dass ich vor Begeisterung platze, wenn er sich plötzlich täglich bei mir meldet und selten dämliche Sachen fragt?
»Na klar bin ich gereizt. Bei blöden Fragen reagiere ich nun einmal gereizt.«
»Na ja, ich frage, weil … was den Sex betrifft, könnte ich dir behilflich sein. Dann steigt deine Laune eventuell ein wenig.«
Wusste ich es doch. Ich könnte mich glattweg übergeben. So ein hormongesteuerter Trottel, dem ich vor kurzem noch so bedeutungslos war wie ein vergessener Traum.
»Du kannst es dir nicht vorstellen, wie sehr ich dich vermisse,« murmelt er und ich unterdrücke den Drang, laut zu lachen. Vermisst? Warum ist er dann zu seiner Ex zurückgerannt, als hätte er den allerletzten Zug verpasst?
»Das Letzte, was ich will, ist Sex mit einem, dem ich vor Wochen noch so gleichgültig war wie eine gutaussehende Frau dem Pontifex.« Mein Tonfall ist kühl, meine Worte klingen ein frostiger Schauer. »Wenn du unbedingt Sex mit mir haben willst, verstehe ich nicht, warum du während unserer Beziehung zu deiner Verflossenen zurückgelaufen bist. Nein, danke. Lass es gut sein, Benno. Da sinkt meine Laune eher noch weiter in den Keller.«
Die Worte hängen in der Luft, eine unsichtbare Barriere zwischen uns. Ich hoffe, er erkennt es und begreift endlich, dass ich mich null über seinen Anruf freue und ihn nicht in mein Bett lasse.
»Hattest du Stress auf der Arbeit oder ist es nur der fehlende Sex?« Benno versucht, die Dinge mit einem leichten Ton zu nehmen, als wäre unsere Trennung bloß ein vorübergehendes Missverständnis. Doch ich durchschaue ihn. Das ist Benno, wie er leibt und lebt, oberflächlich, impulsiv und dabei so verdammt unwiderstehlich.
Ich atme tief durch und versuche, den Wirbelsturm in mir zu bändigen. Ein Moment der Stille breitet sich aus, gefolgt von einem Seufzen, das aus meiner Kehle kommt.
Eine Weile spiele ich mit dem Gedanken, diesen unmöglichen Kerl durch den Telefonhörer zu ziehen, ihn zu packen und durchzuschütteln. Doch nein, es wäre keine gute Idee. Er würde es ohnehin nicht verstehen. Die Sache mit der Versetzung nach München werde ich ihm schon gar nicht auf dem Silbertablett servieren. Dieser Kerl ist so dermaßen unsensibel und obendrein unverschämt.
»Warum ich gereizt bin, geht dich ein Scheiß an. Mein weiteres Leben geht dich einen Scheiß an, seitdem du …«
Energisch beiße ich mir auf die Zunge, unterdrücke den Drang, ihm meine verletzten Gefühle um die Ohren zu schleudern. Er ist definitiv der falsche Gesprächspartner für so etwas.
»Ich höre,« sagt er vorsichtig und tastet sich geboten näher, als würde er auf weitere Andeutungen meinerseits warten.
»Lass mich in Ruhe. Ich fühle mich sterbensmüde und absolut groggy. Seit Monaten versuche ich, mein Leben auf die Reihe zu bekommen. Ohne dich, also höre auf, mich ständig anzurufen.«
Seine Antwort kommt wie ein sanftes Flehen, eine leise Brise, die versucht, den Sturm in meinem Inneren zu beruhigen. »Lass mich dir helfen.«
»Warum hörst du nicht einfach zu, was ich dir sage? Ich will, dass du mich in Ruhe lässt. Falls ich eines schönen Tages über dein Verhalten lachen kann, spreche ich vielleicht wie eine erwachsene Frau mit dir. Momentan fühle ich mich dazu nicht in der Lage. Das liegt daran, dass mein letzter Freund ein waschechtes Arschloch war.«
Seine Reaktion ist ein aufgeregtes Zischen, als würde purer Ärger in seiner Stimme brodeln. »Machst du etwa mit diesem Versager Bernd herum?«, fragt er, die Worte fast herauszischend, während er schneller zu atmen scheint.
Bernd, mein Mitbewohner, ist ein Kapitel in meinem Leben, das ich so nicht geplant habe. Ein schwerwiegender Fehler war es wohl, Benno davon zu erzählen. Ein Gedanke, der wie ein Sturm durch mein Inneres fegt, wenn ich daran denke, wie manche Männer das Gewicht der Worte tragen. Sie malen sich Bilder aus, die wie Schatten auf ihren Gedanken lasten, nie verblassend.
»Und wenn ich mit dem Innenminister von Japan eine Liaison hätte? Was geht es dich plötzlich an? Es nervt mich extrem.«
»Aber ich liebe dich.«
»Lügner!«, entfährt es mir ungehalten. Ich richte mich abrupt auf, der Drehstuhl knarzt protestierend.
»Ehrlich, es tut mir so unendlich leid, was geschehen ist«, murmelt er.
Seine Worte klingen reumütig, aber in mir brodelt eine Übelkeit, die sich kaum beschreiben lässt. Es ist, als wäre der Raum plötzlich enger geworden, als würden unsichtbare Fäden mich mit Benno verbinden, aus denen ich verzweifelt versuche, mich zu befreien. Doch die Worte, hängen schwer wie Blei in der Luft.
In der frostigen Einöde meines Herzens klafft eine schmerzhafte Leere. Ein Abgrund, der mich an einen gewaltigen Krater erinnert. Hier ist vor Kurzem der Meteor mit dem Namen ›Benno Tautendorf‹ eingeschlagen.
Seither reckt sich kein Baum mehr stolz gen Himmel. Die Erde rund um diesen Ort des Unglücks liegt rabenschwarz verbrannt da und wirkt wie eine unwirkliche Ödnis in der drückenden Mittagssonne. Es scheint, als wäre jegliches Leben aus dieser Gegend geflohen, und die Stille, die nun herrscht, erdrückt alles Lebendige.
Am Telefon herrscht eine bedrückende Stille, die mich wie ein eiskalter Windhauch durchdringt, bevor er mit einem leisen Seufzen hinzufügt: »Ich war ein Idiot.«
Ich denke, dass ich es sofort unterschreiben würde, wenn jemand mir den Vertrag für den Austausch meines Schmerzes anbieten würde.
Nach einem weiteren, schweren Seufzen durchbricht er die Stille mit den leisen Worten: »Gute Nacht, Amelie.«
Schweigend beende ich das katastrophal verlaufende Gespräch. Wir sind ein Jahr zusammen gewesen. Dummerweise habe ich mit jedem Monat angefangen, an mehr zu denken. Aber er nicht. Er ist gegangen.
Zu seiner Ex.
Momentan ruft er mich täglich an und fragt fortwährend nach, wie ein ständiger Herbstregen, wie es mir geht oder es etwas Neues gibt. Ich habe unzählige schlaflose, tränenreiche und stockfinstere Nächte durchlebt, um über seine Untreue hinwegzukommen. Und bis heute ringe ich erbittert darum, meine zerzausten Gefühle zu ordnen. Was ich dabei feststelle, ist dies: Mein Feuer für ihn, das einst so lodernd war, ist erloschen.
Puff, und aus. Als hätte ein unsichtbarer Luftzug geholfen, die Flammen zu ersticken.
Die Tage verweben sich zu einem Muster aus Tränen und Selbstfindung. Die Worte, die er spricht, verhallen in der Leere meines Herzens. Ein Jahr der Liebe, das nun wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen ist. Während ich morgens in den Spiegel blicke, erkenne ich nicht nur die Bruchstücke einer gescheiterten Beziehung, sondern auch die Kraft, die in mir erwacht.
Puff, und aus. Aber nicht mein Licht. Es hat sich nur verlagert. Von ihm zu mir.
Ich brauche niemanden an meiner Seite, der mein Vertrauen derart gefühllos hintergeht und mich mit Füßen tritt. Einerlei, wie vorsichtig er wieder an meine Tür klopft, sie bleibt verschlossen. Untreue kann ich unmöglich verzeihen. Das war noch nie meine Stärke.
Was bleibt, sind schmerzhafte Erinnerungen an einst reizvolle Gefühle und zahlreiche unerfüllte Wünsche für mein restliches Leben. Ich möchte einen treuen, aufrichtigen Partner an meiner Seite, eine stabile Beziehung und eine ehrenwerte Arbeit.
Habe ich aber alles nicht.
Was ich stattdessen in den Händen halte, ist schlicht und ergreifend: die Nase gestrichen voll. Am liebsten würde ich meine Sachen achtlos in eine Plastiktüte stopfen und einfach verschwinden. Wohin ist egal, Hauptsache, das Muster der Tapete an der Wand ändert sich.
Doch dafür ist es notwendig, endlich einmal radikaler zu denken. Auf den ausgetretenen Pfaden des Gewohnten sind Entdeckungen undenkbar. Mein Blick wandert zu meiner Pinnwand, an der ein kleiner, viereckiger Zettel hängt, übersät mit handschriftlichen Notizen.
»Traumjob gesucht! Ohne pochende Kopfschmerzen. Zufriedenheit. Sinnvolle Tätigkeit. Nachhaltig.«
Ich gestehe, ich liebe Listen. Sie machen Dinge sichtbar, greifbar, und sie irren nicht ziellos im Kopf umher. Sie müssen raus. Das ist ihre Bestimmung. Alles, was im Kopf oder im Herzen stecken bleibt, macht letzten Endes krank.
In diesem Moment, während ich die Worte auf dem Zettel lese, wird mir klar: Es ist Zeit für einen Wandel. Der Traumjob, die Zufriedenheit, eine Tätigkeit mit Sinn – all das verblasst in einem Arbeitsumfeld, das nur pochende Kopfschmerzen hinterlässt. Es ist an der Zeit, das Leben auf eine nachhaltige Weise zu gestalten, nicht nur im Beruflichen, sondern auch in der Liebe. Und vielleicht, wenn ich diesen Weg beschreite, finde ich nicht nur den Traumjob meines Herzens, sondern auch die Liebe meines Lebens. Die Entscheidung ist gefallen, und nun liegt die Welt offen vor mir, bereit für neue Entdeckungen.
Nach dem Gespräch mit meiner Mutter habe ich eine weitere Liste meiner Wunschliste verfasst. Diese könnte alle interessieren, für die Selbstgespräche nicht merkwürdig klingen. Sie ist ganz bewusst an das Universum adressiert und schmückt seither meine Pinnwand. Oft lese ich sie.
Ehrlich gesagt, immer wieder.
Wenn ich an diese Liste denke, male ich mir die gewünschten Dinge lebendig aus. So, wie sie sich in meiner Vorstellung später anfühlen sollen. Diese Liste ist sozusagen mein Inserat, eine Aufforderung an das Universum, den Mann fürs Leben zu finden.
Mein Traummann.
Das klingt kitschig, aber nach dem Fiasko mit Benno ist mir jedes Mittel recht. Sicherlich mag es verzweifelt klingen. Das bin ich. In höchstem Maße. Seit Benno.
Egal, hier ist meine Wunschliste:
Traumprinz gesucht! Bitte sei:
über deine Beziehung vor mir hinweg,
ernsthaft an einer Familie mit mir (gerne auch mit einem Familienhund) interessiert,
wahrhaftig in mich verliebt,
ein Mensch, der uns durch uns wachsen und erblühen lässt,
Klingt arg verzweifelt, was? Mein Reden. Falscher Freund, falsche Arbeit … das sind die nervigen Dinge, die ich zukünftig aktiv ausschließe. Falscher Freund hat sich bereits von selbst erledigt, nervt aber aktuell mit Anrufen.
Ein neuer Mann an meiner Seite ist nicht in Aussicht. Es steht buchstäblich in den Sternen geschrieben, ob ich ihn überhaupt jemals treffe. Diesbezüglich bleibe ich gerne geduldig, erwarte dann allerdings vom Universum, dass es zu einhundert Prozent passt.
Mindestens.
Der nächste Punkt, den ich aktiv angehen muss, ist meine unbefriedigende Arbeitssituation. Schon seit Längerem weiß ich, dass er der Hauptgrund für meine alltäglichen Kopfschmerzen ist. Ich möchte mich nicht wegen einer Arbeit räumlich von meiner Familie entfernen. Mir ist einerlei, wie anständig er bezahlt wird.
Ebendarum lege ich seufzend das Handy aus meiner Hand und schaue von meiner Pinnwand zum Laptop. Die Internetseite mit den Stellenbörsen hat sich während des Telefonats mit Benno aufgebaut. Wahllos klicke ich eine Stellenanzeige an.
Hoppladihopp, was tut sich denn da?
Das Angebot, welches ich als Erstes anklicke, kommt von einer Gärtnerei. Sie suchen einen Helfer in Großrachenau, was nördlich im Speckgürtel von Berlin liegt. Die Aufgaben klingen machbar, sofern der Bewerber etwas für Gartenarbeit übrig hat. Unkraut entfernen, Mithilfe bei Bepflanzungen, Aushilfe im Hofladen und Hofcafé. Eine spezielle Ausbildung ist nicht erforderlich. Einzige Bedingungen: passable Deutschkenntnisse, Fleiß und der Wille, sich rasch in die Aufgabe einzuarbeiten.
Klingt in meinen Ohren machbar, sinnvoll und nach einem entschiedenen Schnitt in meiner, geradlinig verlaufenden Karriere. Sogar radikal, weil ich gelernte Bürokauffrau bin.
Die Stellenbeschreibung klingt einladend. Geradezu verlockend. Habe ich die dazu nötige Courage? Andererseits hält diese Branche garantiert nichts von Krawattenträgern, wie ich sie aus meiner kenne. In der zählen ein dickes Auto vor der Tür, eine teure Wohnung in bester Stadtlage und ein Urlaub auf Pump, der nach einer Woche vergangen ist.
Oder zwei, wenn ich großzügig aufrunde.
Größtenteils lebt meine Branche genauso oberflächlich, wie die Medien es als Inbegriff der Konsum-Geilheit predigen, in mir jedoch nichts als Ekel aufsteigen lässt. Das finde ich widernatürlich und kontraproduktiv dem Gemeinwohl und dem Weltgefüge gegenüber.
Für das schlechte Gewissen dieser Raubbau-Lebenseinstellung wird dann regelmäßig für wohltätige Zwecke gespendet. Wie früher in der Kirche erkauft sich jeder das vermeintliche Seelenheil. Mein politisch interessierter Vater meint beständig, es wäre ein moderner Almosenablass. Du meine Güte, jetzt klinge ich beinahe ebenso pessimistisch, wie er die aktuelle politische Lage bewertet.
Noch immer betrachte ich das Stellenangebot. Letztlich komme ich zu dem Schluss, dass es eine Chance ist, die ich ergreifen muss. Die Arbeit in einer Gärtnerei ist derart gegensätzlich zu meiner aktuellen Stelle und ich möchte gerne herausfinden, ob hier eine andere Lebenseinstellung gelebt wird.
Eine, die hoffentlich gescheiter zu mir passt.
Eine Arbeit ohne tägliche Kopfschmerzen und unliebsame Versetzungen. Dort wird eher in der Erde gewühlt und im Gleichklang der Natur gelebt als sich weiter von ihr zu entfernen.
Kurzerhand wähle ich die Nummer, die im Stellenangebot angegeben wurde. Es klingelt. Erst nach einiger Zeit meldet sich eine Frau, die sich jung anhört und sich atemlos meldet: »Hallo, hier Winter.«
»Guten Abend, Frau Winter. Hier spricht Amelie Richter. Frau Winter, ich rufe an, weil ich eben über Ihr Stellenangebot gestolpert bin. Die Stelle interessiert mich und ich wollte nachfragen, ob Sie derzeit noch eine Aushilfe suchen.«
In meinem Beruf hilft es ungemein, bei Telefonaten mehrmals die Namen zu nennen. Das weckt Vertrauen und dient als Türöffner.
»Hallo, Frau Richter. Ja, wir suchen noch. Besitzen Sie denn Kenntnisse?«
»Sie meinen im Gartenbau? Nein, ich weiß nur das, was ich im Garten meiner Eltern gelernt habe. Aber das ist nicht wenig zu nennen. Im Stellenangebot wurden jedoch keine Fachkenntnisse vorausgesetzt«, erinnere ich sie. »Ich meine damit, dass ich hart arbeite und kräftig anpacke. Beruflich möchte ich mich umorientieren und Gärtnerei klingt um einiges aufregender als Bürojob.«
»Sie arbeiten im Büro und wollen zu uns wechseln? Warum das?«
Im Hintergrund höre ich, wie ein Fahrzeug vorbeifährt und hupt.
»Ja, ich bin Bürokauffrau. Ich habe es satt und möchte etwas Sinnvolleres tun, als Kopien aus dem Drucker zu holen und Besprechungsprotokolle in Reinform abzutippen. Nichts gegen Besprechungsprotokolle. Sie sind wichtig. Und eintönig gleichermaßen, darum möchte ich die Branche wechseln. Noch bin ich in Anstellung, suche aber ernsthaft etwas Neues. Ihr Inserat ist mir ins Auge gestochen und ich finde, was Sie als Aufgabengebiet beschreiben, passt gut zu meinem Naturell. Was Sie beschreiben, klingt unglaublich abwechslungsreich. Damit ist es genau das, was ich suche.«
»Das hört sich doch super an. Nun, ich frage nach, weil die meisten Leute lieber ins Büro gehen würden. Ins Warme und daneben angemessen bezahlt.«
Bitter lache ich auf. »Glauben Sie mir. Ich suche etwas Anderes, Sinnvolleres. Und anständig bezahlt, ist in der freien Wirtschaft mittlerweile Auslegungssache. Es stimmt. In einem Büro ist es warm und trocken. Aber was, wenn ich als Mensch im Warmen und Trockenen auf der Strecke bleibe?«
»Im Garten Ihrer Eltern … was haben Sie dort gemacht? Ich meine, was haben Sie dort gearbeitet?«
Sie beißt an und fragt weiter nach, daher deute ich das vorsichtig als Fisch am Haken.
»Ich habe Unkraut gejätet, Komposthaufen angelegt und gewendet, Beerenobst und Rosen geschnitten, im Hochsommer die Pflanzen bewässert. Besonders die im Gewächshaus, die …«
»Wann haben Sie Zeit für ein persönliches Gespräch?«, unterbricht sie mich und scheint in Eile.
»Gerne morgen Nachmittag«, antworte ich aus dem Konzept gekommen, aber sogleich.
Ich frage mich, was von dem Gesagten sie überzeugt, mich näher kennenlernen zu wollen. Das wäre gut zu wissen, denn darauf könnte ich beim kommenden Gespräch den Schwerpunkt legen und ihn geschickt zu meinem Vorteil nutzen.
»Morgen passt mir gut. Um fünf? Die Adresse haben Sie ja. Wenn Sie in den Hof kommen, befindet sich mein Büro rechts im Altenteil. Ist kinderleicht zu finden.«
»Ich werde da sein, Frau Winter«, verspreche ich und ziehe ruckartig meinen rechten Unterarm samt geballter Faust nach unten.
»Bis morgen also«, verabschiedet sie sich.
Wow, das ist ja einfach gegangen, wie Teig ausrollen. Was auch immer sie überzeugt hat, morgen überzeuge ich noch mehr. Ach, was rede ich. Ich überzeuge sie komplett.
Mit ein bisschen Glück bin ich demnächst den Frustjob los. In diesem Fall habe ich einen wesentlichen Punkt in meinem Leben angepackt.
Noch einmal sehe ich zu meiner Liste. Geht doch. Beschwingt tänzele ich in die Küche, um meine Teetasse in den Abwasch zu stellen. Bernd hockt zusammengekauert am Tisch.
Nach der nervenaufreibenden Trennung von seiner Frau hat er schleunigst die freien Zimmer vermietet. Jetzt wohnen wir hier zu dritt, teilen die Miete, Freud und Leid. Wenn ich keinen Freund habe und sich der Hunger nach Nähe übermäßig anfühlt, teile ich mit Bernd sogar vereinzelt die Nähe.
»Na, wie war dein Tag?«, fragt er, sobald ich in die Küche eintrete.
Aktuell plagt ihn eine depressive Phase, von der er nichts hören will, die sich aber leider dadurch nicht zwangsläufig verdünnisiert. Bernds Tonlage verrät es eindeutig.
Nach dem Telefonat habe ich Auftrieb bekommen und fühle mich momentan hoch motiviert. Ich schlendere zum Kühlschrank, hole mir ein Bier heraus, setze mich an den Küchentisch und betrachte ihn. Er sieht derart mitgenommen aus, wie ich mich vorhin gefühlt habe.
Hundeelend.
»Bis eben grauenvoll. Ich hatte abartige Kopfschmerzen von dem ganzen Gelaber auf der Arbeit. Stell dir vor, vier Meetings hatten wir heute. Sophie ist wieder einmal ausgefallen und ich musste ihre Sitzungen übernehmen. Ich fühle mich so was von gerädert. Aber eben habe ich ein Vorstellungsgespräch für morgen vereinbart.«
Bernd hebt seine müden Augen und starrt mich an, als hätte es ihn eiskalt erwischt.
Ich zucke mit den Schultern. »Waas? Wer, außer mir kann etwas an dem ganzen Mist ändern? Du solltest es auch endlich tun, statt ewig und drei Tage deiner Frau nachzuheulen und dir damit dein Leben selbst zu versauen.«
»Für mich ist der Zug längst abgefahren«, entgegnet er schlapp und starrt erneut stumpfsinnig vor sich her. Diesmal auf den Tisch.
Vom nervenaufreibenden Scheidungskrieg hat er schwere Depressionen bekommen und sich nie davon erholt. Daran trägt er eine Mitschuld, weil er nie ernsthaft etwas dagegen unternimmt. Bernd kommt mir wie ein Zombie vor. Wie ein körperliches Wrack, das auf seine Verschrottung wartet, indem er einen um den anderen Tag überlebt, statt zu leben.
»Du sitzt in dem Zug. Du selbst entscheidest, ob du in der ersten Klasse, in der zweiten oder im Frachtabteil sitzen willst.«
»Klugscheißerin«, bellt er mich heiser an, ohne aufzusehen.
»Ja, ja, ranze mich ruhig an. Ich sage das, weil du ein liebenswerter Mensch bist, der es verdient, eines Tages wieder glücklich zu sein. Lass dir helfen! Tue es für dich, denn das bist du dir verdammt noch eins schuldig. Der Rest findet sich von allein.«
»Du findest mich liebenswert?«
Diese Frage verwundert mich nicht zum ersten Mal. Sein Selbstbewusstsein reicht lediglich bis zur Höhe der Tischkante. Hoffnungsvoll heften sich seine braunen Augen an mich. Ich erkenne einen kleinen, verstörten Jungen, der begierig nach Liebe und Beachtung hechelt.
»Es ist doch schnurz, wie oft ich dir das sage, wenn du unfähig bist, es selbst genauso zu sehen. Dein Spiegel ist verzerrt und du brauchst dringend Hilfe. Ärztliche Hilfe.«
»Ich brauche dich, wie mir scheint«, entgegnet er mit zusammengezogenen Augenbrauen. »Damit wäre mir schon geholfen. Kommst du mit in mein Zimmer?«
»Ach Bernd, das haben wir doch schon mehr als einmal besprochen. Und nein, ich komme nicht mit in dein Zimmer. Ich wünsche mir einen Mann. Kein Kind, das eine Ersatzmutter sucht. Du sagst zwar, dass du mich brauchst, aber was du insgeheim willst, ist der Ersatz für einen Verlust, den niemand ersetzen kann.«
»Dann tröste mich wenigstens kurz. Mir buggy, wie du es nennst. Außerdem bin ich bis zum Anschlag geladen.«
Halsstarrig dreinblickend verzieht er seinen Mund, doch ich erhebe mich von dem Stuhl, statt tröstende Worte zu spenden. Mit glasigen Augen schaut er mich an. Ihm ist schnurzpiepegal, was ich sage, solange ich ihn für einen Moment ›tröste‹.
Zudem tut es aus seinem Mund weh.
Ich neige mich und küsse liebevoll seine Wange, auf der grau melierte Stoppeln wachsen. Was wäre er für ein liebevoller Partner, wenn er endlich den Verlust seiner Mutter und seiner Frau überwinden könnte.
Er missversteht meine Geste, umarmt und drückt mich an sich.
»Gute Nacht, Bernd«, murmele ich und reiße mich unerbittlich los.
In Gedanken versunken, betrachtet er meine unbekleideten Beine. »Wann hast du das Vorstellungsgespräch?«
»Siebzehn Uhr.«
»Ich denke an dich. Ich denke immer an dich.«
»Gute Nacht.«
»Gute Nacht, Klugscheißerin.«
Lächelnd ziehe ich mein Shirt über das Gesäß, um ihm im Hinausgehen darauf hinzuweisen, wo er mich gerne einmal darf.
Kapitel 2

A
m Morgen darauf wähle ich ein aufsehenerregendes Outfit für den Tag aus. Jedoch ist es nicht zu schick für den Gärtnereibetrieb, im Büro aber vorzeigbar. Gleich nach der Arbeit angele ich mir die Stelle in der Gärtnerei.
In der Nacht habe ich stundenlang wach gelegen und mir kühn ein farbenfrohes Leben als Angestellte in einer Gärtnerei ausgemalt. Ich habe Blumentöpfe über Blumentöpfe in meinem Traum gesehen, Hände vollgeschmiert mit Dreck, der bis unter die Fingernägel reicht. Alles hat herrlich nach fettem, fruchtbarem Ackerboden geduftet.
Obwohl ich wenig Schlaf gefunden habe, wache ich vor dem Klingeln des Weckers auf und fühle mich taufrisch. Auf der Arbeit meldet sich Sophie erneut krank, daher übernehme ich ihre Sitzungsprotokolle, muss aber zeitgleich meine Arbeit, die Gästebewirtung und den Empfang managen.
Stress pur.
Zum Ausgleich gönne ich mir mehrere kleine Pausen, in denen ich auf meinem Handy die Route nach Großrachenau recherchiere. Per Landkarte schaue mich unter der angegebenen Adresse um. Aus der Vogelperspektive erkenne ich einen riesigen Dreiseithof und zwei gigantische, kommerzielle Gewächshäuser. Rings um den Hof erstrecken sich weitläufige Felder. Erst in einigem Abstand stehen weitere Höfe.
Die Homepage wirkt einladend, professionell. Laut Homepage liegt der Schwerpunkt eindeutig auf Ökologie, nachhaltiges Wirtschaften und Kundenbindung. Ich klicke auf mehrere Seiten und verschaffe mir einen ersten Eindruck über ihre Produkte.
Anemonen.
Hübsche Pflänzchen.
Jedenfalls gefallen sie mir optisch besser als Kakteen.
Anemonenarten sind das Spezialgebiet der Gärtnerei. Das Angebot umfasst bekannte und weniger bekannte Sorten. Deren Preise haben sich gewaschen, daher vermute ich so etwas wie spezielle Zuchtformen. Daneben bauen sie aber auch Kräuter an. Vornehmlich dreht sich allerdings alles um die Zucht von etablierten Sorten der Anemone und der Verkauf an umliegende Händler und Hofbesucher.
Mein Büroleiter ruft mich zu sich, um mit mir anstehende Arbeiten und deren Terminierung zu besprechen. Daher bleibt kaum Zeit, um etwas über die Inhaber zu erfahren. Mittags geht es auf der Arbeit meist hektisch zu, dabei hätte ich noch zu gern mehr über meine potenziell neuen Vorgesetzten erfahren.
Na ja, wenn ich schon ins kalte Wasser springe, dann komplett und kopfüber. Was soll’s.
Nach Büroschluss, den ich sehnlichst herbeisehne, fahre ich durch eine typisch bäuerlich geprägte Landschaft, die im Speckgürtel von Berlin liegt. Es ist Frühlingsanfang. Zartes Grün sprießt auf den Futterfeldern.
Die Dörfer wurden größtenteils nach dem gleichen Schema angelegt. Überwiegend erstreckt sich um eine Kirche ein kleiner Dorfkern. Einige Höfe liegen weit verstreut außerhalb. Alles ist über Bundesstraßen und Autobahnen miteinander verbunden, damit die Landbevölkerung schnell in die Großstadt zur Arbeit gepumpt werden kann.
Die Stimme aus dem Navigationsgerät kündigt die Ankunft an und fordert mich auf, in einen schmalen Feldweg einzubiegen. Riesige Äcker säumen die kleine, staubige Schotterstraße, die ich schon aus der Vogelperspektive gesehen habe. Ein Hinweisschild weist den Weg zum Hofladen und Hofcafé. Letzteres empfängt ausschließlich am Wochenende Gäste.
Kein Zweifel, ich bin angekommen.
Vor einem schmiedeeisernen Zaun befindet sich ein kleiner Kundenparkplatz, auf dem ich mein Auto abstelle. Ich schlendere durch das große, sperrangelweit geöffnete Tor. Zunächst möchte ich genau wissen, was mich erwartet und lasse mir Zeit, um alles auf mich wirken zu lassen.
Das Altenteil liegt rechter Hand. Das Büro erkenne ich bereits von Weitem. Alles ist genau so, wie Frau Winter es am Telefon beschrieben hat.
Problemlos zu finden.
Gegenüber dem Altenteil steht ein aufsehenerregendes, zweistöckiges Wohngebäude. Ober und unterhalb des vierflügeligen Fensters schmückt ein aufwendiger Stuck die Fassade, was sie feudal wirken lässt. Vor den Fenstern der unteren Etage hängen Blumenkästen, in denen Frühblüher ein Meer aus Blumen bilden. Das üppig blühende Blumenmeer rankt weit über den Rand der Töpfe. Fährt eine Brise durch sie hindurch, fühle ich mich seekrank, aber von himmlischem Wohlgeruch umgeben.
Eine grauweiß gefleckte Katze sonnt sich auf den breiten Treppenstufen, die zu einer dunkelgrünen Eingangstür führt. Sie besteht aus zwei Flügeln und ist mit handwerklicher Schnitzkunst verziert.
Zwischen dem imposanten Wohntrakt und dem renovierungsbedürftigen Altenteil erstreckt sich die modern ausgebaute Scheune. In der oberen Etage wurden bodentiefe Fenster eingebaut und die Fassade mit Holz verkleidet, welches silbergrau in der Nachmittagssonne schimmert.
Insgesamt wirkt der Innenhof picobello aufgeräumt. Glanzstück ist ein alter, dicker Baum. Er wächst mittig im Hof und trägt erste, zarte Blattknospen. In ihm zwitschern Vögel. Ihre munteren Rufe schallen von allen Wänden der drei Gebäude wieder.
Bald sprießen die ersten Blätter. Zartgrün, beinahe zerbrechlich. Dann wird es nach und nach wärmer.
Ich atme kurz ein und schließe meine Augen. Was ich sehe, wirkt wie pures Landleben. Trotz pochender Kopfschmerzen fühle ich mich ausgesprochen gelassen. Bleibe ich weitere zehn Minuten stehen, verschwinden sie garantiert. Das finde ich schon jetzt um einiges besser als die tägliche Dusche nach Feierabend.
Leider bin ich nicht zur Kur hergekommen, darum schlendere ich zu einer Holzbank, die vor dem Bürofenster platziert wurde. Auf der liegt eine schwarze Katze, die sich ausgiebig putzt. Meine Hand gleitet zu dem Tier und krault das weiche Fell.
Wenigstens kurz.
Prompt dreht sich der Kopf genüsslich in meine Richtung. Hätte ich mehr Zeit, würde ich ausführlicher mit dem freundlichen Tier schmusen und ebenfalls meine lästigen Kopfschmerzen loswerden. Alles an diesem Ort wirkt außergewöhnlich beruhigend auf mich.
Hier möchte ich unbedingt arbeiten.
Die Bürotür öffnet sich. Eine Frau erscheint. Überrascht mustern mich blaue Augen von oben bis unten. Der Blick gleitet zur Katze hinab, die meine Streicheleinheiten sichtlich genießt und flehend miaut.
Die Frau ist etwa in meinem Alter. Auf den ersten Eindruck wirkt sie herausgeputzt, als würde es geradewegs in den nächsten Nachtclub gehen. Die blonden Haare trägt sie streng zum Hinterkopf gekämmt, wo ein schwarzes Haargummi den wuchtig wirkenden Zopf hält. Als würde sie meine Gedanken erahnen, hebt sie eine ihrer unnatürlich stark gezupften Augenbrauen.
»Guten Tag. Ich bin Amelie Richter. Sind Sie Frau Winter?«
»Tag«, antwortet sie.
Ihr Gegengruß klingt gelangweilt. Nach dem ersten Ton bin ich heilfroh, dass ich mit meiner Vermutung falsch liege. Sie näselt stark, kann daher nicht Frau Winter sein.
»Nein, die bin ich nicht. Sie ist im Büro, telefoniert aber. Sind Sie wegen der Stelle gekommen?«
»Warum fragst du?«
»Weil sehr viele kommen und auch wieder abhauen.«
»Woran liegt das?«, erkundige ich mich. Mit dieser unvermittelten Frage unterbreche ich sie damit, mich unumwunden zu mustern.
»Größtenteils überschätzen sie die Arbeit und sich«, erklärt sie schmallippig und stöckelt an mir vorbei. Steif wackelt sie auf ihren abgeschrammten Absätzen über das holprige Kopfsteinpflaster.
»Und du? Arbeitest du auch hier?«, rufe ich hinterher.
Jählings bleibt die schönste Frau des Dorfes stehen und dreht sich zu mir herum, wobei mich ihre blauen Augen erneut beurteilen. Ihr Mund spitzt sich unübersehbar. Anschließend entscheidet die Grande Dame, zu antworten. »Sagen wir es mal so: Ich bin die rechte Hand des Chefs.«
Aha.
Hätte eure Majestät mal besser geschwiegen, saust es mir schlagartig durch den Kopf. Absichtlich verweigere ich ihr den standesgemäßen Hofknicks. Leute, die von sich in der Mehrzahl sprechen, ertrage ich überhaupt nicht. Dieser Typ Mensch bereitet mir arge Kopfschmerzen und erinnert eher an unerfreuliche Abschnitte meiner Lehrzeit.
Muss ich nicht unbedingt noch einmal haben.
»Na, das wird ja amüsant«, entladen sich meine Gedanken postwendend und lauter als ursprünglich beabsichtigt.
»Kommt ganz auf den Humor an, den du mitbringst. Von wo eigentlich?«
»Berlin, und von wo kommst du ursprünglich?«
Mit meinem vorlauten Konter finde ich stehenden Fußes eine neue Freundin. Zusammengekniffene Augen versprühen massenweise Gift, obwohl sie ihren Mund breit zu einem Grienen verzieht. »Ganz sicher nicht von dort. Viel Glück Großstadtgöre.«
»Vielen Dank, rechte Hand des Chefs.«
Plötzlich wirft der Hausbaum ellenlange Schatten, dabei ist mir die Umgebung bis eben außergewöhnlich malerisch vorgekommen. Ich drehe mich um, drücke die Türklinke hinunter und befinde mich in dem Büro der Gärtnerei.
Unmittelbar vor mir erstreckt sich ein Tresen. Dahinter steht ein großer Schreibtisch, auf dem unzählige Papiere und aufgeschlagene Ordner liegen. Mir gegenüber entdecke ich einen runden Tisch und vier Stühle. Dort stehen zwei Tassen, die vermutlich von einer Besprechung mit der rechten Hand des Chefs stammen.
Nahe dem Tisch reihen sich Regale und Schränke aneinander, die bis zum Schreibtisch reichen. Die einheitlich beschrifteten Ordnerrücken lassen vermuten, dass hier eine auf Struktur bedachte Persönlichkeit arbeitet.
Ein Blick auf den Schreibtisch bestärkt meine Annahme. Er wirkt voll Arbeit, aber nicht planlos. Die Ablagekörbe quellen nicht über. Staub entdecke ich nirgendwo. Eine mittelblonde, schlanke Frau telefoniert. Auf Höhe des Unterleibes streicht ihre Hand über das Shirt.
Das ist also Frau Winter.
Ich trete an den Tresen und sehe aus dem Fenster, das einen überwältigenden Ausblick auf den verträumten Innenhof und das gegenüberliegende Wohnhaus bietet. Die Vögel zwitschern aufgeregt, streiten oder schimpfen wild durcheinander.
Ob die entspannte Katze der Grund ist? Die leckt aktuell gründlich ihre Pfote ab und ignoriert den Tumult der beunruhigten Piepmätze.
»Ja, ich weiß, aber sage ihr bitte auch, dass ich für diese Zeit dringend einen für den Übergang benötige. Nur ersatzweise«, erklärt Frau Winter in das schnurlose Telefon. Dabei nickt sie, als würde sie ihrem Gesprächspartner direkt gegenüberstehen. »Ja, wir haben gestern darüber gesprochen. Sage ich ja. Nein, damit hat es nichts zu tun und diesbezüglich halte ich deine Zweifel für unbegründet. Lass mich das machen. Du, ich habe jetzt das Vorstellungsgespräch und möchte an dieser Stelle unser Telefonat beenden.«
Für eine Sekunde lächelt sie einnehmend und mustert mich dezent aus attraktiven, blaugrauen Augen. Sie deutet zum Tisch, auf dem die beiden benutzten Teetassen stehen und bittet mich auf diese Weise, schon einmal Platz zu nehmen.
»Ich melde mich hinterher bei dir. Ja, mache ich. Sage mal, vertraust du mir nicht?«, lacht sie und beobachtet mich.
Ahh, möglicherweise dreht sich das Telefonat um meine heutige Vorstellung, daher lächele ich zurückhaltend und setze mich unter dem wachsamen Blick von Frau Winter an den Tisch.
»Gut, bis später«, verabschiedet sie sich, legt den Hörer auf und kommt herüber.
Sie trägt eine weite, bequeme Pumphose aus Leinen und ein unifarbenes Shirt, was bestens zu der schlanken Figur passt. Freundlich und warm, wie gestern am Telefon, begrüßt sie mich und streckt mir ihre schmale Hand entgegen. »Guten Tag. Tut mir leid, dass Sie einen Moment warten mussten. Haben Sie gut hergefunden?«
Nebenbei räumt sie die Teetassen vom Tisch und stellt sie auf ein Tablett, welches sich auf dem Tresen befindet.
»Ja, es war unkompliziert, den Hof zu finden.«
Sie setzt sich mir gegenüber und schaut mich neugierig, aber offen an. »Ich fand unser Telefonat gestern ausgesprochen interessant und wollte Sie näher kennenlernen. Leider kann mein Bruder heute nicht mit bei dem Gespräch sein. Er bedauert außerordentlich seine Abwesenheit. Wir unterhalten uns dementsprechend allein.«
»Verstehe«, erwidere ich und ahne sogleich, mit wem sie am anderen Ende der Leitung gesprochen hat.
Der Chef von der rechten Hand, die ich eben vor der Tür getroffen habe. Wenn er so eine eingebildete Trulla zur rechten Hand macht, bin ich tierisch auf ihn gespannt. Spätestens jetzt rächt sich, dass ich keine Zeit für eingehende Recherche der Homepage gefunden habe.
»Warum wollen Sie die Branche wechseln?«
Mit dieser Frage habe ich gerechnet. Der Moment ist gekommen, in dem ich mich präsentieren darf und in dem sie sich ein genaueres Bild von mir machen kann.
»Ich habe von meiner Firma ein schmeichelhaftes Angebot für eine Versetzung erhalten. Leider sehe ich mich gegenwärtig nicht in der angedachten Position. Meine Familie ist mir sehr wichtig und die Entfernung wäre eindeutig zu groß.«
»Wohin sollten Sie denn versetzt werden?«
»Nach München.«
»Das ist tatsächlich weit.«
Zustimmend nicke ich.
»Und wie sind Sie auf unsere Branche gekommen?«
»Reiner Zufall. Ich habe Ihre Stellenanzeige gelesen, sie ansprechend gefunden und alle Optionen miteinander abgewogen. Neben meinen Stärken und Kompetenzen ist mir durch den Kopf gegangen, wie wunderbar radikal die berufliche Veränderung für mich ist. Ich sehe meine berufliche Zukunft in Ihrem Unternehmen«, gebe ich unverblümt zu.
»Laufen Sie etwa vor etwas fort?«
Verhalten lache ich auf, denn das trifft ja auf eine ganz kuriose Weise zu. »Oberflächlich betrachtet sieht es so aus, ja. Ich brauche einen Neuanfang, bin zu jedem Risiko bereit und wild entschlossen, etwas Wesentliches in meinem Leben zu verändern. Logischerweise zum Positiven.«
Klar ist mir bewusst, dass ich sehr viel mehr über mich preisgebe, als angeraten wäre. Ich mag keine Spielchen, somit können wir nahtlos zum Fachlichen überleiten. Dafür bin ich schließlich hergekommen.
»Sie sagten, Sie haben keinerlei Kenntnisse in …«
»Falsch. Ich besitze lediglich keinerlei Ausbildung in Ihrer Branche«, entgegne ich bestimmt und mit fester Tonlage, die Selbstsicherheit vermittelt.
»Wenn ich Sie mir so ansehe …«, murmelt sie diplomatisch, was weder überheblich noch abfällig klingt.
»Lassen Sie sich von Kleidung täuschen?«, unterbreche ich sie und hebe verwundert meine Augenbrauen in die Höhe.
Mein Blick kommt fragend und herausfordernd zugleich daher. Sie faltet ihre Hände und schaut mich geradeheraus an. Meine Gegenfrage ist eine Punktlandung, weil sie genau ins Schwarze trifft.
Auf mich wirkt Frau Winter nicht oberflächlich. Weder die Art, wie sie sich sprachlich ausdrückt, der nonchalante Kleidungsstil noch das Mienenspiel lassen darauf schließen. Ich finde sie sympathisch.
»Sie erwähnten im gestrigen Telefonat, dass Sie schon einmal Rosen geschnitten haben«, fährt sie fort und scheint über den netten Gesprächsverlauf ganz augenscheinlich angetan.
»Ja, im Garten meiner Eltern.«
»Welche?«
»Strauchrosen, Beetrosen …«
»Wo liegt der Unterschied beim Schnitt?«, unterbricht sie mich schnell.
Vermutlich lotet sie aus, ob ich nur Müsli daher schwatze oder ein wenig Verständnis für die Natur mitbringe. Kein Problem. So läuft das Bewerbungs-Spiel und ich würde es an ihrer Stelle nicht anders handhaben.
»In der Art des Schnittes. Jede Rosengattung besitzt andere Wuchseigenschaften, die beim Schnitt berücksichtigt werden müssen.«
»Woran erkennen Sie ein Auge an einem stark verholzten Rosentrieb?«
Ihre Fragen erinnern mich an einen schnellen Schlagabtausch beim Tischtennis. Zweifelsfrei beabsichtigt sie damit, zackig fachliche Fakten abzuklopfen, ohne dass mir Zeit zum Luftholen bleibt.
»Es sieht schwarz aus und liegt direkt …«
»Sie bekommen die Stelle.«
»Wie bitte?«
Meine Stimme klingt überrascht, obwohl ich genauestens erfasse, dass ich als passabler Gegner beim Tischtennis-Match gelte. Allein der Inhalt kommt für mich erstaunlich überraschend und schnell.
»Sie bekommen die Stelle«, wiederholt sie geduldig und legt ihre Hände auf die Armlehnen, während sie sich im Stuhl zurücklehnt. »Sofern Sie die Stelle noch interessiert.«
Ich nicke. Logisch bin ich interessiert.
Echt mal. Wie kann ich bei diesem imposanten Hausbaum und der beschaulichen Atmosphäre nicht begierig auf die Stelle sein?
Frau Winter steht auf und geht zum Schreibtisch. Von dort holt sie Papiere, kommt zum Tisch zurück und breitet sie vor mir aus. »Das ist der Mustervertrag. Lesen Sie ihn durch und schlafen Sie meinetwegen noch ein, zwei Nächte darüber. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bei mir. Wir können Ihnen gern ein Zimmer im Altenteil anbieten. Es ist nicht saniert, aber sauber. Ich zeige es Ihnen, bevor Sie fahren, damit Sie alle Gegebenheiten kennen. Das Zimmer wäre kostenlos. Die Hauptmahlzeiten ebenfalls, aber dafür ist das Gehalt kleiner. Folgen Sie mir?«
Ich bin baff. Mit so einer raschen Entscheidung habe ich nicht gerechnet. Warum auch immer, ich bin davon ausgegangen, dass sie sich mit ihrem Bruder beraten möchte. Am Telefon klang das Gespräch so, als müsste sie ihn erst noch davon überzeugen, einen neuen Mitarbeiter einzustellen. Die müssen echt dringend jemanden suchen.
Frau Winter wartet an der Tür auf mich. Schwerfälliger als angebracht erhebe ich mich und folge ihr durch die Bürotür nach draußen.
Mit ihrem Arm deutet sie auf das linke Gebäude. »Im Haupthaus wohnen wir. In der Scheune ist das Büro meines Bruders untergebracht, unter dem Sie arbeiten werden. Schade, dass Sie ihn heute nicht kennenlernen, denn er hätte Ihnen sicher gern weitere Einzelheiten erklärt, aber nun ja. Es ist, wie es ist und wir müssen flexibel bleiben.«
Neben dem Hofladen befindet sich eine Tür, die sie aufschließt und eine Treppe emporsteigt. Wir stehen in einem Flur, von dem sechs Türen abgehen. Vor einer bleibt sie stehen und öffnet diese mit dem Schlüssel.
Wir betreten ein geräumiges, lichtdurchflutetes Zimmer. Ein Bett, ein Schrank, ein Sessel, eine Pantryküche und ein kleines Bad befinden sich darin. Nichts Zeitgemäßes, aber sauber.
Und auf eine gewisse Art charmant.
»Sie müssen hier nicht wohnen, falls Sie lieber mit dem Auto pendeln wollen«, erklärt sie, während ich eintrete, um mir das Zimmer anzusehen.
»Nein, ich nutze das Angebot gern. So kann ich zwei Stunden durch den Stau und jede Menge Spritkosten sparen«, erkläre ich aus dem Fenster sehend.
Die Sonne senkt sich inzwischen am südwestlichen Himmel. Ihr mattes, gelbes Licht durchflutet den rechten Teil des Zimmers, was demzufolge unglaublich verträumt und behaglich anmutet. Vor dem Fenster entdecke ich den Hausbaum, der mit seinen zarten, frischen Triebspitzen ebenfalls von der untergehenden Sonne angeleuchtet wird. Die zwitschernden Vögel, die sich im Baum tummeln, höre ich sogar durch die geschlossenen Fenster.
Gott, finde ich den Hof paradiesisch.
»Gut, abgemacht. Lesen Sie sich den Vertrag in Ruhe durch. Melden Sie sich danach telefonisch. Meinetwegen können Sie in vier Wochen anfangen.«
»Ist mir lieb«, murmele ich mit Blick auf den wunderschönen Hausbaum.
»Prima.«
Ich wende mich ihr zu und lächele sie zufrieden an. »Morgen Nachmittag haben Sie meine Entscheidung. Es sei denn, die Bezahlung ist unterirdischer als unterirdisch.«
Gut aufgelegt, lacht sie und wirft ihren Kopf zurück. »Bitte nennen Sie mich Lea.«
»Okay, Lea. Ich bin Amelie.«
»Würde mich freuen, wenn du zusagst. Entschuldige bitte, ich erwarte einen dringenden Anruf von einem wichtigen Kunden und muss in das Büro zurück.«
Ich folge ihr bis zur Bürotür, wo wir uns zum Abschied die Hände kräftig schütteln und voneinander verabschieden. Mit zwei Exemplaren des Vertrages stehe ich im Innenhof und juble innerlich vor Freude. Hastig blättere ich ihn durch, während ich zum Parkplatz schlendere.
Er ist detailliert aufgesetzt und enthält sogar den dazugehörigen Einarbeitungsplan. Damit hat sich jemand auffällig viel Mühe gegeben, denn das ist nicht an der Tagesordnung. Mein Gehalt ist nicht berauschend, aber in Anbetracht dessen, dass Hauptmahlzeiten und Unterkunft frei sind, ist es fair. Ich stolpere über die Befristung des Vertrages.
Das ist nicht gut.
Durch die Fensterscheibe sehe ich Lea, die am Schreibtisch steht und telefoniert. Ich eile zurück, klopfe an und trete ein. Weil sie spricht, warte ich am Empfangstresen. Sie müht sich nach allen Regeln der Kunst ab, einen verärgerten Kunden zu beschwichtigen. Irgendwer hat vor zwei Tagen lädierte Ware kommissioniert, was den Kunden nun verärgert in den Telefonhörer dröhnen lässt.
Müde und erschöpft beendet sie das Gespräch. »Ja, Amelie? Was gibt es? Du siehst nicht begeistert aus.«
»Im Vertrag steht, dass die Stelle befristet ist, was sich schwierig für mich gestalten kann«, platze ich frei heraus. »Ich meine, ich bin derzeit fest angestellt und kündige ungern für zwei Monate mit ungewisser Zukunft. Klar bin ich da wenig begeistert. Und du hast gesagt, ich kann nachfragen …«
»Verstehe«, meint Lea, kommt zu mir und deutet einladend zum Stuhl, in den ich mich prompt setze. »Ich möchte jemand einstellen, der unbefristet bei uns arbeitet, aber mein Bruder hat seine Bedenken. Sieh die zwei Monate als Probezeit an. Wir sprechen miteinander, wenn sie verstrichen ist. Ich kann dir keine Hoffnungen machen, würde mich aber wirklich freuen, wenn du dich bewährst und dauerhaft hier auf dem Hof siehst. Ich kann dich gut leiden und das ist mir in puncto Zusammenarbeit wichtig. Wichtiger als Fachkenntnisse, die sich jeder halbwegs intelligente Mensch schließlich auf verschiedene Weise aneignen kann.«
»Es ist also eine Probezeit, ich verstehe.«
»Ja, genau«, antwortet sie, »und das Maximale, was ich bei meinem Bruder herausholen konnte, nachdem ich erwähnt habe, dass du aus der Bürobranche kommst. Versteh es nicht falsch. Er hat keine Zeit und Nerven, um alle paar Tage neue Leute einzuarbeiten.«
»Das kann ich nachvollziehen und danke, für deine offenen Worte, Lea.«
»Von mir immer gern. Schon am Telefon warst du meine Favoritin. Solltest du dich in der Probezeit bewähren, kann er gar nicht anders, als einem unbefristeten Vertrag zuzustimmen. Oft wollen es die Mitarbeiter gar nicht, weil sie weiterziehen. Oder sich überschätzen. Nicht vergessen, für jemand aus dem Büro ist es nun einmal ein Knochenjob. Alles liegt allein an dir«, erklärt sie und lächelt hinreißend. Das Telefon klingelt wiederholt, daher sieht sie entschuldigend zu mir.
»Okay, ich lasse es mir durch den Kopf gehen und melde mich wie vorhin besprochen. Es geht hier wohl zur Sache.«
»Nur im Augenblick. Eigentlich läuft alles entspannt. Uns ist ein fürchterlicher Fehler unterlaufen, den wir nun umständlich ausbügeln müssen. Der Händler ist ein gewiefter Geschäftsmann und will logischerweise das Beste für sich herausholen.«
»Verstehe, dann schleiche ich mich leise hinaus.«
»Ich freue mich, bald von dir zu hören«, versichert Lea und hebt den Telefonhörer ab.
Im Hinausgehen sehe ich sie winken und höre, wie sie sich mit ihrem Nachnamen meldet. Aufmerksam schaut sie mir lange hinterher, wie ich über den Hof zum Auto schlendere, während sie am Telefon mit dem Händler die Höhe des Preisnachlasses verhandelt.
Kapitel 3

D
a der Kalender Mitte März zeigt, verdunkelt sich der Himmel auf der Heimfahrt bereits. In Berlin angekommen, ist das Licht des Tages längst Geschichte. Ebenso das fröhliche Zwitschern der Vögel, die im Hausbaum gesessen und einander mit Balzrufen angelockt haben. Ihr munteres Singen klingt lange in mir nach, denn ich empfinde den Hof als pure Natur, die ich in den Straßenschluchten von Berlin vermisse.
Hier nehmen die Stadtbewohner einen Baum vor dem Haus schon als ein seltenes Glück wahr. Geräuschlosigkeit ist, wenn überhaupt, nur in den eigenen vier Wänden zu finden.
Für mich war es ein Tag voller Gegensätze. Hektische Arbeit, möglichst ohne eigene Persönlichkeit, danach idyllische Landatmosphäre mit der ausgeglichenen Lea. Zuletzt wieder die Großstadthektik mit Autohupen, teilweise aggressiven Menschen und wenig Stille.
Ein Punkt geht an den Dreiseithof.
Wie jeden Abend fliegen meine Pumps in die erstbeste Ecke. Ich entdecke Bernds Schuhe im Schuhregal und spähe in die Küche. Niemand da. Bestimmt ist er in seinem Zimmer.
Ich lege den Vertrag auf den Küchentisch und stelle den Wasserkocher an. Kurz darauf sprudelt das Wasser und ich gieße es in meine Teetasse. Hm, wie wunderbar der Kräutertee duftet. Am großen Küchentisch schreibe ich Pro und Contra auf jeweils ein Blatt Papier, damit ich zusätzlich zu meinen Gedanken einen visuellen Eindruck erhalte. Dafür bekritzele ich zwei Notizzettel mit jeweilig einer Sichtweise, die ich zu jeder Variante habe, während der grüne Tee durchzieht.
Gärtnerei
Ohne Kopfschmerzen
Sinnvoll
Hoffnung auf ein erfülltes Leben
Befristet/Probezeit
Bürojob
Kopfschmerzen/Versetzung
Sinnlosigkeit
Überforderung
Unzufriedenheit
Unbefristet
Ich schlürfe einen Schluck von dem heißen Tee und stelle prompt fest, wohin ein weiterer Punkt geht. Trotz neuer Probezeit. Ich möchte keine täglichen Kopfschmerzen mehr.
Zwei zu null für die Gärtnerei.
Wenn ich an die finanzielle Sicherheit denke, müsste ich in dem derzeitigen Job bleiben. Ich schiebe die Zettel fort und raufe mir verzweifelt die Haare, denn gefühlt finde ich mich in einer Sackgasse wieder.
Geräuschvoll schlurft Bernd in die Küche.
Schwerfällig plumpst er auf einen Stuhl. Ich hebe meinen Blick nicht an, nehme aber aus den Augenwinkeln wahr, wie er meine Stichpunkte durchliest. Anschließend beäugt er den Mustervertrag.
»Du bist bei dem Vorstellungsgespräch gewesen?«
»Jep.«
»Habe an dich gedacht. Wie ist es gelaufen?«
Sobald ich aufsehe, bleibe ich an seinen dunkelbraunen Augen kleben, die mich an einen knuffigen Teddybären erinnern. In ihnen steht eine unverkennbare Unruhe. Seine großen, runden und immer traurigen Augen ruhen erwartungsvoll auf meinem Gesicht. Die grau melierten Haare hängen fettig herunter und seinem Kinn täte eine Rasur nicht schlecht.
»Habe gerade eine Pro- und Contra Liste geschrieben«, murmele ich und kann nicht fortsehen.
»Du immer mit deinen Listen«, murrt er und dreht den Zettel mit den Kontra-Punkten mit einem Finger so, dass er problemlos alles durchlesen kann. »Suchst einen neuen Job und bei Contra hängst du jetzt fest? Das ist so typisch für dich. Nächtelang an ellenlangen Listen zu tüfteln, ist eben kompletter Irrsinn.«
»Die Stelle ist auf zwei Monate befristet, weil ich aus dem Büro komme. Es ist eine Probezeit«, erkläre ich, schiebe den Vertrag zur Seite und übergehe gewohnheitsmäßig seinen Einwand. Er hält meine Listen-Marotte für hirnverbrannt und betrachtet sie als reine Zeitverschwendung.
»Der Mitinhaber traut einer aus dem Büro den Job nicht zu. Ich habe in diesem Fall die Qual der Wahl: Versetzung nach München oder Probezeit. Das ist fast genauso ätzend, wie auszuwählen, ob ich an Pest oder Cholera verrecken möchte.«
»Jetzt übertreibst du aber gewaltig. Und überhaupt: Seit wann ist die Meinung anderer für dein Leben entscheidend? Denke einmal an all die hirnrissigen Listen an deiner Pinnwand. Wozu machst du dir überhaupt die Mühe, alles minutiös aufzuschreiben, wenn du jetzt sowieso hier sitzt, und klein beigibst?«
»Er wird seine berechtigten Gründe und Erfahrungen diesbezüglich gemacht haben. Die muss ich nicht zwangsläufig nachvollziehen.«
»Papperlapapp! Kann doch egal sein, was er erlebt hat, oder dir zutraut, solange ›du‹ es dir zutraust.«
»Da gibt mir vermutlich der Richtige reizend klingende Lebenstipps«, gluckse ich amüsiert.
»Gut, dann sage ich eben nichts mehr dazu.«
Eingeschnappt, lehnt er sich zurück und sieht stur an mir vorbei.
»Ich bekomme dort ein Zimmer, was erheblich Spritkosten und Fahrzeiten spart. Unter dem Strich bleibt mir dadurch mehr Freizeit«, ergänze ich.
Bernd reißt seine Augen auf. Ich kenne ihn inzwischen gut genug, um zu wissen, welcher Gedanke nun durch seinen Schädel rast. Hundertprozentig rattert es in seinem Oberstübchen, wie er allein zurechtkommt. Ob er überhaupt klarkommt. Ohne vertraute Gespräche und die beruhigende Gewissheit, dass irgendwer im Zimmer nebenan schläft.
»Ich dachte, weil du dich von Benno getrennt hast … stattdessen gehst du demnächst auch?«
Bekümmert schaut er auf die Tischplatte. Ich schiebe meine Hand herüber. Etappenweise atme ich aus, denn ich verspüre keinerlei Lust, das heikle Thema zum dreihundertsten Mal durchzukauen.
»Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Benno hat mich verlassen«, antworte ich und ziehe meine Hand ein, die er in seinem Kummer unbeachtet lässt. »Und ich brauche mehr, als mich ständig an eine andere Stelle versetzen zu lassen. Wer möchte sich schon austauschbar wie ein Möbelstück fühlen oder nur eine Nummer in der Personalabteilung sein?«
»Zwei Monate sind lang.«
Er geht nicht darauf ein. Bin ich etwa davon ausgegangen? Nun, in dem Fall bin ich soeben eines Besseren belehrt worden.
»Nein, sind sie nicht.«
»Doch, denn in zwei Monaten kann viel passieren.«
»Von allein passiert nicht viel.«
Ich raffe mich auf, klaube Zettel und Vertrag vom Tisch. Heute kommen wir an diesem Punkt nicht weiter. Mein Herz holpert.
Es rebelliert.
»Dir ist es wirklich ernst?«
Im Türrahmen bleibe ich stehen. Auf Schlag jagen tausend Antworten auf einmal durch den Kopf, doch keine wäre auch nur annähernd fair. Ich schätze Benno als Mensch, ertrage es aber nicht, wie er sich fortwährend hängen lässt, statt das Leben mit den eigenen Händen zu gestalten. Immer wartet er auf irgendwen oder irgendetwas. Jemand, der für ihn alles besser macht.
»Wenn du deiner Frau auch nach Jahren nachtrauerst, bitte schön. Wenn du für den Rest deines Lebens damit zubringen willst, zu jammern, statt dich zu verändern, bitte schön. Ich mag dich, aber du erdrückst alles und jeden mit deinem Kummer. Mich wundert es nicht, dass deine Frau die Kraft verlassen und sie sich von dir scheiden lassen hat. So ergeht es jedem, der mit dir zusammen ist. Ich wünsche mir, du begreifst eines Tages, dass du es bist, der dir im Weg steht. Hole dir Hilfe und lass den liebevollen, zärtlichen Mann in dir endlich glücklich werden.«
Bernd taumelt, schluchzt auf. Er sackt regelrecht auf seinem Stuhl zusammen und bricht in Tränen aus. Statt ihn zu trösten, wende ich mich ab und eile in mein Zimmer. Ich kann ihn jetzt nicht aufrichten und überlasse ihn seinen Gefühlen, mit denen er seinen Weg finden muss.
In meinem Zimmer angekommen, telefoniere ich mit meiner Mutter und berichte von der Zusage der Staudengärtnerei. Sie reagiert geschockt, weil sie es deutlich unter meiner Würde sieht, als gelernte Bürokauffrau eine Arbeit in einer Gärtnerei aufzunehmen. Dann auch noch einen Aushilfsjob. Es dauert eine Weile, in der ich ihr exakt darlege, warum ich mich mit dem, für sie erstklassigen, Bürojob unzufrieden fühle.
»Warum hast du es nie erwähnt?«
»Dass ich versetzt werden soll? Jeden Tag habe ich Kopfschmerzen, wenn ich von der Arbeit komme, seitdem ich von der Versetzung weiß. Wozu dich damit unnötig belasten? Es reicht doch, wenn es einem von uns mies dabei geht.«
»Deine Sorgen sind doch erst recht meine Sorgen, Kind. Deine Beweggründe verstehe ich nicht zu einhundert Prozent, was aber nicht automatisch bedeutet, dass ich mit ansehen möchte, wie du jeden Tag unglücklicher wirst. Wenn du etwas Anderes ausprobieren möchtest, begrüße ich das auf jeden Fall.«
»Wie sich das anhört: Ausprobieren. Ich ziehe nicht meilenweit für einen Job fort, der mich nur halb so viel begeistert wie der, dem ich jetzt ohne Herzblut nachgehe. Möglicherweise ist es ein riskanter Weg, warum aber nicht in einer Gärtnerei neu anfangen? Mein erlernter Beruf bleibt mir erhalten und ich greife darauf zurück, wenn sich das Experiment als ein Schuss ins Leere erweist. Mehr ins Klo greifen als im Augenblick, geht doch kaum noch. Was habe ich zu verlieren? Ich muss etwas ändern. Jetzt, denn mein Chef drängelt schon wegen des Termins und ich habe keine Lust, es länger aufzuschieben. Am Anfang war ich über die Probezeit geschockt, aber inzwischen sehe ich es rational. Schließlich möchte ich auch austesten, ob es das Richtige für mich ist. Wenn nicht, bin ich nicht bis zu meinem Renteneintritt daran gebunden. Ich fühle mich in meinen Entscheidungen frei. Das ist der springende Punkt.«
»Dann ändere ›jetzt‹ etwas an deiner Situation«, meint sie energisch. »Du bist jung. Wenn du etwas brauchst, dann lass es uns wissen. Wir helfen dir gerne.«
»Danke, das ist lieb von euch, doch ich hoffe, dass es nicht so arg kommt. Dürfte ich im Notfall wieder bei euch einziehen? Nur im Notfall versteht sich.«
»Logisch kannst du das«, gackert sie belustigt in das Telefon.
Mir wird warm ums Herz. Es sind ihre Worte, die das wunderbare Gefühl auslösen. Mit meiner Hand streiche ich mir eine Falte am Oberteil glatt, obwohl dort keine zu sehen ist. Für einen kurzen Atemzug fühle ich mich erschöpft. Mir wird bewusst, wie groß der Schritt ist, den ich demnächst gehe. Ohne Seil und doppelten Boden.
Na ja, nicht auf Gedeih und Verderb, denn meine Familie fängt mich im Notfall auf.
»Wann geht es denn los?«, erkundigt sie sich nach einer kleinen Pause.
»In vier Wochen. Ich wohne dort in einem Zimmer. Stell dir vor, im Altenteil«, grinse ich bis zu den Ohren, obwohl sie mich nicht sieht.
»Na, wie das klingt: Altenteil. Das ist doch eher was für mich, als für dich, du junges Huhn«, spöttelt sie.
»Dann besuche mich.«
»Wenn das eine Einladung sein soll, nehme ich die glatt an.«
»Es war eine. So, Mama, ich fühle mich wie nach einem Marathon und husche brav ins warme Bett. Wir sprechen an einem anderen Tag ausführlich darüber, ja?«
Ich beende das Gespräch und stelle mich vor meine Pinnwand. Mit dem Lohn bin ich in der Lage, mich zu versorgen und sogar einen kleinen Teil als Reserve beiseitezulegen. Meine Eltern fangen mich auf, falls ich die Probezeit nicht bestehe oder andere Komplikationen auftreten. Meine Sorgen sind letzten Endes doch kein Anlass, mir stundenlang die Haare zu raufen. Dieser Punkt geht ebenfalls an die Gärtnerei.
Drei zu null.
Mein Blick gleitet über die nächste Zeile. Dort steht Hoffnung. Ja, die habe ich. Jetzt.
Wieder.
Ich habe Hoffnung auf ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben. In diesem Wort steckt so viel. Alle anderen, der notierten Wörter, wirken dagegen glattweg unbedeutend. Ich möchte etwas Anderes, als tagein, tagaus zu funktionieren und zu überleben. Ich möchte leben.
Jetzt, nicht erst morgen oder irgendwann einmal.
Mein Herz entscheidet. Keine Möhre vor der Nase, kein Hamsterrad, sondern absolute Selbstbestimmung.
Vier zu null.
Mit einem ausladenden Schmunzeln unterzeichne ich die Verträge und stecke sie in einen Briefumschlag. Morgen bringe ich ihn zur Post. Lea rufe ich anschließend an, obwohl ich den Brief ohnehin als Einschreiben mit Rückschein versende. Es ist beschlossene Sache und sie soll schnellstmöglich erfahren, dass ihre Suche nach einem neuen Mitarbeiter vorerst beendet ist.
Ich nehme das Stellenangebot an.
Nachdem ich meine Kündigung formuliert und zu Papier gebracht habe, lege ich mich in mein Bett und schaue an die Decke. Mein Herz klopft, denn eben habe ich die Weichen für mein Leben neu gestellt. In absehbarer Zeit verlasse ich den sicheren Hafen und wage ein Abenteuer. Dabei hoffe ich, den Herausforderungen gewachsen zu sein, den Muskelkater und die abgebrochenen Fingernägel zu überstehen.
Andererseits: Was bedeuten abgebrochene Fingernägel, wenn ein Leben ohne tägliche Kopfschmerzen und Selbstbestimmung winkt?
Kapitel 4

E
rstklassig gelaunt, erscheine ich am nächsten Morgen im Büro und bitte meinen Büroleiter um ein kurzes Gespräch. In dem erkläre ich ihm, dass die Versetzung für mich nicht infrage kommt und überreiche das Kündigungsschreiben. Zerknirscht akzeptiert er meine Entscheidung. Damit ist heute mein erster Arbeitstag seit Langem, an dem mich nach Feierabend keine Kopfschmerzen plagen.
Wie verabredet, teile ich Lea am späten Nachmittag mit, dass ich den Job annehme. Die Verträge sind inzwischen unterzeichnet auf dem Postweg. Dazu wähle ich die Telefonnummer ihres Büros.
Es klingelt.
Ich höre eine Männerstimme, die sich mit Kroll meldet und bin irritiert, weil ich mit Lea gerechnet habe. Und die heißt mit Nachnamen Winter. Fieberhaft überlege ich, ob ich die korrekte Telefonnummer gewählt habe.
»Guten Tag, hier ist Amelie. Ähm, Amelie Richter. Ich möchte mit Lea Winter sprechen«, beginne ich ungewohnt fahrig und mit viel zu hoher Tonlage. Darum räuspere ich mich kurz einmal, stelle beide Beine auf den Fußboden und rüttele mich innerlich wach. In meinem Beruf werde ich täglich mit unvorhergesehenen Situationen am Telefon konfrontiert.
Kein Beinbruch.
»Lea ist nicht im Büro. Soll ich ihr etwas ausrichten?«
Der Mann klingt kurz angebunden. Gut, wenigstens habe ich mich nicht verwählt und bin bei einem Mitarbeiter gelandet.
»Richten Sie ihr bitte aus, dass ich das Stellenangebot annehme. Die Verträge kommen per Einschreiben. Wenn möglich, würde ich es ihr gerne persönlich mitteilen wollen.«
Eine Weile herrscht Grabesstille in der Leitung.
»Sind Sie noch dran?«, vergewissere ich mich.
»Für persönlich müssen Sie vorbeikommen.«
Über die abweisende Art sprachlos, öffne ich verdattert meinen Mund. Er klingt absolut unfreundlich. Beinahe feindselig. Himmel, was arbeiten dort nur für Exzentriker. Gestern habe ich die Schönste aus dem Dorf kennengelernt, heute einen Autisten, der die deutsche Sprache sehr genau nimmt und mir die Bedeutung der Wörter näherbringen möchte.
Ist bestimmt nett gemeint, wirkt aber irgendwie skurril auf mich.
In Ordnung. Einmal kurz durchsortieren und tief Luft holen. Danach versuche ich, mich so auszudrücken, dass mein Gesprächspartner mit meinen Gedanken mitkommt.
»Mit persönlich meine ich telefonisch-persönlich«, korrigiere ich gedehnt, damit es bei ihm selbst im hintersten Winkel des Oberstübchens verständlich ankommt.
Guter Dinge, mein Anliegen exakt formuliert zu haben, betrachte ich die Wand vor mir und bin fest entschlossen, mir meine gute Laune nicht vermiesen zu lassen. Mein Beruf bringt es mit sich, dass zwangsläufig nicht jedes Telefonat unkompliziert verläuft.
Scheinbar auch dieses. Es gibt eben überall schlecht gelaunte oder wundersame Menschen, denen eine Laus über die Leber gelaufen ist. Nichts, was mich beunruhigen sollte.
»Wie zuvor erwähnt: Für persönlich wäre Ihre Anwesenheit vor Ort nötig, finden Sie nicht?«, entgegnet er ein wenig gereizt.
Jetzt fühle ich mich von der beharrlichen Art angepickt, mit der er mir anscheinend den letzten Nerv rauben will. Es gibt drei Arten von Stinkstiefeln am Telefon. Stinkstiefel, übler Stinkstiefel und ganz übler Stinkstiefel. Mit Letzterem habe ich es anscheinend zu tun, denn ein Mensch mit einem Handicap hätte es definitiv anders formuliert.
Ich meine damit, er würde es weniger genervt ausdrücken, eher trockener und die Wörter nicht künstlich in die Länge ziehen. Das wirkt gnadenlos abweisend.
Dieser Stinkstiefel verkackalbert mich offensichtlich. Bis eben habe ich mich bemüht, umgänglich zu bleiben, jedoch reißt unvermittelt mein Geduldsfaden. Ich hole meine imaginäre Kalaschnikow heraus und bringe sie in Position.
»Ich bin persönlich am Telefon und möchte Lea telefonisch sprechen. Reicht das für persönlich telefonisch aus?«
Um meinen Worten Nachdruck zu verleihen, setze ich mich kerzengerade auf den Stuhl. Beide Füße stehen nebeneinander auf dem Boden. Nun klinge ich ebenfalls unfreundlich.
Mein Gesprächspartner gibt keinen Ton von sich. Dennoch belasse ich vorsorglich meinen Finger am Abzug. Man weiß ja nie.
»Ich richte es ihr aus«, murmelt er und klingt gelangweilt.
Woher weiß er, was er ihr ausrichten soll? Ich möchte Lea sprechen und sicherstellen, dass er ihr etwas Falsches ausrichtet und mich gewissenlos abwimmelt. Unruhig straffe ich mich und schaue an meine Pinnwand, wo meine Wunschlisten hängen.
Ruhig Blut, Amelie. Tief durchatmen.
Möglicherweise hat er emotionale Probleme. Eventuell steckt er mitten in einem unschönen Rosenkrieg und verabscheut für die nächsten drei Jahre Frauen, weil ihn seine derzeit über den eingedeckten Tisch zieht. Es käme auch ein familiärer Todesfall in Betracht. Schreckliche Sache, die durchaus den gescheitesten Menschen durchrütteln kann. Nachvollziehbar, wenn der Tonfall in so einer Ausnahmesituation nicht nett oder weltoffen klingt.
Mir scheint, es gibt tausende von Gründen, unhöflich zu sein.
»Und, mit wem hatte ich das Vergnügen dieses kurzweiligen Telefonats?«, erkundige ich mich bissiger als beabsichtigt. »Nur für mich zur Information. Da weiß ich, wem ich in den Hintern treten kann, wenn ich persönlich vorbeikomme und Lea nicht ausgerichtet wurde, dass ich sie heute sprechen wollte.«
»Mit Alan Kroll.«
»Gut, ist notiert, Alan Kroll. Alles klar. Nur für den Fall, du verstehst? Da weiß ich jetzt Bescheid, wer meine Nachricht nicht weitergeleitet hat.«
»Das denke ich nicht.«
»Was?«
»Ich denke nicht, dass du Bescheid weißt. Du sprichst mit Alan Kroll.«
Alan Kroll, Alan Kroll, Alan Kroll …
Nee, das sagt mir nichts. Er tut gerade so, als ob er drei Tage in den Abendnachrichten zu sehen gewesen und ein ganz hohes Tier ist.
»Sagt mir nichts. Muss ich Sie kennen?«
»Ich bin der Bruder von Lea.«
Aha.
Ohh.
Kennt ihr das Gefühl bei einem Bungee-Jumping? Ihr springt freudig jauchzend in eine irre tiefe Schlucht und berauscht euch an dem unglaublichen Gefühl des freien Falls. Doch irgendwann kommt der heikle Punkt, an dem das Band die maximale Dehnung erreicht.
Genau an diesem Punkt befinde ich mich gegenwärtig.
In Zeitlupe begreife ich, dass es mit einem Schlag wieder nach oben geht. Und zwar derart rasant, dass mir dabei schlecht wird und ich mich am liebsten übergeben möchte.
Das Herz rutscht nicht nur in die Hose, sondern eine Etage weiter in die Schuhe, dermaßen schnell vollzieht sich der Richtungswechsel. Der komplette Körper reagiert entsetzt, während der Kopf noch ewig im freien Fall festhängt. Entsprechend schlucke ich schwer.
Alan Kroll bemerkt es hundertprozentig.
»So«, trällert er und wirkt plötzlich bestens aufgelegt, »jetzt bin ich gespannt, wie du mir in den Hintern treten willst. So persönlich durch das Telefon und so.«
Seine Stimme klingt nicht laut, aber eindringlich und zu Teilen finster. Ich sage vorerst keinen Mucks und blicke betreten drein. Mit einem Schlag habe ich meinen zukünftigen Chef verschnupft. Nachdem mir das klar geworden ist, ist es bereits zu spät. Halbseidene Ausflüchte und Kriecherei sind mir verhasst, darum gehe ich in die Offensive.
»Nicht persönlich durch das Telefon. Nur persönlich vor Ort. Macht mir mehr Freude, Alan Kroll«, erwidere ich, ohne großartig nachzudenken.
Aus mir unerfindlichen Gründen will und kann ich, trotz besseren Wissens, die Bremse nicht treten. Wahrscheinlich steckt mein Kopf noch im freien Fall fest und fühlt sich unbesiegbar.
Zumindest vorerst.
Auch ich spreche meine Sätze entschlossen. In einem Kommunikationsseminar habe ich gelernt, meine Stimme in so einer Situation, ja nicht piepsig oder schrill klingen zu lassen. Eine Menge Frauen piepsen, wenn sie sich emotional aufgewühlt fühlen. Das nervt und klingt zudem meist hysterisch. Anschließend wundern sie sich, wenn sie von ihrem Gegenüber nicht ernst genommen werden.
»Fein, fein. Dir ist doch hoffentlich klar, dass du unter mir arbeitest, oder? Ich mag dich jetzt schon so richtig leiden, Amelie Richter«, gibt er offen zu und mit einem Unterton, der mich moralisch darauf vorbereitet, dass es harte acht Wochen für mich werden. »Dann sehen wir uns demnächst und erfahren dann, wer hier wen in den Allerwertesten tritt. Ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit.«
Grient er etwa am anderen Ende der Leitung? Klingt so, denn ›Zusammenarbeit‹ kommt lang gezogen durch die Leitung und verursacht eine unangenehme Ganzkörper-Gänsehaut.
»Na wunderbar, da liegt die Sympathie schon auf zwei Seiten. Was wollen wir mehr? Ich könnte jetzt zurückrudern, aber das mache ich nicht und bin vielmehr gespannt darauf, welcher Hintern mich erwartet. Richte Lea aus, ich bin in vier Wochen da.«
»Mache ich, Bürohäschen«, entgegnet er gelassen.
»Fabelhaft. Ach, übrigens, falls du Arschkriecher suchst, unterschreibe meinen Arbeitsvertrag besser nicht. Wenn ich eine Meinung habe, vertrete ich diese auch. Egal, ob ich unter dir oder unter dem Kaiser von Kenia arbeite.«
»Arschkriecherin.«
»Bitte?«, frage ich platt wie Omas frisch gebackener Pfannkuchen.
»Die korrekte Aussprache muss die weibliche Form beinhalten. Dementsprechend heißt es Arschkriecherin, nicht Arschkriecher. Kenia hat keinen Kaiser«, belehrt er mich, wobei mir seine Tonlage eine Spur zu überheblich klingt.
»Du mich auch«, lächele ich honigsüß in das Telefon und strecke gedanklich meinen Mittelfinger in die Höhe.
Mein Herz schlägt bis zum Hals, nachdem ich das Gespräch beende, ohne seine Antwort abzuwarten. Ich bin mir selbst fremd und verstehe nicht, welcher Teufel mich in diesem Augenblick reitet. Letztlich ist er schließlich nicht irgendwer, sondern der, der mir in wenigen Wochen meinen Lohn zahlt.
Mein Chef.
Na, das war ja der reinste Raketenstart. Wenn er das Gespräch neulich mit mir geführt hätte, würde ich den Arbeitsvertrag gewiss nicht einmal vor mir liegend ansehen dürfen. Mit Sicherheit wäre ich nach zwei Minuten im hohen Bogen aus dem Büro geflogen.
Andererseits wäre das Telefonat vermutlich besser gelaufen, wenn er mit mir gesprochen hätte, statt irgendwo in der Weltgeschichte herumzudüsen. Lea hat ja durchschimmern lassen, dass er wenig begeistert gewesen ist, als er von meinem Beruf erfahren hat.
Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte ich bestimmt nicht einmal eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen. Das Telefonat verfestigt garantiert seine Ansicht, dass Bürokauffrauen die reinsten Zimtzicken sind. Lea hat gestern erwähnt, dass es an mir liegt, ob ich die Probezeit bestehe. Ist dem so, werde ich den Beweis erbringen müssen, dass ein Bürohäschen mehr kann, als sich stundenlang hübsch die Nägel zu lackieren.
Der Dorftrottel wird mich ›Häschen‹ schon noch kennenlernen. Ich habe in meiner alten Firma gekündigt. Egal, ob er unterschreibt oder nicht, mein berufliches Leben geht so oder so weiter. Wenn ich die acht Wochen Probezeit nicht überstehe, pumpe ich meine Eltern an und suche eine neue Anstellung.
Nur eben ohne tägliche Kopfschmerzen, so viel steht fest.
***
Da ich Resturlaub habe, ist mein letzter Arbeitstag in einer Woche. Die bemühe ich mich, anständig hinter mich zu bringen. Das Brimborium der Verabschiedung ist schwer zu ertragen, wohingegen das Zusammensuchen meiner Siebensachen Jubel in mir auslöst. Dann stehe ich das letzte Mal vor dem Bürokomplex und fahre in dem Wissen heim, nie wieder einen Fuß über diese Schwelle zu setzen.
Bis ich die neue Stelle antrete, bleiben mir zwei Wochen, die ich nutze, um mir passende Kleidung zu besorgen. Ich benötige bequeme Schuhe, Hosen, Jacken und Shirts. Ich renne von Berufsbekleidungsladen zu Berufsbekleidungsladen, wälze Unmengen an Kataloge für Arbeitsklamotten und bestelle bequeme Ausrüstung, die auch ohne Unterschrift auf dem Arbeitsvertrag tragbar ist.
Insbesondere lege ich Wert auf solide Schuhe, die bequem, luftdurchlässig und dennoch arbeitssicher sind. Über den Arbeitstag sollten sie nicht wie Klötze an den Füßen hängen, wenn möglich den Körper nicht ermüden und sich problemlos in den Hintern von Vorgesetzten treten lassen.
Auf diese Weise stapelt sich in meinem Zimmer nach und nach Kleidung, die ich früher nicht einmal im Traum in Erwägung gezogen hätte, zu shoppen. Wie enorm die Umstellung ist, erkenne ich zweifelsfrei an dem stetig wachsenden Turm aus neuen Klamotten.
Nur wenig von der Kleidung, die ich im Büro trage, erweist sich bei der neuen Arbeitsstelle als zweckmäßig. Demzufolge lege ich nur zwei Lieblingsklamotten zu diesem Stapel. Die nehme ich mit. Möglicherweise möchte ich am Wochenende durch das Dorf spazieren gehen und irgendwo zünftig essen.
Das kann ich schlecht in Arbeitsklamotten.
Für zwei Tage besuche ich meine Eltern. Unmittelbar, nachdem ich durch die Eingangstür trete, mutiere ich sofort zur Tochter. Mir werden alle meine Lieblingsspeisen vorgesetzt, meine Mutter spricht viel mit mir und fragt mich über mein Vorankommen in puncto Vorbereitungen für den neuen Arbeitsplatz aus.
Sie geht mit mir die fehlenden Sachen einkaufen und freut sich, dass ich neuerdings jeden Morgen vor dem Frühstück jogge. Sie scheint entzückt, weil ich meine Tage ohne Kopfschmerzen verbringe und alle nasenlang ein albernes Gelächter anstimme. Einfach alles fühlt sich wesentlich anders an als noch vor Wochen. Ich fühle mich um geschätzte fünfzig Kilo leichter, schleppe keine unsichtbaren Lasten mehr mit mir herum und habe endlich wieder Spaß am Leben.
Bei einem unserer Einkäufe landet eine Jogginghose in meinem Einkaufsbeutel. Meiner Mutter besteht darauf, sie zu bezahlen. Hinterher leuchte ich schamrot im Gesicht, aber überglücklich wie ein kleines Kind, das ein neues, großartiges Spielzeug geschenkt bekommen hat.
Die Tage vergehen zu schnell und der Abschied fällt entsprechend schwer. Wie meistens. Meine Mutter verspricht hoch und heilig, mich für ein Wochenende auf dem Dreiseithof zu besuchen. Ein wenig beklommen wegen der bedeutsamen Veränderung fühle ich mich schon, aber sie ermuntert mich fortwährend.
***
Rechtzeitig vor meiner Abreise bin ich in der Wohngemeinschaft zurück. Meine Sachen sind gepackt. Aktuell stapeln sich keine Kisten mehr in meinem Zimmer, sondern drei Koffer, die ich mit klopfendem Herzen ansehe.
Ich habe das Gespräch mit Leas Bruder nicht vergessen und mir, auf Anraten meiner Mutter, genug Zeug eingepackt, welches bei Muskelverspannungen hilft. Falls mein Vorgesetzter mir blöde kommt, kann ich notfalls auch vor den acht Wochen gehen.
Ich beabsichtige jedoch, ihn zu überraschen.
Er hat mich abfällig ›Bürohäschen‹ genannt und dabei schrecklich dünkelhaft geklungen. Dem werde ich zeigen, wozu ein Bürohäschen fähig ist. Der wird Bauklötze staunen.
Morgen früh ist es endlich so weit. Mein erster Arbeitstag in der Gärtnerei beginnt um acht Uhr in der Frühe. Am Abend vor der Abreise gehe ich die Liste durch, die ich vor Wochen erstellt habe.
Alles ist mit etlichen Häkchen als erledigt markiert. Bis auf einen Punkt. Ganz unten habe ich etwas in Klammern notiert. Ich habe sicherheitshalber einen ›Eventuell-Punkt‹ hinzugefügt, denn ich wollte mir noch gründlich überlegen, ob ich ihn überhaupt umsetze.
Wer weiß, wann ich wieder …?
Und in einem Dorf gestaltet es sich nicht ganz unproblematisch. Na ja, dann erst die verminderte Auswahl. Schließlich gibt es dort schon rein rechnerisch weniger Männer als in einer Großstadt.
In der Konsequenz beschließe ich, für Bernd und mich zu kochen. Was soll es, er wird gewiss nicht ablehnen.
***
Durch den einladenden Geruch angelockt, kommt er in die Küche geschlichen. Von der Arbeit zerschlagen, schlurft er näher. In letzter Zeit wirkt er derart energielos, dass er sich nicht einmal bei der Rasur in den Spiegel schaut. Ich vermute, er hasst sich abgrundtief, kann es aber nicht zugeben.
»Na, hast du Hunger?«, frage ich, weil er mit erhobener Nase zu erraten versucht, was ich koche.
Am Herd angekommen, lugt er über meine rechte Schulter in die drei Töpfe, deren Inhalt duftend darin köchelt. Eine Weile sieht er mir über die Schulter zu, wie ich mit dem Kochlöffel die Rahmmöhren umrühre, bevor er mich vorsichtig mit seinen Armen umschlingt.
»Das duftet exzellent.«
Bernd sagt immer ›exzellent‹. Niemals lecker oder köstlich, denn exzellent klingt gebildeter. In lautstarkes Gelächter ausbrechend, drehe ich meinen Kopf in seine Richtung. Ich bin mir unschlüssig, ob er mein Essen meint oder womöglich mich, zumal ich Parfüm hinter meine Ohren getupft habe, an dem ich nun seine kühle Nasenspitze spüre.
»Setz dich doch. Essen ist gleich fertig. Mach inzwischen den Wein auf«, bitte ich ihn und deute unmissverständlich mit dem Holzkochlöffel zum Rotwein, der auf dem eingedeckten Tisch bereitsteht. Es ist seine Lieblingssorte und sicher wird ihm sofort klar, warum ich heute für uns koche, den Tisch geschmackvoll eindecke und hochhackige Schuhe trage.
»Wird das etwa ein Abschiedsessen?«
»In den nächsten zwei Monaten musst du allein essen, daher ja. Chris ist ja noch in Belgien unterwegs, da dachte ich mir, dass ich dich zum Abschied ein wenig verwöhnen möchte.«
Kommentarlos füllt er die Gläser mit dem geöffneten Rotwein und setzt sich an den gedeckten Tisch.
»Lass es dir schmecken. Gibt es etwas Neues bei dir?«, erkundige ich mich und picke eine Möhre auf die Gabel.
»Ein neues Projekt und ich leite es.«
»Klingt doch fabelhaft. Was ist es denn für ein Projekt?«
»Die Oper wird saniert.«
Erstaunt sehe ich den blassen und teilnahmslos wirkenden Mann an. Die Arbeiten zu leiten, wird garantiert nicht jeden x-beliebigen Mitarbeiter übertragen.
»Das klingt großartig. Finde ich erfreulich. Eine Menge Arbeit kommt auf dich zu, aber mit diesem Projekt kannst du dir bestimmt einen Namen machen.«
»Einen Namen habe ich.«
Geräuschvoll knallt er die Gabel auf den Tisch und kleckert durch den Schwung einen Schwall Soße auf die blütenweiße Tischdecke. Mir wird schwer ums Herz. Bedröppelt schaue ich ihn an, denn meine Freude kommt aus tiefster Seele.
»Tut mir leid. Klingt es doof? So war es nicht gemeint.«
»Wie dann?«, schreit er ungehalten los, springt auf und fegt getrieben in der Küche hin und her. Endlich bleibt er vor mir stehen, schaut mich verzweifelt an und kratzt sich nachdenklich an der Stirn. »Entschuldige, Amelie. Ich bin inzwischen nur noch ein nervliches Wrack. Chris ist seit Ewigkeiten in Belgien und du gehst morgen früh für zwei Monate fort. Alle gehen weg. Immer lassen mich alle allein.«
Sein Problem ist ihm klar, wenn er auch die Personen durcheinanderbringt.
Niedergeschlagen blicke ich auf meinen Teller, weil er sich noch nie seiner Einsamkeit im Leben gestellt hat und sich sagenhaft ratlos fühlt. Ich ahne, welche Qualen ihn in den nächsten Wochen erwarten. Zu genau kann ich das Loch vor seinen Füßen erkennen, gleichwohl ihm unmöglich dabei helfen, nicht hineinzufallen.
Davon abgesehen möchte ich es auch nicht mehr.
»Ich weiß.«
»Du weißt einen Scheiß«, fährt er mich an, versprüht dabei Speichel und ist in einem Satz bei mir.
»Nur die wenigen Brocken, die du mir anvertraut hast«, gebe ich kaum merklich zu bedenken und betrachte furchtlos das dunkelrote, erzürnte Gesicht. »Möchtest du mir mehr erzählen?«
Bernds Augen hasten über mein Gesicht und bewegen sich dabei mindestens genauso ungestüm wie Irrlichter in einer dunklen Neumondnacht. Vorsichtig berühre ich seinen Unterarm, worauf er zusammenfährt und aus seiner Starre fällt. Auf den Stuhl sinkend, bebt sein Körper immer stärker, bis er kraftlos in sich zusammensackt.
»Nein, das möchte ich nicht.«
Ich trete zu ihm, drücke behutsam seinen Kopf an meinen Leib und streichele beruhigend die stoppelige Wange. Hilflos umklammert er mich, bis seine Hände an meinen Beinen emporfahren. Was das bedeutet, weiß ich. Er benötigt Trost.
Und ich brauche ihn heute ebenfalls.
***
Zu vorgerückter Stunde liege ich mit ausgebreiteten Armen in seinem Bett und betrachte die Zimmerdecke. Ich fühle mich schwerelos, erschöpft und zufrieden. Bernd atmet inzwischen wieder regelmäßig. Freudestrahlend lächelnd, dreht er sich zu mir.
»Das war genial.«
»Bernd, es war Sex«, erkläre ich nüchtern die Fakten.
»Aber es war genialer Sex.«
»Meinetwegen, war es genialer Sex.«
Es klingt knapper als ursprünglich beabsichtigt. Ich möchte ihm nicht wehtun, aber auch keineswegs ein bestimmtes Thema vertiefen.
»Hast du ihn denn nicht genial gefunden?«
Ich frage mich, was er jetzt von mir erwartet. Wirke ich etwa so, als würde ich mich in einem unaufhaltsamen Rauschzustand befinden. Oder mich, wie von Sinnen, um meine eigene Achse drehen?
»Bernd, sei bitte ehrlich. Ich tröste dich und du tröstest mich. Mehr nicht. Du liebst deine Frau noch immer. Wenn ich mit dir schlafe frage ich mich jedes Mal, ob du sie vor deinem inneren Auge siehst, anstatt mich?«
Er rückt von mir ab, um mich lange zu betrachten.
»Spinnst du jetzt vollkommen?«, fragt er anschließend.
»Nein, Bernd. Das war eine ernst gemeinte Frage.«
Ich richte mich auf und sehe im dürftigen Licht des Zimmers seine dunklen Augen, die durch mich hindurchsehen, als wäre ich transparent. Unangenehm berührt schweigt er. Ich weiß auch ohne seine Antwort längst Bescheid.
Genau genommen wusste ich es schon immer, wollte es aber lange Zeit einfach nicht wahrhaben. Träge krabbele ich aus dem warmen Bett.
»Früher hätte es mir etwas ausgemacht. Da war ich in dich verknallt, aber das war einmal.«
»Du warst in mich verknallt?«
Postwendend bücke ich mich, um mit hastig meine Klamotten aufzuheben, die überall neben dem Bett verstreut liegen. Im Dunkeln mustere ich Bernd, der nackt und ausgestreckt auf dem zerwühlten Bettlaken ausruht.
»Ich habe gesagt, das war einmal. Wie auffallend es dich erstaunt, zeigt mir doch nur einmal mehr … Ich gehe jetzt in mein Bett, denn ich möchte allein sein«, murmele ich und fahre mir durch die wirren und zerzausten Haare.
»Du bleibst nicht hier?«
»Nein, Bernd. Was soll ich hier neben dir? Die Seite des Bettes ist seit Jahren belegt und es gestaltet sich arg eng zu dritt«, entgegne ich gereizt und verlasse unverzüglich das Zimmer.
Niedergeschlagen schaut Bernd hinterher, doch das berührt mich nicht. Ich habe bekommen, was ich wollte. Mehr kann er mir nicht geben. Statt geduldig zu empfangen, habe ich genommen, wonach mir war.
Die Befriedigung meiner körperlichen Lust, ohne das Herz und die Seele daran zu beteiligen. Das hätte ich früher auch schon so halten sollen.
Leider Gottes ist es mir damals aber misslungen.
Kapitel 5

N
och vor dem Morgengrauen starte ich mit meinen gepackten Koffern in Richtung Norden. Es ist noch finster, als ich an einer Tankstelle in Großrachenau anhalte und mir eine Flasche Wasser kaufe. Vor der Tür des Shops nehme ich einen großen Schluck aus der Glasflasche und schaue mich um. Mir bleibt genügend Zeit bis zum Arbeitsantritt, starte also vollkommen entspannt in den Tag.
Gegen eine Wand gelehnt, betrachte ich den atemberaubenden Morgenhimmel. Der Tag zeichnet sich mit einem leuchtend orangeroten Streifen im Osten ab. Spärliche Wolken ziehen auf. Schlechtes Wetter kündigt sich an.
Ich ziehe den Kragen meiner grünen Jacke hoch. Obwohl ich ein langes und kurzärmeliges Shirt übereinander angezogen habe, fröstelt es mich. Die schwarze Arbeitshose wärmt ebenfalls nicht sonderlich. Wenigstens sind meine Füße, die in grünen Arbeitsschuhen stecken, warm. Vielleicht rührt das leichte Frösteln der Anspannung. Wegen der ungewohnt frühen Stunde und der Aufregung.
Meistens werde ich zudem erst in einer Stunde munter. Für gewöhnlich liege ich um diese Zeit eingekuschelt im Bett und rolle mich mindestens noch dreieinhalb Mal behaglich auf die andere Seite. Heute dagegen fühle ich mich ruhelos und könnte den Adrenalinüberschuss locker an Hormonbedürftige verkaufen. Ich sehe hier allerdings niemanden, der infrage kommt und muss folglich allein damit klarkommen.
Hier auf dem Land passiert um diese Zeit noch nicht viel, daher erwäge ich ernsthaft, in mein warmes Auto zu steigen und dort mein Wasser zu trinken. Ich bin die einzige Kundin, bis eine dunkelblaue Familienkutsche die Tankstelle besucht.
Oho, denke ich spöttisch, das Leben auf dem Lande startet und ich darf live dabei sein. Mäßig interessiert wende ich mich von dem reizenden Morgenhimmel ab und beobachte den dunkelblauen Kombi, der an einer Zapfsäule hält.
Die Fahrertür öffnet sich. Ein Mann steigt aus. Er beguckt mich aus der Ferne.
»Morgen.«
»Morgen«, gebe ich deutlich hörbar zurück.
Wenigstens scheinen die Menschen aus dieser Gegend wohlerzogen und grüßen sogar Fremde. Ich beobachte, wie der Mann um seinen Wagen schreitet, die Tankklappe öffnet und den Tankschlauch hineinsteckt. Das Nummernschild verrät mir, dass er aus der Gegend stammt.
Ich schätze ihn auf etwa Mitte dreißig. Er trägt Kleidung, die ich eher in einem Berliner Szeneviertel erwarte als hier auf dem Dorf. Alberne, festgefahrene Denkmuster aber auch. Die Dorfbewohner sind ja nicht unbedingt Hinterwäldler.
Zurück zu dem Mann. Seine Haare sind braun, bis dunkelbraun, kurz geschnitten und gehen nahtlos in einen Zwei-Tage-Bart über, durch den die gebräunte Gesichtshaut durchschimmert. Er wendet mir sein Gesicht zu. Dunkle Augen betrachten mich einige Zeit.
Ich nicke kurz.
Das wirkt, denn seine Mundwinkel ziehen sich geringfügig in die Höhe. Anschließend schaut er zu einem kleinen Mädchen auf der Rückbank. Das klopft von innen gegen die Fensterscheibe und bekommt augenblicklich seine volle Aufmerksamkeit.
Sie hat ebenfalls braune Haare, die ihr süßes Kindergesicht einrahmen. Ihr Mund lächelt breit und die Hand gestikuliert wild, wobei logisch ist, dass die Zeichen ihm gelten.
Obwohl sein Gesicht müde wirkt, schmunzelt er und antwortet. Ebenfalls mit Handzeichen.
Bei einer Gebärde, die das kleine Mädchen macht, stimmt er ein schallendes Gelächter an und nickt eifrig mit dem Kopf. Bei seinem Lachen fühle ich mich schlagartig hellwach. Mir ist es schlichtweg unmöglich, meine Augen abzuwenden. Dafür erscheint mir zu interessant, wie er unbekümmert aus vollem Hals lacht und sich mit dem Mädchen ›unterhält‹.
Den Zapfhahn hängt er an die Zapfsäule zurück, reinigt seine Hände mit einem Tuch und wirft es in einen Papierkorb, der neben der Säule steht. Die Hintertür öffnend, bittet er das Mädchen, ihn zur Kasse zu begleiten, um die Tankfüllung zu bezahlen.
Sofort hüpft mein Herz vor Aufregung drei Meter in die Höhe, weil ich ihn dabei gleich aus nächster Nähe begutachten kann. Vom holpernden Herzklopfen begleitet, strecke ich mich blitzartig.
»Darf Hase auch mitkommen?«, will die Kleine wissen und klettert umständlich aus dem Kindersitz.
»Dann frage ihn vorher, ob es ihm hier nicht zu stark nach Benzin stinkt. Wir wollen doch nicht riskieren, dass ihm übel wird und er sich hinterher im Wagen übergibt, oder?«
Über die raffinierte Antwort erheitert, schmunzele ich.
»Willst du mit, Hase? Er sagt ja, Papi.«
»Gut, dann darf er uns gerne begleiten. Trägst du ihn oder möchte er zu mir auf den Arm?«
»Er meint, er möchte lieber bei mir bleiben und quasselt mich andauernd voll, wie müde er ist. Da ist es wohl besser, ich nehme ihn.«
Das kleine Mädchen hüpft aus dem Wagen und läuft in Richtung Tankstellentür. Ihre Locken wippen auf und ab. In ihrer Hand hält sie ein braunes Plüschtier mit langen, schlabbrigen Ohren, das erheblich mitgenommen aussieht. Sicher ist es ihr Lieblingskuscheltier, das überall hin mitgenommen werden muss. Ohne findet sie bestimmt keinen Schlaf.
Forsch stapft sie auf mich zu, wobei sich ihr Mund zu einem hinreißenden Lächeln verzieht. Genau vor mir bleibt sie stehen und schaut mich aus riesigen Knopfaugen an. Unvermittelt sprachlos und aus dem Konzept geraten, bemerke ich ihre Augenfarbe.
Grün, mit wenigen Einschüssen von Braun um die Pupille herum.
»Kennen wir uns?«
Ich hocke mich in die Knie, damit sie mich auf Augenhöhe betrachten kann. Dabei tue ich so, als würde ich überlegen. »Nicht, dass ich wüsste. Wer bist du?«
»Ich bin Lara und fünf«, entgegnet sie und hält mir ihre abgespreizten Finger direkt vor meine Augen, damit ich selbst nachzähle.
Jeden ihrer kleinen Finger berühre ich und zähle sicherheitshalber laut nach. »Eins, zwei, drei, vier. Du bist schon vier Jahre alt? Ich heiße Amelie. Freut mich Lara.«
»Mich auch. Und ich werde bald fünf«, raunt sie und steckt mir ihren Kopf entgegen, was die verschwörerische Geste verstärkt und uns zugleich zu Verbündeten macht. Ihr Schmunzeln wird breiter, während sie genauestens meine Gesichtszüge betrachtet.
Ich nehme eine Bewegung wahr und bemerke die Jeans ihres Vaters, der hinter Lara auftaucht. Eine männliche Hand mit anmutig geformten Fingernägeln legt sich auf die zarte Haut ihrer Wangen und streichelt diese unmerklich. Am rechten Ringfinger ist ein Abdruck von einem Ehering zu erkennen. Die Haut dort ist heller. Es wirkt beinahe wie ein Brandmal.
»Entschuldigen Sie bitte, meine Tochter ist …«
Ich erhebe mich und kann ihn nun aus unmittelbarer Nähe betrachten. Das perfekt modellierte Gesicht wird von hellbraunen, lebhaften Augen dominiert. Seine Nase verläuft schnurgerade zum Mund hinab, an dem mir zuerst der sinnlich geschwungene Amorbogen auffällt.
»Das macht sie normalerweise nicht …«, unterbricht er wiederholt seinen eigenen Satz und starrt mich an.
»Freundlich sein?«, erkundige ich mich und beende den Satz für ihn, da ich zu gerne erfahren möchte, was er mit ›das‹ meint.
Auf meine Frage hin, gleiten seine Augen ein Stück desorientiert über meine Gesichtszüge. Wie es aussieht, bringe ich ihn mit meiner Frage durcheinander.
Jesus, bitte verrate mir, wie ich ihn für eine Antwort aus seinen Gedanken reißen kann.
»Ist sie normalerweise unhöflich?«, taste ich mich vor.
»Oh, nein«, stammelt er und fasst sich zum Glück im selben Moment.
Der Blick löst sich von mir, weil er ein Zupfen an seiner linken Hand bemerkt. Seine Tochter. Selbst dieses kleine Mädchen verfolgt staunend die Sprachlosigkeit und möchte wissen, was er als Nächstes sagt. Geduldig wartet sie auf eine Antwort, doch er schweigt sich aus, während er sie in aller Ausführlichkeit betrachtet.
Folglich gehe ich davon aus, dass er meine Frage vergessen hat. Ebendeswegen hocke ich mich nochmals vor Lara. »Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Fährst du in den Kindergarten?«
»Ja, Papi bringt mich hin, aber vorher muss er tanken.«
»Na, das ist ein Service für dich und deinen Hasen, was? Ich wünsche euch viel Spaß im Kindergarten«, erwidere ich und richte mich auf. An den netten Sprachlosen gewandt, verabschiede ich mich: »Also dann.«
»Dann«, wiederholt er unnötigerweise mein letztes Wort, als würde er darauf warten, dass ich noch irgendetwas anfüge.
Scheu deute ich auf mein Auto. Damit signalisiere ich, dass ich jeden Moment losfahre. Da er aber einsilbig bleibt, ist mein zweiter Versuch vertan, ihn vor meiner Weiterfahrt zu einer letzten Plauderei zu bewegen. Statt zu reagieren, lächelt er mich unergründlich an.
Okay, von ihm kommt jetzt nichts mehr, denke ich und möchte mit meinen Fragen nicht weiter aufdringlich wirken. Gewiss bringe ich ihn mit meinem Geplauder in Verlegenheit, denn hier auf dem Dorf kennt jeder jeden und ein Gespräch mit mir würde sicher schnell die Runde machen.
Zu seiner Ex-Frau.
Langsam zieht er Lara in den Shop, um die Tankfüllung zu bezahlen. Unauffällig schaut er zu mir, als würde er es sich noch einmal überlegen. Weil ich mich ebenfalls mehrmals umdrehe, trete ich auf etwas Weiches. Verdattert schaue ich zu Boden.
Der Hase von Lara.
Ich bin genau auf das braune Kuscheltier mit den langen Schlappohren getreten. Dankbar für diesen neuen Anlass, mich noch einmal mit ihm unterhalten zu können, hebe ich Hase auf und flitze zurück in den Shop. Das Letzte, was ich mir für Lara wünsche, ist, dass sie ohne ihn keinen Schlaf in der Mittagspause findet.
Kurz vor der Kasse hole ich beide ein. Lara sitzt jetzt auf seinem Arm und freut sich, weil ich mich nähere. Ihr Mienenspiel wird von ihrem Vater wahrgenommen, denn er dreht sich augenblicklich um.
An meiner rechten Hand entdeckt er Hase, der dort baumelt. Ein hinreißendes Lächeln biegt seine Mundwinkel in die Höhe und bringt damit glattweg beide Polkappen zum Schmelzen.
»Lara, du hast deinen Hasen verloren.«
»Weil er für dich ist.«
»Für sie?«, fragt ihr Vater erstaunt.
»Für mich?«, kommt zeitgleich aus meinem Mund.
Lara bekräftigt ihre Worte, indem sie nickend bestätigt und ihren Vater aus großen, grünbraunen Augen anschaut. Der Zeigefinger steckt in ihrem Mund. Direkt so, als würde sie seinen Einwand befürchten. Unschlüssig schaue ich ihren Stoffhasen an, den ich in meiner Hand halte und warte ebenfalls auf Einwände, die eventuell kommen.
Die bleiben allerdings aus.
»Bist du dir ganz sicher, dass du Hase verschenken möchtest, Lara?«, erkundigt er sich bei seiner Tochter und schaut forschend in ihr Gesicht, um völlig auf Nummer sicher zu gehen.
Abermals nickt Lara. Sie hält seinem eindringlichen Blick stand. Die Augenbrauen leicht erhoben, nimmt er es damit als gegeben hin.
»Das macht sie normalerweise nicht. Hase ist ihr Heiligtum.«
»Eine Menge ›normalerweise nicht‹ für einen Morgen, oder?«, erinnere ich ihn an seine Einsilbigkeit, die er vor der Shoptür an den Tag gelegt hat. Allerdings wäre auch denkbar, dass es sein Lieblingswort ist, womit ich unter Umständen in ein riesengroßes Fettnäpfchen trete. Um den Fauxpas zu überspielen, halte ich Hase schnellstens in die Höhe. »Heiligtümer aus Stoffplüsch bekommen bei mir einen Ehrenplatz«, verspreche ich ernst und blicke entsprechend drein.
Ihr Vater kann sich plötzlich artikulieren und gibt in aller Ausführlichkeit lachend zurück: »Tja, was soll ich sagen. Lara mag Sie offenbar und das ist auch ein normalerweise nicht.«
Von Laras liebenswürdiger Geste tief gerührt, drücke ich den kuscheligen Hasen fest an meinen Brustkorb. »Liegt eventuell am Gegenüber. Wie dem auch sei, vielen Dank für den Hasen, Lara. Er bringt mir sicher Glück. Und das kann ich heute echt gebrauchen.«
»Erst mir, dann dir«, bekräftigt sie und zeigt abwechselnd mit ihrem Finger von sich zu mir. Mit glühenden Wangen sehe ich auf und bemerke, wie meine Augen an ihrem Vater kleben bleiben.
»Tja, also dann … Ich muss los.«
Abermals deute ich auf meinen Wagen, denn ich habe heute leider Gottes nicht ewig Zeit, zu plaudern. Er richtet den Blick auf meinen roten Kleinwagen. »Kommen Sie aus der Gegend? Ich meine, es wäre nicht ausgeschlossen, dass wir uns bei Gelegenheit über den Weg laufen und Durst auf Kaffee …«, erkundigt er sich rasch.
Die Sätze überschlagen sich beinahe. Ich entschließe mich, unpräzise zu bleiben, und lächele siegesgewiss über den ansehnlichen Fisch am Haken. Nun muss ich nur noch herausfinden, warum seine Ex-Frau diesen Prachtbrocken gehen lassen hat. Kann ja bedeuten, dass es einen Haken an der Sache gibt.
»Wäre gut möglich«, schmunzele ich erfreut über die nette Aussicht, ihn wiederzutreffen und den Haken an der Sache herauszufinden. Gerne auch bei einer Tasse mit frischen Kaffee. »Ich meine, wenn Hase tatsächlich Glück bringt.«
An der Eingangstür drehe ich mich noch einmal zu Lara um, griene sie an und wedle glücklich mit ihrem Hasen, der jetzt mir gehört.
Kapitel 6

N
achdem ich in den Feldweg einbiege, parke ich auf einem Kundenparkplatz und schlendere zum Büro im Altenteil, während ich ein Lied pfeife. Das Fenster ist hell erleuchtet. Im Innenhof ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Ich hätte morgens um einiges mehr Bewegung vermutet, als ich tatsächlich vorfinde.
Heute entdecke ich nirgendwo die entspannten Katzen. Die sind mit Sicherheit bereits vor Stunden zur Frühstücksjagd aufgebrochen.
Der Hof liegt verträumt im heller werdenden Morgenlicht, welches immer mehr von den leuchtenden, aber gedeckten Farben verliert. Die Vögel im Hausbaum zwitschern ihr Morgenlied.
Im Büro angekommen, sitzt Lea am Tisch und schaut auf, sobald ich eintrete. »Guten Morgen und herzlich willkommen, Amelie.«
»Guten Morgen, Lea.«
Mit einer Geste lädt sie mich ein, Platz zu nehmen. »Du bist also mit dem Vertrag einverstanden? Freut mich außerordentlich.«
»Bin ich, solange ich in meinem Zimmer Besuch empfangen darf und nicht wie in einem Kloster leben muss.«
»Nein, natürlich nicht«, erklingt ihr vergnügtes Lachen. »Selbstverständlich kannst du jederzeit Besuch empfangen. Nur ist dein Herrenbesuch nicht in der Kost inbegriffen.«
»Das geht für mich in Ordnung. Ich frage auch nicht vorrangig wegen Herrenbesuch. Meine Mutter schaut bei Gelegenheit für ein Wochenende vorbei. Und ich muss anführen, dass sie äußerst wissbegierig ist, was das Leben auf dem Hof angeht. Na ja, wir haben Gott sei Dank ein gutes Verhältnis.«
»Tja, wohl dem, der bis zum jetzigen Zeitpunkt eine Mutter hat«, erwidert sie flink. Für eine Sekunde umspielt eine gewisse Melancholie ihre blaugrauen Augen. »Unterschreibe bitte hier, dass ich dir die Schlüssel für dein Zimmer ausgehändigt habe. Dann musst du noch die Belehrung für die Arbeitssicherheit durchlesen und ebenfalls unterzeichnen. Den Rest der Einweisung übernimmt Alan, der in etwa einer knappen halben Stunde zu uns stößt. Bis dahin hast du Zeit, dein Gepäck in das Zimmer zu schaffen.«
Nach dem obligatorischen Kram lade ich meine Koffer aus dem Auto und verstaue alles provisorisch, bevor ich zu Lea in das Büro zurückkehre. Ein Becher mit köstlich duftendem Tee steht für mich bereit. Sie erwartet mich mit der Frage: »Kandis?«
»Ja, gerne.«
Ich nehme am Tisch Platz und verfolge, wie sie zwei große Stücke vom Kandis in den Tee legt, einen Löffel in die Tasse steckt und ihn mir anschließend reicht. Jede ihrer Bewegungen vollführt sie ohne Hast. Das bloße Zuschauen entspannt mich vollkommen.
»Wir frühstücken jeden Morgen in der Küche des Wohnhauses. Mittagessen gibt es täglich gegen zwölf Uhr. Das Abendbrot um sieben, aber es ist dir überlassen, ob du mit uns gemeinsam einnehmen möchtest. Die Mahlzeiten sind ein Angebot, keine Pflichttermine. Um die Reinigung deines Zimmers und deiner Wäsche kümmerst du dich. Alan zeigt dir nachher den Hof und die Arbeit für heute. Wir fangen gemütlich an. Wichtig wäre mir, dass du irgendwann den Hofladen allein übernimmst. Die Verkaufstage sind Montag, Mittwoch und Freitag von drei bis sechs. Am Wochenende ist unser Hofcafé von drei bis sechs Uhr geöffnet und wir benötigen dort ebenfalls deine Hilfe. Viele Ausflügler kehren an den Wochenenden bei uns ein und gönnen sich eine kleine Rast auf der Heimfahrt. Es ist gratis Werbung für den Hof und eine gute Einnahmequelle obendrein. Sommer wie Winter.«
»Verstehe. Kein Problem. Alan erklärt mir, was ich zu tun habe und teilt mir die Arbeiten zu?«
»Genau, denn er ist für die Gärtnerei zuständig und dir überstellt. Der Hauptteil deiner Arbeit fällt in seinen Bereich, daher halte ich mich weitestgehend raus. Ich bin für den Hofladen, das Hofcafé und alle Arbeiten rund um das Büro zuständig und diesbezüglich deine Ansprechpartnerin. An den Wochenenden teilen wir uns die Arbeit im Hofcafé gerecht untereinander auf. Es gibt einen Einsatzplan, der hängt dort drüben an der Pinnwand. Wir haben ein rotierendes System entwickelt, damit jeder ein langes Wochenende genießen kann. Alle packen an. Jeder braucht jeden und wer das nicht versteht, ist buchstäblich fehl am Platz.«
»Klaro.«
»Bist du nervös?«, höre ich sie belustigt fragen und ahne, dass sie längst den Grund dafür kennt.
»Ja, offen gestanden ein wenig. Es ist der erste Tag. Alles ist neu.«
»Bleibe ganz entspannt. Dich beißt niemand und keiner reißt dir den Kopf ab, wenn am Anfang etwas nicht mühelos von der Hand geht. Komm in Ruhe an, lerne möglichst schnell und hinterher lachen wir über deine heutige Nervosität.«
Tapfer nicke ich und denke an das Telefonat mit ihrem Bruder. Meine Anspannung steigt unaufhaltsam, was ich fühlbar an meinem Herzklopfen erkenne.
»Hast du eine eigene Familie, Amelie?«
»Nein. Und du?«
Lea beäugt mich, was argwöhnisch wirkt. Bestimmt hat sie nicht mit dieser direkten Gegenfrage gerechnet.
»Ich bin sechsunddreißig Jahre und mit Philipp Winter verheiratet, der in einer Bank angestellt ist. Bis heute noch kein Nachwuchs«, entgegnet sie dennoch. Ihre schmale Hand legt sie auf ihren Bauch und blinzelt.
»Aber demnächst«, sinne ich ihren Worten nach und betrachte ihre Hand.
»Wie bitte?«, fragt sie mich nach langem Schweigen.
Ich schaue bedeutungsvoll in ihre Augen, die sich sofort weiten. Blitzschnell schaut sie errötend in ihre Teetasse, als könne sie mit den nicht vorhandenen Teeblättern die Zukunft vorhersagen. »Ich sollte bei dir besser meine Zunge hüten, wenn ich Geheimnisse für mich behalten möchte.«
»Nein, musst du nicht. Ich höre aufmerksam zu und verfüge obendrein über zwei gesunde Augen. Die Zunge zu hüten wäre das eine, aber in deinem Fall war es nicht nur die Zunge und auch nicht erst heute. Meine Cousine ist kürzlich Mutter geworden und hat in den ersten Schwangerschaftswochen unbewusst ihre Hand an den Unterleib gelegt. Ich denke, das tun werdende Mütter, wenn sie ihr Kind sehnlichst erwarten. Oder nicht?«
Meine Aussage entzückt offenbar, denn sie holt tief Luft und pustet unentwegt ihren Tee kalt. »Ich mag Menschen, die aufmerksam zuhören und erst recht diejenigen, die Augen im Kopf haben. Und ja, es wird sehnsüchtig erwartet. Aber Alan weiß nicht …«, gesteht sie und lächelt mich in ihren Gedanken vertieft an.
Ich schmunzele zurück, denn wir verstehen uns auch ohne Worte. Das zeigen nicht nur unsere gleichzeitigen Bewegungen. Und auch nicht erst heute. Ihrem Bruder gegenüber werde ich es verschweigen.
Die Tür des Büros öffnet sich.
Ich löse meinen Blick von Lea, um in die Richtung des Eintretenden zu sehen. Zu meiner großen Überraschung tritt der Vater von der süßen Lara ein. Sprachlos durchforstet mein Hirn verzweifelt einige Schubladen, um hektisch sämtliche Fakten zusammenzufügen.
Der nette Sprachlose von der Tankstelle ist Leas Bruder?
Wie er neben dem kleinen Tresen steht und mich anstarrt, ist er rein anatomisch der, den ich vorhin an der Tankstelle getroffen habe. Aber ich schwöre beim allmächtigen Schöpfer, in der Zwischenzeit ist etwas mit ihm passiert. Was genau es ist, erahne ich.
Unser Telefongespräch.
Du meine Güte. Der, den ich vorhin an der Tankstelle ungeniert und mit den Augen klappernd, angebaggert habe, ist Alan Kroll. Mein neuer Boss. Anders ausgedrückt, der, den ich neulich bei unserem Telefonat am liebsten auf DIN-A4-Größe gefaltet hätte.
Na, danke auch.
Och Mensch, Lara. Hase sollte mir doch Glück bringen.
»Alles klar? Was ist mit dir los, Alan?«, erkundigt sich Lea, weil er eilends seine Augenbrauen ärgerlich zusammenzieht.
»Nix ist los. Alles ist super«, gibt er mit seiner Hand abwiegelnd zurück, schaut mich aber an, als ob er meinen fassungslosen Gesichtsausdruck genießt.
»Ernsthaft?«, erkundigt sie sich skeptisch und das hätte ich an ihrer Stelle gleichfalls getan. Er erweckt absolut nicht den Eindruck, als würde er sich tiefenentspannt fühlen.
»Lara hat heute Hase verschenkt«, erklärt er bemüht tonlos und schaut mich dabei regungslos an.
Wenn Blicke töten könnten …
Aber zum Glück geht das nur in Comics oder Filmen. Bringt Hase mir voraussichtlich doch auf eine Art Glück.
Puh!
»Hase?«, fragt Lea überrascht. »Tatsächlich? Wem denn?«
»Och, nur irgend so ’ner blöden Kuh, die wir an der Tankstelle getroffen haben«, berichtet er, flach atmend, und taxiert mich minutiös.
Ich straffe mich und räuspere. Der abfällige Tonfall erinnert an unser Telefonat. Jetzt nennt mich der nette Sprachlose eine blöde Kuh. Logischerweise muss ich seine Mutation zu meinem mürrischen Chef erst mehr oder weniger verarbeiten.
Eher mehr als weniger.
»Verstehe ich nicht. Warum sollte Lara ausgerechnet ihren Hasen verschenken? Und dann noch an eine blöde Kuh?«, grübelt Lea. »Das passt so gar nicht zu ihr.«
Erneut hüstle ich, um auf mich aufmerksam zu machen. Aus ihren Gedanken gerissen, bemerkt Lea mich und setzt eine fröhliche Miene auf. »Alan, das ist Amelie, unsere neue Mitarbeiterin.«
»Weiß ich«, offenbart er und verschränkt die Arme vor dem Brustkorb. Ich halte seinem Blick stand, entgegne aber nichts.
»Woher?«, will Lea wissen, der jetzt Stück für Stück dämmert, dass ihr ein Großteil an wichtigen Informationen fehlt. Infolgedessen gleitet ihr Blick abwechselnd zwischen uns hin und her.
Er zeigt mit einem Finger auf mich. »Lara hat ihr Hase geschenkt.«
»Aha, tja, also dann«, murmelt sie, und sieht mich an, als sähe sie mich in diesem Augenblick zum ersten Mal. »Du bist also die blöde Kuh, die …?«
»Ich will Hase zurückhaben«, unterbricht er seine Schwester, fährt mich grob an und eilt hastig auf mich zu.
Das gefällige Gesicht verfärbt sich dunkelrot. Der Farbton setzt sich sogar über die gebräunte Haut hinweg. Verwirrt schaut seine Schwester aus der Wäsche, weil sie ihren Satz noch nicht beendet hat, er fuchsteufelswild auf mich losgeht und andauernd ungehobelt mit dem Finger auf mich deutet. Fassungslos beobachtet Lea uns und versteht praktisch null.
»Sie hat ihn mir geschenkt«, gebe ich trotzig zurück, »und wenn Lara ihn haben will, bekommt sie ihn zurück. Aber nur, wenn ›sie‹ es wirklich möchte. Von sich aus. Und ausschließlich dann.«
Provokativ führe ich meine Tasse zum Mund, um gemächlich einen Schluck vom lauwarmen Tee zu trinken. Über den Rand hinweg beäuge ich ihn. Er soll sich nicht einbilden, dass ich den Schwanz einziehe, nur weil er mein neuer Vorgesetzter ist. Geschenkt ist geschenkt und an der Tanke war er schließlich damit einverstanden.
»Keine Sorge, das werde ich nicht und weißt du, warum? Du wirst ihn zurückgeben. Und zwar freiwillig. Gleich heute Abend«, zischt er und schäumt vor Wut.
Ich bemerke, wie die Farbe auf seinen Wangen das Gesicht noch ein Ticken dunkler einfärbt. Augenblicklich kann ich nicht anders, als ihn an seinen Hörnern zu packen, mich behände auf seinen Rücken zu schwingen und, so lange es geht, im Sattel zu halten.
Dieses dunkelrote Gesicht alarmiert mich nicht etwa. Es regt stattdessen zu den unmöglichsten Gegenargumenten an und brennt meine Sicherungen durch.
»Hörst du mir nicht zu? Ich sagte: Nur, wenn sie ausdrücklich danach verlangt«, entgegne ich in aller Seelenruhe, trotz des innerlichen Tumults. »Ich schätze, sie hat einen triftigen Grund gehabt, ihn mir zu schenken. Den respektiere ich. Du solltest es ebenfalls. Auch, wenn ich in deinen Augen mit einem Mal eine blöde Kuh bin.«
Peng!
Meine Kalaschnikow ist noch immer voll einsatzbereit. In Gedanken puste ich den Rauch vom Lauf fort. Macht man zwar nicht bei der Schnellfeuerwaffe, aber egal. Ich fühle mich wie Sylvester Stallone auf einer seiner filmischen Missionen am Amazonas.
War doch der Amazonas, oder?
Lea saugt scharf die Atemluft ein, als ob sie etwas einwenden oder mich warnen möchte. Bevor sie jedoch halbwegs etwas Gescheites herausbringt, brüllt Alan mich an: »Das bist du. Und überhaupt: Wenn ich mich nicht irre bist du zum Arbeiten hier, nicht zum Tee schlürfen, Miss Großstadttussi.«
Sofort springe ich auf, salutiere und schreie aus Leibeskräften: »Jawohl, General Oberfeldarsch. Melde mich gehorsamst zum Dienst. Hase meldet sich heute krank und lässt sich untertänigst entschuldigen.«
Lea bricht in schallendes Gelächter aus, legt die Hand auf Magenhöhe und schlägt sich vergnügt auf die Oberschenkel. Über ihr ausgelassenes Gekicher erbost, fährt ihr Bruder herum, damit sie augenblicklich schweigt.
»Was denn? Ich mag ihren Humor«, beteuert sie, unschuldig dreinblickend, und hält bedeckt mit ihrem Handrücken den Mund.
Zusätzlich schielt sie zu mir, was ihm erst recht ein Dorn im Auge ist und wodurch er sich offensichtlich in seiner Autorität untergraben fühlt. Zackig fährt mein Arm nach dem Salut hinab. Ich stehe stramm vor meinem neuen Chef, der sich mir abermals zuwendet.
Lea hat wenigstens Humor. Aber ich arbeite unter ihm. Und er hat mich nicht entlassen.
Mit glutrotem Gesicht nähert er sich einen Schritt. »Steh bequem, Soldat Bürohäschen! Ich zeige dir jetzt deine Arbeit hier in unserem Kaff. Wenn du heute Abend immer noch so vorwitzig grinst, während dein Körper vor Muskelkater am liebsten sterben will, zeige ich dir gerne, in welchen Hintern du treten darfst. Wollen wir?«
»Extrem gerne«, antworte ich, schaue langsam an ihm hinab und beuge mich dazu leicht vor, um seine vier Buchstaben in Augenschein zu nehmen.
Umgehend versperrt er jedoch die Sicht auf sein Hinterteil und bellt: »Nicht glotzen, sondern mitkommen.«
Ich schaue zu Lea, die bis zu den Ohren schmunzelt und sich vor Lachen schüttelt. Das Gekicher kann sie kaum unterdrücken. Aufmunternd nickt sie mir zu, während ich mich in Bewegung setze, um meinem Chef zu folgen.
»Moment, Alan. Der Arbeitsvertrag. Du solltest die Exemplare unterschreiben, bevor es an die Arbeit geht, damit ich Amelie ihr Exemplar aushändigen kann. Ich habe schon unterschrieben und das Organisatorische erledigt«, ruft Lea ihn zurück.
Wedelnd hält sie ihm meinen Vertrag entgegen.
Abwechselnd von mir zu Lea sehend, trabt er geräuschvoll zum Tisch. Er zögert einen Augenblick, einen Vertrag in die Hände zu nehmen und schaut stattdessen geringschätzig drein. »Du führst nie wieder ein Einstellungsgespräch ohne mich, wenn sie es nicht packt. Ich habe echt keine Lust auf noch so ein dämliches Experiment«, presst er zwischen den Zähnen hervor.
»Du solltest mir mehr vertrauen, Bruderherz«, trällert Lea rasch und unterkühlt, schielt aber in der Zwischenzeit zu mir und zwinkert verschwörerisch.
Gehetzt, und dabei diese vertraute Geste nicht bemerkend, setzt Alan seine Unterschrift unter beide Exemplare. Danach wirft er den Kugelschreiber samt Verträgen gereizt auf den Tisch.
Absichtlich rempelt er mich an, drängelt sich an mir vorbei, wie an einem lästigen Insekt und reißt geräuschvoller als nötig die Tür auf. Ohne weiteren Gruß stürmt er in den Innenhof und stapft davon.
»General Oberfeldarsch?«, fragt Lea und schüttelt ihren Kopf. »Wenn du genauso arbeitest, wie du konterst und beobachtest, gelingt das Experiment hundertprozentig. Los, laufe ihm schnell hinterher, denn er ist deswegen echt aufgebracht. Und mäßige dich besser, wenn du nicht möchtest, dass er dich zu Kleinholz verarbeitet.«
Ich hebe meine Hand zum zackigen Gruß und verlasse unter ihrem Gekicher das Büro.
»Wird es bald?«, ruft Alan, der wie ein angestochenes Schwein über den Innenhof flitzt.
Im Schnellschritt hetze ich hinter meinem neuen Kommandanten her, der mit mir im Schlepptau über den Innenhof spurtet. An der Scheune angekommen, öffnet er die Tür mit einem Schlüssel und tritt ein, ohne sie mir aufzuhalten.
Gleich links hinter dem Eingang befindet sich ein abgetrennter Raum, in dem unzählige Gartengeräte lagern und zu dem er eilt. Mehr Zeit, mich umzusehen, bleibt nicht und er ist scheinbar auch nicht geneigt, mir alles zu zeigen.
»Hacke.«
Ja, Hacken kenne ich. Machen sich wunderbar, um Unkraut aus den Beeten zu entfernen.
»Nehmen«, fordert er mich kurz angebunden auf und holt eine aus dem Regal. Für sich.
Aha, okay. Ich soll mir also ebenfalls eine Hacke schnappen. Jetzt verstehe ich.
Einem uralten Korb entnimmt er ein Paar Handschuhe und steckt sie sich in die hintere Hosentasche. Ein weiteres Paar wirft er mir zu, ohne sicherzugehen, ob ich sie auffange. Von einer Haltevorrichtung nimmt er sich zwei große Eimer und nickt in Richtung Schubkarren.
»Schubkarre.«
Ja, Schubkarren kenne ich. Die machen sich wunderbar, um schwere Dinge von A nach B zu transportieren. Soll ich jetzt eine nehmen oder wollte er nur den Gegenstand als ebenjenes definieren?
»Nehmen«, ordnet er an und greift sich eine davon.
Aha, okay. Ich soll mir also eine Schubkarre schnappen. Jetzt verstehe ich.
»Kommst anscheinend schnell zur Sache, was?«, erkundige ich mich und ernte einen bitterbösen Blick. Danach nimmt er eine Schubkarre, dreht sich um und stiefelt davon.
Für weitere ausgefuchste Fragen bleibt keinerlei Zeit, daher schnappe ich mir blitzschnell eine Schubkarre und haste hinterher. Er stürmt in der Waagerechten aus dem Hintereingang der Scheune, als wolle er den olympischen Rekord im Schubkarrenschieben brechen.
Linker Hand erstrecken sich die zwei riesigen, gewerblichen Gewächshäuser. Es sind jene, die ich aus der Vogelperspektive bei meiner Internetrecherche gesehen habe. Meine Augen weiten sich staunend, denn sie erscheinen mir endlos. Anstatt derer hätte ich besser nach Fotos der beiden Inhaber recherchieren sollen, kommt mir spontan in den Sinn.
Tja, hinterher ist man meistens schlauer.
Alan weist nach rechts, während er auf das Feld stiefelt und knurrt: »Gewächshäuser.«
Ah, ja, jetzt, wo er es sagt …
Ich folge ihm auf das Feld, welches sich vor uns erstreckt und bin fest entschlossen, meinen ersten Arbeitstag, trotz des Generaltons lebend zu überstehen. Fehlt nur noch, dass ich gleich mein Gesicht mit Matsch beschmieren und dutzende Male quer über das Feld robben muss, um mich fit für den Feind zu machen.
Schneidig, wie es nur ein General Oberfeldarsch kann, marschiert er zu einer der unzähligen Reihen auf dem Feld. Dort fristen Stauden ihr trauriges Dasein, die in etwa zwei Handbreit über dem Boden abgeschnitten wurden.
»Hacken.«
Müsste es aber nicht Feld heißen? Wir stehen doch mitten darauf. Fragend schaue ich ihn an.
»Fang endlich an, zu hacken.«
Ah, jetzt verstehe ich. Ja, das ergibt Sinn, denn es steht in meiner Stellenbeschreibung, dass ich Unkraut hacken soll. Er selbst bearbeitet bereits tatkräftig mit seiner Hacke den Boden und beachtet mich nicht weiter.
»Hacken«, äffe ich ihn nach, weil er mir mit seinem Befehlston und der schrägen Sightseeingtour gehörig auf den Wecker geht. Was ist denn das für eine schräge Einweisung?
Prompt spüre ich etwas an meinem Bein. Beikraut klebt an meinem linken Hosenbein.
»Klappe.«
Provokativ die Augenbrauen zusammenziehend, stütze ich mich auf meinem Hackenstiel ab. »Was Klappe? Klappe, die Dritte oder Klappe halten?«
»Klappe halten. Ich will keinen einzigen Mucks von dir hören, bis die Mittagsglocke läutet«, antwortet er schroff und baut sich vor mir auf.
Ich muss meinen Kopf leicht heben, damit ich in seine Augen sehen kann, die mich streitlustig anfunkeln. Klar wäre es jetzt besser, zu kuschen und ihn nicht noch mehr zu reizen. Wie schon am Telefon rudere ich nicht zurück, stichele sogar weiter.
»Schon gut, Herr Kommandant. Du darfst an diesem Punkt unserer informationslosen Lagebesprechung in deine Reihe zurücktreten und mich meinetwegen von dort wieder mit Franzosenkraut bewerfen. Ich wollte bloß kurz horchen, ob du auch ganze Sätze auf dem Kasten hast. Entspann dich, alldieweil! Du bist vollkommen … steif.« Ich stehe vor ihm. Dabei lockere ich, blödsinnig herumhüpfend, meine Arme und Beine, die unkoordiniert um meinen Körper schlackern. »Erst mal muss ich warm werden und Lockerungsübungen machen, um …«
»Ich zeige dir gleich ein paar Lockerungsübungen, wenn du weiterhin dämliches Zeug quatschst«, fährt er mitten in meinen Satz hinein.
Anscheinend eine blöde Angewohnheit von ihm, doch ich hüpfe unentwegt wie ein Flummi vor ihm herum. Denke ja gar nicht daran, damit aufzuhören.
»Vorhin an der Tanke hätte ich dazu gerne ›Ja‹ gesagt, aber jetzt steht gewissermaßen unser Telefonat zwischen uns«, provoziere ich weiter und beuge mich endlich zu den verwelkten Stauden, an denen nur die abgestorbenen Blätter etwas Tageslicht abbekommen.
Zu genau weiß ich, dass ich meinen ersten Tag äußerst vorlaut angehe. Blöd, ich weiß, kann aber nicht gegensteuern. Was soll ich zu meiner Verteidigung vorbringen? Jedes Wort kommt unkontrolliert aus mir raus. Normalerweise bin ich nicht frech oder respektlos.
Wie viel normalerweise noch heute Morgen, denke ich und kichere minutenlang in mich hinein.
»Nicht nur das Telefonat steht zwischen uns, Bürohäschen«, erwidert er barsch, stapft in seine Reihe zurück und beugt sich zu den Stauden herab. »Halte schlicht und einfach bis zur Mittagsglocke deinen vorlauten Rand und erledige gefälligst die Arbeit.«
Ich versuche ernsthaft, mir auf meine Zunge zu beißen, keine schnodderige Gegenantwort zu geben und halte vorbildlich meinen vorlauten Rand.
Kapitel 7

W
ir arbeiten gebückt, ohne ein Wort miteinander zu wechseln. Alan arbeitet routiniert, was mich herzlich wenig erstaunt. Immerhin ist es sein tägliches Brot. Da ich mir vorgenommen habe, das Unkraut sorgfältig zu entfernen, lässt mich seine Geschwindigkeit unbeeindruckt.
Muss es mich lassen.
Hundertprozentig zielt er darauf ab, dass ich mit ihm Schritt halten möchte und mich dabei verausgabe oder unsauber arbeite. In jedem Fall hätte er mit einer Rüge eine kleine Genugtuung gefunden, um mich zu maßregeln.
Muskelkater bekomme ich so oder so. Diese Arbeit bin ich schlichtweg nicht gewohnt. Schon im Vorfeld habe ich beschlossen, jede Art von Schmerz konsequent zu verbergen
Sofern es möglich ist.
Über den Vormittag verteilt lerne ich von Alan, wie ich effizienter arbeite, indem ich gelegentlich verstohlen zu seinen Handbewegungen schiele. Auf meine Arbeit konzentriert, bemühe ich mich hinterher, das Gesehene rasch umzusetzen und den innerlich gestellten Leistungsdruck bestmöglich auszublenden. Schneller werde ich, wenn ich Routine bekomme. Mein heutiges Tagesziel lautet daher, bestmöglich die Handgriffe zu kopieren.
Geschickt schneidet er in wenigen, zackigen Bewegungen die abgestorbenen Blätter der Stauden ab. Diesen Vorgang wiederholt er dreimal, bevor alle Blätter in den nebenstehenden Eimer fliegen. Das nenne ich ökonomisch und freue mich, als mir diese Arbeit am späten Vormittag halbwegs gelungen von der Hand geht.
Das Unkraut und die abgestorbenen Blätter landen anschließend im Eimer, der in die bereitstehende Schubkarre entleert wird. Nachdem eine Karre bis über den Rand gefüllt ist, entleere ich meinen Eimer in die Zweite.
»Spinnst du? Wenn deine Karre voll ist, entsorge das Zeug gefälligst auf dem Kompost und hau nicht den ganzen Schrott in meine rein«, schnauzt er mich an.
Verstehe, die Schubkarre gehört scheinbar Alan höchstpersönlich, obwohl sie nirgendwo beschriftet ist. Gut, es ist seine Firma. Theoretisch betrachtet, gehört ihm alles.
»Den ganzen Ramsch schmeißt ihr auf den Kompost?«, frage ich platt wie eine Flunder.
»Klar oder wolltest du es an irgendeiner Stelle einpflanzen und hübsch wachsen lassen?«, antwortet er und tut, als ob es das Normalste von der Welt ist, derart ineffizient zu arbeiten.
Ich fasse es nicht. Die kompletten Samenstände der Beikräuter werden wieder in die Erde des Feldes eingearbeitet und dürfen im nächsten Sommer erneut keimen, blühen und Samen ausbilden. Jetzt wundert es mich nicht, warum sie jemand benötigen, der tagelang Unkraut zupft.
»Nein, wozu?«, entgegne ich. »Wenn du es auf den Kompost schmeißt, ist es doch schon so gut wie auf dem Feld eingepflanzt. Verrät mir der Herr Gutsbesitzer, wohin ich mit dem blühenden Kraut soll?«, erkundige ich mich schwülstig und deute auf die übervoll beladene Schubkarre.
Dabei sehe ich auf die grünen, teils gedeihenden Gewächse im Eimer und leere sie resigniert in die Karre, die scheinbar mir gehört. Auf eine Antwort wartend, hebe ich sie an. Gemächlich zerrt er sich seine Handschuhe von den Fingern und schreitet wie ein affektierter Gockelhahn zu ›meiner‹ Schubkarre.
Wortlos wuchtet er sie in die Höhe und schiebt sie zurück zum Hof. Bevor wir dort eintreffen, biegt er links an der Scheune ab, wo ich nun einen riesigen Hügelkompost entdecke.
»So, jetzt kennt die Leibeigene unseren adeligen Komposthaufen und macht gefälligst, ohne allzu viele Pausen, weiter«, befiehlt er kurz angebunden.
Nach der Leerung der Karre trabe ich auf das Feld zurück und setze meine Arbeit fort. Seine Firma, murmele ich beständig und nehme mir vor, mich nicht über diese sinnlosen Arbeitsabläufe zu wundern oder darüber aufzuregen.
Je weiter der Vormittag vorrückt, desto höher steigt die Sonne. Genau wie die Temperatur. Für Ende März ist es ungewöhnlich warm, weswegen ich meine Jacke am Feldrand ablege. Bis Mittag arbeite ich mich Meter für Meter vorwärts. Die sich mittlerweile bemerkbar machenden Rückenmuskeln dehne ich ungesehen von Alan und am liebsten, wenn ich allein am Komposthaufen stehe.
Ein Gong wird irgendwo geschlagen. Ich halte in meiner Arbeit inne und richte mich verwundert auf, wobei ich nebenbei einen Schweißtropfen von der Schläfe entferne.
»Mittag«, verkündet Alan, lässt prompt seine Hacke aus der Hand fallen und stapft vom Feld.
Ah ja, das war dann also die Mittagsglocke und ich darf ab jetzt sprechen. Ich sehe dem Meister der langen Sätze nach, der breitbeinig vom Feld stapft und lasse meine Hacke ebenso fallen.
Ihm hinterher trottend, komme ich an der hölzernen Terrasse an, die offenbar an die Wohnküche angrenzt. Von dort weht ein appetitlicher Duft herüber. Topfdeckel klappern. Lea erwartet uns mit dem für sie typischen und sympathischen Lächeln. In ihren Gesichtszügen erkenne ich unverhüllte Neugier, die unbedingt befriedigt werden will.
»Na, ihr zwei? Vertragt ihr euch inzwischen?«, erkundigt sie sich und schaut abwechselnd von Alan zu mir.
»Ganz bombastisch«, entgegnet er tonlos und seift seine Hände in einer bereitgestellten Schüssel mit Wasser ein. Danach macht er mir Platz. Seine Hände abtrocknend, nimmt er das Handtuch mit zum Tisch, statt es mir zu überlassen.
Die rechte Hand des Chefs spaziert auf die Terrasse, setzt sich zu ihm und ignoriert mich vorsätzlich. Sie zerschmilzt förmlich, wenn sie Alan mit ihren unnahbar wirkenden, hellblauen Augen anhimmelt. Der wendet seinen Blick nicht von Lea ab, die aus der Küche kommt und einige Sachen trägt, um den Tisch einzudecken.
Meine Hände lasse ich lange im eiskalten Wasser eingetaucht. Die Kälte tut unbeschreiblich wohl. Da Alan mit dem Handtuch bereits am Tisch sitzt, hat er mit tausendprozentiger Sicherheit nicht vor, es mir zu reichen.
Verstehe. Es ist eine kleine Retourkutsche für mein aufsässiges Verhalten.
Bestimmt möchte er ausloten, ob ich frage, bettele oder sonst irgendwie darauf reagiere. Was Ersteres betrifft, kennt mich der Bursche aber schlecht. Ich fackele nicht lange und beschließe, mir die Hände an meinem Shirt abzutrocknen.
Weil mich niemand von den hier Anwesenden beachtet, lege ich die nassen Hände an beide Brüste. Der Rest an den Fingern trocknet demnächst von allein und kühlt derweil angenehm die geschundene Haut.
Am Tisch stelle ich mich so hin, dass er es sehen muss, wenn er aufblickt. Ich stehe ihm gegenüber, zögere mein Hinsetzen aber hinaus. Er bemerkt es, sieht auf und entdeckt die dunklen Stellen auf meinem Shirt.
Unmerklich, aber für mich deutlich erkennbar, weiten sich seine Augen. Innerlich feiere ich ab, denn nun gleiten sie in mein Gesicht hinauf. Alles läuft genauso, wie erwartet, darum lächele ich vergnügt.
Besser gesagt rotzfrech.
Erst mit dieser Genugtuung setze ich mich umständlich auf meinen Stuhl und benehme mich, wie die Unschuld vom Lande. Die Dorfschönste registriert die auffällige Gesichtsfarbe, die seine Wangen überzieht, sucht die Ursache und landet schließlich bei mir. Sie stutzt und betrachtet nun ebenfalls betreten meine Handabdrücke.
Genau in diesem Moment erscheint Lea am Terrassentisch. Sie trägt einen Kochtopf und bemerkt das seltsame Schweigen am Tisch inklusive Alans peinlich berührte Blicke. Damit kommt sie der Ursache schnell auf den Grund. Strafend gleitet ihr Blick zu ihrem Bruder, der mit den Achseln zuckt und gierig in den Kochtopf schaut.
»Kannst du dir deine Hände, wie jeder normale Mensch auch, an einem Handtuch abtrocknen?«, fragt die Dorfschönste und zieht dabei angewidert ihr Kinn ein. Auf diese Weise entsteht ein Doppelkinn.
Ich linse zum Handtuch.
Das liegt unter dem rechten Arm von Alan und wird behütet, als wäre es ein neuentdeckter Goldschatz der Azteken. Absichtlich deutlich und gefühlt eine halbe Ewigkeit schaue ich an mir herab. Die Handabdrücke zeichnen sich drastisch vom Rest des Shirts ab. Sie stechen regelrecht hervor und sind bestimmt schon von Weiten erkennbar.
Blitzschnell hebe ich meine Lider. Alan, der jetzt flammend rot anläuft, schaut geschwind fort, sobald er meinen Augenaufschlag bemerkt. Er tut, als würde er sich langweilen, doch die eindeutige Farbe auf seinen Wangen verrät ihn.
»Lass gut sein, Michaela«, murmelt er seiner rechten Hand zu.
»Wieso? Das ist echt nicht normal.«
»Oh, ich bin nicht normal oder so, wie alle anderen es gerne hätten. Das ist nur Wasser und trocknet spätestens in einer Stunde. Du kannst derweil gerne woanders hinsehen, wenn es dich stört.«
»Typisch Großstadt. Die Kinderstube ist absolut lausig.«
»Hast du etwa Vorurteile gegenüber Großstädtern?«, will ich wissen.
»Du etwa?«
»Gegenüber Leuten aus der Großstadt? Nein.«
Alan räuspert sich, worauf seine rechte Hand schweigt und ihre Fingernägel betrachtet, die nervös an dem Suppenlöffel fingern. Unruhig rutscht sie auf ihrem Stuhl hin und her, während ich die Teller mit Suppe fülle. Gelegentlich schaut Alan scheu auf die dunklen Abdrücke.
Ich setze mich, lecke bühnengerecht meinen Finger ab und grinse ihn anschließend unverschämt an. »Alan gefällt es, denn er guckt sie immer wieder an«, ergänze ich und nehme zufrieden meinen Löffel auf.
Michaela starrt nun fragend zu Alan.
»Geht so«, brummt er nuschelnd und versucht krampfhaft, woanders hinzusehen.
Abfällig schnaubend, lehne ich mich zurück und beobachte ihn. Das Gesicht glüht noch immer krebsrot. Vergebens versucht er, sich auf seinen Teller Suppe zu konzentrieren. Seine rechte Hand möchte etwas einwenden und setzt dafür an, doch ich bin schneller.
»Geht so, ja?«, erkundige ich mich und beuge mich dazu über den Tisch.
Er hat Mühe, mir in die Augen zu sehen, was mich köstlich amüsiert. Diese Suppe muss er gefälligst selbst auslöffeln.
»Sage ich doch. Keine Manieren«, antwortet Michaela für ihn, rutscht dichter an den Tisch und zieht für den Rest des Essens den Gesprächsverlauf auf Vorgänge im Hofladen. Lea seufzt, hebt ihren Löffel und isst ihre Suppe, ohne das muntere Geplapper zu unterbrechen.
Nach dem Mittagessen und zurück auf dem Feld, verspürt Alan scheinbar weder die Absicht, die schweren Schubkarren zu entleeren, noch fragt er, ob ich sie ausleere. Stattdessen befüllt er ›meine‹ Karre, bis sich das Unkraut darauf haushoch türmt und bei der Entleerung der Eimer daneben purzelt.
»Ist das der Grund, warum die näselnde Blondine herumerzählt, dass hier viele Mitarbeiter kommen und gehen?«
Unvermittelt bleibt er mitten auf einer Staude stehen und baut sich erbost vor mir auf. »Wenn schon. Was interessiert es dich?«
»Kann ja vielleicht nicht nur allein an den Mitarbeitern liegen«, vermute ich und beuge mich zu den Stauden hinab, um meine Arbeit fortzusetzen.
»Mir scheint, du hast die Weisheit mit riesengroßen Löffeln gefressen. Stehen solche Schlauheiten in den Frauenzeitschriften, die du heimlich während der Arbeit liest. Oder stecken sie im Müsli, das du morgens mit langen Zähnen knabberst, damit du vom vielen Sitzen am Computer nicht in die Breite gehst?«
»Mein Irrtum. Ich habe dich unterschätzt. Du bist sogar ein frauenfeindlicher General Oberfeldarsch.«
»Sagt wer? Etwa eine vorlaute Bürotussi aus einem noblen Büro in nobler Innenstadtlage?«
Ich nehme mir fest vor, nicht weiter auf diese Stichelei einzugehen, denn er ist schließlich mein Chef. Stattdessen schnappe ich mir lieber den vollen Eimer, entleere ihn auf einer Schubkarre und schaffe sie zum Kompost. Dort kann ich gerne einen Wutschrei raushauen, der mir den ärgsten Druck nimmt.
Gesagt, getan und ich schiebe die Schubkarre fort.
Durch den aufgeweichten Boden des Ackers kippt sie allerdings zur Seite. Ich stürze mit ihr in den Dreck. Der Inhalt purzelt heraus und liegt überall am Boden verstreut. Von oben bis unten eingesudelt, orientiere ich mich verdattert.
Alan lacht aus voller Kehle.
Obwohl es wie das Lachen von der Tankstelle klingt, springe ich auf. In einem Satz bin ich oben und balle meine Fäuste.
Postwendend verstummt er.
Ich stürme auf ihn los, schreie fuchsteufelswild und mit meinen Armen wedelnd: »Was gibt es da zu lachen, du dämlicher Flachfurz von einem Mann? Laut Arbeitsschutzgesetz dürfen Frauen zehn Kilo an beiden Armen tragen, heben oder schieben, sofern sie dies häufig tun. Du stehst hier und lachst dich schlapp, während du dabei zusiehst, wie ich mir mögliche Kinder abschminken kann. Mag ja angehen, dass du ein Problem mit mir hast, aber lass es gefälligst nicht an meinen ungeborenen Kindern aus. Wenn du willst, dass ich dich verklage, weil ich durch dich grinsenden Dorftrottel keine Kinder mehr bekommen kann, lache nur weiter so dämlich! Bin ich hinterher mit dir fertig, kannst du den Laden dichtmachen.« Ich trete noch einen Schritt näher. Mit geballten Fäusten stehe ich breitbeinig vor ihm und senke bedrohlich meine Stimme. »Der Spaß hört in dieser Hinsicht auf, verstanden?«
Meine Grenzen sind abgesteckt, womit er den Punkt kennt, an dem ich empfindlich reagiere. Mir ist vollkommen egal, ob er mich hochkant rausschmeißt.
Ich habe ihn bei meinem Telefonat wütend gemacht und nun lässt er mich schuften … schön und gut. Er verweigert mir ein Handtuch, nach der Handwäsche … lustig. Wir geben einander gemeine Spitznamen … auch lustig. Er wettet, dass ich nach einer Woche auf allen vieren vom Hof krabbele, weil er mich Bürotussi bis dahin so richtig mit schwerer Arbeit fertig gemacht hat.
Alles lustig, aber an dieser Stelle vergeht mir der Spaß.
»Zehn Kilo, ja?«, fragt er und stöckelt großtuerisch zur Schubkarre.
»Männer dreißig«, ergänze ich zähneknirschend und beobachte ihn aus schmalen Augen. »Steht in den farblosen Broschüren zur Arbeitssicherheit, in denen ich nebenbei am Computer und mit Tee in der Hand schmökere, weil ich ja sonst nichts weiter im Büro zu tun habe, als mir mein Heck platt zu sitzen.«
Alan hebt die Schubkarre mit beiden Händen an und scheint sie zu wiegen. »Dann können noch drei Eimer drauf«, schlägt er vor und stellt die Schubkarre wieder ab.
Aber gerne doch.
Ich fülle drei Eimer mit Unkraut, wobei ich großzügig Erde einsammele. Danach presse ich alles fest auf die Karre. Er hebt sie an, nickt zufrieden und will losrollen, doch ich stelle meinen Fuß vor das Rad.
Schmunzelnd lege ich einen Halm auf den riesigen Berg.
»Och, nö«, stöhnt er und lässt seine Schulter hängen, »jetzt sind es über dreißig Kilo.«
»Du hast bereits ein Kind, das später einmal den Hof übernehmen kann, wenn es sich für Landwirtschaft interessiert«, entgegne ich kühl und mit hochgerecktem Kinn. »Höre also auf, herumzujammern wie ein Waschweib.«
»Du bist ziemlich kess für dein Alter und hast einen großen Rand, wenn ich hier die Hände voll habe«, murrt er und setzt die Karre schwungvoll in Bewegung.
»Sei ehrlich, da stehst du doch drauf«, rufe ich ihm lachend hinterher.
Ein Finger spreizt sich von seiner rechten Hand ab. Ich ahne, es ist der Mittelfinger, kann es aber von meinem Standpunkt aus nicht zweifelsfrei erkennen.
»Mein letzter Bürochef war ein Träumchen. Der hatte echt großartige Manieren. Und erst seine tadellosen Führungsqualitäten … ach …«
Abrupt setzt er die Schubkarre ab, wirbelt geschwind herum und kommt auf mich zugestürmt. Kreischend lasse ich schnellstens die Hacke fallen und renne quer über die Stauden tiefer in das Feld hinein, um mich in Sicherheit zu bringen.
Belustigt lacht er hinter mir auf, weil ich anscheinend ein köstliches Bild abgebe. »Da läufst du wie ein feiger Hase querfeldein, du Schisserin. Große Klappe und nichts dahinter, wie meistens. Werde nicht frech und arbeite gefälligst weiter, während ich die Schubkarre fortschaffe.«
Nachdem ich lässig in die Reihe zurückgehe und mich mehrmals versichere, dass er nicht herübergelaufen kommt, fährt er die Schubkarre zum Komposthaufen. Eine Weile sehe ich dem schlanken Mann seufzend nach, der mit den schwarzen Stiefeln über die Staudenreihen trabt.
Obwohl es auch sinnlose Arbeit ist, das Unkraut auf dem Kompost zu entsorgen, wo es wieder auf das Feld gelangt, bin ich froh, dass ich an der Luft arbeite und nicht im Büro hocke.
Nach einem Weilchen taucht Alan wieder auf.
»Feierabend. Pack ein und reinige die Geräte, bevor du sie in die Scheune bringst. Morgen um acht wieder hier.«
Erneut dreht er sich zum Gehen, während ich befehlsgemäß die Geräte einsammele. Vor der Scheune reinige ich gründlich das Werkzeug und verstaue es anschließend in dem kleinen Verschlag.
Die Sonne senkt sich bereits am Abendhimmel. Hier in der Scheune erscheint alles grau. Immer mehr spüre ich jeden einzelnen Muskel meines Körpers, den die heimlichen Dehnübungen inzwischen nicht mehr entspannen.
Müde und mit verkrampften Muskeln öffne ich die Tür meines Zimmers und schlurfe sogleich in das Bad. Dort lasse ich Wasser in die Wanne einlaufen, entkleide mich und tauche ab. Ich lasse die wohlige Wärme durch den geschundenen Körper dringen und genieße die plötzliche Leichtigkeit. Oh, das tut gut.
Als wäre ich leicht wie eine Feder.
Meine kochenden, pochenden Hände schweben an der Oberfläche. Unwillkürlich rutsche ich immer tiefer. Auf Schmerzen in den Muskeln habe ich mich eingestellt und weiß, dass sie verschwinden, sobald ich eingearbeitet bin.
Kopfweh habe ich keine. Auf eine gewisse Art fühlt es sich fantastisch an, den Feierabend schmerzfrei zu genießen. Im wohltuenden Wannenbad liegend, gehe ich in Gedanken eine Liste mit Dingen durch, die ich mir demnächst besorgen muss. Da Alan mich auf dem Kieker hat, muss ich unbedingt meine Notfallapotheke erweitern. Er wird Ernst machen und mich bis auf das Äußerste schinden, um sich für mein loses Mundwerk zu rächen.
Aber das habe ich mir gewissermaßen selbst erarbeitet.
Wäre ich am Telefon gelassener geblieben, würde meine Einarbeitung garantiert gemütlicher ablaufen. Zweifelsfrei hätte ich in diesem Fall jetzt auch einen anständigen Muskelkater. Allerdings ohne zusätzliche Anstrengungen, um die aufgewühlten Wogen wieder zu glätten.
Genau da sind wir am springenden Punkt.
Warum sind die Wogen nicht glatt? An der Tankstelle ist doch alles super gelaufen. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich es anstellen soll, entspannt auf sein Verhalten zu reagieren. Nur eines scheint klar: Wenn ich ihm beweisen möchte, dass ich als Bürokauffrau malochen kann, muss ich mir schleunigst irgendetwas einfallen lassen.
Wie ein Mantra dieses Wort wiederholend, dusele ich um ein Haar in der mollig warmen Wanne ein, bis mich ein kaum hörbares Klopfen an der Tür auffahren lässt.
»Ich komme sofort«, rufe ich, steige in Windeseile aus der Wanne und wickele mich in ein kuscheliges Badetuch ein.
Lara steht vor der Tür und lächelt mich honigsüß an. Verlegen streift sie mit ihrer kleinen Hand eine Strähne fort, die ihr vorwitzig in das liebenswerte Gesicht rutscht. Ihr geflochtener Pferdeschwanz hängt wild zerzaust aus dem Haargummi und ist Zeuge ihres lebhaften Herumtollens im Kindergarten.
»Na, süße Maus? Wie war es im Kindergarten?«, erkundige ich mich entzückt, sie zu sehen.
»Du arbeitest bei uns, sagt Tante Lea und ich wollte dich besuchen. Kindergarten war supi.« Aufgeregt nickt sie und holt hinter ihrem Rücken ihre Hand hervor. In der stecken kleine, frisch gepflückte Frühlingsblüher.
»Oh, wie lieb von dir«, rufe ich erfreut über ihr zweites Geschenk an diesem Tag. »Möchtest du hereinkommen und gemeinsam mit mir eine Vase für die Blümchen aussuchen?«
»Lieber nicht. Es gibt gleich Essen und ich soll pünktlich sein.«
»Dann gehen wir danach gemeinsam zum Essen. Ich möchte mir vorher aber gerne etwas anziehen. Nur mit dem Handtuch bekleidet kann ich mich bestimmt nicht im Wohnhaus zum Abendbrot sehen lassen«, antworte ich kichernd und öffne einladend die Tür ein Stück, damit sie eintritt.
Zaghaft betritt sie das Zimmer und schaut sich neugierig um. Derweil suche ich in der Pantryküche ein Trinkgefäß, welches als Vase herhalten muss, fülle es mit Wasser und halte es Lara entgegen.
»Auf dem Tisch würden sie mir gefallen.«
Lara steckt die Blümchen in das Glas und stellt es vorsichtig dort ab, wo ich mir das kleine Sträußchen Frühlingsblumen wünsche. Ich gehe zum Kleiderschrank, ziehe ich mir Unterwäsche an und bemerke, wie Lara mich dabei beobachtet, wie ich zwei Shirts heraussuche.
»Du beobachtest mich?«
»Weil, ich finde dich hübsch«, antwortet sie murmelnd und setzt sich in den Sessel.
Ihr Blick ist nicht scheu abgewendet. Im Gegenteil. Sie nimmt meinen unbekleideten Körper aufmerksam in Augenschein und betrachtet mich mit riesigen Manga-Augen von oben bis unten.
Welch ein hinreißendes Kompliment. Ich erröte tatsächlich.
»Du bist echt herzig.«
»Papi hat da noch was hängen«, erzählt sie mir freimütig und deutet für einen winzigen Moment mit ihrem Finger auf die Mitte des Körpers.
»Oh, ähm, ich weiß«, lache ich belustigt.
Erneut muss ich bei dem nun folgenden Gesichtsausdruck kichern. Sie überlegt tatsächlich, wann ich es gesehen habe.
»Woher?«, will sie schließlich wissen, bevor ich zu einer weiteren Erklärung ansetzen kann.
»Andere Männer haben das auch dort hängen«, erkläre ich ihr geduldig und mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Aha«, murmelt sie gedehnt, doch ihr Gesicht zieht sich in nachdenkliche Falten. »Onkel Philipp auch?«
»Ja, Laura, Onkel Philipp auch. Jeder Mann hat das dort hängen.«
»Ich will das jedenfalls später mal nicht haben.«
»Oh, nein, ausgeschlossen. Ich meine, nur Jungs und Männer haben das.«
Abwechselnd halte ich die zwei Shirts vor meinen Oberkörper, damit sie entscheidet, was ich heute zum Abendessen trage.
»Das Rote gefällt mir.«
»Gute Wahl, dann bin ich sofort fertig. Ich habe einen Bärenhunger. Magst du gehen?«, frage ich und schlüpfe in das Shirt.
Sie bejaht, während ich den Zimmerschlüssel suche. Munter hopst sie zur Tür. Ihre Hand in meine legend, führt sie mich über den Hof in die geräumige Wohnküche des Wohntraktes.
Unterwegs informiert sie mich darüber, dass ihr Vater es gar nicht schätzt, wenn sie verspätet zum Abendbrot erscheint. Ihr schneller Schritt überzeugt mich ohnedies. Auch ich beabsichtige, heute nicht nochmals unangenehm aufzufallen, daher halte ich mich ran.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783739480374
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (Januar)
- Schlagworte
- Liebesroman contemporary wholesome Chick Lit Bauernhof Romantik Romance Gärtnerei Humor Frauen