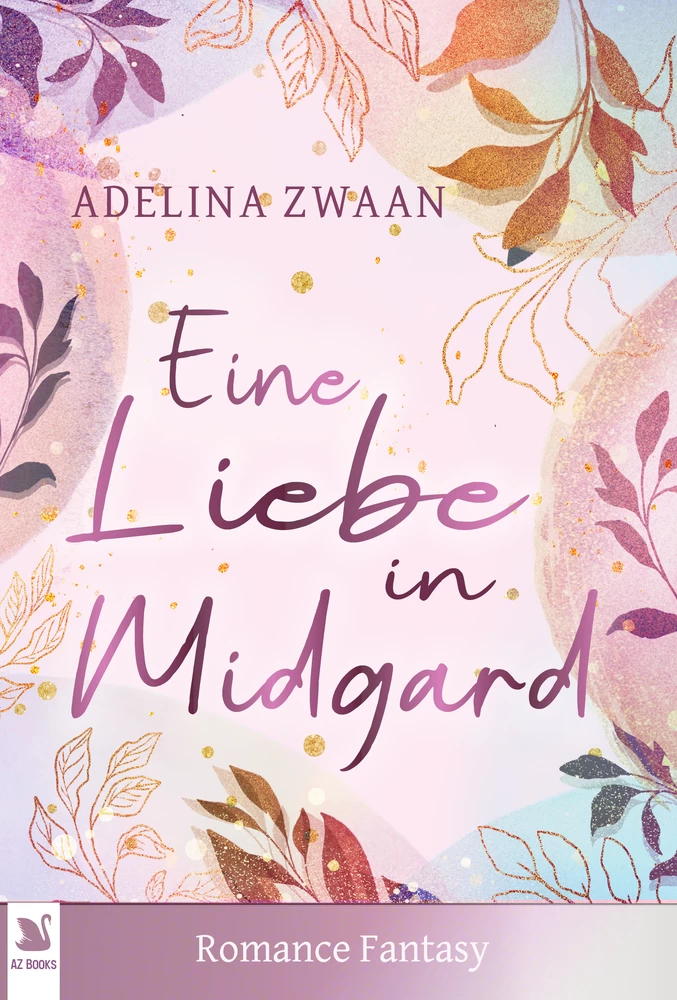Zusammenfassung
Drei Götter erschufen sie. Midgard wurde ihnen zur Heimat gegeben und nur gemeinsam finden sie ihr Glück.
Seit Kindertagen liebt Emma die nordische Mythologie, Sprache und sagenumwobene Völker. Auf einem Galaabend begegnet sie Askel, der nicht nur anziehend, sondern auch rätselhaft wirkt. Er überreicht ihr mysteriöse Schriftzeichen, die auf das legendäre Volk der Davatuja schließen lassen.
Die Sprachwissenschaftlerin brennt förmlich darauf, die rätselhaften Zeichen zu entschlüsseln. Ehe sie sich versieht, schwebt sie in Lebensgefahr und muss mit Askel fliehen. Nach Midgard, einem neopaganistisch geprägtem Projekt in einem Biosphärenreservat, das ihr Vater erschuf. Und es gibt weitere Geheimnisse …
Die mythisch futuristische Fantasy Romance »Eine Liebe in Midgard« von Adelina Zwaan jetzt als eBook bei AZ Books.
Ursprünglicher Titel: »Das Haus in Midgard«
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Eine Liebe in Midgard – Romantasy
Eine Liebe in Midgard – Romantasy
Adelina Zwaan


Widmung
Es geht nicht darum, was wir erforschen, sondern wie wir die Ergebnisse dieser Forschungen zukünftig anwenden.
Adelina Zwaan
Prolog
d
Der Mann in dem Fernsehinterview lächelt einnehmend in die Kamera. »Wir schreiben das Jahr 2178. Es sind kleine, archäologische Funde verglichen mit dem Alter unseres Universums. Aber sie regen hoffentlich zum Nachdenken an. Insbesondere, wie die Geschichte der Menschheit seinen Verlauf nahm.«
Seit Tagen reißen sich die Fernsehsender darum, den nonchalanten Gesprächsgast auf ihren roten Sofas begrüßen zu dürfen. Die Presse und die Bevölkerung himmeln ihn an. Überall, wohin ich hinsehe, entdecke ich das attraktive Gesicht.
Inzwischen sogar auf Müslipackungen.
Dort bewirbt er mit einem unglaublich betörenden Lächeln Sammelteile für ein Ausgrabungs-Set. Logischerweise extra für Kinderhände angefertigt, die sich um diese förmlich prügeln. Nebenbei bemerkt, produziert der gewiefte Unternehmer und Marketingexperte diese ›Give aways‹ und streut sie gewinnbringend unter die kleinen Nachwuchsforscher.
Alle sind verrückt nach ihm. Mit seinen paar und zwanzig Jahren überragt er alle bekannten Größen auf seinem Fachgebiet.
Die Archäologie.
Obwohl er grün hinter den Ohren wirkt, zieht er den Erfolg magisch an, wie andere den jahrelangen Misserfolg. Ununterbrochen prästiert er beispiellose, archäologische Funde, die ihresgleichen suchen.
Dieser Umstand brachte ihm den Spitznamen ›Steinzeit Goldfinger‹ ein. Aber ich wage zu behaupten, den verliehen ihm Neider.
Dennoch, ein derartiger Erfolg steigt gewiss zu Kopf. Kann gut angehen, hinter seinem charmanten Lächeln verbirgt sich eine selbstverliebte Persönlichkeit. Jemand, der wie ein Popstar gefeiert wird … An wem würde das nicht spurlos vorbeigehen?
Zumindest verhält es sich für gewöhnlich so.
Genau diese Tatsache ist mir an der erfolgsverwöhnten Sorte Mensch ein Gräuel. Die kenne ich hinlänglich. Ihre Karriere beginnt meist ab der Schuhgröße zwanzig. Nach einer Norland Nanny besuchen sie ein unerhört teures Elite-Internat, statt in der Freizeit nach einem Regenschauer in matschiger Erde Staudämme zu bauen oder nach Herzenslust bei einem Fußballspiel herumzutoben.
Es folgt eine namhafte Uni, statt ein Jahr auf Weltreise zu gehen und Eindrücke außerhalb von Lehrbüchern zu sammeln. Der Rest klingt in meinen Ohren fade: Kostspielige Armbanduhr am Handgelenk, ebenso teuer erkaufte Freunde, eine Geliebte, die jeden Wunsch erfüllt, endlose Meetings und immer mehr Geld scheffeln.
Durch Geburt verkehre ich in den oberen gesellschaftlichen Kreisen. Meine geerdete Mutter brachte mir jedoch frühzeitig bei, wie ich auf dem Teppich bleibe und keinen Höhenflug durch meinen Status bekomme.
Gott hab sie selig.
Trotz meiner Analyse wende ich den Blick nicht vom Fernsehgerät ab. Ich kann nicht. Seine Augen haben eine recht eigenwillige und außergewöhnliche Färbung, die fesselt. Sie scheint zwischen blaugrün und braun zu liegen und richten sich abermals direkt in die Kamera. Dabei erwecken sie den Anschein, als sähe er mir direkt in mein Herz, welches zur Antwort sofort stolpert.
Herrje, mir kommt es vor, als bemerke er, wie ich in meiner Wohnküche stehe, Salat im Spülbecken wasche, diesen unterhaltsamen Fernsehbeitrag verfolge und seltsamerweise über ihn nachdenke. Besser gesagt, ihn anstarre.
Beileibe, ich finde keine anderen Worte dafür, wünsche aber, es wäre anders. Dieser intensive Blick wirkt geheimnisumwoben und zieht mich magisch an. Vor allem, weil er, aus mir unerfindlichen Gründen alle meine Härchen aufrecht stehen lässt. Auf die eine oder andere Weise werde ich das seltsame Gefühl nicht los, er bemerkt meine Gedanken, denn er schaut recht eigentümlich.
Herr im Himmel, jetzt ist aber mal gut. Er gibt lediglich ein Interview und kann mich gar nicht sehen. Oder von mir wissen. Außerdem: Paranoia ist mir für gewöhnlich fremd.
Dennoch senke ich betreten meinen Blick auf den Salat und wische vehement diese absurden Gedanken fort, die mich umtreiben. Die saftig grünen Blätter schwimmen in dem Spülwasser, was nur schleppend in den Ausguss abläuft. Aus Protest?
»Ah, der Herr Professor gibt wieder ein Interview?«
Johann fragt dies hinter mir stehend, während er mich vorsichtig im Nacken küsst.
»Er ist Professor?«
Verblüfft studiere ich erneut die jungen Gesichtszüge. Genauestens mustere ich die geraden Augenbrauen, die braunen, unbändigen Haare, die geradlinige Nase und den nicht zu auffällig geschwungenen Mund. Alles scheint ausgewogen, obwohl das Gesicht nicht dem heutigen Schönheitsideal eines Mannes entspricht.
Der aktuelle Modetrend besteht aus stark zurückgekämmten Haaren, die die Herren der Schöpfung aufwendig einölen. Seine Frisur hingegen ist das genaue Gegenteil von ›en vogue‹, denn er ließ es bis zu den Schultern wachsen.
Er trägt sie offen, was rebellisch und revolutionär und ihn in meinen Augen wiederum sympathisch wirken lässt. Geradezu abenteuerlich und aufsässig.
Und interessant.
»Ja, er ist der jüngste Professor dieser Epoche. Mit Vorliebe macht er über seine grandiosen Funde von sich reden. Und daneben mit seiner exzentrischen Erscheinung. Gefällt er dir?«
Johann, der beinahe doppelt so alt ist, wie ich, schaut über die Schulter zu, wie ich den Salat aus dem Waschbecken fische. Ein umwerfendes Parfüm steigt in meine Nase, vernebelt meinen Verstand und spricht alle weiblichen Sinne an.
»Kennst du ihn?«
Ich möchte so beiläufig wie nur irgend möglich klingen, funktioniert allerdings nicht. Meine Stimme vibriert, was sogar die Vögel vor dem Haus irritiert aufschrecken lässt.
»Flüchtig, weil er sich ungern in der Öffentlichkeit zeigt. Keine Empfänge, keine Bälle. Sogar in den Klatschspalten findet sich nichts über ihn. Aber alle Welt spricht über ihn. Stell dir vor: Mit vierzehn verließ er Le Rosey am Genfer See mit Bestnoten. Nach dem Besuch der teuersten Schule der Welt studierte er in Rekordzeit Alterskunde und rüttelt die alten Herren auf der Uni wach. Interessanter Bursche, nicht wahr?«
»An welcher namhaften Universität hat den der Musterknabe studiert? In England, der USA? Was lachst du?«
»Er hat in Leipzig studiert und ich lache nicht über dich.«
»Leipzig? Wirklich? Du scherzt.«
Spätestens jetzt gebe ich Johann einen Grund mehr, sich über mein entgeistertes Gesicht zu belustigen. Mit dieser seltsamen Wahl rechnete ich gewiss am wenigsten. Immer wieder frage ich mich, warum sucht er sich Sachsen aus, finde aber keine plausible Antwort.
»Erstaunlich, oder? Ich frage mich, warum ausgerechnet Leipzig. Niemand weiß es, obwohl sich die namhaften Universitäten nach den Kids aus Le Rosey alle zehn Finger lecken. Stell dir vor, wie enttäuscht sie alle waren. Und wie frappiert. Vor einigen Jahren lernte ich ihn in Leipzig auf einem der vielen, elend langweiligen Symposien kennen. Er hielt eine Rede und mir war sofort klar, dass es dieser Junge einmal weit bringt. Und siehe da, vor Kurzem wird er tatsächlich der jüngste Professor aller Zeiten, findet mir nichts, dir nichts die älteste jemals entdeckte Babymumie und macht zum wievielten Mal auf sich aufmerksam?«
»Ich zähle nicht mit, vermute aber etwas Ähnliches wie ›im Stundentakt‹. Rechne es dir selbst aus.«
»Jetzt übertreibst du gewaltig, Emma, und ich würde dich am liebsten dafür rügen. Obwohl seltsam gestaltet sich sein kometenhafter Aufstieg in den Olymp der Archäologie allemal, nicht wahr?«
»Seltsam? Jetzt untertreibst du aber gewaltig. Er ist kaum älter als ich. Wie kann er mit Anfang zwanzig bereits Professor sein, durch mehrere, außergewöhnliche Funde vorweisen und in aller Munde sein? Das ist definitiv etwas anderes als seltsam. Eher unglaublich.«
»Sehe ich genauso, solange dir dabei das Wort genial im Hinterkopf herumgeistert.«
»Schwärmst du etwa heimlich für ihn?«, frage ich grinsend und stelle das Wasser ab.
»Er ist grandios, glaube mir, aber momentan schwärme ich nur für dich. Komm endlich ins Bett, Emmichen, dann zeige ich dir spektakuläre Hieroglyphen, die du als angehende Sprachwissenschaftlerin entschlüsseln und damit ebenfalls weltweites Aufsehen erregen kannst.«
»Johann, er spricht nicht von Hieroglyphen und ich werde mit meinen Forschungsergebnissen nie in meinem Leben Aufsehen erregen. Schon gar nicht weltweit«, verbessere ich gedehnt und winde mich aus seiner drängenden Umklammerung.
»Bei mir schon. Nenne mich also ab sofort: weltweit.«
Begehrlich schmunzelnd schaut er zum Fernsehapparat, dessen Ton er mittels Sprachsteuerung leiser stellt. Mit einem zweideutigen Grinsen manövriert er mich, eine Melodie summend, zum Doppelbett. Schwungvoll stupst er mich in die weiche Matratze und beugt sich zu mir nieder.
Das freche Grinsen erstirbt schlagartig, nachdem ich meine Beine um seine schmale Hüfte schlinge. Bedächtig fährt er mit seiner Hand meine Seite entlang und arbeitet sich sanft zu meiner Körpermitte vor, bis ich meine Augen genüsslich schließe. In etlichen Küssen arbeitet er sich hingebungsvoll vor, während ich zum leiser gestellten Fernseher schaue.
»Jetzt studieren wir zusammen das gedehnte ›A‹ ein, Fräulein Conde und nähern uns langsam dem lang gezogenen ›O‹. Eventuelle Zwischentöne überlasse ich deiner Fantasie. Junge Studentinnen brauchen schließlich hin und wieder eine geistreiche Ablenkung von ihrer anstrengenden Forschungsarbeit. Selbstverständlich nur, um das menschliche Dasein zu genießen, ähm, zu erforschen. Hm, dir gefällt das?«, fragt er entzückt, doch ich fühle mich nicht imstande, zu antworten.
Stattdessen packe ich seinen, an den Schläfen ergrauten Haarschopf und mache deutlich, wonach mir heute der Sinn steht. Ganz der aufmerksame Liebhaber bemerkt er meinen inneren Aufruhr. Gehorsam folgt er meinen kleinen Andeutungen, bezüglich meiner Wünsche, bis ich erstaunlich rasch einen lauten Seufzer ausstoße.
»Das ›O‹ nenne ich wunderbar und sehr langgezogen«, lobt er meinen leidenschaftlichen Ausbruch, liebkost die Hautregion rund um mein Genick und schmiegt sich hinterher an mich.
In den wenigen Wochen, die meine Affäre mit dem Polizeidirektor und Freund meines Vaters andauert, kenne ich ausschließlich diesen Wortlaut. Das liegt hauptsächlich daran, weil er mich diesbezüglich ergeben und begeistert umsorgt.
Freilich bin ich unschlüssig, ob Johann meine Emotionen heute auslöst. Immerfort sehe ich zu dem Mann, der unaufdringlich in die Fernsehkamera lächelt und mit seinen faszinierenden Augen mein haltloses Herz aufwühlt.
Ausführlich berichtet er über den neuesten Fund in der Atacama-Wüste, wo noch immer Mumien der Chinchorros gefunden werden. Dieses südamerikanische Jäger- und Sammlervolk hält Wissenschaftler aller Sparten mit ihrem hochkomplexen Totenritual in Atem.
Was er gefunden hat, legt nahe, es ist älter als die jemals gefundene Mumie, die ›Acha-Mann‹ genannt wird und über neuntausend Jahre alt ist. Wenn sein neuester Fund in der Zeit vor dem Acha-Mann fällt, stellt das im gewissen Sinn die Wissenschaft auf den Kopf. Obendrein wirft es ein völlig neues Licht auf die unerforschte Chinchorro-Kultur.
Doch das ist jetzt für mich belanglos, obwohl es als überragende Forscherarbeit gilt. Die ganze Zeit durchbohrt mich der Blick, der nichts anderes als mir zu gelten scheint. Zumindest bildete ich es mir in meiner lebhaften Fantasie ein, kurz, bevor ich durch Johanns Zärtlichkeiten nicht mehr an mich halten konnte und laut aufseufze.
Diese tiefschürfend dreinschauenden Augen sehen mich an, bis ich vollkommen in mir ruhe, als hätte ich mit ihm, nicht mit Johann …
Mit einem Satz zerstört Johann alle glühenden Fantasien, die mich jetzt und schon vorhin in Verzückung versetzt haben. »Ich muss leider gleich los. Meine Jungs wollten heute Nachmittag mit mir angeln.«
»Wir treffen uns nicht wieder«, entgegne ich schläfrig von der Anstrengung und entkräftet, weil ich inneren Frieden finde. Ich drehe mich, um ihn dabei in die Augen zu sehen.
»Dabei waren wir erst beim ›O‹ und ich hätte noch gerne bis ›Z‹ weitergemacht.« Er scherzt unsicher und wägt ab, ob ich es tatsächlich ernst meine.
»Belassen wir es dabei und du gehst mit deinen beiden Jungs angeln.«
»Du schickst mich fort, Emmichen?«, fragt er bekümmert und ertastet vorsichtig meine Hand, die ausgestreckt neben meinem Körper ruht.
»Das finde ich besser für alle Beteiligten. Bei Vaters Gesellschaften kann ich deiner Frau nicht ohne schlechtes Gewissen in die Augen sehen. Ich mag Babette, musst du wissen, denn sie ist eine herzensgute Frau. Ehrlich, unaufdringlich und humorvoll. Außerdem war dir doch höchstwahrscheinlich klar, dass es mit uns nicht über ein paar klangvolle A-Töne hinausgeht, oder?«
»Nein, Emmichen. Mir war das klar«, gesteht er flüsternd. Vorsichtig berührt er mit seinen Lippen die empfindsame Haut am inneren Handgelenk, an der meine Venen leicht hervortreten. »Dann ist das jetzt unser Lebewohl?«
»Nein, kein Lebewohl. Nur ein Abschied, denn wir sehen uns am Freitag. Vater liebt seine Gesellschaften. Und Babette liebt sie ebenfalls. Dort sehen wir uns. Wahrscheinlich hilft Vater die lieb gewonnene Tradition über die Einsamkeit hinweg.«
Ich möchte ihn aufmuntern, was eindeutig misslingt. Betrübt nickt Johann, senkt seinen Blick und erhebt sich schwerfällig von meinem Doppelbett. Während er das Hemd vom Boden aufhebt, seufzt er und hält für eine Weile inne. »Ich mache mir Sorgen um Constantin. Dein Vater wirkt in letzter Zeit fahrig, redet von ungereimten Dingen und deponiert seine Schuhe im Laborbrutschrank, in dem die Petrischalen-Kulturen reifen. Du musst dringend etwas unternehmen, weil er augenscheinlich Hilfe braucht. Er scheint den Tod deiner Mutter nicht verkraftet zu haben und du im Übrigen auch nicht.«
»Wir kommen klar«, versichere ich halbherzig, sinke wieder in das Kopfkissen zurück und sehe abwesend zum Fernseher.
Dort lacht der junge Mann, dessen Titel und Name erneut unterhalb seines ungewöhnlich symmetrischen Gesichts eingeblendet wird. Askel von Holst, Professor der Archäologie. Abermals bringt er mit seinem Lächeln mein Herz zum Schmelzen.
Ich bin nicht der Typ Frau, der bei Männern in erster Linie auf Äußerlichkeiten Wert legt oder sich jemand anderem bei Intimitäten vorstellt. Aber er hat etwas an sich …
»Da bin ich anderer Meinung«, unterbricht Johann erneut meine Träumereien und setzt sich so vor meinem Bett, damit ich ihn ansehen muss. Auf diese Weise versperrt er mir die Sicht auf den unwiderstehlichen Professor, der mich auf ungewöhnliche Weise in seinen Bann zieht. »Hörst du mir überhaupt zu?«
»Nein, denn will ich keinen Ton davon hören«, entgegne ich gelangweilt und schaue an ihm vorbei.
Johann erweist sich mit jedem Treffen ritterlicher und zärtlicher. Anfänglich überraschte es mich gehörig, bringt mich nun allerdings immer mehr durcheinander. Ich blicke zu seiner Frau auf und mag sie nicht hintergehen, fühle andererseits jedoch, als wäre Johann ein Strohhalm, der mich vor dem Ertrinken bewahrt.
Vorsichtig schiebt er sich in mein Blickfeld. »Ich würde es dir gegenüber nicht erwähnen, aber sie reden mittlerweile auch über dich und das setzt mir wirklich zu, Liebes.«
Erbost fahre ich auf. Zu genau ahne ich, worüber sich die Gelehrten an der Universität und angeblichen Freunde von Vater das Maul hinter meinem Rücken zerfetzen. Ich lege alle Wut, die ich diesbezüglich darüber empfinde in diese Worte und sehe ihn bitterböse an.
»Meine Mutter hätte nicht an einer läppischen Lungenentzündung sterben müssen und ich will meine eigenen Fehler machen dürfen«, schreie ich trotzig. »Wenn die hohen und gelehrten Herren sich mit ihren Scheiß Forschungen besser auf das Immunsystem konzentriert hätten, könnte meine Mutter noch immer leben! Noch immer, verstehst du?«
Bekümmert betrachtet er mich und berührt besänftigend meinen Unterarm. »Eine Lungenentzündung ist nie läppisch. Nicht einmal für junge, gesunde Menschen.«
Mit wutverzerrter Miene speie ich direkt in sein Gesicht: »Sie wäre es, wenn sich Vaters Kollegen mit ihren Forschungen daran, anstelle der Gentechnologie festkrallen würden. Anscheinend bringt ihnen aber nur diese Sparte der Wissenschaft schnellen Ruhm, ein hohes Einkommen und weltweite Aufmerksamkeit ein. Was bedeutet ihnen da schon eine Frau, die eine Krankheit dahinrafft, die im Jahre 2178 längstens ausgerottet sein müsste.«
Noch nach über einem Jahr peinigen mich nachts die Bilder meiner schwerkranken Mutter, die im Todeskampf nach jedem Rettungsanker griff und dennoch den aussichtslosen Kampf verlor. Mit ihrem Tod büßte ich ein empfindsames Gleichgewicht ein.
Und den Glauben an eine gerechte Welt.
»Emma, ich bin seit zwanzig Jahren mit Babette verheiratet. Ich dachte nie auch nur im Entferntesten daran, sie zu verletzen. Trotz alledem sitze ich in diesem Augenblick neben dir. Was glaubst du, aus welchem Impuls heraus ich das tue?«
»Pah, weil ich nach einem Spaziergang durch den Garten freiwillig die Beine breitgemacht habe und du dich in Ruhe an mir für deine Frau heißmachen kannst?«, gebe ich spöttisch, aber mit zittriger Stimme zurück.
»Ich wünschte, du hättest deine Problematik mit besser durchdachten Worten ausgedrückt, liebe Emma. Zu keiner Zeit sah ich nur das in dir. Ich ahne jedoch, dass du über diese Tatsache Kenntnis besitzt und dich momentan einfach nur haltlos fühlst«, entgegnet er in dem ihm eigenen Flüsterton, der eindringlich, aber zu gleichen Teilen sanft wirkt.
Das ist einer der Gründe, warum ich mich mit ihm einließ. Johann wirkt beruhigend und besänftigend in einer haltlosen Zeit, in der ich mich gerade selbst verliere. Eingeschnappt darüber, wie er hervorragend mich einschätzt, lasse ich mich auf mein Kopfkissen fallen.
In der Tat, nach Mutters Tod hatte ich viele amouröse Abenteuer. Gelegentlich sogar zeitgleich. Was das Getuschel und die engstirnige Meinung der Mitmenschen betrifft, fühle ich mich wie ins dunkelste Mittelalter zurück versetzt.
Störrisch und in Unreinen mit meinen vielfältigen Emotionen überfordert, bedecke ich das Gesicht mit meinen Händen, um die aufsteigenden Tränen besser zu kontrollieren und zu unterdrücken. Es funktioniert nicht. Noch immer sehe ich deutlich das Bild meiner sterbenden Mutter vor mir, die in Vaters machtlosen Armen verstarb.
Danach stürzte sich Vater mit gebrochenem Herzen in die Forschungsarbeit und vernichtete in blinder Zerstörungswut den Großteil seiner Aufzeichnungen. Mir erschien es, als hätte er erkannt, dass Gentechnik zwar gewinnbringend erforscht wird, aber simple Krankheiten die Menschen unbarmherzig dahinraffen.
Und Familien hinterher auseinanderbrechen.
Ich stürzte mich nicht in die Arbeit, wie Vater, sondern Hals über Kopf in jede Menge substanzlose Liebesbeziehungen. Einzig, um mich zu betäuben. Diesen schrecklich plagenden Schmerz zu betäuben. Ich finde jedoch nie das, wonach ich mich in schlaflosen Nächten verzehre. Das, was mir nach dem qualvollen Ende von Mutter an Fülle fehlt und wovon ich nie zuvor ausging, es überhaupt eines schönen Tages verlieren zu können.
»Weine dich getrost aus, Liebes«, tröstet Johann mich sanftmütig, zieht mich beharrlich in seine Arme.
Er wiegt mich geduldig, als sei ich ein wehrloses Kleinkind. Johann kennt mich, seit ich denken kann. Womöglich schon seit meiner Geburt, doch nie in meinem Leben sprach er mir mehr Mut zu und küsste meine tränennassen Wangen trocken als im Augenblick. Er hält mich, gibt mir sein Ehrenwort, stets für mich da zu sein, wann immer ich nach ihm rufe.
Jedes Mal, wenn er dieses Versprechen leise in mein Ohr murmelt, ergebe mich meinem Schicksal und weine zügellos all meinen versteckten Kummer in die grausame Welt hinaus, die mir kaltblütig meine Mutter geraubt hat.
»Sie fehlt mir so entsetzlich!
»Nicht nur dir, Liebes«, flüstert er und wischt jede Träne fort, die über meine Unterlider kullert. »Allerdings würde sie die Richtung, in die du derzeit läufst, ebenfalls ins Grab bringen. Lass mich so lange an deiner Seite, bis du ihren Verlust überwunden hast. Ich kann dir nicht versprechen, das für dich zu sein, was dich glücklich macht, aber ich möchte in dieser schwierigen Zeit nicht von deiner Seite weichen. Bitte schicke mich nicht fort.«
»Und verletze deine Frau gleichzeitig?«
»Sprechen wir nicht über Babette.«
»Theo will mich auch beschützen«, murmele ich urplötzlich lachend und denke an den blässlich wirkenden Mann, der als Vaters Nachfolger gehandelt wird.
Er geht bei uns Daheim ein und aus, sitzt beim Abendessen mit am Tisch und diskutiert mit Vater die neuesten Forschungsergebnisse. Neuerdings wirkt Vater jedoch abwesend, als stieße ihn dieses Thema ab. Dabei liebte er es früher, mit Theo darüber zu sprechen.
Oft sogar nächtelang.
Solange ich zurückdenken kann, sitzt Theo zu den Mahlzeiten an unserem Tisch. Aber seit Mutters Tod ist alles anders. Irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten.
»Gott bewahre! Nein, Theo ist nicht der Typ Mann, der in der Lage ist, dich zu beschützen. Ich beobachte ihn genau.«
»Du spionierst ihm nach?«, frage ich und wische mir, darüber äußerst belustigt, mit meinem Handrücken eine Träne fort.
Johann beugt sich zu mir vor, küsst mich sanft auf meine Stirn und belässt seine Lippen für eine Weile dort. »Nein, aber dir.«
Tapfer, aufgepäppelt und zuversichtlich wische die letzte Träne aus meinem rechten Augenwinkel. »Sehen wir uns also morgen bei Vaters Empfang?«
Erneut küsst mich Johann auf die Stirn und erhebt sich, um sich im Badezimmer frisch zu machen. »Sehr, sehr gerne. Du hast es geschafft, dass ich schleunigst nach Hause zu Babette muss.«
»Ich denke, du gehst mit deinen Kindern angeln.«
»Ja schon, aber für Babette muss ich mir vorher Zeit nehmen. Andernfalls fange ich keinen einzigen Fisch, weil ich immer nur an das eine denken kann.«
Bevor ich mich auf Johann einließ, bot er mir eine kleine Übereinkunft an. Er holt sich bei mir mehr oder minder Appetit, der ihm zu Hause durch all die Ehejahre abhandengekommen zu sein scheint, stillt sein körperliches Verlangen jedoch ausschließlich mit Babette. Zweifelsfrei liebt er sie und bildet sich ein, es kommt keinem Betrug gleich, mich auf unfassbar erotische Weise zu befriedigen. Wie auch immer er es anstellt, nie weiter als bis zu ebendieser Grenze zu gehen, es tut den Liebesaktivitäten seiner Ehe gut.
Und ich wäre augenblicklich ohnehin nicht für eine Beziehung gewappnet.
Er betont ständig, dass er auf mich aufpassen möchte. Väterlich besorgt sieht er mich an und stellt fantastische Dinge mit mir an, bevor er angestachelt zu Babette ins Bett krabbelt. Für mich ist das einer der triftigsten Gründe, warum ich keine anderen Abenteuer mehr brauche. Eben eine typische Win-win-Situation, von der sogar Babette profitiert.
Mehr oder weniger.
Aber ich hege nicht die Absicht, mich tiefergehend mit ihrer Beziehung zu befassen, weil ich alle Hände voll mit mir zu tun habe. Es klingt egoistisch, ich weiß, aber ich befinde mich diesbezüglich in Ausbildung und lege diese Trotzphase bestimmt bald ab. Eines Tages.
Wenn ich Mutters Tod verarbeitet habe.
»Wie ich aus sicheren Quellen erfahren habe, spekulieren sie lebhaft an der Universität, wie lange sich dein Vater noch auf seinem Posten hält. Was das bedeutet, muss ich dir nicht erklären.«
Soeben kommt Johann aus dem Badezimmer, um sich von mir zu verabschieden. Er schlüpft in seine Schuhe, verknotet die altertümlichen Schnürsenkel und streift sich sein Jackett über. »Ich fürchte, die alten Freunde, die ihm noch geblieben sind, können nicht mehr lange etwas für ihn tun und seine Karriere endet unschön. Obendrein hat er sich mit der Vernichtung seiner Aufzeichnungen Feinde bis weit nach oben gemacht. Von dort kann er keinerlei Rückendeckung erwarten. Ich mache mir ernsthaft Sorgen.«
»Ich weiß. Auch von zu Hause schleppt er bergeweise Kartons in seinen Wagen und schafft sie an irgendeinen Ort. Die da oben haben ihn noch nie interessiert. Ich bringe ihn nächste Woche zu einem Facharzt. Danke, dass du und deine Freunde ein Auge auf ihn werft.«
»Leider rollen deren Schädel als Nächstes, wenn du nicht bald etwas unternimmst. Die Geldgeber für seine Forschungen sind echt angesäuert, seit er ihnen den Rücken kehrt. Die Szenen, die sich abspielen werden immer unangenehmer. Hässliche Anschuldigungen fallen und jede Seite ist kurz davor, die Nerven zu verlieren. Mit der Vernichtung der Aufzeichnungen gestaltet sich alles prekärer. Die Lage ist absolut besorgniserregend.«
»Mit besorgniserregend meinst du seine Meinung zum Thema gentechnische Selektion? Ich finde nach wie vor, er hatte gute Gründe, die Nutzung der erforschten Techniken kritisch zu hinterfragen.«
»Versteh doch! Einige wollen unbedingt die Unsterblichkeit und gehen dafür sogar über Leichen. Seine Forschungsergebnisse sind die Grundlage und zeitgleich das Ziel. Verstehst du, was das bedeutet?«
Fassungslos blicke ich drein. »Sie würden sogar über seine Leiche gehen?«
Johann seufzt: »Die Abgründe der menschlichen Seele sind immens, Emmichen. Es ist ein Drahtseilakt, sich mit dieser Sorte Mensch abzugeben, glaube mir«, erklärt er, tritt dabei näher zu mir und küsst mich auf meinen Mund, obwohl es laut unserer Absprache ein Tabubruch darstellt. Normalerweise bleiben Küsse Babette vorbehalten.
Kapitel 1
d
Zehn Jahre später verliere ich mich in einen Traum. Füße stampfen in Pfützen, deren Wasser wild durcheinander aufspritzt und die unteren Hosenbeine beschmutzt. Die Flecken, die dadurch entstehen, nehmen kein Ende.
Der mitreißende Rhythmus, den dicke Regentropfen vorgeben, berauscht und beflügelt offensichtlich die beiden Tanzenden. Immer ausgelassener hüpfen sie. Die gleichmäßigen Bewegungen mit dem drängenden Rhythmus der Trommeln lässt mein Herz vor Aufregung hämmern, als wäre es kein berauschender Tagtraum, sondern real.
»Emma, kommst du kurz?«
Seit Tagen klingt die Stimme von Theo angespannt. Jetzt höre ich deutlich heraus, wie es um sein Nervenkostüm steht. Belegt, beinahe krächzend und viel zu schrill für einen Mann Mitte vierzig reißt sie mich gewaltsam aus dem Traum.
Obwohl ich ihm im Gästezimmer meines Elternhauses ein Bett hergerichtet habe, schläft er nicht darin. Mein Vater wird durch die fortgeschrittene Demenzerkrankung in einem Pflegeheim betreut. Mein Elternhaus bewohne ich daher allein. Ehrlich gesagt hatte ich mich ein wenig auf Abwechslung und nette Gespräche gefreut, sehe mich aber schwer enttäuscht.
In seinem Zustand ist Theo alles andere als ein angenehmer Gesprächspartner. Auch kein guter Gesellschafter, denn er durchforstet lieber bis in die frühen Morgenstunden Vaters erhalten gebliebene Unterlagen im Speicher, statt Muße für einen ausgedehnten Spaziergang aufzubringen. Bisweilen reagiert er unwirsch auf alle meine Ablenkungsversuche und blättert wie ein Besessener die alten, verblichenen Aktennotizen durch.
Damit strapaziert er ungewollt mein Nervenkostüm als Gastgeberin, denn das reagiert schon ähnlich mit Reizbarkeit auf jede Lappalie. Ich versuche, seine Situation nachzuvollziehen.
Aktuell verfolgen ihn sensationshungrige Reporter, die vor der heutigen Preisverleihung auf eine einträgliche Geschichte für ihre Klatschmedien hoffen. Kurzerhand bot ich ihm Quartier an. Nichts ahnend, wie extrem meine Privatsphäre damit eingeschränkt wird.
Er zitterte stark und sah mitgenommen aus, nachdem er eines Abends an der Tür klopfte und um Unterschlupf für die letzten Tage vor der Preisverleihung bat. Mittlerweile kann ich es kaum erwarten, sie endlich hinter mir zu haben, denn dann herrscht in seinem und meinem Leben endlich wieder Ruhe.
»Emma, kommst du?«
Die schrille Stimmfärbung reißt Theo mich unsanft aus meinen lebhaften Träumereien. Zur Ordnung gerufen straffe ich mich auf meinem Bürostuhl und sehe durch die Tür des Arbeitszimmers in das Gästebad. Unwillig und mich langsam von der Achterbahnfahrt der Gefühle erholend erhebe ich mich.
Egal, wie sehr ich mich anstrenge oder alle Kräfte anspanne, um die Träumereien zu unterdrücken, es bewirkt meistens das genaue Gegenteil. Die bloße Vorstellung von den tanzenden Füßen in den Pfützen versetzt mich unerklärlicherweise in ein für mich unbekanntes und ungewohntes Hochgefühl. Mit jedem Regentropfen erfasst es meinen gesamten Körper und erzeugt ein bis dahin unbekanntes Glücksgefühl.
Und auch jetzt verschlägt dieses Gefühl mir schier den Atem, obwohl ich nicht einmal annähernd benennen kann, warum ich alles so intensiv fühle.
»Emma?«
Theo klingt nun argwöhnisch, weil ich noch immer nicht reagiere. Schnell senke ich meine Hand, die auf dem Brustkorb ruht, als könnte ich so all die Sinneseindrücke aus meinem Wachtraum noch ewig dort bewahren.
In wenigen Stunden wird Theo ein weltweit begehrter und hoch dotierter Preis für seine Forschungsarbeit überreicht. Danach belagern ihn Reporter für Fotos und scharen sich um ihn wie Stubenfliegen unter einer Lampe. Anschließend kehrt er in das avantgardistische Kugelwohnhaus aus recyceltem Kunststoff zurück.
Spätestens dann kehrt Ruhe in dieses Haus. Keine schrillen Stimmen, keine gereizten Antworten, kein Gepolter auf dem Dachboden.
Seit Jahrzehnten forscht Theo im Bereich gentechnisch modifizierter Organismen. Heute erhält er dafür einen Lorbeerkranz. Die Tatsache finde ich merkwürdig, verdreht und zynisch, denn er arbeitet gegen die Natur, nicht mit ihr zusammen.
Das stört mich. Er weiß es, lächelt aber immer nachsichtig mit mir.
Die Evolution findet heutzutage im Labor statt, gesteuert durch Wissenschaftler und Mediziner. Kurz, durch Forscher wie Theo, nicht durch die Gegebenheiten der Natur.
Mithilfe von Selektionsmethoden per Labor können seit Mitte des einundzwanzigsten Jahrhunderts dank der Genschere Kinder gezielt nach den verschiedensten Kriterien erschaffen werden. Dabei wird die DNA gezielt geschnitten und manipuliert, um Gene einzufügen, zu entfernen oder auszuschalten.
Zahlungskräftige Kunden, ich meine damit Eltern, überlassen heutzutage nichts dem Zufall und setzten sich die Kinder wie in einer Art Baukastensystem zusammen. Sie haben zumeist Wünsche an spezielle Begabungen, dem Intellekt oder an eine makellose Schönheit. Selbstverständlich ist der Ausschluss bestimmter Gendefekte ein alter Hut und im Preis inbegriffen.
Ein chinesischer Forscher manipulierte im Jahre 2018 erstmals offiziell menschliche Embryonen auf diese Art und pflanzte sie Frauen ein. Nach anfänglicher Empörung unter den Fachleuten brach ein weltweiter Wettkampf in der Genforschung aus, der bis heute anhält.
Das Forschungsgebiet ähnelt in seinen Grundzügen einem Goldrausch und erreicht teilweise ebensolche bizarren Dimensionen. Wer über genug Geld verfügt, ›bestückt‹ seinen Nachwuchs mit praktisch allem derzeit Umsetzbarem, womit die Genforschung aufwartet. Der langen Rede kurzer Sinn: Es ist die Modifizierung des Nachwuchses für Rendite in Form von Erfolg, Einfluss, Geld oder Herrschaft.
Für diese Klientel spielt der Preis eine untergeordnete Rolle.
Theo ging mit seinem Team einen Schritt weiter als alle Wissenschaftler vor ihm. Unterschiedliche Forscher fachübergreifender Richtungen, die an Möglichkeiten der menschlichen Zellregeneration forschen, arbeiten unter seiner Federführung. Er gilt als Genie seiner Zunft.
Inzwischen leitet er die weltweit größte Forschungsstation auf diesem Gebiet, publiziert kontinuierlich in Fachzeitschriften und präsentiert ununterbrochen neue, spektakuläre Forschungsergebnisse.
Meinem Vater gelang einst die absolute Modifikation eines Babys, das widerstandsfähig gegenüber Krankheiten war und sich bei Verletzungen selbst regeneriert. Theo arbeitete in seinem Team, wurde schnell sein Vertrauter und Freund der Familie. Einst war er der beste Student seines Jahrgangs und glühender Anhänger von Vaters Forschungsergebnissen, die seinerzeit aufsehenerregend, spektakulär und skandalös zu gleichen Teilen waren.
Unter Insidern gelten Vaters Forschungsergebnisse noch heute als Vorstufe zum ewigen Leben. Hinter vorgehaltener Hand wird gemunkelt, er fand tatsächlich eine Art Schlüssel, der alle Wünsche wahr werden ließ. Das einzige Experiment scheiterte kläglich, denn das Kind verstarb noch im Mutterleib.
Stimmen, die beharrlich behaupten, es war vorsätzlicher Mord, verstummen heute auch nicht.
Ein gewaltiger, mehrmonatiger Aufschrei ging mit diesem, wenn auch gescheiterten, Forschungsversuch durch die Presse und alle bedeutenden wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Vater löste die heftigste, jemals geführte Debatte über die Ethik dieses Forschungsgebietes aus. An dem Goldrausch änderte es rein gar nichts.
Nach Mutters Tod und seiner aufkeimenden Krankheit vernichtete er alle Aufzeichnungen. Damit den Schlüssel. Auch hier verklingen die Stimmen niemals, die behaupten, er wurde wegen seines plötzlichen Sinneswandels ›geopfert‹ und von seinen Gegnern mit einer Krankheit ausgeschaltet.
Meiner Meinung nach sind das wüste und haltlose Verschwörungstheorien. Demenz ist kein Gebrechen, welches mittels Injektionsspritze verabreicht werden kann, damit er schweigt. So weit ist die heutige Forschung nun auch wieder nicht.
Theo möchte dieses verloren gegangene Puzzle mühsam zusammensetzen und den Schlüssel wiederfinden. Er übernahm Vaters Position und führt die Studien weiter. Wie makaber ich das finde, kann ich nicht in Worte fassen.
Schon die geschichtliche Vergangenheit des letzten Jahrhunderts erzählt von Menschen, die zum Mond flogen, was etliche Billiarden verschlang. Gegen den Hunger auf der Erde oder der Erforschung von altersbedingten Krankheiten wurde dagegen schon immer nur ein Bruchteil von diesen Geldsummen aufgewendet. Als sollte es absichtlich so sein. Bis heute hat sich nicht viel an dieser Vorgehensweise geändert und wir schreiben das Jahr 2188.
»Hey, warum antwortest du mir nicht?«
Das fragile Konstrukt meiner Gedankenwelt verblasst zusehends. Erschrocken bemerke ich, wie Theo zu meinem Schreibtisch tritt, an dem ich nur so tue, als arbeite ich den riesigen Berg Unterlagen ab. Der Auftraggeber drängelt bereits, sie endlich ausgehändigt zu bekommen. Es ist augenfällig: In letzter Zeit arbeite ich weniger, als mir lieb ist, denn diese Vision überfällt mich inzwischen auch bei wichtigen Tätigkeiten.
»Ich, ähm …«
»Was ist mit dir? Ich dachte, du arbeitest an den geheimen Übersetzungen für das Gugenheimer-Projekt?«
Ich sehe auf den Notizzettel hinab, der vor mir liegt und aus Kalksteinmehl besteht. Auf dem liegt ein Stift, doch anstatt Zahlen, Notizen oder Berechnungen der Kosten aufzuschreiben, zeichne ich planlos Rhomben. Die ergeben nicht den geringsten Sinn oder dienen der zu erledigenden Aufgabe, daher öffne ich eine leere Dokumentseite auf meinem hochmodernen Tablet.
Peinlich berührt sehe ich zu Theo auf. »Nun, Rhomben habe ich schon einmal gekonnt festgehalten. Morgen übe ich einen Kreis«, übergehe ich meine Kopflosigkeit mit einem halbwegs abgeschmackten Versuch, der einmal Scherz werden wollte. »Wie schön. Du bist fertig angezogen.«
Versehentlich stoße ich gegen den vorsintflutlich aussehenden Papierkorb, den schon meine Mutter an ihrem Schreibtisch zu stehen hatte. Wieder halte ich eine Sache für makaber, denn ein Papierkorb dient dazu, Papier zu sammeln.
Holz, aus dem es hergestellt wird, ist heutzutage weitestgehend abgeholzt. Übrig geblieben sind kaum nutzbare Sträucher und auch nur die Überlebenskünstler unter ihnen. Papier gleicht einer Kostbarkeit, darum verwenden wir heutzutage Steinpapier.
Meinem Wissen nach existiert nur noch ein kleiner Restbestand an Bäumen. An einem unbekannten Ort. Ob das stimmt, weiß aber niemand so genau.
Wegstellen oder entsorgen möchte ich den Papierkorb nicht, denn ich finde ihn ebenso kostbar, wie all die schönen Erinnerungen an meine Mutter. Sie war Sprachwissenschaftlerin. Wie ich.
Ein Beruf, für den sie mich in meiner Kindheit begeistert hat. Er erinnert mich daran, wie ich als Dreikäsehoch neben ihrem Schreibtisch hockte und meine erste Fremdsprache lernte.
Altgermanisch.
Theo reckt seinen Kopf in die Höhe, um mir dabei nicht in mein Antlitz sehen zu müssen. »Bindest du mir liebenswürdigerweise die Krawatte?«
»Komm her.«
»Ziehst du das dunkelgrüne Abendkleid an?«
»Das ist inzwischen unmodern. Ich war sechzehn, als ich es auf meiner ersten, offiziellen Freitag-Abend-Gesellschaft von Vater trug.«
»Es war wunderschön.«
»Ich weiß. Wochenlang und auf Kosten der Nerven meiner Mutter klapperte ich jede Boutique in der Stadt ab. Es muss etwas Besonderes gewesen sein.«
»Das war es. Es betonte deine blasse Haut, die flammend rote Haarfarbe und die grünen Augen. Diese Farbe existiert kaum noch und gilt als ausgestorben.«
»Nun, ich lebe. Aber du bist der Experte, was Gene betrifft.«
Ein Ziel der Evolution ist es, sich ständig weiterzuentwickeln. Auch, wenn dies bedeutet, blonde und rothaarige Gene werden seltener weitergegeben. Vor Jahrzehnten lamentierten ganze Bevölkerungsschichten gegen diese ›Durchmischung‹, vergaßen aber, dass die Natur nichts grundlos tut. Sie lebt, entwickelt sich, zerstört Gestriges, bringt aber genauso gut pausenlos wundervolle, neue Dinge hervor.
»Ich finde es großartig, dass du mich heute Abend begleitest«, murmelt Theo an die Zimmerdecke sehend.
»Wie könnte ich mir Oktopusherz entgehen lassen?«, spöttele ich und binde die altmodische Krawatte, die er heute Morgen in Vaters Kleiderschrank entdeckt hat.
Sie passt wenigstens zum Anzug, der ebenso uralt und unmodern wirkt, wie die Garderobe meines Großvaters. Was Mode betrifft, scheinen alle Wissenschaftler ausgesprochene Muffel zu sein. Den blütenweißen Kittel trägt er für seinen Lebtag gerne und setzt gewiss nur unter Androhung des Todes einen Fuß in ein Modegeschäft für Herren.
»Du hasst Oktopusherz und wirst alle in Grund und Boden diskutieren, die es für eine Delikatesse halten«, kommentiert er meine kritische Haltung zur derzeitigen Umweltpolitik.
Meine Haltung, die wenige Menschen der Oberschicht teilen, richtet sich gegen alle, die die letzten verbliebenen Fischbestände der Weltmeere rücksichtslos als Spezialität verspeisen, während der Rest der Menschheit sich mit Konserven von pürierten und mit Zusatzstoffen versetzten Quallen begnügt.
»Doch wohl nicht grundlos. Wie kann es sein, dass Umweltaktivisten im Untergrund leben und um ihr Leben fürchten, wo doch offensichtlich ist, dass wir auf einen Abgrund zurasen? Ich möchte nicht schon wieder anfangen, aber früher konnten die Leute wenigstens für ihre Sache auf die Straße gehen …«, entgegne ich entsprechend emotional und schiebe energisch den Knoten zum Kragen hinauf. »Ich komme dir zuliebe mit. Vergiss das nicht. Ich brauche den Zirkus nicht. Den ganzen Firlefanz. Du bist für drei Menschen nervös und einer muss schließlich den Kopf auf den Schultern tragen, oder etwa nicht? Ich reiß mich für heute Abend zusammen. Extra für dich.«
»Lieben Dank. Sei nett zu Herrn Wenzin.«
»Ausgeschlossen. Ich sage, was ich denke, oder ich bleibe hier«, entgegne ich mit meiner Hand abwinkend und wende mich zu den ungeordneten Papieren auf meinem Schreibtisch.
»Ach komm! Er ist nicht so schlimm, wie du immer denkst.«
»Wir haben nun einmal eine unterschiedliche Sicht auf die Dinge, Theo«, murmele ich und wende mich zum Schreibtisch.
Die Übersetzungen für das Forschungsprojekt von Herrn Gugenheimer gehen schleppend voran. Ewigkeiten schiebe ich die Zusammenfassung meiner Arbeit vor mir her. Mir sind die Ansichten zuwider, mit der dieser unmögliche Mensch die indigenen Völker Skandinaviens als primitiven Volksstamm abstempelt.
Nun, ich lerne insofern dazu, als ich in Zukunft derartige Aufträge im Vorfeld besser unter die Lupe nehme und notfalls ablehne. Seit einigen Tagen überlege ich ernsthaft, die Aufzeichnungen kurzerhand zu vernichten.
Wie Vater einst seine.
Die Welt nutzt sie sowieso nie für das, was Forscher bezweckt haben. All die guten Ansätze verpuffen in der Luft. Die Gier der Menschen kehrt alles ins Gegenteil, ramponiert unnötigerweise die Welt und lässt mich nun schwer aufseufzen.
Inzwischen verstehe ich sehr genau, wie wenig Vater damals seine Ideale verraten konnte. Besonders mit dem Wissen darum, wie das jeweils bestehende politische System die Ergebnisse gezielt nutzt, um die Natur nach Belieben und Gutdünken der oberen Zehntausend zu verbiegen.
»Emma?«
Theo ergreift mein Handgelenk genau in dem Moment, in dem ich mich vom Schreibtisch entferne. Nachdem er mich für einige Sekunden auf diese Art ansieht, schellt es an der Tür.
Darüber erschrocken, zucke ich zusammen. »Das wird der Chauffeur sein und dabei ich bin noch nicht einmal umgezogen«, flüstere ich plötzlich panisch und entziehe mich geschwind seinen Fingern. »Gehst du an die Tür oder soll ich?«
»Was, wenn es Reporter sind?«
»Wie sollen diese Schmierfinken herausgefunden haben, dass du dich hier bei mir versteckst?«, winke ich ab, schaue ihn dennoch verunsichert an, weil sich seine Miene zusehends verändert. »Gut, ich gehe nachsehen und du bleibst besser hier in Deckung. Wenn es ein Klatschreporter ist, wimmele ich ihn ab.«
Auf Zehenspitzen nähere ich mich dem Eingangsbereich mit der hölzernen Tür. Bedacht schleiche ich zu einem der bodentiefen Fenster, die seitlich der Tür einen Blick auf den Besucher preisgibt. Sogleich richtet sich ein Fotoapparat auf mich.
Der Blitz blendet mich.
Fluchtartig ziehe ich mich in den offen gehaltenen Wohnbereich zurück. Dabei rempele ich versehentlich Theo an, der hinter mir ebenfalls zum Fenster schlich. Ich lande genau in seinen Armen, doch der entsetzte und erstarrte Gesichtsausdruck leibt auf den Fotografen gerichtet, während er seine Arme schützend um mich schlingt.
Erneut blitzt es.
»Verdammt noch eins, die haben dich tatsächlich aufgespürt, Theo«, rufe ich beunruhigt und ziehe den wie angewurzelt dastehenden Mann in das Wohnzimmer, um uns aus der Schusslinie zu bringen. »Wie geht das an?«
Er bringt noch immer keinen Ton über die Lippen, glotzt mich nur sprachlos an und scheint mit seinen Gedanken völlig woanders zu sein.
»Theo?«
Achselzuckend und auf diese Art meiner Frage ausweichend wendet er sich halb von mir ab und verdreht zermürbt seine Augen.
»Theodor Stigner? Sieh mir gefälligst in die Augen. Wem, verflucht noch eins, hast du leichtsinnigerweise von deinem Aufenthaltsort erzählt?«
»Nur meinem Sekretär«, gibt er vernehmlich gereizt zu.
Fluchend hebe ich meine Hände und signalisiere damit auf sehr anschauliche Weise, dass ich am liebsten seinen Hals würgen würde. »Theo.«
»Was denn? Schließlich arrangiert er meine gesamten Dienstreisen, kennt diesbezüglich meine Präferenzen und gibt sich nicht mit den klatschsüchtigen Reportern ab.«
»Ach nein?«, entgegne ich schneidend und deute mit ausgestrecktem Arm zum Eingangsbereich.
Theo wirkt bei dem Blick zum Hauseingang reumütig, was mich um ein Haar dazu verleitet, ihn jetzt milde gestimmt anzusehen. Ei, ei, dieser Hundeblick …
»Ich gehe mich kalt abduschen, erhole mich dabei hoffentlich von deinem Leichtsinn und ziehe mich anschließend um. In der Zwischenzeit organisierst du unsere Abholung. Ohne lästigen Paparazzo.«
»Ich?«, fragt der Unvernünftige doch tatsächlich und macht mich heute damit mehr als einmal fassungslos.
»Du kannst auch gerne stracks diese Haustür öffnen und direkt in seine Kameralinse lächeln. Aber ich mache da nicht mit, weil du mich aus diesem Personenkult heraushalten wolltest. Erinnerst du dich an dein Versprechen?«, gebe ich atemlos zurück. »Alternativ verbringe ich einen gemütlichen Abend auf dem Sofa, denn ich bekomme heute schließlich keinen hoch dotierten Preis für meine Arbeit als Sprachwissenschaftlerin überreicht.«
»Aha, das ist also dein Problem, ja?«
Nicht der unverhohlene und zur Schau gestellte Zynismus irritiert mich. Vielmehr ist es die Art und Weise, die mich an ein Ehepaar erinnert, das über all die Ehejahre lernte, sich an Nichtigkeiten aufzureiben. Meine Eltern liebten sich, stritten und versöhnten sich anschließend, verirrten sich jedoch nie im Dschungel der eigenen Charakterzüge.
Vom Esstisch, dessen Oberfläche etliche Kratzer zieren, als sei sie ein Gesicht eines Menschen von beträchtlichem Alter, ergreife ich das hochmoderne Handyarmband. Mit einer geschickten Handbewegung werfe ich ihm das kostspielige Gerät zu. Ich weiß, er hasst es, wenn ich nachlässig mit sensibler Technik umgehe, aber das juckt mich augenblicklich herzlich wenig.
»Du redest, als lägen dreihundert schlechte Ehejahre hinter dir. Dabei bist du nicht einmal verheiratet.«
»Wollte deswegen keine deiner Romanzen länger als nötig bei dir bleiben? Wegen deinem Zynismus?«
Auf dem schnellsten Weg kehre ich um, denn er kennt meine Schwachstelle von einst und steckt mit diesen Worten routiniert seine Finger in die klaffende Wunde. Der Tod meiner Mutter war schwer zu verarbeiten. Jede Romanze kam mir wie ein tröstendes Pflaster vor, bis Johann mich in seine Arme nahm.
»Wenigstens hatte ich Romanzen.«
»Was sagt Babette eigentlich dazu, dass Johann, dieser greise Sabberheini dich anschmachtet, wenn du ihm einen Drink bringst, den er ohnehin verschüttet«, presst er abfällig hervor.
Mit zitternden Händen imitiert er die Parkinsonerkrankung, die Johann immer mehr erfasst, was für mich schwer genug mit anzusehen ist. Der unverhohlene Spott ekelt mich an.
»Sie wischt ihm den Sabber fort, weil sie ihn selbst in diesem Stadium der Krankheit über alles liebt.«
Ich wende mich ab. Eisern halten seine Finger mein Handgelenk umschlossen. »Ich konnte es nie leiden, wie er dich anglotzt.«
»Komisch, denn vor langer Zeit ließ er eine Bemerkung darüber fallen, dass es ihm mit dir ähnlich ergeht. Ich beruhigte ihn, in dem ich ihm Gewissheit verschaffte, welche Gefühle ich für dich hege.«
»Du hegst mir gegenüber Gefühle?«
»Wäre es so, hättest du damals an seiner Stelle gelegen und unerhörte Dinge mit mir tun dürfen.«
Ich deute mit ausgestrecktem Zeigefinger auf meine Körpermitte. Entsetzt weitet er seine Augen, lässt mich schnellstens los und verzieht angewidert beide Mundwinkel. »Er war ein Freund deines Vaters, Emma.«
»Schau nicht so betreten.«
»Mit Johann?«, fragt er unsicher nach und wendet sich ab, nachdem ich mit den Achseln zuckend bestätige. Hektisch knetet er seine Finger, was immer Ausdruck seiner inneren Unruhe ist.
»Ja, er war bewandert und …«
»Das reicht, Emma«, knurrt er ungehalten, hält sich seine Ohren zu und hetzt gepeinigt in die äußerste Ecke des Wohnzimmers. Vor den bodentiefen Fenstern bleibt er stehen und schaut atemlos durch die Sprossenfenster auf die Terrasse, an der wir vorhin unseren Espresso zu uns nahmen. »Diese Neuigkeit ist unerträglich für mich. Überdies kommt es mir vor, als würdest du es genießen, mich moralisch am Boden liegend zu sehen.«
»Wie könnte ich es genießen? Und, du liegst nicht am Boden. Du erhältst heute den begehrtesten Preis der Welt, den ein Forscher jemals in seinem Leben überreicht bekommen kann. Du hast alles erreicht, was du dir sehnlichst gewünscht hast. Jetzt willst du mir ernsthaft glauben machen, du liegst auf dem Boden?«
Seine Finger krallen sich um die Verstrebungen des Fensters und lassen die Gelenke blutleer hervortreten. »Du hast einen impotenten Tattergreis …?«, fragt er tonlos, wendet mir dann jedoch rasch das schmerzverzerrte und von Traurigkeit veränderte Gesicht zu. Eindeutig kommt ihm der komplette Satz nicht über die Lippen.
»Er hat es erstklassig kompensiert.«
In Windeseile hebt Theo seine Hand und bringt mich mit dieser Geste zum Schweigen. »Gut jetzt! Danke. Warum tust du mir das an?«
»Es ist besser, wenn du nach der Preisverleihung in dein Haus zurückkehrst. Wir reiben uns hier gegenseitig auf.«
»Aber vor Wochen hast du mir gesagt, du denkst ernsthaft über meinen Vorschlag nach.«
»Theo, bitte!«
Wiederum wendet er seinen, aller Hoffnung beraubten, Blick aus dem bodentiefen Fenster, nickt abwesend, als verstünde er und gäbe sich mit meinen halbseidenen Erklärungen zufrieden.
»Verstehe, du kanntest die Antwort längst.«
»Nein, denn freundlicherweise hast du mir Bedenkzeit eingeräumt und die ist noch nicht verstrichen.«
Bemitleidenswerte Augen sehen niedergeschlagen zu mir, als schöpfe er durch meine Antwort neue Hoffnung. »Ich stehe zu meinem Wort.«
»Das hast du erwähnt und es fließt in meine Überlegungen ein.«
»Aber wenn du liebst, brauchst du keine Bedenkzeit. Wenn dich mein Heiratsantrag ehrt, hättest du …«
Allmählich werde ich sauer, was hauptsächlich der Tatsache geschuldet ist, dass er seine nüchterne und pragmatische Frage ernstlich als Heiratsantrag auslegt. Er ist zweifelsfrei hochbegabt, stellt sich in romantischen Dingen jedoch hölzerner als der Parkettfußboden an, auf dem wir stehen.
»Wünschst du meine Anwesenheit bei deiner Preisverleihung noch immer?«, erkundige ich mich vorsichtshalber und unterkühlt. Ich verspüre keinerlei Lust auf ellenlange und quälende Debatten.
Jählings spannt er seinen hageren Körper an und fährt zerstreut mit seiner Hand über die Krawatte. »Ich sorge dafür, dass wir unbehelligt von hier zum Firmengelände gelangen«, entgegnet er heiser und akzeptiert meinen Unwillen über diese Angelegenheit vor Ablauf der Bedenkzeit zu diskutieren, »und morgen nach dem Frühstück bist du mich los.«
»Theo?«
Sogleich bleibt er stehen, dreht sich aber nicht zu mir herum. Seine Hand ruht auf der Türklinke. Verständlicherweise er bemüht sich, seine gekränkten Gefühle zu verbergen.
»Es wird in Kürze regnen und der Chauffeur soll bitte an Schirme denken.«
»Ich nehme jede deiner Antwort zur Kenntnis«, flüstert er, statt mich gewohnheitsmäßig mit meinem Talent aufzuziehen, Regen vorherzusagen.
Mit merkwürdig beklommenen Herzen steige ich die Treppe zum Badezimmer empor, während er seinen flexiblen Bildschirm vom Handy aus dem Designerarmband herausschiebt und seine Telefonkontakte öffnet.
Kapitel 2
d
Selbstvergessen scrollt Theo einen Zeitungsartikel hinunter, den er auf seinem Armbandhandy liest. Den Glasbildschirm, auf dem er völlig versunken herumtippt, zog er aus dem Armband. Das grelle Licht sticht im dunklen Wageninneren der Limousine hervor. Ratlos huschen die Augen über den beleuchteten Bildschirm, in den er starrt.
Wie die drei Querfalten, die sich oberhalb der Nasenwurzel abzeichnen. Um ihn nicht zu stören und den fragilen Frieden nicht erneut zu riskieren, lasse ich ihn in Ruhe.
An seinen Schläfen zeichnen sich erste graue Haare ab. Seine mittelblonden Haare kämmte er akkurat zu einem modernen Seitenscheitel. Sorgsam befreite er das Gesicht von Bartbewuchs. Nichts raschelt, wenn er sich mit seinen Fingern nachdenklich über den Kieferknochen reibt.
Er arbeitet beinahe rund um die Uhr und opfert seine Freizeit dem beruflichen Erfolg unter. Ich komme nicht umhin, mich zu fragen, ob der Aufwand es wert ist. Freilich, wissenschaftliche Erfolge überdauern die Zeit. Dennoch. Was wird man in einhundert Jahren über Theo Stigner sagen?
Schwer atmend stöhnt er auf. Er öffnet den Verschluss des Armbandhandys, streift es vom Handgelenk und wirft es achtlos auf den Ledersitz. Der Kieferknochen arbeitet rege, während er zerknirscht aus dem Fenster der Limousine schaut und sein Kinn abstützt.
Wie von mir vorhergesagt, platschen dicke Regentropfen gegen die Scheibe und schlängeln sich durch den Fahrtwind in langen Fäden hinab. Allesamt Tränen, die der Himmel um uns uneinsichtige Menschenkinder weint.
»Ausgerechnet heute Abend regnet es«, murrt er.
»Wenigstens regnet es endlich wieder. Hätten wir mehr Wälder, würde es auch mehr regnen.«
»Ich finde Regen überflüssig. Es gibt Wettermodifikation, womit uns Wirbelstürme erspart bleiben.«
»Die bräuchten wir nicht, wenn wir uns ernsthaft bemühen, die Emissionen in den Griff bekommen.«
»Ach, Emma, du unverbesserliche Ökologin. Ich fürchte, du verrennst dich in Träumereien, die schon unsere Urgroßeltern aufgaben.«
»Du kennst meine Meinung.«
»Die kenne ich. Aber ich wünschte, du würdest ein wenig mehr Glauben in die Wissenschaft investieren. Wie einst dein Vater.«
»Ich glaube an die Wissenschaft. Nur sollte sie eben nicht Gott spielen wollen. Er sagte, es geht nicht darum, was wir erforschen, sondern wie wir die Ergebnisse dieser Forschungen zukünftig anwenden.«
»Nein, sprich nicht weiter. Heute Abend möchte ich keine aufreibenden Debatten über Ökologie oder Ethik führen. Verdirb uns bitte nicht den schönen Abend. Was sagst du zur Limousine?«
Die schwarze Luxuslimousine organisierte er mittels seines ehrgeizigen Assistenten, der obendrein einen Personenschutz auftrieb. Dieser verjagte erfolgreich den aufdringlichen Fotografen, der noch immer vor dem Haus lauerte und auf einen Schnappschuss von Theo hoffte.
Das sind die Schattenseiten des Ruhms und ich frage mich, ob Theo die Aufmerksamkeiten unbeschadet übersteht, ohne vom Boden der Tatsachen abzuheben.
Theo ist ausschließlich für die finanziell erstklassig aufgestellten Anhänger der neuen Gentechnologie tätig und kooperiert dafür mit den Behörden. Die genehmigen und legitimieren seine umstrittenen Verfahren. Befruchtete und zuvor mit der Genschere selektierte Eizellen, pflanzt er der Frau im Operationssaal ein. Total unromantisch, finde ich und sehe nun ebenfalls zermürbt aus dem Fenster.
Kritikerstimmen, die seit Jahrzehnten gegen diese Art der menschlichen Fortpflanzungen ankämpfen, werden von den Behörden seit Jahren mundtot gemacht oder in eigens dafür angelegte Straflager ausgewiesen. Die meisten schweigen aus Angst oder behalten ihre Kritik für sich.
Jene, die sich ein Kind nach seinen Wünschen designen, wollen nichts von der Betrachtungsweise der Kritiker wissen. Diese behaupteten unterdessen beharrlich, dass die Wissenschaftler vorselektierte Ei- und Samenzellen benutzen, nicht die der tatsächlichen Eltern.
»Hast du über die Operation nachgedacht? Mein Team könnte dir behilflich sein, deine Eizellen zu sichern, zu analysieren …«, bietet er mir leise, mich aber noch immer nicht ansehend an.
»Nein«, lautet meine knappe Antwort.
Stur schaue ich aus dem Seitenfenster der Limousine, an der die Stadt vorbeisaust, die im Neonlicht erstrahlt.
»Dein Vater würde es befürworten.«
»Woher willst du wissen, dass Vater die Entnahme meiner Eizellen befürworteten würde? War Vater es etwa, der diesen ganzen genetischen Selektionswahn und Injektionsmist guthieß oder warum fängst du bei diesem Thema immer von ihm an?«
»Nein, er hieß es nicht gut und ich vergesse seinen Standpunkt niemals. Aber dein Vater war es, der uns mit seinen unanfechtbaren Forschungsarbeiten einen wesentlichen Anstoß lieferte, damit wir vor der breiten Masse vernünftig argumentieren und seine Forschung in die Tat umsetzen können. Seine Forschungsergebnisse bergen doch auch Chancen für alle kommenden Generationen.«
Die gut gemeinten Chancen für kommende Generationen war in der Tat der Motor, die Vaters Forschungen einst vorantrieben. Aber das erging den Curies bei der Erforschung der Atomkraft genauso, bevor andere Forscher aus ihren Schlussfolgerungen letzten Endes die todbringende Atombombe entwickelten.
Noch heute leiden die Menschen in Hiroshima und Nagasaki an den Spätfolgen, was gewiss nicht im Sinne der Forscher war. Demzufolge rolle ich entnervt mit meinen Augen.
Vater wollte mit seinem Forschungsteam menschliche Erkrankungen im Vorfeld ausklammern und die Regenerationsfähigkeit erhöhen. Man sagt, rein zufällig stieß er auf den Schlüssel, der ein längeres Leben ermöglicht. Auf keinen Fall beabsichtigte er, mit seinen Forschungsergebnissen die Zwei-Klassen-Gesellschaft auf die Spitze treiben.
Mir wird speiübel bei dem Gedanken, wie seine Forschungen Anwendung finden, sollte der Schlüssel eines Tages gefunden werden. In den vergangenen Nächten ging Theo systematisch alle Notizen, Aufzeichnungen durch, die sich auf dem Speicher befinden. Noch heute Morgen hockte er dort oben zwischen den alten, vergilbten und staubigen Kisten und vergaß über die Suche sogar die Uhrzeit.
Seine Suche blieb ergebnislos.
Unermüdlich arbeitet er an seinen Projekten. Wie mein Vater einst. Beide Männer sind absolute Ausnahmetalente, allerdings wirkt Theo getriebener als Vater. Er ist buchstäblich von dem Gedanken besessen, ein genetisch perfekt modelliertes Kind zu erschaffen. Ein Kind frei von Krankheiten und in der Lage, sich bei Krankheiten ohne Einnahme von Medikamenten zu regenerieren. Im besten Fall erhofft er sogar den verschollenen Schlüssel für das ewige Leben zu finden.
In meinen Augen gleicht ewiges Leben der Quadratur des Kreises. Was nützt der Menschheit all die moderne Wissenschaft, wenn sie die falschen Dinge erforschen und ein instabiles Ökosystem uns alltäglich dahinrafft?
»Danke, dass du trotz der Umstände mitkommst.«
»Keine Ursache«, antworte ich schmallippig und streiche mein Abendkleid glatt.
»Willst du etwas über den neuesten Klatsch erfahren, den die Medien verbreiten«, fragt er versöhnlich und klingt sehr nah. Tatsächlich neigt er sich zu mir vor, nachdem ich den Kopf in seine Richtung wende.
»Verschone mich besser mit dem Geschwätz.«
»Wie du möchtest. Obwohl die Neuigkeiten ausgesprochen aufschlussreich wären«, versetzt er bestens gelaunt, rutscht in eine aufrecht sitzende Position und zupft sich seine Krawatte am Hals in eine bequemere Position. »Habe ich vorhin erwähnt, dass dein Kleid bezaubernd aussieht?«
»Nein, denn du warst schmollich auf mich.«
»Sage nicht immer schmollich!«
»Nicht immer schmollich«, wiederhole ich wie aus der Pistole geschossen, obwohl ich genau weiß, was er meint und wie ihn meine launenhafte Art aufbringt. Amüsiert kichert Theo. Ich freue mich, weil sich unsere Laune augenfällig bessert.
»Es ist das perfekte Kleid zu der perfekten Frau.«
»Du schmeichelst mir und dennoch fühle ich mich dabei voller Defizite«, lächele ich verlegen und weiche seinem Blick unverzüglich aus.
»Vertrau mir, die machen dich sympathisch.«
»Defizite machen sympathisch? Das ist ein Widerspruch an sich«, entgegne ich argwöhnend über seine eigentümliche Wortwahl.
»Ich ahne, als Sprachwissenschaftlerin kommt das Wort sympathisch nicht infrage.«
»Nein, mich überrascht lediglich deine merkwürdige Wortwahl und ich überlege angestrengt, worauf du hinauswillst. Schließlich plapperst du für gewöhnlich nicht achtlos irgendetwas Unausgegorenes daher.«
»Das überrascht mich.«
»Wieso, wenn meine Defizite bei dir bewirken, dass …«
»Lässt du bitte die Sprachwissenschaftlerin heute Abend im Büro?« Er klingt mutlos.
»Wir sind ohnehin da und verschieben diese kleine Diskussion besser auf irgendwann.«
Die Preisverleihung feiert dieses Jahr ihr fünfzigjähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass findet der glanzvolle Festakt in dem großen Saal des BIOX-Gebäudes statt. BIOX gehört Theo, womit der Bogen geschickt zu seinem Lebenswerk gespannt ist. Die Firma ist sein ganzer Stolz und ein wahrhaft überdimensionierter Prunkbau, der nach der neuesten, modernsten und innovativsten Baukunst errichtet wurde.
Am Ende einer langen, gewundenen Zufahrtsstraße befindet sich das Hauptgebäude mit der metallischen Außenhülle. Rings herum wuchern Hecken aus Brombeeren und anderen Gehölzen. Der kurz geschnittene Rasen ist künstlich angelegt.
Es heißt es sei ein englischer Rasen. Wie jene, die einst auf Golfplatzen zu finden waren. Das war, bevor die Wasserreserven knapp wurden. Er wächst nicht höher als zwei nebeneinander gelegte Finger, weil er jeden Tag getrimmt wird. Zudem kommt ein Hightech-Bewässerungssystem zum Einsatz. Das dunkle Grün wirkt frisch, erholsam und beruhigend.
Purer Luxus, den sich ausschließlich Reiche leisten können. Und auch davon nicht jeder. Einzig Ultrareiche leisten sich diese Verwendung von überlebenswichtigen Ressourcen.
Jedes Mal, wenn ich hier entlang fahre, begeistert mich die prächtige Farbe. Ich finde bedauerlich, dass es nicht jedem Erdenbürger vergönnt ist, sie zu bestaunen. Unwillkürlich frage ich mich, wie es damals aussah, als riesige Bäume ein selbstverständlicher Anblick waren. Ich las einmal, einige Exemplare wurden an die tausend Jahre alt.
Unvorstellbar.
Theo berührt meinen Oberarm und deutet anschließend zum Hauptgebäude. Die modern gestaltete Außenhülle bedeckt den Glasbau komplett und gibt kleinere Fensterfronten vor. Eine perfekte Illusion. Ich besuche Theo vereinzelt in seinem Büro, denn das Gebäude mit den organischen Formen und großzügigen Fenstern für die Büroangestellten erscheint mir wegen der übermäßigen Überwachungstechnik dubios.
An dem ausgelegten Teppich, der feuerrot in der hell von Scheinwerfern beleuchteten Nacht glüht, warten zahlreiche Fotografen. Extremes Durcheinander herrscht, nachdem unser Wagen im Schritttempo anrollt. Der Chauffeur lässt die Fensterscheibe hinab und kündigt einem beflissenen Angestellten unsere Ankunft an. Dieser läuft sofort los, um alles Nötige in die Wege zu leiten.
Nachdem einige Hellhörige unter den Reportern Theos Nachnamen aufschnappen, drängelt sich die Menschentraube hektisch zur Limousine. Beruhigend drückt Theo meine Hand, bevor er aus der durch den Chauffeur geöffneten Hintertür steigt und etliche Blitzlichter aufflackern.
Aufgeregt rufen sie seinen Namen. Er schreitet, die aufdringlichen Rufe ignorierend, um den Wagen, öffnet kavaliersmäßig die Tür und streckt mir seine Hand entgegen, um mir beim Aussteigen behilflich zu sein.
Sobald ich auf dem roten Teppich stehe, bricht ein ungeheures Blitzlichtgewitter los und blendet mich für mehrere Minuten. Theo lächelt geduldig in alle Kameras, die unzählige Fotos von uns schießen.
»Frau Conde, bitte sehen Sie einmal in meine Kamera!«
»Bitte einmal lächeln!«
»Eine kleine Umarmung und wir haben das perfekte Foto«, schreit ein zudringlicher Reporter über etliche Köpfe hinweg. Alle drängeln und schubsen sich beiseite, um die beste Position für ihre Fotos zu erwischen. Die verkaufen sie noch heute meistbietend an die begierige Presse, die schon begierig darauf warten, jedes kleine Detail in ihren Klatschspalten zu veröffentlichen. Am liebsten mit handfesten Skandalen, die den meisten Umsatz bedeuten.
In Anbetracht unseres globalen Desasters eigentlich ein verabscheuungswürdiger Rummel. Aber es ist wie zu Zeiten der Römer. Brot und Spiele.
Manche Dinge ändern sich offensichtlich nie.
»Von welchem Designer ist Ihr Kleid?«
»Sehen Sie doch mal hier her, Frau Conde!«
»Ihr Vater wäre bestimmt stolz, Sie heute Abend an der Seite seines Nachfolgers zu sehen. Lächeln Sie bitte einmal in meine Kamera?«
Über all diese Fragen blendet das flackernde Licht der Blitze, bis ich mich schwindlig fühle. Ich finde derartige Aufforderungen und Aussagen beklemmend, zumal ich lediglich die Tochter meines Vaters und nur durch das Privileg der Geburt in den Medien bekannt bin. Diese Aufmerksamkeit wäre mir angenehmer und leichter zu ertragen, wenn ich seltene Schriftzeichen entschlüsselt und damit den Blick auf die Welt verändert hätte.
Theo, der diesen Wirbel um Vater hasst, wirkt immer entnervter. In gewisser Weise wetteifern Forscher um die prestigeträchtigsten Erkenntnisse, weshalb er nun derart angesäuert reagiert. »Lass uns schnell hineingehen«, bittet er mich mürrisch und lotst mich rasch über den roten Teppich.
Im Foyer des Laborgebäudes angekommen, reicht er einer blutjungen Dame am Einlass die Einladungen.
»Herzlich willkommen zur Preisverleihung, Herr Stigner. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend«, frohlockt sie strahlend und präsentiert formschöne Zähne.
Theo nickt knapp und zieht mich in eine ruhige Ecke. Besorgt blickt er zu der Taube aus Fotografen, die dem nächsten Glitzerpaar der Klatschpresse seine Aufmerksamkeit schenkt. Bei denen spielen sich derzeit ähnliche Szenen ab, wie bei unserer Ankunft.
»Ich schwöre, ich werde ärgerlich, wenn sie mich von den Fotos retuschieren.«
»Wieso sollten sie das tun? Es ist dein Abend und immerhin bekommst du einen Preis für dein Lebenswerk. Du bist heute die Nummer eins.«
»Ich werde wirklich sauer«, zischt er mich mit einer senkrechten Zornesfalte an, die sich zwischen seinen gerade verlaufenden Augenbrauen bildet. Der kalte Blick, zu dem er fähig ist, jagt mir für einen Moment eiskalte Schauer über den Rücken.
»In dem Fall wäre ich besser zu Hause geblieben. Sie haben Vater noch nicht vergessen und gehen wie selbstverständlich davon aus, ich fülle diese Lücke, dabei bist du sein Nachfolger, nicht ich. Nach heute Abend werden Sie es wissen, also beruhige dich.«
Mit seiner Weisheit am Ende sieht er mich an. Anhand der nach oben gezogenen Augenbrauen erkenne ich, wie wenig Gedanken er sich zuvor gemacht hat, die Tochter seines Mentors zu dieser Veranstaltung einzuladen. Erst jetzt spürt er, wie ich ihm, wenn auch unabsichtlich, den Rang ablaufe und wie unwohl ich mich dabei fühle.
Auf dem roten Teppich bejubeln die Reporter nun die soeben eingetroffenen Berühmtheiten der Wissenschaft und Politik. Die wenig übrig gebliebenen Gegner der genetischen Selektion wurden vorsorglich am anderen Ende der Stadt mit einem Großaufgebot mithilfe von etlichen Sondereinsatzkommandos vom Veranstaltungsort ferngehalten.
Schon im Vorfeld gab es unzählige Festnahmen, damit ja kein noch so winziges Ärgernis den glamourösen Festakt ruiniert. Die High Society der Forschung möchte unbehelligt feiern und sich auf gar keinen Fall mit Kritik, Bedenken oder Zweifel auseinandersetzen.
Ich lege meine Hand auf Theos Unterarm, um ihn zu beruhigen. Zeitgleich schlucke ich meinen Groll auf den fachlich begnadeten, aber gefühlsmäßig ungelenken Mann herunter, der mir stammelnd und ohne Verlobungsring einen plumpen Heiratsantrag gemacht hat.
»Sie wagen es nicht, Theo. Wir machen uns einen schönen Abend und ich halte mich von den Reportern fern, bis sie sich beruhigen und genügend Fotos von dir im Kasten haben.«
»Du bist wunderbar.«
Erneut wende ich meinen Blick ab, denn seiner durchdringt mich buchstäblich.
Inzwischen drängen sich immer mehr Gäste zur Einlasskontrolle. Die kreischenden Rufe der Reporter vertreiben jäh den zerbrechlichen Frieden, der zwischen Theo und mir aufkeimt. Es gibt hier nirgendwo ein Entrinnen und unsere strapazierten Nerven liegen erneut blank.
Ein Pärchen schreitet lächelnd auf uns zu. Erleichtert erkenne ich den amtierenden Stadtrat Edmund Freiger mit seiner geschiedenen Frau Martina. Vaters Freunde, die regelmäßig zu seinen Freitagabend Empfängen kamen und gute Bekannte von mir sind.
»Ich fühle mich heute ernsthaft entbehrlich«, murmele ich, denn der Stadtrat erreicht uns just in dieser Sekunde. Auf Theos Gesicht zeichnet sich ein müdes Lächeln ab, weil er sich durch die Neuankömmlinge gestört fühlt.
»Wie erfreulich, dich nach so langer Zeit zu sehen, Emma«, begrüßt mich der sympathische und füllige Stadtrat mit den Geheimratsecken an der hohen Stirn. »Die Reporter benehmen sich wie die Aasgeier und erst die einfältigen Fragen, die sie stellen. Die schlagen dem Fass glatt den Boden aus. Guten Abend, Herr Stigner. Wie ich jüngst hörte, sitzen wir erfreulicherweise am selben Tisch. Wenn Sie uns also bis nachher entschuldigen, Martina drängt es auf dem schnellsten Weg zur Damentoilette, denn sie fühlt sich von der Aufregung und dem elendigen Blitzlichtgewitter unwohl.«
Besorgt mustern wir drei die fahl wirkende Frau, die sich in seine Seite drückt, um sich dort anzulehnen. Ich schätze ihr angenehmes Wesen. Auf mich wirkt sie wie ein jung gebliebenes Schneewittchen. Ihre dunkelbraunen Haare, der blasse Teint und die unsagbar klugen Augen riefen schon als Kind meine Vorstellung von einem lebenden Märchenwesen wach.
»Komm Martina, du siehst tatsächlich blass um die Nase aus. Ich begleite dich gern zur Toilette«, biete ich hilfsbereit an und reiche ihr meinen Arm als Stütze.
»Sehr gern«, gibt sie verhalten zurück. »Wir treffen uns dann gleich am Tisch?«
»Selbstverständlich, Martina«, entgegnet Theo höflich, tritt jedoch nah zu mir, um mir noch einen Satz in mein Ohr zu flüstern: »Ich gebe dir eine weitere Woche Bedenkzeit.«
Schnellstens schaue ich an ihm vorbei. Statt einer Antwort führe ich Martina in die gut besuchte Damentoilette.
Dort geleite ich sie zu einem der vielen gepolsterten Stühle, drängele mich durch die aufgeregte Frauenmenge, die ihre Aufmachung an den Spiegeln überprüft und befeuchte ein Tuch. Nach wenigen Augenblicken wieder zurück, reiche ich ihr den Lappen, den sie dankbar entgegennimmt und zaghaft lächelt.
»Wenn der Festakt nicht so wichtig für Edmund sein würde, wäre ich am liebsten bei meinem angelesenen Buch geblieben«, gesteht sie mir, während ich ein bereitgestelltes Wasserglas für sie fülle.
»Du besitzt ein echtes Buch?«
Vater besaß einst auch sehr viele. Aber heute … verschwunden, wie die weitschweifigen, saftig grünen und üppig wachsenden Wälder.
»Nicht nur eines, mein Kind, aber ich erwähne es ungern. Du weißt ja, die Neider. Die Bücher lagern in einer hoch gesicherten, klimatisierten Bibliothek. Jedes Einzelne spricht meine Sinne an. Ein Buch aufzuschlagen, gleicht wahrhaft einem feierlichen Ereignis. Der wohlige Geruch des Papiers. Das erhebende Gefühl, Wissen in den Händen zu halten … phänomenal. Derzeit lese ich Herman Melvilles Mobi Dick. Kennst du es? «
»Nicht in Papierform, aber inhaltlich ging es um Umweltthemen, wenn ich mich recht erinnere.«
»Melvilles war seiner Zeit offenbar weit voraus. Digital finde ich jedes Buch nur halb so spannend wie auf Papier. Stell dir vor, wie er schon damals wunderbar den Raubbau an der Natur erfasst und das Thema geschickt in ein spannendes Naturabenteuer verwoben hat.«
»Ich kann mir echte Bücher leider nicht leisten. Vater verbrannte in einem Wahnanfall alle auf der Terrasse. Aber es waren ohnehin keine Romane, sondern ausnahmslos wissenschaftliche Texte.«
»Um jedes vernichtete Wort auf Papier sollten wir eine Träne weinen. Wie Schade, dass heutzutage sogar angemessen bezahlte Sprachwissenschaftler darauf verzichten müssen. Die Bibliothek wäre eine echte Fundgrube für dich, meine Liebe. Die reinste Offenbarung.«
»Ich fürchte, jetzt fühle ich mich neidisch und würde sehr gern einmal lesen. Überdies bin ich zufrieden, dass ich auf dem Speicher einen uralten Schreibblock gefunden habe und empfinde selbst ihn als zu kostbar, um ihn zu beschreiben. Aber ich rieche laufend an dem wunderbar duftenden Papier.«
»Ja, Schade um all die abgeholzten Bäume. Stell dir vor, ich kenne eine Stelle, an der noch welche im Überfluss wachsen. Weißt du was? Ich leih dir Mobi Dick, sobald ich damit durch bin. Aber, du musst mir hoch und heilig versprechen, es gut zu verwahren und pfleglich zu behandeln.«
»Wie bitte?«
Ich weiß nicht, auf welche der beiden Aussagen ich zuerst erstaunt reagieren soll. Sie kennt einen echten Wald und leiht mir ein echtes Papierbuch aus?
»Sieh nicht so überrascht, Liebes. Ich leih es dir aus, denn du musst unbedingt erfahren, wie ungemein sinnlich es sich anfühlt, einen Roman vom Papier abzulesen, eine Seite umzublättern, die Struktur des Holzes zu fühlen. Es ist erheblich sinnlicher, als das neumoderne Steinpapier, obwohl dies gewiss Vorteile hat, die ich nicht leugne. Ehrlich gesagt wäre ich jetzt am liebsten daheim mit einer Tasse duftenden Tee. Ich würde liebend gern der Geschichte folgen und mich in dem Kampf zwischen Mensch und Natur verlieren. Aber, ich verrate nicht, wie die Geschichte ausgeht.« Träge erhebt sie sich und umfasst Halt suchend meinen dargebotenen Arm. »Ach, wie schrecklich ich die wöchentlichen Empfänge deines Vaters, vermisse, Emma. Die ganzen Freigeister, die Querdenker und Wegweiser, die sich um ihn geschart haben … Dabei fällt mir ein, wie du und mein Sohn euch andauernd in das Arbeitszimmer verkrochen habt.«
»Daran erinnere ich mich gar nicht, so lange muss es zurückliegen. Er war doch auf irgendeinem Internat?«
»Richtig, aber das scheint mir ebenfalls Ewigkeiten her. Entschuldige meine heutige Rührseligkeit. Ich fühle mich etwas geistesabwesend.«
»Geh einfach nach dem offiziellen Teil zu deinem Mobi Dick«, ermutige ich Martina lächelnd, die sich auf den kurzen Marsch zum Tisch konzentriert.
Dort angekommen, springen Theo, der Stadtrat und andere Männer auf. Sie saßen bereits und unterhalten sich aktuell miteinander. Äußerst angeregt, wie ich feststelle.
»Guten Abend, die Herren. Frau Wenzin. In Anbetracht von Martinas Verfassung setze ich mich besser neben sie. Wenn die Herren daher bitte liebenswürdigerweise jeweils einen Stuhl weiter rücken würden? Danke schön«, verkünde ich bestimmt, ohne großartig in jedes einzelne Gesicht zu schauen.
Ein modisch gekleideter Mann, der mit dem Rücken zu mir sitzt und sich eifrig mit Edmund unterhält, springt prompt auf. Er sitzt neben Martina und fühlt sich sogleich angesprochen. Jeder am Tisch rückt freundlicherweise einen Stuhl weiter.
Auch er.
Der graue Anzug, den sieben Knöpfe am schräg verlaufenden Reverse zieren, wurde mit schwarzen Paspeln abgesetzt und schmückt ein farblich passendes Einstecktuch. Die gepflegte Erscheinung steht im Widerspruch zur Langhaarfrisur, die untypisch und gegen die aktuelle Mode der Männer steht. Höflich bietet er mir seinen Stuhl an, den er ritterlich ein winziges Stück zurückzieht.
Graue Augen blicken mich an.
Innerlich erstarre ich zu einer Salzsäule. Vor mir steht der jüngste Professor aller Zeiten, der lieber in Leipzig studiert hat als in Harvard oder Oxford.
Mit einer anmutigen Handgeste bittet er mich, seinen Stuhl anzunehmen, damit ich neben Martina Platz finde. Wie der füllige Edmund bei Martina hilft er mir beflissen, den Stuhl so zu platzieren, damit ich mich mühelos setzen kann. Dankend lächele ich ihn an, doch ich fürchte, ich sehe hochgradig albern dabei aus.
Theo räuspert sich und rutscht unruhig auf seinem Stuhl umher. Gewiss behagt ihm nicht, wie auffällig lange mich die imposanten und in der Farbe beeindruckenden Augen mustern. Und ich dachte damals, er hätte blaue oder gar braune Augen.
Jetzt verstehe ich, warum dieser Blick …, denn er geht tatsächlich durch und durch.
»Askel, das ist Emma. Erinnerst du dich an sie?«
Seine Augen auf mich gerichtet, schweigt er, wendet seinen zudringlichen Blick jedoch nicht ab.
»Constantins Tochter«, erklärt Martina. »Emma, das ist mein Sohn Askel.«
Askel von Host ist Martinas Sohn?
Dann … Das ist der kleine Junge, mit dem ich in Vaters Arbeitszimmer gespielt haben soll? Ich erinnere mich nicht.
»Das reinste Affentheater, fand ich«, murmelt Theo, wenngleich er nicht gemeint war.
»Sie übertreiben maßlos, Theo«, wirft der Edmund ein, der neben Martina Platz nimmt. »Sie spielten zusammen, verstreuten kurzerhand die Spielkarten im gesamten Büro und erkoren einen Adler als ihr Wappentier für ihre imaginäre Flagge. Anschließend stellten sie Constantins Büro auf den Kopf. Ich fand es grandios, dabei war Emma erst fünf.«
»Nein, Edmund, denn sie war vier Jahre«, korrigiert Martina und deutet es mit der entsprechenden Zahl der erhobenen Finger an.
»Ich?«, frage ich überrascht, weil mir jegliche Erinnerung daran fehlt und nun fragend zu Martina blicke.
Die ergreift meine Hand, drückt sie fest und murmelt hinreißend lächelnd: »Es war so entzückend, euch Kinder zu beobachten. Ihr habt aus jeder Kleinigkeit eine Wissenschaft gemacht. Niemand von den Erwachsenen wollte euch dabei stören, aber alle sahen hingerissen zu.«
»Du erinnerst dich nicht? Ernsthaft?«, erkundigt sich Askel vergnügt, wobei der rechte Mundwinkel ein leichtes Zucken umspielt.
»Ich erinnere mich verschwommen an etwas anderes«, murmele ich wahrheitsgetreu und bereue es auf der Stelle.
»Woran?«, möchte er erwartungsgemäß wissen.
Mit gesenktem Kopf greife ich zur Serviette und hoffe, niemand der Anwesenden bemerkt, was ich auf meinen Wangen spüre. Mein Sympathikus, jener Nervenstrang, der Teil des vegetativen Nervensystems ist und somit unwillkürlich die Regulation bei Stress übernimmt, versetzt mich skrupellos in höchste Alarmbereitschaft und pumpt unentwegt erhitztes Blut in meinem Kopf, bis sich meine Wangen kochend heiß anfühlen.
Das Schlimme an der Sache: Ich kann nichts dagegen unternehmen, fühle mich der Hitze hilflos ausgeliefert und kann in meinem stillen Kämmerlein nur hoffen, es bemerkt niemand.
Kapitel 3
d
»Verschwommene Erinnerungen sind belanglos, andernfalls würde sich der Geist daran erinnern«, rettet mich Theo aus der Antwort, ohne im Mindesten zu ahnen, wie sehr er in meinem Fall daneben liegt.
»Ist das Ihre wissenschaftliche Meinung?«, richtet sich der unterschwellig Angesprochene an den zufrieden dreinblickenden Theo. Dessen Sympathikus reagiert ebenfalls, doch er setzt beherzt an, um etwas zurückzugeben.
»Ah, seht nur, ist das nicht Johann von Berchtingen?«, unterbricht Edmund die sich anbahnende Kontroverse, bei der jeder gescheite Mann nur verlieren kann.
»In der Tat«, entgegnet Martina. »Ich hörte, er hält heute eine Laudatio. Sein Leiden zeichnet ihn gotterbärmlich und ich frage mich, woher er die Kraft nimmt. Er ist ein wahrhaft schneidiger Mann, der seiner Parkinsonerkrankung kämpferisch die Stirn bietet.«
»Ich bin sicher, er kompensiert es gewiss«, murmelt Theo und schielt Johann und Babette hinterher.
Strafend dreinblickend gleitet mein Blick zu ihm, jedoch lässt er das Rückgrat vermissen, mich anzusehen. Alle anderen schauen Babette hinterher, die drei Tische weiter den Rollstuhl an einen freien Platz schiebt und die Bremsen feststellt.
»Ein schönes Paar«, sinniert Askel von Holst neben mir und trinkt ohne Hast aus seinem Wasserglas. Diensteifrige Kellner treten sogleich heran, schenken Wasser in die unbenutzten, hochglanzpolierten Gläser ein und füllen dort nach, wo Bedarf herrscht.
»Wir unterhielten uns vor Ihrem Erscheinen über Theos Chancen, neben dem Preis für sein Lebenswerk auch den für die bedeutendste Entdeckung des Jahrzehnts zu erhalten«, lenkt der Direktor des Amtes für Genüberwachung das Gesprächsthema auf Theo.
Das Amt für Genüberwachung, welches unter der Leitung von Herrn Wenzin steht, arbeitet eng mit BIOX zusammen. Durch diese Kooperation und dessen rentablen, staatlichen Aufträge entwickelte sich die Firma von Theo innerhalb weniger Jahre zur höchstdotierten Aktiengesellschaft an der Frankfurter Börse. Damit wurde nicht nur Theo milliardenschwer, sondern auch der Direktor Wenzin, der kräftig in ebenjene Aktien investiert.
»Wollen Sie damit andeuten, Sie schließen für Theo automatisch alle weiteren Kategorien aus?«, frage ich mit erstaunt erhobenen Augenbrauen meine es aber nicht ganz ernst.
Augenblicklich erhebt sich verhaltenes Gekicher von allen Seiten. Mit irritiertem Augenausdruck schaut Theo in die Runde und erkennt aber kurzzeitig den Grund der allgemeinen Erheiterung nicht. Seine Position ist undankbar, denn er sitzt zwischen den Stühlen. Genauer gesagt, sitzt er zwischen alten Bekannten einerseits und dem Entscheider über weitere profitable Aufträge andererseits.
»Nun, wie mir scheint, geriet sein Charakter eindeutig eine Spur bescheidener als der Ihren«, kontert der Direktor.
Sofort verstummt das Gekicher am Tisch. Einige Gesichter verstecken sich hinter den blütenweißen und gestärkten Stoffservietten.
Durch diesen geschwollen daherkommenden Angriff angestachelt, mustere ich den unsympathischen Mann eine Weile. Anmaßend schaut er zu seiner Frau, die neben ihm sitzt und ihm eifrig nickend beipflichtet.
Herr Wenzin trägt teure, wenn auch unmoderne Garderobe. Der ganze Pomp vermag die Arroganz seines Wesens jedoch nicht im Entferntesten zu kaschieren. Wie kommt es nur, dass einflussreiche Personen wie ganz gewöhnliche Menschen erscheinen, nahezu unscheinbar wirken und sich dennoch bei näherer Betrachtung als absolute Widerlinge entpuppen?
»Da meine privilegierten Eltern sich trotz ihres Vermögens keinen selektierten Menschen gestalten wollten, müssen Sie mir die Tendenz zur Unverschämtheit wohl oder übel nachsehen. Ich möchte Sie ebendeswegen vorwarnen, denn es tritt je nach gesellschaftlichem Verkehr vermehrt auf.«
»Ganz der Vater«, kichert Martina gedämpft neben mir. »Er war immer so köstlich unverblümt und dennoch charmant, womit ihm niemand seine unmissverständliche Art ernsthaft zürnen konnte. Wie herzerfrischend ich dich finde, Emma.«
»Herzerfrischend?«, fragt ihr geschiedener Mann skeptisch. »Ich halte diesen Charakterzug in der heutigen Zeit eher für risikobehaftet.«
»Ach, Edmund. Stand uns früher nicht auch die rigorose Stirn gut zu Gesicht? Leider haben wir sie mit den Ehejahren abgestreift, was zur unschönen Scheidung geführt hat, die in den Augen aller Klatschtanten exorbitante Ausmaße annahm.«
»Wo wäre die Menschheit heute ohne wagemutige Experimente?«, erkundigt sich Theo, ganz der Forscher, der Martinas traurigen Blick übergeht.
Wenn auch tapsig, schlägt er sich damit auf meine Seite und manövriert geschickt um ebenjene Scheidung, die vor fünf Jahren in aller Munde war. Freilich lediglich hinter vorgehaltener Hand und mit schiefem Blick auf Martina, in der alle eine undankbare Übeltäterin sahen.
»Nun, ich für meinen Teil finde es mehr als befremdlich, wenn ausgerechnet die Tochter unseres hochgeschätzten Herrn Conde so offen gegen die Gentechnik wettert«, murmelt Herr Wenzin, was wie eine doppelte Ohrfeige bei mir ankommt.
»Ich wettere nicht«, erkläre ich leicht über den festlich eingedeckten Tisch gebeugt, obwohl ein Kellner den ersten Gang serviert. »Schon gar nicht gegen die Gentechnik.«
»Ach nein?«, fragt er mit und zieht eine Augenbraue leicht nach oben.
»Das kann ich absolut bestätigen«, wirft sich Theo wie ein Kavalier in die Bresche. »Meine liebe Emma wettert keinesfalls gegen die Gentechnologie. Sie äußert nur ihre rational motivierten Bedenken, wie wir Forscher die erforschte Technik in Zukunft anwenden. Absolut vertretbar, versichere ich ihr immer.«
»Und Sie als einer der höchstdotierten Forscher und Firmeninhaber von BIOX akzeptieren, ohne in Gewissensbisse zu geraten, die Tendenz zur Impertinenz bei der Tochter von Constantin Conde?«, entgegnet Herr Wenzin, der Theo achtsam beäugt. »Wie ist das mit ihren beruflichen Zielsetzungen und der Vorbildfunktion für die Gesellschaft vereinbar?«
»Lassen Sie diese Vereinbarkeit bitte meine Sorge sein, Herr Wenzin. Im Übrigen sehe ich Emmas unverblümte Art nicht als Impertinenz an. Für mich gleicht sie eher einer treibenden Kraft. Für all meine Forschungen. Und nicht nur das. Sie müssen zugeben, ihre Bedenken und Abwägungen kommen einem Geschenk gleich, welches, mit Verlaub, Stimulans und Aufforderung zugleich ist, jederzeit bestmögliche Endergebnisse abzuliefern. Ausschließlich ihrem agilen Geist verdanke ich, dass ich mit meinen Forschungsergebnissen heute dort stehe, wo Sie mich sehen. Weiter bin ich felsenfest davon überzeugt, die außergewöhnlichen kognitiven Fähigkeiten meiner Verlobten gereichen unseren Kindern einmal sehr zum Vorteil. Es waren in der Menschheitsgeschichte doch immer diejenigen, die alles und jedes infrage stellen, die letztlich wahrhaft Großes vollbrachten, oder etwa nicht?«
Habe ich richtig gehört?
»Mo…, Moment«, versuche ich, die sich überschlagenen Gedanken nacheinander zu erfassen. »Verlobt?«
»Im letzten Punkt muss ich Ihnen applaudierend beipflichten«, entgegnet Herr Wenzin schmallippig, ohne auf meine Verwirrung einzugehen. »Aber wieder einmal zeigt sich, wie Sie jeden überzeugen, Herr Stigner. Selbst, wenn es um die Sinnhaftigkeit einer Stubenfliege geht.«
»Sie wollen Emma ernsthaft mit einer Stubenfliege vergleichen?« Schrill erhebt Theo die Stimme. Er will aufspringen und sich heute scheinbar mit jeden am Tisch anlegen, wird aber von seinem Tischnachbarn zurückgehalten.
»Das haben Sie wunderschön ausgedrückt, Herr Stigner«, übergeht Frau Wenzin den Angriff ihres Mannes. »Ich bekomme direkt eine Gänsehaut, über so viele Lobeshymnen auf Ihre Muse. Das lässt mich direkt in Vorfreude auf Ihre grandiose Dankesrede schwelgen. Wenn doch nur jeder Mann derart zu schätzen wüsste, was er an seiner besseren Hälfte hat.« Bei ihrem letzten Satz trifft ihren Mann ein vielsagender Seitenblick.
»Ich bin weder seine Muse, seine bessere …, noch seine Verlo...«
Kichernd unterbricht mich Martina, streckt feierlich ihr Wasserglas in die Höhe und prostet der loyalen und leicht ergrauten Frau zu: »Wie wahr, wie wahr, Frau Wenzin. Einen besseren Trinkspruch auf die Liebe bringt heute niemand vor.«
»Aber …«, protestiere ich und schaue verärgert zu Theo, der meinen Blick meisterlich ausweicht.
»Unter diesen Umständen«, murmelt er zufrieden in einige Gesichter blickend, wischt sich seinen Mund an der Stoffserviette ab und erhebt ebenfalls das Glas. »Lassen Sie mir bitte ein klein wenig Zeit, dann werde ich Sie heute Abend gewiss überraschen. Da meine liebe Emma mit der Sprache vertraut ist und die Entstehung der Wörter akribisch entschlüsselt, muss ich das Wort ›Muse‹ in dem Zusammenhang strikt reklamieren, Frau Wenzin. Ich kann sie nicht als Muse degradieren, denn für mich gleicht sie einer Königin.«
Alle am Tisch schauen umgehend zu mir. Einige der Gesichter wirken erstaunt, andere erwarten mit unbeweglichen Mienen meine Reaktion. Die bleibt aus. Einzig meine Augenbrauen ziehen sich verärgert zusammen.
»So dann. Ein Toast auf die Verlobung«, kräht Herr Wenzin und hebt das Champagnerglas. Mehrheitlich tun es ihm die Gäste am Tisch nach, bis sie meinen grimmigen Blick bemerken.
»Es muss Ihnen nicht unangenehm sein, meine Liebe«, säuselt Frau Wenzin zuckersüß. »Wir erfuhren alles aus den Medien, obwohl Sie beide sich die größte Mühe gaben, diesen Umstand lange Zeit vor der Öffentlichkeit geheim zu halten.«
»Die Medien?«, frage ich mit Blick auf Theo und verstehe sogleich.
Aha, diese interessanten Neuigkeiten wollte er mir also in der Limousine mitteilen. In dieser Erkenntnis schlage ich mir an den Kopf, weil ich exakt in diesem Augenblick mehrere Puzzleteile zusammensetze. »Ach ja, die gewieften Medien wissen ja immer alles aus allererster Hand.«
»Nun, das Foto war eindeutig«, murmelt Frau Wenzin und wirkt dabei unangenehm berührt, weil ich abfällig abwinke.
»Ja«, lache ich und schaue kurz zu meiner linken, ausgestreckten Hand, an der kein Diamantring von einer innigen, rührigen oder tränenreichen Verlobung erzählt. »Die wissen sogar immer alles vor mir. Ähm … Wie bitte? Welches Foto?«
»Ich freue mich jedenfalls für Sie und gratuliere herzlichst«, schmunzelt Frau Wenzin zurückhaltend und schlürft geräuschvoll einen gehörigen Schluck aus dem langstieligen Glas.
»Und ich erst«, presse ich zwischen meinen Zähnen hervor, lächele sie aber heldenhaft an.
Innerlich koche ich und bedenke Theo mit einem wutschäumenden Blick. Er hält es nicht einmal für nötig, den Irrtum zu dementieren. Garantiert lässt er nach der Veranstaltung mehr als zwei oder drei Federn. Genüsslich werde ich sie ihm einzeln ausrupfen und ihn ersuchen, noch heute Abend in sein Haus zurückzukehren.
»Nun, mir scheint, wir haben heute gleich mehrere Gründe, zu feiern«, frohlockt er, während ich mir insgeheim vorstelle, wie ich ihm mit einem festen Griff die Luftzufuhr am Hals abdrücke. »Was für ein Glückspilz ich doch bin, meine Herren.«
Bei seinen letzten Worten schweift der dreiste Blick in die Runde.
»Wie Schade, dass Constantin heute nicht bei uns weilt«, wirft Edmund ein und wirkt urplötzlich nachdenklich. »Er würde sich bestimmt über diese Nachricht freuen. Ich erinnere mich, wie entzückt er immer war, wenn du als Dreikäsehoch bei ihm ins Arbeitszimmer getapst bist.«
»Daran erinnere ich mich«, antworte ich mich straffend. »Ich schlich mich auf Zehenspitzen in sein Büro und sah ihm heimlich über dem Schreibtisch zu. Er schnitt in aller Seelenruhe eine Krone aus einem Blatt Papier aus, welches er vermutlich aus alten Unterlagen entnommen hatte. Mit andachtsvoll gesprochenen Worten setzte er sie mir anschließend auf das Haupt. Ich vermute, derlei Gebaren eines sentimentalen Vaters förderte meine viel gerühmte Impertinenz. Welches kleine Mädchen steigt eine Königskrone schließlich nicht zu Kopf? Und dann noch aus einem derart kostbaren Material.«
Pikiert schaut mich der Direktor an. Frau Wenzin legt rührselig beide Hände auf ihre Herzgegend. Martina lacht geräuschvoll.
»Ganz der Vater«, schmunzelt sie verträumt und nimmt seufzend ihre Gabel auf. »Ich sah es eines schönen Tages. Wirklich, ich sah es mit meinen eigenen Augen. Dich und diese Krone aus Papier.«
»Tatsächlich?«, erkundige ich mich verwundert, weil sie bemerkt, wie ich sie ungläubig anstarre.
»Aber sicher, Emma. Nun, wie es sich mir aber heute darstellt, setzt dir in Kürze der liebe Theo eine Krone auf das Haupt. Und die ist gewiss nicht aus Papier, sondern aus purem Gold. Sieh nur, wie majestätisch sein Kopf immerfort wackelt.«
»Wer weiß, liebe Martina, ob er nachher überhaupt noch einen Kopf auf den Schultern trägt«, entgegne ich kaum vernehmlich und zwischen den Zähnen hervor gepresst, aber zu Theo sehend.
»Junge Leute sind entzückend, wenn sie frisch verliebt sind«, gackert Frau Wenzin und lehnt sich an ihren Mann.
»Wie geht es deinem Vater?«, erkundigt sich mein Tischnachbar, der bislang ohne eigene Beiträge die Unterhaltung verfolgt hat.
»Danke, der Nachfrage«, entgegne ich und bin dankbar, über den unvermittelten Themenwechsel. »Leider vergisst er kontinuierlich sein Leben. In einigen Augenblicken schwanke ich und überlege, ob es für ihn Segen oder Fluch bedeutet.«
»Ich hoffe, es ist ein Segen für ihn«, murmelt Martina beinahe lautlos.
»Doch ganz sicher ein Fluch«, tönt der Herr Wenzin zeitgleich und übertönt meine Tischnachbarin.
»Wie gesagt, ich bin überzeugt, es ist beides zu gleichen Anteilen«, gebe ich zu denken.
»Nun, niemand verstand so recht, warum er damals der Nachwelt derart entschlossen seine Resultate vorenthalten wollte«, grübelt Herr Wenzin und weiht uns damit in seine ungeschminkten Ansichten über Vaters ›Verbrennungsaktionen‹ ein. »Dabei waren seine Forschungsergebnisse weit mehr als bahnbrechend. Geradezu revolutionär. Leider Gottes ist dieses Wissen tragischerweise auf immer verloren. Was für eine Schande, dass ihn damals niemand aufhalten konnte.«
Mühsam zerkleinert er das servierte Oktopusherz, welches in mir absoluten Ekel erregt. Die drei Herzen werden dem Tier bei lebendigem Leib entnommen, damit das Fleisch nach der Zubereitung angeblich zart auf der Zunge schmilzt. Zudem stößt mich die Art ab, wie er das Herz kaut, über Vater und mich redet, als ob ich ihn entmündigen hätte sollen und jetzt nicht an diesem Tisch sitze.
»Vermutlich hat er seine Aufzeichnungen zerstört, weil er verhindern wollte, was Ihre Behörde damit in Gang setzt«, gebe ich angriffslustig zurück.
»Emma«, beschwört Theo mich, nicht in das Minenfeld der Politik abzuschweifen.
Doch ich bin in Fahrt und Herr Wenzin hält mich sowieso für unverschämt. Außerdem fühle ich mich streitlustig, muss meinem Ärger unbedingt Luft verschaffen und kann diese unterschwelligen Angriffe keine Minute länger auf mir sitzen lassen.
»Was? Es ist doch hinlänglich bekannt, dass Vater sich vehement gegen diese Vorgehensweise der Genbehörde gestellt hat. Und ich erkläre auch gerne warum. Es ist allein den oberen Zehntausend von Nutzen, ihre Kinder gewinnbringend zu selektieren. Was, ganz nebenbei bemerkt, ein kleines Vermögen kostet. Der breiten Masse bleibt ebendarum dieses Auswahlverfahren verschlossen, wodurch sich die Chance entscheidend dezimiert, in absehbarer Zeit ebenso erfolgreich zu agieren und ebenfalls ein kleines Vermögen anzuhäufen. Das sah mein Vater voraus und wollte es verhindern. Wäre es anders, hätte er keinen Grund gesehen, sein Wissen auf immer zu vernichten.«
Geräuschvoll legt Theo seine Gabel auf den Tisch ab und schaut vorwurfsvoll drein. Ihm ist Politik am Tisch auf ähnliche Weise verhasst, wie Tagträumer, die stundenlang und gedankenverloren an ihren Schreibtischen hocken. Ich kann nicht einmal mit absoluter Gewissheit sagen, was Theo nicht unerträglich findet, obwohl ich ihn lange kenne.
»Ich pflichte Emma bei. Wer kann sich als einfacher Arbeiter heutzutage leisten, ein Kind aufgrund von intellektuellen oder äußerlichen Aspekten modellieren zu lassen?«, wirft Frau Wenzin ein.
»Die Honorare für derartige Selektionen sind tatsächlich unerschwinglich und zudem nur nach etlichen, bürokratischen Voraussetzungen möglich. Es gibt demnach gleich zwei Hürden, die ein Werktätiger nehmen muss. Das grenzt in der Tat an Benachteiligung und ich bin heilfroh, dass meine Familienplanung abgeschlossen ist«, murmelt Martina, die an ihrem Champagnerglas nippt und hinter meinem Rücken Askel antippt.
»Nun, genau diese kaufkräftige Klientel finanziert eben das ganze Brimborium«, verteidigt sich Herr Wenzin, der aufgebracht mit seiner Hand gestikuliert, in der er die silberne Gabel hält. »Wie immer kommt eine kleine Gruppe für die breite Masse auf, die dann auch noch andauernd herumnörgelt und sich bei jeder Gelegenheit beschwert, statt dankbar zu sein. Oder wie sehen Sie diesen Fakt, Frau Conde?«
Ich aß keinen einzigen Bissen dieses bejammernswerten Tieres und strecke meine Hände neben dem Teller aus. »War es auf der Titanic nicht die unterste Klassenschicht, die die Preise der pompösen und luxuriösen Überfahrt der oberen Klasse als vergleichbares Taschengeld aussehen ließ und überhaupt erst ermöglichte? So war es immer und so bleibt es vermutlich bis in alle Ewigkeit. Selbst, wenn einige Ultrareiche es gerne andersherum darstellen. Und ebenjene Menschen ließen sie qualvoll ertrinken, als seien sie lediglich lästige Ratten.«
Als hätte er in seiner Funktion als Leiter einer einflussreichen Behörde, diese gegebenen Umstände noch nie zu Ohren bekommen, schaut Herr Wenzin überrascht von seinem Oktopusherz auf. In seinen Gesichtszügen steht nun deutlich die urplötzliche Appetitlosigkeit geschrieben.
»Ganz der Vater«, kichert Martina amüsiert.
»Ganz sicher ließ die obere Schicht sie nicht qualvoll ertrinken. Es ist hinlänglich bekannt, dass es auf der Titanic zu wenig Rettungsboote gab«, entgegnet der verschnupft dreinblickende Direktor, der jetzt unverhohlen zum Angriff übergeht.
»Freilich, aber nur, damit der Oberklasse beim Flanieren genug Platz auf den Oberdecks blieb. Die Arbeiterklasse ertrank sehr wohl. Und zwar qualvoll. Eingeschlossen in den Unterdecks«, fahre ich ungerührt fort.
Mahnend hebe ich einen Zeigefinger. Theos Seufzen überhöre ich gekonnt, denn Personen, wie der Herr Wenzin reizen meinen Gerechtigkeitssinn bis zur Belastungsgrenze aus.
»Emma«, murmelt Theo nun eine kleine Spur ungehalten.
»Egal«, wiegele ich mit einer fahrigen Handbewegung ab und verziehe abschätzig meinen Mund. »Es gibt ausreichend Fußvolk, die die nächste Luxusüberfahrt für die Herrschaften finanzieren. Im Endeffekt vermehren sie sich seit Jahrhunderten noch immer wie die Kaninchen und stehen dem Ultrakapitalisten damit unbegrenzt zur Verfügung. Zumindest, solange wir sie dumm genug halten und sie nicht über die wahren Gründe ihrer prekären Lebensumstände aufklären.«
»Was reden Sie? Sie sitzen doch seit Ihrer Geburt selbst an dieser Seite des Tisches«, empört sich Frau Wenzin. »Und Sie plappern daher, als wollen Sie heute an genau diesem Tischbein sägen. Das käme dann Anarchie gleich.«
»Ich finde, du übertreibst maßlos, Emma«, regt sich Theo unruhig auf seinem Stuhl. »Eine kunstfertige Wendung im Gesprächsthema wäre an dieser Stelle überdies äußerst angebracht.«
»Ich habe den Eindruck, Ihre Kinder profitieren tatsächlich von Emmas kognitiven Fähigkeiten, Herr Stigner«, trällert Martina trocken und tupft sich ihren rot geschminkten Mund an der Serviette ab. »Zogen Sie schon in Erwägung, sich ein Kind zusammenzustellen?«
»Anarchie beinhaltet nicht zwangsläufig auch die Abwesenheit jeglicher Herrschaft. Wie überaus müßig ich diese Parole finde, die beständig von den Ultrakapitalisten verdreht wird, um beim Volk Angst vor Veränderung zu schüren. Selbst Mutter Natur existiert und wirkt mit jeder Sekunde anarchistisch. Sie braucht keinen Herrscher, weil es in ihrer Natur liegt, sich ohne Zwang oder Druck zu entwickeln. Warum sollte es den Menschen ohne Herrschaftsansprüche anders ergehen? Menschen sind schließlich auch ein Teil dieser grandiosen Natur und würden ihren rechtmäßigen Platz finden, wenn ihnen genug Raum gegeben wird. Stellen Sie sich bildlich vor, es gäbe keinen Herrscher, der Freude daran verspürt, eine saftige Zitrone auszupressen, um sich an dem Saft gütlich zu tun. Was da alles an Freigeist möglich wäre und wohin es die Menschheit bringen könnte. Aber nein, ein dummes Volk regiert sich leichter, nicht wahr?«, rede ich mich in Rage, ohne auf Martinas Frage einzugehen.
»Wer sagte das noch einmal?«, will Askel wissen.
Der Kopf mit der gelockten Haarmähne neigt er sich leicht nach vorn und schiebt sich langsam in mein Gesichtsfeld. Der Intelligenzbrocken am Tisch nimmt mich also auf den Arm? Dachte mir doch gleich, dass er die Nase ziemlich weit erhoben trägt. Die apart geschwungenen Nasenflügel zucken minimal, als sei er von meinem Blick belustigt.
»Wurde es dir im Eliteinternat versäumt, zu vermitteln, von Holst? Oder warst du in den drei Monaten auf dem Chalet im Ski-Resort Gstaad mit Skifahren derart zeitlich in Anspruch genommen, um kein bisschen für deine Allgemeinbildung zu tun?«
Es ist kein Geheimnis, dass die komplette Eliteschule samt Haus- und Hofstaat für drei Monate nach Gstaad umziehen und es Winter-Campus nennen. Der Schulunterricht findet ausschließlich am Vormittag statt, während die Nachmittage dem Sport auf Schnee und Eis vorbehalten sind. In meinen Ohren klingt das mehr nach Ferienlager als nach Studium.
»Höre ich etwa Missgunst aus deiner Frage heraus?«, erkundigt sich Askel von Holst mit einem schiefen Lächeln.
»Worauf missgünstig? Darauf, die meiste Zeit des Jahres von meiner Familie getrennt zu leben? Gott bewahre! Wer hätte mir in Le Rosey eine Krone aufgesetzt? Du?«
»Penderetoperam.«
»Friedrich der Große, sagte das einst«, tönt Theo, der es sogleich in seinem Armbandhandy recherchiert und damit gekonnt den Blickkontakt unterbricht. Und damit die unverschämte Antwort von Host, es käme auf einen Versuch an.
»Genau, der Markgraf von Brandenburg sagte dies«, ergänze ich seinen miserablen geschichtlichen Wissensstand, sehe aber noch immer in die amüsierten Augen vor mir.
»Aber er tat so viel Gutes für sein Volk«, wiegelt Herr Wenzin ab.
Postwendend hole ich Luft und setze für meine Gegenargumentation an. »Zumindest will es uns die Geschichtsschreibung weismachen, aber auch er ließ sein Volk vorsätzlich unwissend. Und zwar, damit es nicht durchschaut, was oben vor sich geht.«
»Auf der Spitze eines Baumes ist allerdings wenig Platz für die gesamte Menschheit, wie mir scheint. Wohin kommen wir, wenn jeder plötzlich nach oben drängt?«, erkundigt sich der selbstgefällige Direktor und schaut auf der Suche nach Fürsprechern fragend in jedes Gesicht.
»Dann schneiden wir für Emma kurzerhand den Baum zu einer Hecke, damit es oben genug Platz für alle gibt«, scherzt Theo und zieht damit das Gespräch wieder auf sich.
Die angespannten Gesichter der Gäste lockern sich merklich. Einige kichern über diesen flachen Witz, andere bestätigen kopfnickend oder flüstern mit ihrem Tischnachbarn über diesen pragmatischen Denkansatz.
»Womit wir wieder beim Thema Kronen wären«, stellt Askel merkwürdig schmunzelnd fest und beobachtet mich aus dem Augenwinkel.
»Zahnkronen?«, kichert Martina leise.
»Der Schnitt am Baum erfordert mehr Arbeit. Wenn aber alle anpacken, sollte es klappen«, wende ich mich vergnügt in Theos Richtung, zwinkere ihm verschwörerisch zu und ignoriere die seichten Kommentare von Askel und Martina.
»Diesen neumodischen, neodemokratischen Ansichten gewinne ich bestimmt nie etwas ab«, brummt Herr Wenzin unzufrieden und legt geräuschvoll seine Gabel ab.
»Zahnkronen finden Sie neumodisch?«, erfragt Askel überflüssigerweise, worauf Martina nun lauthals lacht.
»Nein, nicht die. Ich bezog mich auf die Äußerung von Herrn Stigner, der Baumkronen, die sich seit jeher bewährt haben, mal eben umfunktioniert«, erklärt der zunehmend gereizte Direktor. »Eine Hecke zu schneiden, statt Baumkronen wachsen zu lassen. Das entspricht definitiv nicht Mutter Natur. Überhaupt, wo kommen wir da hin? Einer muss schließlich die Zügel in der Hand halten, oder nicht?«
»Was das betrifft, beruhige ich Sie gerne, Herr Direktor«, entgegnet Askel mit seinen unbändig wirkenden Haaren, die er nicht einmal für diesen Anlass am Hinterkopf zusammenband. »Demokratie ist alles andere als eine Erfindung der Neuzeit und wird nicht ohne Grund mit den Worten ›Herrschaft des Volkes‹ übersetzt. Jedoch gab es im letzten Jahrhundert in der Anwendung der Demokratie gleich mehrere unterschiedliche Auslegungen. Wie kann sich etwas demokratisch nennen, wenn das Volk im Endeffekt in allen Entscheidungen übergangen oder mittels Medien manipuliert wird? Diese falsch interpretierte Demokratie scheiterte nicht grundlos, wie wir heute wissen.«
»Ebenso wie der Kommunismus«, murrt Theo wie beiläufig.
»Das ist leider nicht korrekt. Der Kommunismus folgt dem Sozialismus, war bislang nie mehr, als reine Theorie und oftmals von Kapitalisten zum Schimpfwort für den Sozialismus verkommen, um die eigene Macht zu erhalten und Angst zu schüren. Beständig wurden die Lehren von Karl Marx ungenau umgesetzt. Vielleicht hatte sie auch Kinderkrankheiten. Wer weiß.«
»Der Faktor Mensch«, füge ich an und ernte ein beherztes Kopfnicken.
»Weder Kapitalismus noch Sozialismus ist ein Allheilmittel, sondern etwas, was dazwischen liegt. Keine Baumspitze, keine Hecke, sondern etwas dazwischen. Ein Pendel schlägt bekanntlich von Natur aus von einer Seite zur anderen, bis es irgendwann in der Mitte zum Stillstand kommt. Physikalisch gesehen ist das exakt die Stelle, die zwischen den Dingen liegt. Zwischen beiden Extremen«, erklärt er leise und mir sein Gesicht zuwendend. »Das physikalische Phänomen kennt nahezu jeder. Trotzdem sind die Menschen beständig unfähig, es dauerhaft und ausgewogen in ihrem Leben zu integrieren. Von einer funktionierenden und stabilen Gesellschaft ganz zu schweigen.«
»In dieser Angelegenheit bin leider kein leuchtendes Beispiel. Und kein Buddhist. Letztlich fehlt mir Erfahrung und die notwendige, menschliche Reife, ein Allheilmittel zu finden.«
In diese, offen ausgesprochenen Gedanken gefangen, mustere ich Askel und denke genauestens über meine Wünsche nach. Und darüber, was sie über mich aussagen.
»So ist die Natur eines jeden, aber der Weg ist das Ziel«, höre ich ihn antworten.
»Es sei denn, ich gebe dem Pendel wieder Schwung«, unterbricht Theo lauthals meine Schlussfolgerungen.
Bedächtig wendet Askel sein Gesicht zu Theo. »Darf ich fragen, ob Sie genetisch selektiert wurden?«
»Ho, ho«, amüsiert sich Theo, »selbstverständlich kam die Genschere bei mir zum Einsatz. Zumindest, soweit es die damalige Technologie erlaubt hat. Oder leider. Je nachdem, was nach heutigem Wissensstand aus mir alles Grandioses hätte werden können.«
»Nun, in diesem Fall sprechen wir nicht über die Natur in ihrem ursprünglichen Sinne. Sie sind nicht natürlich. Sie sind buchstäblich ›getunt‹ und gewiss alles andere als optimal für den Mittelweg ausgelegt. Sie sind ein Extrem.«
Das ist ein rüpelhafter Angriff, auf den sich Theo unruhig räuspert und zum Gegenangriff übergeht. »Nicht optimal? Ich? Wovon faseln Sie? Was bitte bin ich, wenn nicht das Optimum, zu dem die Natur durch bestimmte Gene fähig ist?«, will er mit einem Anflug Hysterie in der Stimme wissen.
»Ich bitte Sie, Herr Stigner. Bis eben hielt ich Sie für überdurchschnittlich intelligent. Wählten Ihre Eltern diese Eigenschaften aus, die Ihnen heute zu Ihrem Vorteil gereichen? Sie nicken, demnach teilen wir die Ansicht, dass Extreme nie der Mittelweg sein können. Für dieses Wissen muss man nicht einmal ein Buddhist sein. Es ist logisch und folgt der Physik.«
Auf diesen versteckten Hinweis kichert Martina. Theos Gesichtsausdruck verändert sich von blass erstaunt zu erzürnt, reißt sich aber gewaltsam zusammen, um keinen Skandal zu riskieren.
»Ihrem Betragen nach, sind Sie ebenso wenig von ihren Eltern selektiert worden, wie Frau Conde. Wie unangenehm, dass die Manieren Ihres Sohnes witzig finden, Frau Freiger«, zischt Herr Wenzin, wie eine giftige Schlange. »Schade, denn er scheint ebenso sein Pulver mit einem Hang zum Sarkasmus zu vergeuden, wie Frau Conde. Typisch für Nicht-Selektierte und ein Grund mehr, zukünftig die Wissenschaft zu fördern und zu vermarkten, bis uns eines Tages hoffentlich ein derartiges Benehmen erspart bleibt. Mir leuchtet überdies nicht ein, warum ausgerechnet jemand mit einem Adelsprädikat uns heute Abend so genial puritanisch die diktatorischen Augen öffnen will. Nun, Herr von Holst? Erklären Sie es mir, sofern ich versehentlich ein Detail übersehe!«
»Mir wäre an dieser Stelle ein Themenwechsel angenehm«, werfe ich wie beiläufig ein.
»Ach nein, so plötzlich? Ist es denn nicht Ihre bevorzugte Gesprächsrichtung?«
»Genetische Selektion ist gewiss kein Allheilmittel, um gegenteilige Meinungen auszuradieren. Die Natur lebt von der Vielfalt und ja, es erweist sich als anstrengend, alle Wünsche, Träume und Bedürfnisse der Menschen unter einem Hut zu bekommen. Umso wichtiger ist die Art und Weise, wie wir unser Zusammenleben gestalten. Der Neokapitalismus ist und bleibt gestrig und wirkt nicht nachhaltig. Erst recht nicht unter dem Deckmantel einer angeblichen Demokratie.« Bei Askel von Host treten während seiner Rede deutlich die Halsschlagadern hervor.
»Sie sind möglicherweise auf Ihrem Fachgebiet untadelig, aber für meinen Geschmack einfach nur arrogant und ein stückweit naiv, was die Wissenschaft der Politik betrifft«, lautet die grimmige Antwort. Herr Wenzin spült den letzten Bissen von seinem Oktopusherz mit einem Schluck Mineralwasser nach.
»Schön, dass wir diesen Sachverhalt klären konnten. Womit verdienst du derzeit deinen Lebensunterhalt?«, schalte ich mich ein und erkundige mich mit einer raschen Kopfdrehung.
»Lebensunterhalt«, äfft Theo mich leise und mit verzogenem Mund nach. »Wer auf die teuerste Schule der Welt ging, verdient sich seinen Lebensunterhalt nicht. Er hat ihn.«
»Höre ich etwa aus deinen Worten und lese ich in deiner Mimik Missgunst, Theo?«, frage ich pfeilschnell, worauf er sich wieder seinem Teller mit dem Oktopusherz widmet.
»Ganz der Vater.«
»Mich interessiert brennend, welche großartige Entdeckung Sie für uns in petto haben, Herr von Holst«, wirft Frau Wenzin ein.
»Eine neue Ausgrabung.«
»Ich hätte Ihrem Aussehen nach alles andere, als auf einen aussterbenden Beruf getippt«, gibt sie postwendend zu denken.
»Aber eben genau damit befasse ich mich.«
»Mit dem Aussterben?«, erkundigt sich Theo spöttisch und erntet ein amüsiertes Hüsteln von Herrn Wenzin.
»Ich formuliere meine Frage anders: Wo und woran graben Sie derzeit? Ach, Theo, wären Sie bitte so freundlich, der Fairness halber ebenfalls beim Thema zu bleiben?«, erfragt die mit einem Mal resolute Frau des Direktors.
»Das ist derzeit noch streng geheim«, erklärt Askel, während Frau Wenzin weiter tadelnd Theo beäugt. »Nur so viel darf ich verraten: Es handelt sich dabei um Menschen, die einer einstigen Hochkultur angehört und in Zentralasien gelebt haben.«
»Reinste Zeitverschwendung«, murrt Herr Wenzin und gibt damit zum Besten, was derzeit viele Menschen von der Erkundung unserer Erdgeschichte halten.
Nichts.
»Wieso? Ist Ihnen das Leben Ihrer Vorfahren, die Entstehung der Menschheit oder die ehemalige Artenvielfalt auf der Erde egal?«, will Askel wissen.
»Sind doch alle tot, oder? Was sollen sie mich also großartig interessieren?«
»Alter Banause«, seufzt seine Frau und schaut zu Askel, dessen Erzählungen sie anscheinend fesseln.
»Und womit verdienst du deine Brötchen?«, fragt Askel an mich gerichtet.
Bevor ich antworten kann, weil ich meinen Bissen Spitzwegerichsalat durchkaue, entgegnet Theo: »Sie ist eine fähige Sprachwissenschaftlerin.«
In den Augen von Askel blitzt etwas auf. »Wie überaus faszinierend. Nimmst du derzeit Aufträge an, sofern diese verlockend klingen?«
»Das verhält sich ähnlich wie mit den Männern«, antworte ich, eilig den Salat auf die Gabel stechend.
»Wie verhält es sich mit den Männern?«
»Nur einer von Millionen ist faktisch verlockend, obwohl sich bei Befragungen alle dafür halten.«
Martina kichert, Theo weitet entsetzt seine Augen, und Edmund wischt sich unauffällig über seinen Schnurrbart, um das Schmunzeln auf diese Weise zu kaschieren.
Das bis eben ernsthaft dreinblickende Gesicht von Askel heitert sich schlagartig auf.
Kapitel 4
d
Askel streckt seine Hand zum Wasserglas aus und gibt den Blick auf eine Tätowierung frei. Sie ziert die Innenseite seines Handgelenks.
Tätowierungen gelten als umstritten, da sie vorwiegend Oppositionelle verwenden, die damit ihren politischen Standpunkt kundtun. Eben darum sind sie in bestimmten Gesellschaftsschichten verpönt.
Im letzten Jahrhundert markierten die Nazis auf diese Weise Häftlinge in Konzentrationslagern. Die Nummern dienten der Identifizierung und der Organisation von Massenmorden. In Auschwitz wurden Juden mit einem A und einer Zahlenfolge ›markiert‹.
Kein Jude hätte sich freiwillig eine Tätowierung stechen lassen, denn ihr Glauben schließt dies aus. Das ist der Grund, warum die Häftlingsnummern zum Synonym für die Entmenschlichung der Gefangenen wurden.
Nach diesem entsetzlichen Krieg verkam ein Tattoo eine Weile zur Selbstdarstellung. Wieder einmal schlug das Pendel von einem Extrem in das Gegenteil. Heute kämen nur wenige auf die Idee, sich freiwillig eine Tätowierung stechen zu lassen.
Die von Askel ist nicht mit schwarzer Farbe gestochen worden, sondern mit grüner und zeigt eine Triskele. Dieses keltische Symbol kennt unzählige Bedeutungen. Ihnen allen gemein ist jedoch dessen spiritueller Kern vom Weg des Lebens.
Zügig bedecken seine Finger das Handgelenk und schieben den verrutschten Ärmel höher hinauf. Doch für mich war es genug Zeit, um mir das Symbol zu betrachten, was zwei Schlüsse für mich zulässt. Entweder ist er ein polemischer Revoluzzer, wie alle, die sich zur Selbstdarstellung im letzten Jahrhundert ihre Seelenergüsse auf ihre ichbezogene Haut einritzen ließen. Oder er ist schlimmeres, was in keinem Zeitalter ein ungefährliches Unterfangen war. Gegen den Strom zu schwimmen, kommt nur wenigen Köpfen in den Sinn.
Mit diesen diversen Überlegungen sehe ich forschend in das ovale Gesicht, als könnte ich darin eine Antwort finden. Und ich finde sie.
Zeitgleich überkommt mich das Bild von den Füßen, die ausgelassen tanzen, was mich angestrengt um meine Fassung ringen lässt. Räuspernd rutsche ich unruhig auf meinem Stuhl herum und fände es an dieser Stelle äußerst begrüßenswert, wenn der streitbare Direktor eine uncharmante Bemerkung zu meiner Person fallen ließe.
Tut er aber nicht, daher schaue ich mich Hilfe suchend um.
»Heute habe ich dir etwas viel Besseres als läppische Schnipsel von Spielkarten anzubieten«, raunt Askel an mich gewandt.
Weil sich die Gäste am Tisch einem anderen Gesprächsthema zuwenden, erhält er meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Die äußert sich in verständnislos zusammengezogenen Augenbrauen, während meine Synapsen auf Hochtouren arbeiten. Zu genau weiß ich, sämtliche seiner Ausgrabungen fördern spektakuläre und richtungsweisende Funde zutage. Und er bietet mir ernsthaft eine Zusammenarbeit an?
Warum?
»Grundgütiger, als ob deine Schnipsel sie interessieren«, kichert Martina, die anscheinend über ein ausgezeichnetes Gehör verfügt.
»Was ist das?«, frage ich überflüssigerweise, nehme jedoch den kleinen Umschlag entgegen, den er aus seinem modischen Jackett zieht und mir reicht.
»Ein Liebesbrief?«, erkundigt sich Theo nun neugierig und streckt seinen Kopf, um einen Blick auf den Absender zu erhaschen.
Den Umschlag ziert die gleiche Triskele, die Askel sich tätowieren ließ und für mich die immer wiederkehrende Unendlichkeit symbolisiert.
Der ewige Kreislauf des Lebens.
»Womöglich von einer Geheimorganisation?«, mutmaßt Martina kühn und reckt ebenfalls wissbegierig ihren Hals.
Die anderen Gäste richten ihre Aufmerksamkeit wieder auf mich, genauer gesagt auf den Umschlag, der in meiner Hand ruht und aus handgeschöpftem Papier besteht. Das bedeutet, jemand gab sich sehr viel Mühe, denn diese Art Papier wird nicht mehr hergestellt und nur noch wenige Menschen beherrschen die Kunst des Papierschöpfens.
»So ist es, aber ich hoffe, es bleibt ein Geheimnis zwischen uns«, schmunzelt Askel honigsüß und zwinkert Martina verstohlen zu. »Wie wäre es mit: Die Erretter der Altertumskunde?«
»Du nimmst mich auf den Arm?«
»Nicht im Entferntesten, liebe Emma«, beschwört er verzückt dreinblickend und blendet Theo gekonnt aus.
Der rutscht nervös auf seinen Stuhl herum und streckt seinen Hals immer weiter, um einen kurzen Blick auf den Umschlag zu erhaschen. »Willst du ihn nicht öffnen?«
»Nicht, sofern es sich um ein Beitrittsformular für diese obskure Geheimorganisation von Herrn Holst handelt.«
Wieder lacht Askel belustigt auf und entblößt seine Zähne, die durch den gepflegten Vollbart ungenügend zur Geltung kommen. Von derart viel Erheiterung angesteckt, stimme ich ein und lege meine Serviette ab. Ohne viel Aufhebens zu veranstalten, öffne ich den Umschlag und ziehe ein kleines Pergamentpapier heraus.
Auf dem durchschimmernden und selten gewordenen Papier wurden drei Schriftzeichen abgepaust, die mir nicht vertraut vorkommen, obwohl sie mich an etwas Bekanntem erinnern.
Runen.
Selbstzufrieden schmunzelnd trinkt er einen Schluck Mineralwasser. »Du bekommst riesengroße Augen, darum gehe ich davon aus, diese Schriftzeichen sind interessant genug, um in meinem Team mitzuarbeiten. Wie beruhigend.«
»Was ist das?«, erkundigen sich Theo und Frau Wenzin beinahe zeitgleich.
»Etwas sehr Außergewöhnliches«, murmele ich in Gedanken vertieft, die sich überschlagen, blitzschnell mehrere Eindrücke gleichzeitig einsortieren und dennoch keine Worte für diese eigenartigen Schriftzeichen finden. »Wo hast du das her?«
»Ich buddele derzeit daran herum«, entgegnet er leichthin, als sei etwas dermaßen Ungewöhnliches bei ihm an der Tagesordnung.
Bei dem Anblick der unbekannten Schriftzeichen verdoppelt sich mein Puls. Er erwähnt den Fund in etwa so beiläufig, als seien sie belanglose Fragmente aus dem Restmüll. Ist er überheblich oder nur erfolgsverwöhnt?
Zumindest scheint der Umgang mit einzigartigen Funden bei ihm offenbar an der Tagesordnung zu sein, denn es entlockt ihm keine Jubelschreie mehr. Ich vermute: Er ist eindeutig erfolgsverwöhnt.
»Rede schon! Was ist das?«, flüstert Martina mir zu, die auf das seltene Material aus Papier blickt.
»Wo genau gräbst du?«, erkundige ich mich erneut und ernte abermals einen vielsagenden Blick, der mir zu verstehen gibt, ich soll es selbst beantworten. Zumal ich anscheinend den Eindruck erwecke, die Antwort bereits zu kennen.
»Wie ich sagte: Derzeit ist es noch geheim«, lautet die in meinen Augen viel zu nüchterne Antwort.
»Das gibt es doch nicht«, murmele ich fassungslos und versuche krampfhaft, mir einen logisch klingenden Reim auf die unbekannten Runenzeichen zu machen. Und auf seinen unbeholfenen Versuch, mich in die Irre zu führen.
»Die legendenumwoben und kontroversen Forschungsergebnisse deines Vaters dürfte es ebenso wenig geben. Aber es gibt sie.«
»Es gab sie«, unterbricht Theo angesäuert, während uns der Nachtisch serviert wird. Jeder am Tisch sieht für eine Weile zu ihm, bis er selbst bemerkt, wie beunruhigend der Tonfall auf alle wirkt. »Tatsächlich, es gab sie. Ich sah die Akte einst auf seinem Schreibtisch liegen und kann es gerne jedem unter Strafe versichern, der etwas Gegenteiliges behauptet.«
»Ich glaube Ihnen«, versichert Askel und erntet einen langen Blick.
»Schön, wenigstens ein Mensch auf der Welt sieht es genauso und sagt, ich bilde mir das nicht nur ein. Nun gut. Allerdings möchte ich erwähnen, es entspricht nicht meinem Charakter, ebenso fahrlässig wie Constantin zu handeln«, entgegnet er und schaut bedeutungsvoll zu Herrn Wenzin. Der nimmt diese unterschwellige Botschaft wohlwollend auf.
Es ist für niemand am Tisch ein Geheimnis, auf was genau Theo anspielt. Er ließ sich einen Mikrochip in seinen Unterschenkel implantieren. Auf dem aktualisiert er täglich sämtliche Forschungsergebnisse. Zu oft reißt er in meiner Gesellschaft Witze darüber, dass sie nur über seine Leiche gestohlen werden können und sich Vaters fataler Fehler auf keinen Fall wiederholt.
Auf diese Anspielung muss ich jedes Mal müde lächeln. Heute steht mir selbst danach nicht einmal annähernd der Sinn. Noch immer starre ich ungläubig auf ein faszinierendes Schriftzeichen und übergehe Theos befremdliche Art, die Daten seiner Forschung zu sichern.
Fieberhaft überlege ich, warum Askel mir den Briefumschlag gab. Klar, er wirbt mich an. Zuvor jedoch muss ich eine Art Einstellungstest absolvieren. Dabei legte er die Latte hoch. Nach meinem Geschmack jedoch nicht hoch genug.
Versonnen fahre ich über die in Bleistift gezeichneten Linien und frage mich, warum er ausgerechnet mich in seinem Team holt. Als Sprachwissenschaftlerin habe ich die Welt bislang nicht einer sensationellen Entdeckung erschüttert. Mein Name geistert nicht wie ein unerreichbarer Schatten durch die Flure der Universitäten, als wäre ich eine Heilige, eine Heldin oder was auch immer.
Verändert habe ich die Welt, ja. Allerdings in Maßen, gut dosiert und eher zurückhaltend präsentiert, nicht in jeder Talkshow oder auf Müslipackungen.
»Und Sie sind heute auf diese Preisverleihung gekommen, um für Ihr neuestes Projekt nach Geldgebern zu suchen?«, fragt der Direktor, der sich über das servierte Dessert hermacht.
»Mitnichten. Was die Finanzierung der Ausgrabung betrifft, sehe ich mich derzeit frei von Sorgen. Ich kann nicht ohne stolzen Unterton behaupten, dass dieses Projekt keines der üblichen Kategorien angehört.«
»Ja, aber was genau ist denn nun so überwältigend daran?«, unterbricht die neugierig dreinblickende Frau Wenzin, die förmlich an den Lippen von Askel klebt.
»Selbstverständlich die ersten Funde, Frau Wenzin«, erklärt er und deutet auf das Pergamentpapier, welches ich nun zur Ansicht auf den Tisch lege.
Martina nimmt es auf, besieht es sich andächtig und reicht es vorsichtig an ihren Tischnachbarn weiter. Jeder möchte einen Blick auf die interessanten Details der neuen Ausgrabung erhaschen, so winzig sie auch erscheinen.
»Verstehe, demnach stammt es von den gefundenen Artefakten?«, erkundigt sie sich und deutet zu dem Pergamentpapier, das Edmund nun eingehend studiert.
»Genauer gesagt wurde es abgepaust«, antworte ich, ohne abzuwarten, ob Askel es erklärt.
»Aha, gewissermaßen abgemalt«, höhnt Theo, dem die Vorgehensweise fragwürdig erscheint. »Über die Maße aufregend und vor allem bei Vorschulkindern derzeit sehr beliebt. Und was genau malen Sie da so schön ab? Kinderzeichnungen aus der Steinzeit?«
Über diesen unverhohlenen Spott kichert der Direktor vergnügt, während ich Theo strafend anschaue. Er weiß haargenau, wie gewaltig mich sein Spott kränkt, wenn er meine Arbeit kleinredet und mit törichten Kinderallüren vergleicht.
Menschen, die in der Erde nach Altertümern graben hält er für Fantasten. Es bleibt mir ein Rätsel, warum er mich bittet, seine Frau zu werden, obwohl ich eben jenes In-der-Erde-Graben aufregend finde und mich am liebsten nächtelang mit der Entschlüsselung von Schriftzeichen beschäftige.
»Es gibt viele Legenden um allerlei mächtige Kulturen. Welche sind Ihnen auf Anhieb bekannt?«, fragt Askel, statt auf die bissige Aussage einzugehen.
»Constantin Conde sprach oft über das Volk der Davatuja«, antwortet Frau Wenzin auf der Stelle.
»Nie gehört«, murmelt der Direktor mit vollem Mund, während ein flüchtiges Funkeln in den Augen von Askel aufleuchtet. Vermutlich war es aber auch nur eines der unzähligen Scheinwerfer, die an der Decke des üppig dekorierten Saales angebracht wurden.
»Doch, doch. Mein Vater erzählte mir als Kind ebenfalls von den Davatuja. Er erklärte mir, sie lebten in der Mitte der Welt, völlig im Einklang mit sich, der Natur und Mutter Erde.« Bei meinen Worten versinke ich in dem bizarren Funkeln, was in den Augen von Askel aufleuchtet.
»In der Mitte der Welt? Wo ist das?«, will Frau Wenzin wissen und reißt mich ungebeten aus der faszinierenden Augenfarbe, die keine ist.
»Dort, wo Anarchie herrscht«, gebe ich bissig zurück, ohne meinen Blick abzuwenden.
Askel kichert über meinen geschickten Konter, der die wahre Antwort findig verheimlicht. Die Mitte der Welt klang in meinen Ohren schon immer fantasievoll, geheimnisvoll und lässt mehrere Interpretationen zu.
»Wo wäre das für Sie, Frau Wenzin?«, schaltet sich Martina ein.
»Afrika?«
»In Afrika herrscht Anarchie?«, erkundigt sich Herr Wenzin und rollt genervt mit seinen Augen.
»Wo die Mitte der Welt ist, kann nur jeder für sich herausfinden«, erklärt Askel.
Das ist in etwa die gleiche Antwort, die Vater mir immer gab, nachdem ich alles über dieses sagenumwobene Volk erfahren wollte. Er gab mir mit einem Lächeln einen Kuss auf die Stirn, bedeckte mich mit meiner Zudecke und versicherte mir, dass ich es eines schönen Tages herausfinde, nun aber brav schlafen sollte.
Ich lege das Papier mit den fremdartig anmutenden Schriftzeichen neben meinen Teller, weil inzwischen jeder am Tisch die Möglichkeit hatte, es sich genauestens zu betrachten. Wie Vater immer bei seinen Erzählungen lächelte …
»Aha, daher weht der Wind«, wiegelt Theo ab und widmet sich dem Gemüse. »Durchweg alles realitätsferne Fantasiegebilde von besessenen Archäologen, die einen in das langweilige Naturkundemuseum locken wollen. Was Marketing betrifft, wirken Sie unglaublich gewieft, doch leider falle ich nicht auf Ihre plumpe Masche herein.«
Mir scheint, als mischen sich unsere Fachrichtungen wie Wasser und Öl. Kaum möglich und irgendwie auch miteinander verfeindet. Der eine möchte die Artenvielfalt und natürliche Selektion bewahren, während der andere selbst selektieren will und nichts Verwerfliches daran findet.
»Zieh mein Arbeitsgebiet bitte nicht ins Lächerliche, auch wenn es dir fremd erscheint«, bitte ich knapp und betrachte das kostbare Papier neben meinen Teller. »Wurde das genaue Alter der Schriftzeichen bereits analysiert?«
»Leuchtet da etwa etwas in deinen Forscheraugen auf? Mein Team erwartet deine Analyse und vergleicht sie anschließend mit dem Ergebnis der Radiocarbon-Analyse von den anderen gefundenen Artefakten ab. Deckt sich das Alter … zumindest ungefähr, haben wir einen Match.«
»Es erinnert stark an das erste Futhark, aber etwas ist atypisch. Das Zeichen hier sticht besonders ins Auge.«
Das älteste Alphabet der Germanen fasziniert noch heute. Sie dienen neben Buchstaben, als Zahlen oder magische Zeichen. Jeder von uns hat das Bild einer einäugigen, faltigen Frau mit Zahnstummeln vor Augen, die Steine mit Runen im Schein des Feuers wirft und den Willen der Götter übermittelt. Aber Runen sind weit mehr als magisch.
Sie sind wahrhaftig.
Nach meiner ersten, vagen Einschätzung wende ich mich wieder an Askel und tippe auf ein Schriftzeichen, welches aus der Reihe tanzt. Dieses Schriftzeichen ist runder, wirkt geschmeidiger und weniger abgehakt. Schwer vorstellbar, dass unsere Vorfahren sie problemlos in Steine geritzt haben sollen.
»Aha, warum sticht es besonders ins Auge?«
»Ich hoffte, die Antwort von dir zu erfahren.«
»Von mir? Sorry, aber ich bin kein Sprachgelehrter.«
»Dann hat dich einer deiner Mitarbeiter an der Nase herumgeführt.«
»Deine Prognose klingt ausgesprochen kühn«, murmelt er und sieht mich eigentümlich eindringlich an.
»Wolltest du denn keine Expertise von mir einholen? Wenn wir gemeinsam Schnipsel zusammengesetzt haben, dürfte dir sehr wohl bekannt sein, dass ich altgermanisch mit der Muttermilch eingesogen habe. Kühn wäre daher das falsche Wort. Setze Gewissheit an diese Stelle, denn dieses Schriftzeichen stammt garantiert von einem ungeübten Fälscher.«
»Ungeübten Fälscher? «
»Absolut schlampige Arbeit.«
Seinen Mund zu einem Lächeln verziehend ahne ich, auch dieses Mal vollkommen richtig zu liegen. Über meine hellseherischen Fähigkeiten zufrieden, lächele ich ihn strahlend an. Es bedarf keinerlei Bestätigung seinerseits und ich ahne, wie spektakulär der neue Fund wieder einmal wird. Zumindest würde es diese alberne Täuschung rechtfertigen.
»Dir wird mit deinem neuen Fund gewiss viel Aufmerksamkeit zuteil, aber darüber warst du sicher bereits im Bilde, was ich an deiner Nasenspitze ablese.«
»Wenn du das so sagst. Was errätst du noch?«
»Einen plumpen, verkappten Test, der auf das offizielle Angebot neugierig machen soll.«
Vielsagend schmunzele ich, bevor ich den Blick zu Theo wende. Während ich meine kleine Handtasche öffne, um das Papier darin verschwinden zu lassen, zwinkere ich mit einem Augenlid. »Danke für den netten Versuch, Askel.«
»Netter Versuch?«, wiederholt er meine Worte und reißt erstaunt seine Augen auf.
Beruhigt über diese Abfuhr wackelt Theo mit seinem Kopf und sieht den, in seinen Augen, Störenfried mürrisch an. Er wirkt unbeschreiblich angespannt und reagiert gereizt, weil derzeit jemand anderer als er im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht.
Ich werde ihm heute Abend nicht die Show stehlen, auch wenn ich jetzt vor Freude über dieses unglaubliche Angebot am liebsten ungeniert Freudensprünge machen könnte. Ein vergleichbares Geschenk kommt, wenn überhaupt, nur einmal in einem Forscherleben vor.
Die Legende der Davatuja war für mich schon immer über alle Maßen faszinierend und faktisch ebenso beflügelnd, wie das sagenumwobene und versunkene Atlantis, welches Platon einst beschrieb.
Nach dem Diner eröffnet eine bekannte Fernsehmoderatorin die festliche Überreichung der Preise, die mit einem kleinen Rahmenprogramm einhergeht. Im Saal wurden etliche Fernsehkameras positioniert, die per Liveübertragung die Preisverleihung aufzeichnen. Unentwegt schluckt Theo etwas seinen Hals hinab und lockert alle paar Sekunden die Krawatte, obwohl sie schon leger um seinen Hals baumelt.
Pausenlos schweift der unruhige Blick im Saal umher. Mir kommt es so vor, als schaut er nach meinen Worten entspannter zur Bühne, auf der Johann soeben seine Laudatio hält und sich an das Rednerpult klammert.
»Du siehst blendend aus«, versichere ich ihm, da ich für den offiziellen Teil wieder neben ihm sitze, »aber ich werde im Anschluss mehr als nur ein Hühnchen mit dir rupfen. Von wegen verlobt.«
»Alle Kameras werden auf mich gerichtet sein«, murmelt er und schenkt meiner Drohung keinerlei Beachtung.
Unmerklich ziehen sich seine Mundwinkel in die Höhe, was das Signal an mich ist, dass er meine Andeutung mit dem Hühnchen rupfen sehr wohl versteht. Lange mustere ich das Profil, bis ein schwarz gekleideter Kellner uns auf einem Tablett Wasser nachschenkt.
»Bitte bringen Sie uns den feinsten Champagner, den Sie auftreiben können«, flüstert Theo ihm zu und steckt dem Mann unauffällig einen Geldschein in die Hosentasche.
Nur Minuten vergehen, bis die Servicekraft wieder bei uns steht und uns zwei langstielige Gläser reicht, deren Inhalt verführerisch am Glasrand prickelt. Theo reicht mir ein Glas, lässt seins dagegen klirren und setzt zum Trinken an.
»Die Lobredner schwatzen immer so ermüdendes Zeug und ich hoffe, meine blamiert meine Arbeit und mich nicht«, flüstert er, bevor er zum Trinken ansetzt.
Ich genieße die prickelnde Flüssigkeit in einem Zug. Anschließend stelle das geleerte Glas auf den Tisch und sehe zu Theo. »Diese Reden kenne ich von Vaters Preisverleihungen zur Genüge. Am Ende wird alles gut. Du hast deine Dankesrede doch hoffentlich geprobt?«
Vor den Kopf gestoßen, gleitet sein Blick an mir hinab. Vergleiche mit meinem Vater, setzen ihm nach all den Ehrungen, Lobpreisungen und positiven Beurteilung noch immer zu.
In dem Gesicht vor mir erkenne ich, dass er derartige Vergleiche am wenigsten von mir hören will. Er arbeitet ehrgeizig daran, Vaters Forschungen zu übertrumpfen und eines Tages seinen Namen in den Geschichtsbüchern zu lesen.
»Das ganze Drumherum-Gerede langweilt mich gleichermaßen, wie den Frauen deiner Berufskollegen«, murmele ich leise zur Erklärung und schiele zu den Frauen am Nachbartisch.
Dort sitzen mehrere Ehefrauen, die ich von den langweiligen Weihnachtsempfängen kenne. Müde und zerschlagen blicken sie drein, weil sie jahrelang im Schatten ihrer erfolgreichen Männer stehen und ihre eigenen Karrieren aufgaben, um entsprechend dem typischen Rollenbild die Kinder zu erziehen. Ein derartiges Leben im Windschatten eines Ehemannes kam mir nie in den Sinn.
»Nimmst du das Angebot an?«, fragt Theo im Flüsterton. »Das von dem Waldschrat.«
»Was, wenn ich es aufregend finde?«
»Theodor Stigner«, höre ich und sehe erschrocken auf.
Sein Blick ruht noch auf mir, nachdem sich mehrere Fernsehkameras nähern, weil sie nach Anweisung der Regie seinen Gesichtsausdruck bei der Verkündung seines Namens einfangen wollen. Applaus ertönt und ich betrachte Theo, der abwesend zu sein scheint.
»Herr Stigner, kommen Sie zu mir auf die Bühne!«
»Papierschnipsel zusammensetzen und dümmliche Bildchen abpausen wäre tatsächlich das Idealbild für deine Zukunft? Du findest das Angebot also interessant, ja? Vergeudest du absichtlich dein Potenzial an so einen Typen oder wie darf ich dein dummes Gerede verstehen?«, erkundigt er sich, obwohl alle am Tisch seine Worte hören. »Das wäre glattweg lächerlich, Emma.«
»Herr Stigner, plaudern Sie lieber mit mir als mit ihrer hübschen Verlobten«, säuselt die Moderatorin lieblich und einladend.
Ich wende mein Gesicht zur Bühne, auf der die elegant gekleidete Moderatorin steht und in sämtliche Kameras lächelt. Na wunderbar, jetzt posaunt sie die falschen Gerüchte auch noch in die weite Welt hinaus.
»Du bist so was von einem Kopf kürzer«, presse ich verärgert zwischen meinen Zähnen hervor, lächele aber zuckersüß, weil sämtliche Kameras in diesem Saal auf uns gerichtet sind.
Er überhört es geflissentlich. Der tosende Applaus überlagert jedes weitere Wort. Ich lasse meine Augen zu der Frau Mitte fünfzig schweifen, die in das Mikrofon am Rednerpult schrie, um endlich seine Aufmerksamkeit zu erhaschen.
Schwerfällig erhebt sich Theo, während der tosende Applaus durch den Saal fegt. Er erhält stehende Ovationen. Mehrere Hände legen sich gratulierend auf seinen Rücken, während er im Scheinwerferlicht zur Bühne schreitet.
Tatsächlich bekommt er den heiß begehrten Preis für das Forschungsergebnis des Jahrzehnts und die für sein Lebenswerk, sieht allerdings alles andere als glücklich aus. Ohne meine Rüge zu beachten, schüttelt er schmunzelnd Hände, die ihm die umstehenden Gäste reichen und langatmig beglückwünschen.
Auf der Bühne angekommen, schäkert er schlagfertig mit der Moderatorin, sieht geblendet in die Scheinwerfer und hält seine tagelang einstudierte Dankesrede. Ich lasse meine Hände sinken, sehe mich hilflos um und fühle mich hundeelend. Am liebsten würde ich mich irgendwo verkriechen, denn jetzt glauben nicht nur die Anwesenden am Tisch, dass wir verlobt sind.
Verdammt, ich muss mir etwas einfallen lassen, um aus dieser Nummer herauszukommen. Scheidung schon vor der Eheschließung? Schwerfällig erhebe ich mich von meinem Stuhl und applaudiere mittelmäßig begeistert.
Askel, der sich neben mich stellt, berührt mich am Arm und schüttelt mir die Hand. »Gratuliere«, murmelt er und lässt zugleich mehrere Rückschlüsse öffnen, wozu genau er mich beglückwünscht.
Kapitel 5
d
Ausgelassen tanzend bewege ich mich zu den Klängen des Liedes. In einem separaten Saal wurde eigens für die ausschweifend feiernde Oberklasse eine Disco eingerichtet. Zwar ist es nur ein langer Flur, aber das scheint den Feiernden einerlei zu sein.
Die Abgeschiedenheit kommt ihnen gelegen, weil sie hier unbeobachtet der vielen Kameras unauffällig Betäubungsmittel konsumieren können. Die machen Dampf, heizen die hormongeschwängerte Luft ein und lassen für kurze Zeit vergessen, in welch einer wahnwitzigen Welt wir leben.
Die Lichtreflexionen der Musikanlage zucken rhythmisch. Sie versetzen mich auch ohne das berauschende Teufelszeug in einen Zustand der Schwebe, dem ich mich nach dem steifen Protokoll der Feierstunde allzu gern hingebe. Ich tanze meinen aufgestauten Frust über die angebliche Verlobung heraus und bewege mich auf jede erdenkliche Art, zu der mein junger Körper fähig ist.
Seit der Name von Theo aufgerufen wurde, er den Preis für sein Lebenswerk entgegengenommen hat und jede Menge Hände schüttelt, geht er mir aus dem Weg. Mich beschleicht der Gedanke, er will auf diese Weise alle im Glauben lassen, dass wir hätten uns tatsächlich heimlich verlobt.
Jener Reporter, der Theo in meinem Elternhaus aufgespürt hat, belegt diese Neuigkeit mit dem ›Beweisfoto‹. Ich sah es mir an. Auf dem Foto ist zu sehen, wie Theo mich umarmt. An sich scheint es eine harmlose Geste zu sein, jedoch ist auf seinem linken Ringfinger deutlich ein Ring zu erkennen, der unsere Verlobung ›beweist‹. Der Reporter vor dem Haus, der Ring an seinem Finger und die Tatsache, dass er nicht dementiert, stattdessen freudestrahlend dreinschaut wirken befremdlich auf mich.
Er wird die Disco meiden, wie der Teufel das Weihwasser. Garantiert werde ich heute Abend nichts unternehmen, was auf ein trautes und verlobtes Paar schließen lässt. Keine Ahnung wer von uns kindischer reagiert, aber ich kam kurzerhand her, gebe meinen Emotionen auf der Tanzfläche Raum und bewege mich ungezwungen wie damals als Kind.
Zu jener Zeit durchstreifte ich am Nachmittag den am Haus angrenzenden Wald. Gut, er war kein Wald im klassischen Sinn. Eher das magere, vertrocknete Überbleibsel jener grünen Periode.
Ich baute mit Erde an dem kleinen Bachlauf einen Stausee und kletterte auf die höchsten Baumstummel. Dort oben sitzend schrie ich aus voller Kehle, wenn mir danach war und lachte anschließend ebenso dröhnend, bis der Hals schmerzte.
Am Abend fiel ich müde, aber unendlich glücklich, ins Bett. Mutter oder Vater bedeckten mich mit der Zudecke, lasen mir eine spannende Abenteuergeschichte vor und schenkten mir anschließend einen liebevollen Gute-Nacht-Kuss auf die Schläfe. Damals war ich das zufriedenste Kind auf der Welt, fühlte mich geborgen und unendlich geliebt. Auch ohne genetische Selektion.
Oder genau deswegen?
Mein Vater forschte für sein Leben gern und setzte etwas in Gang, wovon er hin und wieder behauptete, es sei die Büchse der Pandora. Meine Mutter knurrte nach seinen nachdenklichen Aussagen immer harsch, er habe zu viel von dem schweren Wein getrunken und würde sentimental daherreden.
Sein Kopf wackelte dann immer heftig. Ein überaus grüblerischer Blick ruhte auf mir. »Meine kleine Emma wird die Welt aus den Angeln heben, richtig?«
Sobald ich eifrig bejahte, ohne zu wissen, wie ich das schaffen könnte, schien seine Welt kurzzeitig wieder in Ordnung. Er lächelte selig. Ich fiel ihm glücklich um den Hals und versicherte, ich würde alles dafür tun. Freilich wusste ich damals nicht, was dazu gehört, die Welt aus den Angeln zu heben, hätte aber in diesen Momenten all seinen Worten beigepflichtet.
Leider weiß ich es heute ebenso wenig. Heute Abend schwebe ich frustriert über die Tanzfläche und bilde mir ein, ich wäre dazu in der Lage.
Obwohl die Forscher vorerst behutsam Schritt in der Selektion umsetzen, weil der nächste Schritt in der breiten Masse bei der Bevölkerung noch keine Akzeptanz findet, treibt es seltsame Blüten. Bei dem ersten selektierten Baby, welches Ende des letzten Jahrtausends in China entstand, fegte ein empörter Aufschrei der Fachleute durch die Welt.
Er verpuffte jedoch rasch in der Luft. Während die Reporter über die neueste Naturkatastrophe berichteten, wurde hinter den Kulissen an noch haarsträubenderen Gentechniken geforscht. Diese regelmäßige Vorgehensweise scheint die Weltbevölkerung weder zu verunsichern noch zu beunruhigen.
Bis heute.
Die Musik dröhnt in meinen Ohren und arbeitet sich pulsierend wie mein Blut durch die Venen, bis ich in jeder meiner Körperzelle vibriere. Ich fühle mich für kleinen Moment frei, überlasse mich dem Leben und tanze zur Musik, als könnte ich mich problemlos über alle gesellschaftlichen Zwänge hinwegsetzen.
Mit mir bewegen sich etliche Gäste auf der Tanzfläche, die alle der Wille nach einer kleinen Atempause hertreibt oder die unzähligen Fernsehkameras im großen Saal. So manch eine Berühmtheit gibt sich hier, wonach ihr ist. Sich frei und unbezwingbar im Geist zu fühlen.
Tanzschritt für Tanzschritt überlagert die Musik ein immer lauter werdender Takt, den ich von meiner Vision der nackt tanzenden Füße kenne. Mich übermütig und manisch zu diesem Takt bewegend, halte ich aus heiterem Himmel in meiner Tanzbewegung inne.
Mich beschleicht das eigenwillige Gefühl, beobachtet zu werden.
Mich im Kreis drehend schaue ich mich um. Vor der Tanzfläche erstreckt sich die Bar, an der viele Gäste sitzen, alkoholische Getränke konsumieren und sich angeregt miteinander unterhalten. Nur ein Mann in dieser Reihe sitzt verkehrt herum, unterhält sich nicht, trinkt nicht und führt auch keine Gespräche.
Mit versteinerter Miene schaut er in meine Richtung.
Es ist der jüngste Professor aller Zeiten. Jener, der mit seiner ungewöhnlichen, zur Mode konträren Frisur, unmöglich macht, ihn in ein bekanntes Schema zu sortieren. Obendrein ist er mit einem mystischen Tattoo versehen, trägt einem untypischen Vollbart und schaut mich aus durchdringenden Augen an, die in der Lage sind, mich glattweg an die Wand zu drücken und mich dort in die Höhe zu heben.
Genau in dem Moment, in dem ich auf ihn zugehen und dem ungewöhnlichen Mann all die Fragen stellen möchte, die mir durch den Kopf gehen, gleiten seine grauen Augen an einen Punkt hinter mir. Sie bleiben dort haften, was mich unschlüssig überlegen lässt, ob er am Ende gar nicht mich beobachtet.
Auf der Stelle wirbele ich herum. Ich möchte nachsehen, wer von den Tanzenden sein Interesse weckt.
Am anderen Ende der Tanzfläche huscht ein Schatten in die Sicherheit des Menschengedrängels und verschwindet hinter den tanzenden Leibern. Die Umrisse nur noch erahnend, erscheinen die Umrisse eher wie ein Geist, der sich seltsamerweise in Rauch auflöst.
Verwirrt schaue ich mich im Saal um. Außer verzückten Gesichtern ernenne ich keinerlei Regung. Niemand der Anwesenden scheint über diesen nebulösen Schatten beunruhigt. Außer mir und Askel von Holst scheint keiner etwas von dem seltsamen Dunst wahrzunehmen.
Ratlos dreinblickend wende ich mich zur Bar, doch auch Askel sitzt nun nicht mehr auf dem Platz. Andererseits verrät mir das halb gefüllte Whiskyglas, dass ich nicht den Verstand verliere, daher nähere ich mich argwöhnisch umsehend.
Je näher ich an den Tresen trete, desto bestürzter weite ich meine Augen. Auf der glatt polierten Oberfläche, die aus schwarzem Granit besteht, erkenne ich ein Runenzeichen. Es
Inguz.
Es ist eines der vierundzwanzig Runenzeichen aus dem älteren Futhark. Genauer gesagt die zweiundzwanzigste Rune.
Ein leicht gedrehtes Quadrat erinnert an eine ausgewogenere Variante des bekannten Karos. Als Symbol steht es für das innere Feuer, welches, einmal entfacht, schwerlich zu löschen geht. Jeder kennt das Gefühl, wenn er für etwas für ihn Wichtiges brennt und eine unbändige Leidenschaft entwickelt.
Dieses Gefühl symbolisiert Inguz.
Als Sinnbild steht es für einen Schmetterling, der aus einem Kokon schlüpft. Es geht um seine Transformation, den Neuanfang und dem konsequenten Verfolgen der eigenen Intuition.
Mit dieser Nachricht steht fest: Askel will mich unter allen Umständen in sein Forschungsteam locken.
Mit einer Handbewegung verwische ich die Rune, während Martina in meinem Blickfeld auftaucht. Sie scheint jemanden zu suchen, denn sie reckt deutlich ihren Kopf über die Tanzenden hinweg.
Nachdem sie mich entdeckt, erstarrt sie. Erst, als ich mich auf sie zubewege, kommt Leben in den agilen Frauenkörper. Sie schreitet mir jedoch nicht entgegen, sondern entschwindet durch die Menschenmenge aus meinem Blickfeld.
»Martina«, rufe ich, übertöne die dröhnende Musik jedoch nicht. »Martina warte!«
Der davonlaufenden Frau folgend gelange ich immer weiter in den hinteren Teil des Flures, der an dieser Stelle aus futuristisch designten Elementen und Lichtern besteht. Ich entferne mich immer weiter von den fröhlich tanzenden Menschen, sehe mich aber mehrmals um.
Das Licht der Deckenbeleuchtung beleuchtet dürftig den Teil des Flures. Gerade so, als wolle mit dem schwachen Licht verhindert werden, dass sich ungebetene Gäste hierher verirren.
Nur noch wenige Sessel stehen in einzelnen Gruppen zusammen. Eine Handvoll Gäste sitzen an diesem abseits gelegenen Ort und schwatzt ungestört miteinander.
Ich folge dem im Fußboden eingebetteten Lichtstreifen und den rosa designten Wandpaneelen, deren glatte Oberfläche mein Ebenbild widerspiegelt. Kurz darauf folgen einige Türen, die eigens für diese Veranstaltung zu Séparées umfunktioniert wurden.
In diesen abgetrennten Räumen feiern hochrangige Gäste im privaten Rahmen. Hinter einigen ertönt lautes Gelächter, hinter anderen ist es mäuschenstill.
Ich husche an den geschlossenen Türen vorbei und erreiche schließlich die Damentoiletten, die wie gewöhnlich überfüllt sind. Die Frauen, die sich hier treffen, wollen plaudern oder schminken sich ihre Münder knallrot, um aufzufallen.
Unterdessen verschwindet Martina hinter einer unscheinbaren Tür inmitten der Designerverkleidung, die ich um ein Haar übersehen hätte. Was zum Henker macht sie hier?
»Martina?«, rufe ich verhalten, nachdem ich die angelehnte Tür öffne.
Vor mir liegt ein stockfinsterer Gang. Den Blick hineinzuwerfen, fühlt sich unheimlich an, zumal ich sie nirgendwo entdecke.
Warum reagiert sie nicht auf mein Zurufen und wohin zur Hölle führt dieser rabenschwarze Gang? Mit einem unguten Gefühl in der Magengegend schlüpfe ich ebenfalls durch den schmalen Türspalt in die Dunkelheit.
Ich warte eine Weile, bis sich mein Augenlicht an die Schwärze gewöhnt. Leider erkenne ich rein gar nichts, denn um mich herum herrscht pechschwarze Leere. Auf leisen Sohlen, mit ausgestreckten Armen taste ich mich vorsichtig einige Schritte hinein und rufe Martina erneut.
Von irgendwo am Ende des Ganges nähern sich hektische Stimmen und Schritte. Lichtkegel von Taschenlampen durchzucken unregelmäßig die Finsternis und ich erwäge, den Personen etwas zu rufen.
Eine kühle Hand legt sich auf meinen Mund. Angestrengt versuche ich, mich verzweifelt gegen diesen unverschämten Übergriff zu wehren. Zwecklos. Mit meinen Armen um mich schlagend, wehre ich nach Leibeskräften gegen den Angreifer, werde jedoch mühelos und unerbittlich in eine dunkle Nische gezerrt.
»Still, Emma! Wenn dir dein helles Köpfchen auf den Schultern lieb ist, sei so lange still, bis sie an uns vorbeigegangen sind!«
Askel von Holst.
Er bedeckt meinen Mund mit seiner flachen Hand. Sein Gesicht wird gelegentlich von den unruhig geführten Lichtern der Taschenlampen erhellt. Besorgt schweifen seine Augen zu den Heraneilenden. Gleichzeitig drückt er mich energisch in die Nische.
Unterdessen nähern sich die hektisch klingenden Stimmen. Mit weit aufgerissenen Augen starre ich den Lichtkegeln entgegen, die sich unaufhaltsam auf uns zu bewegen. Schließlich löst sich die Hand von meinen Lippen, weil ich keinen Widerstand leiste.
Immerhin.
»Wie konnte es so weit kommen?«
Theo.
Auf der Stelle versteife ich mich innerlich. Auch ohne die eindringliche Warnung von Askel würde ich mich jetzt mucksmäuschenstill an die schutzbietende Wand pressen.
Theo klingt äußerst gereizt. Die Lichter von Taschenlampen erhellen das blasse Gesicht, weil jemand seine Taschenlampe auf ihn richtet.
»Verdammter Idiot. Leuchten Sie gefälligst woanders hin und nicht direkt in meine Augen!«
»Mach ich. Verzeihung, Herr Stigner. Wir wissen nicht, wie das passieren konnte, aber E513131 hat schon immer Auffälligkeiten im Verhalten gezeigt. Heute dann das.«
»Wie die ganze E-Serie Auffälligkeiten zeigt«, fügt ein weiterer Mann an.
»Ich begreife allerdings nicht, wie E513131 trotz Wachposten flüchten konnte. Verdammt, machen Sie schon endlich hin«, knurrt Theo unzufrieden einen Mann an.
Der Angesprochene tippt hektisch auf einer Tastatur herum, die sich soeben aus der Wand schiebt und durch den Lichtschein einer Taschenlampe erhellt wird. Angestrengt verfolge ich den Ablauf, erkenne allerdings nicht genau, durch welchen Mechanismus die Tastatur aus der Wand fährt.
»Sofort, Herr Stigner«, flüstert er unterwürfig. »Würden Sie bitte die Eingabe mit Ihrem Daumenabdruck bestätigen?«
Aus heiterem Himmel erhellt sich die bis eben dunkle Wand. Geräuschlos sinkt sie sekundenschnell in den Fußboden.
Das schwache Licht, welches aus einem Raum hinter einer Glasscheibe dringt, beleuchtet die ratlos dreinblickenden Gesichter. Mein ungünstiger Standpunkt ermöglicht mir keinerlei Einsicht. Instinktiv trete ich einen Schritt zur Seite.
An einer weißen Wand erkenne ich Blutspritzer an der Wand und gehe einen Schritt, um besser in den Raum hinter der Glasscheibe sehen zu können. Askel hindert mich am Weitergehen und schiebt mich vorsichtshalber wieder in die sichere Nische zurück.
Von seinem schwach beleuchteten Gesicht kann ich deutlich ablesen, dass auch ihn brennend interessiert, was vor sich geht.
»Null, fünf, null, sechs, zwei, eins, fünf, fünf«, flüstert er nah an meinem Ohr und mit Blick auf die tippenden Finger gerichtet.
Bei jeder Zahl, die er mir nennt, streift sein Atem, der nach Whisky riecht, über mein Gesicht. Augenblicklich springen tanzende Füße in einer Pfütze herum und ich bekomme den Kloß nicht meinen Hals hinab geschluckt.
In einem himmlischen Tagtraum versunken, verschließe ich meine Augen, doch ich sehe sie noch immer vor mir und kann weder dieses Bild noch das aufsteigende Gefühl nicht willentlich vertreiben. Etliche, bunte Farbkreise gesellen sich dazu, die mir in ihrer schlichten Schönheit glattweg den Atem rauben.
»Hast du dir die Zahlen gemerkt?«, will Askel wispernd wissen, wobei erneut sein Atem über mein Gesicht streift, als wolle er mich streicheln.
Ich flehe zu Gott, er möge Theo schnell aus dem Gang verschwinden lassen. Damit mich und Askel. Allerdings lässt sich Theo Zeit und starrt unentwegt durch eine Glasscheibe in den rätselhaften Raum.
»Das gibt es doch nicht«, flucht er mantraartig und wirkt ausgesprochen ratlos.
»Doch, leider«, murmelt ein Mann neben ihm, der seinen Blick betrübt senkt. »Damit ist die Versuchsreihe E missglückt, was wir Ihnen schon seit Monaten darlegen wollten. Die E-Serie war von Anfang an zum Scheitern verurteilt.«
Theo tritt näher an die Glasscheibe und legt die flache Hand auf die glatte Fläche. »Das darf einfach nicht wahr sein. Dreißig Jahre Arbeit ruiniert, weil ihr Idioten es entwischen lasst.«
»Wir … Nein …!«
»Halten Sie ihr gottloses Mundwerk«, schreit Theo und wendet dem Mann das zornige Gesicht zu. »Ihr hab keine Ahnung. Von nichts. Nicht darüber, wie wertvoll E513131 für die nächsten Generationen ist. Findet es! Holt es mir zurück, sonst rollen eure Köpfe und das solltet ihr besser wortwörtlich nehmen. Gott verfluchte Nichtsnutze. Wenn man nicht alles selbst macht.«
Ich schlucke schwer. Askel untertrieb mit seinem Ratschlag keineswegs. Zum ersten Mal in meinem Leben frage ich mich, mit welchen Methoden Theo seine Forschungen vorantreibt. Das verspritze Blut im Raum lässt auf etwas Ungeheuerliches schließen.
Ratlos mustere ich das schwach beleuchtete Gesicht von Askel, das noch immer angestrengt versucht, etwas zu erkennen.
»Jawohl«, murmeln die drei Männer zerknirscht.
»Dreißig Jahre Arbeit einfach so den Bach runter, weil ihr Bauerntrampel nicht aufpassen könnt. Und das ausgerechnet heute«, presst Theo hervor und schlägt wütend mit seiner Faust gegen die Glasscheibe, als könne er nicht begreifen, was er dahinter erblickt.
Nachdem ich das Blut erkenne, will nicht mehr wissen, was hier vor sich geht. An was Theo forscht. Ohnehin habe ich damit zu tun, alle Eindrücke zu sortieren, die auf mich einprasseln.
Theo holt aus der Tasche des Jacketts einen kleinen Gegenstand und betrachtet ihn sich in der rechten Hand drehend. Im faden Licht funkelt etwas.
Erschrocken erkenne ich einen Verlobungsring. Ein verhaltener Laut entschlüpft mir.
Sofort drehen sich alle fünf Männer in unsere Richtung.
Geistesgegenwärtig presst Askel mich tiefer in die Dunkelheit der Nische und schützt mich, damit wir nicht von den Lichtkegeln der Taschenlampen erfasst werden.
»Wer da?«
Theo klingt streng, aber ebenso zittrig.
Ein leicht gewellter und nach einem würzigen Haarwaschmittel duftender Haarschopf befindet sich nah an meinem Gesicht. Askel steht derart nah, dass ich jeden seiner schnellen Atemzüge wahrnehme und mir insgeheim wünsche, sie gingen meinetwegen stürmisch, nicht wegen der brenzligen Situation.
»Gehen Sie schon nachsehen, wer sich dort rumtreibt«, fährt Theo seinen Mitarbeiter barsch an.
Ängstlich neige ich meinen Kopf, mache mich klitzeklein und verschließe furchtsam meine Augen, als könnte ich damit unsere baldige Entdeckung verhindern. Ich möchte nicht mehr durch die quer verlaufenden Rohre zu Theo sehen und erst recht nicht wissen, was gleich als Nächstes passiert. Ich möchte schlichtweg fort, während der Mann sich auf Anordnung seines Chefs zögerlich unserem Versteck nähert.
Ein fiependes Geräusch neben mir lässt mich urplötzlich aufhorchen. Zitternd suche ich die Hand von Askel. Um nicht noch einen Laut zu verursachen, presse ich meine Lippen fest aufeinander und drücke zusätzlich mein Gesicht in das wunderbar nach Sandelholz duftende Jackett.
Unsichere Schritte nähern sich. Das Fiepen wird lauter und scheint von mehreren Nagetieren herzurühren, die miteinander kommunizieren. Angespannt halte ich die Luft an und lausche meinem ungestüm klopfenden Herz.
Damit nicht genug. Hinter geschlossenen Lidern sehe ich allerlei prächtige Farben. Immerfort gleiten sie ineinander, verschmelzen und lösen sich auf. Sie hauen mich um, womit das Absurde an meiner verfahrenen Situation jedoch kein Ende nimmt.
»Ratten«, entfährt es dem Angestellten angewidert, der sich zu unserem Glück schnellstmöglich zurückzieht.
»Ich hasse Ratten. Die Hausmeister sollen weniger saufen und sich endlich um diese Plage kümmern«, murrt Theo. »Und bringen Sie den Ring sofort in mein Büro.«
»Ich dachte, Sie sind bereits verlobt?«
»Bin ich, wüsste aber nicht, was es Sie angeht. Machen Sie gefälligst ihre Arbeit und bringen Sie mir E513131. Lebend!«
Gehorsam nickend entfernen sich seine Angestellten. Ich entspanne mich merklich. Nachdem ich prüfend die Rohre absuche, auf denen die aufgeschreckten Ratten durch die Dunkelheit huschen, blicke ich zu Theo, der nachdenklich mit seinem Kopf an der Glasscheibe lehnt.
»Das bin ich«, murmelt er trotzig und schwermütig klingend. »Würdest du bitte meine Frau werden? Alles Quatsch, da lacht sie sich kaputt und so würde letztlich jeder dritte Idiot anfangen. Und ich bin keiner. Gewiss nicht. Lass mich kurz nachdenken …«
Er beugt sich über die Tastatur, tippt eilig darauf herum und sieht zu, wie sich die Wand geräuschlos aus dem Boden erhebt, als würden die Glasscheibe und der Raum dahinter nicht existieren. Sofort wird es wieder stockdunkel im Gang.
»Du bist die Frau, mit der ich mir ein Haus, Kinder und einen Hund vorstellen kann. Ich bekomme keine Luft, wenn du in meiner Nähe bist. Genau, ich bekomme keine Luft, wenn du in meiner Nähe bist«, murmelt er zufrieden und entfernt sich gemächlichen Schrittes.
Askel rückt ab. Erleichtert entlasse ich einen kleinen Seufzer und lege die Hand auf meinem Bauch.
»Ernsthaft? Er bekommt keine Luft, wenn du in seiner Nähe bist?«
Durch seine Frage daran erinnert, dass er neben mir steht, straffe ich mich. Mein Kopf stößt hart gegen etwas. Ein unterdrückter Schmerzschrei lässt mich herumfahren.
»Autsch!«
»Was machst du überhaupt hier?«, zische ich ärgerlich.
Hauptsächlich bringt mich auf, dass heute alles mehr oder minder daneben geht. Ich hätte eindeutig zu Hause auf dem Sofa bleiben und mir einen Film ansehen sollen. So langsam zerren die dubiosen Vorkommnisse an meinen blank liegenden Nerven, die sich entsetzlich nach Ruhe sehnen.
»Und was machst du hier?«, fragt er flüsternd zurück, als fürchte er, Theo könnte zurückkommen, wenn wir uns in normaler Lautstärke miteinander unterhalten.
»Das wollte ich zuerst von dir wissen«, murre ich und stürme zu jener Stelle, an der Theo mit seinen Mitarbeitern stand.
Tastend untersuche ich die Wand, spüre jedoch außer kaltem Stein nichts. Wie zum Henker bekamen sie die Tastatur aus der Wand geschoben?
»Was kann hinter der Wand liegen?«
»Ein es der Séparées?«
»Gut möglich«, entgegne ich gedämpft und drehe mich, um den Gang zu beobachten.
Zum Glück kann ich kein Taschenlampenlicht entdecken. Noch immer fühle ich mich nicht wohl in meiner Haut, denn Theo oder die anderen Personen könnten etwas vergessen haben und zurückkommen.
Abermals taste ich sachte die Wand ab, denn die Tastatur war keine Einbildung. Bedauerlicherweise bleibt meine Suche erfolglos. Bleibt nur, mir schnellstens eine Taschenlampe zu besorgen und die Wand genauestens zu untersuchen.
»Woran erinnerst du dich verschwommen?«, erkundigt sich Askel mit einem seltsamen Klang in seiner Stimme.
Er steht genau hinter mir, als bereite ihm die Finsternis keinerlei Probleme. Ich halte inne, starre bewegungslos mit weit aufgerissenen Augen in die Schwärze, antworte jedoch nicht. Sehen kann ich ihn auch nicht, aber mich beruhigt, dass er es ebenso wenig vermag.
»Du hast gesagt, du erinnerst dich verschwommen an etwas. Woran, Emma?«, fragt er um einiges dichter als bei seiner ersten Frage und noch tiefer gesenkter Stimme.
Schlagartig wird mir klar: Ich darf nicht länger bleiben. Die leuchtenden Farben, die permanent ihre Form ändern und ineinander zerfließen, übermannen mich und ich verliere garantiert jeden Moment den Verstand.
»Wo ist die Tür?«
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783739485058
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (Februar)
- Schlagworte
- Liebesroman nordische Mythologie contemporary Romantik Fantasy Romance Liebe Frauen Urlaubslektüre Mythologie