Zusammenfassung
Mann + Frau = beste Freunde?
Tamaras Beziehung zerbröckelt, denn Daniel betrügt sie. Mit der Freundin ihres besten Freundes und Arbeitskollegen Reino. Kurzerhand packt sie ihren Koffer. Im Berliner Nachtleben will sie sich an Daniel rächen und ihr Ego aufpolieren.
Am Bahnhof passt Reino sie ab, denn er sinnt ebenfalls auf Rache. Die Pläne geraten schnell ins Stocken. Prompt gerät Mara in einen Sog, der noch mehr Gefühlschaos auslöst und ihre tragische Vergangenheit neu aufrollt.
Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der emotional bewegenden Liebesroman »Der Geschmack deiner Haut« von Adelina Zwaan. Wer diesen Roman liest, hat mehr von den Frühling. Jetzt bei AZ Books.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Der Geschmack deiner Haut
Adelina Zwaan
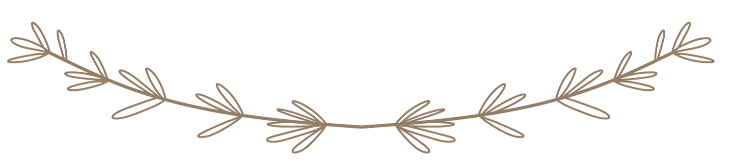
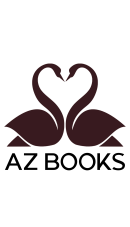
Widmung
Für meinen lieben Mann, Seelenpartner und allerbesten Freund
Mit dir ist alles so viel, wie es sich mit anderen zu wenig angefühlt hat. Du sorgst auf sehr sonderbare Weise dafür, dass ich mich angenommen fühle und zu etwas entwickle, was ich mir nicht einmal annähernd in meinen kühnsten Wunschträumen ausmalen konnte. Jeden Tag reißt du mir zärtlich das schlagende Herz aus der Brust, fordert meine Persönlichkeit heraus und fängt es von Liebe erfüllt ein, wenn es sich in einem wilden Kampf gegen ebendiese sträubt. Dann falle ich jedes Mal aus dem Himmel und lande weich in deinen liebenden Armen.
Mehr brauche ich nicht.
Adelina Zwaan
h h h
Prolog
Im Partyraum herrscht ausgelassene Stimmung. Ein Kommilitone hält eine weitschweifige, philosophische Rede. Mit Bierflasche in der Hand steht er auf einem wackeligen Tisch. Von dort palavert er wild gestikulierend über den Sinn des Lebens.
Aus Sicht eines krepierenden Hundes.
Gleichermaßen abgestoßen wie fasziniert, lauscht das Publikum, weil eine Straßenbahn den Hund erfasst. Genau in dem Moment, in dem er seine Liebe zu einer Hündin erkennt.
Hinter mir öffnet sich die grau gestrichene Kellertür. Henner betritt den muffigen Raum, in dem sich gut und gerne zwanzig Studierende um das improvisierte Rednerpult drängen. Mit seinen grünen Augen überfliegt er den Raum, entdeckt mich und schließt die knarrende Kellertür, was den rhetorisch geschickten Redner aus dem Konzept bringt.
Reino von Borstel.
Mit zusammengezogenen Augenbrauen schaut der große, schnörkelig sprechende und dunkeläugige Mann auf Henner. Der Grund versteht sich von selbst. Niemand lädt Henner zu unseren Zusammenkünften ein, dennoch taucht er gelegentlich ungefragt und ungebeten auf. So auch jetzt.
An den meisten Wochenenden versammeln wir uns in diesem Partyraum. Der befindet sich im Keller des Wohnhauses, in dem ich in einer Wohngemeinschaft wohne. Hier unten ist es nicht nur stickig, sondern auch beengt. Die verbrauchte Luft strotzt nur so von allerlei verbotenen Substanzen, die einige der Anwesenden in regelrechte Euphorie versetzen.
Auch davon halte ich nicht viel. Ich bleibe gern Herrin über meine sieben Sinne. Zudem habe ich mit dem Zeug einen echten Höllentrip erlebt und die ganze Nacht zitternd in einer Ecke gehockt. Hinterher haben einige Freunde gemeint, ich habe lediglich einen schlechten Tag erwischt.
Nett gemeint, aber sorry. Sie ahnen nicht, dass schlechte Tage bei mir die Norm sind.
Ich erlebe ausschließlich Scheißtage. Mit wenig bis gar keinem Sonnenlicht, jeden Nachmittag mindestens einmal einen kräftigen Hagelschauer. Am Abend ziehen Schneegestöber und Blitzeis durch das Land. Von den Nächten mag ich gar nicht erst erzählen. Mit derlei Grundbedingungen kann jeder Trip nur in die Hose gehen.
Da verlasse ich mich schon eher auf körpereigenes Zeugs. Das hebt genauso gut in den Himmel, wenn man weiß, wie man es gescheit anstellt.
Die hier Versammelten studieren Lehramt an der Universität Leipzig. In unserer freien Zeit setzen wir uns gerne mit philosophischen Themen auseinander. Unsere Reden gleichen denen von Rappern, die sich in gewagten, doch durchaus poetischen Lines dissen.
Momentan disst mich Herr von Borstel.
Das hat Tradition. Seit wir uns das erste Mal begegnet sind, fordern wir uns auf diese kindische Art heraus. Er ist geistreich und sprachgewandt, mir aber ein Dorn im Auge.
Vor drei Wochen habe ich meinen dreiundzwanzigsten Geburtstag gefeiert. Mein blutjunges Gesicht glüht. Hitze steigt auf und ich muss mich arg beherrschen, damit ich nicht etwas Feindseliges in Richtung Rednerpult brülle. Alles nur wegen des Vortrags, den ein adeliger Selbstdarsteller hält.
Die schmalzige Geschichte des verliebten Köters nervt. Nicht nur sämtliche seiner rhetorischen Kniffe, auch der Blick, die Gestik und die Mimik zielen einzig darauf ab, mich zu provozieren.
Auf einen Schlag fallen mir zehn Gegenargumente ein, warum der Hund nicht verliebt sein kann. Ich finde die Metapher, die er bringt, abgedroschen und leicht durchschaubar, aber ansatzweise schlau ausgedacht und mit beeindruckenden Stilelementen gespickt. Das wäre der einzige Grund, der mir einen kleinen Applaus abringen würde.
Wenn überhaupt.
An den Gesichtern der Zuhörer, die seine Rede noch immer gebannt verfolgen, erkenne ich blankes Entzücken. Das fehlt mir eindeutig.
»Grüß dich, Tamara«, quatscht Henner mich schräg von der Seite an.
Normalerweise verkehrt er in den teuren Clubs der Stadt. Dort, wo sich die feinen Pinkel vergnügen. In vollen Zügen frönt er dem süßen Leben als Sohn eines einflussreichen Juristen. Wie ein Wohltäter spendiert Henner kostspielige Getränke und versammelt mit Vorliebe geleckte Affen um sich, die ein Stück vom Wohlstandskuchen abhaben wollen und Freundschaft für reine Zeitverschwendung halten.
»Hast du dich etwa im Puff geirrt? Bekommst du nicht fette Eiterpickel beim Anblick des Arbeiterpacks?«
Vergnügt lacht er auf und legt seinen Kopf schief, als wäre ich ihm nicht auf den Schlips getreten. Den Status, der ihn durch Geburt in die Höhe hebt, finde ich mindestens genauso ätzend wie seinen düsteren Charakter.
Derweil präsentiert er makellose Beißerchen, bis er sich wieder fängt und die Hand vor den Mund legt. Die verschämte Geste lässt ihn jedoch nicht einen Deut liebenswürdig wirken.
Alles an ihm stößt mich extrem ab. Die giftgrünen Katzenaugen lösen eine unangenehme Gänsehaut aus. Selbst im Hörsaal spüre ich dieses Augenpaar beständig auf meinem Nacken ruhen, was mich direkt anwidert.
»Ich mag dich, Tamara«, hüstelt er und räuspert sich.
Ich mag ihn nicht.
Gelangweilt und durch seinen halbherzigen Versuch, lieb Kind zu tun, schaue ich zum Redner. Der taxiert uns noch immer in feinster Ich-bin-hier-der-Lehrer-Manier. Reino von Borstel trinkt einen kräftigen Schluck Bier und widmet sich erneut sein wissbegieriges Publikum.
Ich kann mir nicht helfen, aber er besitzt das seltene Talent, mich permanent in Aufruhr zu versetzen. Keine Ahnung, warum das so ist. Nur eines weiß ich: Seine herausfordernden und verstörenden Reden hinterlassen gigantische Krater in mir, in denen ich mich konturlos und geistlos anfühle.
Und winzig.
Niemals würde ich dies offen zugeben und mir eher die Zunge abbeißen, als es ihm gegenüber zu erwähnen. Er ähnelt einem unerforschten, mysteriösen und schwarzen Loch. Unaufhaltsam saugt er Materie auf und transformiert sie hinterher. Zu was auch immer.
Bislang bleibe ich unsicher, ob der adlige Nachname meine Ablehnung steigert, das kolossale Ego oder das immerwährende Lächeln. Unter Umständen ist es eine Mischung aus allem.
Im Internet wimmelt es von Borstels, jedoch schweigt er sich bislang beharrlich aus, woher das Adelsprädikat stammt. Das Geheimnis um seinen Familienstammbaum weckt die Neugier. Nicht allein meine, auch die der anderen Studentinnen. Kein Geheimnis ist hingegen, dass seine Familie vermögend ist.
Und wo sich Geld auf Konten eifrig vermehrt, verwandelt Fortuna postwendend jeden Kackhaufen in pures Gold und wiegt es mit Erfolg auf. Abartig, doch trifft das Sprichwort abermals zu: Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen.
Neben dem Studium schlägt sich Herr von Borstel nicht in ein oder zwei geisttötenden Jobs durch das Studentenleben wie wir. Seine goldene Adelsnase darf sich in die Lehrbücher stecken, wann immer es ihr beliebt. Die Mark und Pfennige in seiner Hand dreht er nicht mehrmals um, wie es die Mehrheit der hier versammelten Studenten kennt.
Haufenweise Frauen scharen sich um ihn. Verschossen schauen sie in seine tiefschwarzen Augen, weil dieser Knabe nicht nur reich, sondern auch ansehnlich geraten ist. Groß, sportlich, gewitzt.
Aber auch hier kann ich mir nicht helfen. Aus irgendeinem Grund reagiere ich absolut allergisch auf reiche Pinkel, die der Erfolg einseitig und parteiisch verwöhnt. Für mich stinkt dieser Schlag Mensch schon auf drei Meilen gegen den Wind nach Machtgeilheit und Hinterlist. Einerlei, wie gut sie aussehen. Sie und ihre Vorfahren haben sich an den Lohnabhängigen gesättigt, um selbst wie die Maden im Speck zu leben.
Abermals schaut er her.
Absichtlich verziehe ich mein Gesicht zu einer desinteressierten Grimasse und gebe ihm damit unmissverständlich zu verstehen, was ich von seiner schwülstigen Rede halte. Nichts. Das Ende sehe ich bereits vorher. Wir streiten uns nachher bis aufs Messer.
Kein Witz. Einmal habe ich mich nach einer Rede derart arg mit ihm gestritten und ein Küchenmesser gezückt. So extrem habe ich mich von seinen schlüssigen Argumentationen erschlagen gefühlt. Klar hat mich der Wutausbruch zutiefst erschrocken. Entsprechend beschämt und von seinen Lachsalven begleitet, habe ich das Messer fallen lassen, bin aus der Wohnung gestolpert und stundenlang bei strömenden Regen durch Leipzig-Plagwitz gelatscht. Noch nach Wochen bin ich aus der Haut gefahren, wenn jemand in meiner Gegenwart seinen Namen erwähnt hat.
Mich bringt auf, wie logisch er die Argumente anbringt. Er hält allen Debatten stand, argumentiert ausgeklügelt und überzeugend. Besonders die Art und Weise, wie fundiert er jede seiner ketzerischen Theorien belegt, lässt mein Herz vor Wut überschäumen.
In Gesprächen über die perfekte Ausrichtung der Didaktik setzt er mich problemlos schachmatt. Anstatt mich jedoch von seinem Intellekt geschlagen zu geben, stachelt es mein Ego an, mich diesem ungleichen Kampf weiterhin zu stellen.
Ganz sicher landet er eines Tages im Schulamt. Ich sehe ihn mit Ende vierzig als stellvertretenden Schulamtsleiter hinter einem klobigen Schreibtisch hocken, weil er logisch und geschickt allesamt in diese Richtung manipuliert.
Seine Augen lodern vor Feuereifer und ich möchte mich zu keinem peinlichen Zwischenruf verleiten lassen. Über meine feindseligen Gedanken zerknirscht, schnappe ich eine Bierflasche und wende mich ab.
Unterdessen applaudiert die Menge erfreut über das pfiffige Ende. Kunstfertig spannt er darin den Bogen zu einem innerlich verletzten Kind, welches sich nach Liebe und Nähe sehnt, diese aber zeitgleich ablehnt.
Gemurmel erfüllt den Raum. Lachen und Kichern breiten sich wie eine Krankheit aus, die keiner will und doch jeder bekommt. Ich schenke von Borstel keinen Applaus. Stattdessen nippe ich an meinem Bier und verdrehe die Augen.
»Ich gehe nachher tanzen. Kommst du mit?«, fragt Henner und öffnet sich ungefragt ein Bier.
»Hast du heute Abend keine Edelnutte in deiner Nobelbar gefunden, dass du dich hier im Proletariat nach einer verlausten Stundenbegleitung umsehen musst? Du Armer.«
Henner tritt einen Schritt auf mich zu. Seine Augen gleiten über mein Gesicht und lassen prompt all meine Nackenhaare aufstehen. »Kann sein, dass dir die Fuzzys hier dein Getue abkaufen. Mich täuscht du nicht, Tamara. Du tust immer hochtrabend, hast aber mehr von denen nackt gesehen als eine Hebamme Babys in ihrem ganzen Arbeitsleben auf die Welt holt«, entgegnet er und deutet mit seinem Kopf zu den plaudernden Studenten. Die rotten sich mittlerweile in Grüppchen zusammen, um die Rede zu diskutieren.
»Wir wohnen in einer WG. Da bleibt es nicht aus, jemanden entblößt zu sehen. Du musst wissen: Eine Arbeiterwohnung ist von Hause aus winzig konzipiert, wodurch sich deren Bewohner mehrmals täglich über den Weg laufen. Tja, du lachst, aber so lebt es sich am hinteren Ende des Schweinenapfes«, antworte ich bissig und trinke gelangweilt mein Bier.
Das abgedroschene Vorurteil, alle Bewohner einer studentischen Wohngemeinschaft würden es wie in der Kommune eins kreuz und quer miteinander treiben, ödet mich entsetzlich an. In den seltensten Fällen entspricht es den Tatsachen.
»Ziehst du bei mir ein?«
»Du hast eindeutig einen Knall«, breche ich in höhnisches Gelächter aus und schüttele meinen Kopf.
Henner steht mit Händen in den Hosentaschen vor mir und grinst verlegen, als wäre ihm seine Frage plötzlich unangenehm. Die Lider senken sich über die grüne Iris. Im gedimmten Licht des Kellers schimmert sie leicht. Immerhin hört er endlich damit auf, mich anzustarren.
»War mein Beitrag etwa so sterbenslangweilig, dass du dich seit Neuestem lieber mit Henner unterhältst, statt mir zu lauschen, Tamara?«, erkundigt sich Reino von Borstel.
Ich drehe mich um und setze ein gekünsteltes Lächeln auf. »Auf einer Skala von eins bis zehn landest du heute bei läppischen Minus dreihundert. Ich gratuliere recht herzlich dazu. Schließlich kann nicht jeder von sich behaupten, mich jemals derart gelangweilt zu haben wie du heute Abend.«
Reino lacht. Auf seinen Wangen zeigen sich lange Lachfalte, die vom Nasenflügel bis zu den Mundwinkeln reichen. Sie lassen ihn unverschämt attraktiv wirken. Die Augen ziehen sich mit nach unten. So auch jetzt.
»Ich muss schon sagen, dass du keine meiner Reden magst, verwundert mich inzwischen nicht mehr.«
»Blitzmerker.«
Abermals lacht er, wobei seine Augen zu Henner gleiten. »Wer hat dich denn eingeladen?«
»Braucht die Bourgeoisie neuerdings ein Einladungsschreiben, um an Vergnügungen des Pöbels teilzunehmen?«, entgegne ich mit einer Frage, obwohl Henner soeben zum Antworten ansetzt.
»Warum reitest du ständig auf einer Präposition herum?«
»Weil sie nun einmal deinen Nachnamen ausschmückt. Der sagt doch alles. Und egal wie herum ich es drehe, vererbte Krankheiten scheinen dir grundsätzlich nicht fremd. Die Heiratsordnung, die Eheschließungen innerhalb der eigenen sozialen Gruppe bevorzugt oder vorschreibt, verursacht bekanntermaßen rezessiv vererbbare Krankheiten, wie jeder zweifelsfrei an dir erkennen kann. Wärst du mal besser im Hochadel geboren. Dort sind weit weniger Degenerationserscheinungen verbreitet. Vermutlich liegt das daran, weil sich die Landesfürsten ausgedehnte Reisen über die Landesgrenzen leisten konnten. Deswegen mussten sie nicht im eigenen Dorf auf Brautschau gehen. Der Landadel hingegen schon.«
»Wunderbar. Ich merke, du verstehst die Botschaft meiner Rede ...«
»Im üblichen Sprachgebrauch wird es auch plump ›Inzest‹ genannt und hat schreckliche Missbildungen zur Folge. Nicht nur körperlich.«
»Jetzt mal Klartext, Tamara. Deine Meinung hin oder her. Ein Punkt macht mich misstrauisch: Was genau macht dich zur Expertin von Inzest?«
»Geht dich einen feuchten Pups an.«
»Wie ich es auch drehe. Anscheinend hast du am eigenen Leib erfahren, was uns in dieser Sache eint. Ich stamme von verarmtem Landadel ab, was im Übrigen keine Schande ist. Hochmut hingegen schon.«
»Was, wenn dem sterbenden Köter keine Erleuchtung kommt? Was, wenn er nichts als Unmut verspürt? Sagen wir einmal darüber, dass er den dämlichen Knochen vergraben hat, statt ihn sich zu Gemüte zu führen, bevor er vor die Straßenbahn gerannt ist?«
»Das ist ein recht unterhaltsamer Denkansatz. Hast du darum nur sporadische Liebesbeziehungen oder finde ich den Grund doch eher im Missbrauch?«
»Keine Liebesbeziehungen, von Borstel. Die Unterschicht sagt ganz schnöde ›Fick-Freunde‹ dazu.«
Hinter mir kräht Henner aus vollem Hals, weil er unseren Disput ungeniert belauscht. Grimmig schaut Reino ihn an, worauf Henner schleunigst verstummt. Von Borstel zieht mich an meinem Unterarm in eine ruhige Gesprächsecke, doch ich winde mich geschickt aus seinem Griff und bleibe bockbeinig stehen.
»Warum so widerspenstig? Es geht ein Gerücht um, dass du händeringend einen neuen Job suchst, Tamara. Ich trete dir meinen ab, da ich aktuell auf ein anderes Angebot scharf bin. Ein Freund meines Vaters sucht in seiner Firma eine Assistentin, die ihn bei seinem Medienauftritt unterstützt. Ist erstklassig bezahlt und unbefristet. Daneben ist es genau dein Ding. Soll ich dich vorschlagen?«
Ich trinke einen großen Schluck Bier und stelle danach die leere Flasche geräuschvoll auf einem Regal ab. Eine neue Stelle wäre wunderbar, aber aus meiner Kindheit kenne ich die Verstrickungen und Erwartungen noch zu genau, die einige Menschen stets an derartige Freundschaftsdienste geknüpft haben.
In meiner Hosentasche tummeln sich seit drei Tagen einsame fünf Mark, die bis übernächsten Montag reichen müssen. Innerlich sträubt sich alles gegen die Annahme dieses verlockenden Vorschlags. Garantiert erwartet er eine Gegenleistung, obwohl er es als Angebot tarnt.
»Fick dich in dein hochherrschaftliches Knie«, spucke ich aufgebracht in das gefällige, ovale Gesicht, aus dem er mich bestürzt anschaut.
»Wo liegt dein Problem?«
»Dein Preis ist mein Problem, von Borstel. Darum kannst du dich selbst aufs Kreuz legen und mich mit deinem lausigen Angebot in Frieden lassen!«
»Dir steht es nicht, wenn du in den Gossenjargon verfällst. Ich mache dir folgenden Vorschlag: Du nimmst das Angebot an und ich verlange nichts dafür.«
»Deine psychologische Dialektik funktioniert bei mir nicht.«
»Eines Tages wirst du mir das Gegenteil erzählen. Dann betrachtest du es als das, was es ist. Ein Geschenk ohne jegliche Gefälligkeiten.«
»Ohne jegliche Gefälligkeiten sagst du. Dennoch knüpfst du diese eine Verbindlichkeit daran.«
Er überlegt eine Weile. Genau genommen spreche ich einen riesigen Haken an, der ihm in seiner Argumentation anscheinend entgangen ist. Sorgfältig wägt er seine nächsten Worte ab.
»Glaube mir. Die tatsächlichen Gegebenheiten erkennst du eines Tages. Dann lügst du mir auch nicht mehr eiskalt ins Gesicht.«
Wiederum bringt er geschickte Argumente vor, versenkt mich mit nur einem Treffer und kassiert den Punkt. Darüber verstört und bestürzt, trete ich den Rückzug an. Unsanft dränge ich mich durch die plaudernde Menge und flüchte in die äußerste Ecke des Raumes.
Noch nie hat jemand in wenigen Sätzen mein geheimnisumwobenes Handicap enttarnt und zeitgleich eine Lösung angeboten, die noch entsetzlicher schmerzt. Vertrauen gleicht für mich einem heimtückischen Wesen mit langen Fangarmen, scharfen Zähnen und sechs gefräßigen Mäulern. Es kommt einem Kraken gleich, was im Mittelalter nicht grundlos zu den gefürchtetsten Seeungeheuern gezählt hat. Und ich fürchte mich auch im zwanzigsten Jahrhundert davor wie vor nichts anderem auf der Welt.
Erst nach einer halben Stunde beruhige ich mich halbwegs und schlurfe zu meinem abgestellten Bier. Das steht im Regal. Stimmt ja, es ist leer. Mist.
Neben der leeren Flasche steht ein einsames Schnapsglas. Es ist eines, aus denen wir billigen Wodka trinken. Der klare Inhalt sieht verlockend aus und spült mein Elend garantiert hinab.
Argwöhnisch hebe ich das Glas an meine Nase. Vorsichtshalber schnuppere ich daran, ob es sich tatsächlich um ein alkoholisches Getränk handelt. Obendrein probiere ich mit der Zungenspitze, ob es Wodka ist.
Ist es, daher kippe ich den Inhalt in einem Zug hinunter. Mit einem neuen Bier spüle ich nach und schniefe die letzte Kullerträne in der Nase hinauf. ›Wird schon‹, heitere ich den kleinen, schwermütigen Teil in mir auf, der seit jeher, aber in solchen Situationen zwecklos, bitterliche Kullertränen weint.
Ein Weilchen schaue ich meinen Mitbewohnern zu, die sich angeregt mit Reino über seine virtuose Rede unterhalten. Urplötzlich erscheint mir der Raum, als würde ich mich in einer überhitzten Sauna befinden. Wohin ich auch immer sehe, steht von Borstel, dessen Anblick mir den puren Angstschweiß aus den Poren treibt.
Nicht nur das.
Unaufhaltsam senkt sich die Zimmerdecke des umgestalteten Kellers nieder und zerquetscht mich mit meinen Gefühlseindrücken, die nicht für ein erwachsenes Gespräch taugen. Mein Magen krempelt sich unerträglich auf links, bis ich an irgendeiner Stelle Halt suchen muss.
Mir nichts, dir nichts steht Reino vor mir. Das plötzliche Auftauchen erschreckt mich entsetzlich und lässt mich zusammenfahren.
»Was ist los, Tamara?«
Väterlich tatscht er an meinem Unterarm herum, was mich an den monströsen, übelriechenden Mann von einst erinnert. Vor lauter Panik über diesen Flashback, schreie ich ungebremst los. Meistens läuft es nach demselben Schema ab. Nach einigen geheuchelten Liebenswürdigkeiten zertrampeln sie gefühllos mein Herz.
»Ich sagte: Fick dich, von Borstel«, fauche ich heiser. »Philosophiere weiter über ... Du hast keine Ahnung, wie ...«
Weil ich inzwischen hysterisch schreie, drehen sich einige Kommilitonen alarmiert zu uns um. Um mich zu besänftigen, legt von Borstel seine Hand auf meinen Unterarm. Angewidert schleudere ich sie fort, indem ich meine Arme blitzschnell hochfahre.
Schnellstens hebt Reino die Hände in die Höhe und hält Abstand. »Alles gut. Es galt als unverbindliches Angebot. Ich erwarte echt nichts von dir. Du kommst zu mir, wenn du soweit bist.« Während er beruhigend auf mich einredet, verändert sich der Blick. »Wie viel hast du getrunken?«
»Ich sagte: Fick dich«, wiederhole ich leicht nach vorn gebeugt und auf kraftlosen Beinen.
Mein Magen begehrt auf, obwohl er nur zwei Bier und drei Wodka bekommen hat. Abendbrot habe ich mir gespart, weil ich niemanden anpumpen mag. Mein Stolz ist mindestens genauso grenzenlos wie die gähnende Leere in meinem Portemonnaie.
Ungelenk fuhrwerke ich mit den Händen in der Luft herum, damit es niemand wagt, mich zu berühren. Hektisch suche ich die Türklinke hinter mir, bis meine fahrigen Finger sie endlich zu fassen bekommen.
Ich halte es in dem engen Raum nicht mehr aus und brauche dringend frische Luft. Schwankend stolpere ich hinaus.
Im düsteren Kellergang atme ich durch, doch es wird nicht besser. Mit eisernem Willen taste ich mich im dunklen Gang zur Treppe vor, wo meine Knie erschöpft einsacken und den Dienst verweigern.
Habe ich mir etwa eine Grippe eingefangen?
Das fehlt für einen rundherum beschissenen Abend. Ich versuche, mich aufzuraffen, doch Tonnen an Gewichten ziehen mich unerbittlich zurück in die bodenlose Tiefe. Ein dicker Speichelfaden rinnt aus meinem Mund, was gewiss unästhetisch aussieht.
Untypisch für eine Grippe.
Ich fühle mich hundsmiserabel. Meine Zunge fühlt sich an, als wäre sie aus Blei gegossen. Mich wundert es nicht, wenn sie heraushängt wie bei dem hechelnden Köter, von dem Herr von Borstel in aller Ausführlichkeit referiert hat. Dieses Stück Blei lässt sich nicht mehr mit Willenskraft bewegen und ist gänzlich ungeeignet, um nach der dringend benötigten Hilfe zu rufen.
Hinter mir vernehme ich Schritte. Sie nähern sich rasch.
Ah, gut.
Irgendwer grapscht in meinen Schritt. Bei dem unbeholfenen Versuch, die ungehobelte Flosse wegzuschlagen, kippe ich zur Seite und kann mich plötzlich nicht mehr bewegen.
»Sieh an, sieh an. Du lieferst den Beweis. Hochmut kommt stets vor dem Fall. Na, komm nur, ich bringe dich ins Bett.«
Die Stimme kenne ich nicht. Sie klingt verzerrt und blechern.
Mit jedem Herzschlag breitet sich ein unbeschreibliches Angstgefühl in meinem Körper aus, sobald sich ein dunkler, konturloser Schatten zu mir hinabbeugt. Absurderweise erinnere ich mich an damals. An jedes Detail. Da hat mein ganzer Körper ebenfalls eiskalte Gänsehaut überzogen. Auch da konnte ich das kommende Unheil förmlich riechen, mich nicht bewegen oder wehren.
Mit einem mühelosen Handgriff werde ich rücksichtslos aufgerichtet. Ich werde über die Schulter gelegt und die vielen Treppenstufen zur Wohngemeinschaft hinaufgetragen. Mit jedem Schritt fliehe ich in eine kalte, tiefe Gletscherspalte, in der niemand meine Seele berühren kann.
Grausige Schwärze breitet sich über mich aus, die keinen Seelenfrieden bringt. Eher raubt sie alle Lebenskraft und peinigt entsetzlicher als die heißesten Tränen, die ein Mensch weinen kann.
Kapitel 1
Murmelnd erheben sich die Jugendlichen von ihren Stühlen, weil die Schulklingel zur Hofpause läutet. Einer wogenden Welle gleich schwappen sie zeitgleich zur Tür des Klassenzimmers. Jeder möchte auf den Hof, in den nahe gelegenen Supermarkt oder zu den Steintreppen am nahe gelegenen Karl-Heine-Kanal.
»Die Hausaufgaben erledigen Sie bis nächsten Montag«, rufe ich den Schülern der Klasse 10b hinterher.
Mit einem Buch unter dem Arm eilt Lisa Barthold auf mich zu. Sie stellt sich neben den Lehrertisch, an dem ich die Klausuren stapele.
»Frau Weigert? Kann ich Sie bitte kurz sprechen?«
»Was gibt es, Lisa?«
»Hat es bei der gestrigen Lehrerkonferenz ein Ergebnis gegeben?«
Verblüfft betrachte ich das blonde, langhaarige Mädchen. Das jugendliche Gesicht mit der glatten Haut wirkt, als würde es aus kostbarem Porzellan bestehen.
»Ich bin nicht befugt, dir das Ergebnis mitzuteilen. Die Vorschriften, wie du weißt. Du erfährst es morgen«, antworte ich ausweichend und wende mich zum Gehen.
Mit ihren schlanken Fingern umklammert sie meinen Unterarm und hält mich vom Gehen ab. »Das ist alles? Von meiner Klassenleiterin habe ich deutlich mehr erwartet. Zumindest einen Hinweis.«
Bei anderen Gelegenheiten ist mir ihr Mut bereits aufgefallen. Lisas starkes Herz beeindruckt. In der Klasse nimmt sie keine Führungsposition ein, weil ihr das Gesamtgefüge selten gefällt. Doch das bedeutet nicht etwa, dass sie dieser Rolle nicht gewachsen wäre. Im Gegenteil. Instinktiv weiß sie genau, für welche Themen sich der Einsatz ihrer Energie lohnt. Unabhängig davon steht sie jederzeit bereit, wenn die Situation es erfordert und die Ordnung in eine unschöne Richtung zu kippen droht.
Darum nenne ich sie liebevoll ›Atlas‹. In gewissen Situationen schultert sie das Gefüge in der Klasse bereitwillig, ohne dabei Überlegungen bezüglich des eigenen Vorteils anzustellen oder etwas Profitables im Gegenzug dafür einzufordern.
Umso verfahrener gestaltet sich ihre Situation aktuell.
»Bitte Frau Weigert. Ich möchte die Schule nicht verlassen und muss endlich wissen, woran ich bin.«
Rasch geben ihre Finger meinen Arm frei, nachdem ich angesäuert dorthin schaue. Inständig bittend beobachten himmelblaue Augen jede meiner Gesten. Trotz des klaren Blicks liegt in ihnen eine Intensität, die mich zuweilen tief erschüttert. Mit ihren sechzehn Jahren haben diese Augen Dinge gesehen, die selbst eine Dreißigjährige vom richtigen Weg abbringen könnten.
Lisa nicht.
Sie legt sich dann erst so richtig ins Zeug. Ihre hervorragenden Noten hat sie sich trotz widriger Lebensumstände hart erarbeitet. Damit straft sie sämtliche Theorien, dass das Elternhaus für die schulischen Erfolgsaussichten entscheidend ist. Soweit ich informiert bin, möchte das Jugendamt sie dauerhaft aus dem prekären häuslichen Umfeld holen. Fraglos wäre das wünschenswert für ihre weitere Entwicklung.
»Das weiß ich, Lisa. Allerdings darf ich im Vorfeld nicht mit dir darüber sprechen. Du erfährst morgen das Ergebnis, also habe noch einen Tag Geduld. Auch, wenn es schwerfällt.«
Tränen rollen über die Kieferknochen des ovalen Gesichts. Ihre Mundwinkel ziehen sich betrübt nach unten. Liebend gerne würde ich sie in meine Arme schließen und ihr zuflüstern, dass alles gut wird, doch dazu fehlt mir der Schneid.
»Lisa, es sind vierundzwanzig Stunden. Die musst du dich leider gedulden«, höre ich mich klanglos daherreden. Statt taktvolle Worte zu finden, berühre sie vorsichtig am Unterarm.
Verdrossen nickt sie, während mehrere dunkle Flecken auf ihrer weißen Leinenbluse von ihrem inneren Aufruhr erzählen. Ihr schmächtiger Leib wendet sich ab. »Schon verstanden. Sie sind genau wie alle anderen Lehrer.«
Mit hängendem Kopf trottet sie aus dem Klassenraum. Ich schaue hinterher und fühle mich hundsmiserabel.
Gestern habe ich mich ergebnislos für sie eingesetzt. Obendrein habe ich mich mit dem halben Kollegium angelegt, um für Lisa alles zum Guten zu wenden. Wie eine Tigerin für ihr Junges habe ich gekämpft, doch alles hat nichts geholfen. Der Rotzlöffel, der sie gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr genötigt und dabei geschwängert hat, ist der Sohn des Schulamtsleiters und darf an der Schule bleiben. Sie muss gehen. Meine Kollegen kuschen lieber als Klartext zu reden und damit den verhassten Broterwerb zu riskieren.
Der Einfachheit halber glaubt die Schulleiterin Lisa nicht, dass es gegen ihren Willen geschehen ist. Um die Sache auf die Spitze zu treiben, fordert sie vom Opfer Beweise. Sie bedrängt Lisa sogar dahingehend, die gestellte Anzeige wegen Vergewaltigung zurückzuziehen. Dabei ist es Aufgabe der Schule, darauf zu achten, was sich in den Mauern des Gebäudes abspielt, statt das Offensichtliche zu vertuschen.
Absolut lächerlich. Es ist eine Farce.
Betrübt schaue ich zu Boden, denn in gewisser Weise habe ich versagt. Das ist der Punkt, der mir ein ungemeines Druckgefühl im Kopf verursacht.
Auf dem Flur vor der Klassenzimmertür hetzen Schüler und Kollegen in die Pause. Zerstreut nehme ich es wahr und frage mich, wer von ihnen Anteil an diesem Schicksal nimmt. Von Lehrern und Schülern geschnitten, als Lügnerin und billiges Mädchen hingestellt, ohne Unterstützung aus dem Elternhaus bleibt mein Atlas dieses Mal auf sich allein gestellt.
Ich hake die Sache nicht ab, ignoriere oder vergesse sie, denn viel von meiner eigenen Vergangenheit mischt sich in diesem Fall und meldet sich vehement zu Wort. Daneben hasse ich Ungerechtigkeit wie die Pest.
Meine Hand holt aus und pfeffert den Berg Zettel zu Boden, den ich vorhin gewissenhaft gestapelt habe. Die Klausuren flattern eine Weile in der stickigen Klassenzimmerluft herum, bevor sie verdreht und ungeordnet auf dem polierten Parkettfußboden landen.
»Mara. Was ist los?«
In der Tür steht Reino. Er ist der einzige Mensch, der mich Mara nennt, nicht Tamara.
Nachdem er vor einigen Jahren an dieses Gymnasium gewechselt ist, habe ich das unsinnige Kriegsbeil aus unserer Studienzeit begraben. Damals hat er mich nach Feierabend ein Stück auf dem Nachhauseweg begleitet. Vor einem vierstöckigen, verfallenen Gebäude bin ich stehen geblieben.
Die Ruinen der einstigen Globus Werke Leipzig stehen einsam und verlassen in der Abendsonne. Der Eingang wurde notdürftig mit Spanplatten vernagelt, die inzwischen verwittert und stellenweise brüchig sind. Das gelbrote Backstein wurde mit etlichen Graffitis beschmiert. Bäume erobern sich ihren Lebensraum zurück. Die hohen Fenster sind mutwillig zerschlagen. Nichts an diesem Ort erinnert daran, dass hier einst ›Elsterglanz‹ und das Autopflegemittel ›Karipol‹ hergestellt wurden.
Neben dem Eingang kniet Atlas, der Titan aus der nordischen Mythologie. Er hat dem Werk seinen Namen gegeben. Die Idee des Firmengründers, die Welt mit seinen Produkten zu erobern, ist kläglich gescheitert.
Atlas scheint davon unberührt. Gleichmütig stemmt er die riesige Weltkugel.
Lange habe ich Reino angesehen, bevor ich in das verfallene Gebäude geschlüpft bin. Schweigend ist er mir über verrottete Bretter, Glasscherben und der steinernen Treppe gefolgt. Staunend haben wir die Jugendstil-Ornamente bewundert.
Aus einem der zerschlagenen Fenster im vierten Obergeschoss habe ich über die Dächer von Plagwitz gesehen. Ich habe ihm gestanden, dass ich meinen Vornamen furchtbar finde.
Und noch mehr.
Zum Beispiel, dass er zu Studienzeiten für mich Sinnbild eines erfolgsverwöhnten Jungen, der aus einem vermögenden Elternhaus stammt. Für mich ist er jemand gewesen, der sich aus Jux und Dallerei gegen seine Eltern auflehnt und sich unter das Volk mischt.
Aber der Erfolg hat trotzdem an ihm geklebt wie eine stinkende Tube Uhu Alleskleber. Ihm ist alles zugeflogen, während sich andere für viel weniger wesentlich mehr abgestrampelt haben. Herr von Borstel hat im Vorbeigehen gute Noten bekommen und musste sich nicht großartig dafür anstrengen. Die besten Jobs, die er nicht zum Überleben gebraucht hat, sind ihm zugeflogen. Und jede Frau, die er begehrt. Vor allem die gutaussehenden Dinger, die gerne an Uhu Alleskleber schnüffeln.
Stell dir vor, du strampelst dich ab, bis deine Kräfte schwinden. Ungeachtet aller Anstrengung bleibt dein Einsatz ergebnislos. Plötzlich taucht eine Hand aus dem Nichts neben dir auf. Sie bittet dich auf ein luxuriöses Motorboot zu steigen. Freundlich wirst du eingeladen, auf elegante, bequeme Art ein Stück mitzufahren.
Damals hat mich die liebenswürdige Geste zutiefst beschämt. Es hat mich in meinem Strampeln absolut armselig aussehen lassen. Ich habe alles gegeben, mich rundweg verausgabt und genau gewusst, dass ich damit der Mehrheit angehöre. Vor Wut auf dieses kräftezehrende Gesellschaftssystem habe ich Reinos Hand und Hilfe ungehalten abgelehnt, als er sie mir mit einem bezaubernden Lächeln an jenen Abend angeboten hat.
Kurz darauf hat sich mein Bild von ihm jedoch radikal geändert. Da habe ich mich in einer Notsituation befunden. Ich meine, mir nichts, dir nichts habe ich so richtig tief in der Sch… gesessen. Bis zur Oberkante der Unterlippe.
Am Morgen nach der Party ist er in mein Zimmer gerannt gekommen, weil ich wie am Spieß geschrien habe. Zitternd habe ich im Bett gehockt und meine blutüberströmten Hände in die Höhe gehalten. Vor Schmerz habe ich mich gewunden und wusste nicht mehr, was passiert ist.
Er hat einen Notarzt gerufen, beruhigend auf mich eingeredet und nicht von meiner Seite gewichen, bis die Ärzte eingetroffen sind. Im Krankenhaus wurde ich notoperiert.
Nachdem ich entlassen wurde, hat er Tee oder Essen für mich gekocht. Nächtelang hat er auf dem abgewetzten Sessel meiner verstorbenen Großmutter gesessen und sogar meine schmutzige Wäsche gewaschen, weil ich weder in der Lage gewesen bin oder mich aufraffen konnte.
Tagelang habe ich an die Zimmerdecke gestarrt und Gott und die Welt verflucht. Ist mir jemand zu nah gekommen, habe ich panisch aufgeschrien. Es ist eine Frage der Zeit gewesen, bis sich alle verkrümelt haben. Zudem wollten sie nicht in die Sache hineingezogen werden.
Reino ist als einziger geblieben.
Habe ich geweint, hat er mir ein Taschentuch gereicht. Eines Abends, als ich … Er hat mich in die Arme genommen, was ich anfänglich mit extremen Wutausbrüchen quittiert habe. Reino von Borstel war der Prellbock, der meine Flüche, Anfälle von Schreikrämpfen und spitzen Fingernägel stoisch abgefangen hat.
Mit der Zeit habe ich mich beruhigt, weil er nicht von meiner Seite gewichen ist. Egal, was ich ihm an den Kopf geworfen oder wie tief ich meine Fingernägel in seine Handflächen gegraben habe, er hat in dem Sessel gesessen und auf mich aufgepasst. Auf diese Weise wurde er peu à peu mein Rettungsanker.
In dem verfallenen Haus mit dem Atlas am Eingang habe ich ihm gestanden, dass ich ihn ab da als meinen Freund betrachtet habe. Reino hat mich angelächelt und schweigend aus dem Fenster geschaut. Verblüfft habe ich zugesehen, wie er seine Hand ausgestreckt hat.
Versöhnungsbereit habe ich meine hineingelegt. Daraufhin hat er mich in seine Armbeuge gezogen. Ewigkeiten haben wir nebeneinander gestanden und aus dem Fenster mit den mutwillig zerschlagenen Glasscheiben geschaut.
An den Wänden haben vergilbte Tapetenreste herabgehangen. Es hat modrig gerochen und ist zugig gewesen, aber wir haben die Aussicht auf die orangerote Sonne genossen, die unaufhaltsam den Tag verabschiedet hat.
Auf dem Heimweg hat er mir vorgeschlagen, am nächsten Tag in seinen Squashverein mitzukommen und mit ihm zu trainieren. Für einen klitzekleinen Moment habe ich gedacht, er wüsste alles über mich. Ehrlich gesagt ist mir diese Tatsache beflügelnd vorgekommen, da ich es bei niemandem sonst erlebe. Immer muss ich mich irgendwie erklären.
Bei ihm nicht.
Seit jenem Tag pflegen wir eine wunderbare Freundschaft. Unter den männlichen Kollegen ist er derzeit der Einzige, der versteht, welche Hilfe und Zuwendung Lisa benötigt. Gestern hat er vehement für ihr Verbleiben an der Schule plädiert und sich damit auf eine recht unbequeme Seite neben mir geschlagen.
»Ist doch alles Scheiße, wenn ich es genau nehme«, antworte ich verdrossen und schaue zu den durcheinandergeratenen Klausuren, die auf dem Boden liegen.
»Kommt ihr heute Abend zum Essen?«
In seinen Händen liegt der Stapel, den ich ihm nun abnehme. Er hat meinen Freund Daniel und mich zum Abendessen eingeladen. Bei sich zuhause. Nach anfänglich skeptischen Blicken haben sich unsere Partner an unsere geschlechterübergreifende Freundschaft gewöhnt, die komischerweise länger hält als jede meiner intimen Beziehungen.
Bevor Reino Lidia kennengelernt hat, ist er fünf Jahre mit Alex verheiratet gewesen. Gefühlstechnisch gleicht die neue Beziehung einer aufreibenden Achterbahnfahrt, wobei keiner der beiden sich zu einem Ende durchringen kann. Dem Aussehen nach fährt er momentan durch ein finsteres Tal.
Anfänglich hat auch Lidia unsere Freundschaft verwundert. Es hat etliche, unschöne Missverständnisse gegeben, die wir in hitzig geführten Gesprächen ausgeräumt haben. Heute sieht sie mich kritisch an, wenn Reino einen Arm um meine Schulter legt oder mich in die Arme schließt. Inzwischen lässt sie aber wenigstens ihre polnisch, temperamentvollen Krallen eingefahren.
»Ja, sofern Daniel sich nicht verspätet. Heute Morgen ist er frühzeitig los, weil viele Termine anstehen. Habe ihn daher nicht gesehen und erinnern können. Ich werde in jedem Fall pünktlich erscheinen und freue mich schon irrsinnig darauf.«
Reino schiebt meine Hände beiseite, um die letzten durcheinander geratenen Klausuren aufzuheben. »Lass mich das machen.«
»Lisa hat eben nach dem Beschluss des Kollegiums gefragt.«
»Und?«
»Nichts und. Ich musste sie fortschicken, obwohl sie für mich am Boden zerstört gewirkt hat. Am liebsten könnte ich laut aufschreien, so ungerecht finde ich, was hier vor sich geht.«
»Heute Abend verwöhne ich euch. Wir essen etwas Leckeres, sitzen zwanglos bei einem Glas Rotwein zusammen und langweilen Daniel mit unseren haarsträubendsten Kabbeleien aus unserer Studienzeit.«
Ich schmunzele, weil Daniel diese alten Kamellen sterbenslangweilig findet. Jetzt straffe ich mich und verlasse besser gelaunt das stickige Klassenzimmer, während Reino unterdrückt lacht und mir auf den Flur folgt. An der Tür zum Lehrerzimmer angekommen, hält er sie höflich auf.
Von den durchgehenden Fensterfronten, an denen mehrere Computerarbeitsplätze stehen, strömt Tageslicht in den großen Raum. An der Wand der Eingangstür erstreckt sich über die gesamte Breite ein Regal mit abschließbaren Lehrerfächern. Ein halbhoher Tresen trennt Raum optisch vom Eingangsbereich ab. Um den riesigen Tisch stehen unzählige Stühle.
Das überfüllte Lehrerzimmer wirkt in den großen Pausen unruhig. Auch jetzt. Eine Traube männlicher Kollegen steht an der Kaffeemaschine. Mit Händen und Füßen debattieren sie. Über was bleibt fraglich. Andere Kollegen sitzen am langen Tisch und kauen lustlos ihre Mittagsmahlzeit, während sie fieberhaft in Ordnern und Zetteln blättern.
»Ich muss jetzt in die 10a«, erkläre ich und lege die Klausuren in mein Schließfach.
Sorgfältig verriegle ich es und widme mich den jüngst verteilten Informationsblättern, die sich in meinem Ablagefach im halbhohen Tresen zu einem gewaltigen Haufen auftürmen. Die Schulleiterin brummt mir gleich drei neue Vertretungsstunden auf. Vermutlich tut sie dies, um sich für meinen gestrigen Auftritt zu rächen.
»Blöde Kuh«, murmele ich verschnupft in meinen nicht vorhandenen Bart und stopfe die teilweise knittrigen Dokumente in das Ablagefach zurück.
Reino steht am Fenster. Er kaut einen Apfel und sieht dabei in den Innenhof. In Gedanken vertieft, schaut er kurz auf. Das auffällige Mienenspiel gibt mir zu verstehen, dass ich zu ihm kommen und aus dem Fenster sehen soll.
Eine Traube pickeliger, schwitzender Jungs steht um Eugen Graft versammelt. Aufmerksam lauschen sie seinen Geschichten und lachen verdruckst über jeden seiner schlechten Gedankenblitze, die sich ganz sicher um Lisa drehen. Meine Nackenhaare stellen sich auf, ohne zu hören, was er von sich gibt.
Hinter vorgehaltener Hand tuscheln die Kollegen, er wäre nicht grundlos an dieser Schule und genau in meiner Klasse gelandet. Er gestikuliert mit Händen und Füßen. Wie sein Vater. Diese großspurige Körpersprache kopierend steht er breitbeinig vor den versammelten Jugendlichen, grinst von sich selbst überzeugt mit schiefem Mund und fühlt sich unantastbar.
»Du meine Güte, sieh dir das an. Er feiert sich. Und seine Untertanen himmeln ihn an, als wäre er das Maß aller Dinge.«
Zustimmend brummt Reino und beißt in seinen Apfel. Zur Ablenkung stelle ich mich an die Stundentafel, die wir salopp ›Sklaventafel‹ getauft haben. Natürlich nur unter der Hand.
Reino unterrichtet in der nächsten Stunde die 8b in Geschichte. Das ist eine schwierige Klasse, aber er gilt als beliebter Lehrer und kommt mit ihnen klar.
Ein Poltern lässt mich aufblicken.
Es kommt von der Tür. Ein Junge mit geröteten Wangen stolpert atemlos in das Lehrerzimmer. »Wir brauchen schnell einen Notarzt. Lisa schneidet sich auf der Toilette die Pulsadern auf«, stammelt der blasse Schüler mit großen, vor Panik geweiteten Augen.
Prompt laufe ich in das Durchgangszimmer, welches sich zwischen Lehrerzimmer und Büro der Schulleitung befindet. Frau Hull, die Sekretärin, ist zu Tisch, daher schnappe ich mir den Telefonhörer. Fahrig wähle ich die Notrufnummer und winke den blassen Jungen heran.
Ein hysterisch kreischendes Mädchen taucht in Tränen aufgelöst neben dem desorientierten Jungen auf. »Wir brauchen Hilfe. Lisa. Sie schneidet sich die Pulsadern auf. Toilette. Dritter Stock. Überall ist Blut.«
Mit angsterfüllten Augen sieht sie zu, wie ich angespannt in den Telefonhörer lausche und ihr zunicke. Endlich meldet sich eine Frauenstimme am anderen Ende der Telefonleitung.
»Bitte schicken Sie einen Krankenwagen. Eine Schülerin fügt sich Verletzungen zu und blutet massiv«, melde ich.
Ich nenne die Adresse der Schule und deute dem hysterischen Mädchen an, hierzubleiben, damit sie mir weitere Auskünfte für die Dame an der Notruf-Hotline gibt. Nachdem alles an Fakten durchgegeben ist, reiche ich den Telefonhörer an einen Kollegen weiter, um nach Lisa zu schauen.
Getuschel erschallt im Flur, während ich mich durch die ungeniert gaffende Menschentraube drängele, die sich vor der Mädchentoilette in der zweiten Etage sammelt. Neugierig recken sie ihre Hälse, um einen kurzen Blick auf die brüllende Lisa zu erhaschen.
Mühsam arbeite ich mich durch das sensationshungrige Publikum und stehe kurz darauf in der Mädchentoilette. Mir bietet sich ein grauenhaftes Bild.
Das weinende Mädchen liegt auf dem Boden. Überall ist Blut. Lisa krümmt sich und stammelt unentwegt mit heiserer Stimme, dass ihr sowieso niemand glaubt und alle sie mal kreuzweise können. Sie will in Ruhe gelassen werden, entwickelt Mordskräfte und stößt jeden fort, der ihr zu nahekommt.
Ich knie mich neben sie, hebe ihr verweintes und gerötetes Gesicht an und ignoriere das weithin verteilte Blut. »Ich glaube dir, Lisa«, hole ich sie mit leisen Worten zu mir. Sachte und vorsichtig streife ich die blonden, klebrigen Strähnen aus dem verweinten Gesicht.
Verstört schaut sie mich an. Ihr Mund zittert. Ebenso ihre Hand, aus deren Handgelenk Blut tröpfelt. Zum Glück hat sie den Schnitt nicht längs angesetzt, sondern quer. Und auch nicht tief genug.
Das sagt mir: Sie will nicht wirklich sterben, sondern sucht verzweifelt, aber mit den falschen Mitteln nach Hilfe. Unsanft reiße ich ihre Hände in die Höhe, was sie für einen Moment wachrüttelt. Wimmernd versteckt sie ihr blutverschmiertes Gesicht in meiner Kleidung, um dort Schutz zu finden.
»Ich will es nicht haben. Es ruiniert mein Leben.«
»Komm her, Josi«, rufe ich einem Mädchen zu. Energisch arbeitet sie sich durch die Menge.
»Halte ihre Hände hoch, bis die Sanitäter dir was anderes sagen.«
Unerschrocken greift das angesprochene Mädchen die blutigen Finger und reckt tapfer die Arme von Lisa in die Höhe.
»Gut so«, lobe ich Lisas Klassenkameradin und beuge mich hinab. Unentwegt wimmert Lisa, dass sie das Kind nicht haben will.
»Schhh! Ganz ruhig. Ich bin hier. Alles wird gut. Gleich kommen die Sanitäter.«
Meine Finger fahren durch ihre langen Haare, bis ich ihren Nacken erreiche. Vorsichtig packe ich ihn, zwinge ihr Gesicht in meine Richtung und verlange auf diese Weise, mich für meine nächsten Worte anzuschauen.
»Ich nähe dir persönlich die Schnittwunden mit einer stumpfen Stopfnadel zu. Ich rufe keinen Notarzt, der dich dafür sediert, solltest du noch einmal diesen Scheiß versuchen. Mache das nie wieder, verstanden? Und das rate ich dir nicht als deine Klassenlehrerin, sondern als Frau.«
Für einen kurzen Moment senkt sie die Lider. Durch diese Geste beruhigt, drücke ich das entkräftete, aber weinende Mädchen an meinen Brustkorb, wo sie in Tränen zerfließt und sich hilflos gehen lässt.
»Halte sie höher«, rate ich Josi, die ihre Hände zu weit absinken lässt, weil sie sich auf mich konzentriert.
Endlich kommen die Sanitäter. Die glotzende Menge macht zögerlich Platz. Unsanft schieben sie mich beiseite, um der blutenden Lisa zu helfen. Josi und ich sorgen für ausreichend Sichtschutz, weil sich die schaulustige Menge noch immer an der Toilettentür versammelt und gafft.
Bevor Lisa auf der Trage in den Rettungswagen gebracht wird, nehme ich eine ihrer blutverschmierten Hände. Ich drücke sie fest und beuge mich über sie. »Es kommt nicht darauf an, wie viele Menschen dir glauben, sondern wer.«
Ohne zu antworten, gleitet ihr entrückter Blick an die hohe Raumdecke. Der Griff um meine Hand löst sich. Beharrlich blendet sie die spöttischen Gesichter und bissigen Sprüche der Mitschüler aus, die einander schubsen und sich zur Trage hinab beugen. Nur wenige von ihnen wünschen gute Besserung.
»Das haben Sie wunderbar gesagt«, raunt Josi mir zu, die den Sanitätern mit nachdenklichen Gesichtszügen hinterherschaut.
Haselnussbraune Augen ruhen danach auf mir. Ich weiß nicht, wer von uns im Moment mehr Halt benötigt. Kurzerhand ziehe ich sie zu mir, drücke sie fest an mich und umarme das rothaarige Mädchen, während ich unentwegt ihre Schläfe herze.
»Danke für deine Unterstützung«, murmele ich an ihrem Ohr und spüre, wie ihre Arme mich zaghaft umschlingen. Für einen winzigen Atemzug schmiegt sie sich an mich und genießt die Vertrautheit.
»Was Sie gesagt haben, war echt spitze und ich hoffe, sie macht so einen Quatsch nicht noch einmal. Bringt doch nichts.«
»Komm, wasch dich und geh nach Hause. Für eine neue Hose gebe ich dir Geld. Ich möchte nicht, dass du daheim Ärger bekommst.«
»Sie müssen das nicht tun. Ist echt nicht nötig«, beteuert sie und öffnet den Wasserhahn. »Ich weiche es kurz in kaltes Wasser ein und keiner merkt etwas.«
»Wie nie einer etwas mitbekommt?«
Josi reagiert nicht, beugt sich stattdessen über das Waschbecken und reinigt die blutverklebten Hände.
»Melde dich, wenn du Hilfe brauchst«, ergänze ich mehrdeutig, lege meine flache Hand auf ihren gebeugten Rücken und fahre vorsichtig darüber. »Gleichgültig welche.«
Nach und nach löst sich die gaffende Menge vor der Toilettentür auf. Hier gibt es nichts mehr zu sehen. Den Schülern scheint Lisas Schicksal einerlei. Die meisten glauben ohnehin Eugen. Dem Lieblingsschüler, dem Schönling, dem Lackaffen ohne jegliches Selbstbewusstsein. Derzeit erzählt er allen ungefragt seine erlogene Variante, die Lisa als käufliches Mädchen darstellt und sich angeblich mit allerlei Lügengeschichten an ihm rächt.
Vor Zorn über die derzeitige Situation bebend finde ich mich an der geöffneten Tür des Lehrerzimmers wieder. Entsetzt sehen mich die anwesenden Pädagogen an. Die Mehrheit hat gestern in der Sitzung dafür plädiert, dass dieses ›liederliche Mädchen‹ besser die Schule verlässt, damit endlich wieder Ruhe einkehrt. So schnell es geht.
Stinkwut arbeitet sich empor. Unaufhaltsam windet sie sich mehrmals kreisend durch meinen Körper. Kurz darauf brennt es dämonisch in meiner Kehle.
»Sie ist sechzehn!«
Entgeistert werde ich angestarrt, weil ich schreie. Unvermittelt entladen sich alle unterdrückten Emotionen, sobald ich an mir hinabsehe. Alles an mir ist voller Blut.
Wie damals.
Völlig außer mir kreische ich immer. Ich schreie so laut ich kann, dass Lisa verdammt noch eins erst sechzehn Jahre alt ist. Uns Lehrer trifft eine Mitschuld, aus der wir uns nicht einfach winden können.
Schemenhaft und von meinen Tränen verschleiert, taucht Reino vor mir auf. Er drängt mich aus dem Lehrerzimmer. »Alles gut, Mara. Alles gut. Bitte atme einmal tief durch. Wir beide gehen jetzt das Blut abwaschen, das überall an dir klebt, in Ordnung?«
Mechanisch folge ich und blende die verständnislos dreinblickende Lehrerschaft aus. In der Damentoilette lehnt Reino mich gegen ein Waschbecken und reinigt meine blutroten Hände unter dem Wasserhahn.
Das Wasser, das in den Abfluss rinnt, färbt sich dunkelrot. Noch immer bebe ich entrüstet über die Feigheit der Kollegen und bekomme meinen Körper nicht unter Kontrolle.
»Du stehst unter Schock. Atme ruhig ein und aus. Genau so. Gut. Beuge dich bitte einmal kurz vor.«
In seiner Hand sammelt er Wasser, womit er behutsam mein Gesicht reinigt. Alles führt er zärtlich besorgt aus und besänftigt mich augenblicklich. Er stellt sich vor mich und entnimmt dem Spender mehrere Papierhandtücher.
Aus weiter Ferne beobachte ich ihn. Ich fühle mich innerlich taub und wehr mich nicht gegen seine Zuwendung. Dafür fehlt mir die Zeit. Flashbacks plagen mich. In Trance durchlebe ich noch einmal, wie mich der unwirkliche Schatten aufhebt, die Treppe hinaufträgt und ich blutüberströmt erwache. Mich vor entsetzlichen Schmerzen windend und nicht erfassen könnend, was mit mir geschehen ist.
Ich sehe an Reino vorbei an die Wand der Mädchentoilette. Das muss ich, um mich vor meinen eigenen Geistern zu retten. Wenngleich er genau vor mir steht, höre ich nicht genau, was er sagt, spüre lediglich, wie fürsorglich er mich umhegt.
»Manchmal schrecke ich nachts schreiend auf. Du sitzt nicht mehr im Sessel, um auf mich aufzupassen. Dann fällt mir ein, dass ich dir nie dafür … Manchmal überlege ich, ob ich nach all den Jahren meinen Dank überhaupt noch in Worte fassen kann. Ehrlich, ich überlege häufig, es dir einfach zu sagen. Nur, damit es endlich raus ist.«
Reino hält inne und mustert mich. Schweigend tupft er meine Wangen trocken. Sein Gesichtsausdruck verrät, wie sehr ihn meine Worte bewegen.
»Du musst nichts sagen. Ich lese alles in deinen Augen.«
»Du liest in meinen Augen?«
»Was glaubst du? Wie lange kennen wir uns inzwischen, Mara?«
»Über zwanzig Jahre. Davon sieben Jahre und neun Monate mit Unterbrechung …«
»Sieben Jahre und neun Monate? Du hast die Monate gezählt?«
»Ja, und auch die acht Tage. Die Minuten rechne ich gerne nach. Was siehst du mich so komisch an?«
»Du zählst sogar die Minuten?«
»Nein, ich bin doch kein Freak.«
»Nein, du bist alles, aber gewiss kein Freak. Jetzt erzähle mir, was dich wütend macht.«
»Ich habe Lisa vorhin fortgeschickt, obwohl sie … Ich kann es ihr nicht sagen, kann es nicht und das erinnert mich an …«, hauche ich nach einer Weile erstickt.
Ich suche Trost in seinen dunklen Augen, die mich mitfühlend betrachten. Reino macht das, was er immer macht, wenn es mir mies geht. Er ist zur Stelle und zieht mich behutsam in seine Arme. Ich lasse mich sinken und lande daunenweich an seiner Schulter.
Eine Wohltat.
Diese herrliche Stille …
»Du bist nicht diejenige, die ihr etwas Derartiges erklären muss. Das soll schön die Gerbauer übernehmen«, tröstet er mich, während er sanft meinen Rücken streichelt, um mich zur Ruhe zu bringen.
Tonlos widerspreche ich: »Aber sie hat mich gefragt, nicht die kaltherzige Gerbauer.«
In seiner freundschaftlichen Umarmung dürfen Tränen rollen. Zumindest, bis sich die Tür öffnet und die grauhaarige Schulleiterin im Türrahmen erscheint.
Frau Gerbauer.
Kraftlos löse ich mich von Reino und wische keine einzige Träne von den Wangen. Die Rektorin sieht flüchtig an mir herab, als wäre ich ein lästiges, widerwärtiges Insekt. Meine gelbe Bluse trieft blutrot von jenem Unglück, was sie mit einer hochgezogenen Augenbraue moniert. In ihrem Blick liegt eine Erbarmungslosigkeit, die ich noch nie ertragen konnte und vermutlich der Grund meiner Antipathie ist.
»Sie ist sechzehn«, wiederhole ich meinen Vorwurf, der diesmal nicht der Lehrerschaft, sondern ihr gilt.
»Das steht in ihrer Schülerakte. Diese Tatsache haben Sie ausgezeichnet recherchiert, Frau Weigert«, antwortet sie unterkühlt. »Nehmen Sie sich Urlaub oder gehen Sie zu einem Arzt. Ich möchte Sie ungern in diesem kopflosen Zustand im Gebäude antreffen. Zumal Sie unnötigen Tumult verursachen. Reißen Sie sich gefälligst zusammen, Mensch.«
Ich gehe einen Schritt auf sie zu, weil sich bei ihrem Anblick mein verborgener Groll erneut den Weg an die Oberfläche bahnt. »Lisa Barthold ist sechzehn Jahre alt«, schreie ich mit letzter Kraft, was selbst in meinen Ohren schmerzt. Der Schall in diesem kahlen Toilettenraum ist unfassbar laut.
»Und Sie? Wie alt waren Sie?«
Schnellstens stürme ich auf sie zu. Ich will ihr die abgestumpft dreinblickenden Augen auskratzen oder ihr das kalte Herz aus dem Brustkorb reißen. Gleichgültig, was. Hauptsache ist, ich erwische irgendetwas von dieser Eiskönigin. Den hochmütigen Blick, die beißende, höhnende Art und ihren erbarmungslosen Charakter kann ich keine Sekunde länger ertragen.
Energisch zieht Reino mich von ihr fort, während ich mich zu dieser Eiskönigin vorarbeite. Mit einem geschickten Griff befördert er mich in die nächstgelegene Ecke und verdeckt die Sicht auf meine Vorgesetzte.
»Um Gottes willen! Bringen Sie Frau Weigert nach Hause, Herr von Borstel. Bevor hier noch ein weiterer Rettungswagen kommen muss. Sie erscheint mir heute gänzlich nervenschwach. Ganz nebenbei bemerkt sieht Ihr Hemd ebenfalls desaströs aus. Nehmen Sie sich beide den Nachmittag frei.«
An seinem hellgrauen Baumwollhemd klebt Lisas Blut. Gewaltsam bringt er mich von ihr ab und beschmutzt sich zeitgleich an mir. Anstatt seine Bemühungen zu würdigen, verhöhnt sie ihn und ohrfeigt uns beide damit.
Kapitel 2
Reino telefoniert. Mit meinem Freund Daniel, der sich am anderen Ende der Telefonleitung sorgt, nachdem er erfährt, was in der Schule passiert ist. Ich sitze daneben, rege mich aber nicht. Dazu fühle ich mich zu ausgelaugt.
»Mara ist bei mir«, erklärt er meinem Freund. »Nein, ich lasse sie auf keinen Fall allein. Ja, sie hat einen Schock erlitten. Ja klar, sagt das der Arzt und hat sie krankgeschrieben. Bringst du frische Klamotten mit, wenn du zum Abendessen kommst? Lidia hat ihr ein Shirt geliehen, möchte es aber gerne zurück. Alles klar, bis nachher.«
Das schnurlose Telefon landet auf der Sitzfläche der rot gestrichenen Gartenbank, die sich deutlich vom Grün der Umgebung abhebt. Schwerfällig strafft sich Reino und schnieft verdrießlich. Er empfindet Daniels Charakter mitunter als strapaziös, was ihm jetzt überdeutlich ins Gesicht geschrieben steht.
Wir sitzen im Garten seines Reihenhauses auf der Holzbank, die er vor Jahren mit Andy zusammengebaut hat. Andy ist mein mittlerweile erwachsener Sohn. Wochenlang haben beide gesägt, geschraubt und gebohrt. Und das in der glühenden Sommerhitze. Eine Grillparty hat das Sommerferienprojekt eingeweiht. Seitdem sitzt er gerne hier und schaut entspannt zu dem, was Lidia im Garten pflanzt und aktuell in allerlei prächtigen Farben erblüht.
Vom Straßenlärm der Hauptstraße, die ganz in der Nähe verläuft, hören wir nichts. Bei Feierabendverkehr gelangen Menschen nur schwer über die quirlige Hauptstraße. Hier hingegen trällern Spatzen in den Baumkronen, die einen Teil des Gartens beschatten. Durch die geschwungen angelegten Blumenbeete fährt der warme Wind. Der ebenfalls geschwungene Weg lädt zum Flanieren ein, um im hinteren Teil mehr zu entdecken.
Die Sonne steht hoch. Kleine, fluffige Wolken ziehen schleppend über den Himmel und spenden gelegentlich Schatten. Für Ende April sind die Temperaturen ungewöhnlich drückend.
Mein Blick klebt an dem rot gestrichenen Gartenhaus, das am Ende des Grundstücks steht. »Erinnerst du dich daran, wie wir es gestrichen haben?«
Reinos Blick gleitet zum Ende des hübschen Gartens. »Hin und wieder.«
»Andy wollte dir unbedingt helfen und sich Taschengeld verdienen«, murmele ich mit vielen schönen Bildern vor dem geistigen Auge und lache unterdrückt.
Mein Sohn wollte unbedingt die unteren fünfzig Zentimeter streichen, doch der Sommer ist glutheiß gewesen, dass er nach zehn Minuten zerknirscht aufgegeben hat. Dennoch hat Reino ihm das vereinbarte Geld gegeben, obwohl er den ganzen Tag keinen einzigen Handschlag getan hat und klugerweise im erfrischenden Poolwasser hocken geblieben ist.
Mit Alex, der geschiedenen Frau von Reino.
Nach getaner Arbeit sind wir übermütig hineingesprungen, bis das Wasser in alle Richtungen geplatscht ist. Andy und Alex sind geflüchtet, weil wir gelärmt, gelacht und uns ausgelassen mit Wasser bespritzt haben.
»Der Sommer war paradiesisch. Von dem Geld wollte Andy sein erstes Mikrofon kaufen. Mit sieben Jahren stell dir vor«, sinniere ich im Flüsterton und denke an die fantastischen, gemeinsamen Stunden.
»Schon damals hatte er etwas sehr Besonderes in der Stimme. Ist er zu Besuch?«
»Ja, er kommt für ein verlängertes Wochenende, weil er hier in Leipzig ein paar Gigs klarmachen möchte.«
»Großartig, aber du redest schon wie er. Gigs! Gehen wir hin, wenn er sie bekommt?«
»Logisch. Das letzte Mal hatten wir einen Mordsspaß.«
Ich erinnere mich an den Konzertsaal mit der Galerie, den riesigen Discokugeln und der hohen Decke mit den Holzgebälk, die mich an eine Dorfkirche in Brandenburg erinnert. An den Lounge-Charakter mit den urigen Chesterfield-Ledersofas und der lila Karo-Tapete, die bei zu langem Betrachten Sinnestäuschungen hervorruft. An den wummernden Bass, der durch den Körper fährt, im Magen und Herz hämmert, bis ich mich ergebe und loslasse. Eins werde mit dem Song …
»Wir?«
»Ja, wir. Auch, wenn du beschwipst peinliche Sachen veranstaltet hast«, weise ich ihn schmunzelnd zurecht.
»Gib den Dingen bloß keine Spitznamen. Ich war sternhagelvoll.«
Versonnen und in dieser schönen Erinnerung gefangen, lächele ich und lege den Kopf zurück, um den Himmel eingehender zu betrachten. »Wir waren jung und brauchten das Geld.«
Reino hat auf dem Heimweg jeden Passanten wegen ein paar Euro angebettelt, der uns zufällig begegnet ist. Mir ist das entsetzlich unangenehm gewesen, weil wir das Geld gar nicht nötig gehabt haben, um nach Hause zu gelangen.
An jenem Abend habe ich das erste Mal seit Wochen gelacht, mich leicht und unbeschwert gefühlt. Seitdem unternehme ich in meiner Freizeit mehr mit Reino, als mit meinem Freund und ignoriere noch heute alle Streitigkeiten, die diese Tatsache links und rechts des Weges heraufbeschwört.
Neben mir bewegt sich die Sitzfläche der Bank, denn er lacht und wippt dabei vor und zurück. Vermutlich erinnert er sich an jenen Frühlingsabend, an dem er mich, aus einem tiefen Loch geholt hat, ohne es zu vermuten.
»Die Trennung von Alex hat dir damals schrecklich zugesetzt«, murmele ich, »und es ging dir miserabel. Mich hatte eine Depressionsphase nach unten gedrückt.«
»Zum Glück liegt es lange zurück.«
Bis heute weiß ich nicht konkret, was damals zwischen ihm und Alex vorgefallen ist. Da er über die schmerzliche Phase seiner Scheidung nicht gerne spricht, dringe ich auch heute nicht in ihn ein. Stattdessen hebe ich das Wasserglas an meinen Mund und schlürfe das erfrischende Getränk, welches Lidia mir vorhin gereicht hat. Sie hat Eiswürfel und ein dekoratives Blatt Pfefferminze in das Wasser getan und es mir mit einem sorgenvollen Gesichtsausdruck ausgehändigt.
Mir gegenüber verhält sich Lidia größtenteils reserviert, obwohl sie aus dem gastfreundlichen Polen stammt. Die unterkühlte Schönheit mit dem stählernen Blick verfolgt unsere Freundschaft misstrauischer als Reinos geschiedene Frau.
Der sinnliche Mund liegt schnippisch unter der schmalen Nase und passt perfekt zum spitzen Kinn. Ab und zu posiert sie für Modezeitschriften, ist damit erfolgreich und wird oft gebucht. Ich beneide ihr weiches, langes und blondes Haar. Gelegentlich bewundere ich es ungeniert und frage mich, woher sie die Zeit nimmt, um sich täglich aufwendig zu frisieren.
Ihre himmelblauen Augen erscheinen mir ablehnend und berechnend, was durch einen Blick verstärkt wird, der von unten nach oben geht. Heute wirkt er obendrein verdrossen. Vermutlich störe ich mit meiner verfrühten Anwesenheit ihren häuslichen Ablauf, obwohl sie bereits halb aus dem Haus ausgezogen ist. Mit einem Auge linse ich zur Terrassentür, wo sie geschäftig umherläuft und missmutig zu uns äugt.
»Hast du sie auch eingeladen?«
»Sie möchte unbedingt ein Reh zubereiten, weil sie gehört hat, dass ihr beide zum Essen kommt. Ich habe nicht wirklich ernsthaften Protest eingelegt. Fühle mich dafür zu müde.«
Entsetzt starre ich ihn an, denn ein süßes Reh mit riesigen, braunen Kulleraugen, esse ich definitiv nicht. Er weiß es und betont deshalb das ›Reh‹ absichtlich gedehnt.
»Dein Gesicht spricht jetzt Bände, Mara«, raunt er und legt aufmunternd seinen Arm um meine Schulter. »Wir überstehen den Abend, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, oder? Zur Belohnung sehen wir uns irgendwann den Trickfilm an und sehen Bambi dort quietschfidel über saftige Wiesen hopsen.«
»Hätte Daniel doch bloß nicht erwähnt, dass er gerne einmal Wild probieren würde. Ich gebe mir echt große Mühe, ihm gelegentlich ein Steak zu braten, obwohl es mich anekelt«, gebe ich zu denken. »Stell dir vor, er will tatsächlich ein süßes Bambi essen. Das geht gar nicht. Ich wünschte, du hättest Lidia nicht erzählt, dass wir heute Abend kommen. Entschuldige, ich … es ist dein Haus. Aber mal ehrlich, ein süßes, kleines Reh essen?«
»Sofern du nicht auf unsere Teller siehst, könnte es ein unterhaltsamer Abend werden.«
»Stell genug süffigen Wein auf den Tisch, damit wir ihn alle überleben«, entgegne ich spöttisch. »Dann betrinke ich mich heftig und brauche zudem keine Entscheidungen bezüglich meiner Beziehung zu treffen. Wie praktisch das wäre. Und wie kindisch. Seit einigen Wochen schläft er im Atelier, was sich mehr nach Single anfühlt als nach einer funktionierenden und soliden Beziehung.«
»Vor wenigen Wochen erst hast du betont, dass dich alles beklemmen, erdrücken und belasten würde. Da sollte dir der neue Status doch eigentlich gelegen kommen. Daniel reagiert, wie er dauernd reagiert. Frustriert. Wundert es dich ernsthaft?«
»Nein, aber offensichtlich liegt darin die Ironie des Schicksals. Ist er hier, wünsche ich ihn fort. Ist er dort, möchte ich ihn bei mir haben. Und dann die Sache mit dem Heiratsantrag … Du weißt doch, wie schnell ich da die Beine in die Hand nehme. Wie läuft es bei euch?«
Reino seufzt und betrachtet seine Hand, deren Finger sich aneinander reiben. »Ich verliere den Faden. Manchmal fühle ich mich erleichtert, wenn sie woanders übernachtet. Kurioserweise schlafe ich in diesen Nächten wesentlich besser.«
»Mich stimmt es traurig, wenn du so sprichst. Und zudem bedeutet es, dass uns ein richtig gemütlicher Abend bevorsteht.«
»Keine Sorge. Ich habe genug süffigen Wein gekauft«, tröstet er feixend und legt damit abermals seine entzückende Lachfalte frei.
»Lass uns unauffällig zur nächstgelegenen Parkbank durchbrennen. Da können sich beide allein mit dem gebrutzelten Bambi amüsieren.«
Reino neigt das Gesicht, um mich besser ansehen zu können. »Rede ruhig weiter, am Ende brenne ich noch mit dir durch.«
Ich lehne mich gegen seine Schulter und fühle mich sofort friedlicher, weil er den Vorschlag zumindest in Erwägung zieht. »Gut, im Notfall brennen wir zur nächstgelegenen Parkbank durch. Ich höre mir auch jede deiner schmalzigen Möchtegern-Reden an«, versichere ich.
Reino bekommt einen kolossalen Lachanfall, der ewig nicht endet. Hinter uns dringen Geräusche aus der Küche. Bestens gelaunt und beschwingt, bereitet Lidia das Abendessen vor. Irgendwann ruft sie ihn zu sich, weil es an der Zeit ist, den Tisch einzudecken.
Geschäftig klacken ihre Absätze auf den Bodenfliesen, wenn sie sich in der halb offenen Küche bewegt. Sie gibt ihm Anweisungen, wie er die Servietten falten soll, wo das Wasserglas zu stehen hat, wie er die Blumendekoration wirkungsvoll drapiert. Geduldig führt er alle Arbeiten aus und lächelt ihre Nervosität charmant fort.
Denkbar wäre auch, dass er bereits unseren Fluchtweg plant.
In der Zwischenzeit genieße ich die Stille des Gartens und das saftige Grün. Ich verdränge das Bild von der weinenden Lisa, die sich auf dem schmutzigen Boden der Toilette windet.
Der Türgong ertönt. Danach höre ich Absätze, die klackern, weil jemand zur Tür huscht.
»Hallo Daniel«, begrüßt die polnische Schönheit ihn überschwänglich und schmatzt drei laute Küsse auf seine Wange.
Daniel und Lidia verstehen sich phänomenal. Im Gegensatz zu mir wurde er überraschend schnell mit ihr warm.
»Lidia, Maus, du siehst heute Abend wieder einmal hinreißend aus. Schick, schick, schick. Hm, das riecht exzellent und mir läuft direkt das Wasser im Mund zusammen. Was kochst du denn für uns? Nein, warte! Lass dich vorher kurz drücken.«
Albern kichert sie und murmelt dankbare Wörter für das unverblümte Kompliment. Ich senke meinen Blick, bleibe aber sitzen, obwohl ich höre, dass mein Freund eintrifft. Geistesabwesend tauche ich meinen Zeigefinger in das Wasser und fahre pausenlos den Rand des Glases entlang.
Reino begrüßt er um einiges sachlicher, was mich nicht wirklich verwundert. Freundlich erkundigt sich Daniel nach dem Befinden und tauscht einige Nettigkeiten aus, bevor er sich lautlos der Gartenbank nähert.
»Hallo Maus«, flötet er lieblich, nachdem er sich gesetzt hat. Zärtlich berühren seine Lippen meine Wange. Ein scheues Lächeln umspielt seinen Mund, als wäre er in mich verliebt.
Der Streit von gestern Abend steckt noch wie eine lästige Zecke in meiner Haut und verseucht mit ihrem infektiösen Speichel das Blut in meinen Venen. Ich fühle mich unzufrieden, weil wir zu keinem Ergebnis gekommen sind. Abgesehen davon erreichen wir in letzter Zeit immer weniger Ergebnisse.
Ein riesengroßer Berg mit unerledigten Dingen stapelt sich inzwischen vor unserer Haustür.
Jede meiner Beziehungen endet absehbar und erwartungsgemäß, womit es mich nach all diesen Gleichnissen beinahe nicht mehr berührt. Kampflos mag ich andererseits nicht aufgeben. Doch allein kämpfen, wo vereinte Kräfte vonnöten sind, vermag ich ebenso wenig.
Eine Tüte aus Papier raschelt. »Ich habe dir was zum Anziehen mitgebracht. Was ist passiert?«
Ich mustere das schmale Gesicht, in dem neuerdings ein Hauch Widerstreben liegt, wenn er mich anschaut. Oder bilde ich es mir lediglich ein? Wäre es anders, würde sich gewiss kein Berg vor unserer Haustür türmen und er hätte sich keine andere Frau in das Atelier eingeladen, sondern mich.
Mit meinen Ängsten und Schatten lebt es sich nicht unkompliziert. Das weiß ich. Höchstwahrscheinlich verlässt ihn die Kraft, merke ich in diesem Augenblick. Ich überfordere ihn mit meinen Problemen, die sich nach all den Jahren noch immer nicht in Luft auflösen.
Unerbittlich fressen sich fiese, hinterhältige Gewissenswürmer durch mein Herz und nagen es seit Jahren an. Dennoch fällt es mir leichter, Männerherzen loszulassen, statt ernsthaft gegen die monströsen Schatten anzukämpfen und sie dauerhaft zu vertreiben.
»Ich fühle mich Schuld an meinem und deinem Dilemma, aber schau mich bitte nicht so vorwurfsvoll an.« Erschöpft hauche ich diesen Satz und meine jedes Wort vollkommen ehrlich.
»Na, dann …«, brummt er, klatscht mit der flachen Hand auf die Hose und erhebt sich.
Durch die gefühlskalte Art gekränkt, trinke ich einen Schluck Wasser, während er in das Haus trottet. Es brennt furchtbar im Herzen und ich würde am liebsten meine Haare raufen.
»Ja, geh nur, aber danke für die Nachfrage«, murmele ich.
Im Haus angekommen, stellt er sich neben Lidia an den Herd. Schamlos neckt er sie, um mich aus der Reserve zu locken. Er schaut über ihre Schulter zu, wie sie Soße eindickt. Gekonnt blendet er unser Debakel aus.
Andachtsvoll rührt sie die Bratensoße und kichert nervös, weil er sich dicht an sie drängt. Reino, der auf der Terrasse gedankenversunken die letzten Details der Tischdekoration überprüft, tut so, als würde er es nicht bemerken. Eine Weile beobachte ich, wie er die Gläser mit Mineralwasser aus Frankreich füllt.
Wie macht er das? Ich meine, beide derart gekonnt auszublenden.
»Ich decke heute den Tisch auf der Terrasse«, erklärt er, ohne aufzusehen.
»Das sieht sehr gemütlich aus«, lobe ich und nähere mich dem Tisch.
»Ihr sollt euch wohlfühlen.«
»Wir fühlen uns immer bei euch wohl.«
»Danke«, antwortet er, lächelt und schaut noch immer nicht auf. In seine Arbeit vertieft, merkt er nicht, wie ich mit der Tüte zum Badezimmer gehe, um mich umzuziehen.
Im Vorbeigehen wirft Daniel mir einen feurigen Blick zu. Der Zeigefinger steckt lasziv in seinem Mund, weil er von der Soße kostet.
In der großzügig angelegten Diele biege ich links zur Gästetoilette ab. Reinos Büro grenzt direkt daran. Die Tür steht offen und gibt den Blick auf seinen Schreibtisch frei.
Der steht unter einem riesigen Fenster, welches nach Nordosten zeigt. Auf dem Fensterbrett stehen, neben liebevoll gepflegten Blumen, mehrere Bilderrahmen. Auf den meisten lächelt er mit Lidia in die Kamera.
Eines zeigt Andy und mich.
Der Schnappschuss ist in einem der vielen Sommerprojekte entstanden, an die sich Andy noch immer schwärmend erinnert. Damals hat er sich eine Theateraufführung gewünscht. Unter seiner Anleitung haben wir eine Woche ein Stück von Shakespeare eingeübt. Was ihr wollt wurde in unserer Version niemals auf einer großen Bühne aufgeführt, aber wir haben unaufhörlich gelacht.
Ich schließe mich im Gästebad ein. Dort hole ich die mitgebrachten Sachen aus der Tüte und schlüpfe aus den Klamotten von Lidia.
Ungefragt steigen lang verdrängte Bilder in mir auf und verursachen plötzliches Unwohlsein. Mich an die kühle Wand lehnend ringe ich um Atem. Jahrelang sind sie mir verschont geblieben. Seit den neuesten Ereignissen in der Schule drängt alles wieder an die Oberfläche. Schwer atmend setze ich mich auf das Toilettenbecken und beuge mich vornüber, um kräftig Luft zu schöpfen und diese qualvollen Bilder zu vertreiben.
All das Blut …
An der Tür klopft es.
»Alles okay, Mara?«
Alarmiert fahre ich auf und sammele mich. Es ist eindeutig der falsche Zeitpunkt, um den Verstand zu verlieren. Zudem lerne ich in meiner Einzeltherapie, dass ich heute in Sicherheit bin. Mittels Autosuggestion übe ich bienenfleißig, dieses Sicherheitsgefühl gezielt zu verstärken, um damit weiterhin die Einnahme von gewissen Tabletten zu vermeiden.
Ich bin in Sicherheit …
Es liegt einundzwanzig Jahre zurück …
»Alles okay bei mir«, bringe ich japsend hervor und ersetze unter enormen Anstrengungen die unschönen Bilder durch angenehme und positive Suggestionen.
Ich atme aus. Wolken formieren sich. Je mehr ich puste, desto schneller ziehen sie davon. Ich erkenne einen wunderschönen Sonnenuntergang. Oranges Licht. Ein weiter, wolkenloser Himmel. Weiches Gras unter mir. In meinen Händen ein Gänseblümchen …
»Ich hole Holz für den Kamin. Essen ist fertig.«
»Okay«, presse ich angestrengt hervor und stelle mich vor den Spiegel.
Ich sehe eine Frau Mitte vierzig. Sie atmet flach. Meine braunen Augen suchen verzweifelt Halt. Die glatten, braunen Haare, die in der Sonne leicht rötlich schimmern, habe ich am Hinterkopf zu einem lässigen Knoten gewunden. Sommersprossen um die Nase und auf den Wangenknochen lenken den Blick auf die großen und von langen Wimpern umgebenen Augen, die ich dezent schminke.
Ich betrachte den gleichmäßig proportionierten Mund und verziehe ihn spaßeshalber. Mein Lächeln passt so gar nicht zu einer strengen Lehrerin, für die ich mich in der Schule gerne ausgebe. Das ist mein perfekt modellierter Schutzpanzer, den ich mir jahrelang und mühsam aufgebaut habe.
Auch privat.
Innerlich fühle ich mich jedoch schlabberig wie Wackelpudding.
Ich verstehe, dass Daniel es zum Kotzen findet, sich ständig ergebnislos an diesem harten Panzer abzuarbeiten. Schließlich scheitert kein Mann gerne an einer Frau, die ihr Herz ohne Vorwarnung und Angaben von Gründen regelmäßig und unvorhersehbar verschließt. Der resignierte Blick in seinen Augen verschlimmert meine Not regelmäßig, weil ich mich verantwortlich fühle. Und schuldig. Dadurch öffne ich mich immer weniger und verschließe mich stattdessen immer mehr.
Es ist ein elender Teufelskreis.
Mit meinen Händen fange ich Wasser auf und erfrische das abgespannt wirkende Gesicht. Geräuschlos öffne ich danach die Tür und husche durch den behaglich eingerichteten Wohnbereich zur Terrasse.
Im Wohnzimmer angekommen, nehme ich wahr, wie Daniel sich vertraulich an Lidia lehnt. Beide kichern nicht mehr. Behaglich windet sie sich, weil er etwas in ihr Ohr flüstert.
Geräuschvoll fallen Holzscheite zu Boden. Ich fahre zusammen. Augenblicklich straffen sich die beiden und gehen irgendwelchen Aufgaben nach.
Angewidert wende ich mich ab. Reino entzündet mit einem entspannten Gesichtsausdruck die Kerzen, die er vorschriftsmäßig und dekorativ in Bodenvasen arrangiert hat. Genauso, wie es sich seine Freundin gewünscht hat.
Er schaut nur kurz zu den beiden Turtelnden und stapelt hinterher Holz vor dem Kamin, der vom Wohnzimmer und der Terrasse befeuert werden kann. »Siehst du den Leibhaftigen oder warum schaust du mich an, als wäre ich es?«
Abwesend schüttele ich meinen Kopf und trotte, gelassen zum liebevoll gedeckten Tisch.
»Alle vollzählig? Nun denn, ich habe einen Mordshunger«, trällert Daniel aufgekratzt und kommt hastig herangeeilt, um sich neben mich zu setzen.
Zufrieden besieht sich Reino die eben entzündeten Kerzen, rückt einige zurecht und geht in das Bad, um sich die Hände zu reinigen. Derweil trägt Lidia das Abendessen auf und ignoriert Daniel, der jede ihrer Bewegungen aufmerksam verfolgt. Seine Augen gleiten an dem eleganten Kleid aus rotem Stoff hinab.
»Das duftet fantastisch.«
Für eine Sekunde huscht ein verlegenes Lächeln über Lidias Lippen. Vor Freude strahlend, weil die Schmeichelei ihre Wirkung nicht verfehlt, gleitet der Blick zu mir. Ich erwäge ernsthaft, mein Frühstück hochzuwürgen. Kratzbürstig aufgelegt, sehe ich in Daniels blaugraue Augen, die mich nonchalant anstrahlen. Das Lächeln auf seinen Lippen wirkt gewinnend und glücklich, täuscht mich jedoch nicht darüber hinweg, dass er ungeniert mit der Freundin meines Freundes schäkert.
»Ziehe nicht so eine Flappe, Tamara. Sei nett, lächele und genieße das großartige Essen.«
Lidia steht seit heute Mittag in der Küche, das honoriere ich. Alles andere nicht. Vor allem nicht das Reh und das, was sich offenbar zwischen ihm und ihr anbahnt. Gekünstelt ziehe ich meine Mundwinkel in die Höhe.
»Meinst du so?«
Teilnahmslos wendet er sich ab und greift zum langen Stiel des Weinglases, in dem der Rotwein seit einer Weile atmet. Die schmalen Finger drehen es regsam. Der dunkelrote Wein schwappt rhythmisch an die Glasinnenwand. Er blendet mich aus, als wäre ich nicht existent.
Reino, der einnehmend lächelt, setzt sich und schaut abwechselnd von mir zu Daniel. »Wie weit bist du mit deiner nächsten Ausstellung? Kommst du gut voran?«
Daniel seufzt. »Geht so. Ich kämpfe noch immer mit einer Blockade.«
»Brauchst du eine neue Muse, um diese Blockade zu überwinden, oder genügt ein gemütliches Abendessen mit Freunden?«
Daniel schlägt die Lider auf, um sekundenschnell Reinos Gesichtszüge zu mustern. Dabei presst er die Lippen fest aufeinander, während die linke Augenbraue nervös zuckt. Der Blick gleitet zu den Fingern, die fieberhaft das Messer auf dem Platzdeckchen hin und her schieben. »Eine neue Muse wäre wahrlich ein Segen, doch woher nehmen, wenn nicht stehlen?«
»Ja, Daniel«, schaltet sich Lidia ein, die würdevoll näher schreitet und den hübsch dekorierten Rehbraten an den Terrassentisch trägt. »Wie wäre es mit einer, die in deinem hübschen Atelier in der Ecke sitzt? Gewissermaßen eine, die dich glücklich und zugetan anlächelt, damit du in Mal-Stimmung kommst?«
Ich höre sehr wohl den aufgekratzten Unterton und setze für einen Konter an, doch Daniel kommt mir zuvor.
»Da habe ich eine spontane Eingebung. Ich nehme dich zur Muse, meine teure Lidia«, schlägt er beflügelt von der albernen Idee vor. »Dein Lächeln fand ich schon immer göttlich. Vorausgesetzt, du sitzt mucksmäuschenstill da, inspirierst du mich tausendprozentig und es sprudelt nur so aus mir heraus. Darf ich mir deine Freundin kurz ausleihen, Reino?«
Lidias Wangen röten sich, während sie sich neben Reino setzt und keusch ihre Lider senkt. »Ach, ich bin nur eine langweilige Hausfrau. Einen talentierten Künstler, wie du einer bist, inspiriere ich gewiss nicht.«
Daniel beugt sich weit über den Tisch. »Du stellst dein Licht klein, Lidia. ›Nur eine Hausfrau‹. Das finde ich alles andere als langweilig oder nur.«
Reino stützt seine Ellenbogen auf den Tisch ab, was Lidia partout nicht schätzt. Ihr bestimmter und verärgerter Blick verrät es eindeutig.
»Du stehst also auf Hausfrauen?«, erkundigt sich Reino dessen ungeachtet.
Meine Hand greift zum Weinglas, denn ich möchte den verheißungsvoll duftenden Inhalt mit einem Zug austrinken. Der lustige, unterhaltsame Abend nimmt seinen schicksalhaften Lauf. Darauf trinke ich.
Zum Wohl.
Daniel antwortet mit einer Gegenfrage: »Du etwa nicht?«
»Ich schon, doch heutzutage schätzt kaum jemand die strapaziöse Hausarbeit. Ich finde es nobel, dass dich meine Freundin stimuliert und du sie ernsthaft als Inspirationsquelle erwägst. Du darfst sie dir gerne ausleihen und musst mich nicht fragen. Sie ist alt genug, um zu entscheiden, für wen sie modelt. Macht ihr das unter euch aus.«
»Fein, fein. So sei es. Hörst du, Süße? Wir haben seinen Segen. Du bist ab sofort meine neue Muse. Mich stimuliert momentan viel zu wenig und die Firma dankt für dein großzügiges Angebot, Reino. Kommst du bei Gelegenheit in mein Atelier, Lidia? Übrigens, exzellenter Wein«, säuselt er süßlich und lehnt sich mit dem Oberkörper lässig gegen die Stuhllehne.
Ich hebe mein Glas an. »Na, darauf trinken wir. Nichts inspiriert den Künstler mehr als ein paar Promille eines vorzüglichen Weines und eine neue Inspirationsquelle.«
Daniel versteht die Botschaft und wirft mir einen verstimmten Blick zu, während ich ihn honigsüß anlächele.
»Auf Lidia, die neue Muse des Künstlergenies. Danke für eure Einladung«, säusele ich zuckersüß und wende mich an die Gastgeberin, die vornehm ihr Glas hebt und sich förmlich zwingt, mich anzulächeln.
»Auf einen gemütlichen Abend.«
Vornehm nippt sie an dem Wein. Ich hingegen gönne mir einen kräftigen Schluck, der wohlig warm die Kehle hinabrinnt und rasch von innen wärmt. Genau das brauche ich jetzt.
»In der Schule gab es heute eine Tragödie, wie ich höre«, berichtet Lidia und erhebt sich umständlich, um unsere Teller zu belegen. Ein Stück Rehfleisch landet mittig auf einem weißen Teller. »Reino hat vorhin erzählt, dass sich ein Mädchen in der Toilette die Pulsadern aufschneiden wollte.«
»Sie wollte sie nicht aufschneiden, sie hat sie sich aufgeschnitten«, korrigiere ich ein nicht ganz unwesentliches Detail.
»Quer?«
Daniel fragt mit wissbegierig aufgerissenen Augen und den Rotwein kostend. Es schaut weit mehr als abschätzig aus, wofür ich ihn momentan echt zum Kotzen finde. Lidia legt ihm ein riesiges Fleischstück auf den Teller, während empört Atemluft aus ihren Lungen entweicht. Niemand am Tisch lacht über diese blödsinnige Frage.
Schweigend zerteilt Reino das Kartoffelgratin in der Auflaufform und bietet es mir an. Dankend rücke ich meinen Teller näher heran, den er großzügig belegt.
»Darüber zu witzeln, finde ich keineswegs unterhaltsam, Daniel«, weist Lidia ihn zurecht. »Egal, wie man es nimmt. Ich finde es entsetzlich, wenn sie offenbar keinen anderen Ausweg weiß als diesen. Wie schrecklich ich so etwas finde. Einfach schlimm.«
»Lernen eure Schüler im Biologieunterricht denn nicht, dass die Pulsadern längs verlaufen und nicht quer?«, stichelt Daniel und hält Reino den Teller für eine Portion Gratin entgegen.
Neben Ethik unterrichte ich Biologie. Diesen Seitenhieb quittiere ich daher mit einem strafenden Blick auf mein temporäres Künstlerarschloch, das Daniel gerne in der Öffentlichkeit heraushängen lässt.
»Erfrage ich bei der Kollegin, die Biologie unterrichtet«, entgegnet Reino emotionslos und legt das Gratin auf Daniels Teller ab.
Die Übelkeit breitet sich in meiner Magengegend aus, weil auf dem Teller Fleischsaft aus den Poren des Bambis fließt. Mit dem Zeigefinger wiegelt Daniel ab, sobald ihm die Portion Kartoffelgratin genügt. Reino geht zum Außenkamin, auf dem er Aubergine und Zucchini für mich röstet. Mit einem Teller serviert er die knusprig gegrillten und köstlich duftenden Scheiben, stellt den Rest auf den Esstisch und setzt sich.
»Das ist mal wieder typisch für unser marodes Schulsystem. Die Kids lernen nichts Praktisches oder Verwendbares für ihr Leben«, stänkert Daniel.
»Lasst es euch schmecken. Behagt dir der Wein, Tamara?« Geschickt lenkt Lidia vom Thema ab, nimmt ihr Besteck auf und übergeht damit seinen Angriff auf mich.
»Ich weiß nicht. Manchmal erinnerst du mich eher an einen Affenarsch als an einen begnadeten Künstler«, murmelt Reino und äugt zum Angesprochenen, der bei dieser Kritik gedehnt ausatmet.
»So sind wir Künstler nun einmal. Freigeister, Affenärsche und allesamt idealistische Idioten, die gelegentlich reizvollen Musen verfallen.«
»Du übertreibst maßlos«, kichert Lidia und rekelt sich unbehaglich auf ihrem Stuhl.
»Finde ich auch«, merke ich kühl an und schiebe mir eine gehörige Portion des köstlichen Gratins in den Mund.
»Sonst sagst du immer, ich wäre in der Öffentlichkeit geltungssüchtig. Ist alles in Ordnung mit dir?«
Aus dem Augenwinkel bemerke ich, wie er mich aufmerksam mustert. Langsam wende ich meinen Kopf und schaue lange in das Gesicht des mir fremd gewordenen Mannes.
»Wer sind Sie, wenn ich fragen darf?«
Reino füllt mein Weinglas und kichert. Betreten beäugt Daniel mein Gesicht, bevor er näher rückt, um mich auf den Mundwinkel zu küssen. »Ihr liebender, langjähriger Gefährte, Frau Weigert«, haucht er heiser und legt sanft seine Lippen auf meine. »Ich bin nicht geltungssüchtig, sondern extrovertiert.«
»Alles klar«, murmele ich tonlos und weiß, welche Diskussion gleich folgt. »Ich wette, das behauptet jeder Narzisst von sich. Die Schulpsychologin nennt es ›sozial unverträglich‹.«
»Tatsächlich?«
»Genau das sind ihre Worte gewesen.«
»Ich wusste gar nicht, dass du zu einer Schulpsychologin gehst.«
»Gehe ich nicht, sollte ich aber. Um mit ihr über mein Leben an der Seite eines Soziopathen zu besprechen.«
»Du verstehst mich nicht. Ich erkläre dir gern, was ein Soziopath ist …«
Tatsächlich hält er kurz darauf eine ausschweifende Rede über Soziopathen in der Kunstwelt, die Herkunft der Wörter, ihren Sinngehalt und Verwendung im heutigen Sprachgebrauch. Mein Weinglas leert sich in der Zwischenzeit dreimal.
Du lieber Himmel, der Wein ist süffig.
»Sage ihm, dass es sich so verhält, Tamara«, verlangt er am Ende seiner langatmigen Ausführungen.
Nur noch Lidia hängt lauschend an seinen Lippen. Versehentlich stoße ich auf, nachdem ich für einen Kommentar ansetze. Reino lacht sich darüber schlapp. Vergnügt stimme ich ein. Lidias strenger Blick drückt aus, wie sehr sie mich für diese Taktlosigkeit verabscheut.
»Bitte um Entschuldigung. Der Wein schmeckt vorzüglich, Lidia. Er hat das gewisse Etwas im Abgang.«
»Daniel hat ihn mitgebracht«, entgegnet sie frostig.
»Die perfekte Wortwahl, wie ich finde, denn Daniel hat auch das gewisse Extra beim Abgang.«
Herrje!
Ich habe eindeutig ein Glas mehr getrunken als ich vertrage, was mich zu diesen gewagten Äußerungen verleitet. Unsanft knufft Daniel mich in die Seite. Irritiert rücke ich ab.
»Selbstverständlich muss ich fairerweise erwähnen, dass dem Wort ›Abgang‹ mehrere Bedeutungen zugrunde liegen. Darum überlasse ich es eurer Fantasie, in welchem Zusammenhang ihr dieses Wort interpretieren möchtet. Schließlich seid ihr erwachsene und gebildete Menschen … ähm, Soziopathen.«
Hinter der vorgehaltenen Hand kichert Reino, damit nicht versehentlich durchgekautes Reh auf den Teller plumpst und Lidia doch noch wegen unserer ungehobelten Tischmanieren kollabiert.
»Das meine ich nicht«, murmelt Daniel.
»Nein?«
Nachdrücklich schüttelt er seinen Kopf. »Nein, das nicht. Du hörst nie zu.«
»Na gut. Möglicherweise habe ich dir nicht zugehört. Was war deine Frage?«
Ich strecke Lidia mein Glas entgegen. Zögerlich schenkt sie nach und geizt diesmal, was die Menge betrifft.
»Ich habe dir keine Frage gestellt.«
»Aha, da seht ihr es. Er stellt mir keine Fragen mehr, die ich mit ›nein‹ beantworten könnte.«
Betreten schweigt Daniel. Die verbale Ohrfeige landet punktgenau auf seiner Wange und erinnert ihn schmerzlich an den mitleidslos abgelehnten Heiratsantrag.
»Was?«, erkundigt sich Lidia, die auf Schlag nur noch Bahnhof versteht.
Aha, demnach hat er es ihr gegenüber nicht erwähnt. Nun, ich hätte an seiner Stelle diese Information ebenfalls unterschlagen.
»Frage mich etwas anderes«, entgegne ich, winke ab und trinke einen kräftigen Schluck von dem vorzüglichen Seelentröster. »Dein Essen schmeckt wieder einmal hervorragend.«
»Du hast keinen einzigen Bissen angerührt«, entgegnet sie ehrlich betrübt und lässt ihren Blick zu meinem geleerten Teller gleiten.
»Tut mir leid. Ich kann die süßen Rehaugen nicht aus meinem Kopf vertreiben, daher habe ich mich an dein erstklassiges Gratin und Gemüse gehalten.«
»Das hat aber Reino zubereitet.«
»Dann danke ich Reino, für das delikate Mahl. Ich bin randvoll, was durchaus trippeldeutig gemeint ist.«
Erneut werde ich von Daniel in die Seite gepufft. Just in dem Moment, in dem ich zu Reino schaue. Diesmal zwickt der Knuff derart stark, dass Wein auf die weiße und sorgfältig gestärkte Tischdecke kleckert. Durch den Schreck fahre ich blitzschnell vom Stuhl auf, wobei ich noch mehr Rotwein vergieße.
»Oh, ich bitte vielmals um Entschuldigung und hole schnell Salz«, stammele ich gackernd und wackele bedrohlich schwankend in die Küche.
Am Schrank für die Gewürze zerre ich Salz aus dem Fach und eile zurück zum Tisch. Großzügig verstreue ich es auf den Fleck und streife absichtlich Daniels Teller.
»Oje, jetzt versalze ich Tollpatsch dein schönes Essen. Na, dann reißt du einen urkomischen Witz darüber und die Lacher sind dir sicher«, gackere ich und streue noch eine Extraportion über das blutende Rehfleisch.
Sofort färbt sich das Salz dunkelrot. Durch mein Bravourstück ist das Fleisch nun ungenießbar und ich zufrieden, ihm wenigstens das Essen zu versalzen, wenn schon nicht die amourösen Liebesabenteuer außerhalb unserer Beziehung.
Urplötzlich schwanke ich, weil ich damit Lisas blutige Hände assoziiere und nicht weiß, ob es vielleicht sogar meine gewesen sind. Für den Bruchteil einer Sekunde wird mir schwarz vor Augen. Zeitgleich versagen die Beine ihren Dienst. Unbeholfen plumpse ich auf meinen Stuhl.
»Na macht nichts. Die dumme Kuh hätte sich die bescheuerten Pulsadern auch längs aufschneiden können, damit es wirkungsvoll in der Gegend herumspritzt. Zu ärgerlich, denn ich bin mit ihnen nicht sämtliche Möglichkeiten eines Selbstmordes in einer Biologie-Projektwoche durchgegangen. Dann wüssten diese dummen Rotznasen nämlich, wie sie sich gescheit den Lebensfaden abschneiden, falls sie ihr beschissenes und unangenehmes Leben satthaben, in dem Männer ungestraft tun und lassen dürfen, was ihnen beliebt. Aber hey, kein Problem, uns geht es gut. Alles bestens, alles bestens. Es ist eben albern, sich ausgerechnet in der Schultoilette die Pulsadern aufzuschneiden, weil sie ein Arschloch hemmungslos vergewaltigt und nebenbei schwängert.«
»Maus!«
Fuchsteufelswild schubse ich ihn von mir. »Nenn mich ja nicht Maus. Echt jetzt mal. Aber weißt du was? Kein Problem, wenn ein Typ eine Frau grausam vergewaltigt. Selbst schuld, nicht wahr? Ich meine, warum ist sie eine Frau geworden«, schreie ich ungehalten los.
Meine Wangen werden nass, weil sich riesige und kochend heiße Tränen daran hinabwälzen. Daniel zieht mich zu sich, doch ich winde mich angewidert aus seinen freischaffenden Künstlerklauen.
»Du bist ein gefühlskalter, mitleidloser Künstler-Arsch, dem überdies die biologische Uhr zu schnell tickt. Ich bin noch nicht bereit, zu heiraten oder Kinder zu bekommen. Außerdem hasse ich es, wenn du so überkandidelt daherredest und tust, als ob die Welt dich kreuzweise kann. Du bist ein Teil dieser Welt. Mit diesem Verhalten machst du sie zu einem beschissenen, düsteren und menschenfeindlichen Ort, an dem man nur ersticken möchte.«
»Tut mir leid, Maus. So meinte ich es nicht.«
»So meintest du es sehr wohl, denn wir haben gestern Abend lang und breit über dieses verdammte Thema gestritten. Ich will nicht heiraten und nenne mich nicht Maus, sonst flippe ich gleich tierisch aus.«
»Komm kurz zu mir. Tut mir leid«, haucht Daniel zwischen seinen liebevoll gemeinten Küssen, die ich dermaßen deplatziert finde und durch sie noch verärgerter reagiere.
Nach dem Aufflackern unseres Rosenkrieges sitzen wir schweigend am Tisch und starren lustlos auf die blutgetränkten Teller. Vergebens versucht Lidia, die Stimmung aufzulockern. Ich schweige, verdecke mit meiner flachen Hand den hässlichen Rotweinfleck und höre ihr nicht zu.
»Ich möchte ins Bett«, erkläre ich irgendwann zerschlagen und erhebe mich schwankend.
Der Alkohol fließt durch meine Adern und lässt mich stark schaukeln, während ich zur Eingangstür wanke. Daniel verabschiedet sich von Lidia und herzt dreimal ihre Wange. Ich stelle mich an, drücke sie flüchtig und murmele eine aufrichtig gemeinte Entschuldigung. Die kommt unbeholfen über meine Lippen.
Der Abschied von Reino fällt wesentlich herzlicher aus. Er rät mir in unserer Abschiedsumarmung, mich ordentlich auszuschlafen.
»Wir hätten lieber zur Parkbank gehen sollen«, flüstere ich. »Nur du und ich. Mehr braucht es nicht für einen schönen Abend.«
An der geöffneten Tür stehend, beobachtet er, wie Daniel auf dem Weg zum Auto meine Hand sucht. In einer ruckartigen Bewegung zerre ich meinen Arm fort und falle um ein Haar in Lidias Blumenrabatte. Wiederholt eilt Daniel mir zu Hilfe, doch ein frostiger Blick und weit erhobene Hände genügen, um ihn davon abzuhalten.
»Alles klar, Frau Mimose. Du interpretierst zu viel in die Dinge hinein. Ja, guck nicht so. Ich habe schon verstanden, dass du nicht angefasst werden willst. Wieder einmal«, zischt er giftig, worauf ich gekränkt dreinblicke und mich innerlich ganz winzig fühle.
Ganz unzulänglich.
Ganz unzufrieden und ungemein ratlos.
Torkelnd an der Beifahrerseite angekommen, schaue ich bekümmert zur Haustür. Reino lehnt gegen den Türrahmen und verfolgt die unschöne Szene. Seine Miene wirkt ehrlich betrübt.
Kein Wunder. Ich habe ihm den schönen Abend verdorben.
Wir hätten besser türmen sollen.
Zum Abschied hebe ich meine Hand, steige täppisch in den Wagen ein und verabscheue mich zutiefst. Daniel fährt uns nach Hause. Auf jede seiner ärgerlichen Fragen antworte ich stoisch mit Schluckauf, statt zu antworten und mich dem Unvermeidbaren zu stellen.
Im Bett übermannt mich ein epileptischer Anfall, während er seelenruhig schläft. Mein Wille setzt aus, wann es ihm beliebt oder zu viel wird. Jetzt ist zu viel.
Eigentlich ist es schon seit Langem zu viel.
Die kleine, gekränkte Mara in mir drängt sich mit dem Anfall in den Vordergrund und ruft sich in Erinnerung.
Sie ist diejenige, der alles zu viel ist. Da ich ihr kaum Mitspracherecht einräume, verschafft sie sich auf diese Weise Gehör. Gerne auch mit aller Gewalt. Sie schüttelt mich durch, macht mich bewegungsunfähig und zeigt mir deutlich ihre Grenzen. Es fühlt sich an, als würden alle meine Sicherungen gleichzeitig durchbrennen.
Hinterher fühle ich mich, als hätte mich ein Bus angefahren. Wie ein nervliches Wrack. Dann, aber immer nur dann, sehe ich ein: Sie erwartet von mir, dass ich endlich Verantwortung für uns übernehme. Sie braucht Geborgenheit, Sicherheit und ausnahmslos Liebe.
Vor allem Liebe.
Kapitel 3
Das Wasser der Duschbrause rinnt auf meinen Kopf und durchnässt die Haare. Ich schließe die Augen und lege den Kopf weit in den Nacken, damit das kühle Wasser mein Gesicht erfrischt. Prickelnd und kribbelnd treffen mich unzählige Tröpfchen, die jedoch nicht beleben und keinen einzigen der müden Geister verscheuchen.
Resigniert sackt mein Kopf vornüber. Gelangweilt sehe ich zu, wie die Tropfen an den Fingerspitzen zusammenlaufen, um sich an dieser Stelle zu sammeln. Von dort rieseln sie in einem plätschernden Rinnsal auf die grauen Bodenfliesen hinab.
Hinter mir höre ich, wie sich die Glastür öffnet. Kurz darauf ertasten mich Daniels Finger. Sie sind eiskalt. Bedächtig fahren sie an meinem Hüftknochen entlang, umarmen mich danach verlangend und pressen meine Hüfte an seinen Unterleib. Der rasche Atem streift meine Haut, nachdem er sich eindeutig bewegt und an mich schmiegt.
»Guten Morgen. Hast du gut geschlafen?«
Sofort winde ich mich aus diesem Griff. »Nicht, Daniel.«
»Ach komm, Maus. Nur kurz, bevor ich in das Atelier muss«, flüstert er mit deutlich gesenkter Stimme und fährt begehrlich mit den Fingerspitzen meine Hüfte entlang.
Sofort nach dieser wollüstigen Bitte winde ich mich energisch aus seinen Armen. Auf dieses ›kurz‹ habe ich heute keine Lust.
Dieses ›kurz‹ bedeutet in der Mehrzahl der Fälle, dass es dabei nicht um meine Begehrlichkeiten geht. Auf diese Art von ›kurz‹ reagiere ich äußerst empfindlich, zumal er nicht genug davon bekommt. Allein der Gedanke daran lässt meinen Magen bereits aufbegehren, obwohl ich nicht ohne Libido durch das Leben laufe.
»Nein.«
Unnachgiebig drängt er sich enger an mich und drückt meinen nackten Leib gegen die kühle Wand der Dusche, als wäre mir eben kein ›nein‹ über die Lippen gekommen. Mir fällt entsetzlich auf die Nerven, wenn Menschen ein ›Nein‹ nie als ein solches akzeptieren.
Der gierige Mund arbeitet sich zu meinem Ohr vor, wobei ein lustvoller Laut seinen Weg in die Welt hinaus sucht. Ich hätte genauso gut mit ›Bewässerungssystem‹ antworten können, er hätte nicht zugehört.
Entnervt schiebe ich ihn fort.
»Bitte, nur kurz«, haucht er und sucht meine Lippen.
»Ich mag nicht.«
»Du magst nie.«
»Das stimmt nicht. Ich möchte schon, aber nicht jetzt. Nicht so.«
Aufgebracht lockert er seinen Griff. »Was stört dich denn nun schon wieder, Tamara?«
»Dein gieriges Gegrapsche bringt mich nicht in eine Stimmung, die ich dazu nun einmal brauche. Du kommst rein, drückst dich an mich und erwartest, dass ich binnen Sekunden den Schalter umlege. Das stört mich.«
Aus der Duschbrause rinnt das Wasser hinab. Daniels lange Haare sind hellblond. Völlig durchnässt kleben sie im Nacken und lassen ihn wie einen fremden Mann wirken. Blaugraue Augen, die in diesem Licht dunkel unter den dicken Augenbrauen aufblitzen und deren Wimpern voller Wassertropfen hängen, mustern mich wachsam.
»Ich habe mich lang und breit für gestern Abend entschuldigt. Im Atelier war die ganze Woche die Hölle los, was meine miese Laune erklärt. Das mit Lidia war doch nur als Witz gemeint. Ein blöder Witz. Ich habe keine neue Muse«, entgegnet er erregt und hätschelt mich versöhnlich am Ellbogen.
Erneut entziehe ich mich und flüchte an die gegenüberliegende Wand, von wo aus ich ihn vorwurfsvoll ansehe. Die Worte stimmen nicht mit seinem Gesichtsausdruck und Verhalten überein. Und blöde bin ich auch nicht.
Oder blind.
»Ich mag jetzt nicht, weil ich genau weiß, dass es unter der Dusche und ohne Vorspiel wehtut. Das weißt du. Und ich fühle mich nicht in Stimmung, weil mir haufenweise Sachen durch den Kopf gehen, was das Ganze nicht vereinfacht. Je mehr du dich rausredest, desto eigenartiger finde ich alles.«
Jedes Mal in derlei Situationen erkläre ich verständlich, dass es mitunter brennt, als wäre ich direkt in der Hölle gelandet. Den wahren Grund verschweige ich. Zu beschämend ist das, was mir passiert ist und stößt bei Männern oft auf Unverständnis.
Fakt ist, dass ich mich seit der Sache damals gegen diese Art von unkompliziertem, einseitigem Sex sträube. Ohne die passende Stimmung tut es halt weh.
Überdies gestaltet sich mein Liebesleben nicht unproblematisch und benötigt überdurchschnittlich viel Feingefühl, was bisher jeder Partner als Liebestöter empfunden hat. Einige haben mich sogar für prüde gehalten. An dieser Stelle haben auch keine Gespräche weitergeholfen.
Den Psychen von Männern schlage ich diesbezüglich ebenso wenig ein Schnippchen wie meiner. Im Endeffekt verbiegt sich einer auf Dauer, was unweigerlich zulasten der Partnerbeziehung geht.
Seine Hand sinkt, als hätte er sich an mir verbrannt. In einem mächtigen Schwall schlägt mir feuchte, frustrierte Atemluft entgegen, die mich wie ein brutaler Faustschlag trifft. Gelegentlich beschleicht mich das mulmige Gefühl, dass er mein niedriges Schmerzempfinden für einen findigen Vorwand hält, um nicht mit ihm schlafen zu müssen.
Dementsprechend gekränkt reagiert er. Der ausdruckslose Blick wandert an einen Punkt hinter mir. »Das sagst du ständig.«
»Lass uns …«
Unvermittelt dreht er sich um und verlässt wortlos die Dusche. Geräuschvoll schließt er die Glastür und lässt mich mit meinem Satz und zehntausend Gedanken zurück.
In mir schreit alles auf. Diese unschönen Szenen, die sich für gewöhnlich gegen Ende von Liebesbeziehungen abspielen, kenne ich haargenau.
Immer bleibt eine lähmende Ohnmacht zurück. Sie befördert mich in einen versteinerten, watteartigen Zustand zwischen Bewusstsein und Bewusstlosigkeit, der sämtliche Empfindungen ausknipst. Zumindest die wenigen, zerbrechlichen Gefühle, die zwei verachtenswerte Männer übriggelassen haben.
Folgende Methode hat sich für mich bewährt: Ich gehe in einen erdachten Raum, in den ich mich regelmäßig verkrieche. Er steckt zwischen allen Räumen, ist nicht greifbar oder erkennbar und mindestens ebenso heimtückisch wie manch eine Krankheit, die sich erst dann zu erkennen gibt, wenn der Zug längst abgefahren ist.
Dieser unwirkliche Ort ist eng, eiskalt, dunkel und trostlos. Daneben ist er unzugänglich und liegt meilenweit entfernt von einer Menschenseele.
Wie, wenn nicht haargenau so, stelle ich mir eine Gletscherspalte vor.
In der schreie ich seit Jahren weithin hörbar um Hilfe, weil ich mein Problem allmählich erfasse, jedoch keinen Ausweg finde. Es hört, sieht und hilft mir niemand. Auf mich gestellt, friere ich und fürchte mich schrecklich davor, in diesem tief gelegenen Spalt mutterseelenallein den Weg allen Fleisches zu gehen, ohne jemals ein Lichtlein in meinem Herzen verspürt zu haben.
Seit knapp einem Jahr sind Daniel und ich ein Paar, was mir bei der Kürze anderer Beziehungen wie ein Wunder erscheint. Mir fällt es einfacher, die Menschen herzlos von mir zu stoßen als sie in mein Herz schauen zu lassen. Das scheint, zumindest oberflächlich betrachtet, taktisch vernünftig.
Alles, was auf ein geöffnetes Herz folgt, wirkt noch bedrohlicher auf mich. Seit einiger Zeit wird mir bewusst, dass ich es mir über all die Jahre in der Gletscherspalte behaglich hergerichtet habe.
Dennoch möchte ich mich nicht gern oder lange hier unten aufhalten. Oder gar freiwillig. Was das betrifft, fühle ich mich wie ein Junkie, der nicht von seiner Droge loskommt, obwohl er sie absolut widerwärtig findet.
Vor allem, was sie aus ihm macht. Emotional einsam.
Durch meinen Sohn, der in Berlin studiert, hat sich Daniel von mir als Frau angezogen gefühlt. Fälschlicherweise ist er davon ausgegangen, ich würde mir weitere Kinder wünschen. Das stimmt jedoch nicht.
In etlichen Gesprächen hat er halbwegs den Grund verstanden, obwohl ich ihn nie ganz über den damaligen Vorfall aufgeklärt habe. Diesbezüglich ist er auch nie in mich eingedrungen. Und ich versuche noch immer krampfhaft, jenen Abend gnadenlos aus dem Gedächtnis zu radieren.
Fakt ist, ich schleppe ein riesiges, erdrückendes Paket Altlasten mit mir herum, was in der Mehrzahl der Tage schwer zu händeln geht. Inzwischen liegt es zweiundzwanzig Jahre zurück, trägt sich jedoch nicht unbedingt leichter. Ganz davon abgesehen, ertrage ich es nach all den Jahren noch immer nicht.
Vor fünf Monaten hat Daniel nach und nach Kleidungsstück für Kleidungsstück in meine Wohnung gebracht. Dieses Vorgehen habe ich als behutsame Geste gedeutet, gegen die ich mich nicht aufgebäumt habe, wie bei allen anderen Beziehungen zuvor.
Daniel ist der erste Mann, dessen Zahnbürste bei mir im Becher steht. In mir hat sich die leise Hoffnung geregt, eines Tages doch noch aus dieser elendigen, engen Gletscherspalte klettern zu können. Zu diesem Zeitpunkt ist unsere Beziehung aufgeblüht.
Aber es gibt Blüten, die sich gewohnheitsmäßig nach wenigen Stunden schließen. So eine Blüte bin ich.
An manchen Tagen schließen sich die Blütenblätter unvorhergesehen, was Daniel schwer zu schaffen macht. Er kann nicht mit der Unvorhersehbarkeit meiner kauzigen Gefühlswelt umgehen. Das merke ich immer ausdrücklicher. Mit dem Schließen der Blüte setzt sich unweigerlich eine Abwärtsspirale in Gang. Ich sage nein, er reagiert genervt und zieht sich zurück, worauf ich mich noch weiter zurückziehe.
Es ist ein verzwickter Teufelskreis.
Vor einem Monat hat er mir einen Ring angeboten und gefragt, ob ich seine Frau werden möchte. Der arme, verzweifelte Mann ist davon ausgegangen, dass der Ring genau die Sicherheit bietet, die mir nach seiner Meinung fehlt. Er hat in seinen lieb gemeinten Überlegungen nicht einkalkuliert, dass es mich zum Rennen bringt, statt zum Bleiben.
Entsprechend frustriert und irritiert hat er reagiert, nachdem ich energisch den Ring abgelehnt und mich für mehrere Tage abgeschottet habe. Ehrlich, insgeheim habe ich gewollt, dass er mich verlässt. Und erkennt, wie sinnlos und unmöglich es ist, eine Beziehung mit mir zu führen.
Er wäre auch nicht der Erste, der ernüchtert die Flinte in das Korn wirft. Schließlich bleibe ich nur auf diese Art in meiner Gletscherspalte hocken, ohne mich großartig irgendwohin bewegen zu müssen.
Dabei wäre ich gern anders.
Zu gerne wäre ich geschmeidig und anschmiegsam, statt permanent auf Abstand bedacht. Eine Beziehung, die stabil und solide ihren Weg durch alle Unwetter und Stürme findet, ist der Wunsch von vielen Menschen. So auch meiner. Einerseits sehne ich mich danach, kann eine Partnerschaft mit der tiefsitzenden Angst vor Nähe andererseits nicht aktiv gestalten.
Wochenlang haben wir miteinander gesprochen, geweint und gestritten. In diesen Gesprächen hat sich herausgestellt, dass Daniel sich sehnlichst Kinder wünscht. Jetzt, nicht morgen oder übermorgen.
Er hört seine biologische Uhr überlaut ticken, was ich bisher lediglich bei Frauen vermutet habe und mich regelrecht irritiert. Lange haben wir darüber gesprochen, sind jedoch keinen Schritt vorangekommen, weil wir mit unseren Meinungen meilenweit auseinanderdriften.
Seither lebt er vermehrt im Atelier, was dem Anfang unserer Beziehung gleichkommt. Genauer gesagt dem Ende.
Es geht steil bergab. In naher Zukunft fliegt die Flinte ins Korn, womit sich meine Vermutung erneut bestätigt und mir einen Grund mehr bietet, mich noch weiter abzukapseln.
Mit dieser Gewissheit verlasse ich die Dusche, frottiere mich und trockne den Fußboden, bevor ich im Anschluss das Badezimmer verlasse. Morgens ist mein Loft lichtdurchflutet, weil das Sonnenlicht durch die großen Fenster dringt und alles größer als ohnehin wirken lässt.
Daniel sitzt am Esstisch, der sich neben der offenen Wohnküche befindet. Lustlos kaut er sein Frühstück. Auf dem Tisch stehen eine geöffnete Milchflasche und gepuffter Dinkel.
Für mich hat er eine Schüssel und einen Löffel bereitgestellt, doch es tröstet mich nicht im Geringsten über den Umstand hinweg, dass er bereits mit dem Frühstück angefangen hat.
Ohne mich.
Wie immer in meinem Leben bohrt sich etwas Spitzes in mein Herz, mutiert zum Sinnbild meines Debakels und treibt mich ungewollt weiter von Daniel fort.
Ich gehe am Wohnbereich vorbei, der in hellen Möbeln frisch und bei Hitze angenehm kühl wirkt. Meine Hand gleitet über den Tresen, der die beigefarbene Küche und den Wohnbereich mit Barhockern abtrennt. In einer Obstschale auf dem Tresen preisen sich frische, knackige Äpfel vom Wochenmarkt an.
Auf einer Kommode, die ich an der Grenze zwischen Wohn- und Essbereich platziert habe, steht eine graue Pflanzschale, die mit üppig blühenden Orchideen bepflanzt wurde. Der Teppich im Wohnbereich ist farblich passend abgestimmt und gibt den Stil der Dekoration vor.
Er ist das einzige Erbstück meiner verstorbenen Eltern.
Eine Weile sehe ich zu, wie Daniel behäbig den Löffel in die Dinkelpops taucht und unnötigerweise umrührt. Ich setze mich bequem hin und probiere ein aufmunterndes Lächeln.
»Was hältst du davon, wenn wir für ein verlängertes Wochenende wegfahren? Wir brauchen ein wenig Abstand und stärken nebenbei unser Zweierteam. Ich suche im Internet nach hübschen Unterkünften.«
»Definitiv fahre ich nicht an den Arsch der Welt.«
»Wie wäre eine Großstadt? Dort gibt es erstklassige Museen, ein abwechslungsreiches Nachtleben und tagsüber ein großes Bett in einer gemütlichen Unterkunft.«
Nachdenklich legt Daniel seinen Kopf schräg, wobei sich die großen Locken unbändig um das runde Gesicht kringeln. Meine Argumente genauestens abwägend mustern mich seine blaugrauen Augen. Etwas darin blitzt auf und ich wette, das Wort ›Bett‹ ist der Auslöser.
»Eine Teambildungsmaßnahme?«
Ich gieße die frische Milch in meine Müslischale und rühre vielsagend dreinblickend den gepufften Dinkel um. »Gewissermaßen. Aber auch viel reden. Über uns. Wie es weitergeht, ob es weitergeht.«
Gründlich zerkaut er die Dinkelpops. An seinem Augenspiel erkenne ich, dass der Vorschlag mit dem Ausflug keine schlechte Idee ist.
»Museum muss nicht unbedingt sein«, meint er beiläufig, während er kurz darauf das benutzte Geschirr in die Spüle einräumt. »Im Bett reden genügt und das Thema sollten Kinder sein, an denen wir uns versuchen. Sonst hat das ganze Quatschen keinen Wert für mich.«
»Ich suche uns etwas Hübsches mit einem großen Bett und Kinder gibt es haufenweise zu adoptieren«, untermauere ich meinen Wunsch nach einem Weg durch den momentanen Wolkenbruch unserer Beziehung. Ich sehe ihn über Kopf an, weil er hinter mir steht.
»Mal sehen.«
Daniel herzt meine Stirn, geht zum Garderobenschrank im Flur und lässt reiflich Spielraum, was genau er meint.
»Du gehst um diese Zeit in das Atelier?«, wundere ich mich. »Es ist gerade drei viertel sieben. Wartet deine neue Muse schon so früh auf dich?«
Er greift zu der abgewetzten, uralten Lederjacke, die im Garderobenschrank hängt, und übergeht damit meinen Vorwurf über seine Untreue.
»Viertel vor sieben, Maus.«
»Wenn du meinst. Dann kaufe bitte eine ›Viertel-vor-Sahnetorte‹ in der Bäckerei, bevor du heimkommst. Beobachte aber genau das verdutzte Gesicht der Verkäuferin, wenn du deine Bestellung aufgibst.«
Daniel ist in West-Berlin aufgewachsen, wohnt jedoch seit über zwanzig Jahren in Leipzig. Beharrlich korrigiert er noch immer jeden Menschen, der ihm auf diese Art die Uhrzeit nennt. Bei einigen Mitmenschen eckt er damit an. Jedes Mal nach diesen Wortgefechten bitte ich ihn, den Mund nur zu diesem Thema zu öffnen, wenn er wirklich bessere Argumente vorbringt als ›Alle Ossis sind Jammer-Ossis‹.
Meiner Meinung nach bewegt er sich damit meilenweit unter seiner Auffassungsgabe. Wutentbrannt knallt er daraufhin jedes Mal mit Türen. Ich möchte gar nicht hören, wie er mich in seinen anschließenden Hasstiraden tituliert.
»Danke für das Gespräch, Herr Haarmeyer.«
»Du willst ein Dreiviertel-Stück einer Torte? Ich verstehe. Aber wir haben es Viertel vor sieben. Gibt es im Tal der Ahnungslosen etwa keine ›Viertel-vor-Torten‹?«
»Du liegst falsch. Leipzig war nie das Tal der Ahnungslosen. Das lag weiter östlich. Frage in der Bäckerei nach, du humorloser, verstockter Künstler«, ziehe ich ihn auf und griene kodderig, um das letzte Wort zu behalten.
»Kreidest du mir etwa an, dass ich im Westen geboren wurde? Entschuldigung dafür.«
»Nein, ich greife dich für deine Klugscheißerei und deinen Hochmut an.«
»Wieso scheiße ich klug?«
»Erkläre ich dir gerne. Du akzeptierst unsere Mentalität nicht. Unser gesellschaftliches Erbe und damit jedes wendeversaute Schicksal. Was würde passieren, wenn deine Großeltern, Eltern, Geschwister und Freunde über Nacht mit nichts in ihren werktätigen Händen dastehen würden? Mit nichts, als ihrem Stolz, ein beschissenes System auf den Kopf gestellt zu haben. Dann bekommen sie noch ständig vorgehalten, dass sie undankbar wären, weil sie doch nun in Saus und Braus leben können. Und wenn sie sich über die desaströsen Zustände in der deutschen Infrastruktur monieren, heißt es lapidar, sie wären Jammer-Ossis. Alles rechte Socken. Ähm, Moment … womit in Saus und Braus leben? Mit einer viel schlechteren Rente, jahrelanger Arbeitslosigkeit, Breitband-Narkotikum à la Mindestlohn im Dienstleistungssektor und Perspektivlosigkeit für weitere drei Generationen, bis auch die nach der Altersarmut endlich ins Gras beißen? Noch Fragen? Gehe mir also mit deiner blöden Viertel-vor-Laberei vom Acker.«
»Es heißt nun einmal viertel vor, nicht drei Viertel.«
»Es gibt keine ›Viertel-vor-Stücke‹ bei Torten. Drei Mal fünfzehn Minuten, ergo drei Viertel. Wo ist dein Problem? Was haben euch die Lehrer in Mathematik beigebracht? Oder ist das so ein Gewohnheitsding, welches du allen anderen Bundesbürgern aufdrücken willst, weil du es in deinem so gelernt hast?«
»Du mit deiner Ossi-Logik. Es hängt mir zum Hals raus. Ich finde es antiquiert und es wäre erfreulich, wenn ihr endlich in der Gegenwart ankommt.«
Scharf die Luft der Umgebung einsaugend, richte ich mich zu meiner vollen Größe auf. »Das, mein Lieber, ist nicht allein ein Ossi-Ding, steht aber sinnbildlich an der Spitze für das Überhelfen eines typisch westlichen und konsumorientierten Denkens. Und selbst wenn es eine Ossi-Logik ist, was es faktisch nicht ist, weil es in mehreren Bundesländern nicht viertel vor heißt … wäre sie als Ossi Logik automatisch weniger wert, oder was?«
»Das habe ich niemals behauptet.«
»Was dann?«, schreie ich ungehalten.
»Irgendwer muss doch mal dieses Gejammer ausmerzen. Das ist nicht zu ertragen. Und immer reagierst du verschroben. Vergiss doch mal die Vergangenheit und lande freundlicherweise im Hier und Jetzt.«
»Aber die Vergangenheit macht die Menschen nun einmal zu dem, was sie sind. Ich wünsche dir nicht, als Kind mit ansehen zu müssen, wie deine hochintelligenten Eltern sich in kürzester Zeit zu Zombies verwandeln. Die Eltern, die einst wild entschlossen auf die Straße gegangen sind, um etwas in der Welt zum Richtigen zu wenden. Einmal in ihrem verschissenen Leben, in dem sie andauernd vor dem System gekuscht sind, um nirgendwo anzuecken. Und doch hege ich insgeheim den intensiven und gemeinen Wunsch, weil du dich dann vielleicht an so manch eines unserer Gespräche erinnerst und Revue passieren lässt, was du zu mir sagst.«
»Du übertreibst maßlos.«
»Wieso übertreibe ich? Wurde denn nicht entsprechend gewählt?«
»Das ist ein bundesweites Phänomen, kein ostdeutsches, Tamara. Ich bin auf deiner Seite.«
»Echt?«
»Ja, sonst würde ich dir nicht einen Ring anbieten.«
»Dann bist du auch ein dummer, missratener Sachse mit vermeintlich rechter Gesinnung«, höhne ich.
»Ja, bin ich mittlerweile und nicht alle Sachsen wählen rechts. Ich bin kein Idiot und kenne die neuen Strömungen.«
»Manchmal bezweifle ich das«, entgegne ich muffelig.
»Frieden?«
»Wenn ein König einmal Armut in sein Land einziehen lässt, die Infrastruktur zerstört und Bildung verweigert, muss er sich nicht wundern, wenn seine Untertanen sich unmenschlich verhalten oder gegen ihn wenden.«
»Du redest nicht nur von den Armen, oder?«
»Bin ich so leicht zu durchschauen?«
»Tamara, muss man es denn auf so paradoxe Weise tun?«
»Die Menschen tun es bundesweit auf so paradoxe Weise. Doch nur, weil der König die Bedürfnisse des Volkes lange genug übergangen ist, jetzt doppelt zynisch agiert und viele nicht kapieren, dass sie das Unheil in einer anderen Gestalt wählen.«
Unauffällig zuckt seine rechte Augenbraue, was ich dennoch bemerke. Jetzt steht fest, dass ich das letzte Wort behalte und er sich jeden weiteren Kommentar zu den Argumenten verkneift, die beständig den Graben unserer unterschiedlichen politischen Auffassungen erweitern.
In der Tat hat es nichts mit der unterschiedlichen Sozialisierung zu tun. Eher mit einem unterschiedlichen Lebenskonzept. Die alberne Viertel-vor-Diskussion steht nur allegorisch für unser gnadenloses Scheitern.
»Ich mag mich jetzt nicht streiten. Bis heute Abend, Frau Gymnasiallehrerin.« Für einen Kuss kommt er auf mich zu, wobei die Lippen halbherzig auf meinem Mundwinkel landen.
»Ich rufe dich an, wenn etwas ist. Bis viertel vor«, brummt er und schließt die Tür.
Meine Finger fahren durch das ungekämmte Haar bis in den Nacken, wo sie eine Weile die völlig verspannten Muskeln massieren. Ich lasse meinen Frust an Daniel aus, obwohl die Ost-West-Thematik rein gar nichts mit unserer zwischenmenschlichen Situation zu schaffen hat.
Schließlich bietet kein Mann einer Frau einen Ring an, wenn er sie nicht liebt. Andererseits igelt sich keine Frau ein, statt begeistert einzuwilligen.
Zumindest keine, die normal tickt.
Kapitel 4
Nach einem leisen Aufseufzen flitze ich in das Schlafzimmer, welches in der oberen Etage liegt. Ich bin spät dran, ziehe aus dem weißen Einbauschrank eilig frische Joggingsachen, streife sie mir über und binde sorgfältig meine Haare zusammen.
Ein Handy vibriert.
Suchend drehe ich mich um. Abermals vibriert es, daher finde ich es beim zweiten Versuch problemlos. Es liegt auf Daniels Bettseite.
Offenbar hat er es durch unseren Knatsch vergessen, mitzunehmen. In der Annahme, dass er anruft, damit ich es schneller finde und in das Atelier vorbeibringe, streife ich mit meinem Zeigefinger über das Display und gebe den vierstelligen Geheimcode ein.
Er erhält eine Textnachricht. Von Doris.
Das finde ich komisch, daher sehe ich mich in dem Chatverlauf um. Die einzige Doris, die ich kenne, ist die Inhaberin einer Kunstgalerie. Sie verkauft einige seiner Werke.
Freilich bleibt fragwürdig, dass er mit der Sechzigjährigen rührige Zeilen austauscht. Zumal er ihre unberechenbaren Launen nicht ausstehen kann.
Das kann nur eines bedeuten: Doris dient als Deckname, denn die Nachrichten wirken intim, obwohl kein ordinäres Wort fällt. Poetische Wörter stechen mir ins Auge und bestätigen meinen Argwohn.
Kurzerhand wähle ich die Nummer.
Es klingelt. Einmal, zweimal, dreimal …
»Wo steckst du, Kochanie?«
Ich lasse meine Hand sinken. Kochanie ist polnisch und bedeutet Liebling.
Nachdem ich die Stimme von Lydia höre, gleitet das Handy aus meinen Fingern. Daniel hat die Flinte ins Korn geworfen. Ich darf mein Gewissen getrost damit beruhigen, dass er mich hinterhältig betrügt, obwohl er es vorhin noch vehement bestritten hat. Damit sehe ich mich um eine Erfahrung reicher und kann es mir in meiner bequemen und doch verhassten Gletscherspalte behaglich machen.
Lidia und er.
Am Schuhschrank schlüpfe ich in die Laufschuhe, atme tief durch und verlasse geistesabwesend das Haus für meinen frühmorgendlichen Trainingslauf. Ich fühle mich innerlich taub. Die Gewissheit macht allen Bemühungen Platz, sich anzustrengen und vehement gegen das Haltbarkeitsdatum meiner Beziehung anzukämpfen.
In den von der Morgensonne rötlich beleuchteten Straßenschluchten gehen viele Menschen zur Arbeit, die sich in Autos, auf Fahrrädern oder zu Fuß auf den Weg machen. Allmorgendlich steuere ich auf den Kanal zu, der den alten Hafen und die Weiße Elster miteinander verbindet.
Einst hat Karl Heine die Wasserstraße gebaut und das erste großflächig geplante Industriegebiet in Deutschland angelegt. Über die Jahre haben sich in dem einst abgelegenen, von Mooren umgebenen Dorf immer mehr Arbeiter angesiedelt. Heute leben und arbeiten in Leipzig-Plagwitz bunte und abwechslungsreiche Menschen, die das besondere Flair in den Stadtteil bringen.
Ich vergleiche Leipzig Plagwitz gerne mit Berlin Prenzlauer Berg vor der Jahrhundertwende. Frisch, bunt und absolut bezahlbar. Mir gefällt Plagwitz, weil es noch nicht totsaniert wurde, wodurch der Stadtteil ursprünglich, kreativ, lebendig und pulsierend bleibt.
Kein noch so gewiefter Investor kann dieses Flair mit Geld und zu luxussanierten Wohnraum aufrechterhalten. Aber es gibt erste Anzeichen, dass sich dies demnächst ändert.
Für Daniel und andere Kunstschaffende wäre es undenkbar, woanders zu leben und zu arbeiten. Für sie ist dieser Stadtteil vollgestopft mit Inspirationen, Leben und Eingebungen.
Apropos Kunstschaffende.
Der teuflische Lump. Dieser hundsgemeine, verachtenswerte und gewissenlose Heuchler. Plärre ich jetzt nach Herzenslust oder schreie doch lieber alles raus, bis ich wahnsinnig vor Gram werde?
Pah, das wäre ja noch schöner.
Diesmal nicht, Freundchen! Diesmal heule und schreie ich nicht.
Basta.
Wie jeden Morgen laufe ich am linken Ufer des Karl-Heine-Kanals entlang, wobei mein Zopf bei jedem Schritt umherschwingt. Die frische Morgenluft kühlt mein Gesicht angenehm, vertreibt unangenehme Gedanken und unliebsame Grübeleien über Flinten, die ins Korn fallen. Oder untreue Kunstschaffende und deren Hausfrauen-Musen.
Auf einer Fußgängerbrücke, die zu einer kleinen Siedlung von Stadthäusern führt, entdecke ich Reino. Soeben überquert er die Brücke.
Soll ich es ihm sagen?
»Guten Morgen. Bist du wieder nüchtern und in der Welt der Lebenden zurück?«, grüßt er, nachdem er mich im Laufschritt einholt.
»Na, ausgeschlafen?«, frage ich, weil er auf mich eher einen zerknitterten Eindruck macht und ich mich vorerst entscheide, über den Betrug zu schweigen.
Seine Nacht scheint ebenso scheußlich verlaufen zu sein, wie meine. Einsilbig brummt er undeutliche Silben in seinen Dreitagebart und erhöht das Tempo, als würde er vor etwas davonlaufen. Schweigend joggen wir westwärts, bis wir kurz vor dem alten Hafen wenden und zurücklaufen. Unser Laufschritt ist gleichmäßig und synchron.
Mit Reino laufe ich gerne, denn er textet mich nicht am frühen Morgen mit Erlebnissen oder Tagesaufgaben zu. Auf diese Weise denke ich beim Laufen nach, ohne tatsächlich nachzudenken, und kann mich freimachen. Das gelingt nur mit einem Laufpartner, der mir die nötige Bewegungsfreiheit für den Geist gibt. Ich möchte beim Joggen nicht grübeln und spare lieber alle Energie für den nächsten Laufschritt.
Gerade heute möchte ich verdammt noch mal über alles andere, als diesen dämlichen Rotz grübeln. Sonst breche ich auf der Stelle.
Nach drei Runden ist unser Pensum geschafft. Neben einem kleinen Spielplatz pausieren wir. Direkt an einer Steintreppe, dessen Stufen zum Kanal hinab führen. Hinter dem Spielplatz liegt das Gebäude, in dem wir unsere Schüler unterrichten. In den großen Pausen strömen unsere Zöglinge hierher und versammeln sich in kleinen Gruppen, um heimlich zu rauchen.
Gebeugt verschnaufen wir an der oberen Reihe der kniehohen Stufen aus gewaltigen Steinquadern, die übergangslos im Karl-Heine-Kanal enden.
»Ist heute der Teufel hinter dir her?«
»Du bist eindeutig aus der Form«, gebe ich zurück und klopfe mit meiner Hand auf seinem Brustkorb. »Die Erkältung setzt dir scheinbar noch immer zu. Schlägst dich aber mittlerweile wacker.«
In meinen Worten liegt kein Spott. Reino läuft seit einem Jahr mit mir und steigert seitdem eisern und kontinuierlich sein Pensum. Die Idee, gemeinsam zu laufen, wurde beim wöchentlichen Squash-Match geboren. Mittlerweile schlägt er mich dort wesentlich öfter als vorher, was ich der deutlich gesteigerten Kondition zuschreibe.
»Immerhin schüttelst du mich jetzt nicht mehr mühelos ab.«
Ich nicke und hüpfe eine Treppenstufe der kniehohen Steinquader hinab. Auf dem Boden liegen unzählige Bierdeckel und Kippen. Keiner der Besucher, die hier an milden Sommerabenden hocken, räumt sie fort. Aber zu ›Friday for Future‹ rennen sie jeden Freitag.
Verrückt.
An der untersten Stufe angekommen, ziehe ich meine Laufschuhe aus und halte die Füße in das kühle Wasser. Reino, der unterdessen zu Atem kommt, setzt sich. »Mir gefällt es hier. Alles erwacht so friedlich im Morgenlicht. Ich finde es grandios, selbst wenn es hier kaum einen freien Sitzplatz gibt. Am liebsten mag ich diesen Ort aber am frühen Morgen. Obendrein möchte ich die Joggingrunden nicht mehr missen.«
»Du hast gegen deinen Bauchansatz gewonnen«, antworte ich und deute auf das dunkelgrüne Laufshirt. Auf Höhe seines Bauchnabels ist deutlich zu sehen, was ich meine. »Sieh die idyllischen Pausen nach den Runden als Belohnung und Motivationsschub an.«
»Ist dir das etwa aufgefallen?«, fragt er zufrieden. Obwohl er mich um einen halben Kopf überragt, ist er nach meinem Kompliment schätzungsweise zwei Meter zwanzig groß.
»Zu deiner Beruhigung: Ich mochte dich auch mit Bauchansatz, denn da habe ich dich im Squash wesentlich öfter geschlagen«, beantworte ich seine Frage.
»Freche Göre«, zischelt er gedehnt und zwickt mich unsanft am Gelenk des Oberarms.
Hier beim Joggen fühle ich mich im Umgang mit Reino freier als unter Lidias Blicken. Wir lachen ausgiebig, ungehemmt und gerne, was ihr ständig ein Dorn im Auge ist und sinnlose Streitereien provoziert. Die wiederum versucht Reino vor mir zu verbergen. Gelingt allerdings nicht immer.
»Wie ich höre, hat dir die Gerbauer gestern wieder Vertretungsstunden aufgebrummt?«, erkundigt er sich, schlüpft aus seinen Laufschuhen und taucht die Füße in das grün schimmernde Wasser.
»Die stille Post, was? Irgendwie schleicht mir gelegentlich der Gedanke durch den Kopf, dass sie auch zukünftig einfach kein Faible für mich entwickelt.«
»Denke ich auch, zumal du immer mehr Zusatzaufgaben bekommst als der Rest des Kollegiums.«
Reino steht inzwischen wieder. Die höher steigende Morgensonne blendet seine Augen, die tiefschwarz schimmern und die beleuchtete Umgebung wie ein Spiegel reflektieren. Nicht einmal in diesem hellen Licht ist es möglich, die Iris von der Pupille zu unterscheiden. Seine dunkelbraunen Haare glänzen in der Sonne. Vom Wind zerzaust stehen sie ab.
Er ist der Typ, der im Winter aussieht, als käme er direkt aus dem Urlaub. Zu jeder Jahreszeit ist seine Haut mit einer gesunden Farbe überzogen. Mit Mitte vierzig hat er nicht das Mindeste seiner Ansehnlichkeit und nicht einmal das bezaubernde Lächeln verloren. Mit dem Unterschied, dass heute reihenweise Kolleginnen und pubertäre Schulmädchen dahinschmelzen, statt Studienkolleginnen.
»Mal sehen, was sie sich einfallen lässt, wenn ich wieder zurückkomme«, schmolle ich und wende mich ab. »Ich überlege, ob ich verreise.«
Ich ernte einen fragenden Blick, den ich aus dem Augenwinkel wahrnehme.
»Was war gestern Abend noch los?«
Mit den Achseln zuckend, beobachte ich eine Frau, die an einem gegenüberliegenden Bürogebäude Fenster putzt. Am Uferstreifen suchen einige Enten im Schilf nach Futter.
»Nur so. Ich möchte raus.«
Wachsam gleitet der Blick über mein Profil, während ich zu meinen Füßen hinabsehe, die sich kreisend im kühlen Wasser bewegen.
»Ist es wegen gestern Abend?«
Ich streife eine Haarsträhne aus dem Gesicht und klemme sie hinter das Ohr. Mir ist der Gedanke unangenehm, wie tief ich gestern Abend meine Nase in das Glas Rotwein gesteckt habe. Schließlich hat Daniel für ihn eine horrende Summe bezahlt.
Aber der Betrug …
»Hast du manchmal alles nicht einfach satt? Nur so für Sekunden oder Minuten? Das blöde Leben, den überhandnehmenden Stress, die nervigen Auseinandersetzungen wegen irgendwelcher Nichtigkeiten?«
»Und da verreist du, um wieder hungrig auf das Leben zu werden?«
Ich schmunzele und rempele ihn mit meinem Ellenbogen an, weil er sehr genau versteht, wenn er es jetzt auch andersherum dreht. Seine gebräunten Oberarme überzieht ein dünner Schweißfilm, den er dezent fortwischt.
Die Sonne, die hinter uns scheint, blendet meine Augen, nachdem ich mein Gesicht zu ihm drehe. Ich möchte ungern gestehen, wie abgrundtief ich in einigen Momenten alles satthabe.
»Ernsthaft. Ich möchte kurz raus. Daniel hat eine Affäre und ich muss überlegen, wie es … weitergeht.«
»Wie bitte?«
Unbeholfen zucke ich mit der Achsel und lenke rasch auf den Kern der Sache. »Kein Ding. Ich habe beschlossen, diesmal Rache zu nehmen.«
»Rache?«
»Genau, ich räche mich. Was er kann, kann ich auch, oder? Ich fahre nach Berlin oder Hamburg und gehe dort auf die Pirsch. Ich stürze mich in wilde, verruchte Abenteuer. Vielleicht fühle ich mich danach besser. Auf jeden Fall möchte ich nicht herumsitzen, heulen und Trübsal blasen, weil meine Beziehung den Bach runtergegangen ist und ich kräftig daran beteiligt bin. Ich schmeiße Unmengen Geld zum Fenster raus, amüsiere mich in den angesagtesten Bars und reiße mir junge, willige und sexy Typen auf, die mein massiv vernachlässigtes Ego aufpolieren. Was lachst du so diabolisch?«
»Ich lache, weil du nicht der Typ Frau bist, der so etwas durchzieht.«
»Dann werde ich kurzerhand der Typ Frau und ziehe es durch. Wenigstens für die Zeit der Reise. Ich habe keinen Bock, die beleidigte Betrogene zu spielen, die schmollend in der Ecke hockt und sich heulend selbst bemitleidet. Mal sehen, was der Herr Künstler dazu meint, wenn ich plötzlich auch mit Musen nach Hause komme.«
»Denke daran, Kondome zu benutzen. Man weiß nie, wen die Musen zuvor inspiriert haben«, lacht Reino belegt.
»Aber logisch oder was denkst du von mir. Schließlich möchte ich mir nichts einfangen, nur Spaß haben. Gott, bin ich an dieser Stelle froh, dass ich im einundzwanzigsten Jahrhundert lebe«, schreie ich meinen letzten Satz in die Welt hinaus.
Lediglich die Entenfamilie kommentiert mein übermütiges Geschrei mit aufgeregtem Geschnatter. Reino lacht schallend. Ich stehe auf und stelle mich auf die grünen, glitschigen Steine, die unterhalb der Steintreppe liegen.
»Morgen Nachmittag fahre ich los«, rufe ich durch das helle Lachen befeuert, was nur minimal klingt, als würde er mir kein einziges Wort glauben. »Berlin oder Hamburg. Vorher gehe ich Lisa im Krankenhaus besuchen. Ich muss ihr klarmachen, dass ich ihr glaube. Der Rest der Mannschaft kann mich kreuzweise. Stell dir vor, keiner weiß, was ich anstelle.«
»Doch, ich weiß es.«
»Ja, nur du«, flüstere ich verschwörerisch und strecke meine Hände in die Höhe, »und ich weiß ja, du behältst Geheimnisse für dich. Ich nehme Rache, lasse mich durch das Nachtleben treiben und tobe mich aus. Mal sehen, wohin mich das Leben befördert.«
Mit ausgestreckten Armen lasse ich mich in das grüne Wasser plumpsen, schwimme in die Mitte des Kanals und tauche kurz ab. Reino lacht dröhnend, bis ich auftauche und ihn unverschämt angrinse.
»So gefällst du mir schon viel besser. Ich verrate niemandem, was du kleine, dreckige Lehrerinnen-Schlampe vorhast.«
»Sei nicht so frech«, empöre ich mich und spritze eine Handvoll Wasser in seine Richtung.
Aufschreiend rennt er kopflos in sichere Distanz, was mich mehr und mehr befeuert, ihn mit unzähligen Wasserspritzern zu beschießen. In weniger als einer Minute klebt die patschnasse Hose an seinen Beinen. Mit der Welt und mir zufrieden, bleibe ich noch eine Weile im Wasser und lasse mich in der sanften Strömung treiben.
»Komm raus, Mara.«
»Nö, ich mache ab jetzt nur noch die Sachen, die keiner von mir erwartet. Unerhörte, schamlose und unglaublich dumme Sachen«, entgegne ich fest entschlossen.
Begeistert von meiner spontanen Entscheidung und zufrieden, schaue ich zu den unzähligen Schäfchenwolken hinauf, die lustlos am morgendlich eingefärbten Himmel treiben. Reino sitzt auf der untersten Stufe der Treppe und beobachtet, wie ich mein Gesicht zum Himmel strecke, die Arme ausbreite und im grün schimmernden Kanal treibe.
»Scheiß was auf die Philister«, murmele ich heiser. »Scheiß was auf Scheißtypen, die ständig in der Gegend rumvögeln. Wäre doch gelacht, wenn ich nachts allein nach Hause muss, oder?«
Ich lasse meine Beine absinken und vergewissere mich bei Reino, der zustimmend nickt. »Tu, was du nicht lassen kannst.«
»Nun komm schon einen Moment rein«, rufe ich beschwingt.
Mit einer eindeutigen Geste lade ich ihn ein, sich ebenfalls zu erfrischen. Skeptisch sieht er sich nach allen Seiten um und schüttelt unentschlossen den Kopf.
»Bist du etwa feige, von Borstel?«
»Hältst du mich für feige?«
Ich tauche ab und verstecke meinen Mund unter Wasser. Ausladend schmunzele ich, verberge es aber. Reino regt sich unruhig, was meine Augenwinkel weiter nach oben zieht.
»Ernsthaft, du hältst mich für feige?«, erkundigt er sich augenfällig besorgt und reckt sich irritiert.
Noch immer schmunzele ich und denke an eine Situation zurück. Damals waren wir zu sechst und haben etwas aus einem Geschäft stibitzt. Es ist eine Mutprobe gewesen, für die jeder von uns in einen Laden gegangen ist und etwas gestohlen hat.
Anschließend ist Reino, der zuletzt an der Reihe gewesen ist, hineingegangen und hat die stibitzte Ware bezahlt. Wir haben ihn ausgelacht. Deswegen hat er von einigen Mitstudenten den Spitznamen ›Mister Anstand‹ verliehen bekommen.
Insgeheim habe ich ihn dafür bewundert, weil er sich den unangenehmen Konsequenzen gestellt hat. Wir anderen haben uns feige verdünnisiert. Ich habe es ihm nie gestanden, aber ich finde es noch heute couragiert, wenn ich ehrlich bin. Nein, Reino von Borstel ist alles andere als feige, doch das blass erstaunte Gesicht, welches er jetzt aufsetzt, finde ich zuckersüß.
»Ich mache los. Muss in die Schule«, erklärt er nach einer Weile verdrießlich und schlüpft in die Laufschuhe.
Mit einem leidvollen Klagen schwimme ich mürrisch zur Steintreppe zurück. Ich halte mich an einem Stein fest, der über und über mit Algen bewachsen ist. »Danke, dass du damals die gestohlene Ware bezahlt hast. Sie haben dich tagelang ausgelacht, aber ich fand es bemerkenswert und mutig von dir.«
Reino hält in seiner Bewegung inne. »Du weißt davon?«
»Ich habe beobachtet, wie du hineingegangen bist und die Ware bezahlt hast«, beichte ich und schaue in ein blass erstauntes Gesicht.
Während ich spreche, tauche ich lautlos aus dem Wasser auf. Achtsam betrete ich die glitschigen Steine, damit ich nicht auf ihnen ausrutsche. Mit einem beherzten Satz springe ich auf die unterste der Steinstufen. Triefend nass, beuge ich mich und nehme meine Schuhe auf.
Alle Jubeljahre sehe ich, wie dieses Gesicht schamrot anläuft. Mit glühend roten Wangen schaut er kategorisch zur Seite, obwohl ich mich nach der Uhrzeit erkundige.
»Was ist denn mit dir?«, frage ich verwundert und vermute, mein Kompliment berührt ihn. Oder er geniert sich, weil ich ihn damals beobachtet habe.
Der Kopf schnellt herum. Seine Augen deuten zu meinem Oberleib, wo das durchnässte Shirt an meinem Brustkorb klebt.
»Oje, danke«, kichere ich beschämt und lockere schnellstens das nasse Shirt. »Stell dir vor, ich wäre damit nach Hause gelaufen. Wie entsetzlich peinlich.«
»Für den Fall, dass dich eine Traube sabbernder und brünstiger Männer verfolgt, weißt du zumindest, woran es liegen könnte.«
»In diesem Fall nehme ich gerne die Telefonnummern der Herren entgegen. Kann ja angehen, dass einer von denen als meine Muse infrage kommt.«
Reino wendet sich ab und steigt die Treppenstufen hinauf. »Dann solltest du das Shirt wieder andrücken und einen Stift bereithalten. Berlin kannst du dir somit sparen.«
»Ungünstig wäre dann allerdings, dass es unter Umständen in einem oder zwei Jahren Väter von Schülern sind.«
»Liegt alles im Bereich des Möglichen«, entgegnet er und hilft mir ritterlich, die letzte der kniehohen Stufen zu erklimmen.
»Klingt nicht nur blöd, wäre es auch, daher fahre ich morgen doch lieber nach Berlin. Dort kennt mich kein Schwein und ich büße langfristig kein Ansehen ein.«
»Grüße Lisa herzlich von mir und halte deine Arme beim Laufen besser so«, schlägt Reino vor. Er deutet mit seinen Armen an, was er meint, bevor er gemächlich nach Hause trabt.
Zum zweiten Mal sehe ich an mir hinab. Wiederholt klebt das nasse Shirt an meinem Brustkorb und lässt erahnen, was sich darunter verbirgt. Verdrießlich verdrehe ich meine Augen und ziehe peinlich berührt, aber feixend, den eigenwilligen Baumwollstoff von der Haut.
Ohne Socken schlüpfe ich in meine Laufschuhe und rufe Reino hinterher, dass er nicht so aufgesetzt mit dem Hintern wackeln soll. In gleichmäßigen Laufschritten entfernt er sich über die Fußgängerbrücke und streckt den Mittelfinger in die Höhe. Das grüne Shirt flattert im Wind, so viel hat er in letzter Zeit abgenommen.
Selbst ihm ist aufgefallen, dass die Gerbauer mich mit Arbeiten bombardiert, während sie andere Lehrerkollegen regelrecht verhätschelt. Das macht echt Mut.
Reino ist ein ausgesprochener Liebling von ihr. Wie im Studium fliegt ihm noch heute alles zu, während ich mich vergeblich im Sumpf abstrampele, um auf einen halbwegs grünen Zweig zu gelangen.
Keine Ahnung, woran die Schulleiterin ihre Sympathie festmacht, aber offensichtlich hat er etwas, was mir eindeutig fehlt. Ich ahne, es ist das charmante Lächeln, seine Vorliebe für Geschichte oder das Erscheinungsbild, was ja trotz der grauen Schläfen attraktiv wirkt.
Ich wende mich ab und laufe in die entgegengesetzte Richtung nach Hause. Schrecklich, dass die Natur mitunter wohlgestaltet und woanders verunstaltet.
Gut, ich bin nicht bucklig, würde aber gerne als kleines Trostpflaster wenigstens im Alter attraktiver wirken. Nicht nur interessanter, denn das sagen die Leute nur, wenn ihnen schrumpelig nicht über die Lippen kommt.
Nun, schrumpelig bin ich noch nicht. Andererseits bin ich nicht geschmeidig wie ein polierter und glänzender Handschmeichler. Ich liege bei keinem Menschen samtweich in der Hand. Eine Menge Ecken und Kanten stehen von mir ab.
Egal, vielleicht hilft ein Dauerlauf dabei, eine Lösung zu finden.
Eigentlich muss ich für meine Figur nicht joggen gehen. Ich wäre auch ohne diesen Frühsport schlank. Aber Reino hat nach einem Weihnachtsfest gefragt, ob er mitlaufen darf, als wir eines Tages unsere Sachen vom Squash eingepackt, noch einen Schluck getrunken und anderen Spielern zugesehen haben.
Zu dieser Zeit habe ich überlegt, damit aufzuhören. Inzwischen möchte ich nicht aufhören, weil ich mich an die morgendliche Erdung mit ihm gewöhnt habe und auf die gemeinsame Zeit freue.
h h h
Zu Hause angekommen, sitzt Andy am Frühstückstisch und kaut lustlos an einer trockenen Scheibe Toast. Seine Haare stehen unbändig ab. Der schmale Leib steckt in einer schlabbrigen Unterhose, die überdies windschief auf der schlanken Hüfte sitzt.
Bis auf die Haut durchnässt, gehe ich zu ihm und ignoriere die unzähligen Tropfen, die auf dem Dielenboden platschen. Überrascht sieht er auf, nachdem ich ihn überschwänglich begrüße. Dazu streiche ich über seine Schulter und beuge mich für einen Wangenkuss.
Er hat sich nicht rasiert. Seine Bartstoppel kratzen an meiner Handinnenfläche. Lächelnd setze ich mich ihm gegenüber, was ihn noch mehr verwirrt.
»Warst du baden?«
»Ja.«
»Etwa so?«
»Es hat sich großartig angefühlt.«
»Was war in deinem Frühstück?«
»Streit um die Art der Wiedervereinigung«, entgegne ich und weiß, er kennt beide Schlachtfelder zur Genüge. Entsprechend verzieht er die Mundwinkel, denn ihm behagt diese Art von Kontroverse nicht sonderlich. Er findet sie ausgesprochen müßig.
»Unter welcher Federführung?«
»Ist einerlei. Viertel vor …«
»Nicht schon wieder das Thema, Mama«, murrt er gedehnt.
»Daniel und ich haben aber das Thema diskutiert. Heute früh. Ja, klar, zum x-ten Mal, aber er kann es nicht lassen, andauernd das beschissene Viertel vor zu korrigieren. Und darum geht es letztlich: Er soll mich einfach nur sprechen lassen, wie ich es gewohnt bin. Das wäre nicht zu viel verlangt. Aber nein, es artet immer zu einem Streit über unsere unterschiedlichen Mentalitäten aus. Ich weiß auch nicht. Vielleicht helfen Lavendeldragees, damit ich die Sache gelassener betrachte.«
»Gegen dieses Gefühl helfen keine Globuli, Mama. Er ist ein Jonny. Das ist der Punkt«, wiegelt er ab.
»Ich mochte den Depp und seine Filme. Na ja, zumindest bis zu seiner Midlife-Crisis.«
»Ah, ja. Ich erinnere mich schwach, du fährst auf seine dunklen Augen ab, nicht wahr?« Er beugt sich über den Tisch, auf dem noch immer meine Frühstücksschüssel steht.
»Damals schon«, antworte ich wahrheitsgemäß und lege verträumt meine Hand an das Kinn. »Seit 21 Jump Street.«
»Die wilden Neunziger.«
»Nun, drehe es, wie du willst. Aber deine Mutter war auch einmal jung, stell dir vor.«
»Ha, ha, meine Mutter ist noch immer jung«, entgegnet er prompt.
Verlegen gleiten meine Finger durch das Haar an der Schläfe, wo ich bereits das eine oder andere graue Haar entdecke.
»Und zwar so jung, dass sie wie eine Dreizehnjährige bei meinem Kompliment errötet.«
»Ja, aber das hat rein gar nichts mit dem Alter zu tun. Und ich werde ausschließlich bei denjenigen rot, die ihre Komplimente ehrlich meinen«, erkläre ich schnell und schnappe mir seinen rechten Arm.
Am inneren Handgelenk erblicke ich das Tattoo, das er sich vor drei Jahren stechen lassen hat. Ein ›L‹ steht für seinen Geburtsort, die Zahlen dahinter stehen für Geburtsdatum und Uhrzeit. Die letzte Zahl geht nahtlos in einen kräftigen Puls über.
»Morgen verreise ich für ein paar Tage. Nach Berlin.«
Andy schlägt nach meinem Großvater. Auch mein Sohn ist mit einer wundervollen Stimme gesegnet. Ich liebe es, wenn er singt. Die Stimme haut mich glatt aus den Schuhen und entführt mich jedes Mal in eine andere Welt.
Seine gesamte Mimik ist bei Auftritten derart ausdrucksstark, dass ich gewohnheitsmäßig Gänsehaut bekomme. Der junge Mann auf der Bühne ist mein Sohn, aber begreifen kann ich kaum, was mir Großartiges in den Schoß geplumpst ist.
»Sag schon, was war heute Morgen in deinem Frühstück?«
»Betrug, fand ich heute Morgen darin.«
Andy verschluckt sich beinahe, glotzt mich regelrecht an und muss sich für Sekunden ordnen. »Betrug? Geht es dir gut?«
»Ja, es geht mir gut. Er schläft mit Lidia. Aber keine Sorge, denn diesmal schlage ich volles Rohr zurück. Die Messer sind gewetzt, die Bleikugeln gegossen und alle Kanonen auf das Ziel ausgerichtet.«
»Das erschrickt mich.«
»Muss es nicht. Ich habe beschlossen, mich adäquat zu rächen.«
»Mit wem denn?«, grinst er unverschämt.
»Ich verreise für ein paar Tage nach Berlin, wo sich reichlich und geeignete Kandidaten in Bars und Clubs tummeln. Nebenbei bemerkt suche ich ein oder zwei Abenteuer, keine feste Beziehung. Habe die Schnauze voll von dem ganzen Gefühlschaos. Bin eben nicht dafür gemacht, mit einem Mann gemeinsam alt zu werden.«
»Denkst du bitte an Kondome?«
»Ja, Papa«, necke ich das besorgte Kind, welches jetzt den Blick beschämt senkt und mich an Reinos mahnende Worte erinnert. »Ich passe auf mich auf, versprochen. Daneben baue ich mich moralisch auf.«
»Ich schweige wie ein Grab.«
»Andy, das musst du nicht extra betonen.«
Er senkt seinen Kopf über den Teller und kaut angefressen. »Wollen wir uns in Berlin treffen? Ich habe in der Kulturbrauerei einen Gig und könnte deine Unterstützung gebrauchen. Ein Radiosender ist dabei, etliche Journalisten und Kritiker. Ich bin jetzt schon mega nervös.«
»Bevor ich abreise, brauche ich deine Hilfe in einer drängenden Angelegenheit.«
»Schieß los.«
»Eine meiner Schülerinnen liegt im Krankenhaus. Ihr geht es verdammt mies und ich möchte ihr das Gefühl geben, dass sie der Welt nicht so unwichtig ist, wie sie meint.«
»Und wie kann ich dir dabei helfen?«
»Begleitest du mich heute Nachmittag?«
»Okay? Ist es aber normal, wenn Lehrer ihre Schüler im Krankenhaus besuchen?«
»Nein und ich wünschte, ich müsste es nicht tun«, antworte ich aufrecht und zeichne mit meinem Zeigefinger sinnlose Kreise auf der Tischplatte.
»Was ist ihr passiert?«
»Eugen. Er hat sie …«
Andy hebt seinen Kopf. Er sitzt kerzengerade in dem Stuhl. »Der Eugen? Was hat er?«
»Ihr Gewalt angetan.«
»Du meine Güte. Wie furchtbar.«
»Sie ist schwanger und möchte es nicht austragen, was ich irgendwie nachvollziehen kann.«
»Das Schwein. Wie der Vater, so der Sohn …«
»Nicht jetzt, Andy«, unterbreche ich ihn rasch.
Beschämt über seinen Kommentar senkt er den Kopf.
»Da ich morgen verreise, habe ich gehofft, dass du sie möglicherweise besuchen kannst. Nur eine Stunde am Tag und sofern du Zeit findest. Ich nehme dich heute mit, damit sie dein Gesicht kennt.«
»Das heißt, ich soll es ihr erzählen?«
Ich zucke mit den Achseln, um reiflich Spielraum zu lassen. Andys Toast landet auf dem Teller. Schlaues Kind.
»Kommst du bitte mit?«
»Um fünf treffe ich mich mit Benno.«
»In Ordnung. Ich gehe stark davon aus, dass der erste Besuch nicht lange dauert.«
»Ich finde es geil, dass du die Kanonen auf ihn richtest.«
»Andy, ich möchte ungern die Lehrerin raushängen lassen, aber ›geil‹ ist ein Wort …«
»Ich weiß, du findest es entsetzlich poppig.«
»Trifft den Nagel auf den Kopf«, stöhne ich und verkneife mir vorsichtshalber jeden Kommentar zu poppig.
»Kommst du nun zum Gig, wenn du in Berlin bist?«
»Nur, wenn ich darf und du dich nicht abwimmeln lässt«, albere ich herum.
Andy versteht und grinst erfreut. »Wir machen uns einen schönen Abend. Die Jungs sind bestimmt auch froh, dich endlich einmal wieder zu sehen.«
»Okay, aber ich fahre nach Berlin, um mir Typen aufzureißen. Nicht, um mit meinem langweiligen Sohn und seinen fantasielosen Kumpels abzuhängen.«
»Mam, das Wort abhängen ist so …«
»Ich weiß, du findest es antiquiert.«
Lachend schmatzt er mir ein Küsschen auf die Wange. »Wann geht es los?«
»Morgen Nachmittag.«
»Geil.«
»Andy!«
Kapitel 5
Nach einem aufschlussreichen Telefonat mit der Sachbearbeiterin vom Jugendamt, die für Lisa zuständig ist, notiere ich für nächsten Donnerstag den vereinbarten Termin im Kalender. Frau Voigt erwartet mich zu einem ausführlichen Gespräch.
Sie interessiert sich für die Vorgehensweise der Schulleitung und meine Rolle in diesem Drama. Dem Jugendamt ist bislang nicht bewusst, wie massiv Lisa von der Schulleiterin und dem Vizepräsidenten des Schulamtes unter Druck gesetzt wird.
Weiter möchte ich mich bei diesem Gespräch nach möglichen Hilfeleistungen für Lisa erkundigen. Im Telefonat habe ich angedeutet, sie gerne bei mir unterzubringen. Bei einem Gespräch sollen meine Fragen zu den Bedingungen des Jugendamtes beantwortet werden. Frau Voigt hat eindeutige Fragen gestellt, die ich alle mit ›Ja‹ und einem guten Gewissen beantworten konnte.
Derzeit wohnt Lisa in einem Wohnheim, hat sich dort aber auch nach drei Wochen nicht wirklich eingelebt. Mir erscheint diese Wohnform ungeeignet und wenig zielführend für die sensible Lisa. Da wundert es mich wenig, wenn sie fremdelt.
Insgesamt klingt Frau Voigt nicht abgeneigt, auf meinen Vorschlag einzugehen. Erleichtert beende ich unser Telefonat und atme befreit auf.
Andy steht in der Bürotür und hört aufmerksam zu. »Warum hast du ihn damals nicht angezeigt?«
Meine Sachen sortierend antworte ich: »Die Strukturen für Hilfe waren damals weniger gut ausgebaut und mein Kopf war proppenvoll mit Angst und Scham. Bis auf den Abstrich, der im Krankenhaus gemacht wurde, hatte ich zudem keinerlei Beweise. Damit war unklar, wen ich überhaupt beschuldige. Letztlich war ich auch nicht scharf darauf, dass ein findiger Anwalt die Sache dahingehend verdreht, dass ich mir in einem Wahn die Verletzungen nach einvernehmlichem Sex selbst zugefügt habe, um ihm zu schaden. Letztlich hätten sie einen DNA-Reihentest mit allen Männern in Leipzig und Umgebung machen müssen, um möglicherweise den Täter zu finden. Wenn das ausreicht. Das habe ich dir doch alles schon erzählt. Warum fragst du?«
»Weil du nicht gegen dieses Unrecht angekämpft hast.«
»Ich verstehe nicht viel über das Leben, mein Kind. Eines weiß ich aber mit Sicherheit: Unrecht verjährt nur in Gesetzestexten. Das Leben hingegen vergisst nicht. Du musst wissen, dass ein Bumerang immer zum Ausgangspunkt zurück kommt. Jeder Gedanke und jede Tat. Es spielt keine Rolle, welcher Natur sie sind. Am Ende bekommt jeder die Rechnung serviert und muss sie begleichen.«
»Servierst du ihm die Rechnung?«
»Hättest du es gerne so?«, frage ich erstaunt, denn normalerweise ist er derjenige, der immerfort vom Verzeihen redet.
»Ja«, haucht er mit erstickter Stimme, die dabei sogar bricht.
Ich stelle mich vor den jungen Mann mit der grandiosen Stimme und dem außergewöhnlichen Talent zum Schauspiel. Voller Rührung für diese sensible Seele fährt meine Hand über sein Handgelenk mit dem Tattoo.
»Du wärst mir eine Sekunde, eine Stunde oder einen Tag später entgangen. Sieh mich an und gib mir die Stärke, es ja nie anders sehen zu wollen.«
Unruhig wechselt er das Standbein und schaut gequält drein. »Oh, Gott, Mam. Das klingt so erwachsen. Wie machst du das?«
»Ich lerne in meiner Therapie, zu verzeihen, und kämpfe selbst am meisten damit, niemanden anderen für etwas in meinem Leben verantwortlich zu machen. Herumjammern wäre wenig hilfreich. Sagst du selbst immer. Wir gehen jetzt zu Lisa und helfen ihr. Du und ich, ein Team, okay?«
Andy fasst meine Hand, drückt sie kräftig mit seinen großen Händen und zieht mich tapfer lächelnd zur Garderobe.
h h h
»Was soll ich ihr sagen? Sie wird doch jetzt nicht gut auf Männer zu sprechen sein, oder?«, erkundigt er sich verunsichert, nachdem wir im Auto sitzen und uns anschnallen.
Ich starte den Wagen und rolle von der Einfahrt. Seelenruhig liegen beide Hände auf dem Lenkrad. Meine einzige Seelenregung ist ein kolossales Aufseufzen.
»Nicht zwangsläufig und nicht automatisch. Und nicht dich, obwohl es nicht auszuschließen wäre. Bleibe in ihrer Nähe, egal wie abweisend und feindlich sie dir begegnet. Hämmere dir bitte unbedingt in deinen Schädel, dass sie mit allem, was sie sagt oder tut, diese eine Person meint, nicht dich. Mehr kann ich dir nicht raten.«
»Wer war für dich da?«
»Reino«, antworte ich flüsternd und sehe kurz in den Rückspiegel. Hinter mir drängelt ein grauer Mercedes.
»Ich mochte ihn schon immer. Jetzt ergibt es doppelt Sinn«, murmelt er gedämpft und beobachtet den Passanten auf dem Bürgersteig geistesabwesend, der sich just in diesem Moment zu seinem Hund herabbeugt. Für den kleinen Welpen, einem Yorkshire Terrier, stellt die Treppenstufe in das Wohnhaus ein unüberwindbares Hindernis dar.
»Ich nicht«, gestehe ich und beobachte genau Andys Reaktion.
Schlagartig fährt der Kopf herum. Verdutzt mustert er mich. Instinktiv ahne ich jede einzelne Frage, die durch seinen Schädel rast und sicherlich flugs gestellt wird. Diese Vorahnungen liegen in der Natur einer Mutter, die mit diesem sechsten Sinn selten daneben liegt.
Während unserer halbstündigen Fahrt kläre ich ihn auf, warum ich Reino nicht leiden konnte und ab wann es sich geändert hat. Inzwischen befinden wir uns auf einem Parkplatz in der Nähe des Krankenhauses, doch ich bleibe im Wagen sitzen.
Umständlich löst Andy den Sicherheitsgurt aus der Halterung. »Fußt also Dankbarkeit auf eure Freundschaft?«
»Was wäre das für eine Freundschaft? Klar bin ich dankbar, aber nicht, weil er es erwartet oder so.«
»Redet ihr darüber?«
»Genau genommen meiden wir das Thema.«
»Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.«
»Es ist kompliziert. Wir brauchen nicht darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, wie ich es verständlich erklären kann, aber es fühlt sich an, als würde er alles wissen, was es darüber zu wissen gibt. Deswegen thematisieren wir es nie im Sinne eines Gespräches. Er weiß es, ich weiß es und gut. Es gibt eine tiefere Ebene, auf der sich alles abspielt, verstehst du?«
»Einigermaßen. Folglich soll ich nur für sie da sein. Sprechen ist nicht unbedingt erforderlich. Fällt jemand vom Pferd, muss er schnell wieder rauf. Und ich vertrete die Pferde.«
»Ein furchtbarer Vergleich, aber irgendwie ist da was dran. Stell dich in jedem Fall auf einen Giftstachel ein, der noch immer Gift in ihren Körper pumpt, ohne dass sie es bemerkt. Selbst bei belanglosen Themen wird sie es versprühen. Einfach, weil es dringend hinaus muss. Lass dich auf keinen Fall davon demoralisieren. Unterbewusst testet sie damit aus, ob du die Beine in die Hand nimmst oder ihren Gemütsbewegungen standhältst.«
»Alles klar. Danke für die Tipps aus erster Hand. Ich hoffe, ich bekomme das für die Zeit hin, die du in Berlin bist und ahne, wie furchtbar das für euch sein muss.«
»Kein Mitleid. Das ist das gleiche Gift, nur aus einem anderen Stachel. Hilf ihr, möglichst schnell wieder auf die Pferdekoppel zu gehen. Mehr nicht. Um den Rest kümmert sich ein Therapeut. Der weiß am besten, wie er mit ihr das Erlebte aufarbeiten muss.«
»Mam, ist es okay, wenn ich hier im Auto sitzen bleibe? Ich fürchte, ich bin nicht belastbar genug für so eine komplizierte Sache. Wie hat Reino das nur geschafft?«
Beherzt klopfe ich auf seinen linken Oberschenkel, um ihn aufzumuntern. »Du bist genau der richtige Mann für die Sache. Zum einen, weil du einfühlsam bist und auf Zwischentöne achtest. Genau das braucht sie jetzt. Quasi das umgänglichste Pferd auf der Koppel. Und nein, es wird nicht leicht für sie. Du bist der lebende Beweis für eine Alternative. Ich komme nicht umhin, ihr diese aufzuzeigen. Daneben muss ich ihr beistehen. Egal, wofür sie sich entscheidet. Verstehst du? Los komm!«
Ich steige aus dem Auto und schreite mit dem nachdenklichen Andy beherzt, und von meinem Vorhaben beseelt, auf das moderne Krankenhausgebäude zu. Nach etlichen Anläufen und mehreren bürokratischen Hürden finden wir endlich das Krankenzimmer, in dem Lisa liegt.
Wir betreten ein hellgelb gestrichenes Zimmer. Verunsichert beäugt sie uns, nachdem wir vor ihrem Bett stehen. Auf Knopfdruck lächelt Andy, sobald er das wohlgeformte Gesicht mit den himmelblauen, aber geröteten und geschwollenen Augen ausmacht.
»Grüß dich, Lisa. Das ist mein Sohn Andy, der mich zurzeit besucht«, erkläre ich, stelle den kleinen, bunten Strauß Blumen auf ihren Beistelltisch und zupfe ihn feierlich in Form.
»Tach«, grüßt Andy gesenkten Hauptes und stellt sich tapfer am Ende des Bettes auf.
Verstohlen äugt er zu ihren Armgelenken, die mit Mullbinden umwickelt sind. Seine Hände krallen sich um die Bettstange am Fußende, was seiner Nervosität geschuldet ist.
»Hm«, grüßt sie schmallippig zurück und betrachtet ihn eindeutig argwöhnisch.
Ihr fragender Blick gleitet rasch zu mir. Sie möchte wissen, warum ich ihn mit zu ihr in das Krankenhaus schleppe, wo sie alles andere als Lust auf Besuch und nette Plaudereien verspürt. Zeitgleich versteckt sie beide Arme unter der weißen Zudecke, damit wir ihr gefälligst ins Gesicht sehen und nicht auf ihr selbst zugefügtes Stigma.
»Tut mir leid. Neulich habe ich Ihre Bluse ruiniert. «
»Willkommen im Club«, raunt Andy gut aufgelegt und möchte sie damit aufheitern. »Wollte sagen … als ich ein Baby war, habe ich sie immer vollge… ihre Blusen.«
Mit zusammengezogenen Augenbrauen funkelt Lisa ihn grimmig an. Postwendend senkt er den Blick und schnappt schwer atmend nach Luft. »Vergiss es. Ich habe nur laut gedacht.«
»Wie ist es dir ergangen?«, frage ich und wechsele in das vertrauliche Du.
Unruhig windet sich Lisa und zieht frustriert die Decke zum Kinn. »Wie soll es schon gehen.«
»Darfst du aufstehen?«
»Ja, will aber nicht. Wozu auch? Wofür soll ich mich aufraffen? Die beschissene Welt kann mich mal gernhaben.«
»Wurde deine Familie informiert?«
»Sehen Sie hier etwa Tonnen von Blumensträußen oder meine Lieblingssnacks, die darauf hindeuten? Ist doch eh alles schnurz.«
»In der Cafeteria gibt es ganz tollen Kakao, meinen die Empfangsmitarbeiter. Magst du einen mit uns trinken?«
»Frau Weigert, wen wollen Sie mit einem bescheuerten Kakao hinter dem altmodischen Ofen vorlocken?«
»Also mich lockt sie damit vor«, platzt es mit heiserer Stimme aus Andy heraus.
Erneut schaut Lisa zu ihm. Diesmal mustert sie ihn unverhohlen und mit einem Blick, der noch um einiges strenger wirkt als vorhin. Mein Sohn senkt nicht etwa schamhaft die Augen auf die Zudecke, unter der Lisa unruhig ihre Füße bewegt.
Instinktiv macht er alles richtig. Er gibt sich nicht unterwürfig, sieht sie nicht als Opfer und hält ihrem Angriff stand, was er gewiss nicht in seinem Schauspielstudium lernen kann. Diese Eigenschaft ist angeboren.
Dennoch berühre ich seinen Unterarm. Er bemerkt meinen Fingerzeig und nickt minimal.
»Der ist echt spitze«, versichert er und wirkt wie ein Fels in der Brandung, obwohl er mich bei seinen Worten ansieht und nicht Lisa. »Der ist zwar nicht annähernd so prima wie der, den meine Mutter zu Hause zubereitet, aber der Wille zählt doch schließlich, oder?«
Für den Bruchteil einer Sekunde schlägt er, wie in einem hollywoodreifen Film, seine Lider nieder. Das ist genug Zeit, um die Blickrichtung zu wechseln. Nach dem Augenaufschlag präsentiert er der Sprachlosen strahlend schöne Augen. Die ruhen auf ihr und verstärken die Wirkung seiner Worte um das Dreifache.
Mindestens.
Lisa wendet ihren Kopf ab, rollt aber eigensinnig mit den Augen, die jetzt auf mir ruhen.
»Wo er recht hat, hat er recht«, bestätige ich mit schief gelegtem Kopf.
Geräuschvoll schnuppert er in der hygienisch reinen Luft voller Desinfektionsmittel. »Hier stinkt es. Riechst du das auch, Lisa? Es riecht gehörig nach Einbildung oder täusche ich mich etwa?«
Sie tut gelangweilt und schnaubt verächtlich aus: »Na, wenn schon. Ist schließlich auch eine Bildung.«
»Na hopp! Rappele dich auf, zieh dir etwas an, dann können wir eine Runde durch das Krankenhaus schlendern. Das hat vielen Patienten geholfen und bringt den Kreislauf in Schwung«, fordere ich sie energisch auf und beuge mich zeitgleich zu ihren Schuhen.
»Wenn wir verschwunden sind, hast du bis morgen deine Ruhe. Wir haben heute niemanden, dem wir sonst mit Kakao auf den Keks gehen können«, versichert Andy im allerschönsten Singsang, der selbst mich mit seinem Eau de Charmant einnebelt.
Für eine Sekunde huscht ein Lächeln über ihre Lippen. »Der nervt ja extremer als Sie, Frau Weigert. Liegt das in der Familie?«
Über diesen Vergleich erheitert, nicke ich amüsiert und schiebe die Schuhe dichter zum Bettrand, damit sie bequem hineinschlüpfen kann.
»Wahrscheinlich«, entgegne ich gedehnt. »Aber ich lasse ihn machen, weil er für sein Studium ausgezogen ist und die Besuche seitdem seltener werden. Sage es ihm nur nicht, sonst nutzt er es gnadenlos aus. In einem Punkt gebe ich dir recht. Gelegentlich übertreibt er. Aber nur, weil er ab und zu für Theaterrollen probt und seine Darbietung gern am lebenden Objekt testet. Und wenn er nicht gerade in seiner Band singt und auf der Bühne die Rampensau rauslässt, kann er unglaublich liebenswürdig sein. Früher wollte er allerdings mehr Kakao mit mir trinken. Angeblich macht Milch die Stimme lieblicher. Heute steht er mehr auf Bier und trinkt es vorzugsweise mit hübschen Mädchen.«
»Der Wolf in Grimms Märchen isst Kreide, Mam. Er trinkt keine Milch.«
»Ach ja, stimmt. Kreide macht sich nicht so gut in Kakao«, albere ich herum.
Lisa kichert und erhebt sich träge. »Kann ich absolut verstehen. Kakao ist so was von vorsintflutlich. Egal, ob mit oder ohne Kreide.«
»Ha, ha, du bist mir sympathisch, Lisa. Mam, du kannst dich gerne verdünnisieren. Wir gehen derweil in das Café gegenüber und trinken ein angenehm kühles Bier.«
Na hoppla! So habe ich das mit dem gefallenen Reiter, der schnell wieder auf das Pferd soll, nicht gemeint.
»Etwa so angezogen?«, fragt Lisa schrill und lässt den Blick an ihren dünnen Leib hinabgleiten.
Das Angebot kommt einem Ritterschlag gleich, dennoch schaut sie kritisch an ihrer mickrigen Aufmachung hinab. Die besteht lediglich aus einem dünnen Shirt und einer ausgebeulten Leggings.
»Sieht doch Hammer aus. Zeig dich mal!«
Er beugt sich vor, um sie eingehender betrachten zu können. In Windeseile setzt sie sich auf das Bett und legt die Zudecke um ihren schmalen Leib, um sich vor seinem neugierigen Blick zu schützen.
Ganz sachte, Junge, denke ich.
»Habs mir überlegt. Kakao wäre wundervoll. Außerdem hatte meine Friseurin heute bedauerlicherweise keine Termine mehr frei. Damit bin ich untauglich für Bier in einem Café und laufe schon gar nicht mit ’nem wildfremden Typen mit«, murrt sie und sieht mit leicht geneigtem Gesicht zu Andy.
h h h
Nachdem wir den Fahrstuhl verlassen haben, steuern wir auf die Cafeteria zu, die unmittelbar an den Eingangsbereich angrenzt. An der Information stehen zwei Frauen. Sie lachen und irritieren Lisa, die ständig hinüberschaut. Verunsichert prüft sie, ob sie ihretwegen kichern. Beruhigt sieht sie zu uns, nachdem feststeht, dass dies nicht der Fall ist.
»Suchst du uns bitte Plätze?« Ich deute auf die teilweise besetzten Tische und Stühle. Auf diese Weise ist sie abgelenkt und kann sich in eine ruhige Ecke zurückziehen. Offensichtlich ist es ihr unangenehm, durch die unzähligen Stuhlreihen zu laufen. Mehrfach dreht sie sich beunruhigt zu uns um und zerrt fortwährend die dünne Übergangsjacke über die Hüfte.
In der hintersten Ecke des Cafés wird sie fündig. Taktisch klug platziert sie sich so, dass sie die Tischreihen überblicken, jedoch trotzdem aus der riesigen Fensterfront schauen kann. Einstweilen blendet sie die Menschen um sich herum aus und schlingt ihre Arme um den dünnen Leib.
Neben mir atmet Andy schwer aus.
»Ganz ruhig. Alles läuft vortrefflich«, beruhige ich ihn.
»Sie guckt mich an, als würde sie mich jeden Augenblick mit einem gigantischen Knüppel erschlagen wollen. Bestimmt mache ich alles komplett falsch und benehme mich wie ein Volltrottel.«
»Lass dich davon nur nicht täuschen. Der unerfreuliche Blick ist nichts als Tarnung, der ihr geholfen hat, im Elternhaus zu überleben. Sie ist intelligent genug, um dir nicht die Schuld für etwas zu geben, was jemand anderer verursacht hat«, erkläre ich und bestelle drei Kakaos, weil wir endlich an der Reihe sind. »Trotz deines Schauspielstudiums hast du offenbar keinerlei Vorstellung davon, wie dein Augenaufschlag beim anderen Geschlecht ankommt, oder? Ist mir eben aufgefallen. Wow. Ich kann nicht behaupten, dass sie den Kopf verloren hat, aber sie war definitiv sprachlos und hat für drei Sekunden an etwas Schönes gedacht. Glaube deiner alten Mutter. Zudem würde ich das Experiment sofort abblasen, wenn sie dich nicht ausstehen könnte. Wollen wir?«
Mit drei Tassen Kakao schlendern wir zu Lisa, die stumm aus dem Fenster blickt. Wir setzen uns zu ihr an den Bistrotisch und unterhalten uns über seinen nächsten Gig.
Vorsichtig berühre ich danach ihre Hand, die flach auf dem Tisch liegt. Schwunglos dreht sie sich herum und sieht zu dem Kakao hinab, der vor ihr steht.
»Was ist mit dir?«, erkundige ich mich, weil sie schwer atmet.
Nun erkenne ich ihre glasigen Augen. Sie keucht: »Die Ärzte haben mich gefragt, ob ich das noch einmal mache.«
»Und?«
Gespannt halte ich den Atem an. Nachdenklich rührt sie die Flüssigkeit in der schmalen Tasse kalt.
»Ich weiß, dass sie mich in die Klapse einweisen, wenn ich mit ›Ja‹ antworte. Weltfremd bin ich nicht, auch wenn es die halbe Welt glaubt. Ich meine, was soll ich jetzt machen? Ich fliege von der Schule. Mein Leben ist im Eimer und er? Was wird aus mir? Was ist das nur für eine beschissene Welt?«
»Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen«, murmele ich leise und puste meinen Kakao kalt.
»Ich gehe kurz für kleine Jungs. Bin gleich wieder da.« Andy zieht sich klammheimlich zurück.
Lange ruht mein Blick auf den feinen Zügen des jungen Gesichtes vor mir. Angespannt kaut Lisa auf ihrer Unterlippe herum und scheint mich ewig überhaupt nicht wahrzunehmen.
»Mal angenommen, es kommt so, wie du befürchtest. Gibst du dann auf oder verfolgst du dein Ziel weiter?« Verdrießlich schnaubt Lisa aus und zieht gelangweilt ihre akkurat gezupften Augenbrauen in die Höhe. Ich beuge mich vor und berühre sanft ihren Unterarm. »Wirklich, Lisa. Ich glaube dir.«
Schnellstens zieht sie ihren Arm zurück und streift sich eine blonde Strähne hinter das Ohr. »Na schön, Sie glauben mir. Und nun?«, fragt sie schmallippig, gereizt und mit Augen, die randvoll mit Tränen gefüllt sind. »Bekommen Sie dafür eine blöde, nichtssagende Tapferkeitsmedaille, oder was?«
»Sage du es mir.«
»Ich wollte Kunstwissenschaft studieren.«
Ihre Stimme bricht. Über die eigenen Zukunftsaussichten deprimiert, knabbert sie am Daumennagel, schweigt über mehrere Minuten beharrlich und lässt dennoch die Tränen ungeniert laufen.
»Dann studiere an einer Uni deiner Wahl. Alles ist möglich. Du bist jung und die Welt steht dir offen.«
»Ich hatte Pläne. Andere Pläne als jetzt schon … mit einem Kind.«
»Die hast du noch immer und kannst neue schmieden.«
»Sie haben keine Ahnung. Überhaupt keine. Wie soll ich Studium und ein Baby unter den Hut bekommen? Scheiße noch mal und dann eins von so einem abartigen Typen. Wenn es dann auch noch so aussieht, wie er … Ich will es nicht. Niemals. Ich schaffe das nicht.«
»Jammern hilft dir nicht weiter.«
»Was geht ab? Lassen Sie mich gefälligst mit Ihren bescheuerten Ratschlägen in Ruhe. Ich sagte, ich schaffe das nicht.«
»Jetzt erzähle ich dir meinen Plan und du wirst mir gut zuhören. Ich glaube dir und bin hier, sitze mit dir an diesem Tisch. In den nächsten Tagen bin ich auf Reisen und habe Andy daher gebeten, dich stellvertretend zu besuchen. Damit du nicht allein bist und jemanden hast, falls du etwas brauchst. Er hält mich auf dem Laufenden und hat Anweisung bekommen, nicht von deiner Seite zu weichen. Ich blase die Reise sofort ab, sollte etwas …«
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783739482361
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (Januar)
- Schlagworte
- contemporary Romantik Sommer Romance Urlaub Liebe Frauen Urlaubslektüre

